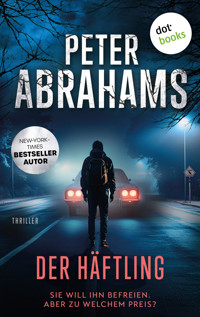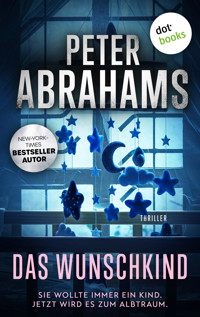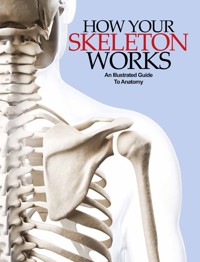1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Er ist die perfekte Hilfe – doch niemand kennt seine dunklen Absichten … Als Scott und Linda Gardner bei ihrer Suche nach einem Nachhilfelehrer auf Julian Sawyer treffen, können sie ihr Glück kaum fassen – denn Julian ist klug, kultiviert und versteht sich auf Anhieb mit ihrem rebellischen Teenagersohn Brandon. Doch nicht nur Brandon profitiert von Julians gutem Einfluss, auch Linda und Scott hören bald auf die fachkundigen Ratschläge des jungen Mannes. Nur Ruby, die 11-jährige Tochter der Gardners, traut der perfekten Fassade des unerwarteten Familienzuwachses nicht. Als einzige sieht sie die dunkle Bedrohung, die hinter seinen vermeintlich guten Absichten durchschimmert. Doch zu lange bleibt Ruby mit ihrer schlimmen Ahnung allein – denn als Julian endlich sein wahres Gesicht zeigt, ist es schon längst zu spät … »Peter Abrahams ist mein Lieblings-Thrillerautor.« Bestsellerautor Stephen King Wenn man dem Falschen traut … Ein düsterer Thriller voller Abgründe für die Fans von K.L. Slater und Michael Robotham – jetzt als eBook bei dotbooks erhältlch!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 592
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als Scott und Linda Gardner bei ihrer Suche nach einem Nachhilfelehrer auf Julian Sawyer treffen, können sie ihr Glück kaum fassen – denn Julian ist klug, kultiviert und versteht sich auf Anhieb mit ihrem rebellischen Teenagersohn Brandon. Doch nicht nur Brandon profitiert von Julians gutem Einfluss, auch Linda und Scott hören bald auf die fachkundigen Ratschläge des jungen Mannes. Nur Ruby, die 11-jährige Tochter der Gardners, traut der perfekten Fassade des unerwarteten Familienzuwachses nicht. Als einzige sieht sie die dunkle Bedrohung, die hinter seinen vermeintlich guten Absichten durchschimmert. Doch zu lange bleibt Ruby mit ihrer schlimmen Ahnung allein – denn als Julian endlich sein wahres Gesicht zeigt, ist es schon längst zu spät …
Über den Autor:
Peter Abrahams ist ein renommierter amerikanischer Autor zu dessen weltweiter Leserschaft auch Stephen King gehört, der ihn als seinen »liebsten amerikanischen Spannungsromanautor« bezeichnet. Sein Roman »The Fan« wurde 1996 mit Robert De Niro in der Hauptrolle verfilmt.
Peter Abrahams veröffentlichte bei dotbooks bereits seine Thriller »Der Nachhilfelehrer« und »The Fan«. Weitere Bände sind in Vorbereitung.
Die Website des Autors: peterabrahams.com/
***
eBook-Neuausgabe Juni 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2002 unter dem Originaltitel »The Tutor« bei Ballantine Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Der Schlange Gift« bei Goldmann, München.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe by Pas de Deux
Published by arrangement with The Aaron Priest Literary Agency New York and Michael Meller Literary Agency, Munich
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2003 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98952-278-7
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13, 4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/egmont-foundation. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Nachhilfelehrer« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Peter Abrahams
Der Nachhilfelehrer
Thriller
Aus dem Englischen von Andrea Brandl
dotbooks.
Widmung
Für meine Kinder
Seth, Ben, Lily und Rosie.
Art in the blood is liable to take the strangest forms.
A. Conan Doyle, Der griechische Dolmetscher
Kapitel 1
Linda Marx Gardner erwachte aus ihrem Traum und spürte die Erektion ihres Ehemanns an ihrer Hüfte – nicht drängend oder fordernd, sie war einfach nur da. Zu einem früheren Zeitpunkt ihrer Ehe, um genau zu sein, zu einem sehr frühen, hätte Linda im gedämpften Licht des Morgengrauens, das das Schlafzimmer in düstere Schatten hüllte, die Sache in die Hand genommen. Diese frühmorgendlichen Aktivitäten, wenn sie entspannt und noch schlaftrunken waren, hatten sich meist als ziemlich gut herausgestellt, wenn nicht sogar besser als das.
Linda stand auf. In ihrem Traum hatte sie hektisch irgendwelche Wörter auf rosafarbenen Papierbögen ausradiert, ohne sie sich jedoch zu merken. Als sie ins Badezimmer ging, gab Scott im Schlaf einen Laut von sich, ein leises Grunzen, das auf tiefe Zufriedenheit schließen ließ. Ein seltsamer Gedanke schoss ihr durch den Kopf, der eigentlich gar nicht zu ihr passte: Radierte er ebenfalls etwas aus?
Sie stellte sich unter die Dusche und ging im Geist ihren Terminkalender durch, dessen Seiten mit ihrer säuberlichen Handschrift gefüllt waren. Es würde einige Diskussionen über den Skyway-Etat geben, in erster Linie wegen der Fotos, aber nicht nur deshalb. Linda überlegte, was noch alles kommen mochte, und war so in ihre Gedanken an die Arbeit versunken, dass sie erschrocken zusammenfuhr, als sie plötzlich durch die beschlagene Scheibe der Duschkabine Scott erkannte, der mit dem Rücken zu ihr vor der Toilette stand.
»Könntest du bitte Brandon wecken?«, rief sie ihm zu.
Scott erwiderte etwas, das sie jedoch wegen des rauschenden Wassers nicht verstehen konnte. Der heiße Wasserstrahl, der auf sie niederprasselte, fühlte sich so gut an, dass sie am liebsten den Rest des Tages darunter verbracht hätte ... Abrupt drehte sie die Dusche ab; Scott war verschwunden.
Sie trat aus der Kabine und griff mit einer Hand nach einem Handtuch, während sie mit der anderen die Wasserspülung der Toilette betätigte. Scott vergaß das ständig, oder es kümmerte ihn nicht, was auch immer. Ein Blick auf ihre Armbanduhr auf dem Granitwaschbecken – schwarzer Granit mit mitternachtsblauen Sprenkeln und damit das hübscheste Stück im ganzen Haus – sagte ihr, dass sie zwei oder drei Minuten zu spät dran war, also nichts, worüber man sich Sorgen machen musste. Sie holte tief Luft.
»Bran? Bran? Bran? Bran?«
Dieses eine Wort, das immer wieder an seine Ohren drang, fräste sich durch Brandons Träume und ließ sie in sich zusammenfallen, bevor es ihn endgültig in den Wachzustand beförderte.
»Brandon? Bist du wach, Kumpel? Es ist schon spät.«
Brandon war wach genug, um festzustellen, dass er die Decken nach oben gezerrt hatte und ganz erhitzt war, völlig durcheinander und absolut nicht in der Lage aufzustehen oder sich auch nur zu bewegen. Er öffnete ein Auge gerade so weit, dass er seinen Vater zwischen seinen vom Schlaf verklebten Wimpern erkennen konnte – der stand mit einem Handtuch um die Hüften, Rasierschaum im ganzen Gesicht und einem tropfenden Rasierer in der Hand direkt vor ihm.
»Ich kann wirklich nicht ...«
»Vergiss es, Brandon. Du wirst zur Schule gehen.«
»Ich fühle mich zum Kotzen.«
»Du wirst gehen. Und achte auf deine Ausdrucksweise, wenn’s recht ist.«
Brandon gab keine Antwort.
»Zeig ein bisschen Leben. Setz dich auf oder mach sonst irgendwas. Und sieh zu, dass ich nicht noch mal kommen muss.«
»Schon gut«, erwiderte Brandon, obwohl die einzige Bewegung, die er zustande brachte, das Schließen des einen Auges war.
»Außerdem sieht es in diesem Zimmer langsam aus ...«
Brandon hörte den Rest des Satzes kaum noch. Die Konturen begannen wieder zu verschwimmen, und watteweicher Schlaf umhüllte ihn erneut.
Im Fenster des Zimmers, das auf der gegenüberliegenden Seite des Flurs lag, baumelte ein Glasprisma. Es war das Fenster, durch das morgens die Sonne als Erstes hereinfiel. Während Brandon wieder in Tiefschlaf versank, schien die Sonne durch die kahlen Baumwipfel und sandte einen Strahl durch das Prisma. Ein kleiner Regenbogen, der sich sofort darauf bildete, fiel auf den Kalender an der gegenüberliegenden Wand, und zwar auf ein ganz besonderes Quadrat – das, auf dem eine kleine Geburtstagstorte mit elf brennenden Kerzen prangte. Dieser kleine Regenbogen, der vibrierend auf ihren bevorstehenden Geburtstag hinwies, war das Erste, was Ruby sah, als sie die Augen öffnete.
Sie hielt einen Augenblick den Atem an. Das ist der Beweis, dass Gott existiert, war ihr erster Gedanke. Sie hatte kaum begonnen, sich mit dem Gedanken auseinander zu setzen und damit, was er mit sich im Gepäck trug – ja, genau, so waren manche Gedanken, sie hatten Gepäck bei sich –, dass Gott offenbar ein persönliches Interesse an ihr, Aruba Nicole Marx Gardner, hatte, als ihr Verstand die Fakten registrierte: Sonne, Ostfenster, das Prisma, der Regenbogen, der irgendwo enden musste, und Zufall. So würde es zumindest Sherlock Holmes sehen, und sie brachte Sherlock Holmes mehr Respekt entgegen als irgendjemandem sonst auf der Welt. Liebe war es nicht – Dr. Watson war derjenige, den man lieben konnte –, sondern Respekt.
Dennoch konnte ein Zufall trügerisch sein. Zum Beispiel damals – sie war etwa vier gewesen –, als sie ein Mortadella-Sandwich gegessen und ein Buch über einen Frosch gelesen hatte. Plötzlich hatte sie sich so heftig übergeben müssen, dass auch Brandon neben ihr auf dem Rücksitz etwas abbekommen hatte von dem Frosch und dem Mortadella-Sandwich, die irgendwie zusammengemixt worden waren; zumindest für sie war es so gewesen. Seit diesem Tag hatte sie nie wieder Mortadella angerührt. Aber sie konnte Sherlock Holmes sagen hören: »Eine lange Autofahrt und eine Straße mit zahlreichen Kurven? Mit einem Erdnussbutterbrot und einem Pinguin könnte man dasselbe Resultat erzielen.« Elementar, meine liebe Ruby.
Der Regenbogen schob sich vorwärts, glitt über ihren Geburtstag und den Kalender hinweg, bevor er sich in Richtung ihres offenen Kleiderschranks schlich. Dort wand er sich in einer Ecke, bis er schließlich im Schatten verschwand. Das war der Erde zu verdanken, die durch die Tatsache, dass sie sich drehte, den Regenbogen in ihrem Kleiderschrank einsperrte. Dieser Gedanke hatte einiges im Gepäck, aber Ruby kam nicht mehr dazu, sich damit zu beschäftigen.
Durch den Korridor bahnte sich irgendein Geräusch seinen Weg, von dem sie jedoch nur einen Teil wahrnehmen konnte, so als würde plötzlich der Kopfhörer auf einer Seite streiken.
»Scott? Habe ich dich nicht gebeten, Brandon zu wecken?« Murmel, murmel, murmel.
»Nun, er ist aber nicht aufgestanden, und es ist schon fünf nach sieben.«
Murmel, murmel.
»Scheiße, hör sofort mit dieser Scheiße auf«, schrie Brandon plötzlich mit seiner neuerdings tiefen Stimme, die ab und zu noch ein wenig kippte und die Wände beben ließ. In diesem Augenblick wusste Ruby, dass Mom ihm die Decke weggerissen hatte – eine Maßnahme, die immer funktionierte.
Die nachfolgenden Geräusche – Brandon, der aufstand, in seinem Zimmer herumpolterte, durch den Flur in das gemeinsame Badezimmer ging und die Dusche aufdrehte – verblassten langsam, als Ruby nach ihrem Buch mit den Gesammelten Werken von Sherlock Holmes griff und an der Stelle aufschlug, wo sie stehen geblieben war. Das getupfte Band. Allein der Titel ließ Ruby ahnen, dass ihr die Geschichte gefallen würde.
Getupft. Ein Wort, das sie noch nie benutzt hatte. »Getupft, getupft.« Zum ersten Mal in ihrem Leben sprach sie es laut aus, während ihre Plüschtiere sie stumm von ihren Plätzen auf dem Regal aus beobachteten. Ein seltsames Wort, das eine gewisse Kraft zu haben schien, sofern das überhaupt möglich war, und wenn ja, dann stand diese Kraft vielleicht nicht nur fur das Gute. Gefleckt war gut, gesprenkelt schon ein wenig hässlicher, aber getupft war irgendwie anders, obwohl sie nicht sagen konnte, warum. Unter ihrem Zimmer ging das Garagentor auf, und sie hörte, wie der alte Triumph ihres Vaters herausholperte.
Es gab kein größeres Vergnügen für mich, als Holmes in seinen Ermittlungen zu folgen und die messerscharfen, raschen Rückschlüsse zu bewundern, die, obgleich sie so unerwartet wie Gedankenblitze kamen, doch immer eine fundierte logische Basis hatten, mit der er die Probleme, die an ihn herangetragen wurden, zu lösen pflegte.
Ja, das war es, was so besonders an ihm war. Als Ruby zu lesen begann, wurde es still im Zimmer, der Raum begann seine physischen Eigenschaften zu verändern, und es schien, als verlöre er seine Substanz. In der Junggesellenwohnung in der Baker Street 221-B hingegen geschah genau das Gegenteil. Ruby konnte beinahe das Knacken des Feuers hören, das Mrs. Hudson in weiser Voraussicht entzündet hatte. Ruby konnte beinahe ...
»Ruby! Ruby! Ruby, verflixt noch mal!«
»Was ist?«
»Ich habe dich schon sechsmal gerufen.« Mom, wahrscheinlich schon für die Arbeit angezogen. Bestimmt stand sie oben an der Treppe mit diesem ungeduldigen Gesichtsausdruck, der sich immer in der senkrechten Linie zwischen ihren Augenbrauen manifestierte. »Bist du auf?«
»Ja.«
»Vergiss nicht, dass du nach der Schule Tennis hast, Liebes.« Aus dem veränderten Tonfall konnte Ruby schließen, dass die senkrechte Linie wieder verschwunden war. »Bis heute Abend.« Moms Stimme verklang, als sie die Treppe hinunterging.
»Bis dann, Mom.«
Vielleicht war ihre Stimme nicht laut genug gewesen, denn sie erhielt keine Antwort. Dann fuhr Mom rückwärts aus der Garage, wie immer ein wenig schlingernd, während die Reifen auf dem Zementboden quietschten. Mit einem langen Jaulen, das mit einem Rumpeln endete, wurde die Garage wieder geschlossen, und das Motorengeräusch des Jeep Grand Cherokee, das leiser und viel weniger spannend war als das des Triumphs, wurde langsam schwächer, bis es nicht mehr zu hören war. Sherlock Holmes schloss aus sieben Schlammspritzern, dass die verschreckte junge Dame in seinem Salon keine ganz unbeschwerliche Fahrt in einem Einspänner hinter sich hatte. Draußen auf der Straße röhrte der Motor eines Wagens – Brandons Mitfahrgelegenheit. Die verschreckte junge Dame verlor vor Angst beinahe den Verstand.
Linda tippte ein Memo über den Skyway-Etat in ihren elektronischen Terminkalender, als ihr Mobiltelefon klingelte. Es war Deborah, die Frau von Scotts Bruder Tom. Wie immer, wenn sie anrief, hielt Linda einen Moment lang die Luft an. Sie klang, als hätte sie sich über irgendetwas aufgeregt, das konnte Linda schon an der Art und Weise hören, wie sie »Hallo« sagte.
»Hallo.«
»Bist du schon im Büro?«
»Nein, bin im Verkehr stecken geblieben.«
»Ich auch.« Sie hielt einen Augenblick inne. »Hast du schon Brandons Resultate bekommen?«
»Welche Resultate?«
»Die Ergebnisse des Aufnahmetests fürs College.«
»Ich dachte, die gibt es nicht vor nächster Woche.«
»Wenn man wartet, bis sie mit der Post zugeschickt werden, schon«, sagte Deborah. »Aber hier ist die Nummer, unter der man sie seit heute früh sieben Uhr abfragen kann – du brauchst nur eine Kreditkarte und ein bisschen Geduld. Bei mir hat es allein zwanzig Minuten gedauert, bis ich endlich durchkam.«
Linda sah auf die Uhr am Armaturenbrett. 7:32 Uhr.
»Also hast du Sams Resultate?«, fragte sie. Sam war Brandons Cousin, der im selben Alter war.
»Hundertachtundfünfzig.« Deborahs Stimme wurde plötzlich abrupt lauter, so als hätte es irgendwo einen Impuls durch eine atmosphärische Veränderung gegeben. Linda hielt das Telefon ein Stück von ihrem Ohr weg.
»Ist das gut?«
»Linda, das ist fast hundertsechzig, also praktisch die Punktzahl aus dem Eignungstest dividiert durch zehn. Das bedeutet, dass Sam 99 Prozent hat.«
»Großartig«, sagte Linda, während sie sich im Schritttempo auf die nächste Ausfahrt zubewegte. Der Obdachlose, der sich diesen Platz als Revier ausgesucht hatte, starrte durch das Fenster zu ihr herein und klapperte mit seinem Dunkin’-Donuts-Becher. »Wow«, fügte sie hinzu.
»Danke. Wir sind überglücklich. Manche Kinder schaffen auch 160, aber nur ganz wenige. Und Sam spielt ja auch noch Tennis und hat seine Sozial ...« Sie unterbrach sich. »Wie auch immer, ich geb dir jetzt die Nummer durch. Viel Glück.«
Linda wählte die Nummer, doch als endlich nicht mehr belegt war, stand sie bereits kurz vor der Tiefgarage des Gebäudes, wo sie keinen Empfang bekommen würde. Sie fuhr an den Straßenrand, blieb, einen Fuß auf der Bremse, stehen und folgte den Anweisungen am Telefon, während ihr Herz plötzlich zu rasen begann. Hinter ihr hupte irgendjemand. Sie musste Brandons Sozialversicherungsnummer nennen, die sie in ihrem Kalender stehen hatte, und eine VISA- oder Mastercard-Nummer mit Ablaufdatum, die sie auswendig wusste. Dreizehn Dollar. Dann gab es eine Pause, eine ziemlich lange sogar, während der sie glaubte, den Schweiß spüren zu können, der ihr inzwischen ausgebrochen war. Schließlich stieß die elektronische Stimme Brandons Resultat hervor. »Einhundertneun.«
Linda legte auf, fragte sich jedoch sofort danach, ob sie richtig gehört hatte. Einhundertneun. Wie viele Punkte waren das? 1090? Unmöglich. Brandon war ein guter Schüler, der immer entweder mit A- oder B-Noten abschnitt. Diese elektronischen Stimmen waren manchmal schwer zu verstehen, da sie die Silben nicht wie ein normaler Mensch betonten. Vielleicht war es 119 oder 129 oder 139 gewesen. 139 würde 1390 Punkte bedeuten, das Resultat, das sie selbst vor vielen Jahren gehabt hatte. Sie glaubte nicht, dass sie klüger war als Brandon, es musste also 139 gewesen sein.
Linda wählte die Nummer ein zweites Mal. Belegt. Inzwischen war es acht Uhr. Sie würde zu spät kommen. Es kümmerte zwar niemanden da oben, ob sie fünf oder sogar zehn Minuten später dran sein würde, aber Linda war niemals zu spät gekommen, nicht ein einziges Mal in den drei Jahren, seit sie für diese Firma arbeitete. Entschlossen ließ sie das Bremspedal los und stellte sich in der Schlange für die Angestelltenparkplätze an, während sie die Wahlwiederholungstaste drückte. Schließlich wurde sie verbunden. Als sie in die Garage fuhr, brachte sie gerade die Prozedur mit der Kreditkarten- und Sozialversicherungsnummer hinter sich, bezahlte erneut dreizehn Dollar und wartete, bis die endlose Stille eintrat. Die Stille, während der was genau passierte? Während der irgendein Computer die Sozialversicherungsnummer mit der Kreditkartennummer abglich und das Sprachprogramm aktivierte? Wie lange würde das wohl dauern? Sie steckte ihre Parkkarte in den Schlitz, rammte ihn mit aller Gewalt hinein und fuhr genau in dem Augenblick durch die Schranke, als die Stimme zu sprechen begann. »Einhundert ...«
Dann verlor sie den Funkkontakt und fuhr ins elektronische Niemandsland. Im Aufzug versuchte sie es ein drittes Mal. Das Gebäude hatte sieben Stockwerke, und ihr Büro befand sich im sechsten. Als sie am dritten Stock vorbeifuhr, bekam sie eine Verbindung, wiederholte die Sozialversicherungs- und Kreditkartennummer, als sie aus dem Aufzug stieg, zahlte noch einmal dreizehn Dollar und lauschte der Stille, während sie den Flur hinabging. Alle wandten sich um und sahen sie an. »Einhundertneun«, wiederholte die elektronische Stimme.
Brandon stieg in Deweys Wagen.
»Hey.«
»Wie isses?«
»Ich fühl mich zum Kotzen.«
»Erzähl mir was Neues.«
Dewey ging in eine der unteren Klassen der Highschool und war der Erste von Brandons Freunden, der einen Führerschein besaß. Er hielt gerade einen brennenden Joint in der Hand, den er an Brandon weiterreichte. Brandon wollte nicht in diese beschissene Schule, er hatte überhaupt keine Lust, jemals wieder dort hinzugehen. Aber er schob den Gedanken beiseite und nahm einen Zug von dem Joint, bevor er ihn seinem Freund zurückgab.
»Könnte ’n bisschen Spritgeld gebrauchen«, sagte Dewey.
Brandon reichte ihm drei Dollarnoten.
»Fahr’ ich vielleicht ’nen Rasenmäher und hab’s nur noch nicht gemerkt?«
Brandon hielt ihm zwei weitere Scheine hin, während er bemerkte, dass die Benzinanzeige voll war. Aber was sollte das Ganze? Dewey fuhr vom Bordstein los, wobei er die Reifen ein wenig quietschen ließ. Dann legte er eine CD ein, irgendein Rap-Song mit fuck you-good as new-all we do-then it’s through, den Brandon noch nie gehört hatte. Nicht schlecht.
»Die Schule nervt«, sagte Dewey.
»Kannst du laut sagen.«
»Ich denke drüber nach, ob ich abgehen soll.«
»Noch vor dem Abschlussjahr?«
»Jetzt gleich.«
»Aber was ist mit dem Baseball?« Dewey war Kapitän des Anfängerteams und hatte vergangenes Frühjahr ein paar Spiele für die Schulmannschaft absolviert.
»Für die Mannschaft komme ich sowieso nicht in Frage«, sagte Dewey. »Ich rassle in zwei Kursen durch.«
»Das kannst du doch noch aufholen.«
Dewey nahm einen tiefen Zug von dem Joint und stieß den Rauch langsam aus.
»Richtig«, sagte er.
fuck you-good as new-all we do-then it’s through
Nicht schlecht? Das war großartig.
»Wer ist das?«
»Du weißt nicht, wer das ist? Unka Death.«
In diesem Augenblick fiel Brandon wieder ein, dass er an diesem Tag einen Englischtest hatte, dessen Ergebnis mit zwanzig Prozent zu seiner Endnote beitragen würde. Macbeth. Er hatte sich nicht vorbereitet, sondern war schon nach den ersten Zeilen darüber eingeschlafen. Es ging um irgendeinen Schwachsinn mit Hexen, der symbolisch oder ironisch oder so etwas sein sollte – was genau, würde er definieren müssen. Dafür gab es wahrscheinlich Punktabzug, obwohl er verdammt genau wusste, was die Begriffe bedeuteten.
»Ich hab ’ne Idee«, sagte Dewey. »Lass uns in die Stadt fahren.«
»Welche Stadt?«
»New York, verdammt. Ich kenne diese Bar im Village, wo sie nie den Ausweis kontrollieren.«
New York lag fast zwei Autostunden entfernt. Brandon war etwa ein Dutzend Mal in New York gewesen, aber immer gemeinsam mit seiner Familie. »Ich hab aber nur zehn Dollar dabei.«
»Ist doch cool. Ich hab ’ne Kreditkarte.«
»Ehrlich?«
»Läuft auf das Konto meiner Mutter. Für den Notfall.«
Dewey lachte. Schließlich fiel Brandon in sein Gelächter ein. Ein Notfall: das war doch wohl einer, oder? Sie fuhren an der Schule vorbei, vor der die Busse parkten und wo sich der Schülerparkplatz langsam füllte. Brandon sah ein paar seiner Klassenkameraden. Dewey drückte auf die Hupe. O Scheiße, dachte Brandon, als sie weiterfuhren. Dewey reichte ihm erneut den Joint.
»Gehört dir«, sagte er und drehte den Lautstärkeregler hoch.
Stille. Ruby genoss es, das Haus für sich allein zu haben. Die verängstigte junge Dame sagte zu Holmes: Sie könnten mir vielleicht einen Rat erteilen, wie ich diesen Gefahren, die auf mich lauem, entgehen kann. Ruby sah auf die Uhr, legte ihr Lesezeichen – das mit dem Chef der Comicfigur Dilbert – in das Buch. Irgendwann war ihr aufgegangen, dass das Haar des Chefs, das seinen Kopf so eierförmig aussehen ließ, an den Teufel erinnern sollte – manchmal brauchte sie eben etwas länger. Sie stand auf. Vor dem Fenster sah sie einen Kardinalvogel, der seinen Kopf in den Futterautomaten steckte. Plötzlich drehte er sich zum Fenster, spreizte die Flügel und schoss in das Wäldchen hinter dem Haus.
Ruby putzte ihre Zähne so lange, bis die Schleimhäute in ihrem Mund zu brennen begannen, dann lächelte sie ihrem Spiegelbild zu. Es war kein richtiges Lächeln, das ihre Augen mit einschloss, sondern diente lediglich der Untersuchung ihrer Zähne. Doktor Gottlieb behauptete, sie brauche eine Spange. Wie schief standen ihre Zähne denn nun wirklich? Sie betrachtete ihr Gebiss aus verschiedenen Perspektiven. An manchen Tagen sahen sie ziemlich gerade aus, aber heute waren sie ein einziges Chaos.
Brandon hatte mal wieder die Toilettenspülung nicht betätigt, und gezielt hatte er auch nicht besonders gut. Vorsichtig trat sie vor die Kloschüssel hin und zog ab, bevor sie unter die Dusche ging.
Sie wählte das extramilde Shampoo mit dem Känguru darauf, weil ihr die Verbindung der beiden, Tier und Shampoo, so gut gefiel, danach eine Kurspülung, auf deren Verpackung behauptet wurde, sie sei für extrem trockenes Haar – was immer auch damit gemeint war. Und dazu seifte sie sich mit dem Fa-Duschgel ein, weil es so lecker nach Kiwis roch. Sauber, abgetrocknet und großartig duftend wickelte sie ein Handtuch um ihr Haar und zog sich an – Khakihosen von The Gap, ein langärmeliges T-Shirt mit einem silberfarbenen Stern vorn drauf und schwarze Clogs mit Plateausohlen, die sie größer wirken ließen –, dann ging sie runter in die Küche. Zippy war auf einen Schlag wach, sprang unter dem Tisch hervor und stürzte sich mit wedelndem Schwanz auf sie.
»Platz, Zippy.«
Aber natürlich gehorchte er nicht, sondern tat genau das Gegenteil. Er richtete sich auf und legte seine Vorderpfoten auf ihre Schultern.
»Platz.«
Er fuhr ihr mit seiner Schnauze ins Gesicht und dann hingebungsvoll mit seiner Zunge über ihre Nase.
»Lieg«, kommandierte sie versuchsweise. Zippy ließ sich ohne Umschweife wieder auf seine vier Pfoten fallen, wobei er an ihrem T-Shirt hängen blieb, so dass zwei der kleinen Spitzen des Sterns heruntergerissen wurden.
»Zippy. Böser Junge.«
Er wedelte mit dem Schwanz.
Seine Wasserschale war leer, und Ruby füllte sie wieder auf. Er schenkte der Schale zunächst keine Aufmerksamkeit, doch als sie ihm den Rücken zuwandte, hörte sie ihn laut hinter sich schlabbern.
Ruby bereitete sich ihr Frühstück zu – Rühreier, Toast und Orangensaft. Keine Milch, die trank sie nur, wenn man sie dazu zwang. Abgesehen von ihrem Zimmer war die Küche ihr Lieblingszimmer im Haus. Sie mochte die Kupfertöpfe an der Wand, die Obstschale (die in diesem Augenblick leer war, sonst aber manchmal sämtliche Obstsorten zu enthalten schien), die Holzkochlöffel, das Gewürzbord und den großen Kühlschrank, der in der Ecke summte. Die Wände waren in einem hübschen Gelbton gestrichen, der wunderbar zu den Eiern passte, die sie sich gerade machte.
Rubys Stuhl am Frühstückstisch war der perfekte Aussichtspunkt, weil sie von dort aus durch drei Fenster auf einmal sehen konnte. Auf ihrem sonnendurchfluteten Platz verspeiste sie die Eier und blätterte durch ein Frisurenbuch, während sie über den richtigen Namen der Dreiecke des Sterns auf ihrem Shirt nachdachte. Sie war rundum zufrieden mit sich.
Vielleicht waren ihre Zähne nicht gerade sensationell, aber ihr Haar konnte sich sehen lassen. Es war dick, hatte einen schimmernden Braunton mit jeder Menge Schattierungen – es war fast, als hätte es eine eigene Persönlichkeit. Ruby entschied sich für eine Hochsteckfrisur, weil sie sie an Dilberts Boss erinnerte. Sie machte zwei Zöpfe, teilte sie jeweils in drei Strähnen auf, die sie zu kleinen Knoten drehte und mit Haarspangen feststeckte.
»Wie sehe ich aus, Zippy?«
Er blickte über die Tischkante und mopste sich das letzte Stück Toast, auf dem die Butter gerade perfekt geschmolzen war.
»Zippy!«
Er knurrte sie an, worauf sie ihm einen drohenden Blick zuwarf. Zippy duckte sich und robbte weg. Was für ein Feigling er doch war!
Ruby zog ihre blaue Jacke mit den gelben Paspeln an und ging mit ihm hinaus in das kleine Wäldchen. Sie nahm die Abkürzung am Weiher entlang, dessen Ufer voller Schlamm waren. Dann ließ sie den Hund von der Leine.
»Lauf. Mach Pipi.«
Er hob ein Bein und pinkelte an einen Baumstamm.
»Lauf, Zippy.«
Aber er wollte nicht laufen. Sie warf einen Stock, dem er jedoch nur nachstarrte. Sie griff nach einem weiteren Stock und schleuderte ihn in den Weiher, wo er geräuschlos vom Wasser verschluckt wurde. Seltsam, dachte sie.
»Lauf und hol ihn, Zippy.«
Aber er gehorchte nicht, und sie machte ihm keinen Vorwurf daraus. Das Wasser sah aus, als wäre es eiskalt. Sie ging wieder zum Haus zurück. Auf dem Weg hob Zippy noch ein Dutzend Mal das Bein.
»So, und jetzt ein großes Geschäft, Zippy.« Endlich gehorchte er.
Ruby räumte das Geschirr in die Spülmaschine – ihr eigenes und das aus dem Spülbecken –, schulterte ihren Rucksack und verließ das Haus durch die Eingangstür, wobei sie sicherheitshalber noch einmal nachsah, ob auch wirklich abgeschlossen war. Der Schulbus fuhr gerade vor, und sie stieg ein.
»Hallo, meine Hübsche«, sagte der Busfahrer.
»Hallo, Mr. V.«
Es gab nur noch einen freien Platz im Bus, neben Winston. Er bohrte in der Nase.
»Schluck das ja nicht runter«, sagte sie.
Er tat es trotzdem.
Der Bus fuhr an. Ohne ersichtlichen Grund fiel ihr plötzlich das Buch mit den Bibelgeschichten ein, das Großmutter ihr geschickt hatte, um an die Tatsache zu erinnern, dass Mom und Dad nicht zur Kirche gingen. Besonders genau konnte sie sich noch an die Geschichte von Lots Frau erinnern, die nicht nach hinten sehen sollte. Sie hatte das Gefühl, dass es auch im Augenblick wichtig war, nicht nach hinten zu sehen, aber sie konnte nicht anders. Das Bedürfnis überkam sie mit fast übermächtiger Kraft. Ruby wandte sich um.
Natürlich passierte nichts. Sie erstarrte nicht zur Salzsäule, und das Haus ging auch nicht in Flammen auf. Es blieb genau, was es war: ein Haus, nicht das größte oder tollste in der Straße, aber stark und solide, weiß mit schwarzen Fensterläden und einem roten Kamin als einzigem Farbfleck, der vielleicht ein wenig zu – wie sagte man noch mal? Imposant? – ja, zu imposant für den Rest des Hauses war. Diese Bemerkung hatte sie aufgeschnappt, als ihre Tante Deborah vorletztes Thanksgiving zu Besuch da gewesen war.
Winston riss ein Snickers in zwei Hälften. »Willst du auch was?«, fragte er. Ruby sah ihn konzentriert an, als wollte sie herausfinden, ob das ein Witz sein sollte. Doch er schien keinerlei Verbindung zu sehen zwischen dem Nasebohren und seinen schmutzigen Fingernägeln, die er in den Schokoriegel grub. Er wollte tatsächlich teilen.
»Vielleicht will Amanda ja was«, sagte Ruby.
Amanda beugte sich herüber – Amanda, die ein verdammtes Piercing in den Ohren hatte, während Ruby noch ein Jahr damit warten musste. »Amanda will was wovon?«, fragte sie.
Und was war das? Etwa Lippenstift?
»Snickers«, erwiderte Ruby, die plötzlich das Gewicht von Teufelshörnern auf ihrem Kopf zu fühlen glaubte. »Du magst doch Snickers, oder nicht?«
»Oh, mein Lieblingssnack«, sagte Amanda.
Winston überreichte ihr die Hälfte und Ruby sah erstaunt zu, wie sie es sich in den Mund schob.
»Hmm«, machte Amanda.
Kapitel 2
Lindas Meeting dauerte bis neun Uhr dreißig. Eine Minute später saß sie wieder in ihrem Büro – einem Kabuff, um genau zu sein, denn es war ein Teil des Teamkonzepts, dass sie alle in diesen kleinen offenen Büros arbeiteten – und rief Scott
an.
»Ich habe ein paar Besorgnis erregende Nachrichten«, sagte sie.
»Skyway?«
Das auch. »Ich habe Brandons Resultate des Vorbereitungstests für das College.«
»Ich auch.«
»Hat dir Tom von dieser Kreditkartensache erzählt?«
»Was für ein Chaos«, sagte Scott lachend. »Wir haben doppelt bezahlt.« Linda erzählte ihm nicht, dass sie insgesamt viermal bezahlt hatten, um die Nachricht abzuhören. »Ich nehme an, sie haben beide ganz ordentlich abgeschnitten. Was ist daran Besorgnis erregend?«
»Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.« Linda war leicht verwirrt. Hatte es irgendein Computerproblem bei ihr gegeben, so dass Scott das richtige Ergebnis kannte, das viel höher lag als das, welches ihr genannt worden war?
»Ich meine Brandon und Sam«, sagte Scott. »Tom meinte, Sam habe sehr gut abgeschnitten und dass Brandon im 75- Prozent-Bereich liegt, richtig? Was ist daran so schlimm?«
Wo sollte sie nur anfangen? Linda bemerkte, dass sie den Telefonhörer verzweifelt umklammert hielt. Eine Reihe wenig erfreulicher Gedanken schoss ihr durch den Kopf: Hatte Scott ihr jemals von seinen eigenen Ergebnissen erzählt? Hatte sie ihn je danach gefragt? Und wenn nein, warum nicht?
»Zuerst einmal«, sagte sie, »willst du mir damit sagen, dass Tom nichts von Sams Ergebnis erzählt hat?«
»Nur, dass es in Ordnung war.«
»Sam hat hundertachtundfünfzig. Hundertachtundfünfzig, Scott. Das heißt, seine Gesamtpunktzahl liegt bei über ein- tausendfünfhundert, das ist ein absolut grandioses Resultat. Er kommt damit auf 99 Prozent.«
Stille.
»Einhundertneun ist entsetzlich schlecht«, sagte Linda. »Das Schlimmste, was wir tun können, ist, uns in diesem Punkt etwas vorzumachen.«
»Ich weiß nicht, was du meinst«, sagte Scott. »Brandon war doch immer ein guter Schüler. Wie war sein Notendurchschnitt?«
»3,4, und dann hat er sich im letzten Halbjahr auf 3,3 hochgearbeitet – 3,29, um genau zu sein.«
»3,3 ist doch nicht so schlecht, das heißt, er hatte nur A- und B-Noten.«
Linda versuchte ihren Griff ein wenig zu lockern. »A- und B-Noten auf der West Mill High sind nicht dasselbe wie in Andover.«
»Wie meinst du das?« Sam war in Andover gewesen.
»Ich meine, dass die Colleges den Unterschied kennen, und eine Punktzahl von 1090 sowie ein Schnitt von 3,3 von der West Mill High bedeutet, dass die Ivies ihn nicht einmal mit dem Hintern ansehen werden.«
»Aber es gibt doch immer noch Amherst oder irgendetwas in dieser Art«, erwiderte Scott.
»Amherst? Träumst du? Vergiss Amherst, genauso wie Trini ty, verdammt noch mal.«
»Ich soll Trinity vergessen?«
»Ja, genauso wie die NYU, wie BC und sogar BU. Hast du es immer noch nicht begriffen? Bei diesem Eignungstest werden die Schüler das erste Mal auf nationaler Ebene geprüft. 75 Prozent bedeutet, dass Hunderttausende von Kindern besser sind als er. Die guten Colleges kriegen ihre Kurse bequem voll, ohne dass Brandon auch nur ansatzweise für sie in Frage kommt. Wir haben’s vermasselt.«
»Wie denn?«
»Wie üblich – indem wir es nicht haben kommen sehen.«
»Was hätten wir denn tun können?«
»Alle möglichen Dinge. Einen Vorbereitungskurs, zum Beispiel.«
»Gibt es denn so etwas?«
»Und wir hätten seine Noten genauer im Auge behalten müssen.«
»Aber er hat doch nur A- und B-Noten.«
»Ein Internat wäre eine Möglichkeit gewesen.«
»Aber darüber haben wir doch gesprochen. Wir wollten nicht, dass er von zu Hause weggeht, und er wollte es auch nicht. Und glauben wir nicht trotz allem an das öffentliche Schulsystem?«
»Glauben wir nicht in erster Linie an Brandon? Davon abgesehen hätten wir es uns ohnehin nicht leisten können.«
Eine erneute Pause entstand. »Also, was machen wir jetzt?«
»Ich weiß es nicht. Wir sollten ihn auf alle Fälle in einen Vorbereitungskurs für den Test stecken.«
»Vielleicht hatte er ja nur einen schlechten Tag.«
»Ich flehe zum Himmel, dass es so war, aber wir sollten uns nicht darauf verlassen. Wahrscheinlich sollten wir seinen IQ testen lassen, nur um zu sehen, was wir zu erwarten haben.«
Es folgte eine weitere lange Pause. Sie konnte Scotts Widerstand spüren. Es war kein konkreter Gedanke, sondern irgendetwas an seinem Charakter, etwas, das mit seinen Genen zu tun hatte. Seine DNA ist anders als die von Tom, dachte sie unwillkürlich.
»Wir reden hier über Brandons Zukunft«, fuhr Linda fort. »Darüber, wie sein Leben aussehen wird, wenn er auf eigenen Füßen steht, wenn er einmal so alt ist wie wir.«
Wieder Stille. »Sam hat also 99 Prozent?«, fragte Scott schließlich.
»Richtig. Harvard, Brown, Williams – sie werden ihm die Tür einrennen.«
In diesem Augenblick trat Tom in Scotts Büro, hob die Augenbrauen und deutete auf seine Armbanduhr.
»Ich muss los«, sagte Scott.
Es gab eine Menge Dinge, die Ruby an der Schule nicht mochte, aber der »Minutentest« war das Schlimmste. »Also gut«, sagte Ms. Freleng, als sie die Klasse nach der Pause wieder in Empfang genommen hatte. »Zeit für den Minutentest.« Ms. Freleng teilte die Aufgabenblätter aus, und jeder bekam einen Bogen mit Multiplikationsaufgaben.
»Aufgepasst«, sagte Ms. Freleng, während sie ihre dämliche Stoppuhr herausholte. »Drei, zwei, eins – los.«
Ruby starrte auf das Blatt. Die erste Aufgabe lautete: 37 x 92. Lieber Herr Jesus, was für ein Kreuz. 7 x 2 ist – sie mochte diesen Ausdruck mit dem Herrn Jesus und dem Kreuz, obwohl ihr nicht klar war, was er bedeutete – 14. Schreibe 4, behalte 1.7x9 ist- 65? Das war vielleicht ein vertracktes Ding hier. 63! Na also. Plus 1 macht 4. Eine Stelle weiter vorn anfangen. 3 x 2 ist ... verflixt und zugenäht. Diesen Ausdruck mochte sie ebenfalls sehr gern. Sie bemerkte, dass ihre Hand sich über das Blatt bewegte und die Aufgaben wie von selbst löste.
Acht mal sieben. Sechsundfünfzig. Geht doch. Schreibe sechs, behalte ... Es war ein Kreuz – Jesus Christus war doch an einem Kreuz gestorben, oder? Das war auch so etwas, das Ruby nicht mochte: eine Seite in einem der Kunstbücher im Wohnzimmer umzublättern und ohne Vorwarnung auf ein Gemälde mit der Kreuzigung zu stoßen. Sie hätte darauf gewettet, dass bei diesem Spruch das Kreuz gemeint war, an dem er gestorben war, oder irgendetwas in dieser Art. Und dann noch diese Dornenkrone. Sie spürte, wie ihre Kopfhaut überall anfing zu prickeln.
»Kinder, die Zeit ist um. Stifte weglegen.«
6. Schreibe 6, behalte 5.
»Das gilt für alle. Sofort die Stifte weglegen.«
Nicht 6, sondern 4. Vierundfünfzig. Warum, zum Teufel ...
»Das gilt auch für dich, Ruby.«
Ruby legte ihren Stift beiseite und zählte die Aufgaben, die sie gelöst hatte. Acht.
»Jetzt tauscht das Blatt mit eurem Nachbarn.«
Ruby gehorchte und sah auf Amandas Blatt, dass diese jede einzelne Aufgabe gelöst hatte. Amanda schenkte ihr ein freundliches Lächeln. Ihre Zähne waren groß und weiß – und natürlich perfekt, wie hätte es auch anders sein sollen.
»Die Lösung von Aufgabe eins lautet ...«
Und der Kerl, der diese Dornenkrone auf den Kopf von Jesus gesetzt hatte ... Wie konnte es sein, dass er sich nicht an den Dornen verletzt hatte? Wenn diese Dornen so waren wie die von dem Gestrüpp im Stadtwald ... Hatte er Handschuhe getragen? Aber es war doch zu heiß für Handschuhe – sie waren doch in der Wüste gewesen, oder nicht? –, aber hatten diese Gladiatorentypen nicht – Ruby hob den Kopf und sah, dass Ms. Freleng sie aus irgendeinem Grund beobachtete.
»Sind alle bereit für die Lösung von Aufgabe zwei?«
Ruby sah auf Amandas Lösung der ersten Aufgabe hinab. Was hatte Ms. Freleng gerade gesagt? Ruby konnte sich nicht an die Zahl erinnern, aber ihr erschien sie irgendwie falsch. Ganz bestimmt war es nicht dasselbe Ergebnis wie das, zu dem sie gelangt war. Sie machte ein X neben die Zahl und wartete gespannt auf die Lösung der nächsten Aufgabe.
»Was darf’s sein, Jungs?«
Es gab mindestens fünfzig Biersorten vom Fass hier, und es war definitiv die coolste Bar, in der Brandon je gewesen war. Der lange Tresen, der aus irgendeinem dunklen Metall bestand, war cool, die Musik war cool, die Gäste, die herumhingen oder Billard spielten, waren cool, die Barkeeperin war cool, und ihr Tattoo, eine perfekte Abbildung ihrer selbst auf ihrer einen Gesichtshälfte, war auch cool.
Brandon deutete auf den am nächsten stehenden Zapfhahn, auf dem ein Bär abgebildet war, worauf die Barkeeperin ihm ein Glas einschenkte. Ihre nackten Unterarme waren muskulös – die coolsten Unterarme, die er je an einer Frau gesehen hatte. Das Bier war dunkelbraun und ähnelte keiner Sorte, die er kannte. Er nippte daran. Es schmeckte grauenhaft.
»Magst du dieses Porter-Zeug etwa?«, fragte Dewey. Die Barkeeperin schenkte ihm eine Flüssigkeit ein, die wesentlich eher wie ein Bier aussah.
»Das hier ist ziemlich gut«, sagte Brandon und nahm einen weiteren Schluck. Es schmeckte noch immer miserabel.
»Fünf«, sagte die Barkeeperin.
»Die Runde geht auf mich.« Brandon reichte ihr seine Zehndollarnote.
»Macht zusammen neunfünfzig.« Sie tippte den Betrag ein und legte zwei Vierteldollarmünzen auf den Tresen.
Mit einer Geste, die er mal in einem Film gesehen hatte, gab er ihr zu verstehen, dass der Rest für sie war.
»Danke«, sagte sie.
Bei der nächsten Runde bestellte Brandon noch einmal dasselbe – Dewey zückte die Notfall-Kreditkarte, und die Barkeeperin machte sich an den Zapfhähnen zu schaffen –, nur um zu zeigen, was für ein Porter-Fan er war. Bei der dritten Runde wechselte er jedoch zu der Biersorte, die Dewey bestellt hatte. So groß war der »Notfall« mm auch wieder nicht. Er behielt diesen Gag für sich (wenn es denn einer war), da er sich nicht sicher war, wie er ankommen würde.
Dewey sah sich im Raum um. Er lächelte einem hoch gewachsenen Mädchen mit einer üppigen blonden Mähne zu, das zurücklächelte. Als Dewey einen Augenblick lang nicht hinsah, versuchte Brandon, ihr ebenfalls zuzulächeln und erntete ein Lächeln, das vielleicht noch eine Spur freundlicher war.
»Schätze, ich ziehe hier runter«, sagte Dewey, »und such mir einen Job als Fahrradkurier. Die machen dreihundert am Tag.«
»Echt?«
»Mindestens.« Dewey orderte eine neue Runde und Zigarren dazu. Sie rauchten und tranken. Interessant aussehende Leute gingen draußen auf der Straße vorbei, sie waren völlig anders als die Typen, die man in West Mill oder sogar in Hartford zu Gesicht bekam. Man brauchte sich doch nur mal diesen Fahrer eines Abschleppwagens ansehen, der ein rotes Tuch um seinen Kopf geknotet hatte und eine Augenklappe trug. Er sah aus wie ein Pirat.
Brandon stand auf, um aufs Klo zu gehen. In diesem Moment stieg ihm das Porter in den Kopf. Nicht weiter schlimm, und er erholte sich innerhalb weniger Augenblicke – wenn auch vielleicht nicht ganz, denn er betrat die falsche Toilette. Das große blonde Mädchen stand drin. Auf den zweiten Blick erkannte er allerdings, dass sie ihren kurzen Lederrock über die Hüften geschoben hatte und ins Urinal pinkelte.
Brandon ging rückwärts wieder hinaus und wartete im Korridor neben den Telefonen. Auf der Straße ging eine Frau mit einer Basstrommel auf dem Kopf vorbei. Dann tauchte der Abschleppwagen-Fahrer aus der entgegengesetzten Richtung mit einem Pkw im Schlepptau wieder auf. Brandon beobachtete die Frau so lange, bis er sicher war, dass sie wirklich das war, was sie zu sein schien. Den Wagen bemerkte er kaum.
Sie saßen in Toms Büro. Es war der Raum, der früher einmal ihrem alten Herrn gehört hatte. Tom saß hinter dem Schreibtisch und Scott auf der Couch.
»Also hat Brandon auch gut abgeschnitten?«, fragte Tom.
»Nicht schlecht.«
»Wie schön. Er ist so ein lustiger Kerl.«
»Lustig?«
»Dieses Gaunergrinsen. Wäre das nicht ein Ding, wenn sie im gleichen College landen würden, so wie wir damals?«
»Wie wir?«
»Auf der UConn.«
Richtig, sie waren beide auf der UConn gewesen, doch als Scott dort angefangen hatte, war Tom gerade nach Yale gegangen, um seine beiden Abschlussjahre zu absolvieren.
»Denk nur an die Aufreißpartys. Und kannst du dir Moms Reaktion vorstellen, wenn wir ihr erzählen, dass die beiden nach Princeton oder etwas in dieser Art gehen?«
Scott gab keine Antwort. Vielleicht dachte Tom, er würde sich gerade Moms Reaktion vorzustellen versuchen. »Da ist noch eine Sache«, sagte Scott.
Tom warf ihm einen seiner typischen Blicke zu. Einen Blick, den er nicht mit Worten beschreiben konnte, was an sich schon eine Menge aussagte.
»Geld?«
»Wenn du es so nennen willst. Kennst du Mickey Gudukas?«
»Dieser glatzköpfige Linkshänder, der die ganze Zeit Fußfehler macht? Ein echter Schleimbeutel.«
»Er kommt an gute Informationen heran.«
»Welche Art Informationen?«
»Uber den Markt.«
»Ist er jetzt Broker? Ich dachte, er sei Sachverständiger bei einer Versicherung oder so etwas.«
»War er auch. Dann hat er als Börsenmakler angefangen. Bei Denman, Howe. Er ist immer noch Broker, aber nicht mehr bei ihnen.«
»Haben sie ihn bei Denman, Howe rausgeschmissen? Welche Verbindung hast du zu ihm?«
»Er war es, der mir den Tipp mit Stentech gegeben hat. Du hast doch eine Menge da herausgeholt, wenn ich mich recht erinnere.«
Tom nickte. »Aber ich habe alles erst genau überprüft, bevor ich eingestiegen bin.« Abgesehen von den Investmentfonds war dies das einzige Aktiengeschäft, in das Tom jemals eingestiegen war.
»Klar. Ich bin ihm über den Weg gelaufen, als ich vor einiger Zeit Ruby vom Tennis abgeholt habe. Er hat mir wieder einen Tipp gegeben. Es ist dieselbe Art von Deal: ein Pharmaunternehmen, das ein neues Produkt auf den Markt bringen will, dessen Testphase gerade abgeschlossen wurde. Es heißt Symptomatica.«
»Wie ist ihr Spiel?«
»Wessen Spiel?« Tom konnte einen manchmal wirklich aus dem Konzept bringen.
»Das von Ruby.«
»In Ordnung, nehme ich an.«
»Gefällt es ihr?«
»Tennis? Klar.« War das wirklich so? Sie nahm schon seit Jahren Unterricht. Ruby war ziemlich schnell, wenn auch ein wenig klein. Es war schwer zu sagen, ob aus ihr jemals eine gute Spielerin werden würde. Dennoch war es wichtig, sich langfristig in einer Sportart zu engagieren, am besten sogar in zwei, selbst wenn man für ein Sportstipendium nicht in Frage kam. Er hatte sich vor nicht allzu langer Zeit mit anderen Eltern auf dem Tennisplatz darüber unterhalten. Vielleicht kam Brandon dieses Jahr in die Schulmannschaft. Er würde wohl kaum Sams Niveau erreichen, der bereits als Nummer vier im Andover-Team spielte, aber zumindest würde er es so weit schaffen, dass einer der Auswahlmannschaftstrainer ein gutes Wort bei der Verwaltung, die über die Aufnahme am College entschied, für ihn einlegen würde. Neunundneunzig Prozent. Verdammt.
»Ein süßes Kind«, meinte Tom.
»Wer?«
» Ruby. «
»Ja, das ist sie. Dieser Symptomatica-Deal läuft genau andersherum wie beim letzten Mal. Ihr Produkt wird nämlich nicht funktionieren. Also geht es darum, kurzfristig zu agieren.«
»Also Leerverkäufe? Lässt du dich neuerdings auf so einen Blödsinn ein?«
»Niemals«, sagte Scott, was beinahe der Wahrheit entsprach. »In diesem Fall gibt es allerdings kein Risiko. Es ist, als könnte man in die Zukunft sehen.«
Tom sah auf das Porträt an der Wand, das ihren alten Herrn zeigte, ein oder zwei Jahre, bevor er krank wurde. Für jeden anderen auf der Welt hätte dieser Blick alles oder nichts bedeuten können, aber Scott verstand die Botschaft. In die Zukunft sehen: Konnte das etwas sein, worüber ein Versicherungsmann sprechen sollte? Die Basis ihres Geschäfts war doch die Unvorhersehbarkeit der Zukunft.
»Woher willst du wissen, dass dieses Produkt oder was immer das auch ist, scheitern wird?«, fragte Tom.
»Gudukas hat einen der Wissenschaftler des Konzerns auf einer Kreuzfahrt kennen gelernt. Guy lehrt jetzt am MIT. Er ist ausgestiegen, als ihm klar wurde, dass diese Sache zum Scheitern verurteilt war. Sie fummeln noch immer daran herum, um das Projekt zu retten, aber es gibt keine Chance. Sie haben schon von Anfang an einen riesigen Fehler gemacht.«
»Was für einen Fehler?«
»Irgendetwas mit einer unbrauchbaren DNA. Gudukas hat mir das Ganze auf einer Serviette aufgezeichnet, und am Ende habe ich es auch verstanden, aber es ist alles sehr technisch, und im Grunde spielt es auch keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass die Aktien an dem Tag, an dem diese Testresultate veröffentlicht werden, in den Keller fahren.«
»Wie stehen sie im Augenblick?«
»Gestern bei Börsenschluss bei zwölf und ein paar Zerquetschten. Sie gehen auf null runter, Tom. Ich dachte an zwanzigtausend Anteile, also zehntausend für jeden von uns. Wir könnten fast eine Viertelmillion herausholen.«
»Was ist Gudukas’ Aufhänger?«
»Eine saftige Provision. Wenn man das als Aufhänger bezeichnen will.«
Tom schaukelte auf seinem Stuhl vor und zurück, genauso wie ihr alter Herr es immer getan hatte. Plötzlich wurde Scott sich dieses seltsamen Dreiecks im Büro bewusst – das Porträt, Tom und er. In Wahrheit sah keiner von ihnen beiden ihrem alten Herrn sehr ähnlich. Sie kamen nach ihrer Mutter, und geradezu frappierend war dabei die Ähnlichkeit zwischen ihnen beiden. Scott war nur ein wenig größer, Tom ein wenig dunkler und mit etwas markanteren Zügen. Ihre Stimmen hingegen waren nahezu identisch – eine Tatsache, auf die sie ständig angesprochen wurden.
»Halte mich da raus«, sagte Tom.
»Du lässt also eine Viertelmillion sausen, einfach so?«
»Ich halte dich doch nicht davon ab.«
Scott holte tief Luft. »Seine Maklerfirma will für Deals wie diesen eine Sicherheit.«
»Dann nimm doch dein Konto.«
»Das reicht nicht.«
»Und was ist mit dem Geld aus den Stentech-Aktien?«
»Davon habe ich die Renovierung bezahlt.«
»Du hast achtzig Riesen für die Renovierung ausgegeben?« »Das war es wert«, sagte Scott. Er erzählte ihm nichts davon, dass ein Teil der achtzigtausend in ein anderes Aktiengeschäft geflossen waren, das weniger erfolgreich ausgegangen war. Und er ließ unerwähnt, dass sein Haus mindestens ebenso schön war wie das von Tom, wenn nicht sogar noch schöner.
Stünde es in Old Mill in derselben Gegend, dann wäre es eine Menge wert ... wesentlich mehr als das von Tom, so viel stand fest.
»Euer Haus ist großartig. Das meinte ich damit nicht«, sagte Tom, als hätte er seine Gedanken gelesen.
Scott zuckte mit den Schultern. »Mein Rentenkonto kann ich nicht nehmen. Das hat etwas mit der staatlichen Börsenaufsicht zu tun. Und wenn ich eine Hypothek auf das Haus aufnehmen würde, bräuchte ich Lindas schriftliches Einverständnis.«
»Sie weiß von all dem nichts?«
»Du weißt doch, wie sie ist.«
Tom erwiderte nichts darauf, hörte aber auf, mit dem Stuhl zu schaukeln.
»Das heißt, es bleibt nur noch die Firma«, sagte Scott.
»Die Firma?«
»Mein Anteil. Als Sicherheit.«
Tom begann wieder zu schaukeln. H.-W.-Gardner-Versicherungen: Zu fünfunddreißig Prozent gehörte das Unternehmen Tom, zu fünfundzwanzig Prozent ihm und zu vierzig Prozent der Nachlassnehmerin, also ihrer Mutter, die inzwischen in Arizona lebte.
»Ich weiß nicht einmal, ob das geht«, sagte Tom. »Es würde mindestens mein Einverständnis und das von Mom auf irgendeinem Dokument erfordern, keine Ahnung, auf welchem.«
»Ich würde selbstverständlich für die Verwaltungskosten aufkommen«, sagte Scott.
»Kannst du das Ganze nicht einfach sausen lassen?«, fragte Tom.
Sie sahen sich an. Das war etwas, was Scott immer schwergefallen war: Es war, als sähe er im Spiegel sein eigenes Gesicht, wenn auch auf seltsame Art anders, gequälter und weniger offen. Das Ganze hatte nichts mit der Aufteilung von fünfunddreißig zu fünfundzwanzig Prozent zu tun, denn das war nur fair: Tom hatte unmittelbar nach dem College beim alten Herrn angefangen zu arbeiten, während Scott zehn oder zwölf Jahre lang zuerst in Boston, dann in Hartford gewesen war, wo er bei Prudential, danach bei Travelers und schließlich bei Allstate Karriere gemacht hatte.
»Hast du noch nie von Unabhängigkeit geträumt, Tom?«
Tom blinzelte. »Unabhängigkeit?«
»Finanzielle Unabhängigkeit. Ganz einfach die Freiheit zu haben, um ... keine Ahnung, wofür.«
»Es geht uns doch ziemlich gut hier, Scott, uns beiden. Unseren Frauen, den Kindern, allen.«
Dir geht es gut, dachte Scott. Dir. Doch er sprach es nicht aus.
»Was ist mit Mom?«, fragte Tom.
»Sie wird tun, was du ihr sagst. Das weißt du ganz genau.« Tom wich seinem Blick aus.
»Ich denke darüber nach«, sagte er. »Das ist alles, was ich dir versprechen kann.«
Denk schnell, nur dieses eine Mal, dachte Scott. Die Uhr tickt schon. Eigentlich hatte er es wörtlich gemeint im Hinblick auf den Deal mit Symptomatica – doch im selben Augenblick wurde ihm bewusst, dass es auch noch um etwas Anderes, etwas Größeres ging: Warum konnte Tom nur dieses gottverdammte Ticken nicht hören?
Kapitel 3
Kyla Gudukas setzte zum entscheidenden Punkt an, indem sie Rubys Rückhand parierte. Am Ende jeder Stunde war eine »Jeder-gegen-jeden«-Runde vorgesehen, bei der die Finalisten vier Spiele ohne Vorteilsregelung absolvierten. Der Gewinner, meist Kyla, bekam als Preis ein Klettband für den Schläger, eine Flasche Gatorade oder einen Satz Bälle von Erich, ihrem Tennislehrer im Club.
Ruby holte aus, trat einen Schritt in Richtung des Balles – von unten nach oben schlagen, von unten nach oben, genau so, wie Erich es ihr unzählige Male erklärt hatte, bis sie am liebsten angefangen hätte zu schreien – und beförderte ihn mit einer recht passablen Rückhand über den Court. Kyla parierte mit einem ihrer typischen tiefen Schläge. Ein Lob-Schlag, gerade mit so viel Tempo, dass er über das Netz flog. Ruby konterte mit einer weiteren Rückhand, die vielleicht noch besser war als die vorige. Kyla retournierte erneut mit einem Lob. Ruby versuchte den Ball so zu schlagen, dass Kyla mit einem Vorhandschlag würde parieren müssen. Kyla schlug einen weiteren Lob zurück. Mehrere Vorhandschläge folgten. Zack, zack. Dann wieder eine Rückhand. Zack. Noch drei weitere. Zack, zack, zack.
Ihr nächster Ball ging ins Netz. So musste es gewesen sein, denn er landete hüpfend neben ihr. Spiel, Satz, Match. Sie traten ans Netz und schüttelten sich die Hände.
»Gutes Spiel.«
»Gutes Spiel.«
Erich kam mit einer Flasche Gatorade herüber, der blauen, die Ruby am liebsten mochte. »Hierr, Champ, nimm errst mal einen Sporrt-Drrink«, sagte er mit seinem typisch schweizerischen Akzent und überreichte Kyla ihren Preis. »Wirrr sähen uns alle am Montag wiederrr.«
»Wirrr werden alle da sein«, konterte Ruby seelenruhig.
»Wie war das, Ruby?«
Vielleicht war sie nicht ruhig genug gewesen. Sie schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. »Danke für die Stunde.«
»Oh, säährrr gern.«
Gerrmja säährr gerrrn sogar. Ruby schob ihren Schläger in die Hülle. Vier Männer mit Knie- und Ellbogenschützern und behaarten Armen stürmten lautstark auf den Court.
»Habt ihr den Court schon für uns angewärmt, Kinder?«, fragte einer von ihnen.
»Passen Sie auf, dass Sie sich die Füße nicht verbrennen«, gab Ruby zurück.
Kyla lachte. Sie hatte eine lustige Art zu lachen, die Ruby sehr gefiel.
Sie gingen in die Lobby. Ruby nahm einen Schluck aus dem Wasserspender, den sie, selbst wenn sie sich auf die Zehenspitzen stellte, kaum erreichen konnte. Irgendjemand hatte seinen Kaugummi darin liegen lassen.
»Deine Mutter hat angerufen, Ruby«, sagte die Dame am Empfang. »Sie kommt ein wenig später.«
Ruby setzte sich auf eine Bank neben dem Süßigkeitenautomaten und sah in ihren Rucksack. Hatte sie an Die Gesammelten Werke von Sherlock Holmes gedacht? Nein. Hatte sie noch Geld vom Mittagessen übrig, nur fünfundsechzig Cents für eine Packung M&Ms? Nein. Sie starrte durch das Glasfenster des Automaten auf die Packung M&Ms, als ihr auffiel, dass die erste Packung in der Reihe halb heraushing. Bevor sie richtig darüber nachdenken konnte, war sie aufgestanden und davor getreten. Vielleicht nur einmal kurz anstupsen, wie zufällig, so etwa ...
»Ruby? «
Sie fuhr herum und sah Kyla an der Eingangstür stehen.
»Mein Vater sagt, wir können dich nach Hause fahren.«
Ruby hörte, wie sich das Automatenfenster mit einem leisen Klicken wieder hinter ihr schloss.
Mr. Gudukas hatte ein hübsches Auto, dessen Rücksitz, auf dem Ruby und Kyla saßen, ganz aus weichem Leder gefertigt war. Mr. Guduka, der allein vorn saß, sah Ruby im Rückspiegel an.
»Wo genau wohnst du?«, fragte er.
Ruby nannte ihm die Adresse.
»Du bist doch Scott Gardners Tochter, richtig?«
»Ja.«
»Er und ich kennen uns schon eine Ewigkeit.«
Ruby nahm ein rotes und ein grünes M&Ms aus der Tüte, bevor sie sie Kyla reichte.
»Er war ein ziemlich guter Spieler damals. Er hat doch für die UConn gespielt, richtig?«
»Ja«, sagte Ruby. Sie hatte das grüne M&Ms auf die eine Seite ihres Mundes geschoben und das rote auf die andere. Sie schmeckten sehr, sehr gut.
»Ist das die Straße, in der du wohnst?«
»Ja.«
»Hübsch hier.«
Aber wenn er sich nicht sicher ist, ob Dad auf der UConn gewesen ist, dann können sie sich doch noch gar nicht so lange kennen, Dr. Watson.
»Sag mir rechtzeitig Bescheid, damit ich nicht an eurem Haus vorbeifahre.«
»Das Nächste ist es«, sagte Ruby.
Mr. Gudukas hielt am Straßenrand. Eine leere Dose Budweiser rollte unter dem Sitz vor Ruby hervor.
»Sehr hübsch«, sagte Mr. Gudukas und betrachtete das Haus. Er drehte sich um und lächelte ihr zu, obwohl sein Schnurrbart alles war, was sie erkennen konnte. Seltsam. Schnurrbärte, die sprechen konnten. Was immer es auch sein mochte, Ruby wollte es jedenfalls nicht hören.
»Seit wann wohnt ihr schon hier?«, fragte er.
»Schon vor der Zeit, als ich geboren wurde«, sagte sie und öffnete die Wagentür.
»Ist das da hinten Naturschutzgebiet?«
»Ja«, antwortete Ruby und stieg aus. Es war kalt.
»Wie viele Schlafzimmer?«
»Vier«, sagte Ruby. Das von Mom und Dad, Brandons Zimmer, ihr eigenes und das Zimmer am Ende des Korridors mit den Treppen davor, das leer stand.
Sie mochte es nicht, wenn sie an das leere Zimmer erinnert wurde. »Danke fürs Mitnehmen.«
»Jederzeit, mein liebes Kind«, sagte Mr. Gudukas.
Am Himmel zeigte sich bereits diese dunkelblaue und tiefrote Farbe, die Ruby nicht mochte; dieselbe Farbe, die auch der Grund des tiefen, kalten Meeres hatte. Im Haus war es ebenfalls stockdunkel. Sie wünschte plötzlich, sie hätte am Morgen die Lichter brennen lassen. Mrs. Lot kommt nach Hause, dachte sie, während sie die Haustür aufschloss. Ein seltsamer Gedanke, der jedoch eine wunderbare Unterschrift für einen dieser witzigen Far-Side-Cartoons abgeben würde. Aber welche Zeichnung würde schon ...
In dem Augenblick, als sie die Tür öffnete, stürzte Zippy heraus, schoss an ihr vorbei und lief schnurstracks in Richtung des Hauses der Strombolis von gegenüber. Seine Pfoten auf der Einfahrt, seine Bewegungen oder sonst etwas ließen die Außenlampen ihres Hauses mit einem Schlag wie eine Weihnachtsbaumbeleuchtung angehen. Zippy, ein riesiges Fellbündel, schoss in Richtung der Haustür der Strombolis und war über die ganze Straße hinweg im gleißenden Licht für jeden erkennbar. Er blieb vor der Eingangstür stehen, hob das Bein und ließ einen Schwall Urin darüber laufen. Es war so hell, dass Ruby sogar sehen konnte, wie der gelbe Strahl langsam an der Tür hinunterfloss. Das war zweifellos eines der schlimmsten Dinge, die Zippy überhaupt machen konnte. Die Strombolis hassten ihn, wahrscheinlich hassten sie sogar die ganze Familie. Nur wegen ihm. Überall im Haus gingen nun die Lichter an.
Ruby hatte einmal gelesen, dass Menschen in einer bedrohlichen Situation erstarren, dass sie vollkommen gelähmt sein können. Bis zu diesem Augenblick hatte sie nicht geglaubt, dass das möglich war. Doch nun gehörte sie offenbar ebenfalls zu diesen Menschen. Sie war unfähig, auch nur einen einzigen Schritt zurück ins Haus zu machen und die Tür zuzuschlagen, damit sie in Sicherheit war. In diesem Augenblick überquerte Zippy in ausgestrecktem Galopp die Straße, mit fliegenden Ohren und allen vier Pfoten gleichzeitig in der Luft. Als er das Rasenstück vor ihrem Haus erreichte, ging die Haustür der Strombolis auf. Ruby war nicht in der Lage, sich von der Stelle zu rühren. Mit weit aufgerissenen Augen rannte Zippy sie um, so dass sie in der Eingangshalle landete. Im Fallen schlug Ruby mit dem Fuß die Haustür zu, während ihr Rucksack und der Tennisschläger durch die Gegend flogen und die M&Ms über den Fliesenboden kullerten.
Ruby lag in der Dunkelheit und schnappte nach Luft, während Zippy hechelnd neben ihr saß. Sie dachte darüber nach, ob sie ihm sagen sollte, was für ein böser Hund er war, aber was sollte das nützen? Er war ein hoffnungsloser Fall, und ihr war klar, dass er noch zu viel schlimmeren Dingen in der Lage war.
»Wie der Hund von Baskerville«, sagte sie. »Das wäre erst schlimm.«
Aber er hörte ihr nicht einmal zu, sondern begann nach den M&Ms zu schnappen, die auf dem Boden herumrollten. Ruby stand auf und knipste die Lichter an. Wie die Ideen in Glühbirnenform in irgendwelchen Cartoons über den Köpfen der Figuren, dachte sie, während ihr aufging, dass Tennis und Mathematik eigentlich praktisch dasselbe waren, ebenso wie diese Minutentests und diese dämlichen Jeder-gegen-jeden- Spiele. Das Gepäck, das dieser Gedanke mit sich trug, lautete ...
Das Telefon klingelte, so dass sie vor Schreck zusammenfuhr und einen unterdrückten Schrei ausstieß, obwohl sie sich hätte denken können, dass genau das passieren würde. Hatten die Strombolis noch alle Tassen im Schrank? Glaubten sie im Ernst, dass sie abheben würde?
Der Anrufbeantworter sprang an. Ruby hörte, wie Mr. Stromboli wütend atmete, bevor er wieder auflegte. Zwei Sekunden später klingelte es wieder.
»Lassen Sie’s gut sein, Mr. Stromboli«, murmelte Ruby.
Der Anrufbeantworter schaltete sich erneut an. Doch dieses Mal waren keine wütenden Atemgeräusche zu hören. »Irgendjemand zu Hause?«, fragte Brandon. Ruby nahm den Hörer ab.
»Hey«, sagte er. Erleichterung durchflutete sie, als sie seine Stimme hörte.
»Wer ist zu Hause?«
»Ich.«
»Wer sonst noch?«
»Und Zippy. Weißt du, was er gerade ...«
»Vergiss den beschissenen Zippy.«
Dieser kurze Ausbruch traf Ruby völlig unvorbereitet. Sie schwieg.
»Ruby?«, sagte er, dieses Mal mit etwas freundlicherer Stimme. »Bist du noch da?«
»Ja.«
»Sag Mom und Dad, dass ich ein bisschen später komme.« »Wie spät?«
»Jesus ...«
»Sie werden danach fragen.«
»Okay, okay, nicht allzu spät. Ich bin noch bei Dewey.« Ruby hörte Rapmusik im Hintergrund. Es klang wie Unka Death.
»Wir arbeiten noch an einem Aufsatz«, fügte Brandon hinzu.
»Zu welchem Thema?«
»Was geht dich das an?« Er legte auf, ohne sich zu verabschieden.
Es hatte sie einfach nur interessiert, das war alles. Der typische Großer-Bruder-Quatsch, also nichts, um einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden, dennoch fiel Rubys Blick sofort auf das gerahmte Farbfoto, das in der Diele über dem Tisch hing, wo jeder es auf den ersten Blick sehen konnte. Das Foto, auf dem die ganze Familie am Strand in Jamaika abgebildet war, war ein paar Jahre zuvor aufgenommen worden, als Brandon nicht viel älter war als sie heute. Alle auf dem Bild lächelten, außer Ruby, die sich vor Lachen ausschüttete. Brandon stand hinter ihr und hatte ihr eine Hand auf die Schulter gelegt.
Ruby ging in die Küche. Durch das hinterste Fenster sah sie die Mondsichel, die über der dunklen Masse des Waldes hing. Die Luft war ganz klar, vielleicht sah sie die Konturen heute auch besonders scharf, denn zwei Punkte auf der Mondsichel stachen ganz besonders hervor. Sie knipste die Lichter an, und die Außenwelt verschwand vor ihren Augen.
Strahlen – so hießen diese Arme der Sterne! Manchmal brauchte sie einfach eine Ewigkeit. Zippys Wasserschüssel war schon wieder leer, und sie füllte sie auf.
»Wie wär’s mit Hot Dogs?«, sagte sie zu sich selbst. Klang gut. Sie nahm ein Päckchen davon aus dem Gefrierfach. Hot Dogs schmeckten besser, wenn man sie auf dem Grill zubereitete, und Ruby wusste auch, wie man ihn bediente. Man musste das Gas aufdrehen, dann den Knopf drücken, wodurch die Flamme entzündet wurde, aber sie hatte keine Lust, auf die Veranda hinauszugehen. Nicht wegen der Dunkelheit, ganz und gar nicht, keine Sekunde hatte sie daran gedacht. Es war ganz einfach zu kalt zum Grillen, das war alles.
Ruby erwärmte zwei Hot Dogs, als sie bemerkte, dass keine Brötchen mehr da waren, also legte sie sie zwischen zwei Brotscheiben und setzte sich an den Tisch. Sie gruppierte alles um sich, was sie benötigte: Senf, Gewürze, Sprite und Die gesammelten Werke von Sherlock Holmes. Das Wohnzimmer in der Baker Street 22 i-B Anfang April 1883 erwachte zum Leben und begann vor ihren Augen zu materialisieren.
Es ist gefährlich, einen Mann wie mich zum Narren zu halten\, sagte Dr. Roylott, der Stiefvater der verängstigten jungen Dame. Er griff nach Holmes7 Schürhaken und verbog ihn mit seinen riesigen braunen Händen.
Die Hände waren deshalb so braun, weil er jahrelang in Indien gelebt hatte. Und aus demselben Grund liefen auch ein Gepard und ein Gorilla in seinem Landhaus herum, das langsam zusammenzufallen begann. Wahnsinn!! Aber es gab weder Geparde noch Gorillas in Indien: Afrika, mein lieber Watson,