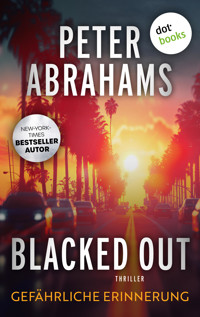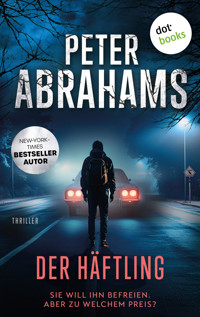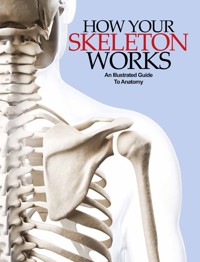9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Roy, ein berühmter Bildhauer, hat den Unfalltod seiner Frau Delia nie verwunden, auch wenn er sein Leben immer entschlossen weitergelebt hat. Als bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert wird, weiß er, dass seine Tage gezählt sind. Aus Eitelkeit heuert er einen jungen Hacker an, um herauszufinden, ob die New York Times schon seinen Nachruf fertig hat. Bei der nicht ganz legalen Recherche stößt Roy auf Ungereimtheiten über den Tod seiner Frau. Kurz darauf wird der Journalist ermordet, der den Nachruf verfasst hat, und Roy muss feststellen, dass er sich in ein lebensgefährliches Labyrinth aus Täuschung und Lüge verstrickt hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Peter Abrahams
Verblendet
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Frauke Czwikla
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Für Molly Friedrich
Was schließlich dabei herauskommt, ist das Ergebnis verworfener Funde.
Picasso
Eins
Manchmal leben die Toten in unseren Träumen weiter. Delia war äußerst lebendig, als sie mit nackten baumelnden Beinen auf einer Terrassenmauer hoch über einer tropischen Bucht saß. Sie hatte nie besser ausgesehen – die gebräunte Haut straff und schimmernd; ihre Augen, hellbraun mit goldenen Flecken darin, zwinkerten, wie sie es immer taten, wenn sie im Begriff stand, eine witzige Bemerkung zu machen. Ihr Mund war geöffnet – Sonnenlicht glitzerte auf ihrem Lipgloss –, und sie redete, jedoch so leise, dass man sie nicht verstand. Es war zum Verrücktwerden. Dann steuerte der nicht schlafende Teil seines Hirns die Erkenntnis bei, dass die funkelnde Bucht irgendwo an der venezolanischen Küste lag, und der tropische Sonnenschein verblasste. Venezuela: Allein das Wort hatte noch immer destabilisierende Wirkung.
Direkt unter der Haut an Delias Schläfe pulsierte eine Ader, eine hervorstehende blaue Ader, geformt wie ein Blitz. Sofort wechselte das Wetter, eine kühle Brise kam auf und zerzauste ihre Haare. Es wurde ungemütlich. Roy streckte den Arm aus, um über ihre Locken zu streichen, doch die Haare, die er berührte, waren nicht Delias: feiner und glatt, nicht lockig.
Er schlug die Augen auf. Winterlicht, vereistes Fenster, Poster von Skiläufern an den Wänden, Jens Zimmer.
»Ich habe es immer gehasst, wenn Männer das getan haben«, sagte Jen, ihre Stimme noch schlaftrunken.
Roy drehte den Kopf. Die Augen, die ihn beobachteten – blassblau, nicht braun –, waren auf ihre Art sehr hübsch. »Was getan haben?«, fragte er.
»Mein Haar berührt.«
Er zog die Hand zurück. Blonde Haare, nicht braun; jenes besondere Braun, ebenfalls mit goldenen Strähnen.
»Aber bei dir ist es okay.« Jen wartete, vermutlich darauf, dass er etwas sagte oder tat. Roy fiel nichts ein. Ihre Gesichter waren dreißig Zentimeter voneinander entfernt. Jen war sehr attraktiv, ihre Haut ein bisschen wettergegerbt, doch Roy gefiel sie deswegen umso besser. Die Überreste des Traums lösten sich in winzige Fetzen auf und verschwanden.
»Geht es dir gut?«, fragte Jen.
»Sehr gut.«
Unter der Decke presste sie ihr Bein an seins. »Ich habe gestern eine Nachricht bekommen. Aus heiterem Himmel.«
»Eine gute?«, fragte Roy.
»Ich glaube schon – ein Stellenangebot.«
»Was für eine Stelle?«
»Dasselbe, was ich jetzt auch mache.« Sie leitete die Skischule am Mount Ethan, zwanzig Minuten von ihrer Eigentumswohnung entfernt. »Aber in wesentlich größerem Maßstab, und das Gehalt ist doppelt so hoch.«
»Wo?«, fragte Roy und dachte an Stowe, oder vielleicht Killington, ein wenig weiter.
Jen senkte den Blick. »Keystone«, sagte sie.
»In Colorado?«
Sie nickte. Dann traf ihr Blick wieder seinen, vielleicht in dem Versuch, in sein Inneres zu sehen, ihn zu lesen.
»Nun«, sagte Roy. Und hätte fast ein Warum heiraten wir nicht? folgen lassen. Warum nicht? Sie lebten jetzt seit zwei Jahren so, zwischen Affäre und gemeinsamer Wohnung. Gab es einen Grund, den nächsten Schritt zu unterlassen? Kein Mangel an gemeinsamem Wohlbefinden, kein Mangel an Zuneigung, an sexuellem Feuer. Ein Altersunterschied, ja – er war fast siebenundvierzig, Jen vierunddreißig –, außerdem wünschte sie sich Kinder und er nicht mehr, aber na und? Roy lächelte sie an.
»Nun was?«, fragte sie.
Und er wollte gerade damit herausplatzen – warum heiraten wir nicht? –, als ihm der Gedanke kam, dass dieses Herausplatzen nicht das Richtige war. Das konnte er besser. Und wäre außerdem ein formellerer Rahmen, zum Beispiel am Freitagabend bei Pescatore, nicht angemessener? Deshalb begnügte er sich für den Moment mit: »Glückwunsch.«
»Glückwunsch?«
»Zu dem Stellenangebot.«
»Oh«, sagte Jen. »Danke. Ich muss natürlich noch darüber nachdenken. Colorado ist weit.«
»Ich verstehe«, sagte Roy, der aus der letzten Bemerkung über die Entfernung schloss, dass sie am Freitag Ja sagen würde. In zwei Tagen. Er kam sich sehr gerissen vor.
Jen stand auf und ging ins Bad. In dem Moment, in dem er die Dusche hörte, griff Roy nach dem Telefon und reservierte Pescatores besten Tisch für neunzehn Uhr dreißig am Freitagabend. Als er auflegte, überfiel ihn plötzlich eine Erinnerung: an seinen einzigen anderen Heiratsantrag. Nachts, im winzigen Schlafzimmer des Appartements in Foggy Bottom, seiner ersten eigenen Wohnung, das Blaulicht eines vorüberfahrenden Streifenwagens blitzte über Delias Gesicht. Damals war er einfach damit herausgeplatzt.
Roy lebte in einer umgebauten Scheune auf halber Strecke nach Osten durch das Ethan Valley, ursprünglich ein Ferienhaus, das er und Delia billig gekauft hatten. Kein Geld damals – Delia war noch neu am Hobbes Institute, einer Denkfabrik, die sich auf ökonomische Probleme der Dritten Welt spezialisiert hatte, und Roys Werke hatten noch nicht begonnen, sich zu verkaufen. Eine baufällige Scheune, komplett mit Fledermauskolonie und hausbesetzendem Hippie. Delias Gesicht strahlte beim ersten Anblick. Sie renovierten selbst, was bedeutete, dass Roy renovierte, während Delia unmögliche Vorschläge machte, wie eine Prinzessin im Märchen. Diese Seite an ihr – Delia hatte kurz zuvor ihren Doktor in Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Georgetown gemacht – war etwas, das sie nur ihm zeigte. Was die eigentlichen Renovierungsarbeiten betraf, benötigte Roy keine Hilfe. Er war schon immer handwerklich begabt gewesen. Andere Bildhauer, die er kannte, hatten Schweißen gelernt, um ihre Kunst auszuüben; er war der Einzige, bei dem es umgekehrt gelaufen war. Er hatte während der Schulzeit und im College jeden Sommer bei King’s Machining and Metal Work-up in der kleinen Stadt in Maine gearbeitet, aus der er stammte.
Jetzt, in diesem Augenblick – ein paar Stunden nachdem er sich von Jen verabschiedet hatte –, klemmte er in einer Art gebrochenem Bogen, der hauptsächlich aus Autokühlern bestand, die an den Kanten in jeweils leicht versetzten Winkeln aneinandergeschmiedet waren. Ihn erinnerte das an ein Daumenkino – eine Wirkung, die er nicht beabsichtigt hatte und von der er nicht wusste, ob sie ihm gefiel. Außerdem befand er sich fünfeinhalb Meter über dem Boden – fast ganz oben auf der Leiter nahe des Scheunendachs, Sauerstoff und Acetylen in einer Art umgekehrter Tauchvorrichtung auf den Rücken geschnallt –, und das Bogenformen hatte gerade erst begonnen. Roy stand dort oben, eine Hand auf der Leiter, die andere am Schweißgerät, und wartete auf eine Eingebung. Er konnte spüren, wie hier und dort in seinem Kopf Schemen Gestalt annahmen, doch sie weigerten sich, aus den Schatten zu treten, sichtbar zu werden, sich von ihm greifen zu lassen. Tief unter ihm begann das Telefon zu läuten.
Der Anrufbeantworter sprang an. »Hi«, sagte Murph von Murphs Schrotthandel, Roys größter Lieferant. »Murph hier. Ich hab vielleicht was für dich.« Klick.
Roy kletterte die Leiter hinunter. Auf der letzten Sprosse passierte etwas sehr Seltsames: Ihm ging die Luft aus. Roy war in so guter Form, war schon so lange in so guter Form, dass er es beinah nicht hätte benennen können, eine ganz alltägliche Sache wie Kurzatmigkeit. Hatte er sein Training vernachlässigt? Gestern war er von der Scheune zum Langlaufski-Parkplatz und zurück gelaufen, sieben Meilen, und am Sonntag hatte er den ganzen Vormittag auf Schneeschuhen auf der Loipe am unteren Gebirgshang verbracht, wo er eine Gruppe von Läufern im College-Alter überholte, die ein Rennen liefen, von dem er nichts gewusst hatte. Was dann? War er nervös wegen Freitagabend? Das musste es sein. Ein Mann war niemals zu alt, um nervös zu werden, auf ungewöhnliche Art ärgerlich, aber wahr, zumindest in seinem Fall.
Am späten Nachmittag fuhr Roy hinunter ins Tal zu Murph, wobei er an der Grünfläche in Ethan Center vorbeikam. Neandertal Nummer neunzehn, die letzte der Serie, mit der er sich einen Namen gemacht hatte, stand an einem Ende. Er hatte sie nicht lange nach Delias Tod der Stadt geschenkt.
Roy gefiel ihr Anblick im Winter, wenn Schnee die glatten Flächen rundete und so irgendwie die Neandertal-Charakteristika betonte. Charakteristika, die er nicht beabsichtigt hatte, nicht bewusst. Der Name der Serie und das sichere Gefühl, etwas Neandertalerhaftes in den riesigen Formen zu erblicken, stammten von Delia; der Hauptgrund, hatte Roy immer geglaubt, warum die Serie und seine gesamte Karriere so abgehoben hatten.
»’nen Kurzen?«, fragte Murph. Sie saßen in seinem Büro mit Blick auf den Hof. Ohne die Antwort abzuwarten, kippte Murph Jack Daniels in zwei nicht zueinander passende Becher und ließ den mit dem Valvoline-Logo über den Tisch zu Roy gleiten. »Du auch, Skippy?«, rief Murph über die Schulter.
»Ich was?«, fragte Skippy, der über einen Computer gebeugt in einer Ecke kauerte. Skippy war Murphs Neffe, ein pickliger Junge, der vor ein paar Wochen die Valley High School geschmissen hatte.
»Einen Kurzen«, sagte Murph.
»Nö, ich verzichte«, lehnte Skippy ab, während er ölverschmierte Tasten drückte.
Murph hob den Becher. »Auf den Schrott.«
»Schrott«, wiederholte Roy. Klonk.
»Warte, bis du es siehst«, sagte Murph.
»Was ist es?«, fragte Roy. Er spähte durch die schmierigen Scheiben. Leichter Schnee fiel auf die Unmengen von Gerümpel und Schrott in Murphs Hof, die von der hinter den Bergen sinkenden Sonne in ein oranges Licht getaucht wurden.
»Du wirst es nicht glauben«, sagte Murph.
»Versuch’s mal«, entgegnete Roy.
»Skippy«, kommandierte Murph, »geh mal raus auf den Hof und hol das Ding.«
»Ding?«, sagte Skippy.
»Für Mr. Valois. Über das wir vorhin gesprochen haben, Mensch.«
Skippy rollte seinen Stuhl zurück und stapfte aus der Tür, die Stiefel offen, das fettige Haar in den Augen.
»Der Junge meiner Schwester«, sagte Murph.
»Ich weiß.«
»Hat die Schule geschmissen.«
»Hab ich gehört.«
»Was soll ich bloß mit ihm machen?«
Die Tür öffnete sich, und Skippy trat wieder ein, Schneeflocken im Haar und ein verdrehtes Stück Metall in den Händen. Er legte es auf den Tisch. Ein wie eine Krone geformtes Stück Stahl, ein fast perfekter Kreis, aber viel zu groß für einen menschlichen Kopf, bestehend aus zwei verflochtenen, geschwärzten … was?
»Erkennst du’s?«, fragte Murph.
»Nein.«
»Rotorblätter«, erklärte Murph. »Von dem Helikopter, der letzten Monat über Mount Washington runtergekommen ist.«
Roy hob es auf; schwerer, als er erwartet hatte, und kalt vom Liegen im Hof. Eine sonderbare Mischung aus Schönheit und Hässlichkeit – Dornenkrone, schoss ihm durch den Kopf, und dann Ehering.
»Stell dir mal vor, was da für Kräfte am Werk waren«, sagte Murph. »Hier zum Beispiel, wo es ganz auseinandergezogen ist.« Murph produzierte ein Comic-Geräusch wie reißendes Metall.
Roy wusste einiges über die Kräfte, die ein Helikopterabsturz entfesselte. Er stellte das Ding ab, die Hände nicht ganz ruhig. »Was soll es kosten?«, fragte er.
»He, Skippy«, rief Murph. »Hab ich’s dir nicht gesagt?«
Skippy, wieder am Computer, murmelte: »Was gesagt?«
»Dass er es haben will.« Murph goss Jack Daniels nach. »Ich werde noch zu einem von diesen … wie heißen die noch?«
»Kunstliebhaber«, sagte Skippy, ohne aufzuschauen.
Murph warf ihm einen Blick zu, seine buschigen Brauen hoben sich. »Genau, Kunstliebhaber.« Er schnippte mit seinem dreckigen Fingernagel gegen das Ding. »Wie klingen zwanzig Dollar?«
»Zehn«, sagte Roy.
Sie einigten sich auf fünfzehn.
Roy legte das Ding auf die Ladefläche seines Pick-ups und fuhr Murphs Auffahrt hinunter. Aber er hatte noch nicht einmal das Tor erreicht, als er feststellte, dass er bremste, als hätte sein Fuß das Denken übernommen. Roy stieg aus und holte das Ding in die Fahrerkabine, legte es auf den Beifahrersitz. Kein Ding, ein Stück – das wichtigste Stück, das wusste er jetzt schon – in der gebrochenen Bogenform, die in der Scheune wuchs. Diese Krone, dieser Ring, besaß eine ganz eigene Ausstrahlung. Er konnte sie spüren, auf dem Sitz neben sich.
In dieser Nacht tobte ein heftiger Sturm durch das Tal. Schnee, Eisregen und wieder Schnee und genug Wind, um an den Fenstern der Scheune zu rütteln; doch Roy oben auf seiner Leiter merkte nichts davon. Ein gebrochener Bogen aus alten Kühlern, ein geschundener Ring aus Helikoptertrümmern, selbst der Daumenkino-Effekt – alles griff ineinander, obwohl ihm die Bedeutung erst nach und nach im Verlauf der Nacht aufging. Die Herausforderung lag darin, die verlockende Vorstellung zu bekämpfen, dass diese verdrehten Rotorblätter der Schlussstein des Bogens waren, das fehlende Stück, auf das der gebrochene Bogen wartete, um ganz zu werden. Der Bogen war gebrochen, würde immer gebrochen sein. Der Ring war nicht mehr als eine gescheiterte Möglichkeit, nur ein Traum. Deshalb konnte er die Lücke auf keinen Fall symmetrisch füllen, konnte nicht sauber passen. Er durfte nicht passen, musste zerbrechlich wirken, als könnte die gesamte Struktur jeden Moment auseinanderfallen. Das zu erreichen war das Problem.
Von Roy hinter seinem dunklen Visier unbemerkt, färbte die Dämmerung die Fenster in einem hellen Milchton, als er endlich glaubte, es gelöst zu haben. Die Schweißnähte – er verwendete letztendlich nur drei – waren so grob, nachlässig und sichtbar wie nur möglich, und die sauberste bearbeitete er mit dem Schweißbrenner, trennte die halbe Verbindung auf, spielte ein wenig fahrlässig mit der Hitze und zernarbte erneut, was bereits entstellt war. Dann schweißte er noch ein wenig aufs Geratewohl herum, nur zum Spaß. Ein brutaler Drang stieg in ihm auf, so als wollte er jemandem ins Gesicht schlagen.
Schweiß tropfte Roy vom Gesicht, als er die Leiter hinabstieg. Er schob das Visier zurück, umrundete sein neues Werk, inspizierte es aus allen Winkeln, besonders aus den schlimmsten.
Er dachte: Ja. Und dann: Vielleicht. Roy lief immer noch hin und her, als er schließlich nach draußen sah, die hohen Wehen erblickte, die gebeugten Bäume, deren Äste im Schnee steckten wie von Riesen geschleuderte Speere. In diesem Moment traf ihn der Titel: Delia. Nicht Delia Nummer eins. Dies war Anfang, Mitte und Ende. Er begann zu begreifen, was das Werk bedeutete: Kulmination. Und deshalb begann er, sich im selben Moment auf Freitagabend im Pescatore zu freuen, sehr zu freuen.
Roy streifte seinen Rucksack ab. Er holte tief Luft, eine dieser kleinen körperlichen Gesten der Zufriedenheit, Vollendung, des Wissens um verdiente Ruhe, die vor ihm lag. Beim Ausatmen spürte er ein leises Kratzen in der Kehle. Er hustete. Zunächst nur ein leichtes Husten, und das Kratzen verschwand, aber aus irgendeinem Grund konnte Roy nicht aufhören zu husten. Er lief in die Küche, unentwegt hustend, drehte den Hahn auf und stürzte kaltes Wasser hinunter.
Das beendete das Husten, aber nur für ein oder zwei Sekunden. Dann ertönte ein tiefes, steinerweichendes Geräusch, das seinen Hals aufriss, zu mächtig und drängend, um es noch Husten zu nennen, und das Wasser schoss in einem Schwall wieder heraus. Es stockte im Ausguss und färbte sich rot – erst rosa, dann karmesin –, während es langsam abfloss.
Roys nächster Atemzug war normal, auch der übernächste und der danach. Er versuchte sich zu erinnern, wann er das letzte Mal die Nacht durchgemacht hatte, und konnte es nicht. Nie wieder, alter Mann. Irgendwo draußen sprang eine Kettensäge an.
Zwei
Wow«, sagte Krishna Madapan, Roys Galerist, während er die Delia umrundete. Freitagmorgen, die Straßen waren wieder frei, und Krishna hatte auf dem Weg von New York nach Stowe, wo er das Wochenende verbringen wollte, bei ihm haltgemacht. Er war wie üblich von Kopf bis Fuß kosmopolitisch schwarz gewandet, obwohl er heute in Skihosen und Nerzmantel halb ländlich, halb städtisch wirkte. »Darf ich mir erlauben, eine Meinung zu äußern, Roy?«
»Was, wenn ich nein sage?«, erwiderte Roy.
Krishna zwinkerte – seine einzige Reaktion, wann immer etwas drohte, ihn aus dem Konzept zu bringen – und fuhr fort. »Dies ist dein bestes Werk«, sagte er. »Das soll deine anderen Werke nicht verunglimpfen oder herabsetzen, verstehst du, aber – schlicht das beste.«
»Ich weiß nicht«, meinte Roy und betrachtete die Skulptur. Heute konnte er nichts als Makel entdecken.
»Selbstverständlich nicht«, sagte Krishna. »Deshalb bist du ja, was du bist. Und ich, was ich bin, möchte ich hinzufügen.«
Roy begriff nicht ganz, doch ehe er um eine Erklärung bitten konnte, hatte Krishna sein Handy hervorgeholt. »Wen rufst du an?«, fragte Roy.
»Meinen Fahrer«, antwortete Krishna.
Roy blickte aus dem Fenster und sah, dass Krishna per Limousine reiste. Der Fahrer legte gerade seine Zeitung zur Seite und klappte sein eigenes Handy auf.
»Seien Sie ein guter Junge«, wies Krishna ihn an, »und bringen Sie mir meine Kamera.«
Der Fahrer schnitt eine Grimasse, die nur Roy sah. Ein paar Sekunden später lief er auf seinen lederbesohlten Straßenschuhen schlitternd und schlingernd den Pfad hinauf, die Kamera in der Hand. Krishna fotografierte die Delia aus jedem erdenklichen Blickwinkel.
»Dies Objet trouvé dort oben«, bemerkte er. »Ich kann es beim besten Willen nicht identifizieren.«
Roy erklärte ihm, um was es sich handelte.
»Aha«, sagte Krishna und warf Roy einen Seitenblick zu. Er hatte Delia gekannt, tatsächlich hatte sie die beiden zusammengebracht. »Dein allerbestes«, wiederholte Krishna, leise diesmal, vielleicht zu sich selbst, möglicherweise sogar bewegt. Er schlug den Kragen seines Nerzmantels hoch, als wäre die Temperatur gefallen.
Dann bemerkte er, dass auch der Fahrer an der Skulptur hinaufstarrte, den Mund leicht geöffnet. »Bitte, wie lautet Ihr Name?«, fragte er.
»Luis«, erwiderte der Fahrer, der sich rasch umdrehte, als hätte man ihn bei etwas Unanständigem ertappt.
»Und was halten Sie von diesem Kunstwerk, Luis?«, erkundigte sich Krishna.
»Ich?«, sagte Luis.
»Sie.«
Luis leckte sich die Lippen. »Das sind Kühler, oder?«
Krishna nickte. »Gewöhnliche Autokühler.«
»Das habe ich mir gedacht«, sagte Luis. »Aber es ist trotzdem Kunst, nicht?« Er betrachtete die Skulptur einen Moment. »Schräg.«
»Wie schräg?«, fragte Krishna.
»Wie schräg?«, wiederholte Luis. »Es erinnert mich irgendwie an …« Abrupt verfiel er in Schweigen.
»An?«, sagte Krishna.
»Diesen einen Stau auf dem L. I. E.«
»Dem L. I. E.?«, wiederholte Krishna.
»Sie wissen doch, wie das auf dem Long Island Expressway ist«, sagte Luis. »Aber das ist schon ein paar Jahre her, Eisregen. Alle fuhren ganz langsam, aber das half auch nichts, weil es trotzdem eine Massenkarambolage gab, direkt vor mir, wie in Zeitlupe.«
»Eine Massenkarambolage in Zeitlupe?«, fragte Krishna. Er warf Roy einen bedeutungsvollen Blick zu, als hätte er etwas unter Beweis gestellt.
Einen bedeutungsvollen Blick, den Luis falsch verstand. »War nicht böse gemeint«, beteuerte er. »Absolut nicht.« Er sah Roy an. »Sind Sie der Künstler?«
Roy nickte.
»Ich wollte Sie nicht beleidigen«, sagte Luis.
»Hab ich auch nicht so verstanden«, erwiderte Roy.
Tatsächlich war es eine gute Kritik. Und da sie von einem Chauffeur stammte und nicht von irgendeinem New Yorker Kritiker mit Gott weiß was für einem Terminkalender, sollte man sie vermutlich hoch schätzen. Roy fühlte sich auf einmal großartig, sogar noch besser als in dem Moment, in dem Krishna beim Hinausgehen seine Hand schüttelte und sagte: »Das hier wird im ersten Absatz deines Nachrufs Erwähnung finden, mein Freund. Und noch wichtiger, ich habe bereits einige Käufer im Kopf. Die dicksten der dicken Geldsäcke.« Er lachte. Roy lachte auch; nicht wegen der Aussicht auf einen guten Verkauf, denn seine Bedürfnisse waren einfach, und er besaß bereits mehr als genug, sondern nur, weil Krishna so viel Freude aus dem Leben zog.
Er begleitete sie nach draußen. Luis öffnete Krishna die hintere Autotür. Krishna stieg ein, wobei er sorgsam seinen Nerzmantel raffte. Trotzdem klemmte die Tür eine Ecke ein, was niemand außer Roy bemerkte.
Er lief auf dem Pfad zurück. Abschnitte der Delia erschienen in den drei Fenstern, ein Effekt, der ihn innehalten ließ. Er stand immer noch dort, als ein verrosteter Sedan mit qualmendem Auspuff vorfuhr. Skippy stieg aus.
»Mr. Valois?«, sagte er, und eine Atemwolke stieg über seinem Kopf auf.
»Ja?«
»Äh.« Weitere Atemwolken erhoben sich, wie Rauchsignale.
»Was ist denn, Skippy?«
Skippy räusperte sich. »Die Sache ist so, na ja, mehr oder weniger, ich habe mir Ihre, äh, Ihr Skulpturendings angesehen, das auf der Grünfläche.« Pause. »Ich hab es im Vorbeigehen bestimmt schon tausendmal gesehen, aber gestern bin ich hingegangen, um es mir anzuschauen, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Und?«
»Und, äh, Onkel Murph sagt, Sie beißen nicht.«
»Ich beiße nicht?«
»Warum gehst du nicht einfach rüber und fragst ihn? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er nein sagt.«
»Mich was fragen?«
»Tja«, sagte Skippy. »Deswegen bin ich hier. Hoffe, ich komme nicht ungelegen oder so.«
Das Ganze wurde allmählich ein wenig unerträglich, besonders bei zwanzig Grad unter null. Und Skippy zog sich – anders als die Skiläufer, Antiquitätenjäger und Feriengäste – nicht der Kälte angemessen an. Heute trug er Jeans, eine leichte Jacke, offen, und Turnschuhe. Keine Handschuhe, keine Mütze und eine laufende Nase.
»Komm rein«, forderte Roy ihn auf.
»Ehrlich?«, fragte Skippy. »Tja, in Ordnung.«
Skippy trat ein. Er sah sich um. Sein Blick landete auf der Delia und blieb dort. »He«, sagte er. »Dafür wollten Sie die ganzen Kühler.«
»Ja.«
»Und das Rotordings – es ist da ganz oben.« Skippy umrundete die Grundfläche, den Kopf im Nacken, ein oder zwei Zähne gammelten bereits. »Wie hoch ist das eigentlich?«
»Sieben Meter vierzig bis zu dem gebogenen Flügel«, sagte Roy.
»Ist das Nummer zwanzig?«, fragte Skippy. »Von den Neandertalern?«
»Nein.«
»Sieht auch nicht aus wie ein Neandertaler«, meinte Skippy. »Das waren Höhlenmenschen, oder?«
Roy nickte.
»Und was für eine Geschichte hat die hier?«
Roy lächelte. »Schwer in Worte zu fassen.«
»Entschuldigung«, sagte Skippy. Seine Augen hatten selbst hinter diesem herabhängenden Schirm fettiger Haare Schwierigkeiten, Roys Blick zu begegnen.
»Du musst dich nicht entschuldigen«, sagte Roy. Er berührte die nächste Säule des Bogens. »Es heißt Delia.«
Skippy schaute genauer hin. »Das ist also irgendwie eine echte Person?«
»Nicht genau.«
»Eine ausgedachte?«
»Nein. Es ist über eine echte Person, würdest du vermutlich sagen, aber keine Darstellung von ihr.«
»Also gibt es eine Delia?«
»Meine erste – meine Frau«, sagte Roy. »Sie ist vor ungefähr fünfzehn Jahren gestorben.« Vor vierzehn Jahren, acht Monaten, zwei Wochen, um ganz genau zu sein.
»Oh.«
Schweigen breitete sich zwischen ihnen aus, keineswegs unangenehm. Dreißig Sekunden vergingen, vielleicht mehr. Roy kam es vor, als befänden sich drei Personen im Raum, die hervorragend miteinander auskamen. »Bei einem Hubschrauberabsturz«, erklärte er. »In Venezuela.«
Skippys Blick huschte zu den verdrehten Rotorblättern über ihnen.
»Delia wollte ihnen beibringen, wie man Ananas anpflanzt«, sagte Roy. »Sie hatte alles ausgearbeitet – Anbauflächen, Marketing, Bewässerung, alles.«
Skippy sagte: »Weiß Onkel Murph, wie sie, äh, wie sie …«
Roy schüttelte den Kopf. »Damals kannte ich deinen Onkel noch nicht.«
Und Roy sprach im Allgemeinen nicht viel über Delia. Wenn die Sprache auf ihren Tod kam, sagte er gewöhnlich nur »Flugzeugabsturz«. So hatte Tom Parrish, Delias Boss, es bei jenem ersten Anruf genannt. Ich fürchte, ich habe schlimme Nachrichten, Roy. Die Einzelheiten – Gewitter, technisches Versagen, Helikopter – waren erst später geliefert worden, zusammen mit der Leiche.
»Oh«, sagte Skippy.
Eigentlich zwei Leichen, da Delia damals im dritten Monat schwanger gewesen war.
»Wie alt bist du, Skippy?«
»Sechzehn«, sagte Skippy. »Aber ich bin zuverlässig – fragen Sie Onkel Murph.«
»Das bezweifle ich nicht«, sagte Roy. Sein Blick wurde von drei Pickeln auf Skippys Wange angezogen, die ein entzündetes kleines Dreieck formten.
»Also«, sagte Skippy. Er räusperte sich und setzte neu an. »Ist das ein Ja?«
»Wie lautet die Frage?«
Skippy lief rot an, wobei sich alle seine Pickel irgendwie weiß verfärbten. »Assistent«, sagte er. »Ein Job. Teilzeit, schweres Zeug heben, saubermachen, solche Sachen.«
»Du möchtest mein Assistent werden?«, fragte Roy.
Skippy nickte.
»Was ist denn mit dem Job bei deinem Onkel?«
»Onkel Murph hat nichts für mich zu tun. Er versucht einfach nur, meiner Mutter das Leben zu erleichtern, verstehen Sie?«
»Was macht sie?«
»Putzt Eigentumswohnungen in den Bergen. Und kellnert ein bisschen.« Langes Schweigen folgte. »Am Computer bin ich nicht schlecht«, sagte Skippy.
Roy hatte nie einen Assistenten gehabt, nie einen gebraucht. Er traf eine Entscheidung. »Warum kommst du nicht erst mal für ein paar Stunden. Wir versuchen, uns was auszudenken.«
»Echt?«, sagte Skippy. »He, danke.«
Seine rechte Hand zuckte, als wüsste sie, dass eigentlich ein Händedruck angebracht war. Doch wurden keine Hände geschüttelt. Skippy bewegte sich zur Tür. »Vielen Dank.« Er öffnete die Tür, trat hinaus, schloss sie. Dann ein Klopfen.
»Herein«, sagte Roy. Er schloss nie die Tür ab. Der Knauf drehte sich, aber die Tür blieb geschlossen. Irgendwie hatte Skippy sie verriegelt. Roy öffnete die Tür.
»Um wie viel Uhr?«, fragte Skippy.
»Wie wär’s mit zwei?«, schlug Roy vor.
»Cool«, sagte Skippy.
Jen betrat das Pescatore, sie sah großartig aus. Roy erhob sich, bot ihr einen Stuhl an, half ihr, ihn an den Tisch zu rücken. Sie warf ihm über die Schulter einen Blick zu. »Was ist denn mit dir los?«
»Nichts, nur mein ganz normales Selbst«, sagte Roy.
»Bestimmt.«
Vor den Fenstern erhob sich der Berg, dessen untere Hänge für nächtliche Skifahrten erleuchtet waren. Die Buckel von Wipe Out warfen runde Schatten, wie Hunderte kleiner Löcher. Ein Skiläufer in Weiß sprang einen perfekten Daffy, schwenkte nach rechts und verschwand hinter einem Fichtengehölz.
»Wie klingt Champagner?«, erkundigte sich Roy.
Jen produzierte ein leises Blubbergeräusch.
Roy lachte und bestellte eine Flasche Pommery. Er kannte sich mit Champagner absolut nicht aus, aber Pommery war das, was Krishna bei Vernissagen servieren ließ, wenn er wirklich an den Künstler glaubte.
»Lecker«, sagte Jen, nachdem sie einen Schluck getrunken hatte. »Hast du etwas zu feiern?«
Roy probierte den Champagner; wirklich gut, aber irgendwie bekam er ihn in den falschen Hals, ein Kratzen in der Kehle, nur ganz leicht. Dies war der richtige Moment, um gleich hoffentlich schon zu erwidern. Jen würde fragen, was er damit meinte, und er würde ihr die Frage stellen. Wahrscheinlich wäre alles genauso gelaufen, aber dieses Kratzen im Hals … Er hustete, zunächst ein zartes, leises Husten, setzte seine Champagnerflöte ab und führte die Serviette zum Mund. Doch das Husten hatte gerade erst begonnen, wie ein starker Motor, der warmlief. Er fiel in ein tiefes, rasselndes Register und dauerte an und an und an.
»Trink einen Schluck Wasser«, sagte Jen und reichte ihm ein Glas, die Augen weit aufgerissen.
Aber zu diesem Zeitpunkt hatte Roy die winzigen roten Sprenkel auf dem weißen Leinen entdeckt. Er machte eine »Entschuldige, ich muss mal aufstehen«-Geste und lief zur Toilette.
Leer. Er hastete in eine Kabine, beugte sich über die Toilette, überließ sich dem Husten. Der Husten machte sich an die Arbeit, zeigte ihm diesmal wahrhaftig, wozu er imstande war. Blut füllte die Toilettenschüssel, in Spritzern, Rinnsalen, Klumpen.
»He, Kumpel«, sagte jemand vor der Tür. »Alles in Ordnung?«
Der Husten erstarb sofort, als würde er Ungestörtheit bevorzugen. Roy holte keuchend Luft. »Alles bestens«, antwortete er, aber mit einer Stimme, die wesentlich älter als seine klang.
Schweigen. Dann folgten leise Schritte auf den Fliesen. Schritte, die er nicht hatte eintreten hören, gefolgt von Urinalgeräuschen, Spülungsgeräuschen, Türgeräuschen. Roy verließ die Kabine, nur ein bisschen wacklig. Er hatte die Herrentoilette wieder für sich, für sich und dieses Bild im Spiegel, ein fahles Abbild mit einer dunkel schimmernden Ahnung in den Augen. Roy spritzte sich Wasser ins Gesicht, trank aus dem Hahn kühles Wasser, das seine wunde Kehle beruhigte, und ging zurück zum Tisch.
»Geht es dir gut?«, fragte Jen.
»Bestens«, sagte Roy.
»Bist du sicher?«
»Bestens«, wiederholte er und machte weiter, als ob nichts gewesen wäre. Jen aß Lachs, Roy Lamm. Sie tranken Champagner, sie teilten sich ein Stück Torte namens Schokoladensünde, sie amüsierten sich. Roy erzählte eine ziemlich witzige Geschichte über eine Sammlerin, die er kannte, ihren Hausschimpansen und einen Pizzaboten. Doch die Frage stellte er nicht.
Drei
Eigentlich war Roy kein sonderlich scharfsinniger Beobachter des Mienenspiels. Aber er wusste, dass die Menschen es liebten, gute Nachrichten zu überbringen, ihre Augen leuchteten dann vor Freude. Deshalb war ein Fehlen dieses Leuchtens ein schlechtes Zeichen. Kein Aufleuchten in Dr. Bronsteins Augen, sie waren dunkel, nachdenklich, vielleicht ein wenig ratlos.
»Entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten, Mr. Valois.«
»Das macht nichts.«
Dr. Bronstein schlug einen Ordner auf, beäugte eine MRT-Aufnahme und hob dann langsam den Blick zu Roy. Roy stellte sich ein wenig aufrechter hin, einfach, um Dr. Bronstein zu zeigen, wie fit er war. Ich habe mit einem Hockey-Stipendium an der Uni Maine studiert, Doc, das volle Programm. Roy hätte es beinah laut gesagt.
»Darf ich Ihnen eine Frage stellen?«, begann Dr. Bronstein.
»Schießen Sie los.«
»Wir müssen natürlich noch eine Biopsie machen«, begann Dr. Bronstein. »Im Moment ist noch nichts endgültig. Aber hatten Sie häufig Kontakt mit Asbest, zum Beispiel bei Ihrer Arbeit?«
»Asbest?«, antwortete Roy. »Nein.«
»Soweit ich verstanden habe, sind Sie Bildhauer?«, fragte Dr. Bronstein.
»Ja, aber ich arbeite mit Metallen.«
»Was für Metalle?«
»In letzter Zeit hauptsächlich mit Schrottwagenteilen«, antwortete Roy. »Davor habe ich mit T-Trägern gearbeitet, die ich von einem Abrissunternehmen in Worcester gekauft hatte.«
Dr. Bronsteins Augenbrauen, weiß und überhängend wie Schneewehen, hoben sich. »Waren Sie auch auf den Baustellen?«
»Nein«, sagte Roy. »Sie haben mir Fotos gemailt, und danach habe ich dann ausgewählt.«
Dr. Bronsteins Blick glitt wieder zu der MRT-Aufnahme. »Und vor den T-Trägern?«
»Stahlfedern«, erwiderte Roy. »Und vor den Stahlfedern Autoteile, genau wie jetzt.«
»Bremsbeläge?«, fragte Dr. Bronstein.
»Nein«, sagte Roy. »Hauptsächlich Kühler, manchmal Motorblöcke, ein paar Achsen.«
»Waren Sie beim Militär?«
»Nein.«
»Haben Sie mal in einer Mine gearbeitet?«
»Nein.«
»Was ist mit Bauarbeiten? Verputz? Rohre verlegen?«
»Nein«, sagte Roy. »Worum geht es überhaupt?«
»Bei allen diesen Gelegenheiten kann man mit Asbest in Berührung kommen«, erklärte Dr. Bronstein.
Roy hob die Hände, Handflächen nach außen.
»Es könnte sehr lange her sein«, sagte Dr. Bronstein. »Zum Beispiel ein Sommerjob in Ihrer Teenagerzeit.«
»Ich habe in einer Maschinenwerkstatt gearbeitet«, sagte Roy.
»Als was?«
»Metallarbeiten«, sagte Roy. »Hauptsächlich Schweißen.«
»Gehörten auch Dämmarbeiten dazu? Feuerschutzdämmung? Heizungsbau?«
»Wir haben Fließbandteile für eine Chemiefirma geliefert«, antwortete Roy. »Größtenteils war das Arbeit im Freien.«
»Davon kann es nicht kommen«, sagte Dr. Bronstein, während er Kästchen auf einer Seite in dem Ordner ankreuzte.
»Kann was nicht kommen?«
»Ist Ihnen das Wort Mesotheliom ein Begriff, Mr. Valois?«
Ein sehr kompliziertes Wort, Roy war nicht sicher, ob er es richtig verstanden hatte. »Sagen Sie das noch mal.«
»Mesotheliom.« Dr. Bronstein artikulierte jede Silbe. Diesmal verstand Roy ihn ganz deutlich. Das Wort erinnerte ihn an diese billigen japanischen Monsterstreifen.
Er schüttelte den Kopf. »Nie gehört.«
Dr. Bronsteins Blick hob sich wieder von der Aufnahme, heftete sich auf Roys Gesicht, direkt unter den Augen. »Mesotheliom, malignes Mesotheliom, ist eine Krankheit, die ausschließlich durch den Kontakt mit Asbest verursacht wird.«
»Was für eine Krankheit?«, fragte Roy.
»Eine sehr schwere.«
»Aber wie heißt sie?«
Dr. Bronstein wirkte verwirrt. »Das habe ich doch gesagt – Mesotheliom.«
Roys Stimme wurde ein wenig lauter, was ein Kratzen in seiner Kehle erzeugte. »Wie lautet der andere Name?«
»Der andere Name?«, wiederholte Dr. Bronstein, wobei er ein wenig zurückwich. Dr. Bronstein war ein kleiner Mann, Roy hätte ihn in Stücke reißen können. »Oh, ich verstehe«, sagte er. »Krebs. Mesotheliom ist eine Krebsart, die normalerweise die Lungen befällt, manchmal aber auch Bauchhöhle oder Herz.«
»Und das habe ich?«
»Ohne Biopsie kann man nicht sicher sein. Eine offene Biopsie ist das einzig Wahre. Dafür muss ich Sie nach Boston zu Dr. Honey überweisen. Ist vermutlich der weltweit führende Mesotheliom-Spezialist. Zufällig habe ich unter ihm gelernt, weshalb –« Dr. Bronstein verstummte, und im Untersuchungszimmer wurde es sehr still, kein Geräusch außer Dr. Bronsteins bleichen Fingern, die auf Roys MRT-Aufnahme trommelten.
»Man kann es nur von Asbest kriegen?«, fragte Roy.
Dr. Bronstein nickte.
»Aber ich habe nie was damit zu tun gehabt«, protestierte Roy. »Dann kann ich das doch nicht haben.«
Dr. Bronstein betrachtete Roys untere Gesichtshälfte.
Roys Stimme hob sich erneut. »Wie könnte ich? Sie haben gesagt ausschließlich. Das waren Ihre Worte. Wenn ich nie damit in Kontakt gekommen bin, wie kann ich es dann haben?« Das Kratzen in seiner Kehle wurde schlimmer.
Dr. Bronstein leckte über seine Lippen. »Das können Sie nicht.«
»Stimmt genau«, bestätigte Roy. »Und ich fühle mich normal. Kräftiger denn je, um ganz ehrlich zu sein.« Roy fragte sich, ob er Dr. Bronstein von den College-Läufern erzählen sollte, die er in der Loipe auf Schneeschuhen abgehängt hatte.
»Da wäre dieser Husten«, sagte Dr. Bronstein.
»Außer dem Husten«, sagte Roy. Mit reiner Willenskraft bezwang er das Kratzen, ließ es verschwinden. »Aber ein Husten kann alle möglichen Ursachen haben.«
Dr. Bronsteins Blick hob sich ein Stück, jetzt sah er Roy direkt in die Augen. »Und darum brauchen wir die Biopsie«, sagte er. »Dann müssen wir nicht länger spekulieren.«
Dienstagabend bedeutete Kneipenliga-Hockey im Tal, alle Spieler über fünfunddreißig, kein Checking, keine scharfen Schüsse, keine Trikots, Helm tragen freigestellt. Danach Bier bei Waldo’s, die Verlierer zahlten, nicht freigestellt. Die Mannschaftsnamen waren der Damenbekleidung entnommen, ein Brauch, der schon lange vor Roys Auftauchen existiert hatte. Er spielte für die Tangas. Heute Abend ging es gegen die erstplazierten D-Körbchen. Die meisten Spieler hatten in der Highschool oder am College Eishockey gespielt, ein paar hatten es in die unteren Profiligen geschafft und einer, Normie Sawchuck, der First Line Center der D-Körbchen, war zwei Spielzeiten bei den Bruins gelaufen. Normie, der mittlerweile zehn bis fünfzehn Kilo Übergewicht hatte – er aß und trank gratis in Normies Burger Paradies –, war nach wie vor der schnellste Spieler der Liga, besonders in den ersten Minuten.
Und in diesem Moment führte Normie ein Drei-gegen-zwei an, hielt auf Roy zu, der als rechter Verteidiger – eine Position, die er schon sein ganzes Leben lang spielte – rückwärts glitt. Roy war auf dem Eis rückwärts tatsächlich schneller als vorwärts, aber deshalb besaß er keineswegs dieselbe Klasse wie Normie, nicht einmal annähernd. Normie überquerte die blaue Linie, Eisflocken stoben von seinen Kufen, er täuschte einen Pass zum linken Flügel an, ein Täuschungsversuch, den Roy ignorierte, denn Normie passte niemals so früh in einem Spiel, und zog rechts vorbei. Roy blieb dran, weit nach vorn übers Eis gebeugt, auf alles gefasst. Aber nicht darauf: Plötzlich löste sich der Puck von Normies Stock. Oder schien es zu tun, denn als Roy danach zielte, war er weg, geborgen zwischen Normies Kufen. Der Kharlamov. Normie kicherte, als er an Roy vorbeiraste. Aber nicht ganz vorbei. Wunder Nummer eins: Roy wirbelte herum, fuchtelte mit seinem Stock, und irgendwie gelang es ihm, den Puck zu treffen. Der löste sich, sprang gegen die Bande, und bei der Annahme erblickte Roy, Wunder Nummer zwei, nichts als offenes Eis zwischen sich und dem Tor. Er wirbelte davon, konnte buchstäblich spüren, wie sein Trikot im Wind flatterte, als hätte irgendein Hockeygott ihn in Bobby Hull verwandelt, und stürmte ganz allein auf den Torhüter zu. Roy hielt sich nicht mit irgendwelchen Spielzügen auf, führte den Puck einfach rechts mit. Ein Drehen des Handgelenks und klong. Der Puck prallte vom Pfosten nach innen ins Netz.
»Scheißgut«, kommentierte der Torhüter.
Und so lief das gesamte Spiel. Endstand: Tangas 6, D-Körbchen 1. Roy erzielte einen Hattrick, sauste den ganzen Abend übers Feld, schwitzte am Ende nicht einmal. Wann hatte er zum letzten Mal so gespielt? Vor Jahren und Aberjahren, vielleicht auch nie.
»Himmel, Roy«, sagte Normie, der ein paar schäumende Krüge zu Roys Tisch im Waldo’s schleppte, »was immer du rauchst, ich will genau dasselbe.«
Roy fühlte sich so gut, dass er beinah die Biopsie abgesagt hätte.
Eine offene Biopsie, das einzig Wahre, bedeutete Vollnarkose. Roy hatte noch nie eine gehabt. Er lag unter grellen Lampen auf einem OP-Tisch. Die Anästhesistin – oder auch Krankenschwester, Roy kannte sich mit dem Personal nicht so aus – erschien mit einem Infusionsset und sagte: »Schöne Venen.«
»Danke«, erwiderte Roy.
»Woher stammt der Bluterguss?«, fragte sie, während sie die Nadel einführte.
»Puck.«
»Wie bitte?«
»Eishockey.«
»Ist er in die Ränge geflogen?«
»Nein«, sagte Roy. Er begann sich ein wenig schwummrig zu fühlen. »Ich spiele Eishockey.« Stehe seit meinem dritten Geburtstag auf dem Eis. Roy fragte sich gerade, ob er diese kleine Tatsache hinzufügen sollte, als Dr. Honey, eine Maske vor dem Gesicht, in seinem Gesichtsfeld aufragte. Dr. Honey hatte strahlend blaue Augen, keramische Augen, falls das Sinn ergab, die ganz plötzlich furchteinflößend wirkten.
Aber seine Stimme war sanft. »Wir werden uns gut um Sie kümmern, Roy«, versprach er. »Sie haben nur die Aufgabe, von zehn rückwärts zu zählen.«
»Und was ist Ihre?«, fragte Roy.
Alle lachten.
»Zehn«, sagte Dr. Honey.
»Neun«, zählte Roy. »Acht, sieben, sechs – das ist meine Lieblingszahl – fü…« Er fühlte sich leicht, leichter und leichter, als könnte er in der Luft schweben, aus dem Raum treiben, durch den Eingang des Krankenhauses, durch Boston, nach Hause. Nicht nach Hause ins Ethan Valley oder zu seinem ehemaligen Heim in Foggy Bottom, sondern zu seinem ältesten Zuhause hoch oben in den Wäldern von Maine. Dr. Honeys keramische Augen kamen näher. »Bobby Greelish«, sagte Roy.
»Wie war das?«, fragte Dr. Honey.
»Ich hab es nicht verstanden«, antwortete jemand hinter ihm.
»Bobby«, sagte Roy. »Wo ist Bobby?«
»Hast du gesehen, wie groß die Ratte war?«, fragte Bobby.
»Wo ist sie hin?«, entgegnete Roy.
Roy und Bobby arbeiteten draußen im Freien, schweißten Stahlbecken für das Montageband der Chemiefirma in Bath, einem von Mr. Kings größten Kunden. Vom Bürofenster aus waren sie gut zu sehen, und Mr. King behielt sie im Auge, deshalb kam irgendein Blödsinn absolut nicht in Frage. Außer bei Regen. Dann arbeiteten sie unter einem Wellblechdach, das Mr. King die Sicht versperrte. Dort konnten Roy und Bobbie alles Mögliche anstellen, zum Beispiel ein Go-Kart bauen, Bobbys Motorrad warten, schmelzen, was immer zu schmelzen war, Spinnen und andere Insekten mit dem Lötkolben eindampfen. Sie suchten gerade nach der Riesenratte, die Lötkolben in der Hand, als Mr. King unerwartet hinter ihnen auftauchte.
»Ihr Jungen beklaut mich?«, sagte er.
Sie wirbelten herum und stellten dabei die Düsen ab. »Sie beklauen, Mr. King?«
Mr. Kings Haare, die wenigen, die er noch besaß, hatte der Regen an seinen Kopf geklatscht. Er tropfte von seiner knochigen Nase und seinem spitzen Kinn. »Ich bezahle euch fürs Arbeiten, oder? Verdammt gutes Geld. Wenn ihr nicht arbeitet, dann nenne ich das ›eure dreckigen Hände in meine Taschen stecken‹!«
»Wir haben nur die Mischung getestet«, beteuerte Roy. »Wir haben nicht …«
»Mir die Butter vom Brot nehmen, das tut ihr.« Mr. King blickte von einem zum anderen, seine kleinen Augen blitzten vor Wut. »Ich sollte euch feuern.«
»Aber Mr. King«, protestierten sie. Das Geld, das sie nach Hause brachten – beide waren Söhne alleinerziehender Mütter –, wurde dringend gebraucht.
»Klar«, spottete Mr. King. »Jetzt könnt ihr aber Mr. King jammern.« Er schaute über den Hof, ihm schien ein Einfall zu kommen. »Ich mache euch einen Vorschlag«, sagte er, schon ein bisschen ruhiger. »Vielleicht kann ich mich ja überwinden, euch noch eine Chance zu geben.«
»Danke, Mr. King.«
»Ich bin zu gutherzig, das war schon immer mein Problem«, meinte er. »Aber ich hätte da tatsächlich eine spezielle Aufgabe.«
»Echt?«, entgegneten die Jungs. Sie fanden es ziemlich langweilig, Tag für Tag diese Stahlbecken zu schweißen.
»Ich werd euch, echt«, sagte Mr. King und drohte mit dem Finger.
Die spezielle Aufgabe dauerte, bis die Schule wieder anfing, und stellte sich als ziemlich lustig heraus.
»Hier, Jungs«, sagte der Boss, der sie zu der entlegensten Ecke des Hofs führte. »Hier hat alles angefangen.«
Sie starrten auf ein altes, verfallenes Gebäude mit geborstenen Fenstern, dessen Anstrich fast völlig abgeblättert war.
»Hat was angefangen?«, fragte Bobby.
»King Machines and Metals, verdammt noch mal«, antwortete Mr. King. »Aber mein Großvater hat mit Zement angefangen. Was ihr hier seht, ist das alte Lagerhaus. Mittlerweile brauche ich den Platz, deshalb sollt ihr es für mich abreißen.«
»Das Gebäude abreißen«, vergewisserte sich Roy.
»Die ganze Chose«, bestätigte Mr. King. »Kloppt es in winzig kleine Stücke und verfrachtet sie in den Container.«
Mr. Kings altes Zementlagerhaus hatte ein Holzständerwerk, vermutlich von Anfang an nicht sonderlich solide gebaut und mittlerweile äußerst morsch. Roy und Bobby zerlegten es in kleine Stücke, zum größten Teil mit Vorschlaghämmern, aber manchmal benutzten sie auch Kettensägen und, wenn sie ein bisschen durchdrehten, ihre eigenen Körper als Abrissbirnen, indem sie ausprobierten, ob sie tatsächlich durch Wände laufen konnten. Rund um das alte Lagerhaus lagen Unmengen altes Gerümpel, darunter auch verrottende Säcke mit diesem und jenem. Es war Schwerstarbeit, die ganzen Säcke zum Container zu schleppen, deshalb machten die Jungs mit ihren Kettensägen normalerweise kurzen Prozess. Wenn die Säcke aufrissen, schoss weißes Zeug heraus, als würde ein Schneesturm durch die Ruine des alten Lagerhauses pfeifen, und bedeckte sie von Kopf bis Fuß, zwei Schneemänner im August. Die Jungs fanden das super, und außerdem ersparte es ihnen eine Menge Arbeit, denn das weiße Zeug verschwand beim nächsten Unwetter, oder sogar bei starkem Wind. An ihrem letzten Tag zahlte Mr. King jedem von ihnen einen Bonus von zwanzig Dollar.
Vier
Mit vernähter Brust – nur vier Stiche – und noch ein wenig benommen, aber schmerzfrei, wartete Roy allein im Vorzimmer auf das Ergebnis der Biopsie. Bei Dr. Honey lagen Unmengen alter National Geographics. Roy stellte fest, dass er das schöne Foto einer Waldhütte mit leuchtend roten Wildblumen vor dem Eingang und einem rasch dahinfließenden Bach im Hintergrund anstarrte. Eine Weile konnte er das Rauschen des Wassers hören und beinah den Duft der Blumen riechen. Die Schönheit der Natur und wie zauberhaft das Leben sein konnte, überwältigten ihn. Dann schwand die Benommenheit allmählich, und die Schwächen des Fotos wurden sichtbar. Es war wie ein Menü, das nur aus Desserts bestand, zu üppig, zu oberflächlich, zu bemüht zu gefallen. Doch kurz bevor Roy das Magazin zuschlug, knüpfte das Bild eine Verbindung zu etwas in den Tiefen seines Verstands, hakte sich an ein Überbleibsel, das noch nicht mit den abebbenden Drogen aus seinem Inneren gespült worden war.
Roy zog sein Handy heraus, rief die Auskunft für North Grafton, Maine, an und fragte nach Bobby Greelishs Nummer. Kein Eintrag für Bobby oder Robert Greelish. Die einzige Greelish im Verzeichnis war Alma, Bobbys Mutter. Roy rief sie an.
»Mrs. Greelish«, meldete er sich. »Roy Valois.«
»Roy?« Eine alte Frau antwortete, aber er erkannte ihre Stimme nicht wieder. »Was für eine Überraschung. Wie geht es deiner Mutter?«
»Gut«, antwortete Roy. Seine Mutter hatte North Grafton vor langer Zeit gegen ein Appartement getauscht, das er ihr in Sarasota gekauft hatte. »Ich suche Bobby.«
»Meinen Bobby?«, fragte Mrs. Greelish.
»Ja«, erwiderte Roy. »Bobby.«
»Du meinst, du hast nie davon gehört?«
»Was gehört?«
»Bobby …« Ihre Stimme stockte. Gedämpfte Stille folgte, als hätte Mrs. Greelish die Hand über den Hörer gelegt. Dann war sie wieder in der Leitung, die Stimme kontrolliert, und sagte: »Bobby ist von uns gegangen, dieses Weihnachten sind es zwei Jahre.«
»Bobby ist tot?« Roy dachte: Motorradunfall. Seine optimistische Seite, die sich zu Wort meldete.
»Verschieden«, sagte Mrs. Greelish. »Er hatte diese schreckliche, seltene Krankheit.«
»Namens?«
»Wie bitte?«
»Der Name«, drängte Roy. »Der Name der Krankheit.«
»Oh, tut mir leid, Roy«, sagte Mrs. Greelish. »Es ist so ein langes, schwieriges Wort – ich konnte es mir nie richtig merken. Bobby war deswegen immer ein bisschen gereizt.«
Deshalb war Roy nicht vollkommen unvorbereitet, als er das Ergebnis der Biopsie erfuhr, man konnte sogar sagen, er nahm es gut auf: Das konnte er in den Mienen von Dr. Honey und seinem Stab lesen.
»Haben Sie jemanden, der Sie fährt?«, fragte eine der Schwestern, als Roy aufbrach.
»Wartet im Auto«, sagte Roy.
Er fuhr selbst zurück nach Norden, allein. Klarer blauer Himmel mit silbrigen Untertönen, kleine goldene Sonne, strahlend, doch irgendwie kühl, Schnee, der immer weißer wurde, je weiter er nach Norden kam. Ein herrlicher Wintertag, und der Winter war Roys liebste Jahreszeit. Ihm gefielen besonders die Eisdecken auf den Granitabbrüchen, wo die Straßenbauer ihren Weg hindurchgesprengt hatten, und er sah heute viele davon, massive schimmernde Felsen. Es trieb ihm die Tränen in die Augen, und Roy, der eigentlich nie weinte, fiel absolut kein Grund ein, warum er das hier, in der absoluten Abgeschlossenheit seines Autos, nicht tun sollte, und ließ sie fließen. Natürlich nicht lange, eine Ausfahrt, vielleicht zwei. Bis er den Connecticut überquert hatte und Vermont erreichte, hatte er sich wieder zusammengerissen.
Diagnose: sarkomatöses, nicht resezierbares, malignes Pleuramesotheliom, Stadium drei in der Stadieneinteilung nach Brigham.
Wie viele Stadien gibt es?
Vier.
Dann könnte es schlimmer sein.
Stimmt.
Gut. Wie geht es jetzt weiter?
Von hier?
Mit der Behandlung.
Ach so.
Sarkomatöses, nicht resezierbares, malignes Pleuramesotheliom; wie sich herausstellte, steckte eine Menge Bedeutung in dieser kurzen Phrase. Allein die Wörter nicht resezierbar bargen einen gewaltigen Hieb.
Behandlung: palliative Pflege.
Palliativ?
Das heißt –
Ich weiß, was das heißt. Ist das alles, was Sie mir anbieten können?
Es gibt klinische Studien, aber für die sind Sie nicht geeignet.
Warum nicht?
Wegen der Diagnose.
Dreht sich das nicht ein bisschen im Kreis?
Dr. Honey hatte dieser Bemerkung einige Berechtigung zugestanden. Dann erwähnte er, dass seine Frau Roys Werk gut kannte und über die Ignoranz ihres Mannes erstaunt war. Danach rückte er mit einer experimentellen Studie heraus, die ein Freund von ihm gerade am Hopkins begonnen hatte.
Können Sie mich unterbringen?
Ich werde es versuchen.
Ernsthaft versuchen?
Prognose: vier Monate bis ein Jahr.
Roy wurde eiskalt, als er das hörte. Und Dr. Honey schien zu schrumpfen, als würde Roy ihn aus der Ferne betrachten, bereits auf dem Weg sein oder schon weg.
Wie sicher sind Sie?
In diesem Beruf ist nichts sicher, nicht im absoluten Sinn.
Dann könnten es dreizehn Monate sein?
Könnte sein.
Vierzehn?
Möglich.
Achtzehn?
Nichts ist sicher.
Das bedeutet, dass Hoffnung besteht.
Immer.
Gestern Abend habe ich einen Hattrick erzielt.
Hattrick?
Dr. Honey kannte das Wort nicht. Roy, der sich wünschte, er hätte nichts gesagt, erklärte es nicht. Hattrick klang ziemlich frivol, verglichen mit einem Begriff wie nicht resezierbar.
Roy fuhr zur Scheune hoch. Ein Junge in Sweatshirt und ungeschnürten Stiefeln schob Schnee vom Pfad. Roy räumte selbst. Er stieg aus dem Auto und rief: »He?«
Der Junge drehte sich um. »Hi, Mr. Valois. Ich dachte, Sie wären irgendwie aufgehalten worden, und deshalb habe ich einfach, na ja …«
Skippy. War heute sein Probetag? Roy hatte ihn total vergessen. Was hatte er zu ihm gesagt? Komm um zwei? Roy sah auf die Uhr – halb vier –, dann bemerkte er einen frischen Pfad, der durch den Garten zum Schuppen freigeschaufelt worden war, und einen weiteren, vollkommen überflüssigen, der einmal um die Scheune herumzuführen schien.
»Ich brauche wirklich keinen …«, begann Roy. Skippy wartete, eine volle Ladung Schnee auf dem Schaufelblatt. »Komm rein«, sagte Roy.
Skippy schleuderte den Schnee hoch über die Wehe, und sie gingen hinein.
»Echt cool«, bemerkte Skippy, den Blick auf die Delia geheftet.
»Auf welche Weise?«
»Auf welche Weise?«, wiederholte Skippy. »Es ist total beeindruckend, Mr. Valois, die ganzen Kühler. Haben Sie schon eine Idee für das nächste?«
Das nächste.
Roy wurde wieder kalt, aber nicht so kalt wie beim letzten Mal. »Was hältst du von Kaffee?«
»Viel«, antwortete Skippy.
»Ich hab welchen«, sagte Roy. Er ging in die Küche, wärmte Kaffee auf, schenkte zwei Becher ein. Im großen Raum stand Skippy in der Nähe des Computers.
»Abgestürzt, was?«, fragte er.
»Passiert andauernd«, antwortete Roy. »Ich ziehe einfach den Stecker und steck ihn dann wieder ein.«
»Hm«, sagte Skippy. »Darf ich mal, vielleicht kann ich …?«
»Bedien dich«, sagte Roy.
Roy zog einen Stuhl neben die Delia. Skippy tippte auf der Tastatur vor sich hin. Der Raum wurde dunkel. Es war friedlich, nur sie drei, nach niemandes Definition eine Familie, doch der Friede war derselbe.
»Fertig, Mr. Valois.«
Roy stand auf, die Brust mittlerweile ein wenig wund, und trat zum Computer.
»Sollte nicht wieder vorkommen«, meinte Skippy. »Ich habe auch Ihren Desktop aufgeräumt.«
»Danke.«
»Wollen Sie gratis Telefon?«
»Gratis Telefon?«
»Ich könnte ein kleines Programm schreiben und Sie anschließen.«
»Wäre das legal?«, fragte Roy.
Skippy drehte sich zu ihm um, das fettige Haar in den Augen. »Was glauben Sie, Mr. Valois?«
»Du kannst Roy zu mir sagen«, bot Roy an.
»Okay, Mr. … äh«, sagte Skippy.
Turk McKenny war der Torhüter der Tangas und außerdem Roys Anwalt. Seine Kanzlei lag im obersten Stock eines weißen Hauses mit Aussicht auf die Grünfläche. Roy konnte durch das Fenster Teile des Neandertaler Nummer neunzehn sehen.
»Tolles Spiel, Roy«, sagte Turk.
»Danke.«
»Du hättest Normies Gesicht sehen sollen, als du mit dem Puck abgehauen bist.«
»Reiner Dusel.«
»Ich weiß nicht«, meinte Turk. »Du hast dein Spiel in letzter Zeit verbessert. Was kann ich für dich tun?«
»Das Testament, wegen dem du mir immer auf die Nerven gehst«, sagte Roy.
»Ja?«
»Ich möchte es aufsetzen.«
Turk nahm die Füße – er trug wollgefütterte Lederpantoffeln – vom Schreibtisch.
»Jetzt«, sagte Roy. »Wenn das möglich ist.«
Turk zog einen Notizblock heran und setzte eine Lesebrille auf. »Wir können selbstverständlich anfangen«, sagte er. Er legte den Kopf zur Seite und spähte über den Brillenrand. »Gibt es einen besonderen Anlass, der dich dazu bringt?«
»Das Übliche«, sagte Roy. Was ziemlich komisch war – tatsächlich so komisch, dass Roy zu lachen begann. Einen kurzen Moment fragte er sich, ob er in der Lage war, wieder aufzuhören. Dann überfiel ihn wie aus dem Nichts der Husten, verschluckte das Gelächter, riss das Kommando an sich. Roy taumelte aus dem Büro, die Hand auf dem Mund, und hastete den Flur hinunter zur Toilette. Er hustete über das Waschbecken gebeugt. Diesmal kein Blut, nur ein wenig gelbliche Flüssigkeit mit der Konsistenz von flüssigem Eiweiß. Eiweiß statt Blut: gutes oder schlechtes Zeichen? Wie konnte es schlecht sein? Bestand Hoffnung? Immer.
Roy kehrte in Turks Büro zurück. Turk wartete an der Tür.
»Was ist los, Roy? Was hast du?«
»Nichts.«
»Komm schon.«
Roy schüttelte den Kopf.
»Ich bin es«, sagte Turk.
Roy schwieg.
»Und falls das nicht reicht, lass mich wenigstens meine Arbeit machen«, sagte Turk.
»Was soll das heißen?«, fragte Roy. Seine Stimme klang rauh und heiser.
»Ich bin dein Anwalt«, antwortete Turk. »Lass mich nicht im Dunkeln stehen.«
Sie waren Freunde, schon seit ewigen Zeiten, hatten im College gegeneinander gespielt – Turk Stammspieler im Tor für Dartmouth – und sogar davor schon, im Finale eines Highschool-Turniers im alten Boston Garden. Delia hatte ihn auch gemocht. Turk war einer der Sargträger bei ihrem Begräbnis gewesen. Und Turk war sein Anwalt, der einzige Anwalt, den er jemals gehabt hatte, der sich um alles kümmerte: Steuern, Investitionen, Verträge, einschließlich dem mit Krishna. Roy holte tief Luft, war sich gleichzeitig bewusst, dass er nicht so tief einatmete wie sonst, nicht annähernd.
»Absolut vertraulich?«, fragte er.
»Das versteht sich von selbst«, erwiderte Turk. »Aber ich verspreche es trotzdem.«
Jemand musste Bescheid wissen. Ansonsten: potenzielles Chaos. Deshalb erzählte Roy Turk alles, direkt an der Tür, im Stehen. Wie sich herausstellte, war es schwer, es laut auszusprechen, alles wurde dadurch wirklicher. Roy konnte sich nicht vorstellen, das noch einmal zu tun.
Turk unterbrach nicht, gab keinen Ton von sich, wurde nur ein wenig weiß um die Lippen. Als Roy fertig war, sagte er: »Gott helfe uns.« Turk legte Roy die Hand auf die Schulter. Roy wollte das eigentlich nicht, mit Sicherheit wollte er nicht umarmt werden oder so etwas, und nichts passierte.
»Was ist mit dieser Hopkins-Sache?«, fragte Turk.
»Ich warte auf Nachricht«, antwortete Roy.
»Also besteht noch Hoffnung.«
Immer.
Sie setzten sich. Draußen auf der Grünfläche warf ein kleines Kind Schneebälle auf den Neandertaler Nummer neunzehn.
»Hast du was in der Schublade?«, fragte Roy.
»Du kannst Gedanken lesen«, sagte Turk. Er zog die Schublade auf, nahm eine Flasche Single Malt und zwei Gläser heraus und schenkte ungefähr fünf Zentimeter hoch ein. Der Whisky war umgehend verschwunden. Er schenkte nach. Ein teurer Single Malt, doch aus irgendeinem Grund schmeckte er nach nichts, zumindest für Roy.
»Was ich will, ist ziemlich einfach«, sagte er. »Jen bekommt eine Hälfte, der Rest geht an meine Mutter.«
Turk notierte es auf dem Block. Seine Schrift war klein und sauber, irgendwie seltsam bei diesen Fingern, krumm und dick. »Das Haus?«, fragte er, ohne aufzusehen.
»Verkauf es.«
»Und deine Werke?«
»Auch verkaufen.«
»Was ist mit der Auswirkung auf die Preise?«
Roy war das egal. Doch warum nicht maximieren, was Jen und seiner Mutter bleiben würde? »Krishna wird wissen, was zu tun ist.«
»Hast du mit ihm gesprochen?«
»Nein.«
»Jen?«
»Nein.«
Turk öffnete den Mund, um etwas zu sagen, und schloss ihn wieder. Roy schob sein Glas über den Tisch. Turk schenkte nach, zögerte und schenkte sich selbst noch mehr ein. Er legte den Stift hin, trank, lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Schweigen erfüllte den Raum. Undurchdringlich, als besäße es eine körperliche Dimension, schien es das Vergehen der Zeit zu verhindern.
»Erinnerst du dich noch an das Tor, das du gegen Harvard geschossen hast?«, fragte Turk. »Gestern Abend bei Waldo’s ist es mir eingefallen.«