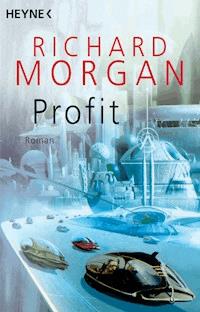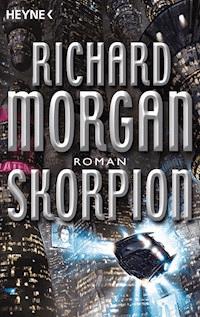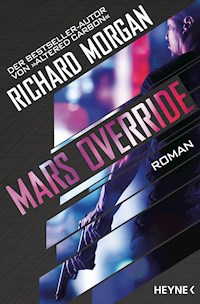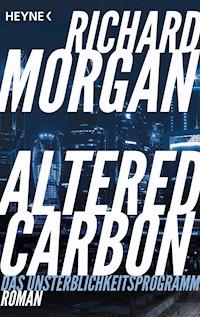12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Zeitalter der Helden-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Ringil Eskiath stammt aus einer alteingesessenen Aristokratenfamilie, die allerdings mit ihm gebrochen hat. Dennoch hat Ringil alles, was er braucht: eine gute Klinge, einen hervorragenden Ruf als Schwertkämpfer und ein gesichertes Einkommen. Dann taucht eines Tages überraschend seine Mutter, die Kaiserin, auf und verlangt von ihm, dass er seine Cousine befreit, die in Gefangenschaft geraten ist. Schnell wird Ringil klar, dass es bei diesem Auftrag nicht nur um das Schicksal seiner jungen Verwandten geht, sondern um das des ganzen Kaiserreiches. Dieser Roman ist bereits unter dem Titel »Glühender Stahl« erschienen und wurde für diese Ausgabe überarbeitet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 712
Ähnliche
Das Buch
Für die meisten ist Ringil ein gefeierter Held und der beste Schwertkämpfer der Tieflande. Für alle, die ihn etwas näher kennen, ist Ringil lediglich ein heruntergekommener Haudegen, der in einem Provinznest seine Zeit mit Schaukämpfen und halbherzigen Affären totschlägt. Als eines Tages seine Mutter, die Herrin seines Klans, in der Tür steht, wird Ringil jäh aus seiner Tristesse gerissen: Er soll eine entfernte Kusine wiederfinden, die in die Sklaverei verkauft wurde. Doch Ringil muss schon bald erkennen, dass seine Kusine nicht nur in einer weit größeren Gefahr schwebt, als alle bisher glaubten – sondern dass diese Gefahr die ganze Menschheit bedroht. Im Verborgenen sind die Dwenda wieder erwacht, uralte, gottgleiche Wesen, und sie wollen die Herrschaft über die Menschen erneut an sich reißen. Ringils einzige Verbündete gegen die Dwenda sind seine alten Kampfgefährten: Archeth, Tochter eines längst verschollenen Volkes, und Egar, Barbarenhäuptling und Drachentöter. Denn so viel steht für Ringil fest – die Rettung der Welt wird eine blutige Angelegenheit …
DAS ZEITALTER DER HELDEN – Das furiose Fantasy-Abenteuer vom mehrfach preisgekrönten Bestsellerautor Richard Morgan:
Das Zeitalter der Helden 1 – Erwachen
Das Zeitalter der Helden 2 – Imperium
Das Zeitalter der Helden 3 – Dunkelheit
Der Autor
Richard Morgan wurde 1965 in Norwich geboren. Er studierte Englisch und Geschichte in Cambridge und arbeitete etliche Jahre als Englischlehrer im Ausland, bevor er sich entschloss, freier Schriftsteller zu werden. Seine Romane landen regelmäßig auf den internationalen Bestsellerlisten und wurden bereits mit dem Philip K. Dick Award, dem John W. Campbell Award und dem Arthur C. Clarke Award ausgezeichnet. Morgan lebt und arbeitet in Glasgow.
RICHARD MORGAN
DAS ZEITALTER DER HELDENI
Erwachen
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der englischen Originalausgabe:
THE STEEL REMAINS
Deutsche Übersetzung von Alfons Winkelmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Redaktion: Karin Will
Copyright © 2008 by Richard Morgan
Copyright © 2020 der deutschen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 18, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-25463-6V001
Dieses Buch ist für meinen Vater
John Morgan.
Dafür, dass er mich durch das Seegras trug
»Ich glaube, du hältst den Tod für deinen Freund«,
murmelte sie. »Ein seltsamer Freund für einen jungen Mann.«
»Der einzige getreue Freund in dieser Welt«, erwiderte er
bitter. »Allein der Tod ist stets an deiner Seite.«
Poul Anderson: Das zerbrochene Schwert
1
Wenn dir ein geistig vollkommen gesunder Mann erzählt, seine kürzlich verstorbene Mutter habe gerade versucht, in sein Schlafzimmer zu steigen und ihn aufzufressen, dann bleiben dir zwei Möglichkeiten: Du kannst an seinem Atem schnüffeln, ihm den Puls fühlen und anhand seiner Pupillen überprüfen, ob er irgendwelche Drogen genommen hat. Oder du kannst ihm glauben. Ersteres hatte Ringil bei Bashka, dem Schulmeister, bereits getan, und zwar ohne Ergebnis, also stellte er sein Bier mit einem ausgiebigen Seufzer ab und ging sein Breitschwert holen.
»Nicht schon wieder«, hörte man ihn brummeln, als er sich in die Bar drängte.
Anderthalb Meter gehärteter kiriathischer Stahl – das war Ringils Breitschwert. Es hing über dem Kamin in einer Scheide aus Legierungen, die keine Namen hatten, die jedoch jedes fünfjährige kiriathische Kind auf Anhieb erkannt hätte. Das Schwert selbst trug einen kiriathischen Namen, wie alle in Kiriath geschmiedeten Waffen, aber es war ein blumiger Ausdruck, von dem in einer Übersetzung nicht mehr viel übrig blieb. Willkommen im Horst der Raben und anderer Aasfresser in den Fußstapfen von Soldaten – genauer hatte ihn Archeth nicht wiedergeben können. Also hatte Ringil das Schwert einfach »Rabenfreund« genannt, auch wenn ihm der Name nicht sonderlich gefiel. Aber er hatte den Klang, den die Leute bei einem berühmten Schwert erwarteten. Sein Wirt, ein geschäftstüchtiger Mann mit Kapital und dem Händchen dafür, es stetig zu vermehren, hatte seine Bar entsprechend umbenannt und das Ding auch verewigen lassen. Ein ortsansässiger Künstler hatte ein passables Porträt von Ringil gemalt, auf dem er den Rabenfreund in der Galgenschlucht schwang, und dieses Bild hing jetzt draußen, zur gefälligen Betrachtung für alle Passanten. Als Gegenleistung erhielt Ringil Unterkunft und Verpflegung und durfte die Geschichten seiner Heldentaten den Touristen in der Bar erzählen, als Gegenleistung für alles, was sie ihm in die Mütze warfen.
Und außerdem, hatte Ringil einmal ironisch in einem Brief an Archeth bemerkt, drückt er beide Augen zu bei gewissen Praktiken im Schlafzimmer, die meiner Wenigkeit in Trelayne oder Yhelteth zweifelsohne einen langsamen Tod am Pfahl eingebracht hätten. Held der Galgenschlucht; ein solcher Status gewährt einem offenbar gewisse Privilegien, die dem gewöhnlichen Bürger in diesen selbstgerechten Zeiten verwehrt bleiben. Hinzu kam, dass man sich nicht auf Schwulenhatz machte, wenn das Opfer dafür berüchtigt war, selbst geübte Schwertkämpfer zu Hackfleisch zu verarbeiten. Ruhm, kritzelte Ringil, hat schließlich doch sein Gutes.
Das Schwert über dem Kamin anzubringen war eine nette Geste gewesen, übrigens ebenfalls eine Idee des Wirts. Der Mann versuchte gerade, seine hier wohnende Berühmtheit zu überreden, im Stallhof hinter dem Haus Fechtunterricht zu geben. Kreuze die Klinge mit dem Helden der Galgenschlucht – nur drei Reichsmünzen die halbe Stunde! Ringil war noch unschlüssig, ob er schon so schlecht bei Kasse war. Er hatte gesehen, was Unterrichten aus Bashka gemacht hatte.
Wie dem auch sein mochte, er zog den Rabenfreund in einer einzigen schwungvollen Bewegung klirrend aus der Scheide, legte ihn sich lässig über die Schulter und trat hinaus auf die Straße, ohne das Publikum zu beachten, das ihn anstarrte und das er noch vor einer Stunde mit Geschichten von Mut und Tapferkeit unterhalten hatte. Vermutlich würde es ihm zumindest einen Teil des Wegs bis zum Haus des Schulmeisters folgen. Schaden würde das nicht, selbst wenn er recht behielt mit seinem Verdacht. Allerdings würden sie vermutlich bei den ersten Anzeichen von Schwierigkeiten die Beine in die Hand nehmen. Was man ihnen wirklich nicht verübeln konnte. Sie waren Bauern und Kaufleute und hatten nichts mit ihm zu tun. Etwa ein Drittel hatte er noch nie zuvor gesehen. Wie hatte er doch gleich in der Einführung seines Traktats über die Taktik bei Schlachten geschrieben (dessen Veröffentlichung unter seinem Namen die Militärakademie höflich abgelehnt hatte): Kennt man die Männer hinter sich nicht mit Namen, sollte man nicht überrascht sein, wenn sie einem nicht in den Kampf folgen. Andererseits sollte man auch nicht überrascht sein, wenn sie es tun, denn es gilt zahllose andere Faktoren zu berücksichtigen. Führung erfordert Fingerspitzengefühl und lässt sich nicht leicht herstellen oder verstehen. Was schlicht und einfach der Wahrheit entsprach – eine Erkenntnis, gewonnen an der blutigen Front einiger der hässlichsten Schlachten, die die freien Städte seit Menschengedenken geschlagen hatten. Die Sache war jedoch, wie es der zuständige Lektor, ein Lieutenant aus Trelayne, in seinem freundlichen Antwortbrief ausgedrückt hatte, einfach zu vage, um für die Akademie als brauchbares Übungsmaterial infrage zu kommen. Diese Ambivalenz veranlasst uns, Euer Traktat abzulehnen. Angesichts des letzten Satzes auf dem Pergament hatte Ringil eine verwandte Seele dahinter vermutet.
Es war kalt draußen auf der Straße. Er trug lediglich ein Lederwams mit halblangen Ärmeln aus Segeltuch, und über den Grat des Hochlands von Majak kroch eine für die Jahreszeit ganz untypische Kühle herab. Die Gipfel der Berge, unter die der Ort sich duckte, waren bereits schneebedeckt, und die Galgenschlucht würde wahrscheinlich schon vor dem Padrow-Abend unpassierbar sein. Erneut ging das Gerede von einem Aldrain-Winter. Seit Wochen kursierten jetzt schon Gerüchte von Weidevieh, das in den Hochlanden von Wölfen und anderen, weniger natürlichen Raubtieren gerissen worden war, sowie von erschreckenden Begegnungen und Sichtungen auf den Bergpässen. Das, mutmaßte Ringil, würde sich als Ursache des Problems erweisen. Das Häuschen von Bashka, dem Schulmeister, stand am Ende einer der Durchgangsstraßen, direkt am hiesigen Friedhof. Als der weitaus gebildetste Mann in dem winzigen Ort Galgenwasser – der hier lebende Held nicht mit eingerechnet – hatte Bashka zwangsläufig das Amt des Tempelofficiators erhalten, und das Haus gehörte gewissermaßen zur Ausstattung des Priesters. Und bei schlechtem Wetter waren Friedhöfe eine hervorragende Fleischquelle für Aasfresser.
Du wirst ein großer Held sein, hatte eine yheltethische Wahrsagerin einst aus Ringils Speichel gelesen. Du wirst viele Kämpfe austragen und viele Feinde besiegen.
Kein Wort davon, dass er Kammerjäger in einer Grenzsiedlung spielen würde, die nicht viel größer als eines der Slums von Trelayne war.
An den Hauptstraßen und der Uferstraße von Galgenwasser standen Gestelle mit Fackeln, aber die übrige Stadt musste mit dem Bandlicht vorliebnehmen, das sich in einer so stark bewölkten Nacht wie dieser sehr rar machte. Wie von Ringil erwartet lichtete sich die Menge, sobald er eine unbeleuchtete Querstraße betrat. Nachdem deutlich wurde, wohin er wollte, verringerte sich seine Eskorte um mehr als die Hälfte. Als er in Bashkas Straße einbog, hatte er immer noch eine lockere Gruppe von sechs oder acht Männern im Schlepptau, aber als er dann vor dem Häuschen des Schulmeisters befand – dessen Tür immer noch sperrangelweit offen stand, so wie sie ihr Bewohner bei seiner Flucht im Nachthemd zurückgelassen hatte –, war er allein. Er drehte sich zu den Gaffern am Ende der Straße um, ein sarkastisches Lächeln auf den Lippen.
»Bleib zurück!«, rief er.
Zwischen den Gräbern erhob sich ein leises Knurren, und Ringil überlief eine Gänsehaut. Er nahm den Rabenfreund von der Schulter und ging, das Schwert wachsam vor sich gehalten, um das kleine Haus herum.
Die Gräberreihen zogen sich den Hügel hinauf, wo die Stadt an den Granitfelsen endete. Die meisten Grabsteine waren schlichte Platten, aus demselben Gestein gehauen, und spiegelten die stoische Haltung wider, mit der die Bewohner dem Sterben begegneten. Hier und da jedoch war das reicher mit Schnitzwerk verzierte Grabmal eines Einwohners von Yhelteth oder einer der Steinhügel zu sehen, unter denen die Bewohner des Nordens ihre Toten begruben. Die Hügel waren mit schamanischen Talismanen aus Eisen behängt und mit den Klanfarben der Vorfahren des Verblichenen bemalt. Gewöhnlich kam Ringil nicht allzu häufig hierher; er kannte zu viele der Namen auf den Steinen, konnte allzu zu vielen der Toten mit den fremd klingenden Namen ein Gesicht zuordnen. Es war eine bunte Mischung gewesen, die unter seinem Kommando in der Galgenschlucht gestorben war, an jenem schwül-warmen Sommernachmittag vor neun Jahren, und nur wenige der Ausländer hatten Familien gehabt, die wohlhabend genug waren, ihre gefallenen Söhne für ein Begräbnis heimzuholen. Überall auf den Friedhöfen entlang dieses Teils der Berge waren ihre einsamen Zeugnisse zu finden.
Geduckt drang Ringil Schritt für Schritt auf den Friedhof vor. Die Wolken am Himmel rissen auf, und auf einmal funkelte die kiriathische Klinge im Bandlicht. Das Knurren kam nicht wieder, aber jetzt vernahm Ringil leisere, verstohlenere Laute. Von jemandem, so vermutete er wenig begeistert, der grub.
Du wirst ein großer Held sein.
Aber sicher.
Er entdeckte Bashkas Mutter, die in der lockeren Erde am Fundament eines vor Kurzem aufgestellten Grabsteins wühlte. Ihr Leichenhemd war zerrissen und schmutzig, und darunter sah man verwestes Fleisch, das er aus einem Dutzend Schritte Entfernung gegen den Wind riechen konnte, trotz der Kälte. Ihre Fingernägel, die nach dem Tod noch ein Stück gewachsen waren, kratzten mit einem unangenehmen Geräusch über den Sarg, an dem sie sich zu schaffen machte und den sie zum Teil freigelegt hatte.
Ringil verzog das Gesicht.
Zu Lebzeiten hatte ihn die Frau nicht ausstehen können. Als Officiator und Priester des Tempels hätte ihr Sohn ihn als nichtswürdigen Degenerierten und Verführer der Jugend verachten sollen. Doch als Schulmeister und Mann von einiger Bildung erwies sich Bashka als allzu aufgeklärt. Sein lockerer Umgang mit Ringil sowie gelegentliche philosophische Dispute spätnachts in der Kneipe hatten ihm scharfe Ermahnungen von den Oberpriestern eingebracht. Noch schlimmer war, dass seine mangelnde Missbilligung Ringils ihm in der Kirchenhierarchie einen Ruf eingebracht hatte, durch den er stets einfacher Lehrer in einem Kaff bleiben würde. Die Mutter gab selbstverständlich dem degenerierten Ringil und dessen schlechtem Einfluss die Schuld daran, dass ihr Sohn nicht weiter aufstieg, und daher war er zu ihren Lebzeiten im Haus des Schulmeisters nicht willkommen gewesen. Diese Zeiten hatten jedoch im vorangegangenen Monat ein jähes Ende gefunden, nach einem plötzlichen Fieber, das nicht weichen wollte und das wahrscheinlich ein gedankenloser Gott geschickt hatte, dem ihre große Rechtschaffenheit in religiösen Dingen entgangen war.
Ringil bemühte sich, nicht durch die Nase zu atmen, und klopfte mit der flachen Seite des Rabenfreunds auf einen Grabstein in seiner Nähe, um ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Zunächst schien sie ihn nicht zu hören, aber dann verdrehte sich ihr Leib nach hinten, und er blickte in ein Gesicht, dessen Augen schon vor langer Zeit von irgendwelchen Tieren aufgefressen worden waren. Die Kinnlade hing schlaff herab, der größte Teil der Nase war verschwunden und das Fleisch der Wangen war fleckig und eingefallen. Es war erstaunlich, dass Bashka sie überhaupt erkannt hatte.
»Komm raus da!«, forderte Ringil und hielt sein Schwert bereit.
Er kam.
Mit einem knackenden, schlürfenden Geräusch kam er durch den Brustkasten der toten Frau, ein Leichenfresser von einem vollen Meter Länge, nicht eingerechnet die rankenartigen Auswüchse, mit denen er die Gliedmaßen des Leichnams bedient hatte. Er war grau und erinnerte in vielerlei Hinsicht an eine glatthäutige Made. Die stumpfe Schnauze des Dings besaß Kiefer mit hornigen Rändern, die einen Knochen zermalmen konnten, und das Schwanzende sah ähnlich aus. Ein Leichenfresser schied seine Exkremente nicht aus. Stattdessen sickerten sie aus Poren entlang des schneckengleichen Leibes; eine Substanz, die wie sein Speichel ätzend und tödlich war.
Niemand kannte die Herkunft dieser Kreaturen. Dem Volksmund nach waren sie ursprünglich ausgehustete Klumpen von Hexenschleim. Die bösartigen Hexen hatten sie dann aus Gründen, die in den meisten Geschichten vage blieben, zu unersättlichen Wesen geformt. Die »offizielle« Religion beharrte darauf, sie seien entweder gewöhnliche Schnecken oder Maden und besessen von den Seelen böser Verstorbener oder dämonische Heimsuchungen aus irgendeiner Friedhofshölle, in der die Unwerten bei vollem Bewusstsein in ihren Gräbern verrotteten. Archeth verfocht eine etwas vernünftigere Theorie: die Fresser seien Mutationen, Ergebnis kiriathischer Experimente mit niederen Lebensformen, die vor Jahrhunderten stattgefunden hatten. Damals hatte man eine Kreatur schaffen wollen, welche die Toten effizienter entsorgte als übliche Aasfresser.
Die Wahrheit sah so aus, dass niemand genau wusste, wie intelligent die Leichenfresser wirklich waren. Aber irgendwie hatten sie während ihrer Evolution – natürlich oder nicht – gelernt, die Leichname, von denen sie sich nährten, zu anderen Zwecken zu nutzen. Ein Leichnam konnte ein Versteck oder eine Brutstätte für ihre Eier sein, und wenn er nicht allzu sehr verrottet war, darüber hinaus ein Mittel zur Fortbewegung oder zur Tarnung, und im Falle von Menschen oder Wölfen auch ein Grabwerkzeug. Es war der Gebrauch menschlicher Leichname, der immer wenn die Winter hart waren, zu den vielen Sichtungen Untoter im ganzen Nordwesten führte.
Hin und wieder hatte Ringil sich gefragt, ob die Leichenfresser die Kadaver nicht zu einer Art Spiel benutzten – eine makabre Idee, die ganz und gar auf seinem eigenen Mist gewachsen war. Gekommen war sie ihm, als er zum ersten Mal Berichte von Reisenden gelesen hatte, die die kiriathischen Wüsten durchquert hatten. Schließlich, so argumentierte er gegenüber dem Bibliothekar seines Vaters, würde sich das eigene Sekret eines Leichenfressers fast ebenso schnell durch das Holz eines Sarges fressen, wie ihn die verwesenden Hände eines Leichnams öffnen könnten – warum sich also damit abplagen? Der Bibliothekar, und später auch sein Vater, fanden, dass Ringil ein krankhaft veranlagter junger Mann war, der sich, gleich seinen älteren Brüdern, mit natürlicheren Dingen beschäftigen sollte, wie Reiten, Jagen und die hiesigen Mägde zu verführen. Seine Mutter, die zweifelsohne bereits einen Verdacht hatte, äußerte sich nicht dazu.
Von einer oder zwei früheren Begegnungen mit diesen Kreaturen her wusste Ringil auch, dass sie sehr …
Der Leichenfresser wand sich vollständig aus dem einengenden Brustkasten heraus und sprang ihn an.
… schnell sein konnten.
Mit einem wenig eleganten Schwerthieb schleuderte Ringil das Ding nach links, wo es gegen einen Grabstein prallte, zu Boden fiel und zappelnd liegen blieb, durch den Streich fast in zwei Hälften zerteilt. Mit einem weiteren Hieb vollendete Ringil mit angewidertem Gesicht sein Werk. Die beiden getrennten Hälften der Kreatur wanden sich noch ein wenig, zitterten und rührten sich dann nicht mehr. Dämonen und die Seelen der Bösen waren anscheinend nicht in der Lage, einen solchen Schaden zu beheben.
Ringil wusste auch, dass Leichenfresser in Rudeln auftraten. Als ihn daher das schleimige Ende eines Rankenauswuchses zart an der Wange berührte, wirbelte er bereits herum. um sich dem nächsten zu stellen. Die Sekrettropfen brannten. Keine Zeit, sie abzuwischen. Er entdeckte die Kreatur, die zusammengerollt auf einem yheltethischen Grabmal lag, und spießte sie reflexartig auf. Die Ranken zogen sich zurück, und das Ding stieß im Sterben ein wütendes Zwitschern aus. Von der anderen Seite des Grabmals antwortete ihm ein Rasseln, und Ringil nahm eine Bewegung wahr. Er schlug einen großen Bogen um den behauenen Stein und sah, wie die beiden kleineren Fresser sich aus den Überresten eines verrotteten Sargs und dessen ebenso verwestem Inhalt herauswanden. Ein einziger Abwärtshieb schlitzte sie beide auf, und Körperflüssigkeit schoss wie helles Öl aus den Wunden. Er wiederholte die Sache, um auf Nummer sicher zu gehen.
Der fünfte Leichenfresser landete auf seinem Rücken.
Er handelte ohne zu zögern. Im Rückblick trieb ihn wohl nackter Ekel. Mit einem Aufschrei ließ er das Schwert fallen, löste mit beiden Händen die Schnürung seines Wamses und streifte es noch mit der gleichen Bewegung halb ab, noch bevor der Leichenfresser gemerkt hatte, dass das Leder nicht die echte Haut war. Das Wams wurde vom Gewicht der Kreatur nach unten gezogen, wodurch Ringil es sich vom Leib zu reißen konnte. Die Ranken um seine Taille und über den Schultern krochen nach wie vor aufeinander zu, doch sie hatten keine Zeit, ihn zu umklammern. Sein linker Arm kam frei, und wie ein Diskuswerfer wirbelte er herum und schleuderte das Bündel aus Wams und Leichenfresser von sich weg, mitten in die Grabsteine. Er hörte den Aufprall, als es auf etwas Hartem landete.
Die Ranken hatten ihn an Brust und Rücken berührt – später würde man Striemen sehen. Jetzt schnappte er sich wieder den Rabenfreund und machte sich auf den Weg zu seinem Wams, mit wachen Sinnen. Schließlich konnte es noch weitere Mitglieder des Rudels geben. Er fand das teilweise aufgelöste Kleidungsstück am Fuß einer moosüberwachsenen Grabplatte ganz hinten auf dem Friedhof. Kein schlechter Wurf, so aus dem Stand. Der Leichenfresser versuchte immer noch, sich von dem Leder zu befreien, und schlug konfus nach Ringil. Er fletschte die und zischte wie ein frisch geschmiedetes Schwert in der Kühlwanne.
»Ja, ja, schon gut«, murmelte Ringil, ließ den Rabenfreund heruntersausen und pfählte den Leichenfresser. Mit düsterer Befriedigung sah er ihm beim Sterben zu. »Das Wams war frisch gewaschen, du Stück Dreck.«
Er blieb zwischen den Gräbern, bis er die Kälte allmählich wieder spürte, und musterte grübelnd den kleinen, jedoch deutlich erkennbaren Bauch, der seine ansonsten makellose schmale Taille bedrohte. Es kamen keine Leichenfresser mehr. Mit einem unversehrten Fetzen seines Wamses reinigte er sorgfältig die bläuliche Oberfläche des Rabenfreunds von den Körperflüssigkeiten. Archeth beharrte darauf, dass die kiriathische Klinge immun gegen sämtliche ätzenden Substanzen sei, aber sie hatte sich schon einige Male geirrt.
Zum Beispiel, wie der Krieg ausgehen würde.
Dann endlich fiel Ringil ein, dass ihn die Kreatur berührt hatte, und wie aufs Stichwort begannen die Blasen auf seiner Haut zu brennen. Er rieb an der Blase auf seiner Wange, bis sie platzte, und zog ein grimmiges Vergnügen aus dem leichten Schmerz. Nicht gerade eine heldenhafte Verwundung, aber mehr hatte er für die Vorfälle dieses Abends nicht vorzuweisen. Bevor es richtig hell war, würde niemand hier herauskommen und sich das Gemetzel ansehen.
Na schön, vielleicht kannst du die Geschichte in ein paar Pints und eine Geflügelplatte umsetzen. Vielleicht besorgt dir Bashka aus purer Dankbarkeit ein neues Wams, wenn er es sich leisten kann, nachdem er das zweite Begräbnis für seine Mutter bezahlt hat. Vielleicht wird dieser flachsköpfige Stallbursche hinreichend beeindruckt sein und übersieht den Bauch, den du dir gerade so eifrig zulegst.
Ja klar, und vielleicht hat dich dein Vater wieder in sein Testament aufgenommen. Vielleicht ist der Imperator von Yhelteth schwul.
Der letzte Gedanke war ein Grinsen wert. Ringil Engelauge, narbenübersäter Held der Galgenschlucht, kicherte auf dem kalten Friedhof ein wenig in sich hinein und sah sich unter den schweigenden Grabplatten um, als könnten seine vor langer Zeit gefallenen Kameraden den Witz würdigen. Die Stille und die Kälte gaben keine Antwort. Die Toten blieben ungerührt, wie schon seit mittlerweile neun Jahren, und Ringils Lächeln erlosch. Ein Schauder überlief ihn.
Er schüttelte ihn ab.
Dann legte er sich den Rabenfreund wieder über die Schulter und machte sich auf die Suche nach einem sauberen Hemd, einer Mahlzeit und einem wohlwollenden Publikum.
2
Inmitten der Wolkenfetzen von der Farbe eines Blutergusses stand eine sterbende Sonne tief an einem scheinbar endlosen Himmel. Aus dem Osten brach die Nacht über die Savanne herein, und die stete Brise kühlte sich ab. Die Abende hier oben haben etwas Schmerzhaftes, hatte Ringil einst gesagt, kurz vor seinem Weggang. Es fühlt sich immer wie ein Verlust an, wenn die Sonne sinkt.
Egar, der Drachentöter, der nie genau gewusst hatte, worauf sein schwuler Freund hinauswollte, wenn ihn eine solche Stimmung überkam, entdeckte auch jetzt, gut zehn Jahre später, keinen rechten Sinn in diesen Worten.
Er wusste auch nicht, weshalb sie ihm gerade jetzt einfielen.
Er schnaubte, bewegte sich leicht im Sattel und schlug den Kragen seines Schaffellmantels nach oben. Es war reiner Reflex, denn die Brise machte ihm eigentlich nichts aus. Er spürte die Kälte der Steppe zu dieser Jahreszeit schon längst nicht mehr – ja, warte nur ab, bis der richtige Winter kommt und es Zeit wird, sich mit Fett einzuschmieren –, aber die einstudierte Bewegung war eine jener Eigenarten, die er aus Yhelteth heimgebracht hatte, und er hatte keine Lust, sie sich wieder abzugewöhnen. Bloß ein Überbleibsel, wie die Erinnerungen an den Süden, die einfach nicht verblassen wollten, und das vage Gefühl von Distanziertheit, das Lara vor Gericht geltend gemacht hatte, als sie ihn verlassen hatte und in die Jurte ihrer Familie zurückgekehrt war.
Verdammt, wie ich dich vermisse, Mädel!
Er gab sich alle Mühe, diesen Gedanken mit echter Melancholie zu unterfüttern, war jedoch nicht mit dem Herzen dabei. Er vermisste sie nicht im Geringsten. In den letzten sechs oder sieben Jahren musste er fast ein Dutzend schreiender Bündel von den Toren Ishlin-ichans bis zu den Außenposten der Tundra von Voronak im Nordosten gezeugt haben, und mindestens die Hälfte der Mütter stand ihm gefühlsmäßig so nahe wie Lara. Die Ehe hatte nie so funktioniert wie die Sommerromanze, die ihr vorausging. Um die Wahrheit zu sagen, war er bei der Anhörung vor der Scheidungskammer vor allem erleichtert gewesen. Er hatte nur pro forma Widerspruch eingelegt, und das auch nur, damit Lara nicht noch wütender wurde, als sie es ohnehin schon war. Er hatte die Abfindung gezahlt und binnen einer Woche mit dem nächstbesten skaranakischen Milchmädchen im Bett gelegen. Sie hatten sich ihm praktisch an den Hals geworfen, als sich die Neuigkeit herumsprach, dass er wieder zu haben war.
Trotzdem. Die hatte schon besonders wenig Anstand.
Er verzog das Gesicht. Anstand war kein Ausdruck, den er benutzte, verdammt! Es war überhaupt nicht sein Ausdruck, aber da lag er in seinem Kopf eingebettet wie alles andere. Lara hatte recht gehabt, er hätte niemals den Eid leisten sollen. Wahrscheinlich hatte er es nur wegen ihrer Augen getan, als sie sich ihm in dem dämmrigen Gras dargeboten hatte, wegen dieser überraschend jadegrünen Pupillen, bei der ihn Erinnerungen an Imrana und ihre musselinbehängte Schlafkammer durchzuckten.
Ja, diese Augen, und diese Titten, mein Sohn. Titten hatte die, für die hätte der alte Urann persönlich seine Seele verkauft.
Das war schon besser. Das waren die Gedanken eines majakischen Reiters.
Hör auf zu brüten, verdammt noch mal. Freu dich lieber an dem, was dir der Himmel geschenkt hat!
Er kratzte sich mit einem harten Fingernagel unter seiner Mütze aus Büffelhaut und beobachtete Runi und Klarn, die in der Dämmerung die Herde zurück ins Lager trieben. Jeder Büffel, den er sah, war sein Eigentum, ganz zu schweigen von den Anteilen, die er an den Herden Ishlinaks weiter westlich hielt. Auf den roten und grauen Klanstandern, die an ihren Fahnenstangen wehten, stand in majakischer Schrift sein Name. Er war in der ganzen Steppe bekannt; in allen Lagern, die er aufsuchte, machten die Frauen für ihn die Beine breit. So ungefähr das Einzige, was er heutzutage wirklich vermisste, waren heiße Bäder und eine anständige Rasur. Für beides hatten die Majaker wenig übrig.
Vor ein paar verdammten Jahrzehnten, mein Sohn, hättest du ebenfalls für beides wenig übrig gehabt. Schon vergessen?
Wohl wahr. Vor zwanzig Jahren hatte sich Egars Äußeres, soweit er sich erinnern konnte, kaum von dem der beiden Klangenossen unterschieden. War doch nichts falsch an kaltem Wasser, einem gemeinschaftlichen Schwitzbad alle paar Tage und einem prächtigen Bart! Nicht wie bei diesen verweichlichten Südländern mit ihrem parfümierten Gehabe und der weichen Haut. Weibisch war das.
Ja. Aber vor zwanzig Jahren warst du ein ahnungsloser Trottel. Vor zwanzig Jahren konntest du einen Schwanz nicht von einem Schwertgriff unterscheiden. Vor zwanzig verfluchten Jahren …
Vor zwanzig verfluchten Jahren hatte Egar sich nicht von dem nächstbesten majakischen Viehjungen mit Bartflaum unterschieden. Er kannte nichts von den Ländern jenseits der Steppen, hielt sich für weltklug gehalten, weil ihn seine älteren Brüder nach Ishlin-ichan mitgenommen hatten, damit er dort seine Jungfräulichkeit verlor, und ihm wuchs ums Verrecken kein richtiger Bart. Er glaubte strikt an das, was ihm sein Vater und seine Brüder eingetrichtert hatten, und das war im Wesentlichen, dass die Majaker die rauesten und zähesten Trinker und Kämpfer auf Erden waren, von allen majakischen Klans die Skaranak die härtesten, und dass ein echter Mann niemals woanders leben wollte als in den nördlichen Steppen.
Diese Lebensphilosophie fand Egar mehrere Jahre später, eines Nachts in einer Kneipe in Ishlin-ichan, zumindest teilweise widerlegt. Als er seinen Schmerz über den vorzeitigen Tod seines Vaters bei einer Stampede in Alkohol ertränkte, geriet er, ganz kindisch, mit einem ernsten, dunkelhäutigen Mann aus dem Reich aneinander. Wie sich später herausstellte, war es der Leibwächter eines durchreisenden yheltethischen Kaufmanns. Die Prügelei war größtenteils Egars Schuld; der Mann hatte die Angelegenheit – und ihn – als »kindisch« bezeichnet und ihm dann mit einer ihm unbekannten Kampftechnik, und ohne das Schwert zu ziehen, eine kräftige Abfuhr erteilte. Seine Jugend, sein Zorn sowie die Wirkung des Alkohols hielten Egar eine Weile lang aufrecht, doch zum ersten Mal im Leben hatte er es mit einem professionellen Soldaten zu tun, und das Ergebnis war absehbar. Als er zum dritten Mal zu Boden ging, blieb er liegen.
Verdammte verweichlichte Südländer. Bei der Erinnerung musste Egar grinsen. Ja, genau.
Die Söhne des Kneipenbesitzers hatten ihn hinausgeworfen. Nachdem sich sein Rausch draußen auf der Straße wieder verflüchtigt hatte, hatte Egar immerhin eingesehen, dass ihn der dunkle, ernste Krieger verschont hatte, obwohl er alles Recht gehabt hätte, ihn zu töten. Er ging wieder hinein und bat mit gesenktem Kopf um Entschuldigung. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er sich so etwas gründlich überlegt.
Der yheltethische Soldat nahm seine Entschuldigung mit würdevoller ausländischer Eleganz an, und dann betranken sie sich mit der speziellen Verbrüderung zweier Männer, die gerade einen beinahe tödlichen Zweikampf überstanden hatten. Als der Mann von Egars Verlust erfuhr, nuschelte er eine Beileidszeugung und machte dann, vielleicht listigerweise, einen Vorschlag.
Ein Onkel von mir in Yhelteth, sagte er sehr sorgfältig artikulierend, ist Rekrutierer für die Reichsarmee. Und die Reichstruppen, mein Freund, suchen in diesen Tagen verzweifelt Verstärkung. Wirklich. Gibt dort unten viel zu tun für einen jungen Mann wie dich, der nichts gegen ’ne Rauferei hat. Bezahlung ist gut, die Huren sind geradezu unglaublich. Ehrlich, die sind berühmt. Die Frauen aus Yhelteth verstehen sich am besten darauf, einen Mann zu erfreuen, da kannst du alle anderen vergessen. Du könntest da unten ein gutes Leben führen, mein Freund. Kämpfen, bumsen, abkassieren.
Diese Worte gehörten zu den letzten, an die Egar sich erinnerte, als er sieben Stunden später allein auf dem Kneipenboden erwachte. In seinem Kopf hämmerte es, er hatte einen üblen Geschmack im Mund, und sein Vater war immer noch tot.
Wenige Tage später wurde die Familienherde aufgeteilt – was sein ausländischer Zechkumpan wahrscheinlich gewusst hatte. Als zweitjüngster von fünf Söhnen – und somit als Vorletzter in der Erbfolge – war Egar plötzlich stolzer Besitzer von etwa einem Dutzend räudiger Viecher, die mit der Herde kaum noch mitkamen. Die Worte des yheltethischen Leibwächters fielen ihm ein und klangen plötzlich verlockend: Kämpfen, bumsen, abkassieren. Arbeit für Männer, die nichts gegen eine Rauferei hatten, für ihr Geschick berühmte Huren. Auf der anderen Seite ein Dutzend räudiger Büffel und die Aussicht, von seinen Brüdern herumgestoßen zu werden. Die Entscheidung fiel ihm nicht schwer. Egar hielt sich an die Tradition und verkaufte seinen Anteil der Herde an einen älteren Bruder, packte dann jedoch, statt als bezahlter Hirte anzuheuern, seine Tasche, seine Lanze und ein paar Kleidungsstücke, besorgte sich ein neues Pferd und ritt in Richtung Süden, nach Yhelteth, allein.
Yhelteth!
Weit davon entfernt, von Entarteten und Frauen heimgesucht zu werden, die von Kopf bis Fuß in Tücher gehüllt waren, erwies sich die Hauptstadt des Reichs als Paradies auf Erden. In puncto Geld hatte Egars Zechkumpan recht gehabt. Das Reich rüstete zu einem seiner üblichen Raubzüge ins Handelsgebiet der Liga von Trelayne, und Söldner waren gefragt. Noch besser war, dass Egar mit seiner breiten Gestalt, dem hellen Haar und den blassblauen Augen für die Frauen dieser dunklen, feinknochigen Rasse offenbar nahezu unwiderstehlich war. Und die Steppennomaden – denn für einen solchen hielt er sich damals – erfreuten sich in Yhelteth eines Rufs, der sich kaum hinter ihrer Selbstwahrnehmung zurückstand. Fast alle hielten sie für wilde Krieger, phänomenale Zecher und potente, wenn auch nicht gerade feinfühlige Liebhaber. In nur sechs Monaten verdiente Egar mehr Geld, nahm mehr üppige Speisen und Getränke zu sich und lag in mehr merkwürdigen, parfümierten Betten, als er bis zu diesem Zeitpunkt selbst in seinen wildesten jugendlichen Träumen für möglich gehalten hätte. Und dabei hatte er bis dato eine Schlacht nicht einmal zu Gesicht bekommen, ganz zu schweigen davon an einer teilgenommen. Das Blutvergießen begann erst …
Ein Schnaufen und ein Ruf rissen ihn aus seinen Erinnerungen. Blinzelnd sah er sich um. Dort am östlichsten Rand der Herde, sah es so aus, als würden die Tiere auseinanderstieben und Runi Probleme bereiten. Egar schob seine Gedanken beiseite und legte die schwieligen Hände an den Mund.
»Der Bulle!«, brüllte er verzweifelt. Wie viele Male musste er dem Burschen noch sagen, dass die Herde ihren Anführern folgte! Beherrsche die Bullen, und du kontrollierst den Rest. »Lass die verdammten Kühe in Ruhe, und hol dir diesen Bul…«
»Achtung, Kampfläufer!!!!«
Ein schriller, panischer Schrei, in dem das äonenalte Entsetzen des Steppenhirten lag, von der anderen Flanke. Egars Kopf fuhr herum. Klarn deutete in Richtung Osten. Als er die Augen zusammenkniff, sah er, was Runis Seite der Herde einen solchen Schrecken einjagte. Hohe, bleiche Gestalten, ein halbes Dutzend oder noch mehr, streiften durch das brusthohe Steppengras.
Kampfläufer.
Runi, der sie ebenfalls gesehen hatte, stellte sich vor die Herde. Inzwischen hatte sein Reittier jedoch die Kampfläufer gewittert und verweigerte den Gehorsam. Es preschte vor und zurück, widersetzte sich den Zügeln, und sein entsetztes Wiehern war über den Wind deutlich zu vernehmen.
Nein, so nicht.
Die Warnung blitzte in Egars Kopf auf, dicht gefolgt von der Erkenntnis, dass ihm keine Zeit dafür blieb. Es hätte ohnehin keinen Zweck gehabt. Runi war knapp sechzehn, und die Steppenghule hatten die Skaranak über ein Jahrzehnt lang nicht mehr ernsthaft belästigt. Näher als in den Geschichten, die der alte Poltar am Lagerfeuer erzählte, war der Bursche einem lebendigen Kampfläufer bisher nie gekommen. Er besaß nicht das Wissen, das Egar lange vor Runis Geburt in Fleisch und Blut übergegangen war. Man kann gegen die Steppenghule nicht kämpfen, wenn man stehen bleibt.
Klarn, älter und weiser, hatte Runis Irrtum erkannt, spornte rufend sein eigenes, alles andere als williges Reittier an und umritt die dunkle Masse von Büffeln. Er hatte seinen Bogen vom Rücken genommen und griff nach den Pfeilen.
Er würde zu spät kommen.
Das wusste Egar, ebenso wie er wusste, wann das Gestrüpp auf der Steppe trocken genug war, um sich zu entzünden. Die Kampfläufer waren keine fünfhundert Schritte von der Herde entfernt, eine Strecke, die sie in weniger Zeit zurücklegen konnten, als ein Mann zum Pissen brauchte. Klarn würde zu spät kommen, die Pferde würden durchgehen, Runi würde herunterfallen und dort im Gras sterben.
Fluchend nahm der Drachentöter seine Lanze zur Hand und trat seinem Streitross aus yheltethischer Zucht in die Flanken, sodass es wild losstürmte.
Er war fast angekommen, als der erste der Kampfläufer Runi erreichte, also bekam er mit, was geschah. Der Leitghul rannte an Runis schrill wieherndem Pferd vorbei, fuhr auf einem mächtigen Hinterfuß herum und trat mit dem anderen aus. Runi versuchte, das in Panik geratende Pferd zu wenden und stach hilflos mit seiner Lanze, dann rissen ihn sichelscharfe Krallen rückwärts aus dem Sattel. Egar sah, wie er sich hochrappelte, doch da fielen zwei weitere Kampfläufer über ihn her. Ein langer, qualvoller Schrei erhob sich aus dem Gras.
Bereits in vollem Galopp, spielte Egar die einzige ihm verbliebene Karte aus. Er legte den Kopf in den Nacken und stieß den wilden Schlachtruf der Majak, der Männern weltweit, auf Tausenden von Schlachtfeldern das Blut in den Adern gefrieren ließ. Den schrecklichen Ruf nach dem unausweichlichen Tod und danach, beim Sterben Gesellschaft zu haben.
Die Steppenghule hörten ihn, hoben die langen, spitzen Köpfe mit den blutigen Schnauzen und suchten nach der Bedrohung. Für die wenigen Sekunden, die sie dazu benötigten, glotzten sie mit leerem Blick die Gestalt an, die donnernd über die Steppe heranritt, dann war der Drachentöter über ihnen.
Den ersten Kampfläufer traf die Lanze voll in die Brust. Die Wucht des Angriffs riss ihn zu Boden, zuckend und Blut spuckend. Egar zügelte sein Pferd, drehte die Lanze und riss sie zurück, wodurch die Wunde viermal so groß wurde. Nasse, seilähnliche Organe blieben an den gezackten Rändern der Klinge hängen. Egar zog und zerrte, und als er die Waffe frei bekam, spritzte eine bleiche Flüssigkeit aus dem Körper. Der zweite Ghul griff nach ihm, aber der Drachentöter hatte sich bereits zu ihm umgedreht. Sein Streitross bäumte sich zum Angriff auf und schlug mit den massigen, stahlbeschlagenen Hufen um sich. Der Ghul jaulte auf, als sein sich heranschlängelnder Arm weggeschleudert wurde, dann tänzelte das Pferd einen Schritt vor – eine Übung, wie sie nur die yheltethischen Ausbilder lehren konnten –, und versenkte seinen Huf im Kopf des Kampfläufers. Egar brüllte, spannte die Oberschenkel an und drehte seine Lanze mit beiden Händen. Blut spritzte durch die Luft.
Zwei Meter lang war eine solche majakische Lanze, gefürchtet von jedem Soldaten, der sich jemals einer solchen zu tun gehabt hatte Traditionell wurde sie aus der langen Rippe eines Büffelbullen gefertigt, und an beiden Enden war eine dreißig Zentimeter lange doppelte Sägezahnklinge befestigt, die an ihrer Basis etwa handbreit war. In früheren Zeiten war das Eisen für diese Waffen unzuverlässig gewesen, voller Unreinheiten und schlecht verarbeitet in kleinen, transportablen Schmelzöfen. Später, als Söldner der Liga Trelaynes, hatten die Majak gelernt, einen Stahl zu fertigen, der ihren grimmigen Instinkten entsprach, und die Lanzenschäfte wurden aus dem Holz der naomischen Wälder gefertigt und besonders zugeschnitten und gehärtet. Als die Armeen von Yhelteth schließlich zum ersten Mal im Norden und Westen gegen die Städte der Liga vorgingen, wurden sie von der Lanzenfront der wartenden Steppennomaden wie eine Welle gebrochen. Es war eine militärische Wende, wie sie das Reich seit mehr als einem Jahrhundert nicht erlebt hatte. Anschließend, so hieß es, hätten sogar Yhelteths erfahrenste Soldaten angesichts dessen, was die majakischen Waffen ihren Kameraden antaten, den Mut verloren. Als bei der Schlacht von Maynes Moor die Kampfhandlungen eingestellt wurden, um die Leichen der Gefallenen zu bergen, desertierte ein ganzes Viertel der zwangsweise rekrutierten Reichstruppen und erzählte Schauergeschichten über die wilden Majak, die angeblich Teile der Leichen gegessen hätten. Ein yheltethischer Historiker sagte später über das Gemetzel auf dem Moor, dass die Aasfresser auf dem Schlachtfeld fieberhaft fraßen, weil sie befürchteten, dass bereits ein stärkerer Räuber bereits über den Fleischteppich hergefallen sei und sich auch noch über sie hermachen könnte. Das war frei erfunden, aber es erfüllte seinen Zweck. Die yheltethischen Soldaten nannten die Lanze Ashlan mber thelan, den Dämon mit den zwei Fängen.
Die Kampfläufer griffen von beiden Seiten an.
Egar stieß bereits wie mit einem Bauernspieß zu, links oben, rechts unten, während sein Pferd noch die Hufe auf den Boden setzte. Der Stich nach unten schlitzte den von rechts angreifenden Läufer auf, der Hieb nach oben blockte einen herabsausenden Arm von links und zertrümmerte ihn. Der verletzte Ghul kreischte auf, und Egar ließ die Waffe wirbeln. Auf der linken Klinge klebte ein Auge und die Überreste eines Schädels, auf der anderen Seite nichts. Unten im Gras lag der aufgeschlitzte Läufer und schrie sich die Lunge aus dem Leib, während er verblutete. Der Ghul, dessen Auge und Arm er erwischt hatte, stolperte weiter vorwärts und schlug um sich wie ein Betrunkener, der sich in einer Wäscheleine verfangen hatte. Die übrigen …
Ein plötzliches vertrautes Zischen, ein festes Dong, und die verletzte Kreatur kreischte erneut auf, als ihr plötzlich einer von Klarns Stahlpfeilen aus der Brust ragte. Sie griff mit der unversehrten Hand danach, zupfte verwirrt an dem Ding herum, und ein zweiter Pfeil bohrte sich in ihren Schädel. Für einen Moment schlug sie mit der Klaue nach der neuen Wunde, dann erfasste ihr Gehirn, was der Pfeil angerichtet hatte, und der lange, bleiche Leib brach im Gras neben dem aufgeschlitzten Gefährten zusammen.
Egar zählte drei weitere Ghule, die auf der anderen Seite von Runis Leichnam kauerten und zögerten. Sie schienen unschlüssig, was sie tun sollten. Mit Klarn, der auf seinem Pferd von der Seite heranpreschte, einen neuen Pfeil auflegte und zielte, hatte sich das Blatt gegen sie gewandt. Niemand, dem Egar begegnet war, nicht einmal Ringil oder Archeth, wusste, ob die Kampfläufer eine vernunftbegabte Rasse wie die Menschen waren. Aber sie hatten die Majak und ihre Herden jahrhundertelang gejagt, und beiden Seiten war klar, was sie voneinander zu halten hatten.
In der jähen Stille stieg Egar ab.
»Wenn sie sich rühren, schießt du!«, befahl er Klarn.
Die Lanze in beiden Händen stapfte er durch das Gras auf Runi und die Kreaturen zu, die ihm nach dem Leben trachteten. Trotz seiner reglosen Miene spürte nagende Furcht. Falls sie sich jetzt auf ihn stürzten, würde Klarn höchstens Zeit für zwei Pfeile haben, und die Kampfläufer konnten sich zu einer Höhe von fast drei Metern aufrichten.
Er hatte gerade seinen Vorteil verschenkt.
Aber Runi lag auf dem Boden, vergoss sein Blut in die kalte Steppenerde, und jede Sekunde konnte darüber entscheiden, ob er ihn noch rechtzeitig zu den Heilern bringen konnte oder nicht.
Die Ghule strichen durch das Meer aus Gras herum, und die weißen Kehrseiten leuchteten wie die Wale, die er einmal vor der Küste von Trelayne gesehen hatte. Die schmalen Gesichter mit den Fängen schwebten über langen Schädel und muskulösen Hälsen und beobachteten ihn verschlagen. Irgendwo lag vielleicht noch einer auf der Lauer, wie er es bei ihnen schon gesehen hatte. Er konnte sich nicht daran erinnern, wie viele er zu Beginn gezählt hatte.
Plötzlich schien es kälter zu werden.
Er kam zu Runi, und das Entsetzen packte ihn noch heftiger. Der Junge war tot, Brust und Bauch aufgeschlitzt, die Augen in seinem schmutzigen Gesicht starrten blicklos zum Himmel. Wenigstens war es rasch gegangen; der Boden rings um ihn her war getränkt mit dem Blut, das er vergossen hatte und das im schwindenden Licht schwarz aussah.
Egar spürte, wie sein Puls durch die Sohlen seiner Füße wie Getrommel nach oben stieg. Er biss die Zähne zusammen und blähte die Nasenflügel. Das Getrommel schwoll an und spülte das Entsetzen heraus, schoss durch seine Kehle nach oben und explodierte hinter den Augen. Einen Augenblick lang stand er stumm da und fühlte sich, als hielte ihn etwas am Boden fest.
Sein Blick ging zu den drei Steppenghulen vor ihm in der Dämmerung. Mit zitternder Hand hob er die Lanze, warf den Kopf zurück und heulte, heulte, als könnte er so den Himmel zum Bersten bringen, als könnte er Runis Seele auf ihrem Weg über die Himmelsstraße erreichen und das Band, auf dem er schritt, zerreißen, sodass er zurück zur Erde fiele.
Die Zeit stand still. Jetzt gab es nur noch den Tod.
Er hörte kaum, wie Klarns erster Pfeil an ihm vorbeizischte, als er, immer noch heulend, auf die verbliebenen Kampfläufer zustürmte.
3
Die Fensterscheibe zerbrach mit einem klaren, hohen Klirren, und etwas schlug mitten im Zimmer auf dem abgewetzten Teppich auf.
Ringil regte sich unter dem zerwühlten Bettzeug und öffnete mühsam ein Auge. Die Kanten des zerbrochenen Glases glitzerten im Sonnenlicht viel zu grell, als dass er sie in seinem gegenwärtigen Zustand direkt ansehen konnte. Er wälzte sich auf den Rücken und tastete mit einem Arm nach seinem Gefährten aus der vergangenen Nacht. Seine Hand fand jedoch bloß einige feuchte Stellen des Bettlakens. Der Junge war verschwunden. Das war immer so. Immer suchten sie lange vor Sonnenaufgang das Weite. Im Mund hatte er einen Geschmack wie das Innere eines Fehdehandschuhs, und in seinem Kopf, so dämmerte ihm allmählich, pochte es wie eine majakische Kriegstrommel.
Padrow-Tag. Großartig.
Er wälzte sich weiter herum und tastete den Boden neben dem Bett ab, bis seine Finger ein schweres, unregelmäßig geformtes Ding streiften. Bei weiterer Untersuchung erwies es sich als ein Stein, der in etwas wie teures Pergament eingewickelt war. Er angelte ihn herauf, hielt ihn sich zur Bestätigung vors Gesicht und zog das Stück Papier herunter, das achtlos von einem größeren Bogen abgerissen worden war. Es roch nach Parfüm und war mit trelaynischen Worten bekritzelt:
Steh auf!
Die Handschrift kannte er.
Stöhnend setzte sich Ringil auf, hüllte sich in eines der Laken, kletterte mühsam aus dem Bett und stolperte zu der frisch zerbrochenen Fensterscheibe hinüber. Unten im schneebedeckten Innenhof sah er Reiter. Alle trugen stählerne Kürasse und Helme, die gnadenlos in der Sonne blitzten. In ihrer Mitte stand eine Kutsche, und geschwungene Fahrspuren zeigten an, wo sie gewendet und angehalten hatte. Eine Frau daneben, mit fellgesäumter Kapuze und trelaynischen, herrschaftlichen Gewändern beschattete sich die Augen und schaute zu ihm herauf.
»Guten Tag, Ringil!«, rief sie.
»Mutter.« Ringil unterdrückte ein weiteres Aufstöhnen. »Was willst du denn hier?«
»Nun, vielleicht frühstücken, aber dazu ist es längst zu spät. Hast du deinen Padrow-Abend genossen?«
Ringil legte sich eine Hand an die Schläfe, wo das Pochen am schlimmsten war. Beim Wort ›Frühstück‹ hatte sein Magen unerwartet Kapriolen geschlagen.
»Hör mal, bleib einfach da unten«, sagte er schwach. »Ich komme gleich runter. Und wirf nicht noch mehr Steine. Das geht alles auf meine Rechnung.«
Er steckte den Kopf in die Schüssel neben dem Bett, rieb sich das Wasser übers Haar und Gesicht, säuberte sich die Mundhöhle mit einem Duftzweig aus dem Krug auf dem Tisch und machte sich auf die Suche nach seiner Kleidung, die er übers ganze Zimmer verstreut hatte. Dafür, dass es so klein war, dauerte die Suche länger als erwartet.
Nach dem Anziehen kämmte er sich das lange feine schwarze Haar aus dem Gesicht, band es streng mit einem Fetzen grauen Tuchs zusammen und trat hinaus auf den Treppenabsatz. Die anderen Türen waren fest verschlossen; niemand ließ sich blicken. Die meisten Gäste taten das einzig Zivilisierte: Sie schliefen sich von den Festlichkeiten des Padrow-Tags aus. Er steckte sich das Hemd in die Hose und polterte so schnell wie möglich die Treppe hinab, bevor Lady Ishil von den Feldern Eskiaths es leid war und ihre Wache anwies, die Tür zum Gasthof einzuschlagen.
Er schob den Riegel der Tür zum Hof zurück, trat hinaus und blieb blinzelnd im Sonnenschein stehen. Die Reiter schienen sich nicht gerührt zu haben, seit er vom Fenster weggetreten war, aber Ishil stand bereits an der Tür. Sie warf ihre Kapuze zurück und legte die Arme um ihn. Der Kuss, den sie ihm auf die Wange drückte, war knapp und formell, aber in der Art und Weise ihrer Umarmung lag etwas Drängenderes. Er erwiderte die Geste mit so viel Begeisterung, wie er mit dem pochenden Kopf und dem flauen Gefühl im Magen aufbringen konnte. Gleich darauf trat sie zurück, hielt ihn auf Armeslänge vor sich und musterte ihn wie ein Gewand, das sie vielleicht anziehen wollte.
»Sei gegrüßt, mein wunderschöner Sohn, sei gegrüßt.«
»Woher hast du gewusst, welches Fenster du einwerfen musstest?«, fragte er mürrisch.
Lady Ishil deutete auf das Haus. »Oh, wir haben gefragt. Es war nicht weiter schwierig. In diesem Saustall hier weiß anscheinend jeder, wo du schläfst.« Sie kräuselte ein wenig die Lippen und ließ ihn los. »Und mit wem.«
Letzteres überhörte Ringil. »Ich bin ein Held, Mutter. Was hast du erwartet?«
»Ja, nennt man dich hierzulande immer noch Engelauge?« Sie spähte ihm ins Gesicht. »Ich glaube, heute passt Dämonenauge besser zu dir. Da drin ist mehr Rot als im Krater von An-Monal.«
»Es ist Padrow-Tag«, sagte er knapp. »Augen von dieser Farbe sind Tradition. Und überhaupt – seit wann weißt du, wie An-Monal aussieht? Du bist nie da gewesen.«
Sie schnaubte. »Woher willst du das wissen? Ich könnte jederzeit während der letzten drei Jahre dort gewesen sein. So lange ist es nämlich her, seitdem du deine arme, alternde Mutter besucht hast.«
»Mutter, bitte!« Kopfschüttelnd betrachtete er sie. Alternd war vermutlich eine zutreffende Bemerkung in Anbetracht ihrer knapp über vierzig Jahre, aber anzusehen waren sie ihr so gut wie gar nicht. Ishil hatte mit dreizehn geheiratet und war noch vor ihrem zwanzigsten Lebensjahr vierfache Mutter gewesen. Sie hatte die folgenden zweieinhalb Jahrzehnte Zeit gehabt, um etwas für ihren weiblichen Charme zu tun und dafür zu sorgen, dass Gingren Eskiath zu guter Letzt stets in sein Ehebett zurückkehrte, mochte er auch noch so viel Affären mit anderen, jüngeren Frauen haben, die ihm in die Finger gerieten. Sie legte Kajal im yheltethischen Stil auf, also um Augen und Lippen; das Haar hatte sie aus ihrer zierlichen, beinahe faltenlosen Stirn gekämmt und zu einem Pferdeschwanz zusammengefasst. Diese Stirn sowie die Wangenknochen schrien ihre südliche Herkunft förmlich heraus. Und wenn sie sich bewegte, umschmeichelten ihre Gewänder Kurven, die einer halb so alten Frau angemessener gewesen wären. Unter den oberen Zehntausend von Trelayne kursierten Gerüchte, dass dies auf Hexerei zurückzuführen sei und Ishil ihre Seele für ihr jugendliches Aussehen verkauft habe. Ringil, der ihr oft genug beim Anziehen zugesehen hatte, führte ihr Aussehen eher auf den Gebrauch von Kosmetika zurück, obwohl er beipflichten musste, was den Verkauf der Seele betraf. Ishils ehrgeizige Eltern, Kaufleute, hatten ihre Tochter ins Haus Eskiath verheiratet und ihr dadurch vielleicht ein Leben in Luxus ermöglicht, aber das hatte, wie jeder Handel, seinen Preis gehabt, und der war das Leben mit Gingren.
»Na ja, es stimmt doch, oder etwa nicht?«, meinte sie. »Wann warst du zum letzten Mal in Trelayne?«
»Wie geht es Vater?«, fragte er pflichtschuldig.
Ihre Blicke trafen sich. Sie seufzte und zuckte mit den Schultern. »Ach, du weißt schon. Dein Vater ist … dein Vater. Das Leben mit ihm ist nicht einfacher, seit er grau geworden ist. Er hat nach dir gefragt.«
Ringil zog eine Braue hoch. »Wirklich?«
»Nein, eigentlich nicht. Manchmal, wenn er am Abend müde geworden ist. Ich habe dass Gefühl, dass er vielleicht … etwas bedauert. Zumindest einiges von dem, was er gesagt hat.«
»Liegt er etwa im Sterben?« Es gelang Ringil nicht, die Bitterkeit aus seiner Stimme herauszuhalten. »Bist du deshalb hier?«
Wieder sah sie ihn an, und diesmal glaubte er, ganz kurz Tränen in ihren Augen schimmern zu sehen. »Nein, nicht deshalb. Dafür wäre ich nicht gekommen, und das weißt du. Es ist etwas anderes.« Plötzlich klatschte sie in die Hände und setzte ein Lächeln auf. »Aber was tun wir hier draußen, Ringil? Wo sind sie alle? Dieser Ort ist etwa so lebendig wie ein aldrainischer Steinkreis. Ich habe hungrige Männer und Frauen, Pferde, die gefüttert und getränkt werden müssen. Ich könnte übrigens selbst etwas zu essen vertragen. Möchte dein Gastwirt sich nicht ein paar Liga-Münzen verdienen?«
Ringil zuckte mit den Schultern. »Ich frage ihn. Und danach kannst du mir vielleicht erzählen, was los ist.«
Der Gastwirt, seinem Aussehen nach ebenso verkatert wie Ringil, wurde bei der Erwähnung von trelaynischer Währung etwas munterer. Er öffnete den Speisesaal hinten in der Bar, befahl verschlafenen Stallburschen, sich um die Pferde zu kümmern, und begab sich in die Küche, um nachzusehen, was vom Festschmaus der vorangegangenen Nacht noch übrig war. Ringil begleitete ihn, bereitete sich einen Kräutertrank zu und ging damit zu einem der Eichentische des Speisesaals, wo er in sich zusammensackte und den Dampf anstarrte, der aus dem Becher aufstieg wie ein heraufbeschworener Geist. Bald darauf trat Ishil ein, gefolgt von ihren Männern und drei Hofdamen, die vermutlich noch in der Kutsche gesessen hatten. Sie verursachten Unruhe und machten viel zu viel Lärm.
»Du reist mit leichtem Gepäck, wie ich sehe.«
»Oh, Ringil, sei still!« Ishil ließ sich auf der anderen Seite des Tischs nieder. »Es ist nicht meine Schuld, dass du gestern Abend zu viel getrunken hast.«
»Nein, aber es ist deine Schuld, dass ich so früh aufgewacht bin und mich jetzt mit den Nachwirkungen herumschlagen muss.« Eine der Hofdamen kicherte und schwieg dann errötend, als Ishil ihr einen eisigen Blick zuwarf. Ringil nippte an seinem Gebräu und verzog das Gesicht. »Würdest du mir also bitte mitteilen, worum es geht?«
»Könnten wir nicht zunächst etwas Kaffee haben?«
»Der kommt schon noch. Mir ist nicht sehr nach Plaudern, Mutter.«
Ishil vollführte eine resignierte Handbewegung. »Schon gut. Erinnerst du dich an deine Kusine Sherin?«
»Vage.« Er erinnerte sich an ein Gesicht aus seiner Kindheit, ein blasses kleines Mädchen mit langen Garben dunklen Haars, zu jung, als dass er mit ihr in den Gärten hätte spielen wollte. Er verband mit ihr Sommertage in Ishils Villa unten an der Küste von Lanatray. »Eines von Nerlas Kindern?«
»Dersins. Nerla war ihre Tante väterlicherseits.«
»Ah, ja.«
Ein Schweigen entstand. Jemand trat ein und machte sich daran, ein Feuer im Herd zu entzünden.
»Sherin ist verkauft worden«, sagte Ishil leise.
Ringil sah von dem Becher in seiner Hand auf. »Was du nicht sagst. Wie ist das denn passiert?«
»Wie passiert so etwas heutzutage?« Ishil zuckte mit den Schultern. »Schulden. Sie hatte einen, äh, Händler für Fertigerzeugnisse geheiratet. Du kennst ihn nicht. Er heißt Bilgrest. Das war von einigen Jahren. Ich habe dir eine Einladung zur Hochzeit geschickt, aber du hast nie geantwortet. Wie dem auch sei, dieser Bilgrest war offenbar ein Spieler. Auch hatte er eine Weile auf dem Getreidemarkt spekuliert, und das meistens mit Verlust. Das, und der Versuch, in Trelayne den Schein zu wahren, hat den größten Teil seines Vermögens verschlungen. Weil er sparen wollte, hat dieser Idiot seine Versicherungsbeiträge nicht mehr gezahlt, und dann hat ein Schiff mit seinen Waren vor Kap Gergis Schiffbruch erlitten, und dann, na ja.« Ein weiteres Schulterzucken. »Du weißt ja, wie das läuft.«
»Ich kann’s mir vorstellen. Aber Dersin hat Geld. Warum hat sie Sherin nicht ausgelöst?«
»Sie hat nicht viel Geld, Ringil. Du gehst immer davon aus, dass …«
»Wir sprechen von ihrer verdammten Tochter, um Hoirans willen! Und Garat hat doch gut betuchte Freunde, oder? Sie hätten das Geld irgendwie auftreiben können. Übrigens, warum haben sie Sherin nicht einfach zurückgekauft?«
»Sie wussten es nicht. Bilgrest hat über die Lage der Dinge beharrlich geschwiegen, und Sherin hat bei der Scharade mitgespielt. Sie war immer so stolz, und sie wusste, dass Garat die Heirat eigentlich nie recht war. Anscheinend hat er ihnen oftmals Geld geliehen und nie zurückbekommen. Garat und Bilgrest hatten deswegen wohl einmal eine heftige Auseinandersetzung. Danach hat Sherin einfach nicht mehr gefragt. Ist nicht mehr zu Besuch gekommen. Dersin hat monatelang keinen von ihnen gesehen. Wir waren beide unten in Lanatray, bevor es uns zu Ohren kam, und als wir in die Stadt zurückkehrten – da musste inzwischen eine Woche verstrichen sein. Wir mussten ins Haus einbrechen.« Sie schauderte geziert. »Es war, als käme man in eine Grabstätte. Sämtliches Mobiliar war verschwunden, die Gerichtsvollzieher hatten alles mitgenommen, sogar die Vorhänge und Teppiche, und Bilgrest saß einfach bei geschlossenen Läden da und murmelte im Dunkeln vor sich hin.«
»Hatten sie keine Kinder?«
»Nein, Sherin konnte keine bekommen. Ich glaube, sie hat sich deshalb so sehr an Bilgrest geklammert, weil es ihm scheinbar nichts ausmachte.«
»Oh, prächtig. Du weißt, was das heißt, nicht wahr?«
Ein weiteres tiefes Schweigen. Der Kaffee wurde serviert, dazu das Brot von gestern, geröstet, damit man nicht merkte, wie hart es geworden war, außerdem verschiedene Marmeladen, dazu Öle und aufgewärmte Brühe. Die Bewaffneten und die Hofdamen fielen mit einer solchen Begeisterung darüber her, dass es Ringil erneut flau im Magen wurde. Ishil trank ein wenig Kaffee und betrachtete düster ihren Sohn.
»Ich habe Dersin gesagt, dass du sie suchen würdest«, sagte sie.
Ringil zog eine Braue hoch. »Wirklich? Das war voreilig.«
»Bitte, hab dich nicht so, Gil! Du wirst dafür bezahlt.«
»Ich brauche das Geld nicht.« Ringil schloss kurz die Augen. »Warum kann Vater das nicht tun? Er hat doch wohl die nötigen Mittel.«
Ishil blickte beiseite. »Du weißt, was dein Vater von meiner Familie hält. Alle Verwandten auf Dersins Seite sind praktisch reinblütige Sumpfbewohner, wenn du ein paar Generationen zurückgehst. Seiner Gunst kaum würdig. Und überhaupt, Gingren würde sich nicht gegen die Gesetze stellen. Seit dem Krieg ist schließlich einiges anders geworden. Sherin wurde legal verkauft.«
»Du hättest doch trotzdem Einspruch erheben können. Das ist in der Charta so geregelt. Soll Bilgrest auf den Knien zur Kanzlei rutschen, öffentlich Entschuldigung und Wiedergutmachung anbieten! Dann bist du sein Bürge, wenn Dersin die Mittel nicht aufbringen kann und Vater sich die Hände nicht schmutzig machen will.«
»Meinst du etwa, das hätten wir nicht versucht?«
»Und was ist dann passiert?«
Ein jähes, herrisches Aufblitzen von Ärger, eine Seite Ishils, die er fast vergessen hatte. »Was dann passiert ist, Ringil, ist, dass Bilgrest sich aufgehängt hat, statt sich zu entschuldigen. Das ist passiert.«
»Huch!«
»Das ist nicht komisch.«
»Nein, vermutlich nicht.« Er trank noch einen Schluck Tee. »Dennoch sehr edel. Tod anstelle von Ehrverlust und so. Und das bei einem Händler für Fertigerzeugnisse. Bemerkenswert. Vater muss wider Willen beeindruckt gewesen sein.«
»Es geht hier nicht um dich und deinen Vater, Ringil!«
Die Hofdamen erstarrten. Ishils Aufschrei hallte vom niedrigen Dach des Speisesaals zurück und lockte Neugierige an, die mit offenem Mund an der Schwelle zur Küche und draußen am Fenster zum Hof stehenblieben und glotzten. Die Wächter wechselten Blicke und überlegten offenbar, ob man von ihnen erwartete, sich aufzuplustern und diesen Bauern klarzumachen, dass sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern sollten. Ringil fing einen ihrer Blicke auf und schüttelte leicht den Kopf. Ishil presste die Lippen aufeinander und holte tief Luft.
»Das hat mit deinem Vater nichts zu tun«, sagte sie leise. »Auf ihn verlasse ich mich lieber nicht. Es ist ein Gefallen, um den ich dich bitte.«
»Die Tage, in denen ich für die Sache der Gerechtigkeit, Wahrheit und Aufklärung gekämpft habe, sind vorüber, Mutter.«
Sie richtete sich auf ihrem Stuhl auf. »Es geht mir nicht um Wahrheit oder Gerechtigkeit. Sondern um die Familie.«
Ringil schloss erneut die Augen und massierte mit Finger und Daumen den Nasenrücken. »Warum ich?«
»Weil du diese Leute kennst, Gil.« Sie streckte die Hand über den Tisch aus und berührte mit dem Handrücken seine freie Hand. Er riss die Augen auf. »Als du noch zu Hause wohntest, hast du uns diese Tatsache oft genug unter die Nase gerieben. Du kannst in Trelayne Gebiete betreten, die ich nicht betreten kann, die dein Vater nicht betreten würde. Du kannst …«
Sie biss sich auf die Lippe.
»… das Gesetz beugen«, beendete er trocken ihren Satz.
»Ich hab’s Dersin versprochen.«
»Mutter.« Sein Kater war mit einem Mal zum Teil wie weggeblasen. Er empfand das Ganze als äußerst ungerecht; Ärger wallte in ihm auf und verlieh ihm eine seltsame Stärke. »Weißt du, worum du mich da bittest? Du kennst doch die gewaltigen Gewinnspannen beim Sklavenhandel. Hast du auch nur eine Ahnung, wozu diese Leute dafür bereit sind? Die fackeln nicht lange.«
»Ich weiß.«
»Nein, du weißt es verdammt noch mal nicht. Du hast selbst gesagt, dass die Sache schon Wochen her ist. Wenn Sherin nachweislich unfruchtbar ist – und diese Leute haben Hexenmeister, die das ziemlich schnell herausfinden werden –, dann wird sie so gut wie sicher auf dem Markt für professionelle Konkubinen auftauchen, was wiederum bedeutet, dass sie wahrscheinlich bereits zu einem Ausbildungsstall in Paraschall verfrachtet worden ist. Ich könnte Wochen brauchen, um herauszufinden, wo der liegt, und bis dahin ist sie höchstwahrscheinlich schon auf dem Weg zu einer Auktion irgendwo in der Liga sein, oder vielleicht sogar weiter südlich im Reich. Ich bin keine Ein-Mann-Armee.«
»In der Galgenschlucht warst du es, heißt es.«
»Oh, bitte!«
Er starrte mürrisch in seine Teetasse. Du kennst diese Leute, Ringil. Wären seine Kopfschmerzen nicht so heftig gewesen, hätte er vielleicht gelacht. Ja, er kannte diese Leute. Er hatte sie gekannt, als Sklavenhandel in den Stadtstaaten formal immer noch illegal war und sie ihren Lebensunterhalt leicht über andere verbotene Unternehmungen konnten. Tatsächlich griff kennen ein wenig zu kurz – wie viele andere reiche Jugendliche aus Trelayne war er ein eifriger Kunde dieser Leute gewesen. Verbotene Substanzen, verbotene sexuelle Praktiken, Dinge, die immer einen florierenden Markt und undurchsichtige Mächte hervorbrachten. O ja, er kannte diese Leute. Kitsch-Findrich, zum Beispiel, mit seinen tiefliegenden Augen und dem Speichel, die er stets an den Pfeifen zurückließ, die sie miteinander teilten. Milacar von Gottes Gnaden, der abtrünnige Lakaien mit übermäßiger chemischer Großzügigkeit zu Tode brachte – durch den neurasthenischen Dunst nach einem Schuss Flandrijn war das alles nicht so schlimm erschienen, hatte tatsächlich hervorragend zu der dekadenten pubertären Ironie gepasst, die Ringil damals kultiviert hatte. Die rote Xanthippe, eine stark geschminkte Schönheit, die immer Überdruss und gelangweilte Geduld zur Schau trug, bevor sie eine der Strafen verhängte, für die sie berüchtigt war und die einen lebenslang zum Krüppel machten. Ringil hatte sie einmal geleckt, Hoiran allein kannte den Grund hierfür, aber damals hatte er es für eine gute Idee gehalten. Anschließend war er mit dem ungewohnten Duft einer Frau an Mund und Fingern sowie dem befriedigenden Gefühl vollkommener Selbstbefleckung heimgekehrt. Xanthippe und Findrich hatten ihre Finger bereits im Sklavenhandel gehabt, als er noch missbilligt wurde, und beide hatten sich darüber ausgelassen, was in dieser Branche möglich wäre, wenn der Gesetzgeber die Schraube nur etwas lockern und den Kreditmarkt ein für alle Mal öffnen würde.
Mittlerweile steckten sie vermutlich bis über beide Ohren drin.
Plötzlich überlegte er, wie Milacar von Gottes Gnaden wohl heutzutage aussah. Ob er nach wie vor sein Ziegenbärtchen hatte, ob er sich immer noch den Schädel rasierte, weil er ja später, wie er zu sagen pflegte, sowieso kahl werden würde.
Oh-oh.
Ishil merkte, wie er ins Schwanken geriet. Vielleicht wusste sie es schon, bevor er selbst es wusste. Etwas veränderte sich in ihrem Gesicht, ihre kajalgeschminkten Züge wurden kaum merklich weicher, als ob ein Künstler mit dem Daumen über die allzu harten Linien seiner Skizze gerieben hätte. Ringil blickte auf und sah es. Er verdrehte die Augen und setzte eine leidende Miene. Ishil öffnete den Mund.
»Nein, nicht.« Er hielt eine Hand hoch. »Sag. Einfach. Nichts.«
Seine Mutter schwieg, aber sie lächelte.
Gepackt hatte er im Handumdrehen. Er ging in sein Zimmer hinauf, fuhr wie ein Berserker hindurch und warf ein Dutzend Dinge in einen Rucksack. Hauptsächlich Bücher.
Wieder unten in der Bar, nahm er den Rabenfreund und die kiriathische Scheide vom Kamin. Inzwischen waren überall Leute, Kneipenpersonal und Gäste gleichermaßen, und diejenigen, die ihn kannten, sahen mit offenem Mund zu. Die Scheide fühlte sich fremd an, als er sie in der Hand wog; zum ersten Mal seit langer Zeit hatte er sie von der Aufhängung gelöst. Er hatte vergessen, wie leicht sie war. Er zog das Schwert etwa eine Handbreit hervor, hielt die Klinge ins Licht und sah kurz mit zusammengekniffenen Augen an der Schneide entlang, bevor ihm klar wurde, dass die Handlung keinem Zweck diente und er nur posierte. Seine Stimmung veränderte sich unmerklich. Ein winziges Lächeln spielte um seine Lippen, und dazu gesellte sich eine wachsende Erregung, die er nicht erwartet hatte.
Er legte Scheide und Schwert über eine Schulter, ließ den Rucksack an der anderen Hand baumeln und schlenderte zurück in den Speisesaal, wo gerade die Überreste des Mahls abgeräumt wurden. Der Wirt, ein Tablett in jeder fleischigen Hand, hielt inne und fügte der Sammlung von offenen Mündern noch den seinen hinzu.