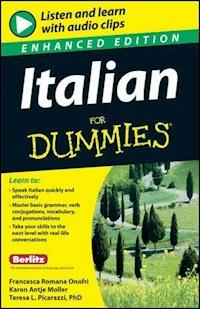Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Wer mit Daten vielfältiger Art kritisch und doch konstruktiv umgehen will (oder dies tun muss), sollte verstehen, wie Da-ten entstehen und wie sie üblicherweise ausgewertet werden. Verstehen wird herkömmlich als Weg und Ziel der Hermeneu-tik von Texten verstanden, für Daten im engeren Sinn ist die Empirie zuständig. Beide Konzepte haben im Grunde sehr ähn-liche Ziele und Gütekriterien: Sie sollen Strukturen und Prozes-se transparent machen und begründete Deutungen für einen öffentlichen Diskurs erarbeiten. Diese Konzepte werden zu-nächst in ihren Grundlagen erläutert und dann an Daten aus einer Befragung über Einstellungen zur Statistik vertieft. Per-spektiven für theoretische und methodische Entwicklungen werden diskutiert. Vorschläge für eine methodisch orientierte Professionalität beenden den Band.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jörg Schlömerkemper, geb. 1943, ist Prof. i. R. an der Goethe-Universität Frankfurt a.M.; Themenschwerpunkte neben Forschungsmethoden: Theorie der Erziehung und Bildung, Schulpädagogik und Bildungsreform.
Vorwort
Wenn man im Alltag fragt, was mit „Wissenschaft“ und „Forschung“ verbunden wird, bekommt man sehr verschiedene Antworten: Die einen halten es im Grunde für entbehrlich, dass sich Menschen in einer Nische der Gesellschaft mehr oder weniger mit sich und ihren Gedankenspielen beschäftigen. Andere erwarten von Wissenschaft „objektive“ Erkenntnisse und gesicherte Wahrheiten. Beide Perspektiven sind nicht gerade förderlich. Den einen muss man zeigen, dass Forschung durchaus für praktisches Handeln hilfreich sein kann, den anderen muss man deutlich machen, dass durch Forschung oftmals mehr neue Fragen entstehen, als beantwortet werden können. Zwischen diesen Polen soll „Daten verstehen“ einen mittleren Weg aufzeigen. Forschung liefert keine Patentlösungen, aber sie kann zu einer besser begründeten Reflexion und zu einem vertiefenden Diskurs anregen.
Innerhalb der Forschung wird (immer noch) unterschieden zwischen eher an Hermeneutik und eher an Empirie orientierten Konzepten bzw. zwischen „qualitativen“ und „quantitativen“ Ansätzen. Über eine freundliche Duldung der jeweils anderen Programmatik hinaus kommt es kaum zu produktiven Ergänzungen. Ohne diese Unterschiede vertuschen zu wollen, soll hier deutlich werden, warum es sinnvoll und möglich ist, diese Konzepte miteinander zu verbinden.
Manche Studierende empfinden Veranstaltungen zu Forschungsmethoden als ein „Martyrium“, dem sie sich nach der Studienordnung unterwerfen müssen, dessen Inhalte sie aber nicht als sehr relevant erleben und deshalb nach der Prüfung alsbald vergessen wollen. Andere empfinden eher geisteswissenschaftlich-philosophisch orientierte Konzepte als „ätzend“, weil man sich in abstrakten Gefilden bewegen muss, deren Bezug zur Praxis nicht immer erkennbar ist oder nicht einmal gesucht wird.
Hier sollen beide Orientierungen zu ihrem Recht kommen. Aber es soll erkennbar werden, in welcher Weise sie miteinander zu tun haben und sogar aufeinander angewiesen sind. An Beispielen aus einer Studie über „Einstellungen zur Statistik“ sollen die Verfahren anschaulich nachvollziehbar werden.
Für vielfältige Anregungen, die ich von Kolleginnen und Kollegen, Hilfskräften und Studierenden erhalten habe, danke ich herzlich. Die frühere Publikation über „Konzepte pädagogischer Forschung“ (Klinkhardt-UTB, 2010) wird hier aktualisiert und um die damals von manchen vermissten konkreteren Beispiele ergänzt. Kritik, Anregungen und/oder Zuspruch sind in die aktuelle Fassung eingearbeitet worden.
Göttingen, im Sommer 2024 Jörg Schlömerkemper
Inhalt
Vorwort
Inhalt
1. Einführung und Überblick
1.1 Hermeneutik oder Empirie?
1.2 Suchen oder Finden?
1.3 Zur Gestalt des Textes
2. Prinzipielle Klärungen
2.1 „Pädagogik“ ‒ ein weites Feld?
2.2 Erkenntnistheoretische Klärungen
2.3 Wissenschaftliches Argumentieren
3. Hermeneutisch-interpretative Konzepte
3.1 Klassische Hermeneutik
3.2 Wahrnehmen: Phänomenologie
3.3 Rekonstruktion von Interviews u.Ä.
4. Empirisch-rationalistische Konzepte
4.1 Induktives Schließen: Positivismus
4.2 Deduktives Prüfen: Kritischer Rationalismus
4.3 Strategien der Forschung
4.4 Daten erheben
5. Qualitativ orientierte Analysen
5.1 Hermeneutische Textanalyse
5.2 Deutung von Phänomenen
6. Quantitativ orientierte Analysen
6.1 Nutzen und Grenzen des Messens
6.2 Skalenwerte, Messwerte und Kennwerte
6.3 Häufigkeiten
6.4 Graphische Darstellungen
6.5 Zentrale Tendenzen: Mittelwerte u.a.
6.6 Streuung und Varianz
6.7 Individuelle Lagen: Prozentrang, Standardwert
6.8 Beziehungen zweier Merkmale: Korrelation
6.9 Inhaltliche Dimensionen: Faktorenanalyse
6.10 Personale Dimensionen: Clusteranalyse
6.11 Entwicklungsverläufe: Pfadanalyse
6.12 Die Erklärung der Varianz
6.13 Die Mehrebenenanalyse
6.14 Meta-Analysen
7. Zur Beurteilung empirischer Befunde
7.1 Statistische Signifikanz bei normalverteilten Daten
7.2 Nicht-parametrische Verteilungen: der Chi
2
-Test
7.3 Praktische Bedeutsamkeit
8. Hermeneutisch orientierte Daten-Analysen
8.1 Konzept und Ziele
8.2 Analysen für Teilgruppen
8.3 Kontrastgruppen
8.4 Schnittgruppen
8.5 Zeitreihen
8.6 Eine quantitativ-qualitative Fallstudie
9. Perspektiven
9.1 Konzeptionelle Grenzen und Gemeinsamkeiten
9.2 Theoretische Folgerungen
9.3 Methodologische Folgerungen
9.4 Methodische Folgerungen
9.5 Professionalisierung fördern
Literatur
1. Einführung und Überblick
Kann man es rechtfertigen, eine gemeinsame Einführung in Hermeneutik und Empirie zu publizieren? Wie kann man deren Darstellung so arrangieren, dass die Leserschaft zu einer aktiven Auseinandersetzung angeregt wird und ein eigenes, kritisches und doch konstruktives Verhältnis zu diesen Konzepten der Forschung und ihren Methoden findet?
1.1 Hermeneutik oder Empirie?
Im Unterschied zu vielen Einführungen, die sich auf das eine oder das andere Feld – auf Hermeneutik oder Empirie – spezialisieren, soll hier versucht werden, das eine mit dem anderen zu verbinden und wechselseitige Bezüge deutlich zu machen. Wenn man die beiden Begriffe nicht zu eng fasst, könnte man in Anlehnung an ein Motto von Immanuel Kant (1724-1804) sagen: Hermeneutik ohne Empirie ist leer, Empirie ohne Hermeneutik ist blind.1
Hermeneutik und Empirie spielen in vielen Bereichen human- und sozialwissenschaftlicher Forschung eine zentrale Rolle. In dieser Einführung werden diese Konzepte und ihre Methoden vor allem am Beispiel pädagogischer bzw. erziehungswissenschaftlicher Themen erörtert. Dadurch können insbesondere normative Aspekte hervorgehoben und diskutiert werden, denn wie in kaum einem anderen Feld ist in der pädagogischen Reflexion zu klären, welche Zielsetzungen und Wertorientierung mit alltäglichen Interaktionen und damit auch mit der darauf bezogenen Forschung verbunden sind. Dass pädagogisches Handeln durch eine besondere Ungewissheit geprägt (oder belastet?) ist, erfordert einen entsprechend offenen Umgang mit normativen Fragen.
Diese Ungewissheit beruht darauf, dass in konkreten Situationen die Faktoren, von denen sie beeinflusst oder gar determiniert sind, häufig nur vermutet werden können und sich ständig verändern. Zudem ist pädagogisches Handeln in aller Regel nicht nur als intentional geleitete Aktion wirksam, sondern durch latente, nicht immer erkennbare Einflüsse geprägt. Mit solchen komplexen Konstellationen gleichwohl sinnvoll umgehen zu können, kann durch Forschung gefördert werden, wenn sie verstehbar macht, welche Ideen bedeutsam sind, und wenn sie vorhersehen kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte Verhaltensweisen durch identifizierbare Faktoren bewirkt sein können. Das alles entlastet nicht von der pädagogischen Pflicht, die jeweilige Situation, die beteiligten Personen – insbesondere die eigene – und mögliche Wirkungen kritisch und verantwortungsbewusst zu analysieren und zugleich vorsichtig, aber doch konsequent zu entscheiden und zu handeln. Hierüber zu reflektieren, macht das Spezifische einer Forschung aus, die praktisches Handeln „explorativ” besser verständlich machen will/soll.
Es geht in dieser Einführung nicht nur um Methoden in einem eher technischen Sinn, sondern auch um den intentionalen Rahmen, in den die verschiedenen Methoden eingebunden sind bzw. auf den sie sich beziehen sollen. Methoden werden als Instrumente verstanden, deren Ergebnisse zu einer differenzierteren und vertiefenden Reflexion befähigen können. Methoden beziehen sich auf Konzepte und Leitlinien. Sie sollen Prozesse, Eigenschaften und Beziehungen in wesentlichen Aspekten so transparent machen, dass sie im wissenschaftlichen und öffentlichen Diskurs konstruktiv verhandelt und praktisch wirksam bearbeitet werden können.
Aber gibt es für eine pädagogisch orientierte Forschung neben den „einheimischen Begriffen“ des Faches (wie vor allem dem der „Bildung“ oder der „Mündigkeit“) überhaupt einheimische Methoden? Zu dieser Frage hat Heinrich Roth (1906-1983) mit seinem Plädoyer für eine „empirische Wendung in der Pädagogischen Forschung“ (Roth 2007, zuerst 1962) wichtige Hinweise gegeben: Ihm ging es damals darum, die seinerzeit auf geisteswissenschaftlich-philosophische Reflexion zentrierte Pädagogik durch Methoden der empirischen Forschung zu ergänzen – mit dem Ziel, dieser Reflexion eine besser gesicherte und kritisch prüfbare Grundlage zu geben. Mit der empirischen Feststellung dessen, was „ist“, sollte die Frage nach dem, was sein „soll“, keineswegs suspendiert werden, sondern diese Reflexion sollte besser fundiert eher intensiver geführt werden können. Man kann es als ein Wechselspiel beschreiben: Die pädagogische Reflexion soll durch empirische Befunde gestärkt werden, aber umgekehrt müssen empirische Befunde zur pädagogischen Reflexion geführt werden.
Das spezifisch Pädagogische der pädagogischen Forschung liegt demnach darin, dass das durchaus schwierige Verhältnis zwischen normativen Fragen und empirischen Fakten transparent werden soll, damit pädagogische Prozesse kritisch kommuniziert und konstruktiv gestaltet werden können. Dies erfordert eine Verbindung zwischen hermeneutischen und empirischen Konzepten der Forschung, und zugleich muss dabei als Ziel und Kriterium leitend sein, dass bzw. ob die Entwicklung zur Mündigkeit gefördert wird. In seinem Plädoyer für eine „empirische Wendung“ hatte es Roth aufdie Formel gebracht: „Die Pädagogik wird auch weiterhin more philosophorum betrieben werden müssen, denn sie ist die Reflexion über eine Aufgabe, die den Kontrollbereich erfahrungswissenschaftlicher Methodik bei Weitem übersteigt.“
1.2 Suchen oder Finden?
In der alltagssprachlichen Rede ist es nicht üblich, zwischen die Begriffe Suchen und Finden ein „oder“ zu setzen: Wer sucht, der findet – wer finden will, muss suchen. Schon in der Bibel heißt es (bei Matthäus 7, 7-8 und Lukas 11, 9-10): „Suchet, so werdet ihr finden.“ Gemeint ist damit: Wer Gott sucht und finden möchte, der wird zu ihm finden. Das Suchen ist Voraussetzung für das Finden. Als Gegensatz hat Hermann Hesse (1877-1962) die Begriffe in seiner Novelle „Siddhartha“ gefasst: „Suchen heißt: ein Ziel haben. Finden aber heißt: frei sein, offen stehen, kein Ziel haben.“
In diesem Sinne können in der Forschung zwei Grundhaltungen unterschieden werden, die durch unterschiedliche Perspektiven gekennzeichnet sind, verschiedene Funktionen haben und zu andersartigen Ergebnissen führen können. Sie sind aber dennoch oder gerade deshalb aufeinander angewiesen. Ihr Verhältnis ist jenem von Hermeneutik und Empirie ähnlich, aber nicht damit deckungsgleich. In beiden Konzepten ist der wissenschaftliche Diskurs weniger eine stringente Abfolge vorab festzulegender Arbeitsschritte, sondern ein Wechselspiel zwischen gezielter Suche und glücklichem Finden.
Suchen bedeutet etymologisch „einer Spur entlang gehen“, ein Ziel verfolgen, etwas Bestimmtes im Blick haben. Es ist mit der Hoffnung verbunden, etwas zu finden, was man vermisst bzw. erwartet. Verwandt sind Begriffe wie „unter–suchen“ oder „durch–suchen“. Man grenzt die Wahrnehmung auf das ein, was man entdecken möchte. Im „ent–decken“ ist impliziert, dass man etwas zu sehen bekommt, das bisher „ver–deckt“, unter einem „Deckel“ verborgen war. Man ist am Ende also glücklich, wenn man das sieht, was man antizipiert hat. Dies kann zum Ausgangspunkt für ein neues Suchen werden, wenn man vermutet, dass noch mehr zu entdecken sein könnte.
Dem gegenüber kann Finden als ein Prozess verstanden werden, der sich auf ein bis dahin unbekanntes Objekt richtet. Das Ergebnis ist offen, man lässt den Blick schweifen, lässt sich von Intuition leiten und hat keine vorbestimmten Kriterien, an denen die Qualität des Fundes gemessen wird. Was der Fund bedeutet und was er wert ist, kann sich erst im Nachhinein erweisen. Finden wird angeregt und begleitet durch Neugier und Aktivität, der Wortsinn verweist auf Weg, Vorgang, in Bewegung sein. Man „kommt auf etwas“, etwas „trifft einen“. Der Begriff „er–finden“ zielt auf etwas, was es noch nicht gab oder nicht bekannt ist (im Unterschied zum „Konstruieren“, das mit vertrauten Parametern arbeitet). Gleichwohl ist mit Finden kein passives Abwarten gemeint, sondern eine aktive Aufmerksamkeit, die nicht gehetzt herumeilt, sondern bereit ist, sich auf etwas einzulassen, etwas aufzugreifen und wahrzunehmen. Eine solche „lockere Wachheit“ ist eher eine Haltung als eine Methode. Sie ist kaum lehrbar und wird durch das Suchen nach Effektivität nicht gerade unterstützt.
Auf den Punkt gebracht hat diese Alternative Pablo Picasso, der auf die Frage nach den Quellen seines Schaffens antwortete: „Je ne cherche pas, je trouve." („Ich suche nicht, ich finde.“).
Diese beiden Ansätze können als Varianten der Heuristik verstanden werden. Unter diesem Begriff wird diskutiert, mit welchen Verfahren man in der (wissenschaftlichen) Reflexion zu Erkenntnissen und zur Lösung von Problemen gelangen kann. Etymologisch abzuleiten ist der Begriff aus altgriechisch „heurískein“, womit ein Finden und Entdecken gemeint ist. Als Heuristik gilt die Kunst, mit begrenzten Voraussetzungen und geschicktem Vorgehen auch dann zu guten Lösungen zu kommen, wenn bewährte Verfahren – so genannte Algorithmen – (noch) nicht vorliegen oder nicht angewendet werden sollen. Dabei mag sowohl das Suchen wie das Finden sinnvoll sein.
Allerdings können beide Haltungen an bedenkliche Grenzen stoßen: Wer sucht, kann nur finden, was er erwartet. Der Blick ist eingeschränkt, manches bleibt außerhalb der Wahrnehmung. Wer stattdessen zu finden hofft, ist darauf angewiesen, dass der Zufall ihn auf eine Fährte führt, auf der etwas zu finden ist. Deshalb ist es wichtig, im Forschungsprozess die Perspektiven zu wechseln bzw. sie gegenseitig zu ergänzen. Wer sucht, sollte offen sein für das, was sich nebenbei finden lässt. Wer finden möchte, sollte sich nicht flatterhaft hin und her bewegen, sondern Wege gehen, auf denen etwas zu erwarten ist, und er sollte aufmerksam wahrnehmen, was sich ihm darbietet. Wer etwas findet, sollte prüfen, ob er dies womöglich unbewusst gesucht hat. In theoretisch anspruchsvollerer Sprache könnte man sagen: Beim „Suchen“ ist die Vielfalt möglicher Aspekte (ihre „Kontingenz“) reduziert, beim „Finden“-Wollen lässt man sich auf sie ein oder fordert sie geradezu heraus. Wer sucht, wird überlegen, wie er nicht nur „das erste Beste“, sondern das „allerbeste“, und nur dies, finden kann. Es wird sich in den nachfolgenden Erörterungen zeigen, dass sich im Forschungsprozess die Gewichte dieser beiden Grundhaltungen ständig verändern (müssen) und dass sie im Prozess der Erkenntnis aufeinander angewiesen sind.
1.3 Zur Gestalt des Textes
Unter Studierenden nicht-naturwissenschaftlicher Fächer wird häufig eine Abneigung oder gar Abwehr gegen „exakte“ und numerische Verfahren bekundet. Diese Einführung ist auch ein Versuch, dies zu überwinden und einen nicht zuletzt auch emotionalen Zugang zu öffnen. Sie richtet sich nicht nur an zukünftige Forscher:innen (im engeren Sinne), sondern auch und vor allem an Professionelle in entsprechenden Handlungsfeldern. Die dafür relevanten Konzepte und Verfahren der Forschung sollen so verständlich (und lernbar) dargestellt werden, dass es zur fundierten Reflexion sozialer Interaktions-Prozesse beitragen kann, sich mit ihnen vertraut gemacht zu haben.
Mathematik ist bei vielen Menschen durch negative Erfahrungen in der Schulzeit belastet oder das abstrakte, formelhafte Kalkül entspricht nicht ihrem eher offenen ästhetischen Empfinden. Eine solche „Mathe-Phobie“ ist in der Literatur vielfach dokumentiert und auch in der Forschung untersucht worden (vgl. die zahlreichen, vielfach kommentierten Hinweise in der Literatur-Datei zu diesem Buch im Internet). Als therapeutische Hilfe kann dabei der „Zahlenteufel“ dienen, den Hans Magnus Enzensberger (1929-2022) einem Jungen im Traum zeigen lässt, wie überraschend und zugleich schön die Welt der Zahlen ist.
Bei einer wissenschaftlichen Einführung ist eine Balance zu finden zwischen einer sozusagen positiven, werbenden Darstellung und eher negativ klingenden Hinweisen auf Grenzen und Probleme. Ich möchte einerseits die Chancen methodisch fundierter Analysen erlebbar machen, aber zugleich davor warnen, diesen Möglichkeiten zu sehr zu vertrauen und zu hohe Erwartungen zu hegen. Ein solches Changieren wird sicherlich dem einen oder anderen hier und da mal mehr zu der einen, mal mehr zu der anderen Seite hin falsch gewichtet erscheinen. Aber für einen forschenden Habitus scheint mir wichtig, sich einerseits mutig zu öffnen und doch skeptisch zu bleiben.
Das Spektrum solcher zunächst noch diffuser Erwartungen und kontroverser Botschaften zieht didaktische Probleme mit sich. Soll man in der Lehre auf diese oder auf die andere Sicht eingehen bzw. welcher soll man entgegenwirken? Den einen wird man glaubhaft machen müssen, dass doch etwas mehr herauskommt als das, was man „schon vorher wusste“, den anderen wird man deutlich machen müssen, dass es mit der „Wahrheit“ nicht so einfach ist, wie man es sich vielleicht wünschen möchte. Übertreibt man in der einen oder in der anderen Richtung, kann dies zu Irritationen führen, die einen konstruktiven Zugang zur „scientific community“ behindern.
In diesem Spektrum soll die vorliegende Einführung sich weder auf der einen noch auf der anderen Seite positionieren, sondern das „und“ betonen: Es geht weder um eine radikale Kritik der Wissenschaft(en), noch um ein optimistisches Plädoyer für objektive Wahrheitsfindung. Vielmehr sollen Möglichkeiten und Grenzen dessen deutlich werden, was wissenschaftliche Kommunikation ausmacht. Einer pauschalen Abwehr soll ebenso entgegen gewirkt werden wie einer naiven Gläubigkeit an „das Objektive“. In der Kontroverse zwischen Hermeneutik und Empirie sollen zwar durchaus die Besonderheiten deutlich werden, es soll aber jenseits ihrer RevierAbgrenzungen sichtbar werden, dass es sich im Grunde um zwei Ausprägungen dessen handelt, was wissenschaftliche Kommunikation ausmacht bzw. ausmachen sollte: Transparenz der Methoden und Kommunizierbarkeit der Argumente.
Ich will mich – nicht nur wegen des begrenzten Rahmens – auf das beschränken, was zur Einführung unerlässlich ist, aber auch ausreichend sein sollte. Wer diesen Text durchgearbeitet hat, sollte am Ende die meisten Forschungsberichte kritisch lesen, ihre Methoden nachvollziehen und die Ergebnisse beurteilen können. Einige Verfahren werden hier nicht ausdrücklich behandelt, aber die Grundprinzipien der wissenschaftlichen Argumentation sollen so weit erläutert werden, dass die Leser:innen (auch mit Hilfe der ausführlich kommentierten Literatur-Datei zu diesem Buch) verstehen, worum es geht und wo sie sich ggf. genauer informieren können.
Diese Einführung geht relativ ausführlich auf Verfahren der statistischen Analyse ein. Dies beruht zum einen auf meiner Wertschätzung empirischstatistischer Verfahren, aber vor allem darauf, dass hermeneutische Verfahren in sehr viel geringerem Maße als Techniken ausgearbeitet sind und dargestellt werden können. Die Verfahrensregeln sind dort relativ einfach zu formulieren, die Schwierigkeiten und die Hauptarbeit entstehen erst in der spezifischen Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Material. Wer hermeneutisch verfasste Untersuchungen kritisch liest, setzt sich vor allem inhaltlich – und weniger methodisch – mit den Interpretationen bzw. den benutzten Quellen auseinander. Bei der Statistik bedarf es wesentlich umfangreicherer Kenntnisse darüber, wie die in den Untersuchungen referierten Kennwerte zustande kommen. Nur dann lässt sich deren Bedeutung sinnvoll einschätzen.
Gleichwohl sollen die Verfahren zur Analyse numerischer Daten so dargestellt werden, dass deren Grundgedanken nachvollziehbar sind. Es soll auch erkennbar werden, was solche Auswertungen zu einer pädagogisch relevanten Reflexion beitragen können. Die grundlegenden Merkmale und der Modell-Charakter (s.u.) dieser Verfahren sind oft nicht auf den ersten Blick erkennbar. Sie sollen gleichwohl „so einfach wie möglich“ dargestellt werden, aber manchmal geht es eben doch nicht einfacher. An den (in dieser Neuausgabe eingefügten) Beispielen zur Frage „Was ist Statistik?“ sollen die Grundgedanken nachvollziehbar werden.
Schließlich möchte ich mit ein paar Sätzen transparent machen, welche Beziehung ich als Person zum Thema dieser Einführung habe: Ich hatte das Zwei-Fächer Studium (Deutsch und Geschichte) für ein Lehramt absolviert, fühlte mich aber unzureichend auf die damit verbundenen pädagogischen Aufgaben vorbereitet. Zudem hatte mich vom ersten Semester an der Pädagoge Heinrich Roth (s.o.) beeindruckt. Er verband konzeptionelle Fragen mit dem Anspruch, diese auf der Grundlage empirischer Forschung zu bearbeiten. Diese Polarität hat mein Denken nachhaltig beeinflusst. In der eigenen akademischen Tätigkeit war es mir wichtig, den Bezug zur Praxis zu halten und zugleich in der Forschung Konzepte hermeneutischer und empirischer Forschung miteinander zu verbinden.
Folgende Hinweise eher formaler und technischer Art möchte ich geben:
Ich versuche, die Konzepte und Methoden
sprachlich so einfach wie möglich
zu beschreiben. Dies soll vor allem jenen Leserinnen und Lesern entgegenkommen, die mit wissenschaftstheoretischen, methodischen und statistischen Fragen erst vertraut werden wollen. Auf dieser Grundlage wird dann der Zugang zu der vielfältigen Literatur hoffentlich leichter zu finden sein.
Es ist keineswegs sicher, ob bei den
männlichen Formen
(„Forscher“ oder „Lehrer“ etc.) die angeblich „immer mit gemeinten“ weiblichen bzw. geschlechtlich diversen Personen wirklich in gleicher Intensität „mitgedacht“ werden. Dies gilt vor allem für Leserinnen und Leser, denen die damit verbundene Problematik nicht bewusst ist. Da dies für die Zielgruppe dieses Bandes sicher nicht zu unterstellen ist, verwende ich hier der Kürze halber auch die generisch neutrale („männliche“) Form.
Ich verwende das Pronomen
„ich“
nicht aus Eitelkeit, sondern weil transparent werden soll, dass sich Einschätzungen o.Ä. nicht irgendwie ergeben, sondern (auch) mit persönlichen Überlegungen und Wertsetzungen verbunden sind. Im Sinne von
Transparenz
(s.u.) scheint mir dies angemessen.
Bei zusammengesetzten Begriffen setze ich gern zwischen den ursprünglichen Teilen einen
Gedanken–Strich
(ohne die an sich üblichen Leerstellen), um an die ursprüngliche Be–Deutung zu erinnern: Es wird eine Deutung beigefügt. Bei langen Begriffen erleichtert ein eingefügter Binde-strich das Lesen, z.B. bei der „Zufalls-Normalverteilung“.
Ich verwende den Begriff
Daten
in einem weiten Sinne, also auch für verbale, sog. „qualitative“ Daten – so wie sich die „elektronische
Daten
verarbeitung“ auch auf Buchstaben und Worte bezieht.
1 In der „Kritik der reinen Vernunft“ heißt es: „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (KrV B75, A51)
2. Prinzipielle Klärungen
In diesem umfangreichen Kapitel sollen grundsätzliche Frage diskutiert werden, die für ein differenzierendes und kompetentes Verständnis sozialwissenschaftlicher Forschung wichtig und zumindest hilfreich sind. Weil diese Einführung sich als Beispiel vor allem auf Fragestellungen der Pädagogik bezieht, soll zunächst geklärt werden, wie in diesem Feld begriffliche und konzeptionelle Fragen diskutiert werden und wie dabei insbesondre mit normativen Fragen umgegangen wird bzw. umgegangen werden sollte. Dabei spielt es in besonderer Weise eine Rolle, was erkenntnistheoretisch unter „Wahrheit“ verstanden werden kann. Ohne den prinzipiellen Anspruch aufzugeben, ist es doch sinnvoll, differenzierter nach möglichen Dimensionen und „Wirksamkeiten“ zu unterscheiden. ‒ Das soll zunächst am Beispiel der „Pädagogik“ erörtert werden.
2.1 „Pädagogik“ ‒ ein weites Feld?
Konzepte und Methoden der sozial-/humanwissenschaftlichen Forschung sollen in diesem Band am Beispiel „pädagogischer“ Themen und Fragestellungen dargelegt und verdeutlicht werden. Was ist zu erwarten, wenn ein bestimmter thematischer Ausschnitt herausgehoben werden soll? Gibt es eine Forschung, die spezifische Fragestellungen oder gar Qualitätskriterien der „Erziehung“ erfüllen soll? Welche Ansprüche könnten das sein? Oder geht es um einen Gegenstands- und Tätigkeits-Bereich, der sich lediglich inhaltlich von anderen Bereichen abgrenzen und erforschen lässt? Sind Konzepte und Methoden einer „pädagogisch“ orientierten Forschung auch für verwandte Bereiche relevant?
Solche Fragen lassen sich halbwegs eindeutig nur beantworten, wenn man sich an bestimmten normativen Anforderungen und Erwartungen orientieren will bzw. orientieren könnte. Das ist angesichts der Vielfalt und der Uneinheitlichkeit der in diesem Feld relevanten Begriffe und Konzepte allerdings kaum möglich bzw. rasch unbefriedigend, sobald andere Aspekte und Orientierungen ins Spiel gebracht werden. Wie man damit in wissenschaftlicher Perspektive umgehen kann, soll in den folgenden Schritte erörtert werden.
Zu der Frage, was das spezifisch „Pädagogische“ ausmacht, gibt es viele durchaus anspruchsvolle Erörterungen, auch normative Ableitungen wie auch gesellschaftliche und/oder bildungspolitische Setzungen. Nicht zuletzt ist der Begriff „pädagogisch“ sowohl mit sehr anspruchsvollen positiven Bewertungen wie auch mit abwehrend negativen Einschätzungen verbunden. Manchmal geht es um Humanität, Aufklärung, Menschenwürde und ähnliche Ziele, andererseits wird mit Pädagogik Dressur, Indoktrination und Anpassung verbunden. Pädagogik soll einerseits zur „Höherentwicklung der Menschheit“ und zur individuellen Entfaltung beitragen (was durchaus bedeuten könnte sich herrschenden Zwängen widersetzen zu sollen), andererseits ist pädagogisch für manche die „Einübung in die herrschenden Verhältnisse“ und die Unterwerfung unter diese.
Eine „pädagogische Forschung“, die sich an wissenschaftlichen Ansprüchen und Gütekriterien orientieren will bzw. sollte, wird sich angesichts dieser uneinheitlichen normativen Vorstellungen weder auf die eine noch auf die andere Seite schlagen dürfen. Sie wird vielmehr versuchen müssen, die Vielfalt solcher Orientierungen analytisch offenzulegen, sie in ihren Widersprüchen aufzuzeigen und diese Verhältnisse begrifflich so zu fassen, dass über „das Pädagogische“ differenziert und kritisch beraten werden kann, im konstruktiven Diskurs mögliche Perspektiven erarbeitet werden können bzw. ein nicht aufhebbaren Dissens transparent wird. In einem ersten Schritt soll der Begriff der „Pädagogik“ thematisch fassbar werden.
„Pädagogik“ wird mehr oder weniger bewusst unterschiedlich weit oder eng verstanden. Idealtypisch kann „Pädagogik“ verstanden werden …
(1) als umfassender Begriff für alle Prozesse, die in irgendeiner Weise in der Beziehung zwischen den Generationen vonstatten gehen, ohne dass dies ausdrücklich mit durchdachten Intentionen verbunden ist,
(2) als verallgemeinernde Deutung solcher Prozesse im Sinne von „Erfahrungen“ und „Theorie“ im umgangssprachlichen Verständnis,
(3) als erkenntnistheoretisch-kritische Reflexion solcher Deutungen und als methodisch-fundierte empirische Analyse praktischer Prozesse,
(4) als theoretisch orientierte und methodisch fundierte professionelle Praxis.
Nach dieser Unterscheidung kann „pädagogische Forschung“ ebenfalls vielfaltig verstanden werden …
(1.) als Forschung, die sich thematisch auf alle Prozesse bezieht, die irgendwie mit dem Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen zu tun haben,
(2.) als Versuch, umgangssprachliche Deutungen pädagogischer Praxis in ihrer historischen Entwicklung zu systematisieren, begrifflich zu schärfen und ggf. zu kritisieren,
(3.) als erkenntnistheoretisch anspruchsvolle kritisch-konstruktive Reflexion pädagogischer Prozesse, ihrer systematisierenden Deutung und der methodisch fundierten empirischen Analyse,
(4.) als ebenso kritisch orientierte und methodisch fundierte pädagogische Professionalisierung bzw. Professionalität.
Pädagogische Forschung ist damit thematisch sowohl bezogen auf die alltägliche Praxis in informellen Bereichen (Familie etc.) wie in institutionalisierten Formen (Kitas, Schulen etc.), sie kann und soll dazu aber in Distanz treten und diese Prozesse und deren alltagsprachliche Deutungen kritisch reflektieren, damit professionelle Kompetenz auf das reflektierte Handeln in der Praxis zurück- und einwirken kann.
„Pädagogik“ oder „Erziehungswissenschaft“
Das Selbstverständnis pädagogischer Forschung und vor allem die unterschiedlichen Auffassungen werden deutlicher verständlich, wenn man sich ihre historische Entwicklung vergegenwärtigt. Das kann hier nur in groben Zügen geschehen.2
Es fällt auf, dass das Themenfeld, um das es hier gehen soll, mit den beiden Begriffen „Pädagogik“ und „Erziehungswissenschaft“ bezeichnet wird. Diese Dualität kennzeichnet zugleich Phasen, aber auch Kontroversen der historischen Entwicklung. Zunächst hat es Pädagogik nur als Teildisziplin bzw. als untergeordnete Fragestellung der Geisteswissenschaften gegeben. Inhaber entsprechender Lehrstühle – wie z.B. der Philosoph Immanuel Kant (1724-1804) oder der Theologe Friedrich Schleiermacher (1768-1834) – waren verpflichtet, auch Vorlesungen über Pädagogik zu halten. Dem entsprechend wurden Fragen der Erziehung vor allem aus der Perspektive dieser Fachrichtungen erörtert. Erst 1779 wurde an der Universität in Halle ein eigenständiger Lehrstuhl eingerichtet, auf den Ernst Christian Trapp (17451818) berufen wurde. Er gilt zugleich als Begründer einer empirisch orientierten Pädagogik, die genau beobachten und beschreiben wollte. Aus der Perspektive seines Schwerpunktes in der Psychologie hat Johann Friedrich Herbart (1776-1841) wesentlich dazu beigetragen, dass die Pädagogik sich nachhaltig als akademische Disziplin etablieren konnte. Dominant blieb allerdings bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts die geisteswissenschaftlich ausgerichtete Pädagogik. Deren Konzept wurde vor allem von Wilhelm Dilthey (1833-1911) erkenntnistheoretisch begründet. Wichtige Vertreter dieser Richtung waren u.a. Eduard Spranger (1862-1963), Herman Nohl (1879-1960), Wilhelm Flitner (1889-1990), Otto Friedrich Bollnow (19031991), Herwig Blankertz (1927-1983), Klaus Mollenhauer (1928-1998) und Hartmut v. Hentig (geb. 1925). Wolfgang Klafki (1927-2016) hat dieses Konzept in vielen Aspekten – vor allem mit Blick auf die Didaktik – weiterentwickelt.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kamen Ansätze einer empirisch orientierten Pädagogik hinzu, für die vor allem Wilhelm August Lay (18621926) und Ernst Meumann (1862-1915) genannt werden müssen.
Während des NS-Faschismus haben Teile der Disziplin die völkischrassistische Ideologie unterstützt, weil sie hofften, dass ihre Ideal-Vorstellungen von „Gemeinschaft“ und ähnlichen Werten verwirklicht würden, sie waren aber blind für die menschenverachtenden Ziele der Herrschenden.
Nach der Befreiung vom Faschismus wurden diese Irrungen in der Disziplin nur zögerlich zum Thema. Man glaubte überwiegend, an den früheren Zielvorstellungen von Humanität, Individualität und Verantwortung anknüpfen zu können. Erst ab etwa 1965 wurde diese Kontinuität radikal infrage gestellt. Die jüngere Generation vor allem der damals Studierenden forderte eine grundlegende Analyse jener Prozesse, in denen diese Ideale pervertiert worden waren. Es wurde deutlich, dass Ideale und Ideologien nicht identisch sind, wenn nicht bewusst ist, welche heimlichen Ziele unter dem Deckmantel scheinbar unangreifbarer Leitmotive verborgen sind oder bewusst verschleiert werden. Die vor allem von Theodor W. Adorno (19031969) und Max Horkheimer (1895-1973) geprägte und von Jürgen Habermas (geb. 1929) weiterentwickelte Kritische Theorie der Frankfurter Schule hat für diese ideologiekritische Deutung wichtige Anregungen gegeben.
Deutlich wurde in diesen Jahren, dass das deutsche Bildungssystem den Anforderungen nicht gerecht wurde, die in einer modernen demokratischen Gesellschaft und angesichts der technologischen und ökonomischen Entwicklungen gestellt waren: Viele Schülerinnen und Schüler erreichten nicht die Leistungen, die für erforderlich und für möglich gehalten wurden. Benachteiligt war dabei vor allem das „katholische Arbeitermädchen vom Lande“. Dieser Befund konnte angesichts der demokratisch-egalitären Ansprüche der Gesellschaft nicht hingenommen werden.
Für die Pädagogik ergaben sich daraus zwei Folgerungen: Zum einen mussten die überkommenen Leitlinien theoretischer Deutungen konsequent auf den Prüfstand gestellt und zum anderen mussten Strukturen und Methoden der pädagogischen Praxis kreativ erneuert werden. Diese Aufgaben sollten mit einer institutionellen Verstärkung des wissenschaftlichen Personals bewältigt werden. Dabei wurden insbesondere sozialwissenschaftliche und psychologische Theorien und Forschungskonzepte und das entsprechende Personal herangezogen. Sie sollten aus der als unkritisch beurteilten geisteswissenschaftlichen Pädagogik eine moderne Erziehungswissenschaftmachen, die von ideologiekritischen Konzepten bis zu pragmatischen Entwicklungen ein breites Spektrum an Erwartungen erfüllen sollte.
Pädagogik und Erziehungswissenschaft sind also durchaus verwandte Begriffe, die sich gleichwohl nach Schwerpunkten unterscheiden lassen. Radikal different wäre eine Unterscheidung, nach der sich Pädagogik ausschließlich auf das Feld und auf Akteure praktischen Handelns bezieht, während Erziehungswissenschaft die Theorie dieser Praxis zu erarbeiten hätte. Im anderen Extrem werden die Begriffe gleichsinnig verwendet – sozusagen einmal als Fremdwort und zum anderen deutsch. In einer moderaten Weise kann man von graduellen Unterschieden sprechen: Es geht immer um das breite Spektrum von praxisbezogener Erfahrung und methodisch fundierter Reflexion. In dieser Spannung kann die Pädagogik stärker bei den Fragen nach Intentionen verortet werden, während die Erziehungswissenschaft stärker nach Tatsachen fragt. Während die Erziehungswissenschaft eine strengere Klärung und Prüfung von Hypothesen verlangt, ringt die Pädagogik stärker um Deutungen und Perspektiven der praktischen Arbeit. Letztlich kommt natürlich das eine wie das andere nicht ohne das aus, was aus der anderen Sicht als Schwerpunkt beansprucht wird: Die Pädagogik muss sich vergewissern, ob ihre Deutungen eine „reale“ Basis haben – die Erziehungswissenschaft muss klären, wie ihre Befunde zu deuten sind und welche Folgerungen gezogen werden können.
Insofern kann der Anspruch einer „Erziehungswissenschaft“ verstanden werden als immer wieder neuer Versuch, die Pädagogik aus Theologie/Kirche und Philosophie zu emanzipieren – das ist freilich nicht (nur) eine Frage der wissenschaftlichen Konzepte und Methoden, sondern der gesellschaftlich-politischen Rahmenbedingungen/Konstellationen, die sich verändert haben bzw. anders gestaltet wurden.
„Erziehung“ ‒ „Bildung“ ‒ „Sozialisation“
In einem zweiten Schritt sollen ‒ ohne dies hier ausführlich diskutieren zu können ‒ die in der Pädagogik bzw. der Erziehungswissenschaft zentralen Begriffe voneinander unterschieden und in ihrer Beziehung zueinander dargelegt werden.
In der öffentlichen und in der wissenschaftlichen Diskussion wird häufig von „Erziehung und Bildung“ oder in Bezug auf Schule umgekehrt von „Bildung und Erziehung“ wie von einer scheinbar selbstverständlichen Verbindung geredet, ohne zu klären, was dabei mit dem „und“ gemeint sein soll: eine Ergänzung verschiedener Prozesse, deren alternative Abgrenzung oder eine verstärkende Reihung synonymer Begriffe. Dabei ergeben sich Überschneidungen und/oder Abgrenzungen:
„Erziehung“
gilt einerseits als unerlässliche Bedingung für die befreiende Entfaltung der Persönlichkeit, während andere Erziehung als repressive Engführung der Heranwachsenden im Interesse der älteren Generation bzw. der Gesellschaft sehen.
„Bildung“
wird (bzw. wurde) gewertet als Beitrag zur Höherentwicklung der Menschheit, zur Entfaltung von Humanität und zur „allseitigen“ Entfaltung der Persönlichkeit, während es in der aktuellen bildungspolitischen Diskussion um Chancen im Leistungswettbewerb und die Legitimation gesellschaftlicher Ungleichheit geht.
„Sozialisation“
wird einerseits kritisch gedeutet als Unterwerfung unter gesellschaftlich dominante („herrschende“) Verhältnisse, zum anderen als Prozess der individuellen Entfaltung in der aktiven Auseinandersetzung mit dem sozialen und kulturellen Kontext.
Diese drei Konzepte werden in vielen Aspekten nahezu deckungsgleich verwendet, sie sind im Grunde thematisch gar nicht sinnvoll trennbar. Angesichts dieser Situation wäre ein übergreifender Begriff wünschenswert, unter dem man diese Vielfalt sinnvoll strukturieren kann. Dieser sollte sowohl weit als auch normativ offen sein für die vielfältigen Orientierungen. Es gibt aber in der pädagogischen Diskussion ‒ so weit ich sehe ‒ keinen Begriff, der dem ohne Vorbehalt und ohne erneute Einschränkungen gerecht würde. Als Alternative wären „Entwicklung“ und „Lernen“ denkbar. Sie könnten zwar die genannten Felder thematisch ansprechen, würden aber die Intentionalität und die Tätigkeit der Erziehenden nicht erfassen. Vielleicht wäre „Edukation“ als übergreifender, alternativer Begriff geeignet. Er wäre ungewohnt und könnte auf eine erweiterte Bedeutung aufmerksam machen. Gelegentlich werden in der Diskussion Begriffe wie „Educational Change“ wie selbstverständlich verwendet. „Education“ wäre zudem an die international gebräuchliche Begrifflichkeit anschlussfähig(er). Er ist in der deutschen Diskussion aber (noch) nicht vertraut.
Mangels überzeugender Alternativen ist es schließlich sinnvoll, den Begriff „Erziehung“ im umfassenden Verständnis zu verwenden: Er bezieht sich auf ein vergleichsweise breites Spektrum der Aspekte, die „pädagogisch“ angesprochen werden sollen. Es geht um Tätigkeiten (das „Erziehen“), aber auch um latente, eher unbedachte Einflüsse („erzogen werden“). In diesem erweiterten Sinne ist es der „Erziehung“ auch zuzuordnen, wenn die Entwicklung von Persönlichkeiten angeregt werden soll durch den Umgang mit „Kultur“, also das „Bilden“ und „Gebildet-werden“. Und auch die Einflüsse und Einwirkungen des gesellschaftlichen Umfeldes lassen sich zuordnen, wenn „Erziehung“ nicht normativ verengt gefasst wird.
Mit Blick auf pädagogische Forschung rückt eine Entscheidung für „Erziehung“ als übergreifenden Begriff ins Zentrum, was in der „Erziehungswissenschaft“ als Wissenschaft von der Erziehung bearbeitet werden soll (ohne dass das Nachdenken über „Erziehung“ nur als Aufgabe der Wissenschaft reklamiert werden soll). Und nicht zuletzt wird die deutsche Diskussion über pädagogische Prozesse im internationalen Diskurs leichter anschlussfähig, wenn sie ihren traditionellen Sonderweg der „Bildung“ dem zu- und unterordnet, was international als „Education“ verhandelt wird (wobei ja selbstverständlich und ähnlich anspruchsvoll auch über das geredet wird, was die Deutschen mit „Bildung“ besonders herausheben zu müssen meinen).
Mit „Erziehung“ sollten also in thematisch übergreifender Sicht alle Aspekte angesprochen werden, die in irgendeiner Weise in der Entwicklung einer Persönlichkeit bedeutsam sind ‒ unabhängig davon, ob dies unbewusst Einfluss hat oder intentional geleitet ist. „Bildung“ ist dabei nicht als Gegensatz oder als lediglich geduldeter Begleiter der Erziehung zu verstehen, sondern als ein wesentlicher Beitrag. Bildung ist „Erziehung im Medium der Kultur“. In ähnlicher Weise ist Sozialisation zu verstehen als „Erziehung im Medium der Gesellschaft“. Wenn aufgezeigt ist, in welchen „Feldern“ pädagogisch relevante Prozesse zu beobachten und zu bedenken sind, dann sollten im nächsten Schritt sowohl verborgene oder unbewusste Einflüsse wie auch intentional geleitete Versuche des Einwirkens und nicht zuletzt die Bemühungen der Zu-erziehenden als „Selbst-Erziehung“ gedeutet werden.
Es ist also nicht zu fragen, ob es um „Erziehung“ (in negativer oder positiver Deutung) geht, sondern, was alles in der Entwicklung einer Persönlichkeit Einfluss hat bzw. einwirken soll. Erst in den jeweils zu untersuchenden Situationen ist zu fragen, ob bzw. unter welchen normativ intentionalen Gesichtspunkten dies geschieht. Erst dann ist zu beurteilen, welche förderliche oder problematische Bedeutung die verschiedenen Wirksamkeiten in der Entwicklung der Persönlichkeiten haben (können) und wie ggf. darauf reagiert werden soll. Statt sich voreilig zu orientieren an eindeutig als richtig erscheinenden Lösungen und beobachtete Prozesse unter solchen Leitlinien zu kritisieren, sollte eine „Auszeit“ genommen werden, damit das Gefüge der möglichen Wirkungen geduldig betrachtet und beraten werden kann. In diesem Sinne sind „Erziehung“, „Bildung“ und „Sozialisation“ zu verstehen als miteinander verbundene Themenfelder pädagogischer Reflexion.
Dieser Vorschlag zur Klärung der Begriffe sollte exemplarisch deutlich machen, wie wichtig es ist, sich darüber zu verständigen, in welchen Kategorien und Dimensionen über ein Untersuchungsfeld und ausgewählte Sachverhalte und Prozesse geredet werden soll. Für Studien zur Pädagogik und Erziehungswissenschaft ist ein weit verstandener Begriff von „Erziehung“ insofern wichtig, als dann nicht nur intentional geleitete und offensichtliche Prozesse zum Thema werden, sondern auch unbewusste unter der Hand und womöglich gegen das gute Wollen wirksame Einflüsse.
Pädagogik und professionelle Praxis
Konzepte der Forschung – insbesondere der pädagogisch relevanten Forschung – sollten nicht losgelöst von inhaltlichen Fragen dargestellt und diskutiert werden. Methoden haben keinen Wert aus sich selbst heraus, sie sollten kein Eigenleben entwickeln, sondern ihre Relevanz daran erweisen, dass sie zur Klärung von Fragen beitragen können, die aus der Funktion der Pädagogik bzw. aus ihren Handlungsfeldern heraus gestellt werden.
Ergebnisse von Forschung können nur so gut sein, wie sie zu theoretischen und/oder praktischen Fragestellungen in Beziehung stehen. Eine solche Beziehung kann darin bestehen, dass eine gängige Theorie überprüft wird oder dass umgekehrt ein bedrängendes Problem, eine irritierende Wahrnehmung auf den Begriff gebracht werden soll und am Ende in einer ggf. neuen Theorie gefasst und „begriffen“ werden kann. Erst ein Bezug zu inhaltlich-theoretischen Konzepten kann Forschung für eine pädagogisch relevante Reflexion hilfreich machen!
Dies ist in anderen Disziplinen im Prinzip auch der Fall, unter pädagogischer Perspektive kommt aber hinzu, dass es nicht bei neutralen, „objektiven“ Feststellungen bleiben kann, denn immer geht es mehr oder weniger ausdrücklich um normative Aspekte: Dürfen und sollen Verhältnisse so bleiben, wie sie sind, oder können und sollten sie geändert werden? Pädagogische Forschung kann nicht deskriptiv bleiben, sie muss sich auch um die normativen Implikationen dessen kümmern, was sich zunächst nur als Tatsache darstellt.
Das schwierige Verhältnis zwischen pädagogischer Theorie und pädagogischer Praxis bzw. zwischen Forschen und Handeln wird seit Jahrhunderten immer wieder diskutiert. Zu dieser Problematik können in prinzipieller Orientierung folgende Positionen unterschieden werden:
Theorie folgt der Praxis; sie analysiert faktische Prozesse und bringt deren Struktur(en) „auf den Begriff“.
Theorie entwickelt Konzepte, die in der Praxis umgesetzt und erprobt werden sollen.
Theorie und Praxis folgen unterschiedlichen Gesetzen: Wissenschaft ist der Wahrheit verpflichtet, die Praxis unterliegt Handlungszwängen und orientiert sich an subjekthaften Interessen, Erfahrungen und Wünschen.
Es gibt unterschiedliche Ebenen der theoretischen Reflexion: In der
Praxis
gelten Alltagstheorien, in der
Wissenschaft
werden inhaltliche, fachliche Konzepte entwickelt und auf einer
Metaebene
werden die Entwicklung und die Bedeutung der beiden unteren Ebenen gedeutet.
Die Sicht auf die jeweils andere Ebene ist häufig mit mehr oder weniger dezidierten Vorurteilen und pauschalen Bewertungen verbunden. Theorie gilt in der Praxis oft als unbrauchbar, Theoretiker werden als überheblich und arrogant wahrgenommen. Umgekehrt gelten Praktiker manchem Theoretiker als ignorant und wenig reflektiert: Sie würden sich auf „Erfahrungen“ berufen und in Routine erstarren. Aus solchen wechselseitigen Einschätzungen folgt eine unproduktive Abgrenzung.
Zweifellos sind theoretische Reflexion und praktisches Handeln nicht identisch, die Aufgaben sind verschieden, aber sie berühren sich in wesentlichen Aspekten. Das eine kann und sollte für das andere nützlich und wichtig sein. Wissenschaft und Erziehungswissenschaft im Besonderen müssen ihre Berechtigung darin suchen und daran erweisen, dass sie zur Reflexion und zur (Weiter-)Entwicklung praktischen Handelns beitragen können. Leitbild sollte dabei sein, die Bedingungen zu optimieren, unter denen das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit verwirklicht werden kann. In diesem Sinne muss Forschung zur professionellen Kompetenz der in der Praxis Tätigen beitragen. Damit ein solcher Transfer möglich ist, müssen auch auf der Seite der Praktiker entsprechende Kenntnisse und Fertigkeiten erworben werden. Wer pädagogisch handelt, sollte Bedingungen und Verläufe dieses Handelns transparent machen und dessen Ergebnisse kritisch beurteilen können. Das ist nur im Medium einer an wissenschaftlichen Gütekriterien orientierten Reflexion möglich. Diese Dimension der Ausbildung zielt auf eine professionelle Kompetenz, die als forschender Habitus bezeichnet werden kann.
Bei einem forschenden Habitus geht es weniger darum, Ergebnisse der Forschung in die Praxis zu übertragen und „1 zu 1“ anwenden zu können, sondern Ziel ist eine an theoretischen Kenntnissen orientierte und durch Methoden gestützte Auseinandersetzung mit situativen Merkmalen und Prozessen der jeweiligen Praxis. Dies mag auch ohne theoretische und methodische Schulung möglich sein: Im alltäglichen Handeln sammelt jeder Informationen, jeder bezieht sich auf Erfahrungen, jeder erwartet bestimmte Wirkungen des Handelns, jeder deutet seine Erlebnisse etc. Aber im Alltag ist man nur für sich selbst verantwortlich. Wer in einer Profession tätig ist, hat Einfluss auf andere Menschen, und er sollte diesen so gut wie möglich, und zugleich kritisch kontrolliert wahrnehmen – er sollte „professionell“ handeln: Er sollte Informationen bewusst(er) sammeln, er sollte Erfahrungen theoretisch einordnen können, er sollte Vermutungen und Erwartungen systematisch prüfen und seine Deutungen als Vermutungen und Vorschläge zur Diskussion stellen etc. Ich betone dabei den Prozesscharakter. Es geht nicht um definitives, richtiges Wissen, sondern um den reflektierenden Bezug zu verantwortlichem Handeln. Der amerikanische Sozialwissenschaftler und Pädagoge Donald A. Schön (1930-1997) hat diesen Gedanken im Konzept des reflektierenden Praktikers gefasst. Dies ist mit dem Konzept des forschenden Habitus gemeint. Die Lektüre dieser Anleitung zum Verstehen von Daten soll zu einer solchen Haltung beitragen.
Für den Umgang mit Forschung kann deshalb als Motto gelten: Forschung ist Medium, nicht das Ziel! Es geht weniger um instrumentelles Wissen, sondern um prozedurales Können. Forschende Aktivitäten von pädagogisch Handelnden zielen also nicht auf Publikationen – jedenfalls nicht in erster Linie. Erst auf einer zweiten, umfassenderen Ebene können Erfahrungen sozusagen gebündelt werden, um z.B. analytische und/oder konzeptionelle Debatten über Handlungsprobleme anzuregen und voranzutreiben. Es geht darum, Deutungs- und Handlungsvorschläge kritisch und konstruktiv zu beraten, ihre Validität (s.u.) zu beurteilen. Kriterium der Gültigkeit ist dann nicht, ob Aussagen und Sichtweisen generalisierbar sind, sondern ob sie der jeweiligen Situation angemessen sind, ein vertiefendes Verständnis anregen und eine kollegiale Verständigung ermöglichen. Es ist das, was Herbart mit dem Begriff des pädagogischen Takts gefordert hat: dass man auf dem Hintergrund theoretischen Wissens (das nicht als eindeutige Anleitung missverstanden wird), aber mit Rücksicht auf die konkrete Situation zu verantwortungsbewusstem Handeln kommt, das den jeweiligen Bedingungen (wahrscheinlich) am besten gerecht wird.
Nun kann man durchaus darüber streiten, welchen Stellenwert Forschung in der beruflichen Tätigkeit – und im pädagogischen Takt – von Pädagoginnen und Pädagogen haben soll. Sicherlich ist methodisch anspruchsvolle Forschung erst möglich, wenn entsprechende Methoden verwendet werden, wenn geschultes Personal dazu zur Verfügung steht, wenn Befunde ohne Handlungsdruck analysiert werden dürfen und mögliche Folgerungen in Ruhe erwogen werden können. Dies erfordert spezifische Kompetenzen und förderliche Situationen. Im Vergleich dazu steht das alltägliche pädagogische Handeln unter Handlungsdruck, der eine distanzierte und geduldige Reflexion zumindest erschwert. Aber so wie unter der forschenden Distanz der Bezug zur Praxis nicht verlorengehen darf, so muss im professionellen Handeln der Bezug zu den professionell relevanten Wissenschaften wirksam bleiben. Dabei kann sicherlich nicht jeder Praktiker in allen relevanten Dimensionen zu Hause sein, aber eine Haltung, ein Habitus des intensiven Suchens und Findens scheint mir für die weitere Entwicklung professioneller Kompetenz sehr wünschenswert. Diese Einführung soll das wechselseitige Verständnis fördern, indem die teilweise sehr elaborierten Konzepte und Verfahren pädagogischer Forschung in ihren Grundgedanken transparent(er) gemacht werden. Es soll deutlich werden, dass mit „Wissenschaft“ sehr unterschiedliche Erwartungen verbunden sind: Manche halten sie für „objektiv“ und im Ergebnis eindeutig; erst wenn etwas endgültig „bewiesen“ und „geprüft“ ist, könne es das Gütesigel „wissenschaftlicher“ Erkenntnis bekommen. Für andere ist „Wissenschaft“ nicht besser und nicht verlässlicher als alltägliches Gerede. Von zwei Wissenschaftlern bekomme man auf eine konkrete Frage mindestens drei verschiedene, also im Grunde wertlose Antworten. ‒ Wer wissenschaftlich arbeiten will, muss sich in diesem Spektrum positionieren.
Wissenschaft und Öffentlichkeit/Politik
In der öffentlichen Meinung sind über Wissenschaft konträre Einschätzungen zu hören:
Einerseits ist eine eher ehrfurchtsvolle Vorstellung von Wissenschaft weit verbreitet: Wenn etwas „wissenschaftlich festgestellt“ ist, dann wird es wohl so stimmen. Wissenschaft ist der Wahrheit sehr nahe, jedenfalls näher als der „gesunde Menschenverstand“.
Andererseits haben viele ein tiefes Misstrauen gegen alles, was den Anspruch erhebt, „Wissenschaft“ zu sein: „Was heißt schon „Wissenschaft“? Die gehe doch meistens an der Wirklichkeit vorbei, oder ihre „Ergebnisse“ seien so banal, dass Leute mit praktischen Erfahrungen das Gleiche in einfachen Worten besser ausdrücken könnten.
Solche Positionen sind in so allgemeiner Form überzogen, aber sie enthalten durchaus ein „Körnchen Wahrheit“: Für die eine wie die andere Meinung gäbe es Beispiele und Belege. Die ganze Wahrheit ist jedoch komplizierter, schon allein deshalb, weil es die Wissenschaft nicht gibt – nicht einmal innerhalb eines Faches. In diesem Kapitel soll ein realistisches Bild von Wissenschaft aufgezeigt werden, in dem ihre Möglichkeiten ebenso erkennbar werden wie „Risiken und Nebenwirkungen“.
Pädagogische Forschung ist auf viele Bereiche der Lebenswelt bezogen. Vom Verhältnis zwischen den Generationen, von Bildung und von der Gestaltung des Lehrens und Lernens sind viele betroffen. Von daher ergeben sich etliche grundsätzliche Fragen und wegen der laufenden Änderungen in diesen Bereichen müssen solche Fragen immer wieder neu bearbeitet werden. Im folgenden Abschnitt sollen solche Beziehungen, Erwartungen und Herausforderungen näher betrachtet werden.
Wissenschaft und Politik gelten als personell und funktional getrennte Regionen, deren Ziele und Verfahren nicht kompatibel sind: Die einen denken und forschen langfristig in eigener, immanenter Logik und seien von Verwertung o.ä. frei. Die anderen müssen handeln, entscheiden und werden durch die öffentliche Meinung kontrolliert und ggf. bei Wahlen korrigiert, sie dürfen und sollen durchsetzen, was sie für richtig erachten.
Eine prinzipielle Trennung zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit bzw. Politik wird spätestens unter ideologiekritischer Betrachtung fraglich. Wissenschaft hat eine gesellschaftlich-politische Bedeutung. Sie deutet Realität nicht nur neutral-distanziert, sondern sie trägt zum Verständnis und zur Gestaltung unserer Lebenswelt bei. Dabei wird Wissenschaft gern zur Rechtfertigung politischer Entscheidungen herangezogen. Zudem ist die Politik angesichts ständig komplexer werdender Probleme auf Expertise angewiesen. Diese enge Beziehung ist nicht unproblematisch, weil wissenschaftliche Forschung finanziell und damit auch inhaltlich von jenen Kräften abhängig werden kann, die Forschung in Auftrag geben und damit Prioritäten setzen.
Für die pädagogische Forschung ergibt sich aus ihrer Beziehung zu gesellschaftlich-politisch bedeutsamen Fragen ein Dilemma: Ethischnormative Fragen können vom pädagogischen Auftrag her und unter pädagogischer Verantwortlichkeit nicht ausgeblendet werden. Werturteile können aber nach einem Diktum des Soziologen Max Weber (1864-1920) wissenschaftlich nur analysiert, nicht aber entschieden werden. – Diese Trennung ist prinzipiell plausibel, in der Forschungspraxis aber schwer einlösbar. Denn schon die Entscheidung, ob eine bestimmte Fragestellung oder eine andere bearbeitet wird, hat normative Implikationen. Und gerade die Erklärung, sich rein auf das Faktische beziehen zu wollen, kann abblenden, welche bewussten oder unbewussten normativen Intentionen mit der angeblichen Betrachtung „sine ira et studio“ verbunden sind oder verfolgt werden. Da ist es einzig und allein hilfreich, die politisch-gesellschaftlichen Implikationen bewusst zu machen, sie ausdrücklich zu reflektieren und transparent zu machen. Dann kann Forschung sich durchaus eher auf der objektiven Seite positionieren oder einer bestimmten normativ-intentionalen Perspektive folgen, solange das je andere nicht ausgeblendet wird (s.u.).
Es ist schwierig, die Erwartungen des politischen und gesellschaftlichen Umfeldes zu erfüllen. Pädagogische Reflexion ist immer in Gefahr, sich mit abstrakten Fragestellungen in einen internen Diskurs zurückzuziehen, der in der Öffentlichkeit als wenig relevant erlebt wird. Grundsätzliche, philosophische Erörterungen können jedoch auch und gerade für eine kritische Klärung praktischer Fragen bedeutsam werden, wenn eine entsprechende thematische Beziehung hergestellt wird.
Auch auf einer primär an Praxis orientierten Seite sind Erwartungen der Öffentlichkeit nicht immer zu erfüllen. In der Regel können Befunde nicht so schnell und nicht so eindeutig erbracht werden, wie politische Entscheidungsträger es sich gewünscht hätten. In aller Regel ergeben sich nur Aussagen über wahrscheinliche Entwicklungen, über funktionale, korrelative Beziehungen, die nicht kausal interpretiert werden können und nicht sicher und verbindlich erklären, was zu tun ist. Diese Forschung kommt immer dann an eine Grenze, wenn die konkreten Bedingungen einer Situation und eines „Falles“ nicht hinreichend transparent sind und dem handelnden Zugriff nicht verfügbar gemacht werden können. Die Ergebnisse sind häufig zu komplex, zu unscharf, zu wenig eindeutig, häufig bereits selbst wieder relativiert – z.B. wegen begrenzter Stichproben, gegenläufiger, sich widersprechender Befunde, möglicher Nebenwirkungen.
Dies wurde durchaus als Nachteil empirisch-statistischer Forschung erkannt mit der Folge, dass die so genannte qualitative Forschung – also vor allem die vertiefende Analyse authentischer, echter Fälle – in den Vordergrund rückte. Dabei werden zwar komplexe Beziehungen und Prozesse in ihrer Tiefenstruktur aufgedeckt, aber eben nur für den jeweiligen Fall – mit der Folge, dass diese Befunde kaum generalisierbar sind und kaum Handlungsanleitungen für andere Fälle und Situationen geben können.
In der Politik steht das, was sein soll bzw. von der jeweiligen Mehrheit der Entscheidungsträger gewollt ist, im Vordergrund; es geht nicht um „Wahrheit“, sondern um Zweckhaftigkeit und politische Gestaltung, letztlich um die Durchsetzung eines politischen Wollens. Für dieses Wollen wird mit Hilfe etablierter und anerkannter Verfahren Legalität hergestellt („Die Mehrheit hat entschieden und hat damit Recht“). Dabei geht es nicht um „Wahrheit“ im abstrakt-prinzipiellen Sinne, sondern darum, dass im Zusammenleben von Menschen, Gruppen und Staaten bestimmte Fragen irgendwie geregelt und entschieden werden müssen und dass möglichst viele Betroffene (eben mindestens die jeweilige Mehrheit) die „Richtigkeit“ solcher Entscheidungen anerkennen, dass sie ihnen Legitimität zusprechen und sich entsprechend verhalten.
Wissenschaft spielt in diesem „Konzert“ gesellschaftlicher Stimmen nur eines der zahlreichen Instrumente. Sie kann zwar für sich beanspruchen, eine besonders reine Stimme spielen zu wollen, aber ob sie sich gegen lautere Stimmen durchsetzen kann, wird ggf. ohne sie oder gar gegen sie entschieden.
Andererseits werden wissenschaftliche Befunde überbewertet und/oder missbraucht. Aus differenzierten Berichten und vorsichtigen Erörterungen werden einzelne Zitate ausgewählt, verkürzt, umgedeutet oder überbewertet. Aus vorsichtigen Vermutungen („Es deutet sich an, …“) werden oftmals im Verlauf der Rezeption dezidierte Feststellungen („Die Wissenschaft hat festgestellt …“). Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beeinflussen die Kommunikation über soziale Realität selbst u.a. dadurch, ...
dass sie Realität in bestimmter Weise wahrnehmen und ihre Beschreibung zur Diskussion stellen,
dass sie ihre Wahrnehmungen in bestimmter, ausgewählter Weise erklären und deuten,
dass sie ggf. gewünschte, favorisierte Alternativen zur Realität entwickeln – oder dies als „Realität“ bestätigen,
dass sie über Schwerpunkte und Zielsetzungen ihrer Forschung entscheiden,
dass sie die zu untersuchenden Merkmale auswählen,
dass sie definieren, wie bestimmte Merkmale erfasst und verstanden werden sollen,
dass sie Wirklichkeit an ihren eigenen Prinzipien messen und ggf. auf Diskrepanzen aufmerksam machen,
dass sie Ergebnisse der Forschung deuten und in ihren eigenen Interpretationen veröffentlichen.
Wissenschaftliche Aktivitäten beschränken sich also keineswegs auf die Beschreibung und Ent–deckung vorfindlicher Wirklichkeit, sondern Wissenschaft stellt diese Wirklichkeit selbst mit her, zumindest entwickelt sie eine Art zweite Wirklichkeit, die in der Lebenswelt, zu der sie gehört, durchaus Folgen hinterlässt. In diesem Zusammenhang wird häufig von der „sichselbst-erfüllenden Prophezeiung“ gesprochen: Die Beschreibung von Wirklichkeit wird selbst zur Wirk–lichkeit (im Sinne von Wirksam–sein). Wissenschaft ist also eine Form des gesellschaftlich-politischen Handelns.
Dies darf nun wiederum nicht so verstanden werden, dass Forschung sich willkürlich an subjektiven Sinndeutungen und Zielsetzungen orientieren könne oder sich gar darin erschöpfen dürfe. Zum einen ist natürlich nicht jeder Zweck sinnvoll (das ist die Frage nach der ethischen Legitimation von Forschung), zum anderen ist nicht jedes Ziel realisierbar. Wenn Wissenschaftler danach fragen, wohin sich unsere Lebenswelt entwickeln könnte, sollen ihre Vorschläge moralisch vertretbar und praktisch relevant (realisierbar) sein. Wissenschaft steht also in einem Spannungsverhältnis zwischen dem subjektiven (bzw. gesellschaftlichen) Wollen und den objektiven (sachlichen) Möglichkeiten. Die Grenze von Wissenschaft liegt also darin, dass auch sie letztlich nur Vorschläge zu Deutungen und möglichen Folgerungen machen kann. Ob ihre Interpretationen verbindlich und ihre Handlungsvorschläge verwirklicht werden, ist eine Sache gesellschaftlicher Prozesse – gleichwohl haben Vorschläge der Wissenschaft als solche die Welt im Prinzip auch dann schon verändert, wenn sie nur Vorschläge sein wollen.
Was kann/soll „Statistik“ dazu beitragen?
Die Frage „Was ist Statistik?“ soll in dieser Einführung bei verschiedenen Aspekten als Beispiel dienen. Viele Fragen können dabei zu bedenken sein:
Seit wann gibt es „Statistik“?
Wie ist es zu dieser Benennung gekommen?
Sind Interessen erkennbar, die mit der Entstehung und Entwicklung der Statistik verbunden waren?
Wie verhält sich statistisches Erkennen zu den „realen“ Verhältnissen?
Ist mit Statistik eine bestimmte, möglicherweise eingeschränkte bzw. fokussierte Sichtweise verbunden?
Können verschiedene Konzepte oder Modelle unterschieden werden?
Wie wird Statistik in der öffentlichen Diskussion verwendet? Wirkt sie eher aufklärend oder engt sie den Blick ein?
Wird Statistik wertgeschätzt oder eher negativ beurteilt?
Kann man Statistik vertrauen?
Wie kann Statistik kritisch beurteilt werden, werden eventuelle Manipulationen erkennbar?
Wie kann man Statistik am besten lernen? Was ist dabei ggf. hinderlich?
Haben Menschen mit besseren bzw. schwächerer mathematischen Kenntnisse unterschiedlichen Zugang zu Statistik?
Spielen Erfahrungen in der eigenen Schulkarriere dabei eine Rolle?
Könnte Statistik verbessert werden?
Thematisch könnte eine empirisch-analytisch orientierte Untersuchung über „Statistik“ herausarbeiten wollen, ob es Ereignisse gibt, die sich im Sinne von „Ursache-Wirkungs-Beziehungen“ beschreiben lassen. Sie würde versuchen, verschiedene Annahmen, Behauptungen, Theorien, die zu solchen Fragen vorgebracht werden können, dadurch zu überprüfen, dass sie diese mit konkreten Situationen, die möglichst genau beobachtet und eindeutig beurteilt werden können, konfrontiert und sie der Möglichkeit des Scheiterns aussetzt. Aussagen, die allgemein gültig sein wollen, werden nicht als solche geprüft, weil man das ohnehin nicht mit Sicherheit tun kann, sondern es werden aus diesen allgemeinen Aussagen konkrete Sätze abgeleitet, die überprüfbar sind.
Beispielsweise könnte die Behauptung untersucht werden, dass Frauen stärkere Abneigung gegen Statistik haben als Männer. ‒ Wenn dies zutrifft, dann müsste sie auch in einer zufällig ausgewählten und näher betrachteten Fall-Gruppe (wie z.B. den Studierenden der Pädagogik einer bestimmten Hochschule) erkennbar sein.
Dabei wäre die Rede von „Abneigung“ noch recht allgemein. Sie könnte konkretisiert werden, indem sie z.B. auf bestimmte Aussagen in einer Befragung bezogen wird: Etwa die Aussage „Die Beschäftigung mit Statistik (in einer Lehrveranstaltung) wird mir Spaß machen.“ Die überprüfbare Konkretisierung der allgemeinen Behauptung würde dann lauten: Frauen stimmen dieser Aussage weniger zu als Männer.
Nun wäre aber noch nicht geklärt, was „weniger“ bedeutet bzw. in welchem Ausmaß ein „weniger“ bedeutsam ist. Im Sinne des kritischen Rationalismus müsste vor Beginn einer Untersuchung, spätestens vor Beginn der Auswertung und der Interpretation festgelegt werden, wie stark sich Männer und Frauen in der Beantwortung dieser Frage unterscheiden müssen, wenn der angenommene Unterschied als empirisch bestätigt gelten soll bzw. wann die Annahme als „falsifiziert“ (s.u.) gelten soll.
Schließlich wäre noch zu klären, ob denn jede beliebige Untersuchungsgruppe als eine akzeptiert werden soll, an der die in Frage stehende allgemeine Behauptung („Frauen haben stärkere Abneigung gegen Statistik“) überprüft werden kann. Das Kriterium „Frau/Mann“ galt bisher als eindeutig, aber können Studierende der Pädagogik stellvertretend für „die Frauen“ und „die Männer“ untersucht werden, gelten deren Ergebnisse überhaupt für Studierende aller Fächer, aller Hochschulen, aller Semester und für alle Zeiten?
Empirisch-analytische Forschung bringt also im strengen Sinne zunächst nur sehr detaillierte und begrenzt gültige Ergebnisse hervor. Man kann zunächst immer nur sagen, für diese und jene Gruppe, mit jener Methode, zu einem bestimmten Zeitpunkt habe sich gezeigt, ob eine Aussage Zustimmung findet oder nicht. Erst die Summe vieler Untersuchungen kann zu einer reichhaltigen, differenzierteren Theorie führen, in der so etwas wie der Gesamtzusammenhang aufscheint. Damit stellt sich dann wieder die Frage, wie all diese Details zu „verstehen“ sind, welche „Bedeutung“ sie haben. Und damit nähert sich die empirische Forschung wieder jenen Fragen, denen sich die Hermeneutik besonders verbunden fühlt.
2.2 Erkenntnistheoretische Klärungen
Die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen des Erkennens ist in vielen Dimensionen und Disziplinen des theoretischen Denkens ausführlich und kontrovers diskutiert worden. Auf prinzipieller Ebene ist es zunächst eine Fragestellung der Philosophie. Sie wird dort unter dem Fachbegriff der Epistemologie verhandelt, also der „Logik des Wissens oder der wahren Erkenntnis“. Natürlich ist auch die Erziehungswissenschaft mit solchen Fragen konfrontiert.
Wissenschaft wird in der Regel mit dem Anspruch verbunden, dass sie „die Wahrheit“ ans Licht bringt oder wenigstens dazu beiträgt, dass man „erkenn(t), was die Welt im Innersten zusammenhält“. Dies war schon Goethes „Faust“ allenfalls mit Hilfe des Teufels möglich und das führte bekanntlich zu problematischen Verwicklungen. Wie verhält sich nun dieser ideelle Wunsch zu den realen Möglichkeiten? Was wollen und was können wir wissen? Wie gewiss ist das, was wir zu erkennen glauben? Welche Bedeutung hat dies für unser Handeln und welche Rolle spielt es insbesondere in der pädagogischen Reflexion? Grundsätzlich geht es um die Frage nach Möglichkeiten und Grenzen der „Wahrheit“.
In den folgenden Kapiteln muss manches noch abstrakt bleiben, aber als Rahmen und Grundlage für die nachfolgenden Einzelheiten scheint es mir wichtig. Grenzen und Möglichkeiten der verschiedenen Konzepte beruhen nicht allein auf deren speziellen Bedingungen, sondern ergeben sich aus den Grenzen menschlicher Reflexionsfähigkeit. – Es wird also sinnvoll sein, diesen Teil des Buches immer einmal wieder zu Rate zu ziehen.
Gibt es „Wahrheit“?
Zum Einstieg in wissenschafts- und erkenntnistheoretische Überlegungen soll die Frage erörtert werden, was eigentlich mit dem anspruchsvollen Begriff der „Wahrheit“ gemeint sein kann.
Wenn man die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs „Theorie“ (gr. theorein: beobachten, betrachten, [an]schauen) – und den damit offenbar erhobenen Anspruch auf absolute und von Menschen unabhängige Gültigkeit bedenkt, stellt sich die Frage, ob die damit verbundenen Erwartungen gerechtfertigt sind bzw. wo dies eine Grenze findet. Was rechtfertigt einen „universalistischen“ Anspruch auf Gültigkeit? Welchen Stellenwert können Ergebnisse der Forschung in theoretischer Hinsicht haben? – In den Sozialwissenschaften sind so gut wie nie „determinierende Zusammenhänge“ zu erwarten, bei denen ein vorausgehendes („antezedierendes“) Merkmal direkt und vollständig ein anderes, nachfolgendes bestimmend verändert. Vielmehr spielen in der Regel viele Faktoren eine Rolle, die ineinander wirken, sich wechselseitig beeinflussen und kaum vollständig aufgeklärt werden können. Möglich sind unter solchen Bedingungen allenfalls Wahrscheinlichkeits-Aussagen – wobei die Gefahr besteht, dass diese Bedingung vergessen wird und plausible Prognosen als zwingende Voraussagen verstanden werden. Damit ist der relative Stellenwert theoretischer Aussagen angedeutet.
Theodor W. Adorno hat es so formuliert: „Theoretischen Entwürfen ist es eigentümlich, dass sie mit den Forschungsbefunden nicht blank übereinstimmen; dass sie diesen gegenüber sich exponieren, zu weit vorwagen, oder, nach der Sprache der Sozialforschung, zu falschen Generalisationen neigen. [...] Ohne jenes Sich-zu-weit-Vorwagen der Spekulation jedoch, ohne das unvermeidliche Moment von Unwahrheit in der Theorie wäre diese überhaupt nicht möglich: sie beschiede sich zur bloßen Abbreviatur der Tatsachen, die sie damit unbegriffen, im eigentlichen Sinn vorwissenschaftlich ließe.“ (vgl. Adorno 1959: Theorie der Halbbildung)
Ähnlich hat es Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) gefordert: „Man muss Hypothesen und Theorien haben, um seine Erkenntnisse zu organisieren, sonst bleibt alles bloßer Schutt [...].“
Wolfgang Stegmüller (1923-1991) hat zur Bescheidenheit gemahnt, indem er darauf hinweist: „[...] dass es nicht nur eine, sondern verschiedene Rekonstruktionsmöglichkeiten dessen gibt, was man wissenschaftliche Erkenntnis nennt, und dass wir vielleicht niemals einen vollständigen Überblick über alle diese Möglichkeiten gewinnen werden.“ (1969, S. XXII)
Zu warnen ist allerdings vor der Vorstellung, dass „Theorie“ zu einem Endpunkt der Wahrheitsfindung führen kann. Theorie ist vielmehr als ein Medium im Erkenntnisprozess zu verstehen, als Hilfsmittel im Versuch, Informationen und Daten zu ordnen, Eindrücke auf einen Begriff zu bringen und Zusammenhänge so zu formulieren, dass eine Kommunikation über den jeweiligen Gegenstand ermöglicht oder gefördert wird. Theorien sind so verstanden eben nur begriffliche „Modelle“, die bestimmte Aspekte hervorheben und zur Diskussion stellen.
Nach dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu (1930-2002) entstehen Theorien in der empirischen Arbeit, also in der (intensiven und kreativen) Auseinandersetzung mit Beobachtungen, Daten, Antworten auf Fragen etc. Es gäbe aber Auffassungen, nach denen solche intuitive Entdeckungen nicht genug methodisch kontrolliert sind und eher die Mutmaßungen ihres Erfinders ausdrücken als die objektiven Sachverhalte.
Der amerikanische Philosoph Richard Rorty (1931-2007) nimmt in der Debatte über „Wahrheit“ eine klare Position ein: Er lehnt die Vorstellung konsequent ab, dass es „da draußen“ Dinge gebe, die wir nicht sprachlich erfassen können. Realität ist nach seiner Überzeugung nur das, was sich im sprachlich-sozialen Diskurs der Angehörigen der Gesellschaft etabliert hat. Theorie bringe nur zum Ausdruck, was jeweils unter den bestehenden („herrschenden“?) Verhältnissen sprachlich formuliert wurde und damit „gültig“ geworden ist. Folgerichtig stimmt er Jürgen Habermas (geb. 1929) in dessen Konzept der kommunikativen, intersubjektiven Vernunft zu, lehnt aber sein Beharren auf Allgemeingültigkeit als „bedauerliche Konzession an den Platonismus“ ab.