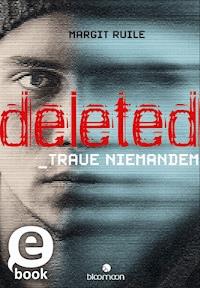
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: bloomoon
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Berlin 2034. Ben lebt ein ganz normales Leben mit seiner Familie. Den Alltag regelt wie bei allen anderen Menschen sein Slave für ihn. Eine Hologramm-Figur, die ihm bei Recherchen hilft, seine Termine plant und auch ansonsten immer für ihn da ist. Dank ihm hat Ben Zugriff auf alle möglichen Kameras in der Stadt. Ben stellt die ständige Überwachung der Slaves irgendwann in Frage und gerät an die falschen Freunde. Um Teil dieser Gruppe zu werden, soll Ben seinen Slave Sakar auslöschen. Ben folgt dieser Aufforderung, obwohl ihm Sakar geholfen hat, die Aufnahmeprüfung für die Akademie zu bestehen. Kurz darauf wird er in der Akademie aufgenommen und trifft dort auf den schwerfälligen Eigenbrötler Lennart, den klugen und aufrührerischen Jonas und die perfekte Zoe. Zoe spricht wie ein wandelndes Werbeplakat für das Internat. Aber irgendwie kommt Ben das alles sehr merkwürdig vor. Und als Jonas nach einer gewagten Diskussion im Unterricht plötzlich mitten in der Nacht verschwindet, weiß Ben nicht, wem er noch trauen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Margit Ruile
_TRAUE NIEMANDEM
Vollständige eBook-Ausgabe der Hardcoverausgabe
bloomoon, München 2015
© 2015 bloomoon, ein Imprint der arsEdition GmbH,
Friedrichstr. 9, 80801 München
Alle Rechte vorbehalten
Text: Margit Ruile
Textlektorat: Svenja Hoffmann
Umschlaggestaltung: Grafisches Atelier arsEdition unter Verwendung
von Bildmaterial von © Thinkstock
Umsetzung eBook: Zeilenwert GmbH
ISBN eBook 978-3-8458-0767-6
ISBN Printausgabe 978-3-8458-0639-6
www.bloomoon-verlag.de
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Der geheime Raum
Teil 1: Is there anybody out there?
Etwas ist anders
Loops
Rauch
Sojasprossen
Pixel
Yes
Teil 2: Die Falschen Freunde
Alien
TaiFun
SEA
Die Scheibe
Stromschlag
Im Sonnenlicht
Fisch
Lebenserhaltende Maßnahmen
Adam
Shakespeares Verbrechen
Fair is foul
U5
Rohstoff
Mücken
Zwillinge
Smiley
Geheimnisse
Teil 3: Ghost in the Machine
Erinnerungen
Blackout
Lügen
Lichter
Dank
Der geheime Raum
Ob sie wohl wiederkommen? Vorhin habe ich ihre Schritte gehört. Schnelle Schritte und Stimmen, die im Korridor hallten, dazu das leise hohe Sirren der Drohnen. Mir war schlecht vor Angst. Aber sie liefen vorbei, ohne die Tür zu bemerken. Es ist nichts passiert. Sie haben mich nicht entdeckt. Dieser Raum ist auf keinem Bauplan verzeichnet, sonst wären sie schon längst hier. Sie gehen nämlich sehr gründlich vor und vergessen nichts.
Meine Vorräte werden irgendwann zu Ende gehen. Ich habe zwei Flaschen Wasser mitgenommen und zwei dieser grauenhaften Soja-Sandwiches. Lennarts Lieblingsessen. Ich werde sie mir einteilen. Wie lange ich wohl davon leben kann? Zwei Tage? Wenn ich sparsam esse und trinke, könnte es reichen. Zwei Tage. So viel Zeit habe ich also, um all das aufzuschreiben, was ich erlebt habe. Ich schreibe diese Zeilen mit einem Bleistift in das leere Buch, das ich bei Korowski gefunden habe. Die Buchstaben sind dünn und sehen so aus, als würden sie übereinanderstolpern. Ich habe tippen gelernt, bevor ich schreiben konnte, und diesen Stift zu halten, ist echt anstrengend. Mir schmerzen jetzt schon die Finger.
Ob die Seiten in diesem Buch wohl ausreichen werden? Den Bleistift kann ich mit einem Taschenmesser spitzen; ich habe es in der Hosentasche. Sie hat mir das Messer geschenkt, kurz bevor sie ging.Immer wenn ich die Augen schließe, sehe ich ihr Gesicht vor mir. Ich kann gar nichts dagegen tun.
Es ist jetzt ganz still und draußen wird es dunkel. Ich sehe das, weil über mir ein Lichtschacht ist. Fahles Licht fällt durch ein Gitter, dessen Maschen selbst für die winzigsten Drohnen zu eng sind. Hier droht mir also keine Gefahr. Bevor ich diese Seiten aufschlug, habe ich auch den Raum überprüft. Keine Bewegungsmelder, keine Kameras. Nur eine Steckdose. Ich starre auf die Steckdose. Sie starrt zurück. Ich benutze sie nicht. Sobald Strom fließt, werden sie mich entdecken. Ich habe noch zwei Kerzen. Ich hoffe, das reicht. Die Buchstaben beginnen schon vor meinen Augen zu verschwimmen. Ich schreibe, solange ich kann, und wenn ich müde bin, dann lege ich mich hier auf den Boden und versuche ein paar Stunden zu schlafen. Der Raum ist immerhin so groß, dass ich ausgestreckt liegen kann.
Was wohl passiert, wenn sie mich finden? Wohin werden sie mich bringen? Ich weiß es nicht. Vielleicht sehe ich dann die anderen wieder, aber das ist mehr mein Wunsch, als dass es wahrscheinlich ist. Zuvor werde ich dieses Buch verstecken. Das Versteck ist so, wie es sein muss. Offensichtlich und doch gut verborgen. Und – egal was mit mir passiert – einer wird dieses Buch finden.
Ich weiß nicht, für wen ich das alles aufschreibe. Ich weiß nur, dass ich es tun muss. Es ist für euch in der Zukunft, wer auch immer ihr seid. Ihr müsst eine andere Stimme hören. Denn sie werden euch nur ihre Geschichte erzählen. Bitte glaubt ihnen nicht! Lest das, was ich euch hier schreibe! Es ist wahr, ich habe es selbst erlebt.
Teil 1Is there anybody out there?
Etwas ist anders
Also, wo soll ich beginnen? Vor allem, wann soll ich beginnen? Immer wenn ich an einem Punkt anfangen will, um meine Geschichte zu erzählen, fällt mir etwas ein, was vor diesem Punkt geschehen ist, und dann wieder etwas, das davor passiert ist. Die Zeit ist eine Gerade, die aus der Vergangenheit in die Zukunft führt. Und alle Punkte auf dieser Geraden haben mich hierher gelotst, in diesen Raum. Soll ich vielleicht bei dem Punkt anfangen, als ich entdeckte, dass diese Straße nicht überwacht wurde? Oder bei dem Punkt, was mir danach dort passierte? Nein, das wäre zu einfach. Vielleicht werdet ihr euch auch wundern, wie ahnungslos ich oft war. Lacht mich nicht aus! Ich wusste es damals noch nicht besser. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte alles noch einmal erleben, mit all dem, was ich heute weiß. Aber das würde diese ganze Linie aus Punkten durcheinanderbringen und sie würde sich krümmen und irgendwelche anderen seltsamen Dinge machen. Und wer will schon eine Gerade, die sich krümmt?
Wenn ich allerdings genau darüber nachdenke, gibt es da einen Punkt in der Vergangenheit. Einen, den ich fast übersehen hätte. Einen feinen Punkt auf der Zeitlinie, blau glühend wie pulsierendes Licht. Ich glaube, dass dort alles begann. Ich hatte es nur noch nicht verstanden. Er schien zu klein und zu unbedeutend zu sein, um ihn wichtig zu finden.
Mein Name ist übrigens Ben. Ich bin am 31. Januar 2020 geboren und wohne in Berlin. Also, ich meine, ich wohnte in Berlin, bevor ich hierherkam. Und wo ich in Zukunft leben werde, das weiß ich nicht. Nichts wird so sein, wie es einmal war.
Vor ein paar Monaten habe ich jedenfalls in Berlin gewohnt, im Stadtteil Friedenau, in einer Altbauwohnung mit vier Meter hohen Decken. Mit mir lebten dort meine Mutter, mein Stiefvater Karl und meine kleine Schwester Louise.
Mein Slave hieß Sakar und war schon zehn Jahre bei mir. Er war ein Geschenk zu meinem vierten Geburtstag. Ich glaube, man brauchte ein E-brace, um überhaupt in den Kindergarten zu kommen. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr das lest, noch ein E-brace kennt. Zu der Zeit, als ich das schreibe, hat fast jeder eines. Es ist ein elektronisches Armband mit einem Touchscreen. Man kann damit telefonieren und seinen Slave aktivieren und man wird damit auch immer gefunden. Deshalb will man wahrscheinlich, dass die kleinen Kinder es tragen. Sie könnten sich ja verlaufen oder entführt werden. Jetzt, wo ich das schreibe, fällt mir ein, dass ihr vielleicht auch nicht mehr wisst, was ein Slave ist. Das ist für mich ein ziemlich absurder Gedanke, aber zur Sicherheit will ich versuchen, einen Slave zu beschreiben.
Ich muss dabei erst nachdenken, denn ein bisschen ist es so, als würde mich jemand fragen, was die Sonne ist oder wie ein Stuhl aussieht.
Also – ein Slave ist eine durchsichtige, vielleicht handtellergroße Figur, die aus dem Touchscreen eines E-brace aufsteigt. Ich sage Figur, denn ein Slave muss keine menschliche Gestalt haben. Er kann auch ein Tier sein oder ein Monster, es gibt sogar Freaks, deren Slave hat die Gestalt eines Würfels. Jedenfalls kann man mit einem Slave sprechen und er führt Befehle aus.
Er sagt dir, wo du dich befindest und wo deine Freunde sind, und sucht für dich nach Informationen. Damit ihr mich nicht missversteht – ein Slave hat nichts mit Zauberei oder so zu tun. Der Slave ist nur ein Computerprogramm, das menschliche Züge hat und mit dem du dich unterhalten kannst. Und das alles über dich weiß, aber dazu kommen wir später.
Jedes der Kinder im Kindergarten bekam also ein E-brace mit einem Slave, und als ich zum ersten Mal in die Gruppe kam, lernte ich nicht nur meine neuen Spielkameraden kennen, mit denen ich bald chinesische Schriftzeichen abpausen sollte, sondern auch deren Slaves. Ehrlich gesagt kann ich mich heute an die Slaves besser erinnern als an die Kinder. Es gab drei schnippische blonde Prinzessinnen, die sich alle verblüffend ähnlich sahen und drei in rosa Tüllwolken gehüllten Mädchen gehörten. Ein Junge hatte einen langweiligen edlen Ritter und ein anderer einen Magier mit einem leuchtenden Stern auf der Stirn, der immer so nervende altkluge Sachen von sich gab. Mein damaliger bester Freund Finn allerdings hatte sich einen Steinzeitmenschen ausgesucht, der Thorob hieß und so tolle Funktionen wie Furzen und Rülpsen einprogrammiert hatte. Heute glaube ich, Finn war vor allem mein Freund, weil mir Thorob gefiel.
Und ich hatte Sakar.
Sakar gehörte zu dem E-brace, das mir meine Mutter in einem Laden für Computerschrott in Neukölln gekauft hatte. Wir waren damals knapp bei Kasse, und ich glaube, Sakar war ziemlich billig zu haben. Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum ich mir ausgerechnet Sakar aussuchte. Also, es war nicht so, dass er mir besonders gut gefiel. Aber es gab in dem Laden nur noch einen peinlichen Teddybären, der immerzu »Willst du mit mir spielen?« fragte und dessen Bewegungen seltsam eckig waren, sodass ich sofort in erschrockene Tränen ausbrach, als der Verkäufer ihn materialisierte.
Die einzige Alternative zu dem Bären war Thor, ein muskelbepackter Actionheld, der völlig unverständlich sprach und mir sofort irgendeine Kampfsportart beibringen wollte, indem er nervös mit der Faust vor meinem Gesicht herumfuchtelte.
Wir wollten gerade den Laden enttäuscht verlassen, als der Verkäufer aus einer der Schubladen ein silbernes Armband mit einem grauen, sehr zerkratzten Touchscreen hervorzog. Er hätte da noch ein besonderes Angebot, sagte er – ein gebrauchter Slave, selbstverständlich neu programmiert, aber ein ganz spezielles Modell. Er legte das E-brace auf den Ladentisch, zeichnete das Passwort auf den Screen und es erschien ein – na ja – ziemlich übergewichtiges Männchen in einem schwarzen, schlecht sitzenden Anzug. Heute würde ich sagen, Sakar sah eigentlich aus wie ein Mafioso, aber das Wort und seine Bedeutung kannte ich damals noch nicht.
Das Männchen jedenfalls nahm seine schwarze Sonnenbrille ab und musterte mich von oben bis unten. Ich war vier Jahre alt, aber ich kann mich bis heute genau an diesen Blick aus seinen dunklen Augen erinnern.
»Ich bin Sakar, was kann ich für dich tun?«, fragte er.
Merkwürdigerweise gefiel mir seine Stimme. Sie war heiser und klang dunkler als die der Slaves anderer Kinder. Später bemerkte ich auch, dass Sakar anders war als die restlichen Slaves. Und das nicht nur, weil er anders aussah. Neben den Elfen, Zauberern und Rittern fiel er einfach auf. Ein dicker Mann in einem Anzug mit schwarzer Sonnenbrille.
Neben seinem Aussehen hatte er weitere Eigenschaften, die ihn von den übrigen unterschieden. Wie ich bald herausfinden sollte, war er eigentlich gar nicht für Kinder programmiert. Er stieß nämlich ab und zu Flüche aus, die ich hier nicht wiederholen möchte. (Meine Mutter war entsetzt, als sie das herausfand, und es gelang ihr schließlich, diese Funktion abzustellen. In der zweiten Klasse bot mir Sakar die Funktion wieder an, was mir dann prompt die Wahl zum Klassensprecher sicherte – aber das nur nebenbei.)
Außerdem war Sakar schlauer als die anderen Slaves, obwohl man ihm das ganz und gar nicht ansah. Alle Suchaufträge erledigte er in Rekordzeit und jeden Weg fand er dreimal schneller als zum Beispiel Thorob.
Und er hatte nie das Unterwürfige der übrigen Slaves. Ich fragte mich als Kind oft, was Sakar wohl machte, wenn er ausgeschaltet war. Ich vermutete, dass er ein eigenes Leben besaß und sich mit Thorob, dem Magier und den Elfen treffen würde. Ich stellte mir dann auch immer vor, dass Sakar dabei nicht die beste Figur machen und immer wieder in Schwierigkeiten geraten würde.
Eigentlich hatte ich gar nicht so unrecht mit meiner Vermutung.
Heute weiß ich natürlich, dass das alles mit seiner Herkunft zu tun hatte. Wie merkwürdig, dass man ihn in diesem Laden verkaufte. Wie seltsam, dass er dort landete, er, der nur ein Versuch war, eine Testversion einer ganz neuen Reihe von Slaves, die eigentlich nie hätte verkauft werden dürfen.
Aber, wie gesagt, das weiß ich heute. Und hätte ich es damals gewusst, würde sich nun die Gerade krümmen.
Jetzt wollt ihr sicher erfahren, wo die Geschichte beginnt. Der Punkt mit dem pulsierenden Licht.
Es war ein Abend, an dem ich allein zu Hause war. Meine Mutter, meine kleine Schwester und mein Stiefvater waren zu Besuch bei Freunden. Ich schlief in meinem Hochbett in dem Zimmer mit den vier Meter hohen Decken, die ich immer mochte, weil sie mir das Gefühl von Weite gaben. Von Weite und Luft. Und das war ganz gut, wenn man manchmal das Gefühl hatte zu ersticken.
Ich las bis spät in die Nacht, und nachdem ich meinen Reader zur Seite gelegt hatte, schlief ich ein und träumte. Ich schwamm in einem See. Die Sonne glitzerte auf dem Wasser und Algen streiften meine Füße. Eine schlang sich um meinen Knöchel, hielt mich fest und zog mich nach unten. Mein Kopf glitt unter Wasser. Ich ruderte verzweifelt mit den Armen, um wieder nach oben zu kommen, aber die unsichtbare Hand zog mich weiter und weiter in die Tiefe.
Hilfe! Ich schlug meine Augen auf und rang nach Luft. Ich ersticke! Ich hatte keine Ahnung, wie spät es war. Durch die Schlitze in der Jalousie sickerte das Licht der Laternen, und unten, vier Stockwerke und einen Keller weiter unten, fuhr mit dumpfem Grollen die Magnetbahn unter der Stadt.
Ich zeichnete mit meinem zitternden Zeigefinger einen Kreis auf den Touchscreen des E-brace und tippte dann zweimal in die Mitte. Es war ganz schwarz, dann – nach einer Weile – erhob sich Sakar. Er leuchtete im Dunkeln, setzte seine Sonnenbrille ab und sah mich ungerührt an. Gott sei Dank!
»Sakar!«, japste ich. »Hilf mir!« Mein Atem pfiff.
»Setz dich gerade hin.«
»Mach ich doch!« Ich röchelte. »Ich … die Luft …«
»Du musst ruhig atmen!«, sagte er. »Ganz ruhig.«
»Ruf meine Mutter an! Schnell, verbinde mich!«
Sakar sah mich prüfend an.
»Du musst ruhig atmen, ganz ruhig!«
Schon wieder! Verflucht, was war los? War er kaputt?
»Verbinde mich, schnell!«
»Dein Spray wird dir reichen!«
»Ich will aber, dass du mich verbindest!«
Sakar schüttelte den Kopf. »Du musst ruhig atmen. Ganz ruhig!«
»Halt die Klappe, Sakar!« Wie soll ich ruhig atmen, wenn mein Herz so rast?
»Du musst ruhig atmen, ganz ruhig!«
Eine Welle von Panik überflutete mich. Meine Bronchien fühlten sich an, als würde sie jemand mit aller Gewalt zusammenquetschen.
»Wo ist mein Spray?«
»Du hast es in deiner Sporttasche.« Ah, gut, wenigstens war er nicht auf seinem Spruch hängen geblieben.
»Und wo ist die?«
Sakar wandte seinen Blick nach innen. Er überprüfte vermutlich die Kameras. Wieso dauerte das nur so lange?
»Du hast sie vorhin in den Schrank geschmissen!«
»Oh Gott!«
Wahrscheinlich können sich nur die Leute vorstellen, die selbst Asthma haben, wie es ist, während eines Anfalls aufzustehen und sein Spray zu suchen.
Na ja. Es ist ziemlich – scheußlich. Stellt euch vor, jemand setzt sich auf euren Brustkorb und ihr müsst euch trotzdem bewegen.
Ich schaffte es zum Schrank, kramte nach meiner Sporttasche, zog endlich die Sprayflasche heraus und atmete einen Spraystoß ein. Tief durchatmen.
Ah, besser. Viel besser. Mein Herzschlag beruhigte sich langsam.
»Du musst ruhig atmen, ganz ruhig!«, flüsterte Sakar.
»Wieso hast du die Nummer nicht gewählt?«
»Du sollst dich jetzt nicht aufregen.«
»Wieso?«
»Es war klar, dass dein Spray reichen würde.«
»Mir nicht!«
»Mir schon!«
»Du hast keine Ahnung, du bist nur ein Programm!«
»Ich weiß.«
Ich atmete immer noch schwer. Und krallte mich am Bettpfosten fest, während ich langsam wieder das Hochbett hinaufstieg.
Sakar verschränkte die Arme und sah zu Boden. Bildete ich mir das nur ein oder sah er anders aus? Und etwas veränderte sich auch in mir: Ich begann ihm zu misstrauen. Das hatte ich noch nie getan. Wieso nur wollte er die Nummer nicht wählen?
Ich schaltete ihn grußlos ab, indem ich dreimal auf den Touchscreen klopfte. Er ging nicht so schnell wie sonst. Es war, als wollte er mir noch etwas mitteilen, entschied sich aber dann, es doch nicht zu tun. Es schien ihn selbst zu verwirren. Seine Gestalt wurde durchsichtig, und ich konnte nur noch seine dunklen Augen sehen, die mich anstarrten. Dann war er plötzlich verschwunden.
Loops
Es war das erste Mal, dass Sakar meinen Befehl nicht ausführte. Was war nur mit ihm los? War er kaputt? War irgendetwas in seiner Programmierung durcheinandergeraten? Plötzlich hatte ich den Verdacht, dass Sakar Programme besaß, von denen ich nichts ahnte und die er mir verheimlichte. Oft war mir so, als würde er nicht nur das Nachdenken simulieren, sondern tatsächlich nachdenken und eigene Entscheidungen treffen. Was aber, wenn diese Entscheidungen mit mir gar nichts mehr zu tun hatten? Oder – schlimmer noch – sich gegen mich richten würden?
Ich beschloss, ihm nicht mehr alles zu erzählen, was mir durch den Kopf ging.
Eigentlich beginnt damit diese Geschichte.
Sie beginnt mit Misstrauen.
Mit einer abgelegenen Straße.
Und mit den Kameras.
Bei einer Sache bin ich mir übrigens sicher: Ihr werdet auch in der Zukunft noch Kameras haben. Selbst wenn es zu einer nuklearen Katastrophe kommen sollte, werden wahrscheinlich als Einziges Kakerlaken und Kameras übrig bleiben.
Die Kakerlaken können dann auf riesigen Monitoren zusehen, wie die Kameras dämlich vor sich hin zoomen, und das Grünzeug aufnehmen, das sich durch den Asphalt bricht. Na ja, ihr könnt das jetzt lesen, also gab es keine Katastrophe. Aber ich wette, ihr habt die Kameras noch überall.
Mit ihnen ist es wie mit Gullydeckeln oder Hydranten. Normalerweise bemerkt man sie nicht. Erst wenn man anfängt, auf sie zu achten, sieht man, wie viele es sind. Sie sind überall. In der Magnetbahn sowieso. Dann an jeder Ampel und an den Laternenpfosten, an den Giebeln der Häuser und an Regenrinnen. Zwischen Leuchtreklamen und über den Verkehrsschildern, sogar in den Parks auf den Bäumen.
Manche schwenken leise hin und her, andere können zoomen und ihre schwarzen Linsen verschieben sich und werden größer und kleiner wie die Pupillen echter Augen.
Mir waren diese Kameras völlig egal, bis zu jenem Tag vor vielen Jahren, an dem ich Sakar eine Frage stellte. Ich hatte mich mit meinem Freund Finn zerstritten. Es ging um einen Papierhelikopter, den ich gebastelt und den Finn einfach mitgenommen hatte.
»Ich möchte wissen, wo Finn jetzt ist, Sakar!«, sagte ich.
»Er sitzt gerade mit seiner Mutter in der Magnetbahn.«
»Woher weißt du das?«
Sakar zog sich seine Brille ab, trat zur Seite und gab damit den Blick auf den Touchscreen frei.
Dort war ein Bild von Finn. Ich konnte ihn von oben sehen. Er saß tatsächlich in der Magnetbahn und hatte meinen Helikopter dabei. Dann sah ich, wie er ausstieg, den Bahnsteig entlanglief und dort den Helikopter einfach in einen Papierkorb schmiss. Wie konnte er nur?
Doch etwas anderes beschäftigte mich noch viel mehr.
»Wie kannst du mir das alles zeigen?«, fragte ich Sakar. »Gehört dir eine eigene Drohne?«
Es gab damals schon Überwachungsdrohnen. Kleine Flugzeuge, die über der Stadt flogen und von der Polizei genutzt wurden, um Verbrecher zu stellen.
Sakar starrte mich an. Wie immer konnte ich seinen Blick nicht deuten.
»Schau nach oben und sage mir, was du siehst!«
Ich zuckte mit den Schultern. »Eine Laterne?«
»Und weiter?«
Mein Blick wanderte den Laternenmast hinauf. Es war eine altmodische Laterne, grün gestrichen, mit einem Blattmuster. Sie machte oben eine Biegung, an deren Ende eine längliche Lichtquelle hing. Darüber war ein ovales silbernes Ding befestigt. Es sah aus wie ein metallener Vogel.
»Da ist die Kamera«, erklärte Sakar. »Und jetzt pass auf!«
Das Bild an meinem Handgelenk wechselte. Es zeigte mich selbst unter der Laterne. Ich saß dort und sprach mit Sakar.
»Cool!« Ich winkte mir selbst zu. Der Junge auf dem Monitor tat das Gleiche.
»Lass das!«, sagte Sakar scharf.
»Wieso denn?«
»Es muss nicht jeder wissen, dass du dich selbst siehst, verstehst du?«
Ich verstand – noch – nichts, aber mein Respekt vor Sakar war gewaltig gewachsen. Er hatte Zugriff auf die Kameras! Und er konnte sie so hintereinanderschalten, dass man jemanden in der ganzen Stadt verfolgen konnte. Was für ein tolles Programm!
Und dieses Programm hatte nur Sakar. Es war eines der Dinge, die ich zunächst für selbstverständlich hielt, aber dann wurde mir klar, dass die anderen Slaves nicht einmal von solchen Programmen wussten.
Es blieb unser Geheimnis. Ich verriet es niemandem. Und das war wirklich nicht einfach, vor allem, wenn die anderen mit den Künsten ihrer jeweiligen Slaves prahlten. Die einen konnten Wing Tsun und vollführten minutenlange Purzelbäume in der Luft, die anderen beherrschten Stylingtricks, bei denen sie pausenlos Haarfarbe und die Größe ihrer Nasen wechselten.
»Und was kann dein komischer Sakar?«
»Er kann euch alle verfolgen. Dauernd«, hätte ich am liebsten gesagt. Aber es kam mir nie über die Lippen. Und so stand ich mit einem leicht überlegenen Lächeln am Rand, wenn die anderen Kinder ihre Slaves Kunststückchen vorführen ließen. Ich ahnte damals schon, dass, sobald jemand davon erfahren würde, Sakar mir dieses Programm nie mehr zeigen würde.
Und das hätte mich schließlich um meine Lieblingsbeschäftigung gebracht: das Ausspähen der anderen.
Das Tolle an Sakars Programm war nämlich, dass ich jederzeit jeden sehen konnte. Zuerst verfolgte ich meine Mutter. Ich sah, wie sie meine Schwester in die Krippe brachte und dann mit der Magnetbahn zum Krankenhaus fuhr. Ich sah, wie sich mein Stiefvater im Stau quälte, dann überprüfte ich die Wege meiner Freunde und schließlich auch die meiner Lehrer. Sakar zeigte mir das alles bereitwillig. Und so wusste ich immer mehr als alle anderen. Ich sah, wer sich mit wem traf und was jeder kaufte. Ich wusste, in welchem Haus jemand wohnte und welche Wege er nahm. Ich erfuhr von nasebohrenden Lehrern, heimlichen Verabredungen und teuren Einkäufen.
Was ich auch öfter machte, war, mich selbst zu überwachen. Ich weiß, dass das komisch klingt, aber es machte mir Spaß, mir selbst von oben zuzusehen. Dabei war ich äußerst vorsichtig und wagte nicht mehr, zu winken oder mir selbst einen Vogel zu zeigen. Aber ich muss gestehen, dass ich öfter einen anderen Gang ausprobiert habe, nur um zu sehen, wie er wirkt.
Mehr und mehr fragte ich mich auch, wer sich außer mir die Aufzeichnungen der Kameras ansehen konnte. Er musste mich ja genauso beobachten können wie ich mich selbst. Was er wohl von mir dachte? Es wäre dämlich gewesen, zu klauen oder ein Graffiti zu sprühen. Ich achtete darauf, so unauffällig wie möglich auszusehen. Nicht stehen zu bleiben, nicht rumzuhängen, keine Bewegungen zu machen, die irgendwie aus dem Rahmen fallen. Und langsam bekam ich ein Gefühl dafür, wer außer mir noch unauffällig sein wollte. Manchmal sah ich, wie plötzlich jemand auf der Straße stehen blieb und in eine Kamera starrte. Andere warfen heimliche Blicke nach oben und dann wieder zurück auf ihr E-brace.
Hatten sie etwa auch Slaves wie Sakar?
Es war an dem Tag nach dem Asthmaanfall, als ich diesen Mann im Kapuzenpulli bemerkte. Wie gesagt, etwas war anders zwischen Sakar und mir, aber ich beschloss, so zu tun, als wäre nichts geschehen.
»Sakar, wach auf!« Ich zeichnete das Passwort auf die kleine graue Scheibe. Sakar flackerte ein wenig, dann erhob er sich.
»Jaaa«, sagte er mürrisch. Ich mochte diesen Ton in seiner Stimme. Sakar sah nie aus, als hätte er nur darauf gewartet, von mir gerufen zu werden. Er sah immer so aus, als hätte ich ihn gestört. Wobei eigentlich?
»Sakar, zeig mich von oben!«
»Wie wär’s eigentlich mit einem ›Bitte‹? Oder einem ›Guten Morgen, Sakar!‹«
»Das habe ich mir alles dazugedacht!«
»Toll!«
»Du musst es dir nur einfach auch dazudenken, Sakar!«
»Hier, deine Kameras, du Kretin!«
Keine Ahnung, was ein Kretin ist. Ich hatte aber auch keine Lust, Sakar danach zu fragen.
Sakar bekam wieder seinen nach innen gewandten Blick, als würde er über etwas nachdenken. In Wirklichkeit checkte er nur seine verfügbaren Daten.
Dann verschwand er und der Monitor zeigte mich vom Standpunkt der Kamera aus. Es war die in der Ernst-Linde-Straße, direkt über unserem Hauseingang mit den steinernen Löwen. Ich war spät dran und sah mich von oben durch die Straßen eilen.
Wir hatten Herbst und es regnete, sodass fast keine Leute unterwegs waren. Deshalb fiel mir wohl auch der Mann mit der Kapuze auf.
Er war noch jung, vielleicht zwanzig, trug eine runde Brille und hatte sich die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Was mir auffiel, war seine betonte Unauffälligkeit. Er trabte mit großen Schritten durch den Regen, hatte den gleichen Weg und war ungefähr so schnell wie ich, nur dass er vielleicht fünfzig Meter hinter mir blieb. Einen Moment lang dachte ich sogar, er würde mich verfolgen. Doch dann bog er plötzlich bei der verlassenen Currywurstbude in eine schmale Seitenstraße ein. Es war die Grimmstraße, eine enge Sackgasse, in der ich noch nie einen Passanten gesehen hatte.
Und so war es auch jetzt.
Der Mann war plötzlich wie vom Erdboden verschluckt!
Statt seiner war nur noch eine Plastiktüte zu sehen, die sich im Wind blähte.
Ich stand am Eingang der Magnetbahn und starrte auf den Monitor an meinem Handgelenk. Mein Herz klopfte laut. Wie konnte er einfach so verschwinden?
Von unten kam eine Durchsage und die Magnetbahn fuhr ein. Hätte ich sie genommen, säße ich nun nicht hier. Aber ich stand oben an der Rolltreppe und spürte, wie mir der Wind ins Gesicht blies, als der Zug davonfuhr. Ohne mich.
»Hey!« Sakar materialisierte sich wieder. »Was soll das? Du wirst zu spät kommen!«
»Das ist mir egal!«
»Was ist mit deiner Disziplinarnote?«
»Was soll schon damit sein? Zeig mir lieber die letzte Aufnahme noch mal!«
Sakar verschwand und ich starrte wieder auf mein E-brace. Die Plastiktüte trieb immer noch über der Straße in der Luft. Irgendetwas stimmte nicht mit dem Bild. Ich putzte die Regentropfen, die sich auf dem Touchscreen verfangen hatten, mit dem Ärmel meiner Jacke weg, um besser sehen zu können.
Dann fiel es mir auf: Dort regnete es nicht. Die Straße sah ganz trocken aus.
Mein Herz klopfte schneller und ich drehte mich um. Ich musste zurück.
»Was machst du?«, schnarrte Sakar. »Du gehst in die falsche Richtung.«
»Ich weiß. Zeig mich von oben und verschwinde!«
Sakar starrte mich an, trat einen Schritt zurück und begab sich wieder ins Innere des E-brace.
Der Regen prasselte auf meine Regenjacke, während ich mich zurück auf den Weg machte. An der alten Currywurstbude stoppte ich. Hier musste es gewesen sein.
Die Grimmstraße war eine schmucklose Sackgasse ohne Bäume, mit heruntergekommenen Häusern, deren Fenster eingeschlagen waren. Niemand schien hier zu wohnen. Die Kamera, die mein Bild gleich übernehmen würde, war über einer mit Brettern vernagelten Tür montiert, die zu einem graubraunen alten Haus gehörte, das über und über mit Graffiti besprüht war.
Ich versuchte, unauffällig auf den Monitor meines Armbands zu sehen, und ging in die Straße. Tatsächlich. Ich war vom Kamerabild verschwunden. Ich hatte mich in Luft aufgelöst wie der Mann mit der Kapuzenjacke. Es gab mich nicht mehr!
Nur die alte Plastiktüte in der Ecke tanzte – vom Wind getrieben – vor sich hin.
Ich blickte vom Monitor hoch und sah vor mir auf die Straße. Hier war keine Plastiktüte. Es regnete und in den Pfützen auf dem Boden zeichnete das Wasser graue Kreise.
Die Kamera zeigte also etwas anderes als die Wirklichkeit.
Ich starrte auf den Monitor. Und plötzlich dämmerte es mir:
Natürlich! Die Plastiktüte, die immer in einem Kreis zu fliegen schien – sie war ein Loop! Es war die gleiche Szene, die wieder und wieder gezeigt wurde.
Ich schnappte nach Luft. Im Laufe der Jahre war ich schon auf mehrere kaputte Kameras gestoßen. Das gab es immer wieder. Man konnte dann einfach nichts mehr sehen. Oder man sah nur noch ein bisschen was, weil Vogelkacke das Objektiv verschmutzt hatte. Diese Kameras schienen dann aber immer schnell repariert oder geputzt worden zu sein. Denn am nächsten Tag war das Bild wieder einwandfrei. Aber so etwas wie hier hatte ich noch nie gesehen. Hier musste sich jemand die Mühe gemacht und eine andere Aufnahme in das Überwachungssystem eingespeist haben. Aber warum?
Ich überlegte. Normalerweise hätte ich meine Entdeckung sofort mit Sakar geteilt, aber etwas hielt mich zurück.
Ich hatte ein Geheimnis. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich ein Geheimnis.
Eine Straße, die nicht überwacht wurde.
Was mich wohl in dieser Straße erwartete? Sollte ich weitergehen?
Ich zögerte einen Augenblick, dann schaltete ich mein E-brace ab.
Rauch
»Was«, werdet ihr euch vielleicht erstaunt fragen, »man konnte das E-brace abschalten?«
Ja, man konnte. Nur – kaum jemand tat es. Eigentlich konnte man nämlich nur mit eingeschaltetem E-brace leben. Nur so wurde man von den technischen Geräten erkannt, konnte die Schule betreten, in einem Laden bezahlen, nur so mit der Magnetbahn fahren, telefonieren oder den Weg finden. Also – ohne E-brace war man eigentlich aufgeschmissen. Es gab zwar noch ein paar Leute, die kein E-brace hatten. Sie zahlten mit Karte und mussten sich überall extra ausweisen. Hinter ihnen bildeten sich überall lange Schlangen. Meine Mutter sagte immer, man sollte Mitleid mit ihnen haben, was mir aber wirklich schwerfiel, vor allem, nachdem mir einmal eine alte Frau mit einem Regenschirm eins übergezogen hatte, nach einer kleinen Meinungsverschiedenheit mit Sakar.
(Sie hatte sich furchtbar über zwei Kampfslaves aufgeregt, die sich für ihre Besitzer um einen Sitzplatz prügelten. Na ja, es spritzte auch ein bisschen virtuelles Blut, zugegeben, aber muss man deshalb gleich mit einem Regenschirm zuschlagen?)
Aber das konnte ich meiner Mutter nicht klarmachen, da sie nie die Magnetbahn nahm und so gar nicht ahnte, wie militant die Regenschirmträger waren.
Als ich an dieser Currywurstbude stand, schaltete ich also mein E-brace aus.
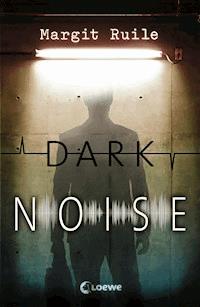



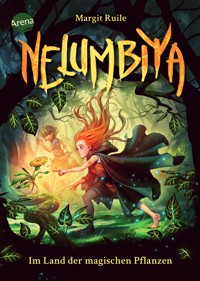














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









