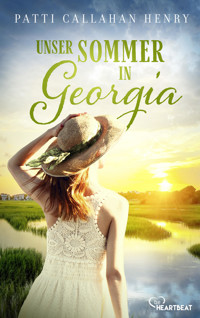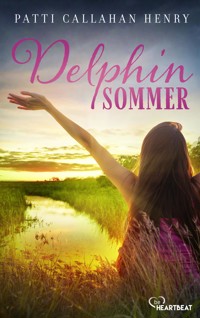
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die bewegendsten Romane von Patti Callahan Henry
- Sprache: Deutsch
Ein Kästchen mit geschnitzten Delphinen weckt in Meridy längst vergessene Erinnerungen an ihre erste Liebe. Damals verbrachte sie unbeschwerte Sommer am Meer. Doch auch die Erinnerungen an eine grausame Katastrophe kehren zurück. Meridy weiß, wenn sie ihr Herz jemals wieder spüren will, muss sie es öffnen und ein lang gehütetes Geheimnis preisgeben. Gemeinsam mit einem Jugendfreund begibt sie sich auf eine Reise in die Vergangenheit. Doch sie riskiert auf diesem Weg nicht nur ihren guten Ruf, sondern auch ihre Ehe und den Zusammenhalt ihrer Familie ...
Einfühlsam, liebevoll und einfach nur schön.
»Mit dem Buch aufs Sofa, und der Stress des Tages ist vergessen.« LEA
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
TEIL I
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
TEIL II
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
TEIL III
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Danksagungen
Anmerkung der Autorin
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Ein Kästchen mit geschnitzten Delphinen weckt in Meridy längst vergessene Erinnerungen an ihre erste Liebe. Damals verbrachte sie unbeschwerte Sommer am Meer. Doch auch die Erinnerungen an eine grausame Katastrophe kehren zurück. Meridy weiß, wenn sie ihr Herz jemals wieder spüren will, muss sie es öffnen und ein lang gehütetes Geheimnis preisgeben. Gemeinsam mit einem Jugendfreund begibt sie sich auf eine Reise in die Vergangenheit. Doch sie riskiert auf diesem Weg nicht nur ihren guten Ruf, sondern auch ihre Ehe und den Zusammenhalt ihrer Familie …
PATTI CALLAHAN HENRY
Delphinsommer
Aus dem amerikanischen Englischvon Sabine Schulte
»Wenn du hier bist, bist du zu Hause«,lautet eine Gullah-Weisheit.In tiefer Liebe widmeich dieses Buch meinem Zuhause:meinem Mann, Pat Henry,und unseren KindernMeagan, Thomas und Rusk.
TEIL I
»Wenn ich am glücklichsten war,war meine Sehnsucht am größten –das Süßeste in meinem ganzen Lebenist die Sehnsucht, das Verlangen,den Ort zu finden, wo all die Schönheitherkommt.«
nach C. S. Lewis, Du selbst bist die Antwort
Eins
»Wenn du nicht weißt, wo du hingehst,solltest du wissen, wo du herkommst.«
Gullah-Weisheit
Ich spüre ein Gefühl der Leere in meinem Herzen, als ich am Anleger stehe, da, wo der Fluss in einer letzten Windung um mein Zuhause herumströmt, bevor er ins Meer mündet, das Gefühl, dass das noch nicht alles gewesen sein kann. Der Wind liebkost mein Gesicht. Zwei Delphine, Mutter und Kind, springen in perfekter Gleichzeitigkeit aus dem Wasser, dann verschwinden ihre silbrigen Leiber wieder in den zinngrauen Wellen. Ich breite die Arme weit aus und bitte die Welt, mir alles zu bringen, wonach ich mich sehne. Heute ist mein zwölfter Geburtstag. Meine Eltern haben mir ein rosarotes Fahrrad geschenkt, mit einem Bananensattel und Troddeln rechts und links am Lenker. Aber dieses Geschenk erscheint mir irgendwie nicht angemessen – nicht bedeutsam genug.
Ich wende mich vom Fluss ab und springe auf mein neues Rad. Da ich mein limonengrünes Festtagskleid trage, stelle ich mich auf die Pedalen und trete behutsam, um den Tüll nicht zu zerreißen. Ich lechze nach der Unabhängigkeit, die ein Fahrrad bietet und die die Jungen in meiner Straße schon längst genießen. Fahren gelernt habe ich auf dem Rad meines Nachbarn Timmy. Ich rolle an meinem Elternhaus vorbei und weiter am Fluss entlang, auf unserer langen Straße, die als Sackgasse endet. Mutter steht auf der Veranda und ruft, ich solle augenblicklich zurückkommen und mich umziehen, bevor ich mit dem grässlichen Ding losflitze. Doch ich trete nur kräftiger in die Pedalen. Mutter schreit zu meinem Vater hinüber, so schrill, wie sie es aus Verzweiflung über mich häufig tut: »Dewey, ich hab dir doch gesagt, wir hätten ihr kein Fahrrad kaufen sollen. Sie ist auch so schon wild genug.«
»Ach, Harriet, lass dem Mädchen doch das Vergnügen!«, erwidert Daddy.
Mutters Antwort höre ich nicht mehr, denn ich bin längst vorbei und um die Kurve gesaust. Unsere Straße windet sich genauso wie die giftigen Mokassinschlangen, die unterhalb unseres Grundstücks im Sumpf wohnen – sie schlängelt sich erst nach links, dann nach rechts, dann wieder nach links –, ja, es ist wirklich eine lange Straße, und sie folgt den Biegungen des Flusses, bis er an der Spitze der Landzunge ins Meer fließt. Als die Erwachsenen mir erzählten, dass der weite blaue Fluss hinter unserem Haus ins Meer mündet und dann bis auf die andere Seite nach Afrika fließt, habe ich das nicht geglaubt. Ich glaube überhaupt nicht viel von dem, was sie mir weismachen wollen. Sie leben ja gar nicht mehr richtig – dauernd machen sie sich Sorgen um Nebensächliches wie Frisuren oder Autos oder zu welcher Party sie eingeladen sind.
Quietschend bremse ich, denn vor dem früheren Haus der Carmichaels blockiert ein Möbeltransporter meine Straße. Wie eine Zunge aus einem offenen Mund hängt hinten aus dem Wagen eine verbeulte schwarze Rampe heraus. Große Männer, in der Hitze des Lowcountry schweißgebadet, laden Kartons aus, auf denen in dicker schwarzer Schrift »Dannys Zimmer«, »Wohnzimmer« oder »Bibliothek« steht. Ich springe mit beiden Füßen auf den Boden und halte das Fahrrad zwischen den Beinen, so dass mein Tüllkleid sich aufbläht wie ein grüner Ballon mit einer Delle hintendrin.
Die Haustür des mit silbrig grauen Holzschindeln verkleideten Gebäudes steht offen, und eine weitere Rampe führt auf die vordere Veranda hinauf. Einer der größten Männer, die ich je gesehen habe, erscheint im Eingang. Er schaut zu mir herüber und winkt, bevor er sich mit einem weißen Taschentuch über die Stirn wischt. Ich winke zurück. Er hebt den Zeigefinger, was wohl heißt, ich solle warten. Dann tritt er auf die Veranda. »Daniel!«, ruft er laut.
Hinter einem Busch taucht ein Junge auf. Er springt auf die unterste Treppenstufe. »Ja, Vater?«
»Sieht so aus, als wäre Besuch aus der Nachbarschaft gekommen, um dich zu begrüßen.«
Der Junge dreht sich um. Sein Gesicht ist mit Sommersprossen übersät. Die Augen leuchten so blau, dass ich die Farbe sogar aus der Ferne erkennen kann. Er trägt verschlissene kurze Bluejeans und ein Pink-Floyd-T-Shirt. Ja, Mutter würde zu viel kriegen. Ich lächle ihn an und winke.
Der Junge wendet sich wieder seinem Vater zu. »Das ist doch ein Mädchen.«
Der große Mann lacht und gibt dem Jungen einen Schlag auf die Schulter, so fest, dass er vorwärtstaumelt. »Du bist ein Genie, mein Sohn.«
»Dad, ich will aber nicht –«
Der Mann winkt mich auf die Veranda. Ich lege mein Fahrrad hin und steige die Treppe hinauf.
»Willkommen in unserer Straße!«, sage ich und bin dabei so nervös, wie ich es eigentlich nicht von mir kenne – als hätte ich zu viele rohe Austern gegessen. »Ich bin Meridy McFadden und wohne ein Stück die Straße rauf, und heute ist mein zwölfter Geburtstag.«
Der Mann beugt sich zu mir herunter und stützt die Hände auf die Knie. »Hallo, Meridy! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Du siehst aus wie eine kleine Fee. Ich bin Chris Garrett, und das hier ist mein Sohn Danny.«
Ich strecke Danny die Hand hin. »Schön, dich kennen zu lernen. Woher kommt ihr?«
Danny nimmt meine Hand, schüttelt sie mit schlaffem Griff und lässt sie gleich wieder fahren.
»Antworte ihr, mein Sohn. Hast du die Sprache verloren?«
»Birmingham«, murmelt Danny.
»In Alabama?« Ich stelle mich auf die Zehenspitzen, denn dann wirken meine Beine länger, finde ich, und dieser Junge guckt auf mich herunter.
»Gibt es denn noch eins?« Der Junge namens Danny schielt zu meinem Fahrrad herüber.
»Ja. In England.« Ich versuche, mich noch größer zu machen, aber das klappt nicht. Ich verliere das Gleichgewicht und stolpere.
Danny blickt mich immer noch nicht an. »Sehen wir so aus, als kämen wir aus England?«
»Danny.« Mr Garrett gibt ihm eine Ohrfeige. »Das war unhöflich.«
»Tschuldigung.« Danny errötet, dabei verlaufen seine Sommersprossen zu einer einzigen roten Fläche.
»Wollen wir eine Radtour machen? Ich zeige dir die ganze Straße«, schlage ich vor.
»Die ganze Straße. Mann, das dauert ja ungefähr fünf Sekunden«, brummt Danny.
Ich fühle mich wie ein junger Hund, der einen Tritt gekriegt hat. Rasch hüpfe ich die Stufen hinunter ins sommerlich welke Gras – sie sollen meine Verlegenheit nicht sehen.
»Warte, kleine Fee!«, ruft Mr Garrett hinter mir her.
Ich drehe mich um. »Ja, Sir?«
»Vielleicht musst du mit meinem Sohn ein bisschen nachsichtig sein. Er ist ziemlich sauer über unseren Umzug. Aber er würde gerne eine Radtour machen.« Mr Garrett zeigt auf ein rostiges blaues Fahrrad, das an der Veranda lehnt. »Oder etwa nicht, mein Junge?«
»Aber Dad, doch nicht mit einem Mädchen … Was ist, wenn mich jemand sieht?«
»Los jetzt, keine Widerworte mehr!«
»Ja, Vater.« Danny latscht die Stufen herunter, schnappt sich seinen Drahtesel, steigt auf und fährt auf die Straße.
Ich springe auf mein Rad und folge ihm. »Warte, warte!«, rufe ich. »Du verfährst dich doch. Und wir brauchen länger als fünf Minuten – die Straße ist zwei Meilen lang!«
Wir rasen die Straße entlang, eigentlich ohne Ziel, denn Dannys Haus liegt ganz am Ende und ist auf beiden Seiten von Wasser umgeben. Ich hole ihn ein und fahre neben ihm her. »Hey, du weißt gar nicht, wo es langgeht.«
»Scheint nicht gerade kompliziert zu sein«, meint Danny und hält an.
Auch ich steige ab. »Ist es aber. Wenn du zu weit in diese Richtung fährst« – ich deute nach links –, »sieht Mrs Foster dich, und dann kommt sie raus, und du musst mit ihr Tee trinken und Kekse essen. Also musst du auf der anderen Seite der Bäume fahren. Und« – wieder zeige ich – »wenn du da hinten zu weit nach rechts gerätst, rennt der verrückte Mr Mulligan hinter dir her und schreit, dass Granaten kommen und du zurück ins Schützenloch musst. Mutter sagt, er ist immer noch im Zweiten Weltkrieg. Aber ich glaube, er trinkt zu viel Whiskey. Da gibt es ’ne Menge, was man wissen muss, wenn man hier auf der Straße fährt. Man kann nicht einfach ohne Sinn und Verstand drauflosradeln.«
»›Ohne Sinn und Verstand‹? Du hörst dich an wie eine alte Frau.« Danny steht breitbeinig über seinem Fahrrad.
»Na, dann fang mich doch!« Ich springe wieder auf mein Rad und trete, so schnell ich kann. Der warme Wind und der süße Duft der Marschen hüllen mich ein, während mich ein Gedanke durchzuckt: Danny Garrett wird sich in mich verlieben. Warum sonst ist er genau an meinem Geburtstag aufgetaucht, an dem Tag, an dem ich mein erstes Fahrrad gekriegt habe? Endlich kommt das Leben zu mir, und ich muss ihm nicht mehr nachjagen.
Ich bilde mir ein, Dannys Atem im Nacken zu spüren, dabei höre ich nur sein Keuchen und das Sausen der Reifen. Er versucht, mich einzuholen – aber ich lasse ihn nicht.
Mein Rock bauscht sich zu beiden Seiten des Rades, das zerzauste blonde Haar flattert mir in die Augen, und ich stelle mir vor, dass ich eine Fee bin, wie Mr Garrett es gesagt hat. Da geben die Reifen plötzlich ein scheußliches Quietschen von sich, die Straße kommt mir entgegen, und ich segle durch die Luft. Mein Rock verfängt sich in der Fahrradkette, und ich knalle mit dem Gesicht in den grauen Sand am Straßenrand.
Ich wälze mich auf dem Boden, und das Fahrrad rutscht über meinen Kopf und knallt mir gegen die Schläfe. Das tut weh, fast so weh wie neulich, als Daddy mich mit dem Holzlöffel verhauen hat, weil ich Mutter angeschrien hatte, sie solle die Klappe halten. Ich rolle mich zu einer Kugel zusammen und warte darauf, dass der Schmerz vergeht und der Erdboden Danny Garrett verschluckt, damit er mich nicht so auf der Erde liegen sieht.
Über mir lacht jemand, aber ich mache die Augen nicht auf. Ich möchte mich in Luft auflösen, hier an meinem zwölften Geburtstag, noch bevor dieser sommersprossige Junge, der mich gerade auslacht, sich in mich verlieben kann.
Auf einmal aber kommt mir das Lachen bekannt vor. Ich öffne ein Auge und blinzle – Timmy. »Meridy McFadden, was in Dreiteufelsnamen machst du denn da?« Timmy Oliver, mein Nachbar, Rivale und bester Freund in einer Person, beugt sich über mich.
Verlegen rapple ich mich auf. »Nichts passiert … Nein, alles in Ordnung.«
»Deine Mama kriegt bestimmt ’nen Anfall.«
Seufzend betrachte ich mein schmutziges Festtagskleid, an dem jetzt Steinchen und limonengrüne Tüllfetzen kleben.
Timmys Miene wird ernst. »Hast du dir wehgetan?«
»Mutter bringt mich um.« Ich werfe einen Blick zu Danny hinüber. Mit offenem Mund steht er neben seinem Rad. Er sieht so hilflos und so hinreißend aus, dass mein Herz sich weit öffnet.
»Timmy … Das ist Danny«, stelle ich ihn vor. »Er ist heute in das alte Haus von Carmichaels eingezogen.« Ich wische so viel Dreck von meinem Kleid wie möglich.
Danny kommt zu uns herüber, streckt die Hand aus und berührt meine Schläfe. »Du blutest. Soll ich deine Mama holen?«
»Nein, nein, bloß nicht.« Ich fasse Danny am Arm. »Wenn ich was brauche, gehe ich immer zu Timmys Mutter … Das hier ist Timmy.«
Danny sieht Timmy an. »Hi!«
»Ihr seid gerade erst eingezogen?« Timmy deutet mit der Hand die Straße hinauf.
»Ja.«
Sie umkreisen sich wie Hunde, bis Danny plötzlich über das ganze Gesicht grinst, ein Grinsen, bei dem die Schmetterlinge in meinem Bauch so lebhaft flattern, wie ich es noch nie erlebt habe. »Du wohnst auch hier in der Straße?«, fragt er Timmy.
»Ja.« Timmy nickt. »Willkommen!«
Ich streiche meinen Rock glatt. »Hey, ich habe ihn als Erste entdeckt.«
Timmy und Danny schauen sich an. Plötzlich krümmen sie sich vor Lachen und klopfen sich gegenseitig auf die Schultern, als würden sie sich schon seit Jahren kennen.
»Er ist doch kein junger Hund, Meridy.« Timmy richtet mein Fahrrad wieder auf.
Ich recke das Kinn. »Ich wette, ich bin schneller beim Anleger als ihr.«
»Weil ich nicht weiß, wo der Anleger ist, hast du gute Chancen.« Danny zwinkert mir zu, und mein Herzschlag setzt einen Augenblick aus.
»Wartet, ich hole nur eben mein Bike.« Timmy verschwindet hinter seinem Elternhaus, und als wir ihn wieder sehen, saust er schon die Straße entlang Richtung Anleger. Die Spielkarten zwischen seinen Speichen flappen laut.
»Fliegender Start gilt nicht!«, schreie ich hinter ihm her und stelle mich auf die Pedalen. Plötzlich hasse ich meinen rosa Sattel und die rosa Pompon-Troddeln. Wahrscheinlich hat Sissy, meine ältere Schwester, dieses Fahrrad ausgesucht, um mir eins auszuwischen. Ich versuche, meinen Rock unter den Sattel zu stopfen, und beuge mich weit über den Lenker. Danny ist direkt hinter mir, und ich hoffe, dass mein Haar wie Vogelschwingen fliegt, nicht wie ein Büschel verhedderter Strähnen.
Gleichzeitig erreichen wir drei den Anleger und lassen die Räder fallen. Jeder erklärt sich zum Sieger.
»Unentschieden!« Herausfordernd sehe ich die Jungen an und renne auf den Steg. »Wer als Erster …«, schreie ich.
»Du spinnst wohl, Meridy!« Timmy läuft hinter mir her, packt mich am Arm. »In dem Kleid kannst du doch nicht in den Fluss springen. Dann bist du doppelt tot.«
»Doppelt tot kann man nicht sein, du Blödmann. Du willst ja nur nicht der Verlierer sein.«
»Verlierer?« Danny tritt zwischen uns. »Niemals.« Und er saust den Anlegesteg entlang.
Ich stoße einen Schrei aus und jage hinter ihm her, aber er erreicht das Ende zehn Schritte vor mir – der schnellste Läufer in meinem Alter, den ich je gesehen habe. Als ich ihn eingeholt habe, schaue ich ihn fassungslos an.
Jetzt ist auch Timmy da. »Mensch, wo hast du denn so rennen gelernt? So was hab ich noch nie erlebt.«
»Bis jetzt hat keiner gewonnen«, sage ich, breite die Arme aus und stelle mich so hin, dass meine Zehen über die Kante des Bohlensteges ragen.
»Wetten, dass du dich nicht traust?« Wieder grinst Danny.
Ich schließe die Augen und springe mit ausgebreiteten Armen, wobei ich mir einbilde, dass mein Kleid so fliegt wie Feenflügel.
Beide Jungen brüllen meinen Namen, als ich eintauche. Ich bleibe ein paar Augenblicke unter Wasser, so wie ich es immer mache, und lasse mich vom Meer liebkosen. Das Meer und ich haben eine besondere Beziehung – es wartet auf mich, nimmt mich in die Arme, streichelt mich. Unter dem Gekräusel der Wellen spreche ich mit ihm: Ich habe ihn gefunden. Er heißt Danny Garrett, und er ist meinetwegen hier. Ich bilde mir immer ein, dass das Meer meine Gedanken lesen kann … dass es weiß, was ich will und was ich brauche.
Meine Lungen lassen mich im Stich, sie brennen. Rasch tauche ich auf und sehe, dass die Jungen zu mir herunterschauen. Mein Kleid schwimmt jetzt wie eine Blase aus Tüll, in der ich mich treiben lasse. »Gewonnen!«, rufe ich.
Um Dannys blaue Augen bilden sich Lachfalten. »Die hat sie nicht mehr alle, was?«
»So was sagt man hier nicht.« Ich mache Wassertreten, damit ich oben bleibe. »Und ich hab gewonnen.«
Die Jungen zwinkern sich zu und springen hinter mir her. Lachend ringen wir miteinander, Danny und Timmy in ihren Shorts und ich in meinem guten Kleid.
Danny fasst mich am Arm. Direkt neben uns springt ein Delphin aus dem Wasser, er schlägt mit dem Schwanz und bespritzt uns. Beim Anblick des geschmeidigen Tieres werden wir alle drei still. Ich strecke die Hand aus und streichle dem Delphin über den Rücken. Danny hält den Atem an, und als er das Tier berührt, liegt seine Hand neben meiner auf der glatten Haut. Der Delphin hebt die rundliche Nase und nickt uns zu, taucht wieder unter und schwimmt davon. Er hat uns einen Segen hinterlassen.
Auf dem Nachhauseweg weiß ich, dass die Strafe, die meine Mutter über mich verhängen wird, mir nichts anhaben kann. Meine Familie steht auf der Veranda, als ich vorfahre. Mutter kommt die Stufen heruntergehetzt und packt mich an den Schultern. »Ach, du lieber Himmel, was ist denn mit dir passiert, Meridy?«
»Nichts, Mutter. Kein Grund, wieder einen deiner Anfälle zu kriegen.«
Danny und Timmy stehen in der Einfahrt, wechseln einen Blick und schauen dann zu uns herüber. Ich bedeute ihnen winkend, dass sie weiterziehen sollen. Mutter deutet mit zitterndem Zeigefinger auf mich. »Du bist mit diesen Jungs unterwegs gewesen, und ich hab mir solche Sorgen um dich gemacht. Mein Gott, fast hätte ich die Polizei gerufen.«
Daddy tritt zu uns und nimmt mich in die Arme. »Alles in Ordnung, Schätzchen?« Er zwinkert mir zu.
»Ja, Daddy.«
Mutter kreischt. Ich fürchte mich vor dieser Stimme – es ist ein hohes Heulen und bedeutet, dass sie drei Tage lang im Bett liegen wird und dass der Doktor kommen muss, und alles ist meine Schuld.
»Was sollen wir bloß mit ihr machen, Dewey? Was? Es kann doch nicht angehen, dass wir eine Tochter haben, die …« Mutter verstummt; sie sinkt auf der Verandatreppe zusammen, und jetzt fließen auch Tränen. Es wird Tage dauern, bis sie sich wieder beruhigt hat.
Danny taucht neben mir auf. »Sir.« Er schaut zu Daddy auf. »Das war alles meine Schuld. Ich bin neu hier – wir sind weiter unten eingezogen –, und ich habe Ihre Tochter gefragt, ob sie mir die Gegend zeigen kann, und –«
»Es ist gar nicht seine Schuld«, unterbreche ich ihn.
»– und ich hab gesagt, sie würde sich garantiert nicht trauen, ins Wasser zu springen, Sir, ich hab ja nicht gewusst, dass sie es wirklich tun würde.«
»Du hast dein Kleid ruiniert«, sagt Mutter mit tränenerstickter Stimme. »Du hast das Kleidchen von Omi ruiniert.«
Sissy, die im Schaukelstuhl auf der Veranda sitzt, grinst schadenfroh. »Man muss sich wirklich schämen für dich«, sagt sie und wirft mit einer raschen Kopfbewegung ihre Locken zurück. Ich strecke ihr die Zunge heraus.
»Mami, hast du das gesehen? Meridy hat mir die Zunge rausgestreckt. Sie ist so … so gemein.« Sissy steht auf, geht ins Haus und knallt die Fliegengittertür hinter sich zu, um ihre Worte zu unterstreichen.
Daddy lässt mich los und sieht Danny an. »Und wer bist du, mein Sohn?«
»Danny Garrett.« Er wird rot und scharrt verlegen mit den Füßen im Kies.
»Aha, Danny Garrett. Also, jetzt weißt du ’s – Meridy traut sich immer. Und es war nicht deine Schuld.«
Mutter jammert wieder los. Ich hebe meine tropfenden Röcke ein wenig und schaue meinen Vater an. »Er konnte wirklich nichts dafür, Daddy, und ich kann dieses Fähnchen sowieso nicht leiden.«
»Meridy, das ist respektlos.« Daddy legt die Hand auf meine Schulter.
»Bitte, Sir, bestrafen Sie Meridy nicht!«, sagt Danny.
Und in diesem Augenblick, an meinem zwölften Geburtstag, während meine Mutter heult wie ein sterbendes Tier und ich in meinem tropfenden Kleid vor unserer Veranda stehe, stiehlt Danny sich in mein Herz.
Ich drehe mich zu Timmy um, aber er ist fort. Ich bin verwirrt, schaue suchend nach rechts und nach links. Da geht Danny rückwärts, wird zu einer undeutlichen Silhouette, wehende Rauchfetzen umgeben ihn. Ich strecke die Arme nach ihm aus. Jetzt bin ich älter, aber ich weiß nicht genau, wie alt. Danny verschmilzt mit dem salbeigrünen Gras- und Sumpfland des Lowcountry. Ich wende mich wieder meiner Familie zu, ich schreie und flehe sie an, sie sollen mir helfen, Timmy und Danny zurückzuholen. Aber Mutter und Daddy sind auch verschwunden. Ich bin allein. Vollkommen allein. Ich sinke in mich zusammen und weiß, dass ich es verdient habe.
Ich erwachte, griff nach meiner Bettdecke und rollte mich ein. Wie immer kehrte mit diesem Traum auch die Sehnsucht meiner Jugend zurück. Lange hatte ich nicht mehr von Danny geträumt. Ich wartete, dass die Sehnsucht verging, vergrub den Kopf noch ein paar Sekunden im Kissen, bis ich ganz wach war. Schlaftrunken versuchte ich, dem Gefühl nachzuspüren, das der Traum hinterlassen hatte. Die Bäume draußen vor dem Fenster waren noch Schatten in der Nacht. Der Wecker blinkte: drei Uhr morgens.
Ich war nicht allein, auch wenn ich die Einsamkeit so deutlich spürte, als sei das Bett neben mir leer. Aber an meiner Seite schlief Beau, mein Mann. Er atmete gleichmäßig mit offenem Mund, so wie ich es nun seit zwanzig Jahren von ihm kannte. Selbst im Schlaf war er hinreißend.
Leise stand ich auf, streckte mich und schlich auf Zehenspitzen hinaus, um Beau nicht zu stören, der bis in die Morgenstunden hinein gearbeitet hatte. Im Flur blieb ich vor der Tür zum Zimmer meines Sohnes stehen. Zum ersten Mal seit Jahren konnte ich diese Tür öffnen, ohne anzuklopfen – Ben war fort. Das Gefühl der Einsamkeit, die der Traum hinterlassen hatte, vertiefte sich noch. Dabei hatte ich stets gedacht, ich würde nicht so reagieren wie andere Mütter, sollte ich eines Tages mit dem sprichwörtlichen leeren Nest konfrontiert sein. Ich war überzeugt gewesen, dass ich diese umfassende Veränderung und den Kummer, den ich bei Freundinnen beobachtet hatte, nicht würde durchmachen müssen.
Bens Tür knarrte, als ich sie öffnete – ein verräterisches Geräusch, als wäre ich ein Eindringling. Die Jalousien waren nicht heruntergelassen, so dass im Raum bereits das kaum wahrnehmbare Licht herrschte, das die Morgendämmerung ankündigt. Erst drei Wochen war mein Sohn im Baseballcamp der Vanderbilt University, und sein Zimmer wirkte, als sei er noch bei uns. Wäre das Bettzeug nicht glatt gestrichen gewesen und hätten die Baseballsachen, seine Kappen und Schuhe nicht gefehlt, die sonst über den Fußboden verstreut lagen, hätte ich mir einreden können, dass er zu Hause ist.
Ich schloss die Tür wieder und lehnte die Stirn gegen den Türrahmen. Eine Erschöpfung erfasste mich, die mehr war als bloßer Schlafmangel. Es war, als sei mein Motor in den Jahren, in denen ich meinen geliebten Sohn bemuttert hatte, auf Hochtouren gelaufen und als werde ich jetzt, da ich bremsen wollte, nur noch vom Schwung vorwärtsgeschoben.
Die Wendeltreppe lag im Schatten. Ich knipste das Licht für die Diele unten an und ging in die Küche hinunter. Nachdem ich den Wasserkessel gefüllt hatte, griff ich nach der Kaffeemühle. Dabei stieß ich mit dem Ellbogen gegen Beaus Aktentasche, und Papiere flatterten zu Boden, als wären sie ein Sinnbild dafür, wie aufreibend sein Job geworden war, seit er in der Kanzlei die Teilhaberschaft anstrebte. Ich bückte mich, um die Bögen aufzuheben. Notizen in der zierlichen Schrift der neuen Juniorpartnerin füllten die Ränder. Ihre Aufgabe bestand darin, bei dem immer weiter ausufernden Fall, in dem es um fahrlässige Tötung ging, zu helfen, wo Not am Mann war. Ihre Handschrift war genauso feminin wie ihre Kleidung, ihr Gang und ihre schlanken, muskulösen Beine auf den hohen Absätzen. Ich schüttelte den Kopf. Eigentlich sollte ich dankbar sein, dass Beau Unterstützung bekam – schließlich befreite ihn das von ein paar aufreibenden Arbeiten.
Damit war ich an dem gleichen Punkt wie üblich: Mein Traum hatte mich daran erinnert, dass ich verantwortungsbewusst leben musste, denn sonst konnte ich wieder genauso viel verlieren, wie ich damals verloren hatte, damals, als ich mich immer getraut hatte, damals, als ich geglaubt hatte, die Welt warte nur auf mich und das Leben läge noch vor mir.
Zwei
Das Herz meint nicht alles, was der Mund sagt.
Gullah-Weisheit
Die Schuld an dem zermürbenden Tag, der auf meinen Traum folgte, könnte ich Cate geben, meiner besten Freundin. Und manchmal tue ich das auch. Ich bin nicht sicher, ob ihre Worte und Anspielungen einfach der zündende Funke für etwas waren, was schon lange in mir geschwelt hatte, oder ob ihr Beispiel etwas Neues bei mir in Gang setzte. Wie dem auch sei, mich beschlich ein Unbehagen – so süß, klebrig und ärgerlich wie Sirup.
Cate saß an einem runden Tisch in einer Ecke von Sylvia’s Tea Room, einem Restaurant auf der Einkaufsmeile von Buckhead – nahezu ideal, um nach dem Essen, ohne Zeit zu verlieren, dem Nobelkaufhaus Neiman Marcus einen Besuch abzustatten. Sie hielt den braunen Lockenkopf tief über die Speisekarte gesenkt, deren Inhalt sie schon seit Jahren auswendig kannte, wie ich genau wusste.
Ich trat an ihren Tisch und klopfte auf die Platte. »Cate.«
Als sie zu mir aufsah, breitete sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht aus, doch es war nicht mehr so strahlend, wie ich es aus früheren Jahren gewohnt war. Ihre blauen Augen wirkten müde. »Hallo, ich habe dich gar nicht hereinkommen sehen«, sagte sie, stand auf und umarmte mich.
Wir setzten uns, und ich nahm die Speisekarte in die Hand. »Und du musst die hier lesen? Als wüsstest du sie nicht längst in- und auswendig?«
Cate lachte und schob sich eine Locke hinter das linke Ohr, eine vertraute Geste, die Erinnerungen an bessere Zeiten weckte – an die Zeiten vor ihrer Trennung, vor all den Veränderungen in unserem Leben. Sie war mit Harland verheiratet gewesen, Beaus Chef, und mit ihrer Scheidung hatte unsere schöne Freundschaft sich in eine komplizierte Beziehung verwandelt. Ich pflegte zu verdrängen, wie sehr ich Cate vermisste, bis sie dann etwas sagte oder tat, was ich zwanzig Jahre lang an ihr beobachtet hatte – und dann war mir, als hätte ich ein Foto von einem vergessenen Urlaub betrachtet und mich von einer nostalgischen Sehnsucht überwältigen lassen.
Cate griff über den Tisch und berührte meinen Arm. »Wie geht’s dir, Meridy?«
»Gut – aber viel wichtiger ist, wie es dir geht.«
Sie presste die Lippen zusammen, so dass von ihrem klassisch roten Lippenstift nur noch eine schmale Linie zu sehen war. »Es wird langsam besser«, sagte sie leise.
»Ich wünschte, ich könnte … mehr tun.«
Sie zuckte die Achseln. »Du kannst nicht viel machen, es sei denn, du würdest Harland aus seinem Wahnsinn herausholen. Aber eigentlich will ich das gar nicht. Inzwischen will ich ihn gar nicht mehr wiederhaben.«
»Wirklich nicht?« Ich schob die Speisekarte weg.
Cate sah zur Seite und nickte dem Kellner zu, der sich gerade näherte. Nachdem wir unseren üblichen Salat mit Gorgonzola und Pekannüssen bestellt hatten, bat Cate noch um zwei Gläser Weißwein.
Ich hob die Hand. »Kommt gar nicht in Frage. Ich werde schläfrig, wenn ich mitten am Tag Wein trinke.«
»Doch, heute trinkt sie ein Glas Wein«, sagte Cate bestimmt und schaute erst den Kellner an, dann mich. »Heute trinkst du mit.«
Ich gab mich geschlagen. »Also gut, aber dann bist du schuld, wenn mein Kopf so schwer wird, dass er in den Salat fällt.«
Als der Kellner sich wieder entfernte, blickte ich Cate scharf an. »Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Willst du Harland wirklich nicht zurückhaben? Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er irgendwann aufwacht und begreift, dass er den Verstand verloren hat.«
»Darauf kann ich nicht warten. Ich möchte einfach die Fassung wiedergewinnen, und zwar sofort.«
Ich nickte. »Ich vermisse dich hier so sehr, Cate. Besteht die Möglichkeit, dass du zurückkommst, wenn … der ganze Wirbel sich gelegt hat?«
Cate seufzte und nestelte wieder an ihren Haaren. »Ich glaube nicht, Meridy. Ich muss … in die Zukunft schauen. Zum Glück habe ich ja das Haus in Wild Palms. Ich kann nicht zurückkommen und zugucken, wie er und diese Anwaltsgehilfin – ich meine natürlich seine neue Gattin – gemeinsam in der Stadt rumspazieren und in meinem Haus wohnen. Das ist alles so widerwärtig – und ich werde mein Leben niemals richtig in den Griff kriegen, wenn ich mich weiter an –« sie spreizte die Hände und machte eine wegwischende Bewegung –, »an dieses Leben hier klammere.«
»Wow!« Ich trank einen großen Schluck Wasser.
»Ich habe Freunde in Wild Palms. Und ich male wieder. Die Scheidungsvereinbarung ist rechtskräftig.«
Ich nickte. »Okay, demnach ist es egoistisch von mir, dass ich dich wieder hier haben möchte.«
Cate lächelte. »Nicht egoistisch. Du lebst immer noch mitten in diesem ganzen Chaos, in dieser ganzen … künstlichen Welt. Du kannst es eben nicht von der anderen Seite aus betrachten.«
Unsicher lehnte ich mich zurück. Unsere wohltuende Freundschaft schien nur noch wie eine Fata Morgana vor mir zu wabern. »Warum empfinde ich das, was du gerade gesagt hast, irgendwie als Beleidigung?«
Cates Augen wurden feucht. »Ach je! So habe ich es bestimmt nicht gemeint. Seit meiner Scheidung sage ich ständig Dinge, die ich früher nie gesagt hätte. Ich wollte dich nicht kränken. Du bist meine liebste Freundin. Ich schätze dich sehr. Es ist bloß einfach so, dass ich das Leben, das du hier führst, hinter mir habe.«
Der Kellner erschien und servierte uns die Salate und den Wein. »Brauchen die Damen sonst noch etwas?« Wir schüttelten die Köpfe.
»Was führe ich denn hier für ein Leben?«
»Ein Leben in Lärm, Chaos und Hektik, so dass man vergisst, innezuhalten, um etwas richtig wahrzunehmen oder zu besprechen, und ehe man sich umguckt, hat der eigene Mann einen neuen Porsche und eine neue Frau.«
»Cate«, sagte ich leise, »das passt nicht zu Beau.«
Sie nickte. »Zu Harland hat es auch nicht gepasst.«
Darauf konnte ich nichts erwidern, denn Cate hatte Recht. Wenn ich hätte wetten müssen, wer von den zehn Männern in der Kanzlei eine Affäre beginnen und seine Frau verlassen würde, hätte ich Harland auf den neunten Platz gesetzt. Ich holte tief Luft. »Dann erzähl mal: Wie geht es Chandler und Becca?«
Cate lächelte, und diesmal hellten ihre Züge sich auf wie früher. »Gut. Sie haben sich beide entschieden, bei mir zu wohnen, nicht bei Harland, jedenfalls den Sommer über, bevor das College in Georgia wieder anfängt. Ich bilde mir gerne ein, dass es ihnen dabei um mich geht, aber natürlich sind sie vor allem auf den Strand scharf.«
Aus den Augenwinkeln nahm ich plötzlich etwas Vertrautes wahr. Ich drehte den Kopf und zuckte zusammen. »Cate? Eben hast du gesagt, du wolltest hier nicht mehr leben, damit du Harland nicht über den Weg läufst –«
Sie folgte meinem Blick und stöhnte. »Ach, Meridy, gerade wenn ich denke, ich wäre endlich mit mir im Reinen, falle ich wieder in dieses verdammte Loch. Bitte sorg dafür, dass er uns nicht sieht.«
Möglichst unauffällig versuchte ich, Harland und seine Begleitung im Blick zu behalten, die soeben das Restaurant betraten. Alexis stützte sich auf seinen Arm. In ihrem bleistiftengen Rock und auf den zu hohen Absätzen musste sie eilige Trippelschrittchen machen, um an seiner Seite zu bleiben.
Ich beugte mich vor. »Cate, lass uns einfach über was anderes reden, dann bemerken sie uns schon nicht …«
»Was wollen die bloß hier? Harland kann das Restaurant doch gar nicht leiden – er hat immer gesagt, es wäre nur was für Frauen, zum Lunch.«
Da hörte ich meinen Namen. Beim vertrauten Klang von Beaus Stimme wandte ich unwillkürlich den Kopf. Mein Mann winkte und kam zwischen den Tischen hindurch auf uns zu.
»Beau?« Ich stand auf.
»Hallo, Schatz, was für eine schöne Überraschung!« Er küsste mich. »Nichts kann mir so den Tag versüßen wie eine unverhoffte Begegnung mit dir.«
Er beugte sich zu Cate hinunter und umarmte sie. »Wie schön, dich zu sehen, Cate.«
Sie nickte, drehte die Gabel in der Hand. »Gleichfalls, Beau.«
»Was wollt ihr denn hier?«, erkundigte ich mich.
Beau deutete auf Harland, Alexis und die Juniorpartnerin Ashley, die stehen geblieben waren. »Wir arbeiten pausenlos an diesem Fall, und heute haben wir einen Durchbruch erzielt, daher durften die Damen sich aussuchen, wohin sie zum Lunch wollen. Offensichtlich ein Fehler. Ich bin für Chops gewesen, aber überstimmt worden.« Er hob die Aktentasche. »Doch es wird ein Arbeitsessen.«
»Ach so …« Ich starrte die drei anderen an. Harland bedeutete Beau, sich zu beeilen.
»Bin gleich da!«, rief Beau halblaut, bevor er sich wieder an uns wandte. »Was wollt ihr beiden denn heute anstellen?«
Ich warf Cate einen Blick zu. »Essen, shoppen …«
»Erst muss Meridy in die Geschäfte mitkommen, die mir in Wild Palms fehlen«, erklärte Cate. »Und dann hole ich die letzten Kisten mit meinen Familienerbstücken aus dem Haus ab.«
Beau schaute mich an. »Ach so … okay. Also, einen schönen Tag euch beiden.« Dann schloss er mich schwungvoll in die Arme, beugte mich hintenüber und küsste mich. Die Gäste am Nebentisch lachten. Zwei Frauen klatschten in die Hände. Beau grinste.
Spielerisch boxte ich ihn in die Schulter. »Los, an die Arbeit mit dir!«
Während er zwischen den Tischen hindurchschlenderte, winkte er mir noch einmal zu. Ich setzte mich wieder hin. »Tut mir wirklich leid, dass das passiert ist, Cate. Ich hatte mir so gewünscht, dass wir diesen Tag ganz für uns haben. Ich hatte mich schon ewig darauf gefreut. Harland ist so ein –«
»Arschloch.« Cate beendete den Satz für mich, und nachdem sie einen Schluck Wein getrunken hatte, wiederholte sie: »So ein unglaubliches Arschloch.« Sie schlug die Hände vors Gesicht und schüttelte den Kopf. »Ach, lass nur, mir geht’s gut … Wir tun einfach so, als wäre das eben nicht passiert.«
Ich drückte ihren Arm. »Okay, also noch mal von vorn.«
»Das geht nicht«, erwiderte sie.
»Doch, das geht …«
»Meridy.« Cate beugte sich vor. »Gib gut Acht! Schau genau hin, und hör gut zu! Wir lassen uns von diesem Leben einlullen, denn von außen sieht das alles so verdammt toll aus – dabei ist es nur der schöne Schein. Wie die große alte Eiche, die bei uns im Garten stand. Sie war ein Prachtexemplar von einem Baum, bis sie durch unser Dach in die Küche krachte und wir festgestellt haben, dass das Wurzelwerk völlig verfault war.«
»Was willst du damit sagen?«
»Gar nichts, nein. Ich glaube, ich möchte dir nur erklären, wie anders das alles jetzt von meiner Warte aus wirkt. Hör zu, Meridy, du hast mir gegenüber mal angedeutet, dass Beau nicht alles über deine Vergangenheit weiß. Und ich glaube nicht, dass eine Frau immer bis in die kleinsten unschönen Einzelheiten erzählen sollte, was sie gemacht hat – eine Frau muss auch Geheimnisse haben.« Cate zwinkerte mir zu. »Aber ich bitte dich einfach, hinzuschauen und hinzuhören. Er kommt spät nach Hause, ihr sprecht nicht miteinander – das addiert sich alles.«
Ich nickte. Am liebsten hätte ich ihr von meinem Traum erzählt und von der Frau, die ich früher gewesen war, bevor ich Cate kennen gelernt hatte, vor den Designerklamotten und dem gestylten Haar, vor Ehemann, Haus und Kind. Stattdessen trank ich einen großen Schluck Wein.
»Ich weiß nicht, wie es kommt, dass wir so werden … dass wir so abstumpfen, bis wir gar nicht mehr mitkriegen, was vor sich geht – aber eins weiß ich sehr gut, nämlich dass ich nie wieder so sein will«, erklärte Cate. »Erinnerst du dich noch an diesen Streich mit dem Bus, an dem euer Ben beteiligt war?«
Rasch blickte ich mich um. »Das ist doch schon Jahre her«, wisperte ich.
Cate nickte. »Das weiß ich. Und du hast es Beau nie erzählt.« Sie beugte sich wieder vor. »Solche Dinge sind es, die die Wurzeln verrotten lassen.«
»Ich habe bloß versucht, den Frieden zu wahren … Ich wollte bloß –«
»Ich weiß, meine Liebe. Genau wie ich.«
»Ich glaube, allmählich gefällt mir diese neue Cate, die kein verdammtes Blatt mehr vor den Mund nimmt«, stellte ich fest.
»Aha, hast du das gemerkt? Du fluchst. Ich übe schon einen schlechten Einfluss auf dich aus. Vielleicht überrede ich dich gleich zu Klamotten, die nicht zusammenpassen, oder sogar zu einem zweiten Glas Wein.«
»So schlimm bin ich gar nicht, Cate.«
»Nein, aber so brav.«
Ich hob mein Glas und neigte es in ihre Richtung. »Auf dich!«
»Und auf dich!«
Die Frau, die mir gegenübersaß, war meine beste Freundin, aber vollkommen anders als ich. Sie wirkte fast, als habe sie Fesseln abgelegt – Fesseln, die sie sich früher einmal irrtümlich gewünscht hatte.
Aber ich war anders und Beau auch. Oder etwa nicht?
Nach dem langen Tag mit Cate hatte ich nicht die geringste Lust, am Abend noch mit Harland, Alexis und zwei weiteren Paaren essen zu gehen. Aber dieses Dinner sollte zur Feier von Harlands fünfzigstem Geburtstag stattfinden, und Beau und ich hatten zugesagt. Ich schüttelte das schmerzhafte Gefühl der Einsamkeit ab, das sich in meiner Brust breitgemacht hatte, lehnte mich an die Granittheke in meiner Küche, klemmte mir das Telefon unters Kinn und starrte nach draußen in den frühen Abendhimmel, an dem sich ein Stern unter den Mond kuschelte. Im Laufe der Nacht würde der Stern immer weiter vom Mond fortwandern – oder vielleicht war es auch umgekehrt; jedenfalls löste diese Vorstellung ein trostloses Gefühl in mir aus, und ich fiel in ein Loch, das immer tiefer wurde. Während Mutter mir von der letzten Versammlung ihrer Gesellschaft der Ladies of Seaboro berichtete, überlegte ich, welche Termine diese Woche noch anstanden und dass Beau und ich zu Harlands Dinnerparty zu spät kommen würden.
»Ich muss jetzt Schluss machen«, unterbrach ich den Redefluss meiner Mutter und konzentrierte mich mehr darauf, welche Schuhe ich zu meinem Leinenanzug anziehen sollte, als auf ihre letzten Sätze.
»Na schön, Meridy, wenn du keine Zeit für mich hast …«
»Nein, darum geht es nicht. Ich bin einfach spät dran –«
»Ach, und übrigens …« Mutters Stimme wurde höher, ein Zeichen dafür, dass sie Neuigkeiten von größter Bedeutung hatte, Neues aus Seaboro, dem Städtchen, in dem ich geboren und aufgewachsen war und um das ich in den letzten sechsundzwanzig Jahren immer einen möglichst großen Bogen gemacht hatte. »Das habe ich dir ja noch gar nicht erzählt – die Historische Gesellschaft hier bemüht sich gerade, Geld zusammenzukriegen, um endlich das Leuchtturmwärterhaus zu renovieren.«
Die Erinnerung an das Leuchtturmwärterhaus berührte mich so unmittelbar wie Atem auf meiner Haut – sie war so deutlich, dass ich glaubte, ich könne die Hand ausstrecken und die verwitterten Holzschindeln berühren. Ein Schauder überlief mich. »Ich dachte, das wäre schon längst passiert«, sagte ich so leise und reglos, als könne man mich finden, wenn ich mich bewegte.
»Na ja, als sie damals nach dem Brand das Fundament ein Stück vom Meer weg wieder aufgebaut haben, wurde viel über Neubau und Renovierung diskutiert. Und dann hat das Haus einfach so dagestanden. Aber jetzt ist die Sache wieder in Bewegung gekommen. Es hat damit angefangen, dass die Historische Gesellschaft sich überlegt hat, wie man mehr Touristen aus Beaufort herlocken könnte. Dieses Leuchtturmwärterhaus hat ja eine interessante Geschichte. Also versuchen sie, Geld zu sammeln … Nein, eigentlich soll es nicht gesammelt werden, sondern man will die Summe von Tim Oliver einfordern. Er wird endlich Wiedergutmachung leisten müssen.«
Meine Benommenheit verwandelte sich in Übelkeit. Seit dem Brand vor sechsundzwanzig Jahren hatte Mutter das Leuchtturmwärterhaus nicht mehr erwähnt.
»Wie bitte? Wiedergutmachung? Warum gerade Tim?«
»Also.« Mutter sprach langsam, als wäre ich ein begriffsstutziges kleines Kind. »Sie brauchen eine Menge Geld, und die Stadt kann diesen Betrag nicht aufbringen. Da ist es am einfachsten, Tim für das bezahlen zu lassen, was er getan hat.«
»Mein Gott, Mutter, jetzt klingst du wie Beau. Tim soll für das bezahlen, was er getan hat? Seaboro kann ihn doch nicht zwingen, so viel Geld zu spenden, bloß weil da vor Ewigkeiten ein Unglück passiert ist.«
»Unglück oder nicht … Jemand muss dafür aufkommen, und man hat entschieden, dass er damals an dem Brand schuld war, Meridy. Die Stadt braucht bloß ein bisschen nachzuhelfen, und schon –«
»Aber Seaboro kann so eine Summe doch bestimmt aufbringen.« Ich war mir nicht sicher, ob Mutter mich überhaupt gehört hatte, denn meine Stimme wurde immer schwächer. »Tim hatte mit dem Brand doch gar nichts zu tun.«
»Ich weiß, dass du das gerne glauben möchtest, weil ihr früher befreundet wart, aber du kennst die Wahrheit. Schließlich hat er damals die Party gegeben.« Ihre Stimme drang überheblich und selbstgerecht aus dem Hörer.
»Die Wahrheit …«, wiederholte ich. Eine Kluft tat sich vor mir auf, größer noch als der Abstand, der zwischen damals und heute lag.
»Meridy, bist du noch dran?« Mutters Stimme schien von weit her zu kommen.
»Ja.« Mein Körper sackte am Schrank hinunter, bis ich auf dem Travertinboden saß. »Wir sprechen später weiter, ja?« Ich drückte auf END und ließ das Telefon auf den Steinboden fallen, ohne mich von Mutter zu verabschieden – was fast eine Todsünde war.
Tim.
Nie, kein einziges Mal in all den Jahren, hatte ich gedacht, dass dieses Bruchstück meiner Vergangenheit mich einholen könnte. Ich war zu sehr damit beschäftigt gewesen, mir mein gegenwärtiges Leben aufzubauen, dieses Leben, in dem ich meinen Wert bewiesen hatte.
Jetzt nicht.
Über die große zeitliche Entfernung hinweg, die Mutters Worte gerade überbrückt hatten, hörte ich die Stimme unserer alten Haushälterin, die Gullah sprach und eine ihrer vielen Redensarten zitierte. »Wie sehr du dich auch bemühst, den Rauch zu ersticken, er muss aufsteigen.«
Mein Traum. Das Leuchtturmwärterhaus.
Jetzt nicht.
Es klingelte an der Haustür, und ich sprang vom Boden auf und schüttelte mich. Ich erwartete niemanden.
»Ich geh schon!«, rief Beau.
Leicht schwankend tappte ich in Richtung Haustür, aber da kam Beau schon durch die Diele, knöpfte sein babyblaues Oberhemd zu und öffnete. Draußen stand Ashley. Als sie sich in unser Haus schieben wollte, trat ich neben meinen Mann. Sie beachtete mich nicht, sondern hatte nur Augen für Beau. Lächelnd streckte sie ihm einen Stapel Akten entgegen. »Hier sind die Unterlagen, die du vergessen hattest.«
»Unterlagen?«, fragte ich.
Beau antwortete mir nicht. »Ashley, herzlichen Dank. Ich brauche sie unbedingt. Schön, dass du sie gefunden hast und damit vorbeigekommen bist.«
»Gerne. Jederzeit. Dafür bin ich schließlich da – um mich um so etwas zu kümmern.« Ihr Blick wanderte durch die Diele nach links zum Wohnzimmer. »Ihr habt ein schönes Haus.«
»Danke«, sagte Beau und legte den Arm um mich. »Meridy ist diejenige, die hier den guten Geschmack hat.«
Schau genau hin, und hör gut zu!
Ich lächelte. »Wozu brauchst du heute Abend noch Akten, Schatz? Wir gehen doch aus.«
Beau drückte mich an sich. »Ich muss sie bis morgen früh durchsehen. Neue Infos zu dem Fall.«
Er nickte Ashley zu. »Danke schön.«
Sie zögerte, sah mich endlich an, drehte sich um und stöckelte meine Vordertreppe hinunter. Während ich die Tür schloss, klopfte ich auf den Packen Papier in Beaus Hand. »Hättest du nicht heute Abend auf dem Weg zum Club im Büro vorbeifahren können?«
»Doch, aber dazu habe ich wirklich keine Lust. Ich bin ohnehin schon viel zu viel da. Ashley hat gesagt, sie würde auf dem Heimweg immer hier vorbeikommen.« Er legte den Kopf schräg. »Gibt’s da ein Problem?«
»Nein, nein, überhaupt nicht. Ich muss mir bloß noch Schuhe anziehen.« Prüfend sah ich ihm ins Gesicht. Beau war und blieb der schönste Mann, den ich je getroffen hatte. Sein Haar war schwarz wie die Nacht, und seine Augen schimmerten so dunkelblau wie die tiefen Stellen im Meer hinter meinem Elternhaus im Lowcountry. Damals hatte ich mir geschworen, nie wieder im Meer zu schwimmen. Und als ich Beau kennen lernte, stellte ich mir vor, dass seine Augen der Ozean seien, in den ich eintauchen konnte.
Aber falls er das mit dem Leuchtturmwärterhaus je herausfinden sollte, würde diese Geschichte den Abstand zwischen dem Mond und dem Stern so sehr vergrößern, dass sie am Abend nicht mehr zusammenfinden könnten. Ich nahm ein Paar helle Riemchensandalen aus dem Schrank. Als ich zu Beau in den Wagen stieg, hatte ich Mühe, die Angst zu unterdrücken, die in mir aufstieg.
Beau blickte geradeaus auf die Straße, während er uns in den Club fuhr. Seine Lippen formten die Worte eines Schlagers im Radio nach, aber ich konnte erraten, wo er in Gedanken war – bei dem Fall, in dem er die Anklage vertreten würde. Er arbeitete seit zwanzig Jahren in derselben Kanzlei, und wenn dieser Prozess gut lief, sollte er Teilhaber werden, womit er Harland gleichgestellt wäre. Beau hatte eine Bilderbuchkarriere hinter sich – in weniger als fünf Jahren war er vom Angestellten zum Partner aufgestiegen.
Ich schaute aus dem Seitenfenster auf den Verkehr der Peachtree Road, der vollkommen stillstand, als hätten die Autos sich zu einem Blutgerinnsel zusammengeballt. Eigentlich aber sah ich nur Ashley, die vor meiner Haustür stand und meinen Mann und mein Haus begutachtete. Ich griff nach Beaus Hand. Bei solchen Gelegenheiten war mein Zorn auf Harland Finnegan am größten. Heute Abend hätte ich Cate am Dinnertisch gebraucht, nicht Harlands Ersatzfrau. Ich hatte das Gefühl, aus dem Gleichgewicht geraten zu sein, und wünschte mir eine stabilisierende Kraft.
Beaus Handy meldete sich. Er nahm es aus der Halterung.
»Beaumont Dresden.«
Während er zustimmende Worte in den Hörer murmelte, lehnte ich müde den Kopf an die Fensterscheibe. Offenbar war das wieder einmal ein Anruf von der Presse, bei dem es um den Fall von fahrlässiger Tötung ging, der im vergangenen Jahr jede Minute von Beaus Zeit verschlungen hatte. Am liebsten hätte ich meinem Mann das BlackBerry weggenommen und aus dem Fenster geschleudert. Ein Teil von mir konnte es nicht ertragen, auch nur noch ein einziges Wort über die Lebensmittelvergiftung zu hören, die ein kleines Kind das Leben gekostet hatte.
»Wir werden dafür sorgen, dass sie bezahlen – sie dürfen nicht ungestraft davonkommen.« Nach diesen Worten, die ich schon tausendmal von ihm gehört hatte, seufzte Beau. »Und ich wiederhole noch einmal: Anfangs war diese Fahrlässigkeit wahrscheinlich einfach ein Versehen, ein Fehler. Aber dann hat die Firma diesen Fehler verschwiegen, sie hat diese unglaubliche Nachlässigkeit vertuscht. Selbst als das Kind bereits erkrankt war, ist sie nicht mit der Wahrheit herausgerückt. Das war ihr schlimmster Fehler. Dieser Betrug ist es, der sie am meisten kosten wird. Sie muss für die Schmerzen und das Leid meines Klienten aufkommen. Das Kind ist tot.«
Ja, das war die Arbeit meines Mannes, dessen Sinn für Integrität so tief in ihn eingegraben war wie die Furchen, die sich auf seiner Stirn gebildet hatten, weil er bis in die frühen Morgenstunden die Prozessakten studierte. Ich hatte sein Credo so oft gehört wie nur irgendetwas in meinem Leben: Wenn man Leid und Schmerzen verursacht, muss man dafür bezahlen.
Beau legte auf, und während wir am Parkservice des Clubs vorfuhren, sah er zu mir herüber. »Geht’s dir gut, Liebes?« Er tätschelte mir das Bein.
Ich nickte. »Hervorragend, und dir?«
»Du siehst aus … ich weiß nicht, du siehst aus, als hättest du heute Abend eigentlich keine Lust auszugehen.«
Ich zwang mich zu dem schönsten Lächeln, das ich trotz des Bebens in meiner Brust hervorbringen konnte. »Doch, ich möchte gerne mitfeiern.«
»Ich weiß, dass du Alexis nicht magst … Aber kannst du es nicht einfach … versuchen? Sie ist jetzt nun mal da.«
»Wenn Harland Cate gegen eine neue Frau eintauscht, heißt das noch lange nicht, dass diese Neue meine beste Freundin ersetzen kann.« Und plötzlich flüsterte es in mir: Vielleicht möchtest du mich ja auch gegen eine neue Frau eintauschen? Ich schloss die Augen und verdrängte diesen Gedanken.
»Gut, also …«
»Tut mir leid«, sagte ich, nicht sicher, wofür ich mich entschuldigte. »Ich bin einfach etwas erschöpft.«
»So ein Gespräch mit deiner Mutter würde mich auch fix und fertig machen.«