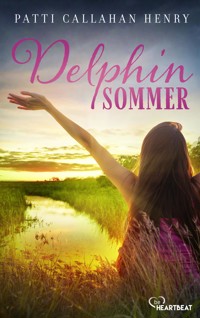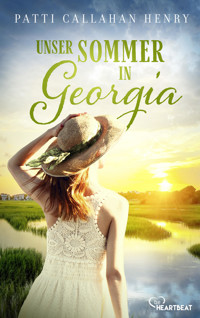4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die bewegendsten Romane von Patti Callahan Henry
- Sprache: Deutsch
Kara Larsons ist jung und verliebt. Sie hält ihr Glück für vollkommen - bis sie Maeve kennenlernt. Die alte Dame erzählt so eindringlich von ihrer ersten Liebe in Irland, dass Kara immer stärker in diese Geschichte voller Magie hineingezogen wird. Sie kann nicht umhin, ebenfalls an ihre erste Liebe zurückzudenken. Und während ihre Erinnerungen an unbeschwerte Sommer mit Jack, aber auch an dramatische Ereignisse übermächtig werden, erkennt Kara, dass sie ihre eigene Geschichte überdenken und ihrer inneren Stimme vertrauen muss ...
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Zitate
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Danksagung
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Kara Larsons ist jung und verliebt. Sie hält ihr Glück für vollkommen – bis sie Maeve kennenlernt. Die alte Dame erzählt so eindringlich von ihrer ersten Liebe in Irland, dass Kara immer stärker in diese Geschichte voller Magie hineingezogen wird. Sie kann nicht umhin, ebenfalls an ihre erste Liebe zurückzudenken. Und während ihre Erinnerungen an unbeschwerte Sommer mit Jack, aber auch an dramatische Ereignisse übermächtig werden, erkennt Kara, dass sie ihre eigene Geschichte überdenken und ihrer inneren Stimme vertrauen muss …
PATTI CALLAHAN HENRY
Frühlingslicht
Aus dem amerikanischen Englischvon Sabine Schulte
Ich widme dieses Buch meiner lieben Meagan.
An dich habe ich beim Schreiben dieses Romans gedacht,bei jeder Seite, und ich bete darum, dass du stetsGottes leises Flüstern in deinem Herzen hören mögest.
Möge Stille in deinen Gedanken sein undSchweigen auf deiner Zunge!Denn ich erzähle dir eine Geschichte,die im Anfang erzählt wurde …die einzige Geschichte, die das Erzählen lohnt.
Traditionelle Begrüßung irischer Geschichtenerzähler
Jedes Wort, das ich sage,Und jedes Wort, das ich schreibe,Muss rastlos die Schwingen rühren,Dass es auf seinem Flug nirgends bleibe …
William Butler Yeats
Eins
Ich war von Wasser umgeben, ebenso, wie ich von Erinnerungen umgeben war. Hier, im Lowcountry in South Carolina, war ich geboren und aufgewachsen, erst bei beiden Eltern, dann nur noch in der Obhut meines Vaters. Meine Heimatstadt, Palmetto Pointe, war vom Fluss, von seinem Mündungsgebiet, von den sumpfigen Salzwiesen und vom Meer umschlossen.
An einem schimmernden Morgen Anfang März stand ich auf dem Anlegesteg und blickte über den Fluss, der noch in Frühnebel gehüllt war. Die kleinen Erhebungen und das Schlickgras verschwammen in der silbergrauen Morgendämmerung. In den ersten Sonnenstrahlen glühten die Haufen der Austernschalen wie mit Perlmutt überzogene, gezackte Erdklumpen, die den Lauf des Flusses nachzeichneten. Ich war früher als sonst zu meinem Morgenlauf aufgebrochen, denn zu Hause hatte ich wieder einmal durch die Wand gehört, dass meine ältere Schwester weinte, und ihr Schluchzen und meine kreisenden Gedanken hatten den Schlaf endgültig vertrieben.
Seit meinem neunten Lebensjahr, seit Mamas Tod, hatte ich durch meine Zimmerwand Deirdres Weinen hören können. Meiner Schwester war das vermutlich nie bewusst gewesen, und auch nun, als erwachsene Frau, ahnte sie nicht, dass ich sie hörte. Sie hatte sich wieder einmal zu Daddy und mir geflüchtet, um einer weiteren einsamen Nacht in ihrem Häuschen zu entgehen, einer Nacht ohne ihren Mann Bill, von dem sie sich getrennt hatte. Wir, die Familie Larson, hatten gelernt, Gefühlsausbrüche zu verbergen – im Gegensatz zu den Ahnenporträts oder unserer Sammlung von Lismore-Kristallgläsern waren sie nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Nein, unsere Gefühle verbargen wir so gut wie damals im Sezessionskrieg das Familiensilber.
Ich streckte die Arme über den Kopf und bückte mich, um meine Kniesehnen zu dehnen und mich so auf meinen üblichen Drei-Meilen-Lauf vorzubereiten. Ein Schwarm Menhaden-Heringe schwirrte unter der Wasseroberfläche wie Schmetterlinge unter einem Seidentuch. Noch war Niedrigwasser, doch die Flut strömte schon wieder vom Ozean herein, und bald würde das Wasser die Schlickbänke bedecken und den Krebsen Schutz gewähren, die im Morgenlicht umherhuschten.
Ich hatte festgestellt, dass es in meinem Gedächtnis Erscheinungen gab, die mit Ebbe und Flut vergleichbar waren, allerdings waren sie nicht annähernd so verlässlich wie die Gezeiten des Meeres. An manchen Tagen wurde ich von Erinnerungen geradezu überschwemmt, während mein Kopf zu anderen Zeiten so trocken blieb wie der Sand in den Dünen. An diesem Märzmorgen tauchte ein ganz bestimmter Tag wieder in meinem Bewusstsein auf wie ein Stück Treibgut, das nach einem Sturm von den Wellen an den Strand geworfen wird. Während hinter einer tief hängenden Wolke die Sonne hervorbrach, öffnete mein Herz sich für eine alte Erinnerung.
Ich war dreizehn.
Fast vier Jahre war es her, dass meine Mama – unsere engelhafte Margarite Larson – gestorben war. Sie hatte ihre Krebsbehandlung abgebrochen und uns verlassen. Der Tod war Mama lieber gewesen als ihre Familie.
Also war ich von zu Hause ausgerissen. Ich hatte mein lila Köfferchen gepackt und war über den Rasen zum Nachbarhaus gewandert, zu den Sullivans. Auf der vorderen Veranda hatte ich mein Gepäck abgestellt und mit aller Selbstsicherheit, die eine Dreizehnjährige aufbringen kann, wenn ihr an einem sengend heißen Augustnachmittag der Schweiß von der Stirn tropft, an die Tür geklopft. Mrs Sullivan öffnete. »Hallo, Fräulein Kara. Wie geht’s an diesem Sommertag?« Ihr Lächeln ließ die Veranda erstrahlen.
Ich klopfte auf meinen Koffer und reckte das Kinn. »Ihr seid meine neue Familie«, verkündete ich mit einem bekräftigenden Nicken.
Mrs Sullivan nahm mich in die Arme, drückte mich fest an sich und protestierte nicht, sodass ich meine Erklärung selbst glaubte. Der beißende Geruch von Terpentin stieg mir in die Nase und verriet mir, dass sie wieder an ihren Ölgemälden gearbeitet hatte. Sie führte mich wortlos ins Haus, versorgte ihre Pinsel und machte mir ein überbackenes Käsesandwich, das vor Butter nur so triefte. Dann bürstete sie mir das Haar und sang mir ein Lied vor – Bridge over Troubled Water.
»Und jetzt erzähl mir mal, Schätzchen, warum du aus deinem schönen Zuhause weglaufen willst.«
Ich schüttelte den Kopf. »Es ist einfach so schrecklich. Daddy hat sich total verändert. Er macht jetzt immer so ein ernstes, strenges Gesicht.« Ich zog eine Grimasse. »So.«
Mrs Sullivan lachte und kniff mir leicht in die Wange.
»Er redet nur noch ganz leise und monoton. Er rennt nicht mehr mit mir durch den Regen, und ich darf auch keine Extraportion Schokostreusel mehr auf mein Eis haben. Ich darf im Haus nicht in Schuhen rumlaufen und erst recht keinen Sand mit reinbringen, nicht mal einen Seestern für meine Kommode – er sagt, Seesterne stinken. Ich habe immer gedacht, mein richtiger Daddy würde irgendwann wieder zum Vorschein kommen und in Wirklichkeit wäre er gar nicht so schlecht gelaunt und so brummig, wie alle Leute sagen – aber nun warte ich schon seit vier Jahren auf meinen alten Daddy, und er kommt und kommt nicht wieder. Also bin ich jetzt hier.«
Die Fliegengittertür zur Küche schlug zu, und Mrs Sullivans Sohn Jack stürmte herein. Sand spritzte von seinen Schuhen, die er ganz selbstverständlich anbehielt. »Was machst du denn hier?«, rief er und schleuderte seine Baseballkappe auf den Küchentisch. Ich war baff, weil niemand ihn anschrie, er solle seine Mütze an ihren Platz hängen.
»Ich bin weggelaufen«, erklärte ich und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch.
»Ach ja?« Jack sah seine Mutter an und pustete eine große Kaugummiblase auf. »Da hast du bestimmt ein paar Tage gebraucht, um so weit zu laufen.«
Mrs Sullivans Lachen erschien mir wie ein Verrat. Am liebsten hätte ich Jack Sullivan mit seinem schmutzigen Gesicht und seinen Kaugummilippen eine schlagfertige Antwort gegeben, aber in meiner Kehle saßen Tränen, sie stiegen mir in die Nase hoch und dann in die Augen, sodass ich mich wegdrehen musste. Ich kannte Jack schon mein Leben lang. Unsere Geburtstage lagen nur drei Tage auseinander, und bisher hatte er mich noch nie zum Weinen gebracht – außer das eine Mal, als er mich in den Fluss geschubst hatte und ich mir an der Austernbank die Ferse aufgeschlitzt hatte.
Er hob die Hände. »Ich hab doch nur Spaß gemacht, Kara. Es war nur ein Scherz. Du bist doch nicht richtig ausgerissen, oder?«
Ich nickte. »Doch. Meine Mama ist nicht mehr da, und jetzt ist Daddy auch weg.«
Jack ließ den Baseballhandschuh von der linken Hand fallen – dieser Handschuh war so sehr Teil von ihm, dass ich ihn gar nicht bemerkt hatte. »Was, dein Daddy …?«
»Nein, sie meint einfach, dass er sich verändert hat«, mischte Mrs Sullivan sich ein.
»Wenigstens ist er noch bei euch«, stellte Jack leise fest.
Ich sah Mrs Sullivan an. Ein Schmerz huschte über ihr Gesicht, flüchtig wie eine Sternschnuppe, sodass ich nicht sicher war, ob ich ihn tatsächlich wahrgenommen hatte. Mit einem Schaudern dachte ich an ihren Mann, der kam und ging, so wie sein Alkoholpegel es gerade zuließ.
»Auch wenn er bei uns ist, Jack Sullivan«, entgegnete ich, »ist er doch ein ganz anderer Mensch geworden. Mein richtiger Daddy ist verschwunden.« Ich richtete mich auf dem Stuhl auf.
Jack setzte sich zu uns an den Tisch, biss einen Happen von meinem Sandwich ab und boxte mir dann leicht in die Schulter. »Willst du mir helfen, am Strand ein Schneckengehäuse für mein Sommerprojekt zu suchen? Ich soll aus Dingen, die ich in der Natur finde, ein Musikinstrument bauen.«
Ich sprang auf. »Na klar. Wann sollen wir zum Abendbrot zurück sein?«, wandte ich mich an Mrs Sullivan. Bei mir zu Hause war Pünktlichkeit ein Götze, dem man unter allen Umständen Respekt zollen musste, daher ging ich davon aus, dass es hier genauso war.
Mrs Sullivan stand ebenfalls auf und schloss mich noch einmal in die Arme. »Schätzchen, wenn es dunkel wird, musst du wieder drüben sein.«
»Nein.« Ich schrie nicht, regte mich nicht einmal auf, sondern stellte einfach eine Tatsache fest.
Mrs Sullivan schüttelte den Kopf. »Doch. In dieser Familie ist das Chaos schon groß genug, da wollen wir nicht auch noch Kindesentführung als Anklagepunkt auf der Liste haben.«
»Dann suche ich mir eben ein anderes Zuhause.«
»Nein, das tust du nicht.« Sie zog mich noch enger an sich. »Weil du nämlich jederzeit herkommen kannst und weil es mit deinem Daddy aus und vorbei wäre, wenn er noch einen Menschen verlieren würde, den er liebhat.«
Damit hatte Mrs. Sullivan natürlich recht. Plötzlich überfiel mich mein schlechtes Gewissen. Es fühlte sich an wie damals, als eine Welle mich umgeworfen hatte. Ich hatte mir vor Schreck auf die Zunge gebissen und dann so viel Meerwasser geschluckt, wie ich nie für möglich gehalten hätte.
Ich folgte Jack nach draußen in das Zwielicht des Sommerabends. Es war die Tageszeit, zu der ich mich oft fragte, was mit dem Tag geschehen war, wo er geblieben war. Hatte ich das Sonnenlicht verbraucht, den Tag in mich aufgesogen, wie man es im Sommer tun soll? Hatte ich alles … richtig gemacht?
Rasch hüpfte ich hinter Jack her. Als ich ihn eingeholt hatte, blieb er stehen und sah mich nachdenklich an.
»Was ist denn?« Ich blinzelte in die untergehende Sonne, in das Rosa und Lilablau der Wolken, um seinen Gesichtsausdruck zu erkennen.
»Willst du wirklich ausreißen?«, fragte er.
»Ja.« Ich war mir so sicher wie nie zuvor.
Jack strich über die Spitzen meiner dunklen, gewellten Haare. Das hatte er noch nie getan – mich so sanft berührt, als wäre ich eine zerbrechliche Muschel, die in seiner Hand in Stücke springen könnte. Er wickelte sich eine Locke um den Finger, und ich spürte seine Berührung durch die Kopfhaut hindurch bis in den Schädel hinein – ein Prickeln, das ich bisher nicht gekannt hatte, wie elektrischer Strom, aber es ging tiefer und kam nicht so schlagartig.
Dann ließ er meine Haarsträhne los und schaute mich an. »Ausgerechnet du – warum solltest du weglaufen? Du hast die beste Familie, die ich je erlebt habe.«
»Weil es nicht mehr so ist wie früher, überhaupt nicht mehr. Mama ist tot, und Daddy ist so abwesend. Deirdre ist nur noch sauer, und Brian ist so sehr mit seinen Freunden beschäftigt, der beachtet mich gar nicht mehr. Also ist es Zeit, dass ich abhaue.«
Ich dachte, Jack würde lachen, aber er blieb ernst. Er blickte starr geradeaus, blickte mich an, ohne mich wahrzunehmen, als würde er durch mich hindurchsehen. »Dass eine Familie sich verändert, heißt noch lange nicht, dass man einfach abhauen kann. Ich wünschte auch, mein Dad würde sich wieder ändern …«
Und in diesem Moment, nachdem er mein Haar in der Hand gehalten hatte, während er von seinem Dad sprach, mit einer Tiefe in seinen braunen Augen, wie ich sie noch nie gesehen hatte, merkte ich, dass ich mich nach seiner Berührung sehnte. Nicht danach, wie er mich anfasste, wenn wir im Meer Ringkämpfe veranstalteten oder wenn er mich vom Steg in den Fluss schubste, sondern nach einer anderen Art, die ich mit meinen dreizehn Jahren noch nicht zu beschreiben vermochte. Nach einer Art von Berührung, die ich noch nicht zu erbitten verstand. Und selbst geben konnte ich sie auch nicht – aber ich versuchte es.
Ich streckte die Hand aus. Unschlüssig schwebte meine Rechte in der Luft, bis mir klar war, was ich mit ihr tun sollte. Ich berührte Jacks Wange. Meine Handfläche lag auf seiner Haut, mein Daumen strich über seine Oberlippe und blieb dort liegen. Jack stand still, regloser als die schneeweißen Reiher im Sumpfland, die wie Statuen aussahen. Schließlich hob auch er seine Rechte und legte sie auf meine Hand. Mein Magen hob sich wie in einem durchsackenden Flugzeug, vor lauter Angst, dass er meine Hand wegschieben würde.
Aber das tat er nicht. Er schloss die Augen und ließ unsere Hände dort liegen – zusammen. Als er die Augen wieder öffnete, beugte er sich zu mir und legte die Stirn an meine. Unsere Nasen, dann unsere Lippen berührten sich. Es war mein erster Kuss, sanfter und weicher, als ich es erwartet hatte, nachdem ich auf unseren Schulfesten das Flaschendrehen beobachtet hatte. Er dauerte nur einen Augenblick, den Bruchteil einer Sekunde, der sich aber, wenn ich es erlaubte, beliebig oft wiederholen konnte wie die Wellen, die eine nach der anderen heranbrandeten, auch wenn man nicht hinguckte.
Keiner von uns sagte ein Wort; ich machte einen Schritt rückwärts, und wir schauten uns an, als hätten wir uns gerade erst kennengelernt, als hätten wir etwas so Neues, Sonderbares entdeckt, dass wir nicht wussten, wie wir es nennen sollten.
Gemeinsam drehten wir uns um und gingen auf die Dünen zu, über den Bohlensteg, der das Stachelgras bedeckte, das sich sonst in die bloßen Füße gebohrt hätte und schlimmer stach als eine Biene. Am Strand setzten wir uns in den Sand und schauten zu, wie die Sonne in Hunderten von Farbtönen und Lichtmustern hinter dem Horizont verschwand.
Als ich mich auf den Rücken legte, rutschte Jack neben mich, und wie zahllose Male zuvor breiteten wir Arme und Beine aus und malten damit große Engel in den Sand. Diesmal allerdings erlaubten wir unseren Fingerspitzen, einander zu streifen. Dann blieben wir schweigend liegen. Wir wussten beide, welches Spiel jetzt an der Reihe war: Wer den ersten Stern am dunkelnden Himmel sah, war Sieger. Ich konzentrierte mich auf den Himmel, wollte unbedingt den Stern entdecken, wollte mir dabei etwas wünschen. Da leuchtete über mir ein kleiner Funke auf – er erschien genauso wie sonst, als wäre er immer schon da gewesen, als hätte ich nur nicht genügend aufgepasst. Normalerweise brüllte ich, wenn ich dieses Spiel gewann, aber dieses Mal flüsterte ich nur: »Da ist er.«
Jack fasste meinen Ellbogen. »Ich sehe ihn.«
»Hast du ihn zuerst gesehen?«, wisperte ich zurück.
»Nee. Du hast gewonnen. Komm, wir gehen besser zum Abendessen, sonst kriegen wir bestimmt Hausarrest.«
Und ich wusste, dass er mich zum ersten Mal hatte gewinnen lassen, und das gab mir, mehr noch als der Kuss oder seine streichelnden Fingerspitzen, die Gewissheit, dass er mich liebte. Ja, es war ganz sicher, er liebte mich. Und ich liebte ihn.
Ich stand auf. Jack nahm meine Hand, und ich fand, dass sie perfekt zu seiner passte, wie dafür gemacht, eigens dafür angefertigt wie Daddys Anzüge von der Schneiderin in der Magnolia Street. Fragend sah Jack mich an. Ich lächelte ihm zu und spürte dabei eine ungewohnte Wärme und Weite in der Brust. Vielleicht konnte dieses Gefühl ja die schmerzhafte Leere ein wenig verdrängen, die Mama hinterlassen hatte.
Zum ersten Mal empfand ich eine Zuneigung, die über das Liebhaben in der Familie hinausging. Ich spürte, wie mein Herz sich weitete, als habe es dreizehn Jahre lang geschlummert und erwache nun.
Noch Wochen und Monate später sann ich darüber nach, warum sich die Gefühle zwischen mir und diesem Jungen plötzlich so verändert hatten. Ich kannte den Nachbarsjungen doch, solange ich denken konnte. Hatte ich ihn schon immer geliebt, oder vermisste ich einfach nur meine Mama und wollte seine haben?
Selbst heute, mit siebenundzwanzig Jahren, konnte ich diese Frage noch nicht beantworten, aber glücklicherweise spielte das keine Rolle mehr. Jack war fort, und das schon sehr lange. Ich wusste mittlerweile, was wahre Liebe war, dauerhafte Liebe – nicht bloß jugendlicher Sturm und Drang, nicht die Art von Liebe, die mich verlassen würde, wie Mama und Jack es getan hatten. Inzwischen fühlte ich mich wohl in meiner Welt, einer Welt, aus der ich nicht mehr auszureißen brauchte.
Zwei
Zwei Monate vor meiner Hochzeit lernte ich Maeve Mahoney kennen. Das süße Versprechen von warmen Frühlingstagen und duftenden Abenden folgte mir durch die Eingangstür ins Foyer des Verandah House, das als Pflegeheim für gehobene Ansprüche galt. Meine hohen Absätze klapperten auf dem Linoleumboden, und mein Hosenanzug und die weiße Bluse saßen perfekt. Ich schaute auf meine Armbanduhr: pünktlich auf die Minute. Dieser Begegnung mit Mrs Mahoney hatte ich etwas ängstlich entgegengesehen – ich sollte versuchen, mich mit einer sechsundneunzigjährigen Greisin zu unterhalten, die mir von der Junior Society in Palmetto Pointe für meine ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde zugewiesen worden war.
Die Liste der Dinge, die ich heute zu erledigen hatte, füllte zwei Seiten meines Terminkalenders. Ich hatte kaum Zeit zum Essen und schon gar nicht die Zeit, eine Stunde in einem Pflegeheim herumzusitzen. Ich steckte mitten in der arbeitsintensivsten Phase meines Lebens – die zugleich die befriedigendste Phase war. Im Geist ging ich mein Programm durch: Gleich nach diesem Termin musste ich ganz schnell zur Anprobe für mein Hochzeitskleid.
Ich schob die Tür von Zimmer 7 auf. Eine winzige Frau mit weißem Haar saß aufrecht in einem Sessel, der mit kariertem Schottenstoff bezogen war. Im Schoß hielt sie einen Roman – Finnegans Wake. Ihre Augen waren geschlossen, aber ihr Mund stand offen. Sie hatte den Kopf zurückgelegt, und ihre Frisur wirkte wie ein Wattebausch.
Auf ihrer Frisierkommode und ihrem Nachttisch waren Fotos in angelaufenen Silberrahmen aufgereiht; verblichene Gesichter starrten mich hinter verstaubtem Glas an. Im ganzen Zimmer waren Häkeldeckchen verteilt, und über dem Kopfteil ihres Bettes hing ein hölzernes Kruzifix, das mit einem Rosenkranz aus abgegriffenen Holzperlen geschmückt war. Ein Ölgemälde, das eine Bucht voller Segelboote im Abendlicht darstellte, hing schief an der Wand. Ich trat an das Bild und strich über den gesplitterten Holzrahmen. Trotz der strohgedeckten Häuser, die im Hintergrund eben noch zu erkennen waren, und dem rauen Seegang in der unbekannten Bucht hatte die Szene etwas Vertrautes.
Im Zimmer roch es genauso wie überall im Gebäude: nach Hautcreme, Rührei, Teppichdeodorant – eine eigenartige Mischung. Das Personal von Verandah House tat sein Bestes, damit man sich hier eher wie in einem netten Hotel als wie in einem Pflegeheim fühlte. Im Foyer befanden sich ein Eiscafé mit rot-weiß gestreifter Markise, ein Kino und ein schicker Friseursalon, die den Besuchern den Eindruck von einer Miniatur-Heimatstadt vermitteln sollten.
Ich setzte mich neben Maeve Mahoney auf den zweiten Stuhl – einen unbequemen Metallstuhl mit einem rosa geblümten Kissen. Ganz leise, um sie nicht zu stören, zog ich die Hochzeitsunterlagen aus meiner Aktenmappe und durchstöberte die Zeitschrift Southern Bride nach Ideen für meinen Hochzeitsstrauß. Schließlich fand ich genau das, was ich suchte: weiße und rosa Pfingstrosen mit Swarovski-Kristallen, die an dünnen Silberstäbchen aus den Blumen herausragten und wie Regentropfen wirkten. Der Strauß war mit einer Satinschleife zusammengebunden. Ich griff nach meiner Hochzeitsmappe mit dem Register, blätterte die Seiten in den Klarsichthüllen um, bis ich zu »Blumen« kam, und stopfte das Foto hinein. Die Einzelheiten schrieb ich auf einen großen linierten Notizblock.
Während ich so an meiner Hochzeit arbeitete, vergingen vierzig Minuten. Maeve Mahoney schlief weiter und gab dabei leise Schnarchlaute von sich. Doch dann hörte ich eine brüchige Stimme: »Ist das eine Hochzeitszeitschrift, in der du da blätterst?« Ihre Worte hatten einen leichten irischen Akzent.
Erschrocken sah ich die alte Dame an. »Ja. Guten Tag, ich bin Kara Larson. Ich bin hier, um ein bisschen bei Ihnen zu sitzen … vielleicht kann ich Ihnen etwas vorlesen oder was Sie sonst gern möchten.« Ich sprach die Worte nach, die die Koordinatorin der ehrenamtlichen Helferinnen mir empfohlen hatte.
Mit ihren runzligen Händen streichelte Maeve die Sessellehnen. Sie blinzelte mich an und deutete auf die Zeitschrift. »Du willst heiraten?«
»Ja. In etwa acht Wochen.«
»Deine erste Liebe?« Sie strich sich eine graue Locke aus dem Gesicht. Ihre Augen waren grün wie Glas, das jahrelang im Meer getrieben ist und klar und glatt geschliffen wurde.
Ich lachte. »Nein, aber ich liebe ihn sehr.«
Maeves Augen füllten sich mit Tränen, die über dem Grün glitzerten. »Heutzutage heiratet kein Mensch mehr seine erste Liebe. Es gibt einfach … zu viel anderes. Zu viele Möglichkeiten. Immer nach dem Nächsten gucken, ob es noch besser ist, dabei ist das Erste normalerweise auch das Beste.« Ihr irischer Akzent ließ die schlichten Worte wie ein Gedicht klingen.
Ich holte tief Luft – worüber sollten wir jetzt reden? »Haben Sie Ihre erste Liebe geheiratet?«, fragte ich.
»Also, das ist eine lange Geschichte, mein Kind. Eine schöne Geschichte, über Liebe und Verrat, voller Wahrheit.«
»Erzählen Sie.« Verstohlen warf ich einen Blick auf die Uhr.
»Aber zuerst bist du dran. Wer war deine erste Liebe?«
Ich spürte einen Stich in der Brust. War das Verrat? An meine erste Liebe sollte ich jetzt nicht einmal denken, nicht mit dem vierkarätigen Diamanten mit Prinzessschliff am Finger, den Peyton, mein Verlobter, mir geschenkt hatte.
»Peyton – das ist der Mann, den ich heirate.« Warum ließ ich mich auf diese Diskussion ein, mit einer alten Frau, der noch Haferflocken vom Frühstück am Kinn klebten?
»Nein … denk mal zurück. Davor. Noch vor dem ersten Kuss. Bevor du zum ersten Mal ›Ich liebe dich‹ gesagt hast. Noch weiter zurück.«
»Wie bitte?« Ja, die Alte war wirklich verrückt. »Wohin zurück?«, fragte ich, während ich nach einer passenden Antwort suchte.
»Zurück an den ersten jungen Mann, bei dem du Schmetterlinge im Bauch gespürt hast. An den ersten Jungen, über den du etwas in dein Tagebuch geschrieben hast. Den du geliebt hast, wirklich geliebt. Ich meine nicht den ersten Mann, mit dem du geschlafen hast, sondern den ersten, von dem du geträumt hast.«
»Mit dem ich geschlafen habe? Aber Mrs Mahoney!« Ich hob die Hand an den Mund. Worauf wollte sie bloß hinaus?
»Nein, noch davor.«
Langsam schloss ich die Augen. Ich brauchte gar nicht sehr weit zurückzugehen – er war in meinem Gedächtnis etwas wie ein Grundstein, auf dem alle anderen Erinnerungen aufgebaut waren. Meine Zunge formte seinen Namen, als hätte ich ihn gestern noch ausgesprochen. »Jack Sullivan.«
»Ja, der. So weit zurück. Was ist aus ihm geworden?« Mit einer raschen Bewegung beugte Maeve sich vor.
Verwundert sah ich die sonderbare alte Irin an. »Ich habe ihn mit vierzehn zuletzt gesehen.«
Da rann ihr eine Träne die Wange hinunter bis zu der Haferflocke an ihrem Kinn. Ich schnappte mir ein Kleenex vom Nachttisch und wischte ihr beides vom Gesicht. Langsam, wie eine Welle, überrollte mich ein Gefühl von etwas Schmerzhaftem, schon lange Verlorenem. Wenn ich es hätte beschreiben sollen, hätte ich es als Hoffnungslosigkeit bezeichnet.
»Warum nicht?«, sagte oder vielmehr sang Maeve Mahoney.
»Wie bitte?« Ich warf das Kleenex in den Papierkorb.
»Warum hast du ihn nicht wiedergesehen?«
Ich zuckte die Achseln. Über Jack Sullivan wollte ich nicht sprechen.
Mrs Mahoney holte tief Luft. »Er hat gegenüber gewohnt. Sein Vater und sein Bruder waren an den ›Unruhen‹ beteiligt, und das hat meiner Mutter nicht gepasst. Bevor er verschwand, hat er mir gesagt, dass er mich liebte und dass er wiederkommen würde, um mich zu holen. Und ich wusste, dass er Wort halten würde.«
»Und hat er es getan?« Wieder sah ich auf die Uhr – noch eine Minute, dann musste ich los, um meine Verabredung mit der Schneiderin in der Stadt einzuhalten.
Mrs Mahoney seufzte, nahm das Buch auf und legte es wieder in ihren Schoß. »Was soll er getan haben?«, fragte sie.
»Ist er wiedergekommen, um Sie zu holen?«
»Wer denn?«
»Der Junge von gegenüber.« Ich unterdrückte ein Stöhnen.
»Du musst ihn finden.« Mrs Mahoney hob beide Hände, wie zu einem flehentlichen Gebet.
»Wen?«
»Den Jungen von gegenüber.«
»Mrs Mahoney, ich kenne den Jungen von gegenüber nicht.«
»Doch nicht meinen Jungen – deinen!« Sie verdrehte die Augen, als sei ich gerade im Begriff, sie zur Verzweiflung zu treiben – nicht umgekehrt.
»Er hat nebenan gewohnt, nicht gegenüber«, erklärte ich. Offenbar war die Verwirrung nun vollständig. »Ich muss jetzt los, Mrs Mahoney. Bis morgen.«
»Ja, ja«, meinte sie. »Du denkst über das nach, was ich gerade gesagt habe, oder? Ich will nicht die Einzige sein, die hier Geschichten erzählt. Wir tauschen Geschichten aus, du und ich. Weißt du, wenn man anfängt, über Dinge nachzudenken, darüber zu sprechen, dann … passieren sie.«
»Ach ja?« Ich erhob mich.
»Weißt du, mein Kind, alles hat seinen Grund. Du bist mir geschickt worden, davon bin ich überzeugt. Ja, das glaube ich wirklich. Du siehst ganz ähnlich aus wie ich, als ich jung war – dunkle Locken, grüne Augen, die Hochzeit mit dem richtigen Mann. Gib acht, was du glaubst – denn das bist du.«
»Wie meinen Sie das?« Ich hob meine Tasche auf und sah auf die alte Dame hinunter.
»Du wirst mir helfen, das weiß ich.«
»Na ja … ich besuche Sie wieder, das verspreche ich Ihnen. Wie sehr ich Ihnen helfen kann, weiß ich allerdings nicht.«
»Oh, kommt Zeit, kommt Rat. Ganz bestimmt. Wir werden das rauskriegen, während ich dir die Geschichte erzähle. Heutzutage muss es eine Möglichkeit geben, ihn zu finden.«
Weil mir nichts anderes einfiel, nickte ich bloß. Ich hatte keinen blassen Schimmer, wen ich da finden sollte. Maeve hob die Rechte, als erteile sie mir einen Segen. »An áit a bhfuil do chroí is ann a thabharfas do chosa thú.«
Kauderwelsch, da war ich mir sicher. Also nickte ich wieder nur und lächelte sie an.
»Das heißt: Deine Füße tragen dich dorthin, wo dein Herz ist.« Die Augen fielen ihr zu.
Ein bedrückendes Gefühl der Unzulänglichkeit überkam mich. Ich hatte keine Ahnung, welche Sprache Mrs Mahoney da gesprochen hatte, aber meine war es nicht.
Ich verließ Verandah House und rannte zu meinem Wagen – zu dem Mercedes, den Daddy mir geschenkt hatte, nachdem er sich den neuen Ford F-150 zugelegt hatte. Mein Vater war nämlich zu dem Schluss gekommen, dass ein Pick-up genau das richtige Auto für ihn war. Was absolut nicht stimmte – eigentlich war der Mercedes genau sein Stil. Aber welche Siebenundzwanzigjährige, die halbwegs bei Sinnen ist, würde ihrem Vater sagen, dass sie keinen Mercedes will und dass er sich lächerlich macht, wenn er Tag für Tag mit einem Pick-up mit Allradantrieb in seine Kanzlei tuckert?
Ich fuhr nach Palmetto Pointe hinein zur Schneiderin und dachte unterwegs an Peyton Ellers – den Mann, den ich heiraten würde. Und ich lächelte.
Früher hatte ich Liebe für ein flüchtiges Gefühl gehalten – etwas, das kam und ging, das mal verschwand und mal blieb, gerade so, wie die launische Meeresbrise es ihm einflüsterte. Die Liebe, die bleibt, die in den Winkeln des Herzens haftet, ist nichts weiter als bloße Sehnsucht oder Erinnerung. Davon war ich überzeugt, denn das wusste ich aus eigener Erfahrung.
Ich hatte Mama lieb, aber sie war fort. Früher hatte ich Jack Sullivan geliebt, aber auch er war nicht mehr da. Ich hatte Daddy lieb, aber er hatte sich vollkommen verändert, sodass ich manchmal dachte, ich hätte ihn nur für das lieb, was ich von ihm wusste, was ich aus der Zeit vor Mamas Tod noch in Erinnerung hatte. Ich beobachtete Paare, die sich ihre Liebe gestanden, und oft, sehr oft fragte ich mich, ob die Partner einander in dem Moment, in dem sie es sagten, wirklich liebten oder ob sie ihre Liebe nur früher einmal empfunden und erlebt hatten und sich seitdem einredeten, sie währe ewig.
Allmählich war mir klargeworden, dass ich nie stark genug lieben würde, um heiraten und sagen zu können: »Ja, lass uns den Rest des Lebens zusammen verbringen.« Ich hatte ein paar Männer gern gemocht, hatte mir sogar das Wort »Liebe« abgerungen. Aber für eine dauerhafte Bindung hatte es nie gereicht. Stundenlang hatte ich, so wie Frauen es oft tun, mein Versagen mit meiner besten Freundin Charlotte besprochen. »Warum kann ich nicht richtig lieben? Nicht stark genug?«
Im Laufe der Jahre hatte Charlotte viele Theorien entwickelt, die erklären sollten, warum ich bisher keinem Mann verfallen war. Auf dem College hatte sie geglaubt, ich vermisse meine Mama so sehr, dass ich niemanden an mich heranlassen könne. Später war sie der Überzeugung gewesen – das war auf unserem Abschlussfest, als ich zu viel Rotwein getrunken hatte –, dass ich auf jemanden wartete, der ganz genau das gleiche Gefühl in mir auslösen würde wie Jack Sullivan damals. Aber als wir dann frisch im Berufsleben standen und wieder in unsere Heimatstadt gezogen waren, hegte sie die Vermutung, ich hätte einfach noch nicht den Richtigen gefunden.
Nachdem ich fünf Jahre lang als Managerin für die PGA TOUR gearbeitet hatte, lernte ich Peyton kennen. Normalerweise hatte ich mit den Berufsgolfern und ihren Familien nicht viel Kontakt – ich arbeitete hinter den Kulissen, wo ich das ganze Drumherum für die Golfturniere organisierte. Mein Job war zwar wahnsinnig anstrengend, aber er gab mir das Gefühl, tatsächlich etwas zu leisten. Ich machte wirklich alles, suchte die Uniformen für die ehrenamtlichen Helfer aus, stellte die Speisekarten für das angelieferte Essen zusammen und sorgte für die Betreuung der Kinder der Spieler. Ich organisierte die Preisverleihung und das Pro-Am-Turnier am Tag vor dem Major und kümmerte mich um tausend weitere Kleinigkeiten im Zusammenhang mit den Turnieren.
Meine zahlreichen Verpflichtungen – der Haushalt, mein Daddy und mein Job – sorgten dafür, dass ich ständig beschäftigt war. Nicht, dass Daddy eine Krankheit oder eine Behinderung gehabt hätte. Nein, aber als ich größer wurde, war ich zu Hause ganz von selbst nach und nach in Mamas Rolle hineingeschlüpft. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich sie weniger vermisste, wenn ich an ihre Stelle rückte. Wenn ich direkt in ihre Fußstapfen trat – die Lebensmittel einkaufte, die Mahlzeiten zubereitete, mich um den Abwasch und die Wäsche kümmerte –, dann war sie in gewisser Weise noch anwesend. Wenn die Hausarbeit erledigt und gut gemacht wurde, schien es, als wäre sie noch im Haus.
Wir hatten zwar eine Haushaltshilfe, die putzte – noch die gleiche wie zum Zeitpunkt meiner Geburt –, aber um alles andere kümmerte ich mich selbst, und ich war bestimmt nicht auf der Suche nach einem weiteren Lebensinhalt.
Doch da lernte ich auf der zehnten Bahn des Golfplatzes von Palmetto Pointe Peyton Ellers kennen. Während einer Übungsrunde für ein lokales Golfturnier begleitete ich einen Berufsfotografen, der Fotos von Peyton machen wollte, auf den Platz. Natürlich wusste ich, wer dieser Peyton Ellers war, den kannte in Palmetto Pointe jedes Kind. Er war vor zehn Jahren als junger Berufsgolfer in die Stadt gezogen und hatte erst für das Georgia Tech Golf Team und dann für die Nationwide Tour gespielt, bis er schließlich in die PGA TOUR aufrückte. In allen Zeitungen hatte man damals seine Ankunft angekündigt, überall waren Artikel darüber zu lesen gewesen, wie dieser grandiose Golfspieler seiner Mutter ein Haus am Fluss und sich selbst eins auf dem Golfplatz gekauft hatte. Zum Entsetzen der Golfsport-Fans war er nach Palmetto Pointe in South Carolina gezogen anstatt in die Nähe eines der renommierten Plätze in Florida, wo die meisten Profi-Golfer lebten.
Mit seinen fünfunddreißig Jahren bewegte er sich auf die Spitze der Einkommensliste zu – und er war Single. Die Presse liebte ihn, die PGA TOUR liebte ihn, und die Frauen liebten ihn ebenfalls.
Daher war ein Foto von Peyton für das Cover der PGA-TOUR-Broschüre, in der unser neuer, von Pete Dye angelegter Golfplatz vorgestellt und Palmetto Pointe als neuer Ort für ein PGA-TOUR-Turnier angekündigt werden sollte, einfach ideal.
Jim, der Fotograf, und ich gingen auf das Grün hinaus und warteten darauf, dass Peyton über den Hügel kam. Der Wind fuhr mir ins Haar, wirbelte meine Locken im Kreis herum und zerzauste sie. Jim bereitete seine Kameras vor. Als er die Filme einlegte und mit dem Fluss im Hintergrund die Belichtung maß, bat er mich um Unterstützung. »Verwenden Sie einhundert ASA oder eine höhere Empfindlichkeit?«, fragte ich, während ich mir das Haar aus dem Gesicht strich.
»Beides«, meinte Jim, der gerade die Kamera einstellte. »Ich will ein paar Aufnahmen von Peyton in Bewegung und einige Porträts mit dem Flussufer im Hintergrund machen.«
»Nehmen Sie für die Bewegung die Digitalkamera oder Ihre Nikon F3? Und welchen Farbfilm nehmen Sie für Ihre Porträts?«
Er lächelte. »Wollen Sie die Aufnahmen für mich machen?«
»Ich wünschte, ich könnte das. Ich fotografiere liebend gern.«
»Das sehe ich.« Er reichte mir die Nikon und zwinkerte mir zu. »Machen Sie doch ein paar Schnappschüsse aus einem anderen Blickwinkel, während ich ihn von vorn fotografiere.«
»Im Ernst?«
»Natürlich.« Jim deutete auf die Hügelkuppe. »Da kommen sie. Mein Ziel ist, Peyton aus verschiedenen Perspektiven aufzunehmen, am liebsten auch mit dem Wasser und den Eichen im Hintergrund.«
Ich nickte. Die Luft um mich herum vibrierte. Ich packte die Nikon fester.
Peyton näherte sich, und ich betrachtete ihn durch das Objektiv. Sein wiegender Gang drückte Selbstvertrauen aus, der Mann hatte die Ausstrahlung eines erfolgreichen Sportlers und gab ein ideales Fotomotiv ab. Ich machte Schnappschüsse von ihm, wie er den Fairway entlangschlenderte, den Golfschläger lässig über die Schulter geworfen, die Mütze, unter der seine braunen Locken hervorguckten, tief in die Stirn gezogen.
Jim trat zur Seite und fing ebenfalls an, Aufnahmen zu machen.
Am Fuß des Hügels stellte Peyton sich in Position, um den Ball zu schlagen. Der Fluss hinter ihm glitzerte wie ein salbeigrünes Band. Ich lief auf die andere Seite des Grüns, kauerte mich hin und schoss Fotos, so schnell ich nur konnte.
Plötzlich räusperte sich jemand hinter mir. Ich sprang auf und drehte mich um. Jim. »Habe ich mich zu sehr hinreißen lassen?«
Er lachte. »Nein, aber Sie waren wirklich in einer anderen Welt. Wir müssen näher an die Bäume heran. Dürfen wir dorthin?« Er zeigte auf einen durch ein Seil abgesperrten Abschnitt des Fairway.
»Ja, das ist nur, um den Massenandrang morgen in Schach zu halten. Kommen Sie, folgen Sie mir!« Ich gab ihm die Kamera zurück. »Ich glaube, ich habe den ganzen Film verknipst. Tut mir leid.« Ich verzog das Gesicht.
»Peyton ist leicht zu fotografieren, was?«, meinte Jim lachend.
Ich wurde rot. »Ich glaube schon.«
Da kam er zu uns, blieb stehen und streckte mir die Hand hin. »Hi, ich bin Peyton Ellers.«
Ich ergriff seine Hand, schüttelte sie. »Hi, ich bin Kara Larson, die Managerin für das Open im nächsten Jahr. Vielen Dank, dass wir Fotos für die Broschüre von Ihnen machen dürfen.«
»Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen«, sagte Peyton. »Es ist immer schön, wenn ich mit dem Namen von Menschen, für die ich seit Monaten arbeite, auch Gesichter verbinden kann. Aber niemand hat mich darauf vorbereitet, dass Sie wie ein grünäugiger Engel aussehen.«
Ich konnte mich nicht abwenden – in seinem Blick lag etwas Warmes, Vertrautes. Ich trat einen Schritt zurück, prallte gegen einen Hartriegelbusch, der in voller Blüte stand, und stolperte dann über eine Azalee, sodass rote Blüten auf das Gras rieselten. Das war nicht gerade elegant.
Peyton lächelte. Er stellte sich Jim vor und fragte, in welcher Pose der Fotograf ihn haben wolle.
Zwei Abende später, auf der Party für die Golfer, die an dem Turnier teilgenommen hatten, und ihre Familien, trat Peyton in den Saal, die Arme voller Hartriegel- und Azaleenblüten, die er vom zehnten Grün stibitzt hatte. Er kam geradewegs auf mich zu, überreichte mir die Zweige und fragte mich, ob ich ihm die Ehre erweisen wolle, mich wenigstens noch einmal mit ihm zu treffen.
Da stand er, die dunklen Locken ringelten sich wild um seinen Kopf, er grinste über das ganze Gesicht, und ich sagte, ja, ich würde mich noch einmal treffen, aber das wäre auch alles.
»Besser als gar nichts.« Er lachte.
Natürlich wurde daraus ein ganzes Jahr von »noch einmal«, bis er sich schließlich auf ein Knie niederließ und mir den vierkarätigen Diamanten mit dem Prinzessschliff auf den linken Ringfinger schob.
Als ich ja sagte, fand in meinem Herzen eine Verwandlung statt, und ich zweifelte nicht mehr an meiner Liebesfähigkeit. Mein Herz hatte nur gewartet – auf ihn. Die leeren Jahre, in denen ich keinen Mann geliebt hatte, bedeuteten nicht, dass ich nicht liebesfähig war oder Mama zu sehr vermisste oder auf jemanden wartete, der genauso war wie Jack. Nein, ich hatte nur noch nicht den Richtigen gefunden. Es war leicht, sich zu verlieben, leicht, ein offenes Herz zu haben, sodass ich immer lächeln musste, wenn ich an Peyton, an seine Berührung oder an seine Stimme dachte.
Mir selbst war so eine Superhochzeit gar nicht wichtig, doch weil ich zu einer der alteingesessenen Familien der Stadt gehörte – wir waren direkte Nachfahren des englischen Herzogs, der die Hafenstadt Palmetto Pointe gegründet hatte – und weil Peyton Berufsgolfer war, sollte unsere Hochzeit in knapp zwei Monaten ein großes gesellschaftliches Ereignis werden.
Ich steuerte den Wagen durch Straßen, die so blitzsauber waren wie Disney World, wenn es morgens aufmacht. Palmetto Pointe konnte vermutlich mehr Häuser aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg aufweisen als jede andere Stadt in Amerika. USA-Flaggen und Fahnen von South Carolina flatterten im Wind. Die Bänke vor den Geschäften waren frisch gestrichen. Entlang der Main Street hatte man in exakt gleichen Abständen Eschen und Eichen gepflanzt. Von ihren Ästen hing Spanisches Moos herunter, wie auf einer Reklamebroschüre für das Lowcountry.
Ich nahm den Fuß vom Gas und bremste vor der roten Ampel am Schnäppchenladen. Mrs Harold winkte mir von der Bank davor zu. Nachdem sie vor fünf Jahren ihren Mann verloren hatte, war sie in eine andere Welt hineingerutscht, und niemand in der Stadt redete ihr diese Wahnvorstellungen aus. Für sie war immer noch das Jahr 1964, und sie wartete auf einen Brief von ihrem Mann in Vietnam. Lächelnd winkte ich zurück. Vielleicht würde dieses Städtchen auch mir zulächeln, falls ich eines Tages wahnsinnig wurde.
Allerdings war das eher unwahrscheinlich. Ich war Porter Graham Larsons jüngstes Kind, und an unsere Familie wurden gewisse Erwartungen gestellt.
Ich parkte vor dem Brautmodengeschäft von Palmetto Pointe. Durch die Schaufensterscheibe sah ich Gretchen drinnen auf und ab gehen. Rasch stieg ich aus dem Wagen und betrat mit meiner Aktentasche in der Hand den Laden. Wie üblich hielt ich meinen Terminplan genau ein.
Drei
Die Wände des Brautmodengeschäftes waren ganz und gar mit Spiegeln verkleidet. In der Mitte des kreisrunden Raumes stand Gretchen auf einem Podest und schaute mit den Händen auf den Hüften zu mir herunter. Mein Daddy hatte für mich eine Schneiderin engagiert, die extra aus Atlanta anreiste – er wollte das Beste für sein kleines Mädchen, hatte er gesagt. Mir fiel auf, dass ich in diesem Raum meine Figur nicht verstecken konnte. Wie dünn ich in den letzten Monaten geworden war!
Charlotte bezeichnete meine Hektik als guten Stress, aber es fühlte sich ganz bestimmt nicht gut an. Ich konnte nicht mehr schlafen, weil ich mir vorstellte, dass auf der Hochzeitstafel ein Namenskärtchen am falschen Platz stand oder dass die Kleider der Brautjungfern nach Prag statt nach Palmetto Pointe geliefert worden waren.
Ärgerlich versuchte ich, meinen Spiegelbildern zu entkommen. »Hm«, brummte Gretchen, »mein Flieger geht in zwei Stunden, wir müssen das jetzt fertigkriegen.«
Ich nickte wie ein gehorsames Kind und stapfte in die Umkleidekabine, wo auf einem gepolsterten Bügel mein Hochzeitskleid hing. Ich zog den Vorhang zu und entkleidete mich bis auf die Unterwäsche. Behutsam strich ich mit dem Finger über die mit Spitze bezogenen Knöpfe auf dem Rücken des Kleides und seufzte. Mein Brautkleid war genau so, wie ich es entworfen hatte. Plötzlich wünschte ich mir Mama her, damit sie es sehen konnte. Wenn es im Leben einer Frau einen Zeitpunkt gab, an dem sie ihre Mama herbeisehnte, dann war das die Anprobe des Hochzeitskleides.
Ich ließ das Kleid über den Kopf gleiten, schloss aber die Knopfreihe im Rücken noch nicht. Das überließ ich Gretchen.
Deine Füße tragen dich dorthin, wo dein Herz ist.
Ich verdrehte die Augen. Die arme Alte – faselte etwas von der Vergangenheit und von verlorener Liebe. Es hatte nichts mit mir zu tun – warum also machten die Worte mich traurig? Ich betrachtete mich im Spiegel. Ohne Schleier, Make-up und Blumen sah ich aus wie ein kleines Mädchen, das Verkleiden spielt. Ich raffte das Kleid in der Taille zusammen und stellte mich auf die Zehenspitzen. Etwas besser.
Peyton hatte bezüglich des Hochzeitskleides nur einen Wunsch geäußert: »Achte bitte darauf, dass es nicht wie ein Kleid für den Schulball mit Schlagsahne drauf aussieht«, hatte er gesagt. »Die Zeitschrift Golf USA wird einen Fotografen schicken.« Ich hatte ihm geantwortet, inzwischen kenne er doch bestimmt meinen guten Geschmack. Daraufhin hatte er mich geküsst und erklärt, dass ich ihn auserwählt hätte, zeuge allerdings von einem hervorragenden Geschmack.
Mein Blick fiel auf den Rock, der mit der feinsten Seide überzogen war, die es gab, so leicht und transparent wie Engelsflügel. Ich hatte gar nicht gewusst, dass man so durchsichtigen Seidenstoff kaufen konnte – aber Daddy hatte gesagt, er würde ihn bezahlen.
Ich zog das Kleid in der Taille hoch, ohne den Rock zu berühren, und schlüpfte in die weißen Pumps, die in der Umkleidekabine bereitstanden. Die Brautschuhe hatte ich noch nicht gekauft. Eine der vielen unerledigten Aufgaben, die mich abends vom Schlafengehen abhielten, war die Entscheidung, ob ich Wasserperlen auf die Schuhe genäht haben wollte oder ob ich sie schlicht lassen sollte.
Ich trat aus der Kabine und schritt zu dem Podest in der Mitte des Raumes. Gretchen baute sich vor mir auf, Stecknadeln guckten ihr aus dem Mund, und zwischen ihren Augenbrauen hatten sich zwei tiefe parallele Furchen gebildet. »Wenn Sie weiter so abnehmen, müssen wir das Kleid jeden Monat ändern. Mein Gott, essen Sie doch was, Kind, irgendwas!«
»Tue ich ja.« Ich biss mir auf die Unterlippe.
»Und Ihr Haar«, fuhr Gretchen fort. »Sie brauchen ein paar Strähnchen. Das Cremeweiß im Kleid tut Ihrem braunen Haar nicht gut. Überhaupt nicht.« Sie zerrte am Rücken des Kleides herum und fing an, Stecknadeln hineinzustechen.
Eine Nadel traf meine Hüfte. Ich zuckte zusammen. »Aua!«
»Halten Sie still, Kara!« Gretchen murmelte etwas Wirres über Bräute und Entscheidungen und die Südstaaten – offenbar eine schlechte Kombination.
»Wie bitte?« Ich blickte auf sie hinunter.
»Sie sollen stillhalten.«
»Hmm«, sagte ich und drehte den Kopf nach links. Ich hätte ein Nickerchen machen sollen, statt diese Pflichtstunde im Pflegeheim zu absolvieren. Aber ich war mit meiner ehrenamtlichen Tätigkeit sechs Stunden im Verzug, und wenn ich diese Zeit nicht aufholte, würden sie mich zeitweilig sperren.
Ich stöhnte. Eine siebenundzwanzigjährige Frau zu sperren – wie lächerlich das klang. Aber Mitglied in der Liga zu sein gehörte zu meinem Pakt mit Palmetto Pointe – es war eine Verpflichtung, die alle jungen Frauen eingingen, deren Familien in der Stadt tief verwurzelt waren. Sowohl Mama als auch Grandma hatten der Liga angehört – wer war ich denn, dass ich diese Kette abreißen ließ? Charlotte und ich sprachen zwar gelegentlich davon auszutreten, hatten es aber bisher nicht getan. Vielleicht war jetzt ein guter Zeitpunkt dazu?
Wo blieb Charlotte denn bloß? Sie wollte sich doch hier mit mir treffen.
»Mist«, murmelte ich.
»Was ist?« Gretchen erhob sich aus der Hocke und streckte sich.
»Ach, pardon, ich habe mit mir selbst geredet. Meine Freundin Charlotte sollte eigentlich herkommen. Ich wollte sehen, wie ihr das Kleid gefällt.«
»Ach ja – junge Frauen brauchen immer Bestätigung. Sie sind doch siebenundzwanzig, oder. Da zählt nur, ob Sie selbst das Kleid leiden mögen. Und Sie lieben es, stimmt’s?«
»Doch, ja.« Meine Hände flogen durch die Luft, wie meistens, wenn ich etwas mit Nachdruck sagte. Meine Geschwister meinten immer, ich sähe aus, als wollte ich fliegen, dabei bemühte ich mich bloß, etwas besonders zu betonen.
»Lassen Sie die Hände unten«, zischte Gretchen durch die zusammengebissenen Zähne.
»’tschuldigung. Es ist nicht, dass das Kleid mir nicht gefallen würde. Ich finde es wunderschön, wirklich. Ich wollte einfach Charlottes Meinung dazu hören. Jack meint nämlich, der Rock soll nicht aussehen wie … ach, Quatsch.« Ich rieb mir die Augen – das war einer der vielen Gründe, warum ich nur ungern Make-up trug, denn dann hatte ich ständig Wimperntusche an den Fingern.
»Und wer ist Jack?«
Mein Kopf flog herum, und der Schmerz schoss durch meine verkrampften Nackenmuskeln. »Wie bitte?«
»Sie haben gerade von Jack gesprochen.«
»Nein.«
»Doch.«
Sonnenlicht fiel glitzernd in den Laden, als hätte jemand Glassplitter hineingeworfen. Auf einmal strömte warme Meeresluft in den klimatisierten Raum, und Charlotte kam hereingestürmt – ganz Licht, ganz Energie. Ihre blonden Locken schienen einen Augenblick zu brauchen, um sie einzuholen, als sie vor dem Podest stoppte.
Meine Freundin legte sich die Hände auf die Wangen, sodass sie ihre Grübchen bedeckten. »Oh. Mein Gott.« Tränen traten ihr in die Augen. »Das ist das schönste, das herrlichste Kleid, das ich je gesehen habe. Und abgesehen von den schwarzen Rändern unter deinen Augen siehst du darin einfach absolut fantastisch aus.«
»Wirklich?«
»Wie ein Traum, ein Traum von einem Engel.« Sie zwinkerte mir zu, und ich verdrehte die Augen. Charlotte wusste, dass ich von klein auf, seit Mamas Tod, von Engeln träumte.
Gretchen räusperte sich. »Sie macht sich Sorgen, dass es Jack nicht gefallen könnte.«
»Wie bitte?« Charlotte hob die Augenbrauen.
»Sie« – Gretchen deutete auf mich – »brauchte –«
»Halt, stopp«, unterbrach ich die beiden Frauen. »Gretchen, das ist Charlotte, meine beste Freundin. Charlotte, das ist Gretchen. Sie hat diese wunderschöne Kreation hier nach meiner Skizze angefertigt.«
Die beiden schüttelten sich die Hände.
»Nett, Ihre Bekanntschaft zu machen«, sagte Gretchen. »Also, wer ist Jack?«
Ich stöhnte. »Das ist eine lange Geschichte.«
Charlotte schaute zu mir hoch. »Jetzt erzähl mir bitte nicht, dass ihr von Jack Sullivan sprecht.«
»Können wir das vielleicht auf später verschieben?« Ich warf Gretchen einen Blick zu.
»Nein, können wir nicht«, meinte Charlotte.
Gretchen lachte und piekste weitere Nadeln in mein Kleid.
»Das hat gar nichts zu sagen«, erklärte ich. »Die alte Irin im Verandah House hat mich nach meinem ersten Freund gefragt, und …« Unter Gretchens Nadeln stand ich so still, wie ich irgend konnte.
»Die alte Dame, die die Liga dir zugewiesen hat?«
Ich nickte. Gretchen beendete ihre Arbeit und warf einen Blick auf die Uhr. »So, Mädels« – sie klatschte in die Hände –, »das reicht. Ich hab noch mehr Termine.«
Charlotte und ich sahen uns an und mussten uns das Lachen verbeißen. »Jack?«, flüsterte sie dann.
Ich zuckte die Achseln, reckte mich und schüttelte den Kopf. »Eigentlich ist es völlig unwichtig.«
Meine Freundin trat zwei Schritte zurück, setzte sich auf die cremeweiße Samtcouch und schlug die Beine übereinander. Dann drohte sie mir mit dem Zeigefinger, als wäre ich ein Kind, das mit der Hand in der Keksdose erwischt worden war.
Dabei hatte ich doch gar nicht in eine fremde Keksdose gegriffen. Wirklich nicht.
Ich fuhr nach Hause, parkte in der Auffahrt und warf einen Blick auf die roten Ziffern der Digitaluhr auf dem Armaturenbrett. 11:45. Mir blieben exakt fünfzehn Minuten, um mir einen Snack zu schnappen, die Papiere zu holen, die ich von meinem Computer zu Hause hatte ausdrucken lassen, und dann um zwölf im Büro der PGA TOUR zu erscheinen, wie ich es versprochen hatte.
Das weiße Haus im Plantagenstil, das unserer Familie gehörte, stand auf einer leichten Anhöhe, einer Erhebung, die einem eigentlich nur auffiel, wenn man den Rasen mähte und den Mäher bergauf schieben musste, so wie ich als Teenager. Eichen in regelmäßigen Abständen säumten die Auffahrt und den Rasen. An einer Stelle auf der linken Seite, auf der Höhe von Jack Sullivans Elternhaus, klaffte ein Loch wie eine Zahnlücke. Ein Tropensturm hatte den Baum, der dort gestanden hatte, entwurzelt, alle anderen Eichen aber unbehelligt gelassen.
Ja, Jack hatte im Nachbarhaus gewohnt. Man sollte meinen, dass dieses Haus mich ständig an ihn erinnerte, aber ich hatte mich so an seine Existenz gewöhnt und es war inzwischen durch so viele Hände gegangen, dass ich es kaum noch wahrnahm – wie eine Narbe in einem Gesicht, die man anfangs nicht ignorieren kann, nach einer Weile aber gar nicht mehr beachtet, weil man sich daran gewöhnt hat. Seit Jack fort war, hatten dort nacheinander fünf Familien gewohnt, und jeder Besitzer hatte das Haus neu gestrichen und etwas angebaut oder weggenommen.