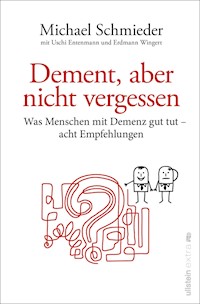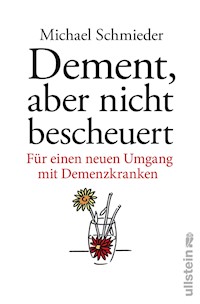
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Michael Schmieder leitet das Heim Sonnweid, das als eine der besten Pflegeeinrichtungen für Demenzkranke weltweit gilt. Sein erklärtes Ziel ist es, den Patienten ihre Würde wiederzugeben. Wenn wir die Kranken mit Medikamenten ruhig stellen, sie gar fixieren oder ihnen eine falsche Realität vorgaukeln, berauben wir sie ihrer Würde – selbst dann, wenn wir ihnen damit zu helfen glauben. Wenn wir sie hingegen ernst nehmen und auf ihre Ängste und Bedürfnisse eingehen, sehen wir sie als Menschen. Und darauf kommt es an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
Demenzkranke wollen in ihrem Sein akzeptiert werden. Aber wir »Gesunden« können nicht ertragen, geliebte Angehörige ins Vergessen gleiten zu sehen. Wir therapieren, beschäftigen und medikamentieren sie, damit wir uns nicht hilflos fühlen, ohne den Dementen damit wirklich zu helfen. Stattdessen sollten wir den Kranken mit Respekt begegnen. Das praktiziert Michael Schmieder im Pflegeheim Sonnweid – mit beeindruckendem Erfolg. Sein Buch ist ein Plädoyer für die Würde von Demenzkranken. Und es ist eine Handreichung für Angehörige, die nach Hilfe suchen.
Die Autoren
Michael Schmieder, geboren 1955, leitet das Heim Sonnweid bei Zürich. Er ist ausgebildeter Pfleger und hat einen Master in Ethik.
Uschi Entenmann, Jahrgang 1963, ist Autorin bei Zeitenspiegel Reportagen in Weinstadt.
Michael Schmieder/Uschi Entenmann
Dement,
aber nicht
bescheuert
Für einen neuen Umgang mit Demenzkranken
Ullstein
Zum Schutz von Personen wurden Namen, Biographien und Orte zum Teil verändert und Handlungen, Ereignisse und Situationen an manchen Stellen abgewandelt.
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1186-9
© 2015 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinUmschlaggestaltung und Illustration: Rudolf Linn, Köln
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
»Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben,Bewahret sie!Sie sinkt mit euch! Mit euch wird sie sich heben!«
Aus: Friedrich Schiller, »Die Künstler«
Inhalt
Über das Buch und die Autoren
Titelseite
Impressum
Motto
Dank
Abschied und Ankunft
Ein Anfang mit Hindernissen
Zusammen ist man weniger allein
Eine Heimat für Struwwelpeter
»Bloß keine Einzelzimmer!«
Heiliger Alois, hilf!
Gleichklang auf Augenhöhe
Eine Frage der Moral
Das kleinere Übel
Ohne Liebe läuft gar nichts
Das menschliche Maß
Anmerkungen
Feedback an den Verlag
Empfehlungen
Dank
Demenz ist eine Krankheit, die den Betroffenen und ihren Angehörigen Angst macht. Doch der Umgang mit den demenzkranken Menschen in der Sonnweid beweist, dass sie ihre Würde wahren können, dass seelischer Schmerz und Angst zwar dazugehören, aber ebenso Zuwendung, Liebe und Humor. Diese Balance anschaulich zu beschreiben ist dem Sprach- und Fingerspitzengefühl von Erdmann Wingert zu verdanken. Er hat den Entstehungsprozess des Buches in allen Phasen intensiv begleitet. Dank ihm erreicht das schwierige Thema die Leser ebenso leicht wie tiefgründig.
Dank gebührt auch den Mitarbeitern der Sonnweid, allen voran Monika Schmieder, die den Menschen im Heim, den kranken und gesunden, seit so vielen Jahren mit Empathie und Respekt begegnet. Ebenso René Boucard, dem Besitzer der Sonnweid, weil er im Heim ermöglicht, dass Neues entstehen kann. Danke auch den Kollegen der Reportageagentur Zeitenspiegel, die uns den Rücken freihielten. Clara Entenmann und Bruno Bienzle sind wir dankbar fürs Erstlesen und mutmachendes Feedback. Herzlicher Dank gebührt schließlich unserer Buchagentin Barbara Wenner und den Lektorinnen Julika Jänicke und Claudia Schlottmann für ihre Ruhe, Geduld und Kritik.
Abschied und Ankunft
Der Eintritt in ein Heim muss nicht Verbannung bedeuten, sondern kann auch von Zwängen befreien – den Betroffenen wie seine Angehörigen
Befürchtet hatten es alle, aber dann fuhr der Familie doch der Schreck in die Glieder. »Mutti muss ins Heim«, verkündete die Tochter, nachdem sie von einem Besuch im Krankenhaus zurückgekehrt war.
Die Gewissheit, Abschied von einem Menschen nehmen zu müssen, der seit je zur Familie gehört hatte, traf alle, jeden auf seine Art. Dass dieser Abschied gewisse Erleichterungen bringen würde, realisierte vorerst noch keiner. Auch nicht die Tochter, die ihre Mutter seit Jahren betreut hatte, meist liebevoll, manchmal auch etwas gereizt, wenn die verwirrte Frau beim Anziehen, Waschen und bei anderen Handreichungen hartnäckig jede Hilfe verweigerte. Weil sich die Tochter von früh bis spät um sie kümmerte, wurden Gespräche und gemeinsame Stunden mit ihrem Mann immer seltener. Vielleicht ahnten sie, dass sie künftig mehr Zeit füreinander hätten, auch für die Töchter und den Sohn. Die Kinder konnten das Dahinschwinden der Großmutter nicht ertragen und kamen kaum noch zu Besuch, der Sohn behauptete sogar, er würde sich eher »die Kugel geben« als so zu altern. Hinzu kam, dass sein Betrieb, den er mit einem Zuschuss der Eltern gegründet hatte, kriselte. Das Geld sollte er wieder zurückgeben, denn Heime sind teuer. Auch die Töchter, beide noch in der Ausbildung, müssten Opfer bringen, zumal sich andeutete, dass es noch schlimmer kommen würde. Denn der Großvater schien nicht mehr so ganz von dieser Welt zu sein, seitdem die Oma im Krankenhaus lag. Wer um Himmels willen sollte und konnte das alles bezahlen!
Seit dreißig Jahren sind wir jede Woche mit ähnlichen Schicksalen konfrontiert. Rund fünfzig Menschen, die an Demenz erkrankt sind, nehmen wir pro Jahr in unserem Heim, der Sonnweid, auf. Jeder von ihnen bringt eine eigene Geschichte mit, und immer wieder tun sich Abgründe auf. Im Gegensatz zu den meisten Heimen gilt deshalb in der Sonnweid die Regel, dass wir beim ersten Treffen Gespräche nur mit den Angehörigen führen. Selbst in einem frühen Stadium der Demenz kann der Kranke dem Gespräch oft nicht mehr folgen. Er hat vermutlich schon lange vorher bemerkt, dass etwas in seinem Kopf nicht stimmt, und tut aus seiner Sicht das einzig Richtige: Er schweigt. Weil er ahnt, dass mit dem Ende des Schweigens auch das Ende seiner bisherigen Sozialstruktur einhergehen würde. Er hat Angst vor der Veränderung. Auch von außen gesehen ist er mit diesem Verhalten im Recht. Es ist schließlich nicht die Aufgabe des Kranken, seine Defizite zu melden – dies würde dem Wesen der Krankheit widersprechen. Er spürt zwar, dass man über ihn redet, versteht jedoch kaum, was das für ihn bedeutet, wird im Verlauf des Gesprächs immer verwirrter, gestresster und zunehmend von Ängsten geplagt. Stellt man ihm eine Frage, dauert es quälend lange, ehe er eine Antwort findet, und die besteht oft nur in der verzagten Bitte an den Angehörigen: »Sag du es.«
Auch ohne seine Gegenwart ist das erste Gespräch ein Schlüsselerlebnis. Für uns, den Kranken und seine Angehörigen. Wir alle wissen, dass eine demenzielle Erkrankung immer ein komplexes System trifft. Krank ist eine Person, betroffen sind viele. Und alle haben sich noch vor dem ersten Treffen in der Sonnweid bohrende Fragen gestellt: Wird Mutti es im Heim aushalten? Kommt es nicht billiger, wenn sie noch ein Weilchen daheimbleibt? Gibt es denn nicht inzwischen eine wachsende Zahl von Pflegediensten, die dafür sorgen, dass es zu Hause möglichst lange gutgeht? Selbst wenn diese Institutionen aus naheliegenden Gründen daran interessiert sind, dass es möglichst lange »gut« geht. Wie viel Lieblosigkeit mit der Pflegekraft durch die Tür kommt, kann niemand beurteilen. Schon gar nicht die Kranke. »Oma redet doch viel, wenn der Tag lang ist.«
Dennoch kommt der Punkt, an dem nichts mehr geht. Es ist quälend, dauernd spüren zu müssen, dass die Pflege zu Hause kaum Anerkennung findet, die Fürsorge auf Essen reichen, Einlagen wechseln und Waschen reduziert ist und man am Ende dennoch nicht alles schafft. Weil man nicht mehr genug Schlaf bekommt, Schlafentzug ist in manchen Ländern eine Foltermethode! Weil man ungeduldig wird, zuweilen sogar aggressiv reagiert und weiß, dass die Belastung von Tag zu Tag schlimmer wird. Demenz ist nicht heilbar, das hat sich herumgesprochen. Schließlich bleibt nur noch der letzte Schritt: Wir bringen die Oma ins Heim, genau dahin, wo sie nie hinwollte.
Auch wenn wir diese Klage aus Hunderten von Gesprächen kennen, ist es wichtig, sie immer wieder anzuhören. In den ein bis zwei Stunden des ersten Gesprächs erlebe ich regelmäßig, dass sich mein Gegenüber öffnet, sehe, wie sich ein Bild des Kranken entwickelt, erkenne ich, wie weit die Demenz fortgeschritten ist, vor allem aber auch, welcher familiäre Hintergrund sich abzeichnet. Schon deshalb bitten wir vor dem Treffen darum, uns keine Vorberichte, keine Krankenakte oder irgendwelchen Papierkram zu schicken. Wir wollen uns ohne Vorwissen ein Bild davon machen, wie es unter der Oberfläche aussieht. Oft sind es tiefe Verletzungen, die sich offenbaren. Wie im Fall der alten Frau, die ihren dementen Mann bei uns unterbringen wollte. Nach einem langen Blick durch die Fensterwand meines Büros in den Garten, durch den Patienten spazierten, manche allein, andere von Pflegerinnen begleitet, brach es aus ihr heraus. Ein Leben lang habe ihr Mann sie betrogen, das Geld verhurt, und für sie habe er nichts übriggehabt. Erst als ihn die Krankheit daran hinderte, über die Stränge zu schlagen, konnte sie sich fürs Alter etwas vom Munde absparen, immerhin dreißigtausend Franken. Und die sollten jetzt für die Pflege dieses Kerls draufgehen!
Es ist nicht unsere Aufgabe zu werten, wir dürfen uns nicht zum Anwalt für den scheinbar Schwächeren einer Beziehung machen. Auch wenn wir glauben, ihn zu verstehen. Im Fall der zornigen alten Dame brachte ich schon ein gewisses Verständnis für ihre Reaktion auf. Sie hätte ja durchaus die Möglichkeit gehabt, den Spieß umzudrehen, wenn sie ihren Mann bei sich behalten hätte. In ihrem langen Eheleben hatte immer er die Rolle des Stärkeren gespielt, zu Hause läge jetzt die Macht in ihren Händen. Es spricht für sie, dass sie ihren Schürzenjäger trotzdem in unsere Obhut gab, wo er es dann auch tatsächlich verstand, sich beliebt zu machen, vor allem bei den Damen. Wie vielen anderen Angehörigen auch hat ihr bei dieser Entscheidung geholfen, dass sie sich ausweinen und den Ärger von der Seele reden konnte. Für die Angehörigen ist es wichtig, dass sie sich nicht bewertet fühlen, sondern in ihren zwiespältigen Gefühlen und ihrer Überforderung angenommen werden. Klagende Fragen, warum die Tochter ihren Vater nie besucht, warum der Sohn die Mutter alleinlässt, bleiben im Raum stehen. Dafür drängen sich neue Fragen auf, die wir beantworten müssen. Wie wird der kranke Angehörige reagieren, wenn er ins Heim gebracht wird? Was geschieht dort mit ihm? Wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt gekommen, ihn fortzugeben?
Wir möchten den Angehörigen nichts vormachen. Ich kenne den richtigen Zeitpunkt auch nicht. Spätestens, wenn man sich wünscht, der andere möge endlich sterben, ist er gekommen. Der Eintritt ins Heim bedeutet immer auch eine Auseinandersetzung mit dem Austritt, dem Tod. Das spüren alle sehr genau. Die gemeinsame Wohnung zu verlassen heißt, ein gemeinsames Leben zu verlassen. Sich vorzustellen, dass heute Abend mein Mann, meine Frau zum letzten Mal neben mir einschlafen wird, ist trotz aller Belastungen der vergangenen Jahre schwer zu ertragen. Dennoch kann es trösten, wenn der gesunde Partner den Wechsel ins Pflegeheim nicht als Abschieben betrachtet. Den Kranken fürsorglich zu betreuen gelingt nur, solange der Gesunde nicht über seine Grenzen hinaus belastet wird. Wenn er verzweifelt ist, den Kranken vernachlässigt, ständig schimpft und wenn ihm vielleicht sogar mal die Hand ausrutscht, dann braucht er dringend Hilfe von außen.
Im Umgang mit Demenzkranken gilt der Grundsatz, sich nicht mit ihnen zu identifizieren. Wir müssen eine Form der distanzierten Empathie im Umgang mit unseren Schützlingen wahren, alles andere wäre unprofessionell und würde weder den Kranken noch den Pflegenden helfen. Doch unter den Lebens- und Leidensgeschichten, die in den Erstgesprächen anklingen und den Besuchersessel in meinem Büro zuweilen in einen Beichtstuhl verwandeln, gibt es auch Tragödien, die uns in einem guten Sinn stark berühren. Dazu gehört die Liebesgeschichte zwischen Regina und Bernard Berger, an die ich mich noch in vielen Details erinnere, weil sie mir sehr nahegegangen ist. Und weil auch sie exemplarisch für den Verlauf der Krankheit ist.
Die beiden begegneten sich Anfang der achtziger Jahre zum ersten Mal. Anlass war ein geschäftlicher Termin, der plötzlich und unerwartet in eine Liebe auf den ersten Blick mündete. Regina war Abteilungsleiterin in einer Firma in Zürich, er arbeitete als Chefinformatiker einer französischen Firma und kam als Kunde zu ihr. Ein Mann, der was hermachte: fast eins neunzig groß, schlank, mit markant geschnittenem Gesicht und Augen, um die er beim Reden feine Lachfältchen zwinkerte. Sein Humor war es, in den sie sich sofort verguckte, dieser jungenhaft spöttische, aber nie verletzende Charme, der die Geschäftsbesprechung zu einem amüsanten Geplänkel machte. Auch ihn hatte es auf Anhieb erwischt. Schon nach einer Stunde wusste er: Diese warmherzige Person, mit der es sich so gut lachen ließ, war die Frau seines Lebens.
Wenn sie doch bloß nicht beide bereits verheiratet gewesen wären! Reginas Ehe war kinderlos geblieben, aber er hatte zwei kleine Söhne, an denen er sehr hing. Undenkbar, sie zu verlassen. Fünfzehn Jahre lang konnten Regina und Bernard nicht zueinander kommen. Dennoch brachen sie den Kontakt nie ab, telefonierten immer wieder miteinander und trafen sich auch manchmal. Aber eine Affäre anzubandeln, das kam weder für ihn noch für sie in Frage.
Als Bernards Söhne aus dem Haus waren, holten sie alles nach. Noch heute leuchten Reginas Augen, wenn sie von den ersten Jahren an seiner Seite spricht. Von Liebe, Leidenschaft und immer wieder von den lustigen Momenten, in denen die Pferde mit ihm durchgingen. Es heißt, dass wir Männer das Herz einer Frau vor allem dann gewinnen, wenn wir sie zum Lachen bringen. Darin war Bernard ein Meister. Als Sohn einer französischen Mutter verstand er sich auf das Savoir-vivre, die Kunst, das Leben hin und wieder auf die leichte Schulter zu nehmen. Regina teilte es mit ihm, nachdem sie im Jahr 2000 geheiratet hatten. Immer wieder verzauberte er sie mit seinem Charme, seiner Klugheit und seinem Humor. Beide verdienten gut und konnten sich Weltreisen leisten. Sie waren unzertrennlich. Regina wich Tag und Nacht nicht von seiner Seite, kletterte mit ihm sogar ins offene Cockpit eines Sportflugzeugs, das zu einem Akrobatikflug mit doppeltem Looping startete. Was konnte ihr schon passieren! Bernard besaß die Lizenz eines Fallschirmlehrers, und er war ihr Liebster. Mehr Sicherheit brauchte sie nicht. Waren sie wieder daheim, genoss sie die stillen Stunden mit ihm. Zu seinen vielen liebenswerten Seiten gehörte das Talent, raffinierte Gerichte zuzubereiten. Er war ein exzellenter Koch, der einen Nachmittag lang am Herd stehen konnte, um Regina am Abend mit einem köstlichen Menü, erlesenen Weinen und einem festlich gedeckten Tisch zu beglücken. Es war eine Ehe, die im Himmel geschlossen wurde – umso tiefer war der Absturz, der folgte.
Ein Jahr nach der Hochzeit verlor er seinen Job. Kurz darauf begannen ihn heftige Kopfschmerzen zu plagen. Tabletten halfen nichts, die Schmerzen wurden schlimmer. Der Hausarzt vermutete als Ursache eine schwere Depression, doch als die Medikamente wieder nicht halfen, schickte er Bernard mit Verdacht auf einen Gehirntumor zur Computertomographie in die Klinik. Dort beruhigte der Chefarzt das Paar. In Bernards Kopf sei alles in Ordnung.
Nichts darin war in Ordnung. Zunächst kaum spürbar, schlichen sich Irritationen ein. Es begann mit der Orientierung. Manches Mal, wenn er seine Mutter in der französischen Schweiz besuchte, erreichte Regina ein besorgter Anruf, weil Bernard nach vier, manchmal fünf Stunden immer noch nicht angekommen war. Warum er für die Autofahrt, die er früher in zwei Stunden geschafft hatte, so viel länger gebraucht hatte, konnte er nicht erklären. Überhaupt fiel dem ehemals so wortgewandten Mann das Reden schwer. Er sprach zunehmend langsamer und machte lange Pausen, in denen er nach Worten suchte. Regina schob es auf die Kopfschmerzen, die ihn offenbar so durcheinanderbrachten, dass er nicht richtig denken und folglich auch nicht flüssig reden konnte. Waren die Schmerzen womöglich auch der Grund dafür, dass in letzter Zeit ein Strafzettel nach dem anderen ins Haus flatterte, die meisten für falsches Parken? Noch ahnte sie nicht, dass er nicht mehr in der Lage war, eine Parkscheibe richtig einzustellen, wollte es wohl auch nicht so genau wissen. Erst als er vergaß, seine Überweisungen zu tätigen, beschlich sie Angst. Sie merkte es zu spät, denn in Gelddingen war auf Bernard seit je Verlass gewesen. Aber plötzlich häuften sich die Mahnungen, seine Krankenkasse hatte ihm sogar gekündigt, weil er seit Monaten keine Beiträge eingezahlt hatte.
Jetzt fiel ihr auf, dass er sich in letzter Zeit davor gedrückt hatte, einzukaufen. Sie merkte, dass er beim Bezahlen Geldscheine und Münzen nicht mehr zusammenrechnen konnte. Er ließ den Sportwagen in der Garage, hörte auf zu kochen, wusste nicht mal mehr, wie man den Tisch deckt. Von bösen Ahnungen befallen, suchte Regina mit ihm eine Neurologin auf, die auf diese Krankheit spezialisiert war. Mehrere Wochen wurde er in der Universitätsklinik untersucht, wurde befragt, getestet, sein Gehirn wurde gescannt, das Blut untersucht.
Regina spürte an seinen schweißnassen Händen, dass er sich mehr und mehr vor dem Gang in diese kachelkalte Klinikwelt fürchtete, wo man ihm Fragen stellte, die er nicht beantworten konnte, wo er kläglich scheiterte, als er das Zifferblatt einer Uhr zeichnen sollte und nicht mehr wusste, wo die Stundenzahlen hingehören. Doch die aufwendigen Untersuchungen in der Neurologie mussten sein, denn nur eine genaue Diagnose bietet die Chance auf eine angemessene Behandlung.
Demenz ist ein Oberbegriff für mehr als hundert Krankheiten mit ähnlichen Symptomen. Allen gemeinsam ist, dass unter ihrem Einfluss die kognitiven Leistungen des Patienten schwinden. An dem sogenannten Alzheimersyndrom leidet mehr als die Hälfte aller Menschen mit Demenz, darunter auch Bernard Berger.
Als Bernard erfuhr, dass er an Alzheimer litt, brach er weinend zusammen: Alzheimer im mittleren Stadium! Regina Berger dagegen fühlte sich fast wie erlöst. Endlich herrschte Klarheit, endlich konnte sie etwas unternehmen, sich über das Krankheitsbild informieren und ins Auge fassen, was auf sie beide zukommen würde. Sie besorgte sich Fachbücher über Demenz und recherchierte im Internet, welche Hilfsdienste in Frage kämen. Als sich herausstellte, dass Bernard nicht einmal mehr den Computer bedienen konnte, setzte sie sich Stunde um Stunde mit ihm vor das Notebook und versuchte, dem ehemaligen Chefinformatiker wenigstens ein paar elementare Techniken zu vermitteln. Vergeblich.
Die bittere Erfahrung hatte ihm offensichtlich den Rest Lebensmut genommen, denn kurz darauf gestand er, dass er mit dem Gedanken gespielt habe, sich umzubringen. Sie flehte ihn an, ihr und sich selbst dieses Ende zu ersparen, und er versprach es.
Bernard machte sich über seinen Zustand keine Illusionen. Er wusste, dass die Zeit nahte, in der er endgültig verstummen würde. Schlimmer noch: Es war absehbar, dass er in einem späteren Stadium der Krankheit seine Freunde, die Mutter und Geschwister, ja selbst sie, seine Ehefrau, nicht mehr erkennen würde. Ehe es so weit war, wollte er alle irdischen Dinge regeln. So geschah es: Sie legten ihre Konten zusammen, er verfasste sein Testament, dazu Vollmachten, die ihr erlaubten, über alle weiteren Stationen seines letzten Lebenswegs zu verfügen, bis hin zu seiner Beerdigung.
Noch arbeitete Regina von Montag bis Freitag in ihrer Informatikabteilung. An zwei Tagen der Woche brachte sie Bernard morgens in eine Tagesstation und holte ihn nach Feierabend Punkt 17 Uhr wieder ab. Doch die übrigen Werktage, an denen er allein im Haus war, wurden zur Angstpartie. Auch weil er sich nicht meldete, wenn sie anrief, denn den Zusammenhang zwischen Telefonklingeln und Abnehmen des Hörers erkannte er nicht mehr. Eine Zeitlang versuchte sie, ihre Arbeit nach Hause zu verlegen, wo er sie auf Schritt und Tritt verfolgte und sie kaum eine Minute in ihrem Homeoffice ungestört arbeiten ließ.
Nachdem sie schweren Herzens gekündigt hatte und in Frührente ging, waren sie wieder Tag und Nacht ein unzertrennliches Paar. Doch statt eines charmanten und weltläufigen Gentlemans begleitete sie von jetzt an ein ungebärdiges, ruheloses Kind, das unterwegs durch sehr lautes Sprechen auffiel. Bei Einkäufen und Ausflügen durfte sie ihren Mann keine Sekunde aus den Augen lassen, weil ihn ein ungestümer Bewegungsdrang dazu trieb, plötzlich und ziellos davonzulaufen. Auch zu Hause machten ihr rätselhafte und fast gespenstisch wirkende Vorgänge zu schaffen. Sie fuhr zusammen, als sie ihn zum ersten Mal im Badezimmer laut reden hörte. Besorgt spähte sie durch den Türspalt und sah ihn vorm Spiegel stehen. Mit schallender Stimme und hektischen Gebärden sprach er auf sein Spiegelbild ein, in dem er offensichtlich nicht sich, sondern irgendeinen Bekannten zu erkennen glaubte. In den folgenden Wochen eskalierte die Situation. Von neuen Phantomen im Spiegel schien er sich bedroht zu fühlen. Angst schüttelte ihn, seine Stimme schnappte über, Schweiß lief ihm übers Gesicht. Er knotete sich aus Handtüchern eine Art Knüppel, den er Tag und Nacht bei sich trug, um sich gegen die Spiegelphantome zu wehren.
Regina wusste sich und ihm nicht anders zu helfen, als die Spiegel in Badezimmer und Flur abzuschrauben, sie verhüllte die Fenster mit doppelten Vorhängen, um zu verhindern, dass ihn nach Einbruch der Dunkelheit wieder sein Spiegelbild erschreckte. Aber außerhalb des Hauses drohten ja noch Schaufenster und Autoscheiben, die bei ihm Angst und Aggressionen auslösen konnten. Deshalb führte sie ihn nur noch tagsüber aus der Wohnung, und selbst dann musste sie unentwegt wachsam sein, um Zwischenfälle zu verhindern. Einmal marschierte er auf einem Parkplatz ohne erkennbaren Grund wütend auf eine Frau los, die neben ihrem Wagen einparkte. Mit Mühe konnte Regina die erschreckte Frau beruhigen, die schließlich sogar Verständnis zeigte, als sie erfuhr, dass der Mann an Alzheimer litt. Doch solche Vorfälle wiederholten sich, und schließlich ging sie mit ihrem Mann nur noch im Wald spazieren. Überhaupt verringerte sich nach und nach die Zahl der Ausflugsziele, weil Bernard sich bei Restaurantbesuchen jedes Mal die Stoffservietten in die Hosentasche stopfte. Also besuchte sie mit ihm nur noch Biergärten, in denen es nichts dergleichen zu klauen gab.
Regina Berger hatte gewusst, was auf sie zukam. Fachbücher und Ratgeber hatten sie auf die Alltagsprobleme im Umgang mit ihrem dementen Mann vorbereitet. Geduld war gefragt, Toleranz und Einfühlungsvermögen, auch Diplomatie, wenn es darum ging, Verständnis für sein verstörendes Verhalten zu wecken. Trotzdem, irgendwann war er kaum noch gesellschaftsfähig. Zum Beispiel, als er begann, seinen Speichel im Mund zu sammeln und dann wahllos in die Gegend zu spucken. Sobald sie merkte, dass sich wieder einmal einiges angesammelt hatte, führte sie ihn zum Spucken an einen Grünstreifen oder Gartenzaun, einmal auch an ein Fenster, was den Protest einer Nachbarin hervorrief, die ihr Büro ein Stockwerk unter ihnen hatte und am geöffneten Fenster gearbeitet hatte. Die Spuckphase wurde nach einer Weile durch eine neue Manie abgelöst: das Anfassen. Er wollte jedem die Hand schütteln, wildfremden Menschen, gern auch kleinen Kindern, deren Mütter sich über die verdächtige Annäherung des Mannes alles andere als amüsiert zeigten. Ähnlich reagierte eine Dame, die bei einem Konzert neben ihnen saß und vor Schreck erstarrte, als er plötzlich ihren Fuß streichelte. Für diese Fälle hielt Regina ein Kärtchen parat, auf dem stand: »Bitte entschuldigen Sie, mein Mann leidet an Demenz.«
Nicht viel leichter zu ertragen war, dass er unterwegs jedes Fitzelchen von der Straße aufhob, und richtig schwer wog, dass er sich nicht mehr selbst waschen und anziehen konnte. Oft dauerte es zwei Stunden, ehe sie ihn aus dem Pyjama geholt und unter die Dusche geschoben hatte. Drängelte sie, ging gar nichts mehr. Als sie ihn am Weihnachtsabend ins Bett bringen wollte, eskalierte die Situation: Er riss die Kerzen vom Weihnachtsbaum und stopfte sich Christbaumkugeln in den Mund. Sie ging dazwischen, und da umklammerte er sie so heftig und schmerzhaft, dass sie schrie. Als er endlich losließ, rief sie ihren Bruder an, der wusste, wie es um sie und ihren Mann stand und als Arzt sofort erkannte, was zu tun war. Noch am selben Abend ließ er Bernard in die Psychiatrie einweisen. Sechs Wochen blieb Reginas Mann dort und wurde mit starken Medikamenten ruhiggestellt. So ruhig, dass er nicht einmal mehr den Kopf heben konnte, als er zu uns in die Sonnweid kam.
Inzwischen kann er es wieder. Jedes Mal freue ich mich, wenn ich durch mein Bürofenster sehe, wie er an der Hand seiner Regina durch den Garten spaziert. Oft hält er in der freien Hand eine Blume, die er aus einer Rabatte gezupft hat. Vielleicht ein Reflex aus seiner Zeit als emsiger Hobbygärtner, vielleicht auch eine ferne Erinnerung an die galante Begrüßungsgeste, die er ihr gegenüber sicher oft zelebriert hat. Ich frage nicht. Ich glaube, er tut es einfach, auch wenn er den Grund dafür vergessen hat, denn Erinnerung und Vergessen sind ein ungleiches Geschwisterpaar, das zusammengehört, weil keines ohne das andere sein kann.
Warum also über die Gründe spekulieren, die Bernard bewegt haben, seiner Liebsten eine Blume zu schenken? Reicht es nicht, dass er es einfach getan hat? Während unseres gesamten Lebens erinnern und vergessen wir. Manchmal ist Erinnern ein Segen und Vergessen ein Fluch. Von Jean Paul stammt der Satz, dass die Erinnerung das einzige Paradies ist, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Doch ob unser Leben tatsächlich ein Paradies war, hängt davon ab, wie wir das Erlebte bewerten. Die zeitliche Distanz beeinflusst unsere Erinnerung sehr. Liegt ein Ereignis weit zurück, ist plötzlich alles gut oder schlecht. Die Undifferenziertheit nimmt zu, einzelne Erlebnisse werden unverhältnismäßig stark gewichtet. Eine intensiv erlebte Kriegskameradschaft kann zum Beispiel dazu führen, die Militärzeit zu verklären. Erinnerungen zu beschönigen kann auch eine unbewusste Strategie sein, um mit schmerzvollen Erfahrungen der Kindheit umzugehen. Die Meinung, eine Ohrfeige habe noch niemandem geschadet, könnte Ausdruck dieser Haltung sein. Umgekehrt werden Erlebnisse manchmal pauschal negativ bewertet, obwohl sie nicht nur negativ erlebt wurden. Oft anzutreffen ist dieses Phänomen, wenn es um das Verhältnis des Einzelnen zu Kirche und Religion geht. Da wird aus der aktuellen Haltung heraus das früher positiv Erlebte nur noch schlecht bewertet. Und kann eine rigorose Ablehnung nicht gerade die Gefahr ausdrücken, die das Abgelehnte für mich darstellt? Signalisiert zum Beispiel Wut auf Homosexuelle möglicherweise die Angst, selbst homosexuell zu sein? Auch die Aussage »Das werde ich nie vergessen« ist Ausdruck eines starken Gefühls. Aber steht nicht auch die Angst dahinter, dass ich es dennoch vergesse und dass letztlich alles vergänglich ist? Wir alle wissen, dass wir vergessen können. Wir fürchten, dass wir prägende Erinnerungen vergessen. Und wir alle wünschen uns manchmal, dass wir vergessen könnten.
Eine Demenz wird vor allem am Vergessen gemessen, viel weniger an den oft deutlich sichtbaren Verhaltensstörungen. Warum wird versucht, diesem Vergessen mit allen Mitteln entgegenzuwirken? Kann der Verlust von Erinnerungen nicht vielleicht auch zu paradiesischem Erleben führen? Kann Vergessen nicht auch Distanz schaffen zu dem, was als nicht erinnerungswürdig empfunden wird? Menschen mit Demenz leben im Hier und Jetzt, wobei oft unklar ist, wann in ihrem bisherigen Leben ihr Hier und Jetzt angesiedelt ist. Wir Gesunden leben selten im Hier und Jetzt. Wir lenken uns mit immer mehr Geräten und Medien davon ab. Zum Beispiel, wenn wir einen Sonnenuntergang auf Facebook posten oder in der Pause eines Konzerts unseren Maileingang checken. Die Fähigkeit zu planen, macht es uns möglich, uns mit der Zukunft zu befassen und sie zu gestalten. Vielleicht wirkt es deshalb so bedrohlich auf uns, wenn Menschen nur im Hier und Jetzt leben, weil es uns zum einen zeigt, wie wenig wir das können, zum anderen, dass wir die Erinnerung nicht brauchen, um Mensch zu sein?
Da wir die Möglichkeit des Erinnerns so hoch bewerten und den Auswirkungen der Erkrankung deshalb oftmals hilflos gegenüberstehen, setzen wir – Betreuer wie Angehörige – die Bemühungen im Umgang mit Dementen oft dort an, wo sie uns am sinnvollsten erscheinen. Wir bewerten Lebensereignisse auf unserer eigenen Skala, teilen sie auf in die guten und die schlechten. Und dann zeigen wir alte Fotos, singen alte Lieder, schauen alte Filme, weil wir meinen, was uns gefällt, wird auch den demenzkranken Menschen gefallen.
Die Begegnungen mit dementen Menschen sollen aber Beziehung fördern, und zwar im Hier und Jetzt. Sie sollen Partnerschaft erlebbar und spürbar machen. Dazu braucht es keine Erinnerung, sondern zwei Menschen, die sich wahrnehmen – wie im Fall von Bernard Berger und seiner Regina. Es zählt allein, dass er ihr das Blümchen überreichen wollte, und nicht, dass er gleich nach dem Rausrupfen vergessen hat, es zu tun.
Jeden zweiten Tag besucht sie ihn und verbringt den Nachmittag mit ihm, das Paar gehört damit fast schon zum Erscheinungsbild unseres Heims. Ein rührendes Bild, in dem sich andeutet, dass ein liebevolles Zusammenleben auch mit Demenz möglich ist.
»Sprechen kann er nicht mehr. Aber Küssen, das geht noch«, erzählte Regina, als ich den beiden neulich über den Weg lief. Und in der Tat, es ging noch!
In wissenschaftlichen Studien heißt es, dass unser Tun und Lassen nur zu einem Drittel vom Bewusstsein gesteuert wird. Zwei Drittel unserer Entscheidungen treffen wir unbewusst, aus dem Bauch heraus. Bei einem dementen Menschen schwindet die rationale Urteilsfähigkeit im selben Maße, wie sein unbewusstes Handeln zunimmt. Wenn er auch nicht mehr die Uhr ablesen kann, nicht mehr spricht und die Orientierung verliert, so bleibt ihm doch die Fähigkeit zu lieben und Liebe zu empfangen. Ja, ich glaube sogar, dass ihn diese Gefühle, darunter Ängste, Trauer und Schmerz, mehr bewegen als den Gesunden. Um einem Menschen, der an Demenz erkrankt ist, gerecht zu werden, bleibt deshalb nur der Weg über die Emotionen. Wir müssen seine Gefühlswelt ansprechen, nicht die Verstandesebene. Das gilt immer, nicht nur für die Angehörigen, sondern auch für uns, und besonders für den Anfang unserer Beziehung, die Ankunft.
Keiner will ins Heim. Wer dann doch reinkommt, ahnt, dass er es erst nach seinem Tod verlassen wird. Deshalb empfinden viele Kranke den drohenden Verlust ihrer Autonomie und der eigenen vier Wände als Schritt in eine Welt, auf die das geflügelte Wort aus Dantes Göttlicher Komödie zu passen scheint: »Wanderer, der du hier eintrittst, lass alle Hoffnung fahren!«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.