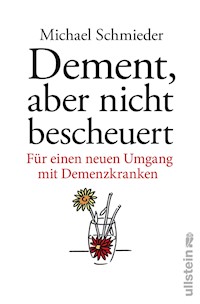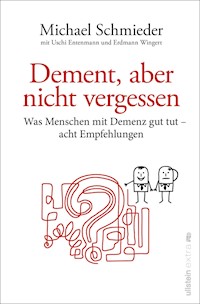
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was sich Demenzkranke wünschen und wie wir ihnen diese Wünsche erfüllen können 1,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz, täglich kommen hunderte hinzu. Viele Angehörige fühlen sich hilflos und alleine gelassen. Was tun, wenn der Mutter, dem Partner oder Geschwistern ihr selbstbestimmtes Leben entgleitet? Michael Schmieders Buch ist eine fundierte Anleitung, die ganz konkret erklärt, wie wir Menschen mit Demenz gerecht werden. Im Zentrum steht die Frage: Was wünschen sich die Demenzkranken? Wie können wir verstehen, was ihnen wirklich guttut? Es ist für Angehörige und Pflegekräfte oft schwer, zu erkennen und zu verstehen, was Demenzkranke sich wünschen. Michael Schmieder ist Experte zum Thema Demenz und kann Angehörige entlasten und helfen, die Bedürfnisse der Kranken zu erfüllen. Ist die Haltung, mit der wir ihnen begegnen von Achtung und Sympathie geprägt, erschließt sich der Rest schon fast wie von selbst. »Für Schmieder steht nicht der Kranke im Mittelpunkt, sondern der Mensch.«Focus
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Dement, aber nicht vergessen
Die Autoren
Michael Schmieder, geboren 1955, leitete bis 2015 das Heim Sonnweid bei Zürich, das als eine der besten Demenz-Einrichtungen weltweit gilt. Er ist ausgebildeter Pfleger, hat einen Master in Ethik und hält regemäßig hält Vorträge über Demenz. Schmieder wurde von der Paradies-Stiftung für sein Lebenswerk geehrt. Die Alzheimervereinigung Kanton Zürich zeichnete Michael Schmieder mit dem Fokuspreis aus.
Uschi Entenmann, Jahrgang 1963, ist Autorin bei Zeitenspiegel Reportagen in Weinstadt bei Stuttgart.
Erdmann Wingert, Jahrgang 1936, ist Autor bei Zeitenspiegel Reportagen in Weinstadt bei Stuttgart.
Uschi Entenmann, Michael Schmieder und Erdmann Wingert
Dement, aber nicht vergessen
Was Menschen mit Demenz gut tut - acht Empfehlungen
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin, 2022Umschlaggestaltung: Rudolf Linn, KölnIllustration: N.l-DreamstimeAutorInnenenfotosMichael schmieder: © Véronique HoeggerUschi Entenmann: © Rainer KwiotekErdmann Wiegert: © Rainer KwiotekE-Book powered by pepyrusISBN: 978-3-8437-2764-8
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autoren / Das Buch
Titelseite
Impressum
Vorwort Der Kranke hat immer recht
Kapitel 1 Die ersten Anzeichen
In aller Kürze: Die wichtigsten Fragen und Antworten
Kapitel 2 Hilfe für zu Hause
In aller Kürze: Die wichtigsten Fragen und Antworten
Kapitel 3 Das Leben ist schön!
In aller Kürze: Die wichtigsten Fragen und Antworten
Kapitel 4 Wo bin ich zu Hause?
In aller Kürze: Die wichtigsten Fragen und Antworten
Kapitel 5 Lieber tot als demenzkrank?
In aller Kürze: Die wichtigsten Fragen und Antworten
Kapitel 6 Beziehung ist alles
In aller Kürze: Die wichtigsten Fragen und Antworten
Kapitel 7 Wie sich unsere Krankenhäuser verändern müssen
In aller Kürze: Die wichtigsten Fragen und Antworten
Kapitel 8 So könnte die Zukunft aussehen
Wie kann in Zukunft eine menschenwürdige Pflege gelingen?
Literatur
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Vorwort Der Kranke hat immer recht
Hinweis
Um die Demenzkranken und ihre Angehörigen zu schützen, wurden ihre Namen, Biografien und Orte in diesem Buch zum Teil verändert und Handlungen, Ereignisse und Situationen an manchen Stellen abgewandelt.
Vorwort Der Kranke hat immer recht
Ein Leitfaden für Wege aus dem Irrgarten der Demenz
Wer einen Menschen betreut, der an Demenz erkrankt ist, sollte darauf gefasst sein, dass sich das Verhalten seines »Schützlings« von Monat zu Monat ändert. Um diesen immer wieder neuen Herausforderungen gewachsen zu sein, sind Kreativität und Geduld gefordert. Schon zu wissen, dass sich ständig Situationen ergeben, die nicht sofort zu lösen sind, kann helfen.
Ein Ratgeber für solche konfliktreichen Aufgaben kann keine Rezeptsammlung sein, die vorgibt, mit simplen Tipps Probleme im Umgang mit demenzkranken Menschen aus der Welt zu schaffen. Aber er kann als Leitfaden dienen, Wege aus schwierigen Situationen zu finden. Die Erfahrung zeigt, dass gesunde Angehörige meist ähnlich unflexibel reagieren wie Kranke, die ihnen anvertraut sind. Auch ein gesunder Mensch sieht oft nicht auf Anhieb ein, warum er von lieb gewonnenen Gewohnheiten abweichen soll, selbst wenn sie schon lange nicht mehr ihren Zweck erfüllen.
Wir alle sind in unseren Mustern gefangen, Kranke und Gesunde. Wie sollen wir das Leben meistern, wenn wir unser Verhalten nicht immer wieder infrage stellen? Viele Beziehungen scheitern, weil Erwartungen herrschen, die die Partnerin oder der Partner weder kennt noch erfüllen kann oder gar erfüllen will. Das hat nicht unbedingt mit Demenz zu tun, sondern kann auch ganz andere Ursachen haben.
Nehmen wir als Beispiel den Vorwurf, der regelmäßig erhoben wird, wenn eine Person immer wieder denselben Fehler macht: Sie muss doch merken, dass das nicht funktioniert, heißt es in solchen Fällen. Doch die Frage, warum sie es nicht merkt, bleibt meist unbeantwortet.
Eine sogenannte Fehlleistung, die wir bei demenzkranken Menschen oft beobachten, besteht darin, dass ihnen Fehler aus guten Gründen unterlaufen. Wir alle gehen doch davon aus, dass man Ordnung schafft, indem man Dinge an ihren Platz stellt, also Schuhe ins Flurregal und Butter in den Kühlschrank, aber um Himmels willen nicht umgekehrt!
Was jedoch, wenn zwar der Ordnungssinn vorhanden, aber der Orientierungssinn verloren gegangen ist – und die Schuhe im Kühlschrank landen?
Unbegreiflich erscheint es auch, wenn sich die kranke Person zu nachtschlafender Zeit unvermutet aufrafft, um zur Arbeit zu gehen. Warum tut sie das? Vor allem, warum tut sie das immer wieder, obgleich man ihr doch jedes Mal klar zu verstehen gibt, dass sie seit Jahren pensioniert ist und endlich Ruhe geben soll.
Wir alle erleben die Welt durch eigene Sinne und interpretieren all das, was wir sehen und hören, riechen, schmecken und fühlen, aufgrund individuell geprägter Erfahrungen. Eine demenzielle Erkrankung im Anfangsstadium kann dazu führen, dass sich die Wahrnehmungen der kranken Person nicht mehr mit ihren Erfahrungen decken. Wenn für sie Schuhe im Kühlschrank keinen Fehler bedeuten, kann sie sie auch nicht als deplatziert erkennen. Niemand macht absichtlich etwas falsch, ob mit oder ohne Demenz.
Was also ist in solchen Fällen zu tun oder zu lassen? Solange keine Schäden für Leib und Leben drohen, genügt es, naheliegende Maßnahmen zu ergreifen. Zum Beispiel die Schuhe stillschweigend in den Flur zu stellen. Oder die Nachtruhe zu wahren, indem man dem arbeitswütigen Partner vorschlägt, den Wecker auf acht Uhr zu stellen. Nach dem Frühstück sei ja noch Zeit genug, zur Arbeit zu gehen.
Stress zu mildern und Ängste zu nehmen, sollte in solchen Situationen Priorität haben. Die Angst vor dem Zuspätkommen, in uns allen seit früher Kindheit verankert, kann das Bewusstsein überlagern, auch wenn man längst den Pflichten aus Schulzeit und Berufsleben entwachsen ist. Ein Beispiel dafür, wie prägend und ins Alter übergreifend solche Erfahrungen sind, liefert die alte Dame, die an der Seite ihres Mannes über Jahrzehnte ein Schuhgeschäft leitete und im frühen Stadium der Demenz die Holztreppe ihres Hauses nicht etwa mit Bohnerwachs, sondern mit Schuhcreme pflegte. Die fast lebenslange Erfahrung, dass damit Glanz und Güte zu erzeugen waren, drängte die Wahl des Mittels ins Abseits. Eine unbewusste und dennoch nachvollziehbare Entscheidung. Sie deutet an, dass Menschen, die an Demenz erkrankt sind, zuweilen an Schlafwandler erinnern. Sie verfolgt im Wachen, was wir Gesunde manchmal in Träumen erleben, in denen wir als Erwachsene noch einmal inmitten von Kindern auf der Schulbank sitzen.
Bei Albträumen hilft nur schnelles Erwachen. Als Reaktion auf Irrungen und Wirrungen eines demenzkranken Angehörigen empfehle ich stattdessen als erste Maßnahme tiefes Durchatmen, das eine Denkpause einleitet. In ihr sollte man sich klarmachen, womit man den Kranken in solchen Momenten verschonen sollte. Im frühen Stadium der Demenz verliert er mit jedem Vorwurf, der ihm gemacht wird, ein Stück Selbstvertrauen, jeder Fehler, der ihm angekreidet wird, vertieft das Gefühl, minderwertig zu sein. Ihn mit Fehlern zu konfrontieren oder Konsequenzen anzudrohen, drängt ihn in die Enge und erhöht seine Angst.
Patentrezepte für den Umgang mit demenzkranken Menschen gibt es nicht. Selbst wer viele Jahrzehnte mit ihnen zu tun hatte, steht manchmal vor neuen Herausforderungen. Die gesammelten Erfahrungen deuten aber immerhin an, was in allen möglichen und zuweilen auch unmöglichen Situationen zu tun und zu lassen ist.
Ich weiß, vieles ist leichter gesagt als getan. In Fällen, in denen gar nichts mehr geht und der Geduldsfaden zu reißen droht, empfehle ich deshalb, zu beherzigen, was ich als Motto vorangestellt habe: Der Kranke hat immer recht. Er ist davon überzeugt, dass seine Sicht auf die Dinge die einzig richtige ist, und lässt sich nicht belehren. Wer das beherzigt, erspart sich viele Konflikte, die zu nichts führen, weil beide verlieren und an der Situation verzweifeln. Der Kranke hat immer recht – das stärkt ihn und gibt dem Angehörigen mehr Raum, die Dinge auf seine Art zu erledigen.
Kapitel 1 Die ersten Anzeichen
Meist spüren Menschen mit beginnender Demenz selbst als Erste, dass etwas nicht stimmt. Sie leiden unter Erinnerungslücken, Namensverwechslungen oder haben Orientierungsprobleme. Manche neigen dazu, die Anzeichen zu ignorieren und zu vertuschen, weil sie ihnen Angst machen. Die bessere Alternative ist, das Gespräch mit Freunden, der Familie und dem Arzt zu suchen.
Ich war noch ein junger Mann mit schulterlanger Mähne, als ich zum ersten Mal mit demenzkranken Menschen zu tun hatte. Jahrzehnte ist das her, das Wort Demenz war nahezu unbekannt, aber die Erinnerung daran hat sich eingenistet und wahrscheinlich mein Berufsleben mitgeprägt.
Wie viele junge Männer, die damals den Wehrdienst verweigerten, war ich im Ersatzdienst als Rettungssanitäter unterwegs. Ein Job, der mich ohne Vorwarnung mit der Endlichkeit des Lebens konfrontierte. Ich lernte in meinem Berufsalltag, in dem der Notfall der Normalfall war, dass es nicht allein darum ging, gebrochene Glieder zu schienen und Spritzen zu setzen, Wunden zu verbinden und Herzmassagen durchzuführen, sondern auch Vertrauen zu gewinnen und damit Verletzten das Gefühl zu vermitteln, in sicheren Händen zu sein.
Trotz allem Leid und Schrecken, denen ich täglich begegnete, spürte ich bald, dass ich in diesem Beruf zu Hause war. Menschen zu helfen, ist eine Aufgabe, die auch einem selbst hilft, weil man etwas Sinnvolles macht und seinen Platz in der Gesellschaft findet. Vorausgesetzt, man bringt eine Haltung mit, die Menschen in Not nicht nur körperlich, sondern auch seelisch stützt. Nicht, dass man im Angesicht des Leids in Tränen ausbrechen muss. Im Gegenteil: Entscheidend ist ein beherzter Beistand, der signalisiert, dass da jemand zur Stelle ist, der sich einfühlt und weiß, was zu tun und zu lassen ist.
Ich bilde mir ein, dass mir diese Art der Zuwendung nach und nach immer besser gelang – bis auf Fälle, die mich und selbst meine erfahrenen Kollegen vor unlösbare Probleme stellten. Sie traten ein, wenn uns verzweifelte Menschen riefen, die daheim einen demenzkranken Angehörigen betreuten und mit ihrem Dienst am Nächsten überfordert waren. Es half ein wenig, wenn sie sich über dessen Unarten ausweinen konnten, über das Chaos, das er anrichtete, über Launen, Schmutz und Schamlosigkeit. Ich selbst war als junger Mann radikal aufmüpfig. Und nun traf ich auf Menschen mit Demenz, die lebten, was ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können. Es hat die Angehörigen oft schon beruhigt, dass ein Sanitäter wie ich zuhörte und versuchte, die Situation zu erfassen. Ich sah in übermüdete Gesichter, weil die Unrast des Erkrankten für Angehörige die Nacht zum Tag gemacht hatte, entdeckte zuweilen aber auch Zeichen von Panik, wenn die Situation eskaliert war und Gewalt drohte. Jahrelang sei es friedlich zugegangen, jetzt häuften sich Wutanfälle, meist aus nichtigem Anlass, zuweilen auch in Form gespenstischer Szenen. Zum Beispiel, wenn der Kranke sich nicht mehr im Spiegel erkannt hatte und den fremden Eindringling anbrüllte, der da plötzlich vor ihm aufgetaucht war.
Zu allem Unglück bot sich kaum eine Möglichkeit, den Angehörigen zu helfen. Es gab keinen Ort für einen Demenzkranken, schon gar nicht im Stadium einer Aggression, die sich gegen seine Nächsten, zuweilen auch gegen ihn selbst richtete. Weder Krankenhaus noch Altenheim fühlten sich zuständig, letztlich nicht einmal Psychiatrien, wo man in solchen Fällen den allzu einfachen Weg ging, indem man den Aufsässigen mit der Medikamentenkeule dauerhaft ruhigstellte.
Solche Tragödien, die ich als junger Sanitäter erleben musste, spielen sich immer noch ab, denn die Zahl der Demenzkranken ist seitdem dramatisch gestiegen, und wir wissen, dass sie weiter steigen wird, weil die Menschen immer älter werden. Verständlich, dass die Sorge wächst, Eltern oder Großeltern könnten demenzkrank werden oder gar man selbst, wenn mal wieder Brille oder Autoschlüssel verschwunden sind oder der Name des Nachbarn auf der Zunge liegt, aber nicht herauswill. Zum Glück alles nur Stolpersteinchen des Alltags, meist dem Stress geschuldet und harmlos, speziell bei Menschen, die Mühe haben, an mehr als zwei Dinge zugleich zu denken, erfahrungsgemäß also Männer.
Ob Frau oder Mann, ein gewisses Maß an Argwohn ist berechtigt, denn mit zunehmendem Alter laufen wir Gefahr, dass sich diese Krankheit nahezu unmerklich einschleicht. In den allermeisten Fällen tritt sie in der unheilbaren Form als Alzheimer auf, die von Jahr zu Jahr mehr Menschen betrifft. 1,6 Millionen Männer und Frauen leiden in Deutschland bereits an Demenz, 900 kommen jeden Tag dazu, das bedeutet Jahr für Jahr mehr als 300 000 Neuerkrankungen, Tendenz steigend.
Damit richtet die Demenz Schlimmeres an als jede Pandemie. Gegen eine Seuche wie Covid 19 kann man sich schützen, indem man sich impfen lässt. Das gilt nicht für die Demenz. Zwar wird so gut wie jedes Jahr von irgendeinem Pharmakonzern versprochen, ein Medikament zu entwickeln, das vorbeugen oder zumindest helfen soll, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen. Doch das geht so, seitdem Alois Alzheimer im Jahr 1907 im geschrumpften und von Eiweißklümpchen durchsetzten Hirn der Magd Auguste Deter sogenannte Plaques als Todesursache identifiziert hat. Bisher haben sich alle Ankündigungen eines Heilmittels als leere Versprechen erwiesen.
Weil wir wissen, dass uns die Demenz noch lange begleiten wird, müssen wir versuchen, mit ihr auszukommen. Im Vergleich zu Pandemien ist sie wenigstens nicht ansteckend – ein schwacher Trost, denn die Angst vor ihr steckt sehr wohl an. Eine verständliche Reaktion, zwecklos, sie zu leugnen. Diese Angst springt jede und jeden von uns an, wenn sich wieder ein Fall in der Familie, bei Freunden oder im Kollegium herumspricht. Angst vor dem Kontrollverlust über unser Denken, Handeln und über unseren Körper. Deshalb geht es vor allem darum, zu zeigen, wie wir mit dieser Angst leben können, ehe sie die Seele frisst. »Jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten«, diese Zeile aus dem Gedicht »Rezept« von Mascha Kaléko kommt mir immer wieder in den Sinn.
Viele Situationen, von denen ich berichten werde, spielen sich im familiären Rahmen ab, also dort, wo 80 Prozent aller Menschen mit Demenz leben und von Angehörigen betreut werden. Immer unter großem Einsatz, oft unter schmerzhaften Opfern und zuweilen unter dem Joch unerträglicher Lasten. Immer versuche ich zu zeigen, was nötig und möglich ist, auch, wo die Grenzen der Belastbarkeit liegen und ständig überschritten werden. Nächstenliebe kann ins Gegenteil umschlagen, wenn sie den Helfenden krank macht. Oft ist es lebenswichtig zu erkennen, wann professioneller Beistand notwendig ist und an die Stelle von familiärer Fürsorge treten muss. In diesen Situationen konzentriert sich alles auf den Kranken, und seine familiäre Umgebung wird vergessen.
Schon deshalb ist es wichtig zu wissen, was ein Pflegedienst leisten kann und was nicht. Ebenso, ob das Heim, dem man schließlich den demenzkranken Menschen anvertraut, auch wirklich hält, was es verspricht. Es hat sich herumgesprochen, dass in den rund 12 000 deutschen Altersheimen vieles im Argen liegt. Ein Ratgeber tut not, der auch hilft, einen menschenfreundlichen Ort zu finden. Wie solch ein Heim aussehen soll und kann, habe ich 2015 in meinem Buch »Dement, aber nicht bescheuert« am Beispiel des Demenzheims »Sonnweid« gezeigt, das ich nahe des Zürichsees in Wetzikon in der Schweiz aufgebaut und geleitet habe. Die Hoffnung, dass es als Modell für andere Heime dienen würde, hat sich nur in Ansätzen erfüllt. Grund genug, mit einem Ratgeber nachzufassen, der sich an Fällen aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung orientiert. Zusätzlich engagiere ich mich auf den Websites https://www.alzheimer.ch und https://www.Demenzwiki.ch.
Es gibt einen Satz, der mich schon als junger Sanitäter berührt hat und mich auch heute noch in die Pflicht nimmt. Kaum eine Woche vergeht, in der ich ihn nicht höre, geäußert von Jung und Alt, Frau und Mann, mit ratloser und oft verzweifelter Miene. Neulich sogar von meiner Kollegin Gisela Hoffmann, die ich seit 13 Jahren als Mitarbeiterin kenne und schätze. Schon seit Längerem hatte ich gespürt, dass sie etwas bedrückt, ein Zustand, den ich bei ihr bisher nicht kannte. Denn so leicht lässt sich diese couragierte Frau nicht unterkriegen, sie ist Mutter von drei Kindern, darunter ein hyperaktiver Teenager.
Aber jetzt hockt sie vor mir im Sessel, der seit jeher als Sorgenstuhl dient, sucht meinen Blick und sagt nach einer Weile mit trauriger Stimme:
»Michael, ich habe Angst.«
Da ist er wieder, der Satz, der mich verfolgt und fordert. Ich ahne, was kommen wird, spüre aber, dass der Grund ihrer Angst nicht in ihr liegt. Wer wie ich seit fast 40 Jahren mit Menschen mit Demenz zu tun hat, erkennt die Symptome früh. Mir ist klar: Gisela, diese tatkräftige und umsichtige Frau, gut organisiert und voll engagiert im Hier und Jetzt, ist alles andere als demenzkrank.
»Geht es um Martin?«, frage ich deshalb.
Sie nickt. Ja, es ist ihr Mann, um den sie sich Sorgen macht, mit dem sie seit gut 20 Jahren verheiratet ist. Glücklich verheiratet, das weiß ich, weil ich oft aus meinem Bürofenster beobachten konnte, wie er sie abgeholt und umarmt hat, wie sie Schulter an Schulter zum Auto gingen, lachend und redend. Beide hatten je drei Kinder aus erster Ehe, sodass sie in den ersten Jahren eine sechsköpfige Schar Halbwüchsiger zu bändigen hatten. Es zeigte sich, dass sie sich gut ergänzten. Sie schätzte seine Ruhe und die bedachtsame Art, Probleme anzupacken, was sich wohltuend auf den quirligen Sohn auswirkte, der oft drohte, außer Kontrolle zu geraten; sie lockte ihn aus der Reserve, wenn er ihr zu behäbig wurde, verführte ihn zum Tanzen und verwöhnte ihn mit gutem Essen.
»Unser Patchwork war mitunter trubelig, aber doch auch schön«, sagt sie.
»Und jetzt nicht mehr?«, frage ich.
Sie schüttelt den Kopf, und während ich spüre, wie sie mit den Tränen kämpft, wird mir auf einmal klar, dass ich sie beide lange nicht mehr so innig wie früher zusammen gesehen habe. Sehr lange sogar.
»Erzähl!«, bitte ich sie. »Was ist los?«
»So ungefähr vor vier Jahren«, beginnt sie, »da ist er um drei Uhr nachts aufgestanden, ins Bad gegangen und hat geduscht. Zurück im Schlafzimmer, hat er Wäsche und einen Anzug aus dem Kleiderschrank geholt. Ich hab ihn gefragt: ›Was um Himmels willen tust du da jetzt mitten in der Nacht?‹ Und er sagte: ›Ich muss doch gleich los. Zur Arbeit.‹«
Keine Frage: Sie hatte Grund, besorgt zu sein, denn der Verlust des Zeitgefühls ist ein starkes Indiz für eine demenzielle Erkrankung. Sie wusste, was das für sie und ihren Mann bedeutete. Als meine Mitarbeiterin war sie seit Jahren mit allen Formen und Phasen der Demenz vertraut. Eine Besonderheit unseres Heims »Sonnweid« besteht darin, dass es ausschließlich demenzkranke Menschen beherbergt. Das hatte schon für Aufsehen gesorgt, als ich es vor bald 40 Jahren gegründet habe, ebenso, als wir es in drei Betreuungsformen gliederten, die den Bedürfnissen der frühen, der fortgeschrittenen und der späten Demenzphase angepasst sind.
Gisela hatte also täglich vor Augen, wie sich die Krankheit entwickelt: von der ersten Phase, in der die Patientinnen und Patienten noch relativ selbstbestimmt leben können und bei uns in Wohngruppen betreut werden, in die zweite Phase, in der sie eine engere Obhut genießen, die ihnen jedoch noch ein angepasstes Leben und große Freiräume bietet, bis in die dritte Phase, in der wir sie in unseren sogenannten Oasen bis zum Ende begleiten.
So unabänderlich und traurig dieser Verlauf auch klingen mag, er hat tröstliche und gute Momente. Lässt man dem kranken Menschen die Freiheit, im Rahmen seiner Möglichkeiten nach eigener Fasson selig zu werden, bleibt sein Dasein trotz aller Irrungen und Wirrungen lebenswert. So könnte es auch im Fall von Giselas Mann sein, wenn er die Fähigkeit noch hätte, seinen Zustand zu akzeptieren. Eben das aber nicht zu erkennen, ist Teil der Krankheit. Dabei kenne ich ihn als klugen und aufgeschlossenen Zeitgenossen, der eine gut dotierte Position als Informatiker eines internationalen Unternehmens besaß und über seine Frau mit den Symptomen einer Demenz vertraut sein musste. Bemerkenswert scheint mir auch die Tatsache, dass die nächtliche Szene, in der Gisela den Ernst der Lage erkannt hatte, schon vier lange Jahre zurücklag. Offensichtlich hatte sie die zunehmende Verwirrung ihres Mannes seitdem stillschweigend ertragen.