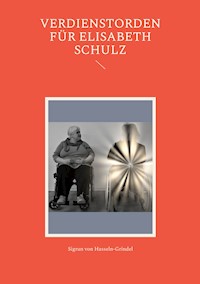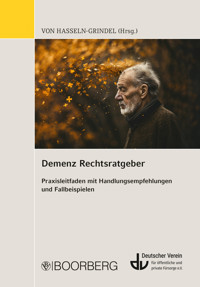
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Richard Boorberg Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Sie haben Rechtsfragen rund um das Thema Demenz? Wird eine Demenz festgestellt, wirkt sich das für die betroffene Person, für ihre Angehörigen und für ihr soziales Umfeld auf nahezu alle Lebensbereiche aus. Wie können Angehörige die immense Belastung bewältigen? Wie kann der starke Grundrechtsschutz der Betroffenen im Pflegeheim oder im Umgang mit Ämtern durchgesetzt werden? Wie können Vertragspartner und Geschädigte trotz der fehlenden Geschäfts- und Deliktsfähigkeit eines Betroffenen ihre Ansprüche durchsetzen? Welche Aufgaben hat der Betreuer? Dürfen Betroffene noch ein Fahrzeug im Verkehr bewegen? Dieser Ratgeber gibt Anworten auf Ihre Rechts- und Haftungsfragen Der neue Ratgeber behandelt umfassend die im Zusammenhang mit Demenz auftretenden Rechtsfragen sowie Haftungsfragen von Aufsichtspersonen, Fragen zur Ausbildung von Pflegefachkräften und zum Einsatz von Pflegerobotern. Umfassende Darstellung aus der Perspektive aller Beteiligten Das Autorenteam beleuchtet das Thema Demenz aus verschiedenen Perspektiven, die sich aufgrund der Demenzerkrankung eines einzelnen Menschen ergeben können: aus der Perspektive von Demenzkranken, von Angehörigen, von Ärzten, Pflegepersonal, Betreuern, Vermietern, Arbeitgebern, Verkehrsteilnehmern, Berufsgruppen sowie privaten und staatlichen Institutionen. Interdisziplinäre Kompetenz und Erfahrung aller Autoren Fachübergreifend verknüpft der »Demenz Rechtsratgeber« medizinische, soziale, rechtliche und ethische Fragen, die sich häufig im Zusammenhang mit einer Demenzerkrankung ergeben. Die Autoren verfügen alle über langjährige Erfahrung in ihrem Fachgebiet: Juristen, renommierte Fachärzte, anerkannte Demenz-Pflegefachkräfte, Betreuer, Pädagogen, (sachkundige) Angehörige etc. Besonders empfehlenswert für: Demenzkranke und ihre Angehörigen Rechtliche Betreuer, Vorsorge- und General-Bevollmächtigte Ärzte, Neuropsychologen, Therapeuten (z.B. Physiotherapeuten, Ergo- und Kunsttherapeuten, Musik- und Tanztherapeuten, Logopäden), Seelsorger Ambulante und stationäre Pflege-, Kranken- und Hospizeinrichtungen Entscheidungs- und Kostenträger im Gesundheitswesen, Mitarbeiter in Ämtern, Gemeinde- und Stadträte, Behinderten- und Seniorenbeiräte Studierende und Mitarbeiter der sozialen Arbeit
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Demenz Rechtsratgeber
Praxisleitfaden mit Handlungsempfehlungen und Fallbeispielen
Herausgegeben von
Sigrun von Hasseln-Grindel
Rechtsanwältin, Vors. Richterin am Landgericht a. D.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek | Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
1. Auflage, 2025
Print-ISBN 978-3-415-07668-6
EPUB-ISBN 978-3-415-07692-1
© 2025 Richard Boorberg Verlag
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Nutzung sämtlicher Inhalte für das Text- und Data Mining ist ausschließlich dem Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG vorbehalten. Der Verlag untersagt eine Vervielfältigung gemäß § 44b Abs. 2 UrhG ausdrücklich.
Titelfoto: © stopabox – stock.adobe.com
eBook-Umsetzung: abavo GmbH, Nebelhornstraße 8, 86807 Buchloe
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG | Scharrstraße 2 | 70563 Stuttgart
Stuttgart | München | Hannover | Berlin | Weimar | Dresden
www.boorberg.de
Grußwort
Wer eine ernste Diagnose erhält, dessen Welt gerät leicht aus den Fugen. Das gilt in besonderer Weise für Demenz. Für viele Betroffene und ihre Familien bricht zunächst eine Welt zusammen. Weltweit sind etwa 55 Millionen Menschen von Demenzerkrankungen betroffen. In Deutschland leben aktuell etwa 1,8 Millionen Demenzerkrankte und ihre Familien. Wie gehen wir als Gesellschaft mit den Betroffenen um? Ist uns bewusst, dass es jeden von uns treffen kann? Als Gesellschaft müssen wir dafür Sorge tragen, dass ein Leben in der Gemeinschaft für Menschen mit Demenz trotz Einschränkungen möglich bleibt. Dies geschieht dann, wenn Menschen mit Demenz, aber auch ihre Angehörigen, am Leben in der Nachbarschaft und im Quartier teilhaben können ohne Berührungsängste in der Begegnung auszulösen oder auf ihre Demenz reduziert zu werden. Noch zu oft werden Menschen mit Demenz und häufig auch ihre Angehörigen quasi „unsichtbar“, weil sie sich aus Angst oder Scham zurückziehen. Damit das anders werden kann, brauchen wir ein soziales Miteinander, das von Verständnis und Mitsorge geprägt ist. Neben Familie und aufgeschlossenen Freunden braucht es auch mutige Kommunen und zivilgesellschaftliche Akteure, die sich für die Weiterentwicklung bedarfsgerechter Versorgungs- und Unterstützungsstrukturen einsetzen.
Darauf macht der Deutsche Verein u. a. in seiner Arbeit aufmerksam und unterstützt die Bundesregierung bei der Umsetzung der Nationalen Demenzstrategie von Anfang an. In seinen Empfehlungspapieren verweist er auf die Notwendigkeit der weiteren Sensibilisierung der Öffentlichkeit, die Verbesserung der medizinischen Versorgung durch interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Verbesserung individueller häuslicher Versorgung durch tragfähige Unterstützungssysteme und den Ausbau wohnortsnaher Beratungs- und Selbsthilfeangebote.
Erkrankt ein Familienmitglied oder ein Mensch aus dem nahen Umfeld an Demenz, stellen sich viele gesundheitliche und pflegerische, aber auch sozialrechtliche Fragen. Die verschiedenen Leistungsansprüche in unterschiedlichen Sozialgesetzbüchern bzw. korrespondierenden Rechtsgebieten sind dabei sowohl für die Betroffenen und deren Zu- und Angehörigen als auch für die damit befassten Berufsgruppen, nicht leicht zu überblicken.
Mit dem vorliegenden spezifischen Demenz Rechtsratgeber wird Familien, aber auch den professionellen Akteuren zentraler Versorgungsstrukturen sowie kommunalen Akteuren ein wichtiges Instrument zur rechtlichen Orientierung im Kontext von Demenz an die Hand gegeben.
Dr. Irme Stetter-Karp
Präsidentin des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V.
Geleitwort
Zu Demenziellen Syndromen gibt es umfangreiche medizinische Fachliteratur, zahllose Ratgeber für den Alltag von Patienten und Angehörigen, und viele gute Ansätze zur Diagnose und Therapie in Schwerpunktpraxen und Gedächtniszentren. Doch das Phänomen Demenz entzieht sich immer wieder auf eine besondere Art einer strukturierten Herangehensweise in der Gesundheitsversorgung, nicht nur, weil es viele ältere Menschen betrifft; es betrifft jeden unterschiedlich auf seine eigene Art und Weise.
Meine ersten Kontakte mit kranken Menschen hatte ich als Zivildienstleistender in einem städtischen Krankenhaus. Noch nicht für einen Beruf ausgebildet, war das „Phänomen Krankheit“ für mich als solches irritierend und herausfordernd. Nach 30 Jahren ärztlicher Tätigkeit in der universitären Neurologie sehe ich heute für viele neurologische Erkrankungen eine gute medizinische Praxis in der Diagnosestellung, Therapie und Versorgung, Bei dem Phänomen Demenz hingegen bin ich bis heute irritiert, ein Erleben, das viele meiner Kolleg:innen aus Psychiatrie, Psychosomatik und Neurologie teilen.
Das menschliche Gehirn ist in seiner Fähigkeit, ein Leben lang zu lernen, Träger grundlegender Funktionen der Wahrnehmung, Verarbeitung und Ausübung. In seinen neuronalen Netzwerken bildet sich die Person ab, die im ständigen dynamischen Austausch mit ihrer Umwelt steht. So leistet das Gehirn durch seine hohe Integrationskraft die Entwicklung und Pflege von Beziehungen, die vom engsten partnerschaftlichen und familiären Umfeld über Freundes- und Bekanntenkreise, bis in Beruf, Gesundheits- und Daseinsfürsorge reichen. Wie selbstverständlich gehen gesunde Menschen davon aus, dass sie in diesen Spielfeldern nicht nur funktionieren, sondern auch lebenslang aktiv gestalten können. Genauso selbstverständlich akzeptieren sie die meisten gesellschaftlichen Normen und gesetzlichen Regelungen, die ihre Rechte und Pflichten beschreiben.
Menschen, die demenzielle Erkrankungen entwickeln, können in allen diesen Bereichen auf sehr unterschiedliche Weise die Fähigkeiten verlieren, konstruktiv an den vielen Bereichen ihres Daseins teilzunehmen. In den Frühphasen ist die Störung oft diskret ausgeprägt. So stellt sich bei den Mitmenschen der Betroffenen eher eine Irritation ein als ein Wahrnehmen von Krankheit. Diese Irritation wird durch eine Veränderung der Fähigkeiten und Fertigkeiten des Gehirns ausgelöst, die die ständige Bildung und Pflege von Beziehungen und Austausch zur Umwelt und den Mitmenschen beeinträchtigt. Oft sind tiefgreifende Zerwürfnisse und Verletzungen der Rechte der Betroffenen wie auch der Rechte anderer Personen mit zivilrechtlichen und möglicherweise strafrechtlichen Konsequenzen die Folge, bevor die zugrunde liegende Erkrankung erstmalig wahrgenommen wird. Doch auch nach einer Diagnosestellung ist es für Betreuende und Beratende nicht leicht, bei Veränderungen des Verhaltens der Betroffenen freie Willensentscheidungen von krankheitsbedingten Fehlhandlungen zu unterscheiden. Diese Schwierigkeit betrifft tatsächlich nicht so sehr Fragen der medizinischen Behandlung, sondern vielmehr die täglich stattfindenden Geschäfte, deren Wirksamkeit einer zunehmenden Unsicherheit unterliegen.
In meiner eigenen Praxis sticht die frontotemporale Demenz hervor, die Verhaltensstörungen mit einer Verminderung des planerischen Denkens beinhaltet und eine besondere Herausforderung für das Umfeld darstellt. So ist selbst beim Wissen um die Erkrankung das ständige, tägliche Ringen um die Abgrenzung zwischen residuellem freien Willen und krankheitsbedingter Verhaltensänderung enorm kraftraubend. Etwas anders gelagert und doch nicht weniger belastend schreitet die Entfremdung bei der Alzheimer-Demenz durch Vergessen und Desorientierung fort. Die ärztliche Rolle ist dabei im Vergleich zu den Menschen, die die tägliche Unterstützung und Pflegearbeit an Demenz Erkrankten leisten, eher wenig belastend. Neue, in den USA bereits zugelassene Medikamente gegen die Alzheimer-Demenz lassen seit 2024 Patienten und Angehörige auf Heilung hoffen, realistischer ist eine Verlangsamung des Verlaufs. Dadurch ist eine Zunahme von mild bis moderat von Demenz Betroffenen zu erwarten, die im Alltag in nicht einfach zu definierenden Teilen durchaus geschäftsfähig handeln können. Umso drängender ist der Bedarf an fundiertem rechtlichem Rat für alle Personen, die mit an Demenz erkrankten Menschen direkt, in der Rechtsprechung oder in der Legislative zu tun haben.
Frau Sigrun von Hasseln-Grindel legt mit diesem Kompendium einen umfassenden Ratgeber vor, der aus grundlegenden Betrachtungen heraus über praktische Beispiele eine Reihe von bei Demenz zu beachtenden rechtlichen Fragen behandelt. Sie baut auf einem bewährten Konzept von rechtlichen Ratgebern im Jugend- und Verkehrsrecht auf, die weit verbreitet in der Versorgung, Pflege und Anwendung des Sozialrechts wirken. Ihre langjährige Erfahrung als Vorsitzende Richterin am Landgericht zeigt sich in der besonders ausgewogenen und feinfühligen Aufarbeitung von Demenzfolgen, die immer mehr Menschen der alternden Gesellschaft betreffen.
So konnte sie eine Reihe von herausragenden Persönlichkeiten gewinnen, die die ganze Bandbreite der Auswirkung von Demenz auf das persönliche Umfeld, pflegerische und ärztliche Versorgung, Sicherung von Grundrechten und das rechtliche Geflecht der Teilhabe am Alltagsleben beleuchten.
Dieses Werk verspricht in seinem Umfang und in seiner Tiefe ein sehr wertvoller Ratgeber für alle Menschen zu werden, die sich Betroffenen mit Demenz widmen.
Lübeck, im September 2024
Prof. Dr. med. Julian Grosskreutz
Universität zu Lübeck
Vorwort
Dieser Demenz Rechtsratgeber richtet sich an Angehörige und Berufsgruppen, die mit der Behandlung und Betreuung von Menschen mit Demenz zu tun haben, wie Rechtliche Betreuer, Ärzte, Neuropsychologen, Therapeuten (z. B. Physio-, Ergo-, Kunst-, Musik- und Tanztherapeuten, Logopäden), Krankenhäuser, Pflegeheime, Hospize, ambulante Kranken- und Pflegedienste, Entscheidungs- und Kostenträger im Gesundheitswesen, MitarbeiterInnen in Ämtern, Gemeinde- und Stadträte, Behinderten- und Seniorenbeiräte.
Die Idee zu diesem Ratgeber wuchs in vielen Jahren, in denen ich immer wieder mit dem komplexen Themenfeld Demenz konfrontiert wurde.
So erlebte ich schon während meiner Semesterferien, in denen ich häufig in einem Seniorenpflegeheim in Stuttgart arbeitete, immer wieder, wie Menschen in teilweise hohen beruflichen Positionen von Weinkrämpfen geschüttelt vor der Tür ihrer Mutter oder ihres Vaters standen. „Das soll meine Mutter sein?“ Die an Demenz erkrankten Elternteile erkannten ihre Kinder nicht. Manchmal warfen sie gar mit Tassen, Besteckteilen, Nachttöpfen oder Kotkugeln nach ihren Kindern und brüllten unter Nutzung schlimmster Schimpfworte: „Hauen Sie nur ab und lassen sich nie wieder blicken.“
Lange fragte ich mich, was wäre, wenn einer meiner Elternteile an Demenz erkranken würde? Würde ich es physisch und psychisch schaffen, sie dann zu pflegen? Ich hatte Glück: Meine Eltern starben hochbetagt bei völlig klarem Verstand. Das ist nicht allen Kindern vergönnt. Im Kap. I.3.2. berichtet eine Juristin unter dem Titel: „Letztlich habe ich drei Therapien bei drei Therapeutinnen gemacht“ über ihren Schuldkomplex, der sich zu einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung ausgewachsen hatte, weil sie es als Tochter einer dement gewesenen Mutter nicht geschafft hatte, diese zu pflegen.
In unserer alternden Gesellschaft ist Demenz inzwischen zur Volkskrankheit geworden[1]. Zehntausende von Menschen sehen sich in der Pflicht, ihre dementen Eltern zu Hause zu pflegen. Oftmals vernachlässigen sie ihre eigene Familie, zerreiben sich über viele Jahre zwischen Beruf, ihrem Partner und ihren Kindern sowie ihren fordernden Eltern. Teilweise beginnen die Probleme, bevor die Demenzerkrankung für jedermann sichtbar ist. Kann man Oma noch an der Familienfeier beteiligen, wenn sie wildfremden Gästen „böse Märchen“ über ihre angeblich lieblosen Kinder erzählt?
Das Leben mit einem demenzkranken Elternteil oder Ehepartner hat nicht nur auf die betroffenen Familien meist große psychische, physische, soziale, finanzielle und spirituelle Auswirkungen, sondern ist für die gesamte Gesellschaft eine enorme Herausforderung; auch in rechtlicher Hinsicht. Das habe ich immer wieder in meiner über 40-jährigen Dienstzeit als Richterin erlebt und werde in meinem jetzigen Beruf als Rechtsanwältin beinahe täglich zu diesen Fragen konsultiert.
Den Wenigsten ist die rechtliche Tragweite bewusst, die mit einer schon beginnenden Demenz verbunden sein kann. Keineswegs erschöpft sich das rechtliche Leben mit einer an Demenz erkrankten Person auf das Betreuungsverfahren. Vielmehr stellt das Phänomen Demenz unsere Rechtsordnung insgesamt vor neue Herausforderungen. Schließlich geht unser Recht von einem autonomen, mündigen Bürger aus, dessen Rechtsfähigkeit mit der Geburt beginnt und der systematisch auf ein Leben hingeführt wird, in dem er grundsätzlich für sich allein entscheidet und haftet, wenn er einem anderen Schaden zufügt (§§ 823 ff. BGB). Schon ein sieben Jahre altes Kind gilt i. d. R. als deliktsfähig und haftet nach § 828 BGB für einen von ihm verursachten Schaden; für Schäden im Straßenverkehr, wenn es 10 Jahre alt ist.
Erkrankt ein Mensch an Demenz, scheint vieles – sukzessive – wieder „rückwärts“ zu laufen. Nach und nach verliert er seine Geschäfts- und Testierfähigkeit, seine Deliktsfähigkeit, seine Verkehrsmündigkeit, seine Strafmündigkeit u. v. m.
Andererseits behält ein Mensch mit Demenz seinen starken Grundrechts- und Bürgerrechtsschutz. So behält er sein Wahlrecht (Art. 38 Abs. 2 GG), hat ein Recht auf Verwahrlosung (Art. 1 Abs. 1 GG) und darf nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts durch die Anbringung von Bettgittern und die Fixierung im Stuhl mittels eines Beckengurtes gesichert werden (Art. 2 Abs. 2, 104 Abs. 2 GG). Zudem ist ein demenzkranker Mensch durch die UN-Behindertenrechtskonvention, durch die Europäische Sozialcharta und die Charta der Grundrechte der Europäischen Union geschützt. Schließlich gilt Demenz als geistige Behinderung i. S. d. UN-Behindertenrechtskonvention. Damit eröffnen sich zahlreiche Anspruchsgrundlagen im Sozialrecht, wie etwa im Schwerbehindertenrecht.
Mein Dank gilt zunächst allen, die zu diesem Demenz Rechtsratgeber auf ganzheitlicher Basis beigetragen haben:
■Im Kap. I. schildern Angehörige, Pflegepersonen, Betreuer, Therapeuten, praktizierende Fachärzte und ehrenamtlich Helfende durch Text- und Interviewbeiträge ihre Erfahrungen mit Demenzkranken aus ihrem praktischen Alltag. ■Im Kap. II. werden medizinische Fakten zur Demenzerkrankung von Prof. Dr. med. Karl-Jürgen Bär erläutert. ■In den Kap. III bis XI erläutern anerkannte Fachjuristen die wichtigsten rechtlichen Fragen rund um die Demenz, wobei auch rechtliche Interaktionen von Bezugsbeteiligten berücksichtigt werden, z. B. Regelungen zwischen Angehörigen, Heim und Arzt. ■Im Kap. XII fragt die Pädagogin und Weiterbildungsdozentin Dr. phil. Silke Morche, in welchem Umfang der Persönlichkeitsschutz von demenzkranken Menschen und die rechtlichen Besonderheiten bei Demenz in der (neuen) Ausbildung von Pflegefachkräften berücksichtigt werden. ■Schließlich beschäftigt sich der Kulturphilosoph Prof. Dr. Hans Friesen im Kap. XIII mit der Frage, ob Serviceroboter in Altenpflege und Demenzbetreuung ein Beitrag zu einer menschenwürdigen Pflege im ethisch-moralischen Sinn und im Sinn der UN-Behindertenrechtskonvention sein können.Neben den Autorinnen und Autoren dieses Buches haben auch weitere Fachleute aus Theorie und Praxis mit Rat und Tat geholfen. Auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Namentlich danke ich
Thomas Deharde, Gymnasiallehrer für Englisch und Geschichte sowie Projektleiter für die berufliche Weiterbildung, Fürstenwalde. Er hat viele Kapitel Korrektur gelesen. Dabei hat er stets darauf geachtet, dass die Sprache verständlich blieb, insbesondere kein unverständliches Juristendeutsch verwendet wurde. Das war eine riesige Hilfe.
Dr. sc. med. Bernhard Grindel, Master in Social Medicine and Public Health (WHO), hat nicht nur mit seinem Fachwissen als Arzt immer dann geholfen, wenn medizinische Fragen auftauchten, sondern er hat auch als Ehemann der Herausgeberin mit viel Geduld zum Gelingen dieses Buches beigetragen.
Ergänzend zu diesem Demenz Rechtsratgeber wird die Lektüre der „S3-Leitlinie Demenzen“ empfohlen, die von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie e. V. und der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. herausgegeben wurde und in Abständen aktualisiert wird[2].
Bad Saarow, im September 2024
Die Herausgeberin
Inhalt
Orientierungsmarken
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Anmerkungen
Abkürzungsverzeichnis
AAPV
allgemeine ambulante Palliativversorgung
Abs.
Absatz
AEMR
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
AFG
Arbeitsförderungsgesetz
AG
Amtsgericht
AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen
AGG
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AHundV
Assistenzhundeverordnung
AMVV
Arzneimittelverschreibungsverordnung
Anm.
Anmerkung
AOK
Allgemeine Ortskrankenkassen
APR
Allgemeines Persönlichkeitsrecht
ArbZG
Arbeitszeitgesetz
ASD
Allgemeiner Sozialdienst
BAföG
Bundesausbildungsförderungsgesetz
BAG
Bundesarbeitsgericht
BAK
Blutalkoholkonzentration
BBG
Bundesbeamtengesetz
BBiG
Berufsbildungsgesetz
Beck Online
Juristische Fachdatenbank aus dem Verlag C. H. Beck
BGG
Behindertengleichstellungsgesetz
BeratungshilfeG
Beratungshilfegesetz
BerBiFG
Berufsbildungsförderungsgesetz
BfArM
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
BFDG
Bundesfreiwilligendienstgesetz
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BGHZ
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen
BKat
Bußgeldkatalog
BliHG
Blindenhilfegesetz
BMFSFJ
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
BMG
Bundesministerium für Gesundheit
BSG
Bundessozialgericht
BT-Drucksache
Bundestags-Drucksache
BTHG
Bundesteilhabegesetz
BtMG
Betäubungsmittelgesetz
BuKSchG
Bundeskinderschutzgesetz
BurlG
Bundesurlaubsgesetz
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVG
Bundesversorgungsgesetz
BWahlG
Bundeswahlgesetz
c. i. c.
Culpa in contrahendo (lateinisch: Verschulden bei Vertragsschluss)
DDG
Digitale-Dienste-Gesetz
DGN e. V.
Deutsche Gesellschaft für Neurologie e. V.
DGPPN e. V.
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde
DNotZ
Deutsche Notarzeitung
DSGVO
Datenschutz-Grundverordnung
Dtsch Ärztebl
Deutsches Ärzteblatt
eKFV
Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr (Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung)
EMRK
Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten des Europarats aus dem Jahre 1950
EstG
Einkommensteuergesetz
EU
Europäische Union
FamFG
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
FeV
Fahrerlaubnis-Verordnung
FGG
Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
FLINTA*
Frauen, Lesben, inter-, nicht-binäre, trans- und agender-Personen. Das Sternchen (Asterisk) am Ende soll zusätzlich weitere Variationen der Geschlechtervielfalt einbeziehen.
FPfZG
Familienpflegezeitgesetz
FZV
Fahrzeug-Zulassungsverordnung
GbR
Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts
GdB
Grad der Behinderung
GdS
Grad der Schädigungsfolgen
GewO
Gewerbeordnung
GewSchG
Gewaltschutzgesetz
GG
Grundgesetz
Ggf.
gegebenenfalls
GOA
Geschäftsführung ohne Auftrag i. S. d. §§ 677 ff. BGB
Grüneberg (früher Palandt)
Kommentar zum BGB
GVG
Gerichtsverfassungsgesetz
GVGA
Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher
HPG
Hospiz- und Palliativgesetz
i. w. S.
im weiteren Sinn
IfSG
Infektionsschutzgesetz
JA
Jugendamt
JS
Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft in Strafsachen
Juris
Online-Portal für Rechts- und Praxiswissen in Deutschland
JuS
Juristische Schulung (Zeitschrift)
JuSchG
Jugendschutzgesetz
KRK
UN-Kinderrechtskonvention
LAG
Landesarbeitsgericht
LG
Landgericht
LV
Landesverband
MDR
Monatsschrift für deutsches Recht
MediationsG
Mediationsgesetz
MiLoG
Mindestlohngesetz – Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns
MoPeG
Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz)
MPU
medizinisch-psychologische Untersuchung
MRK
Menschenrechtskonvention
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR
Neue Juristische Wochenschrift – Rechtssprechungsreport Zivilrecht
NSZ
Neue Zeitschrift für Sozialrecht
NZI
Neue Zeitschrift für Insolvenz- und Sanierungsrecht
OEG
Opferentschädigungsgesetz
OLG
Oberlandesgericht
OWiG
Ordnungswidrigkeitengesetz
PflBG
Pflegeberufegesetz
PflBRefG
Pflegeberufereformgesetz, Gesetz über die Pflegeberufe
PflegeArbbV
6. Pflegearbeitsbedingungenverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS).
Pflege-Charta
Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen
PflegeZG
Pflegezeitgesetz
PflStudStG
Pflegestudiumstärkungsgesetz
PflVG
Pflichtversicherungsgesetz
PfWG
Pflege Weiterentwicklungsgesetz
PKH
Prozesskostenhilfe
PKS
Polizeiliche Kriminalstatistik
PSG
Pflegestärkungsgesetz (PSG I, II und III)
r+s
Recht und Schaden (Zeitschrift)
S
Berufungssache gegen Zivilurteil des Amtsgerichts beim Landgericht (Gerichtsaktenzeichen)
S.
Satz
s. o.
siehe oben
s. u.
siehe unten
SAPV
spezialisierte ambulante Palliativversorgung
SchwarzArbG
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
SGB
Sozialgesetzbuch
SGB II
Sozialgesetzbuch II. Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende
SGB V
Sozialgesetzbuch V. Gesetzliche Krankenversicherung
SGB VI
Sozialgesetzbuch VI. Recht der gesetzlichen Rentenversicherung
SGB VIII
Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
SGB IX
Sozialgesetzbuch IX. Soziale Entschädigung
SGB XI
Sozialgesetzbuch XI. Soziale Pflegeversicherung
SGG
Sozialgerichtsgesetz
StGB
Strafgesetzbuch
StPO
Strafprozessordnung
StrRehaG
Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz)
StVG
Straßenverkehrsgesetz
StVO
Straßenverkehrsordnung
StVZO
Straßenverkehrszulassungsverordnung
TOA
Täter-Opfer-Ausgleich
U
Berufung in Zivilprozesssachen beim Oberlandesgericht (Gerichtsaktenzeichen)
UN-BRK
UN-Behindertenrechtskonvention
UN-KRK
UN-Kinderrechtskonvention
V
Verordnung
VersMedV
Versorgungsmedizin-Verordnung mit Anlage „Versorgungsmedizinische Grundsätze“ (VG)
VGH
Verwaltungsgerichtshof
VMG
Versorgungsmedizinische Grundsätze
VVG
Versicherungsvertragsgesetz
WEG
Wohnungseigentumsgesetz
WHO
Weltgesundheitsorganisation
WzS
Wege zur Sozialversicherung (Zeitschrift)
ZDG
Zivildienstgesetz
ZPO
Zivilprozessordnung
I.Schlaglichter Demenz. O-Töne aus dem Alltag beim Leben und Arbeiten mit Demenzkranken
Eine Demenzerkrankung kann jeden Menschen in jeder Bildungs- und Einkommensschicht treffen und verschiedene Ausprägungen haben. Zudem werden ihre Auswirkungen im Alltag oft unterschiedlich wahrgenommen, je nachdem, aus welcher Perspektive man sie erlebt. Ob als Betroffener, Angehöriger, Seelsorger, Arzt, ehrenamtliche, hauptberufliche – ambulante oder stationäre – Pflegekraft, (ehren-)amtlicher Betreuer, Nachbar, Vertragspartner oder Behördenvertreter.
Nach zwei typischen Beispielfällen aus dem Leben, die uns im Buch immer wieder begegnen, berichten Angehörige und Praktiker aus ihrem Alltag beim Leben mit Demenzkranken und den teilweise schwierigen Interaktionen bei der Kooperation mit Ämtern, Kranken- und Pflegeversicherungen. Leider mussten wir viele Beiträge aus Platzgründen – teilweise erheblich – kürzen.
1.Zwei Beispielfälle aus dem Leben, die uns durch das Buch begleiten
1.1Schleichende Alzheimer-Demenz eines pensionierten Studiendirektors
Immer wieder berichten Ehepartner und Kinder über ein „Adieu auf Raten“, wenn eine Demenzerkrankung schleichend verläuft, wie die Alzheimer-Demenz beim pensionierten Studiendirektor Dr. Eberhard Fischer.
■
Stufe 1 leichte Demenz: Vergesslichkeit, erste Defizite bei der örtlichen und zeitlichen Orientierung, erste Schwierigkeiten im Alltag. Dr. Fischer kann noch arbeiten und Auto fahren.
■
Stufe 2 mittelgradige Demenz: Gedächtnisaussetzer, motorische Schwächen beim Ankleiden, Körperpflege, Nahrungsaufnahme. Häufige, abrupte Stimmungswechsel bis hin zu aggressivem Verhalten. Dr. Fischer entwickelt einen Bestehlungswahn, lässt deshalb niemanden mehr in seine Wohnung, vernachlässigt seine Körperpflege, seine Wohnung verkommt zur „Messiwohnung“.
■
Stufe 3 schwere Demenz: Angewiesensein auf eine dauerhafte, unterstützende Begleitung, Betreuung und Pflege. Nahe Angehörige werden oft nicht mehr erkannt. Die Sprache ist auf wenige Wörter reduziert. Einweisung ins Krankenhaus und Pflegeheim. Anregung einer amtlichen Betreuung. Umstellung von Verträgen.
Herr Dr. Fischer wird als Protagonist während der Stufen seiner Demenz durch diesen Rechtsratgeber begleitet.
1.2Schockstarre nach Schicksalsschlag: mittelgradige geistige Behinderung einer verwitweten, alleinerziehenden berufstätigen Mutter nach Unfall[3]
Die verwitwete berufstätige Mutter Lena Schneider erleidet bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. In der Folge entwickelt sich eine mittelgradige geistige Behinderung. Sie ist nicht mehr in der Lage, sich und ihre beiden minderjährigen Kinder selbstständig zu versorgen, insbesondere die Personen- und Vermögenssorge für ihre Kinder zu übernehmen, und ihren Beruf auszuüben.
2.Diagnose Demenz – aus dem Alltag der psychiatrischen Arztpraxis
Wir beginnen mit Berichten der beiden Fachärztinnen Dr. Sabine Müller und Ruth Chudaska aus dem Praxisalltag, wo eine Demenzerkrankung i. d. R. zuerst festgestellt wird. Die „medizinischen Fakten zur Demenzerkrankung“ (Krankheitsbilder, Statistiken) sind in Hauptkapitel II. von Prof. Bär zusammengefasst.
2.1Demenz – eine unendliche Geschichte.
VonDr. med. Sabine Müller, Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie i. R.
Jeder Laie meint, darüber Bescheid zu wissen. Ich behaupte, es gibt so viele Demenzen wie es Betroffene gibt.
Schon der Beginn hat viele Variationen. Der Verlauf wird am besten von den Angehörigen und den Pflegepersonen beschrieben. Hier ist ein Unterschied zwischen Stadt und Land im Umgang und der Handhabung der dementen Angehörigen. Im ländlichen Bereich finden sie sich besser zurecht und haben noch einfache Beschäftigungen, z. B. mit Haustieren, die ihnen emotional guttun. Im hektischen Großstadtmilieu und den verwirrenden, teils betrügerischen Angeboten sind auch noch nicht Demente oft überfordert.
Ob früher oder später Beginn, am Ende läuft alles auf eine gemeinsame Endstrecke hinaus mit den bekannten Ausfällen des Gedächtnisses, des Denkens, sowie der erlernten Fähigkeiten, z. B. Schreiben oder feinere Handarbeiten wie Nähen. Auch frühere Routinearbeiten bspw. Kochen oder Körperhygiene und Bekleiden werden zunehmend beeinträchtigt. Dabei spielt es aber immer eine Rolle, welche hervorstechenden Charaktereigenschaften der Betroffene prämorbid hatte. Dadurch werden die Demenzsymptome modifiziert. In abgeschwächter Form beobachtet man im Laufe eines Lebens eine Zuspitzung von Charaktereigenschaften. Aus Sparsamkeit wird Geiz, aus Ordnungsliebe Zwanghaftigkeit und aus Misstrauen und Ängstlichkeit Bestehlungswahn, was für Angehörige oder fremde Pflegepersonen sehr belastend ist. Seltener ist der Ungezieferwahn, der zunächst Ärzte und Hygiene beschäftigt, bis die Diagnose klar ist.
Hier ist schon die Grenze zu psychiatrischen Erkrankungen. Wahnerkrankungen müssen aber nicht mit Demenz einhergehen. Sie sind chronisch und nur schwer medikamentös zu beherrschen. Für diese schwierigen Fälle ist die Gerontopsychiatrie zuständig, eine Unterabteilung der Geriatrie oder Psychiatrie.
Eine Form der vorübergehenden Demenz konnte ich beobachten bei Patienten nach einer großen Narkose. Die Patienten wurden nach einer schweren OP mit der Zusatzdiagnose Demenz entlassen, was mich sehr verwunderte. Waren sie doch vor der OP noch völlig orientiert.
Oder bei einer Patientin mit einer schweren Kohlenmonoxidvergiftung und einem Patienten mit einer wochenlangen unbemerkten Auspuffgasinhalation.
Sie alle zeigten typische Demenzsymptome, die monatelang anhielten und bei denen schon eine gerichtlich angeordnete Betreuung vorgesehen war.
Am wenigsten bekannt ist die emotionale Demenz, also Ausfälle im Gefühlsbereich. Sie sind den bestürzten Kontaktpersonen nicht erklärbar. Man kann nicht immer von der prämorbiden Persönlichkeit und ihrer Vergangenheit auf die späteren Persönlichkeitsveränderungen schließen. Beschimpfungen und Ablehnung der Angehörigen nehmen diese oft persönlich, obwohl sie die einzigen sind, die sich um die betreffende Person kümmern. Es kann plötzlich auftretender Hass oder Abwehr zu den zuvor geliebten Menschen die Atmosphäre in den Familien vergiften. Die Dunkelziffer von früheren unbewältigten Konflikten dürfte hoch sein. Die völlig ratlosen und sich keiner Schuld bewussten Angehörigen sind damit alleingelassen. Das ist schwerer zu ertragen als die pflegerische Tätigkeit selbst.
Von dem früher sehr sozialen liebevollen Menschen ist später nicht immer eine freundliche, pflegeleichte Demenz zu erwarten.
Natürlich gibt es auch positive emotionale Entwicklungen bei Dementen. Sie werden milder und Konflikte werden einfach vergessen.
Die Verkennung der Angehörigen als Fremde ist dagegen durch das erloschene Gedächtnis leichter zu verstehen. Mit Verständnis und mit Langmut, auch mit einer Portion Humor findet man sich damit ab, dass man jeden Morgen als neuer Besucher freundlich begrüßt wird.
Günstig wirkt sich bei der Betreuung von Dementen aus, dass sie in ihrer Schulzeit Gedichte und Lieder auswendig gelernt haben. Über diese emotional im Gehirn gespeicherten Erinnerungen sind sie meist noch gut ansprechbar. Gegenwärtig kommen durch die Kriege in der Welt eigene Erlebnisse und Ängste hoch, und schwere Traumatisierungen werden wieder geweckt, die sich in nächtlicher Unruhe und depressiven Verstimmung äußern können.
Eine Sonderform der psychischen Veränderung gibt es bei Sterbenden in den letzten Lebenswochen oder -tagen. Die vorher noch harmonische voll orientierte Persönlichkeit ist plötzlich wie ausgetauscht. Ohne erkennbaren Anlass, z. B. einer organischen Gehirnerkrankung ist da plötzlich eine dämonische böse Persönlichkeit in dem schwachen Körper, die laut schreiend mit den schlimmsten Schimpfworten gezielt auf die liebsten Angehörigen um sich wirft. Eine Erklärung dafür sei ein gestörter Hirnstoffwechsel. Aber ist das ausreichend?
In dem Umkreis meiner Gleichaltrigen um die 80 Jahre, aber auch schon von Jüngeren, werde ich oft mit der bangen Frage konfrontiert, ob denn auch Demenz bei ihnen wie bei den Eltern auftreten könnte? Dazu können sich am besten Geriater äußern, die über lange Beobachtungszeiträume, eine gezielte Diagnostik und statistische Ergebnisse verfügen.
Ich habe die verschiedensten Beobachtungen in meiner Praxis für Neurologie und Psychiatrie machen können und kann keine Prognosen stellen.
Sicher ist der Bildungsstand, das Temperament, Bewegungsfreudigkeit, musikalische Aktivitäten und der Kontakt mit der Natur von Bedeutung und ein gewisser Schutz vor der Altersdemenz. Ich kenne aus meiner Praxis jedenfalls keinen Landwirt, Förster, Gärtner oder Imker mit Demenz. Der Motor eines jeden Menschen ist der Wille, der sich schon im Kleinkindalter zeigt und in jedem Lebensalter vom ICH gesteuert wird. Neue Aktivitäten im Alter probieren oder alte Hobbys wieder aufnehmen, Kontakte halten und seinen Tagen eine Struktur geben. Das sind so allgemeine gute Ratschläge. Eine große Hilfe ist für alte Menschen auch der gezielte Umgang mit Medien. Meine alte Mutter wollte ihren „Hausfreund“ den Fernseher und die Hirntrainingsgruppe im Heim nicht vermissen und ich, in der nächsten Generation, nicht den Umgang mit dem Internet und dem Chor.
Ausblick
Der Vorteil der alten gegenüber der jetzigen jungen Generation ist nach meiner Meinung, dass sie sich in der Kindheit alles über Augen, Ohren, Hände, Nachahmen und Fantasie, sozusagen lebendig dreidimensional erarbeiten konnten. Dadurch haben wir gespeicherte Erfahrungen und Wissen, mit dem wir die Angebote aus dem Internet kritisch beurteilen und auswählen können.
Der Neurowissenschaftler und Psychiater Prof. Dr. Manfred Spitzer[4], hat sich mit dem medialen Konsum der kleinen Kinder beschäftigt und erschreckende Erkenntnisse gemacht. Durch das vor dem Bildschirm-Sitzen und die Bewegungsarmut, die fehlende Kommunikation mit echten Gegenübern und emotionalen Erfahrungen bleibt ein Lerneffekt fürs Leben unterentwickelt. Das Lernen über die Mattscheibe und nicht über alle Sinne hat bereits nachweisbar zu Veränderungen im kindlichen Gehirn geführt. Er sieht eine frühe „digitale Demenz[5]“ auf sie zukommen.
Die Auswirkungen bekommen wir schon heute zu spüren.
Meine persönliche Anmerkung: Die einzige Abhilfe ist, die junge Generation zum Lernen und zum Durchhalten zu motivieren, also Millionen, statt für Waffen für die Bildung auszugeben.
2.2Gesichter der Demenz
VonRuth Chudaska, Fachärztin für Psychiatrie
Es gibt nicht „DIE Demenz“, sondern viele Demenzen. Diese unterscheiden sich nicht nur aufgrund der Art der Entstehung und der klinischen Differenzierung, sondern auch ganz maßgeblich dahingehend, wie diese vielfältige und vielgesichtige Erkrankung auf die im Leben geprägte Grundpersönlichkeit trifft und wie Betroffene und Umwelt damit umgehen. Fünf unterschiedliche (anonymisierte) Fälle stelle ich aus meiner Praxis vor:
Fallbeispiel 1: Blackout nach dem Nagelstudio. Die Nachbarin mit vaskulärer bzw. gefäßbedingter Demenz (Arteriosklerose)
… Die Nachbarin läuft nur in Unterhose und BH bekleidet, barfuß durch den Garten, ihre Kleidungsstücke und die Schuhe sind über das gesamte, große Grundstück verteilt. … Sie wirkt bei der ersten Ansprache ängstlich und desorientiert und versucht vergeblich, ihre Kleidungsstücke wieder einzusammeln und anzuziehen, was ihr aber nicht gelingt. Bei der Frage, was denn mit ihr los sei, erzählt sie freimütig, sie wisse nicht, wie sie nach Hause gekommen sei. Die letzte Erinnerung sei, dass sie vormittags mit dem Fahrrad in der Stadt beim Nagelstudio gewesen sei, aber sie könne sich nicht erinnern, wo das Fahrrad abgeblieben ist und vor allem habe sie Angst, weil sie ihre Handtasche mit allen Papieren und der Geldbörse im Fahrradkorb gelassen habe. Sie wisse auch nicht, wann sie das Nagelstudio wieder verlassen habe und welchen Weg zurück aus der Stadt sie gegangen sei. Sie wisse aber noch, dass sie ihr Fahrrad geschoben habe.
Gleichzeitig versucht sie vergeblich, Hose und Schuhe wieder anzuziehen, was ihr aber misslingt, weil sie sich vergeblich bemüht, beide Beine gleichzeitig in ein Hosenbein zu stecken und zudem simultan die Schuhe anzuziehen. „Ideatorische Apraxie“. …
… Es beruhigt Frau Ullrich etwas, als sie mitbekommt, dass ihre Tochter gleich kommen wird und den Ersatzschlüssel für die Wohnung mitbringt. In der Zeit bis zum Eintreffen der Tochter wird behutsam versucht, die Geschehnisse bis zum aktuellen Zeitpunkt zu rekonstruieren, um Schadensbegrenzung zu betreiben und das Fahrrad mitsamt Tasche möglichst schnell wiederzufinden. …
Das ist eine typische klinische Konstellation bei sogenannten vaskulären, das heißt gefäßbedingten Demenzen. Diese treten meist auf, wenn zusätzliche Zivilisationserkrankungen, vor allem Übergewicht, Diabetes mellitus Typ 2 und oft auch Bluthochdruck gleichzeitig vorhanden sind. Im Laufe des Lebens kommt es auf dieser Basis zunehmend zu Gefäßveränderungen, die in der früheren Nomenklatur als „Arteriosklerose“ bezeichnet wurden.
Fallbeispiel 2: Senior Schulzes „Feldzug“ durch das Verkehrsrecht als Pkw-Fahrer mit fortgeschrittener Alzheimer-Demenz
Verursachung von Blechschaden mit Pkw auf Supermarkt-Parkplatz. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Polizeiliche Sicherstellung von Führerschein und Pkw-Schlüssel. Versuchter Neukauf eines Pkws mit Abschluss eines Kredit-Vertrages
Symptome einer zunehmenden Demenz; Vergesslichkeit, Wesensveränderung wie „Altersstarrsinn“, Fehlhandlungen.
(Einzelheiten s. Kap. X 8.5. Rechtliche Fragen bei Demenz im Verkehrs-, Bußgeld- und Strafrecht.)
Fallbeispiel 3: „Drama im Schlafzimmer“: die frontotemporale Demenz und Umgang mit Wahninhalten Eifersuchtswahn, Bestehlungswahn
Herr Heinrich ist 86 Jahre alt und für sein Alter sowohl optisch als auch im Hinblick auf die Gedächtnisleistungen auf den ersten Blick bemerkenswert agil. Aber: der erste Eindruck täuscht. Er macht seiner Frau heftige Vorwürfe, dass sie sogar in seiner Gegenwart, vor allem nachts, den Besuch fremder Männer im ehelichen Schlafzimmer nicht nur duldet, sondern noch aktiv befördert. Er habe ganz eindeutig gesehen, dass sich auch in der letzten Nacht wieder fremde Männer in dem ehelichen Schlafzimmer aufhielten und seine Frau habe ganz freiwillig in seiner Gegenwart mit diesen Männern Geschlechtsverkehr gehabt und habe sich von ihm davon nicht abhalten lassen. Sie seien ja jetzt schon über ein halbes Jahrhundert verheiratet und stünden kurz vor der diamantenen Hochzeit, aber einen solchen Verrat habe er ihr nicht zugetraut. Er werde daher die Konsequenzen ziehen und gleich am Folgetag einen Termin beim Scheidungsanwalt vereinbaren. Das werde er sich nicht von ihr bieten lassen. Alle Beteuerungen von Frau Heinrich, dass dies nicht den Tatsachen entspreche, verhallen – von ihm ungehört. Im Gegenteil, je mehr sie das dementiert und letztlich anfängt, verzweifelt zu weinen, desto wütender wird er und bezichtigt sie, die Unwahrheit zu sagen und ihn nur über ihre Untreue hinwegtäuschen zu wollen.
Was hier sehr dramatisch klingt, ist es in der Realität leider auch. Dieses Krankheitsbild mit massivem Eifersuchtswahn und szenischen Halluzinationen hat sich in der Realität als frontotemporale Demenz herausgestellt, die im Wesentlichen weniger durch den Verlust der Gedächtnisfähigkeiten und der körperlichen Beweglichkeit imponiert, sondern durch eine gravierende Wesensveränderung. Selbst vor Beginn der Erkrankung gutmütige und liebenswerte Menschen können sich auf diese Weise leider sehr negativ entwickeln. Diese Demenzform ist praktisch unbehandelbar. Es gibt keine Behandlungsmöglichkeiten. Lediglich kann durch vorsichtige Gabe von Psychopharmaka, die Stimmung und Antrieb verbessern, versucht werden, die Auswirkungen zu minimieren. Eines der wesentlichen, aber nicht ausschließlichen Symptome dieser Demenzform sind optische Halluzinationen, die sehr lebhaften und szenischen Charakter annehmen können, sodass die Patienten sie für völlig real halten. Akustische Halluzinationen, (also Sinnestäuschungen), können ergänzend hinzukommen, sind aber nicht zwingend vorhanden. Allein die Vorstellung der oben genannten Inhalte reicht bei einem organisch bedingten Eifersuchtswahn, um diesen vermeintlichen Film, den die Patienten, wie gesagt für reale Erlebnisse und Wahrnehmungen halten, auch ohne Ton – quasi als Stummfilm – für unwiderlegbare Beweise zu halten. Während akustische Halluzinationen überwiegend bei Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis typisch sind, sind optische Halluzinationen, also Trugwahrnehmungen, charakteristisch für hirnorganische Veränderungen. Sie sind zwar nicht allein beweisend, aber doch richtungsweisend, um die Diagnose einer frontotemporalen Demenz zusammen mit anderen typischen Eigenschaften stellen zu können. Für die Angehörigen sind sie meist besonders belastend, weil sie sich ungerechtfertigten Anschuldigungen ausgesetzt sehen und fühlen, obwohl sie eigentlich alles dafür tun, um es ihren Angehörigen möglichst gut gehen zu lassen.
Generell sind Wahninhalte nicht nur für frontotemporale Demenzen typisch, sondern auch für alle anderen Demenzformen, auch wenn sie dort nicht so häufig auftreten.
Ein weiteres, sehr bekanntes Beispiel für wahnhafte Inhalte im Rahmen einer Demenz ist der Bestehlungswahn, der nicht nur innerhalb der Familie oder gegenüber Pflegediensten geäußert wird, sondern auch schon zahllose Polizeieinsätze wegen vermeintlich verschwundenen Eigentums ausgelöst hat. Dieser kann nicht nur dadurch ausgelöst werden, dass die Betroffenen selbst Gegenstände verlegen und sich nicht erinnern können, wo sie diese hingetan haben, sondern auch durch ganz ausschließliche Wahnwahrnehmungen. Dabei ist es wie beim sonstigen Wahn auch typisch, dass solche Wahrnehmungen von außen nicht korrigierbar sind. Die Betroffenen sind völlig davon überzeugt, dass sie betrogen, bestohlen und übervorteilt werden. Es ist dann häufig zu erleben, dass die Angehörigen oder Freunde anfangen, dagegen zu argumentieren, weil sie sich keiner Schuld bewusst sind und sich zu Unrecht angegriffen fühlen, was den entsprechenden Streit bis zum unwiderruflichen Zerwürfnis steigern kann. Hier gibt es keine Patentlösung, außer der stetigen Erinnerung daran, dass es sich um krankhafte Prozesse im Rahmen der Demenz der Angehörigen handelt und diese keinen Bezug zur Realität haben.
Fallbeispiel 4: „Frau Doktor, heute habe ich nur ganz kurz Zeit, weil ich mich mit meiner Freundin in der Stadt zum Shoppen verabredet habe.“ Heilung von einer Pseudodemenz
Frau Neumann, eine ältere Patientin, nimmt im ärztlichen Wartezimmer wortlos Platz. Sie wirkt schon auf den ersten Blick sehr deprimiert und niedergeschlagen. Die Körperhaltung ist gebeugt. Sie wirkt verhärmt und belastet. Die Stimme ist sehr leise, verzagt und klagend. Sie berichtet über anhaltende und in letzter Zeit drastisch zunehmende Gedächtnisstörungen, aber auch über Probleme in der Familie, Einsamkeit und wirtschaftliche Schwierigkeiten wegen einer sehr geringen Rente. Sie schlafe schlecht und nicht durchgängig und habe nur wenig Appetit. Daher habe sie auch schon ungewollt 10 kg an Gewicht abgenommen. Eine konsumierende Erkrankung, wie eine Krebserkrankung sei aber schon von ihrem Hausarzt abgeklärt und ausgeschlossen worden. Im körperlichen Bereich seien nach dessen Information keine Gründe für diese Symptomatik vorhanden, er habe ihr aber den Besuch beim Psychiater empfohlen. … Manchmal habe sie einfach auch keine Lust mehr, zu leben, weil das mit zunehmendem Alter so beschwerlich geworden sei. Auf Nachfrage verneint sie aber aktive Todeswünsche und Suizidideen. Sie habe nur in letzter Zeit öfters keinen Sinn mehr im Leben gesehen.
Im weiteren empathischen Gespräch zeigt sich eine mittelschwere, tendenziell schwere Depression mit den typischen Symptomen des Verlustes der Fähigkeit, sich zu freuen (Anhedonie), Antriebsmangel und Schlafschwierigkeiten, sodass sie sich am Tag nicht mehr leistungsfähig fühlt und auch ihren Haushalt kaum noch schafft. Neben der rein psychiatrischen Diagnostik erfolgt auch eine zusätzliche Laboruntersuchung, bei der neben den Routineparametern wie dem kleinen Blutbild auch Vitamin B12 und die Schilddrüsenwerte bestimmt werden. Wenn hier ein Mangel oder schon eine Anämie oder eine Schilddrüsenunterfunktion bestehen, können auch Symptome mit Gedächtnisproblemen und Antriebsmangel auftreten, die einer Demenz täuschend ähnlich sehen, aber gut behandelbar sind. Da diese Werte bei Frau Neumann aber im Normbereich waren, konnten wir uns im zweiten Termin auf die rein psychiatrische Problematik fokussieren. Sie erhielt ein geeignetes Antidepressivum, das gerade für alte Menschen optimal ist, weil … Frau Neumann … sprach schon ab einer mittleren Dosierung gut auf die Wirkung an und fühlte sich von Termin zu Termin wohler. Das Gedächtnis hatte sich nicht nur subjektiv, sondern objektivierbar gebessert, auch die Stimmung war erfreulich aufgehellt. Sie war emotional wieder schwingungsfähig und nicht wie „eingefroren“. Sie konnte auch wieder gut schlafen. Den besten Beweis für die Wirksamkeit der Behandlung lieferte sie eines Tages fast unfreiwillig, als sie gut gelaunt vermerkte: „Frau Doktor, heute habe ich nur ganz kurz Zeit, weil ich mich mit meiner Freundin in der Stadt zum Shoppen verabredet habe. Ich brauche mal wieder frischen Wind im Kleiderschrank“ – und weg war sie. …
Das beschriebene Phänomen der gesteigerten Vergesslichkeit bei schweren Depressionen nennt man „Pseudodemenz“. Vieles scheint für das Vorliegen einer „echten“ Demenz zu sprechen, aber es ist im engeren Sinn keine.
Fallbeispiel 5: Schusseligkeit im Alltag
Manchmal fragen auch jüngere Menschen: „Ich habe in letzter Zeit den Eindruck, als würde ich alles vergessen. Ich drehe mich um und der Wagenschlüssel ist weg. Ich spreche mit Kunden über einen wichtigen Auftrag und kurze Zeit später habe ich die wichtigsten Inhalte schon wieder vergessen. Habe ich jetzt eine Demenz???“ Nein! Zu Ihrer Beruhigung: haben Sie nicht. Sie haben möglicherweise beruflichen Stress, sind chronisch überfordert, versuchen, zu viel in zu kurzer Zeit zu erledigen und Multitasking zu betreiben. Es kann auch sein, dass Ihr Zeitmanagement unzureichend ist und Sie mit den … Gedanken schon bei der nächsten Aufgabe sind, bevor die vorhergehende abgeschlossen ist.
(Anmerkung: Die sehr ausführliche fachliche Erklärung konnte aus Platzgründen leider nicht abgedruckt werden.)
3.Adieu auf Raten – Angehörige zwischen grenzenloser Erschöpfung und grenzenloser Trauer
Viele Menschen kommen mit der Demenz-Erkrankung ihres Angehörigen nicht zurecht. Die Herausgeberin dieses Demenz Rechtsratgebers hat während ihrer Studienzeit häufig als Hilfskraft in einem Seniorenpflegeheim in Stuttgart erlebt, wie erwachsene Kinder in teilweise hohen Positionen von Weinkrämpfen geschüttelt vor der Tür ihrer Mutter oder ihres Vaters standen. „Das soll meine Mutter sein?“ Zu diesen Fällen gehörte ein bekannter Ost- und Russlandexperte, der zahlreiche Bestsellerbücher geschrieben hatte. Seine Mutter, eine emeritierte Mathematikprofessorin, hatte wieder mit Kotkugeln nach ihm geworfen und unter Nutzung schlimmster Schimpfworte gebrüllt: „Hauen Sie nur ab und lassen sich nie wieder blicken.“
Die Betreuung von Demenzkranken hat auf Angehörige oft große psychische, physische, soziale, finanzielle und spirituelle Auswirkungen. Stützende und beratende Gespräche können für die Gesundheit von Angehörigen, für die Beziehung zum Demenzkranken sowie zur besseren Behandlung des Patienten beitragen. Leider aber finden pflegende Angehörigen oft keine emotionale Unterstützung in ihrem sozialen Umfeld, geraten gar in eine soziale Isolation. Kinder leiden zuweilen ein Leben lang unter Schuldgefühlen, weil sie es nicht ausgehalten haben, ihre demente Mutter oder ihren dementen Vater in einem „so unwürdigen und hilflosen Zustand“ zu erleben und den Kontakt abgebrochen haben. Immer wieder berichtet die Presse von extremen Verzweiflungstaten allein gelassener Angehöriger.[6]
Eindrucksvoll beschreibt Susanne Juhnke, die Witwe von Harald Juhnke, ihr Adieu auf Raten in dem Buch: Was bleibt, ist die Liebe: Wie ich meinen Mann an das Vergessen verlor. Erinnerungen an Harald Juhnke. Harald Juhnke, Volksschauspieler, Entertainer und Sänger, starb am 1. April 2005 mit 75 Jahren in einem Heim für Demenzkranke im engsten Familienkreis.
Weitere Berichte von Angehörigen findet man auf der Website der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft[7]. Besonders beeindruckend das Gedicht „Zu Zweit und doch allein“ nach 54 Ehejahren von Wera Heinert.
Eigens für diesen Rechtsratgeber Demenz berichten Angehörige, wie sie die Zeit der Pflege bewältigen und nicht bewältigen konnten. Wir sind als Redaktion dankbar für diese erschütternden Berichte, die einen Blick für die menschliche Dimension eröffnen, über die andere, oft fremde Menschen – in juristischen Dimensionen – Entscheidungen zu treffen haben.
3.1Mein Mann sagte, er suche einen Bahnhof, von dem aus er einen Zug zu seinem Elternhaus fände
Hildegard Mackeüber den schleichenden Abschied von ihrem an Parkinson-Demenz erkrankten und verstorbenen Mann Peter Macke
Prof. Dr. Peter Macke war Präsident des Brandenburgischen Oberlandesgerichtes und Präsident des Verfassungsgerichts des Landes Brandenburg (jeweils von 1993 bis 2004) sowie Präsident des Deutschen Verkehrsgerichtstages (1997–2003).
„2004 ging mein Mann in den Ruhestand. Er behielt in Brandenburg seine kleine Wohnung und unterrichtete Rechtskunde an der Fachhochschule Brandenburg, bis sich seine Krankheit bemerkbar machte. Die typischen Anzeichen einer Parkinson Erkrankung kommen schleichend über Jahre und sind irreparabel.
2012 verabschiedete er sich von seinen Kollegen am Oberlandesgericht und der Fachhochschule und zog ganz zurück in unser Haus in Bretten in Baden-Württemberg. Die Krankheit machte sich trotz fachärztlicher Behandlung mit Medikamenten, Physiotherapie, Ergotherapie, Gymnastik usw. stärker bemerkbar. Hinzu kamen psychische Veränderungen. Sein Arbeitswille war aber ungebrochen. Seine Verehrung für Friedrich den Großen ließ ihn nicht los. Er verfasste noch zwei Broschüren. Ein verständnisvoller Bekannter tippte die kaum leserliche Handschrift. Die Ausfallerscheinungen, die seine Krankheit mit sich brachten, wurden immer stärker, ebenso die körperlichen Einschränkungen. Die Halluzinationen nahmen zu, ebenso der gestörte Tag- und Nachtrhythmus. Ich musste uns einschließen, denn er lief oft weg und drohte mit Selbstmord. Medizin, Fachärzte und Rehaklinik Aufenthalte verzögerten nur langsamer den typischen Krankheitsverlauf.
Ich versuchte immer in seiner Nähe zu sein. So konnte ich einige Ausfallerscheinungen mildern oder verhindern. Manchmal war er sehr verwirrt und aggressiv. Ein anderes Mal konnte er folgerichtig denken und machte bei Kollegen und Arztbesuchen einen gesunden Eindruck.
Am 6. November 2013 lief mein Mann mir wieder einmal fort. Er sagte, er suche einen Bahnhof, von dem aus er einen Zug zu seinem Elternhaus fände. Beim Laufen konnte er nicht mehr abstoppen (Propulsionstendenz), stolperte und schlug mit der Stirn auf den Bürgersteig. Nach einer Woche Intensivstation riet man mir, ein Pflegeheim für meinen Mann zu suchen. Mein Mann hatte inzwischen die Pflegestufe 3 (das entspricht heutzutage dem Pflegegrad 5). Die Diagnose war Parkinson Rigor (Steifheit, schlurfender Gang, Maskengesicht, monotone Sprache, depressive Grundstimmung, Apathie, Schluckstörung (Dysphagie), Bewegungslosigkeit (Akinesie) usw).
Im Pflegeheim baute er körperlich immer weiter ab, obwohl ich ihn zwei Mal täglich zu den Mahlzeiten besuchte und ihn danach im Rollstuhl spazieren fuhr. Er nahm nichts mehr wahr, lag im Bett bewegungslos, erkannte seine Familie nicht mehr und sprach auch kein Wort mehr. Am 17. September 2014 schlief er im Beisein seiner Kinder einfach ein.
Nach 50 Ehejahren, und davon etlichen mit Wochenendpendeleien, hätte ich mir zwar einen schöneren Lebensabend gewünscht, aber bei der Erkrankung war ein Abschied voraussehbar. Wie ich damit zurechtgekommen bin? Da mein Mann in seinem aktiven Berufsleben viel unterwegs war, wir teilweise sogar eine Wochenendehe geführt haben, habe ich früh begonnen, mir eigene Standbeine aufzubauen. Als Lehrerin für Sport und Kunst habe ich in meiner Freizeit in Bretten eine Jugendkunstschule gegründet und junge Menschen an die Kunst geführt. Schon 1994 habe ich mich erfolgreich an der Bürgerinitiative gegen den geplanten „Müllglühofen“ Bretten beteiligt, und später am Protest gegen die menschenverachtende Fehlplanung des Bauvorhabens „Am Knittlinger Berg” in Gölshausen. Außerdem war und bin ich in zahlreichen Vereinen ehrenamtlich tätig, wie etwa im „DAF-Internationaler Freundeskreis Bretten e. V.“, Kunstverein Bretten und im Freundeskreis Asyl. Als mein Mann erkrankte, war ich also schon gut in der Bevölkerung der Stadt Bretten eingebunden. Das hat mir während der Zeit seiner Pflege und nach seinem Tod sehr geholfen.
Ich kann jedem, der einen kranken, insbesondere einen dementen Partner pflegt, nur dringend raten, sich selbst Freiräume zu schaffen. Nur dadurch kann man sich die Stärke erhalten, die man für die Pflege des Partners, aber auch für andere Aufgaben, wie etwa für Kinder und Enkel, benötigt.“
Hildegard Macke, Bretten
3.2Letztlich habe ich drei Therapien bei drei Therapeutinnen gemacht
Eine Juristin berichtet über ihre posttraumatische Belastungsstörung als Tochter einer dement gewesenen Mutter.
Ende der 1980er-Jahre erkrankte meine Mutter an Morbus Pick, heute als frontotemporale Demenz bezeichnet. Erst die Untersuchung in der Uniklinik brachte Gewissheit. Am 6. September 1997, am Tag der Trauerfeier für Prinzessin Diana, legte man ihr eine Magensonde für die künstliche Ernährung. Im März 2005 verstarb sie.
Mein Vater erkrankte Ende der 1960er-Jahre erstmals an einer Depression. Als ich etwa 12 Jahre alt war, habe ich erlebt, dass er nicht in der Lage war, morgens aufzustehen. Die Depressionen blieben sein Leben lang. Meine Leistungen in der Schule ließen nach. Die 10. Klasse absolvierte ich dreimal. Das dritte Mal habe ich dem Einsatz einer Lehrerin zu verdanken. Das Abitur schaffte ich nur, indem ich Mathematik abwählte. Zum Studium zog ich in eine andere Stadt und besuchte nur selten meine Eltern, vor allem wegen der Krankheit meines Vaters, die mich sehr belastete und runterzog.
Als die Krankheit meiner Mutter diagnostiziert wurde, suchte ich einen Spezialisten für Demenzerkrankungen im Max-Planck-Institut der Universität auf, um mich über die Krankheit aufklären zu lassen. Damals ging ich auch in eine Selbsthilfegruppe und traf mich einmal mit einer Frau, deren Vater auch diese Krankheit hatte.
Das Verhältnis zu meiner Mutter war eher schlecht gewesen. Sie war überfordert, hat mich als Kind geschlagen und mich mit Schweigen bestraft. Ironie des Schicksals: Bei dieser Demenz verliert man sein Sprachvermögen. Bisweilen litt ich an Stressübelkeit