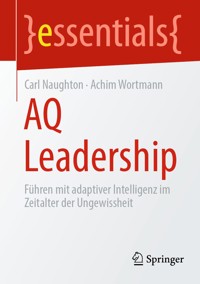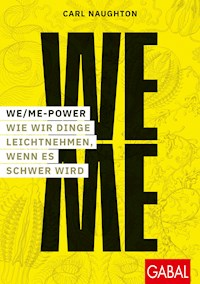Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GABAL
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Dein Leben
- Sprache: Deutsch
Während Sie denken, dass Sie denken, denkt Ihr Gehirn, was es will. Es nutzt bekannte Denkmuster und manövriert Sie mit besorgniserregender Zuverlässigkeit in Denkfallen. Nur wenn Sie wissen, wie Ihr Autopilot im Kopf funktioniert, und nur wenn Sie die Denkfallen kennen, können Sie besser denken. Es gibt nur drei Dinge, die Sie tun können: wissen, wie der Autopilot im Kopf funktioniert, bekannte Denkfallen kennen und die richtigen Denktools nutzen. Dieses Buch bietet Ihnen alles drei – fundiert, unterhaltsam und spielerisch. Ein spannendes Sachbuch und Denktraining, prall gefüllt mit Beispielen und Lösungen für besseres Denken. Wissenschaft zum Anfassen und Anschauen und in unseren Denkalltag transferiert. Nur denken müssen wir dann noch selbst. ;-)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort von Gregor Staub
»Überlegen macht überlegen.«
Antoine de Saint-Exupéry
Der Verstand ist die am gerechtesten verteilte Sache der Welt: Niemand beschwert sich, dass er zu wenig davon hat! Jetzt im Ernst: Wussten Sie, dass Sie nicht nur Ihr Gedächtnis, sondern Ihr ganzes Denken optimieren können? Dass Ihr eigener Verstand Ihnen beibringen kann, noch wirksamer zu denken?
Nach über 20 Jahren als Gedächtnistrainer, in denen ich mit vielen Tausend Menschen aller Altersstufen gearbeitet und trainiert habe, weiß ich eines ganz sicher: Sein Gehirn kann man trainieren. Insbesondere das Langzeitgedächtnis zu trainieren, ist enorm effektiv. Da kommt es auf die richtige Technik an – nicht auf den IQ! Das von mir entwickelte Mega memory® ist so eine Technik. Sie basiert auf griechischen Mnemotechniken aus der Antike. Weil das Lernen damit auch noch enorm viel Spaß macht, wird es umso leichter. Dies steigert die Lebensqualität in jeder Lebensphase – und schafft Lebensfreude! Nachdem meine Methoden inzwischen von vielen Tausend Anwendern erfolgreich praktiziert werden, freue ich mich umso mehr, dass Dr. Carl Naughton mit dem vorliegenden Buch nun auch eine Anleitung an die Hand gibt, mit der das Denken ebenso gezielt gefördert werden kann wie das Merken.
In Carls Zeit an der Uni Köln habe ich regelmäßig mit seinen Studenten trainiert. Der Bereich, in dem er damals forschte und lehrte, war die pädagogische Psychologie, also die Wissenschaft rund um das Lehren und Lernen. Da gab es vor allem für seine Schüler tolle Verbindungen zwischen seinen Erkenntnissen und meiner Methode. Dass er damals schon von der Idee erfüllt war, neben dem Gedächtnis auch das Denken selbst zu verbessern, hat er mich erst viel später wissen lassen. Das Team an der Uni Köln forschte auch an anderen Hirnleistungen: Problemlösen, kreatives Denken, Entscheiden. Kurzum alles, was unser Gehirn sonst noch so kann, außer sich etwas zu merken. Carl und sein Team glaubten schon immer daran, dass man das Denken auch trainieren kann.
Seitdem hat Dr. Naughton an seinen Techniken gefeilt und sie, nach ausführlichen Feldversuchen, in dieser Trainingsanleitung anschaulich zusammengefasst. Ihre Wirksamkeit ist mittlerweile genauso anerkannt wie die der Mnemotechniken für das Gedächtnis – herzlichen Glückwunsch, Carl!
Ich lade Sie ein: Trainieren Sie Ihr Gedächtnis und Ihr Denkvermögen. Sie werden erstaunt sein, welche Fortschritte möglich sind! Und wie viel Spaß es Ihnen bereiten wird. Sie werden sich mit neu gelerntem Denken von Tag zu Tag selbst überraschen. Bis sie eines Tages gar nicht mehr zu existieren scheinen, die »alten« Gedanken, weil das neue, befreite Denken sich Bahn gebrochen hat. Spannend, nicht wahr?
Lassen Sie sich ein – auf eine kluge, humorvolle und inspirierende Anleitung, den eigenen Gedanken auf die Schliche zu kommen.
Herzlich Ihr Gregor Staub
Einleitung: Good news, bad news
Wieso haben wir mit entwaffnender Regelmäßigkeit den Eindruck, vor der schwierigsten Denkanstrengung unseres Lebens zu stehen? Und warum wird dieser Eindruck von dem unguten Gefühl begleitet, dass alle Anstrengung und alles Denken umsonst waren, weil es mal wieder anders kam als gedacht? Zwei für viele Menschen zentrale Erlebnisse: zu merken, dass das eigene Denken nicht ausreicht, und zu spüren, dass unsere Denkanstrengungen ohne Einfluss bleiben. Doch nicht unser Denken macht uns das Leben schwer. Vielmehr ist es unsere Art, unser Denken einzusetzen.
Und genau darum geht es in diesem Buch: den Denkmustern auf die Spur zu kommen, die unser Gehirn nutzt, während wir denken, dass wir denken. Denn beim Grübeln, Rätseln, Kopfzerbrechen, kurz: bei jeglicher bewussten Verstandestätigkeit, neigen wir dazu, uns unbewusst in mentale Sackgassen zu manövrieren, und tappen mit besorgniserregender Zuverlässigkeit in Denkfallen. Die daraus entstehenden Schlussfolgerungen, Urteile, Einschätzungen und Entscheidungen sind dann alles andere als das Ergebnis angestrengten bewussten Denkens! Nun kann nur besser werden, wer die Fallen kennt und umgeht und wer seinen Muskel für bewusstes Denken (das Arbeitsgedächtnis) trainiert. Willkommen also bei dem, was Sie beim Gehirnjogging nicht lernen, willkommen beim Weiter-Denken.
Die Zielgruppe dieses Buches sind Menschen, die denken. Gut, könnten Sie jetzt entgegnen, das schränkt die Zielgruppe erheblich ein. Diesem Einwand entgegne ich mit einem entschiedenen Zögern. Denn denken tun wir alle, immer wieder, wenn auch mit unterschiedlicher Begeisterung. Aber über unser Denken nachzudenken, das ist viel entscheidender. Und das tun wir oft erst, wenn wir mit den Ergebnissen unserer Denkanstrengung nicht zufrieden sind. Merke: Wer vor dem Handeln denkt, muss später nicht dem eigenen Denken nachtrauern. Und Gründe, zu trauern, gibt es viele:
1. Mit professionalisiertem Denkverhalten kommen klarere Vorstellungen in unseren Kopf. Damit könnten jährlich bis zu 5 Billionen US-Dollar Heizkosten eingespart werden (Kempton 1986).
2. Mit dem Wissen um die Verzerrungen im Beurteilen und Schätzen könnten unnötige medizinische Operationen verhindert werden (Bornstein/ Emler 2001).
3. Mit dem Verständnis des persönlichen Entscheidungsverhaltens könnten sinnlose wirtschaftliche und zeitliche Investitionen verhindert werden (Arkes/ Blumer 1985).
4. Mit dem Können, das Denken der Situation anzupassen anstatt umgekehrt, werden Lösungen entwickelt, die zu strategischen Innovationsmotoren werden (Kim et al. 2005).
5. Mit der erlernten Vorsicht vor Wahrscheinlichkeitsrechnung beschleunigen wir das Verständnis von Zahlen, Daten und Fakten um ein Vielfaches (Mangold 2007).
Diese Beispiele machen deutlich, wie groß die Spanne zwischen unbewusstem und bewusstem Denken ist. Und sie verdeutlichen, wie wichtig es für uns alle ist, mehr darüber zu wissen, wie unser Denken uns zu Entscheidungen, Urteilen und Schlussfolgerungen führt. Vor allem deuten sie darauf hin, wie wichtig es ist, diese Fähigkeit über das unbewusste, automatisierte Denken hinaus zu trainieren und auszubauen. Unser Denkdilemma wird durch zwei wichtige Faktoren verursacht: dadurch wie unser Kopf die Infos bereithält, die er für eine Lösung abruft, und wie groß unser Zwischenspeicher ist, in den wir die Infos einlagern, um sie zu einer Entscheidung zusammenzufügen. Dieser Zwischenspeicher – unser Arbeitsgedächtnis – kann schnell überfließen oder an Verstopfung leiden.
Wir alle tragen zwar unsere mentale Grundausstattung mit uns herum, doch wir können tatsächlich mehr. In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie zu einer Turboausstattung kommen. Warum wollen Sie sich mit dem Golf zufriedengeben, wenn ein Porsche drin ist?
Hinter diesem Angebot steckt eine kleine Revolution. Dass wir unsere Fähigkeit, (neue) Probleme zu lösen, systematisch verbessern können, war bis vor wenigen Jahren unvorstellbar. Die Gehirnforschung ist eine sehr junge Wissenschaft, und in ihr herrschte mehr als 40 Jahre lang die felsenfeste Überzeugung, dass das Arbeitsgedächtnis als Motor unseres Denkens nicht trainierbar ist. Damit behielte die Redewendung recht: »Schlau geboren gewinnt, und doof bleibt doof, da helfen keine Pillen.« Vor gut 20 Jahren konnten der kalifornische Neurowissenschaftler Michael Gazzaniga und Kollegen jedoch einen gesteigerten Blutfluss in bestimmbaren Regionen unseres Gehirns beim Lösen einer neuen, unbekannten Aufgabe nachweisen (Gazzaniga/ Ivry/ Mangun 1998). Und zwar nicht irgendwo, sondern in einem Bereich, der viele Psychologen immer schon sehr fasziniert hat: im Arbeitsgedächtnis. Dort steigt beim Denken die Durchblutung und versiegt, sobald das Problem gelöst ist. Klar war damals: Es tut sich was im Arbeitsgedächtnis, wenn wir denken. Von Training war aber noch keine Rede. Das mag auch damit zu tun haben, dass sich das Wissen um das Training von Gehirnen aktuell ungefähr auf einem Kenntnisstand befindet, den die innere Medizin im 19. Jahrhundert erreichte. Also vor Bypassoperationen, vor der Erfindung des Insulins und vor der Bekämpfung des Kindbettfiebers durch Hygienemaßnahmen.
Machen wir einen Sprung ins Jahr 2008. Ein Team um den Berner Gedächtnisforscher Walter Perrig wagte ein ungewöhnliches Experiment: 70 Versuchspersonen trainierten drei Wochen lang jeden Tag 20 Minuten ganz spezifische Aufgaben (Jaeggi/ Buschkuehl/ Jonides/ Perrig 2008). Das Ergebnis: Nach sieben Stunden Training (verteilt auf Etappen von jeweils 20 Minuten täglich) waren die Teilnehmer deutlich besser in der Lage, unbekannte, neue Probleme zu lösen. Im Schnitt verbesserte sich ihre Leistung um 13 Prozent. Jeder war also um ca. ein Siebtel schlauer geworden! Nicht schlecht für drei Wochen, oder? Es ist wie beim Joggen: Das regelmäßige Training macht’s. Perrig und seine Mitarbeiter gaben ihrem Trainingsprogramm den Namen »Braintwister«. Ein Twister ist übrigens eine harte Nuss, und wir alle können unser Gehirn systematisch daran gewöhnen, harte Nüsse zu knacken.
Gedächtnistraining wird inzwischen so ernst genommen, dass es bei der Behandlung von Suchtkranken eingesetzt wird. Tägliche Gedächtnisübungen verstärken die den Süchtigen abhandengekommene Fähigkeit, langfristig zu planen. Mit Forschern der Universität von Arkansas lernen sie dies wieder in täglichen Gedächtnisübungen. In der Forschung ist es wie im richtigen Leben: Ist der Stein erst mal ins Rollen gebracht, geht alles ganz schnell. Nach Walter Perrigs Braintwister-Experiment häuften sich die Belege, dass unsere Verarbeitungskapazität im Arbeitsgedächtnis entscheidend dafür ist, wie gut wir Probleme lösen und wie gut wir in Intelligenztests abschneiden. Robert Sternberg, eine Koryphäe in der Intelligenzforschung und Professor in Yale und Boston, kam in einem ähnlich gelagerten Versuch zum gleichen Ergebnis wie Perrig (Sternberg 2008).
Das Arbeitsgedächtnis mit seiner trainierbaren Kapazität der fluiden Intelligenz ist also für unser Denken zentral. Neueste Erkenntnisse legen sogar nahe, dass wir durch Training eine Art körpereigenes »Gehirndoping« in Gang setzen. Kaum zu glauben, aber wahr: Durch spezielle Arten von Gedächtnistraining verbessert sich die Dopaminausschüttung im Gehirn (McNab et al. 2009). Dopamin ist das Glücks- und Belohnungshormon. Es beeinflusst die Feuermuster der Neuronen im vorderen Teil des Stirnhirns, wenn dort Informationen präsent gehalten werden. Dafür gibt es eine optimale Dopamin-Dosierung (Vijayraghavan/ Wang/ Birnbaum/ Williams/ Arnsten 2007). Training, so zeigte sich im Versuch, verändert die Dichte der Dopamin-Rezeptoren. Sie tanken also quasi Super fürs Gehirn, wenn Sie regelmäßig trainieren. Wie das geht? Nun, das geht,
• indem wir die Fallen des Nichtdenkens kennenlernen, in die wir immer wieder geraten, und ihnen den Garaus machen,
• indem jemand uns mit geeigneten Techniken den Weg zum begeisterten Profidenker und Gernegrübler ebnet und
• indem wir das Zentralorgan unseres Problemlösedenkens – das Arbeitsgedächtnis – in seiner Kapazität erweitern.
Je öfter und je regelmäßiger Sie trainieren, desto mehr tut sich zwischen Ihren Ohren. Sie werden nach dem Training in diesem Buch sogar Probleme lösen, an die Sie zuvor gar nicht gedacht haben. Versprochen! Ist das nur was für besondere Leistungsträger? Nein, Schüler, Studenten und Lehrer profitieren ebenso wie Unternehmenslenker, Abteilungsleiter, Piloten, Ärzte, Maschinisten. Sie alle haben ein Arbeitsgedächtnis, sie alle nutzen es, nur nutzt es nicht jeder gleich und auch nicht gleich viel. Denn: Menschen mit unterschiedlichen kognitiven Fähigkeiten sind nicht einfach Opfer ihrer Gene, sondern sie haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Intelligentere Menschen sind offener für neue Erfahrungen, so der US-Psychologe Michael Kane. So weit die »Good news«.
Was aber ist mit den angekündigten »Bad news«? Ganz einfach: Es gibt keine Ausrede mehr, und es wird höchste Zeit, mit dem Training anzufangen! Nun ist dieses Buch zwar eines über Probleme, es sollte aber besser nicht selbst zu einem werden, sondern Ihnen helfen, diese leichter und besser zu lösen!
Teil 1: Was denkt? Die Denkausstattung
»Es ist überraschend, wie viele Menschen über ihr Gedächtnis klagen und wie wenige über ihren Verstand.«
François de La Rochefoucauld
Unser Denken ist auf zwei Dinge ausgerichtet: Ziele zu erreichen und Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Das gilt für den Schimpansen Cheeta, der im Zoo vor Ihnen sitzt, ebenso wie für den hoch entwickelten Primaten Dieter, der vielleicht gerade neben Ihnen sitzt. Wir alle sind zum Denken geboren. Nun benutzen Dieter und Cheeta zwar mitunter sehr ähnliche Denkmuster, um zu Entscheidungen, Urteilen und Problemlösungen zu kommen. Aber die unterschiedliche Denkpower in unseren Gehirnen ermöglicht es uns Menschen, ein paar mehr Strategien einzusetzen, um uns in der Umwelt zurechtzufinden und so mitunter im Wohnzimmer statt auf dem Baum zu hocken. Schauen wir uns also einmal kurz an, was es ist, das gute Denker ausmacht.
Dazu lade ich Sie auf eine Reise in sonnigere Gefilde ein. Die Kanareninsel Teneriffa war 1917 Heimstatt des Intelligenzforschers Wolfgang Köhler. Köhler war zu jener Zeit ein angesehener Denker. Ihm und seinen Kollegen verdanken wir die Idee der Gestaltpsychologie. Die begegnet uns im Alltag z.B. in dem Merksatz: »Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.« Die Redewendung verdichtet den Gedanken, dass unser Wahrnehmen und Erleben eine Ganzheit ist. Diese Ganzheit besteht aus einzelnen Aspekten, die untereinander in Beziehung stehen. Sie können sich das vorstellen wie eine Melodie: Die Ganzheit, also die Melodie, besteht aus einzelnen Tönen (Teile). Die einzelnen Töne alleine reißen in der Regel keinen vom Hocker. Aber wenn sie in einer bestimmten Reihenfolge nacheinander oder gleichzeitig erklingen, berührt uns diese Melodie (die Summe der Teile) mitunter sehr. Versuchen Sie einmal, die einzelnen Töne von »Happy Birthday« getrennt zu hören. Da bleibt die Geburtstagsstimmung garantiert auf der Strecke.
Diese Gestaltpsychologie hatte neben der Untersuchung solcher Gestaltgesetze auch ein starkes Interesse am Denken. Genauer gesagt an der Einsicht, also dem, was wir als den Moment kennen, in dem uns »ein Licht aufgeht«. Diesen Einsichtsprozessen widmete sich Köhler nun im besagten Jahr auf Teneriffa. Er war dort Direktor der Anthropoiden-Forschungsstation der preußischen Wissenschaftsakademie und untersuchte intensiv die mentalen Fähigkeiten von Primaten. Er analysierte das Denken der Primaten beim Lösen von Problemen in naturnahen Situationen. Dazu versetzte er seine Affen in eine Situation, die in sich unbefriedigend war, und schaute zu, wie sie diese zu ihren Gunsten veränderten. Hunger ist eine der typischsten und unbefriedigendsten Situationen. Der Schimpanse sah nun seine Nahrung. Aber er kam nicht so einfach dran. Und da musste dann so etwas wie Nachdenken einsetzen. »Wie komme ich an das Essen? Ich muss höher kommen, da die Banane zu hoch hängt. Wie komme ich höher? Wenn ich auf etwas draufsteige. Aber das muss ich unter die Banane schieben.« Diese Gedanken sind natürlich eine freche Unterstellung. Klar zu sehen war allerdings, dass der Affe tatsächlich etwas suchte, auf das er sich stellen konnte, um die Banane zu erreichen. Sobald der Affe die Banane erreicht hatte, machte Köhler das, was Forscher nun mal machen: Er hängte die Banane höher. Jetzt musste der Schimpanse erhöhtes Einsichtsverhalten, sprich Denken, zeigen, indem er Kisten aufeinanderstapeln oder, in anderen Versuchen, Stockteile zusammenstecken musste, um das Futter zu erreichen. Um zu erkennen, dass er für das Erlangen der Banane mehrere Stöcke zu einem langen zusammenzusetzen hatte, benötigte einer der Problemlöse-Schimpansen namens Sultan eine ganze Stunde. Einsicht braucht Zeit. Das gilt auch für uns Menschen, wie wir später noch sehen werden (vgl. Lösung zur 21. Denkfalle).
Nun kann man schnell den nächsten Gedanken erahnen: Wenn ein Schimpanse, mit dem wir 95 Prozent der DNA teilen, das hinbekommt, besteht Hoffnung. Fazit: Problemlösen kann jeder lernen, egal ob Affe oder Mensch, es geht nur darum, sich immer weiterzuentwickeln. Lerne zu denken! Oft stellen Menschen in diesem Zusammenhang die Frage: »Wenn ich jetzt anfange, das Denken zu lernen, ab wann kann ich das dann?« In der Tat wurde in unterschiedlichsten Bereichen festgelegt, wann aus einem blutigen Anfänger ein Experte wird:
1. Sticken: Nach 1,5 Millionen Stichen können Sie es.
2. Geige spielen: Nach 2,5 Millionen Strichen haben Sie eine gute Bogenführung.
3. Schach spielen: Nach 5000 Stunden schlagen Sie auch einen Schachmeister.
4. Steuererklärungen: 3000 Stunden brauchen Sie, um als gewiefter Steuerberater mit allen Tricks und Kniffen zu arbeiten.
Übung macht eben in allem den Meister. Und wenn Sie beim Denken als solcher vom Himmel fallen wollen, endet das schnell mit einer Gehirnerschütterung. Dabei müssten Sie Ihren Kopf als Profidenker sehr pfleglich behandeln. Denn für all die komplexen mentalen Prozesse brauchen wir vor allem eines: eine gute Verarbeitungsressource, will meinen: jede Menge Denkpower. Und die befindet sich in einem ganz besonderen Teil unserer Hirnrinde: Die Rede ist vom Arbeitsgedächtnis. Da trennt sich nämlich evolutionär gesehen Dieter von Cheeta. Die Fähigkeiten des Arbeitsgedächtnisses sind ein entscheidender Aspekt menschlicher Intelligenz. Und weil das Arbeitsgedächtnis der Teil ist, um den sich beim Denken (fast) alles dreht, schauen wir uns den nun ein wenig genauer an.
Eine kleine Anatomie des Denkens
30.000 Jahre ist kein Alter. Zumindest nicht für den Benjamin unter unseren Gehirnteilen. Darum taufte die Wissenschaft diesen jüngsten Durchbruch in der Entwicklung unseres Nervensystems auch auf den Namen Neokortex (vom Griechischen neos = neu und Lateinischen kortex = Rinde oder Hülle). Der Neokortex umfasst die Hirnhälften wie eine zwei bis fünf Millimeter dicke Rinde. Mit der Ausbildung dieses Neokortex war allerdings die Entwicklung des Erfolgsmodells abgeschlossen; es kamen keine Modellvarianten oder weiteres optionales Zubehör mehr hinzu. Ist auch nicht notwendig, denn unser Gehirn stellt bereits das komplizierteste natürliche System im bekannten Universum dar.
Abb. 1: Das Gehirn im Modell
Zum Alltagswissen gehört inzwischen die Tatsache, dass unser Gehirn aus zwei Teilen, auch Hemisphären genannt, besteht. Zum nicht ganz richtigen Alltagswissen gehört die Annahme, dass die linke als die logische, mit Sprache verknüpfte Hälfte bezeichnet und die rechte als die intuitive Hälfte angesehen wird. Ganz so einfach ist es in der tatsächlichen Aufgabenverteilung nicht. Auch sind die beiden Hälften sehr unterschiedlich in ihren Größenverhältnissen und in ihrer Aufgabenverteilung, wie Sie sehen werden.
Schon im 19. Jahrhundert kam in der Hirnforschung der Gedanke auf, dass in bestimmten Bereichen höhere geistige Prozesse aktiv sind. Das fiel besonders an Mitmenschen auf, bei denen einzelne Bereiche der Hirnrinde beschädigt waren: Bat man diese Patienten, Spielkarten nach den Farben von Symbolen zu sortieren und im Anschluss diese Karten nach den Formen der Symbole zu ordnen, gelang ihnen das nicht – sie führten weiter die Sortierung nach Farben aus. Sie konnten genau die Dinge nicht mehr tun, für die wir Entscheiden und Handlungsplanung benötigen, um die Dinge zu bewältigen, die gerade anstehen.
Für solche Leistungen arbeiten verschiedene Bereiche der Hirnrinde zusammen. Diese Zusammenarbeit wiederum wird an bestimmten Punkten orchestriert. Es sind der vordere rechte und der vordere linke Teil des Gehirns: die beiden Frontallappen. Die beiden scheinen anatomische Zwillinge zu sein. Bei genauerem Hinsehen jedoch ist der rechte breiter als der linke. Diese Aussagen gelten in der Regel für Rechtshänder. Manchmal sind bei Linkshändern die Hemisphären und dementsprechend auch die Frontallappen miteinander vertauscht – aber nicht immer. Dennoch funktionieren sie in der Regel gleich gut – egal ob rechts oder links die dominante Körperhälfte ist. Wann immer Sie hochgradig zielgerichtetes Verhalten an den Tag legen, greift Ihr Gehirn auf diese Bereiche zurück. Sie brauchen sie zum Definieren Ihrer Ziele, zum Planen, wie Sie diese Ziele erreichen, zum Zusammenstellen der Mittel, die für das Erreichen Ihrer Ziele erforderlich sind, und, last, but not least, zur Erfolgskontrolle.
Die Frontallappen sind aber nicht nur Planungsprofis. Sie können noch mehr. Um das zu verstehen, schauen wir noch ein wenig genauer hin. Die vorderen Anteile der Frontallappen werden als präfrontaler Kortex bezeichnet. Warum lohnt sich ein Blick auf diese kompliziert klingende Region? Einfach gesagt steuert sie die Gefühle zum Denken bei. Sie ist mit den subkortikalen Bereichen des limbischen Systems und den Basalganglien verbunden. Der präfrontale Kortex (PFC) ist daher eine Art übergeordnetes Aufmerksamkeitssystem unserer Denkfunktionen. Er gleicht emotionale Bewertungen mit Gedächtnisinhalten ab und übersetzt sie in Handlungen. Diesen gesamten Bereich nennen wir ab jetzt vereinfachend das Stirnhirn. Und so langsam bekommen Sie vielleicht den Eindruck, dieses Stirnhirn sei so etwas wie das »Schweizer Messer« unseres Gehirns. Es plant, setzt Ziele, priorisiert, kontrolliert unsere Impulse und integriert unsere Emotionen.
Und in der Tat ist es diese besondere Art des Stirnhirns, die uns so einzigartig macht. Die Größe dieses Bereichs nimmt zu, wenn Sie eine Ratte, einen Affen und einen Menschen nebeneinander platzieren. Die Größe macht beim Menschen 29 Prozent des gesamten Kortex aus, beim Schimpansen sind es nur noch 17 Prozent, dann 11,5 Prozent beim Gibbon und beim Makaken 8,5 Prozent, beim Hund 7 Prozent und bei der Katze 3,5 Prozent. Diese Entwicklung ist evolutionär. Der Neandertaler-PFC hatte noch die Größe desjenigen eines Primaten. Damals fehlte beiden die gleiche Fähigkeit: das rationale Denken. Doch dann hat sich etwas Entscheidendes geändert: der Enzephalisationsquotient. Dieser Quotient setzt die Körpergröße eines Lebewesens in Beziehung zu dessen Hirngröße. Und da punkten wir mit einem Quotienten von 7! Das heißt, unser Gehirn ist siebenmal größer, als bei unserer durchschnittlichen Körpergröße eigentlich zu erwarten wäre.
Dementsprechend ist die Entwicklung dieser Region auch der zentrale und bedeutendste Unterschied zwischen unseren Vorfahren und uns heutigen Menschen. Und auch in unserer ganz individuellen Entwicklung steht der PFC hinten; erst im Jugendalter reift dieser Bereich komplett aus, quasi als letzter Teil unseres Gehirns. Wenn Sie Kinder haben, kennen Sie diese Phase: Pubertät. Genau in diesem Zeitfenster wird das Gehirn noch einmal umstrukturiert und werden die Bereiche des Stirnhirns vollends ausgebildet.
Nach diesem Blick auf das Wo stellt sich jetzt die Frage nach dem Warum. Warum haben wir eigentlich ein Gehirn? Sie scheint albern und die Antwort einfach: um am Leben zu bleiben. Die Forschung antwortet anders: Sie untersucht z.B. die Seescheide. Die schwimmt im Ozean und sucht nach einem Stein, auf dem sie sich niederlassen kann. Für diese Suche nutzt sie ihr hohles, zerebrales Ganglion und eine Art neurale Drüse – eine Art Hirn light. Hat sie den Platz gefunden, verdaut sie ihr Gehirn. Die Antwort auf das Warum ist also: um uns sinnvoll in unserer Umwelt zu bewegen. Doch die Menschen machen damit noch ein wenig mehr. Schauen wir also ein wenig genauer: Wie funktioniert das eigentlich mit dem Denken?
In unserem Stirnhirn tobt wie in allen anderen Bereichen unseres Gehirns ein ständiges chemisches und elektrisches Gewitter. Elektrische Impulse schießen mit bis zu 468 km/h die Nervenbahnen entlang. Sie werden als Aktionspotenziale bezeichnet. Jede Nervenbahn (Axon), an der die Potenziale entlangsausen, hat ein Ende. Dieses Ende trägt den Namen Synapse. Wenn ein elektrischer Impuls von einer Nervenbahn zur anderen gelangen will, muss er von einer Synapse zur anderen gelangen. Zwischen den beiden Synapsen ist jedoch ein kleiner Spalt. Dieser würde den elektrischen Impuls nicht weiterleiten. Daher wird die elektrische Energie kurzzeitig in eine chemische Reaktion verwandelt, um den Spalt zwischen den Synapsen überwinden zu können. Die Substanzen, die diese Verwandlung ermöglichen, heißen Neurotransmitter oder Neuromodulatoren. Hat der Impuls den Sprung über den Spalt geschafft, wird er auf der anderen Seite von der empfangenden Synapse wieder in einen elektrischen Impuls umgewandelt und weitergeleitet.
Das passiert also an einer einzigen Synapse. Wir verfügen aber über eine Vielzahl von Synapsen: eine Billiarde. Geschätzt. Gezählt hat sie bisher noch keiner. Und die sind vielfach miteinander verbunden. Jedes der, ebenfalls geschätzten, eine Milliarde Neuronen kann mit bis zu 10.000 Synapsen verbunden sein. Unter denen vervielfachen sich die Aktionspotenziale. Und so können mit diesen elektrischen und chemischen Gewittern enorm komplexe Informationen vermittelt werden. Diese Gewitter bezeichnet die Forschung als Aktivierungsmuster. Sie können auch ganz profan Lernen dazu sagen. Lernen ist nichts anderes als eine Veränderung der Leichtigkeit, mit der die elektrischen Impulse entlang unzähliger Nervenbahnen geleitet werden, und die damit einhergehende Veränderung der elektrischen und chemischen Prozesse. Der Fachmann spricht von einer Veränderung der Übertragungsstärke.
Das geschieht im Stirnhirn, wenn Sie denken. Allerdings geschieht es in unterschiedlichem Maße, je nachdem, was Sie denken. Forschungen zeigen, dass die rechte Seite unseres Gehirns besonders gerne Neues verarbeitet, während sich die andere Seite mit Vorliebe schon bekannten Infos, sogenannten Routinen, widmet. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Was ist Routine und was ist neu?
Die Forschungsergebnisse zeigen, wie sehr unser Stirnhirn auf Effizienz beim Verarbeiten von Informationen aus ist. Sobald es eine neue Denkstrategie zur gelernten Routine entwickelt hat, wird sie von der rechten Stirnhirnseite auf die linke Seite outgesourct. Parallel verringert sich der Energieverbrauch im Stirnhirn. Nacherleben können Sie das ganz einfach mit einem Tetrisspiel. Das diente auch in der Studie im Originalversuch von 1992 unter der Leitung von Richard J. Haier als Vorlage. Die Mitspieler steigerten nach vier bis acht Wochen Spielpraxis ihre Ergebnisse um das Siebenfache; der messbare Stoffwechsel in ihrem Stirnhirn ließ dabei allerdings kontinuierlich nach. Diese Bilder zeigen jedoch eines deutlich: Ein intelligentes Gehirn durchblutet weniger Regionen, es arbeitet mit weniger Aufwand. Eingespielte Denkprozesse, so scheint es, machen dem Köpfchen nicht mehr Arbeit, sondern eher weniger! Hinzu kommen Ergebnisse von 2009, die zeigen, dass diese Routinen, sprich diese regelmäßigen Wiederholungen, von mentalen Aktivitäten sogar zu einer Veränderung in der kortikalen Dicke führen. Routinen hinterlassen Spuren und verändern das Gehirn.
Zwei Ziele könnte das Gehirn mit diesem routinemäßigen Abarbeiten und Outsourcen verfolgen: Vertrautheit und Sicherheit im Umgang mit den Infos und das Sparen von Energie. Denn wann immer wir mit etwas Neuem konfrontiert werden, muss unsere vordere rechte Hemisphäre sich ganz schön anstrengen, um die Infos zu verarbeiten. Das kostet Energie. Routinen, Prozesse, Outsourcing sparen an der einen Stelle Energie, damit sie an der anderen zur Verfügung steht. Fazit:
Erste goldene Regel des Hirns: Je intelligenter ein Mensch ist, umso weniger Energie verbraucht sein Gehirn. Das klappt nur, wenn die unnötigen Verbindungen im Hirn gekappt werden (Sommer et al. 2008).
Zweite goldene Regel: Das Gehirn verfügt über einen eigenen Belohnungskreislauf. Der hält engen Kontakt zum Hirn hinter der Stirn. Und das ist extrem wichtig, wie aktuelle Forschungen belegen (Loewenstein 2014): Menschen erinnern sich an Informationen viel besser, wenn beim Lernen das Belohnungssystem aktiviert wurde.
Dritte goldene Regel: Vorn handeln, hinten wahrnehmen. Das Stirnhirn ist zuständig für das Planen und Kontrollieren unserer Bewegungen und Handlungen. Die für Sensorik zuständigen Großhirnareale hingegen liegen im hinteren Teil, hinter der Zentralfurche (Markowitsch 2005).
Das Arbeitsgedächtnis – ein Gedächtnis für Arbeit
Das Denken benötigt natürlich einen Raum, wo es stattfinden kann: ein Gedächtnis. Wenn ich in meinen Vorträgen zum Thema »Wenn du denkst, du denkst« frage, was die Zuhörer unter einem »Gedächtnis« verstehen, kommen meist klare Antworten. Wir sind so an den Begriff gewöhnt, dass wir ihn für alles benutzen, was irgendwie mit den Fähigkeiten unseres Kopfes zu tun hat: Telefonnummern merken, Vornamen behalten, an den Hochzeitstag denken oder Infos für die nächste Präsentation speichern. Das ist allerdings nur ein geringer Teil der Fähigkeiten unseres Gehirns. Denn die Teile des Hirns, die auf den sich ständig verändernden Informationsfluss reagieren, die permanent Auswahlen treffen, nach Lösungen im alltäglichen Dasein suchen, bilden eine ganz spezielle Gedächtnisart, die von den Frontallappen gesteuert wird.
Wenn Sie die Frontallappen in Ihrem Stirnhirn nun nicht aus neurologischer, sondern aus psychologischer Sicht betrachten, bekommt das Ganze einen anderen Namen: Arbeitsgedächtnis. Das unterscheidet sich sehr von allem, was wir in der Regel mit dem Gedächtnis verbinden, wie z.B. das Erlernen und Behalten von Informationen. Der Begriff »Arbeitsgedächtnis« entstand bereits im frühen 19. Jahrhundert – in den Jugendjahren der Hirnforschung. In den 1870er-Jahren wandte sich die Forschung dem Neokortex zu, besonders den vorderen Bereichen in der Nähe unserer Stirn. Die Experimente zeigten, dass unterschiedliche Bereiche im Kortex auch für unterschiedliche Funktionen zuständig sind. Manche scheinen motorische Aufgaben zu organisieren, andere eher kognitive Prozesse. In den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts wurde von Psychologen der heute gebräuchliche Terminus »Arbeitsgedächtnis« eingeführt – dieses wird als Kurzzeitspeicher von Informationen angesehen. Das wurde wahrscheinlich dem Konzept des Computer-Arbeitsspeichers entlehnt. Der PC setzte nämlich damals zu seiner Invasion in unsere Büros und Wohnzimmer an. Und folglich war alles, was mit den Prozessen der spannenden neuen Bits-und-Bytes-Welt verglichen werden konnte, der letzte Schrei und wurde versuchsweise auf das Verständnis des Gehirns übertragen.
Physiologisch gesehen ist unser Arbeitsgedächtnis hauptsächlich in einem kleinen Bereich des Frontallappens angesiedelt: dem schon bekannten PFC. Es sind die in der folgenden Abbildung markierten Bereiche.
Abb. 2: Präfrontaler Kortex
Richard Haier trug 2007 in einer Metaanalyse zusammen, wie dieser Bereich Informationen aus den verschiedensten kortikalen Regionen zusammenführen und testen muss. Er bezeichnet das Netzwerk der verteilten Bereiche, die mit dem präfrontalen Lappen interagieren, als P-FIT (parieto-frontal integration theory) – eine Biologie der Intelligenz. Variationen in diesem verteilten Netzwerk lassen Voraussagen über die individuellen Differenzen bei Intelligenz- und Schlussfolgerungstests zu. Wann immer Sie schlussfolgern, urteilen, schätzen, entscheiden oder Probleme lösen, wird dieses Netzwerk aktiv. Ein permanenter Wechsel von kognitiven Aufgaben gehört dazu. Das Arbeitsgedächtnis muss ständig neue Inhalte online gehen lassen und alte offline schicken. Es muss Wahrnehmungsinhalte mit emotionalen Bewertungen zusammenbringen; es muss Infos so lange präsent halten, bis sie optimal in unsere Handlungen integriert sind; es muss Inhalte aus der Erinnerung abrufen und Neues integrieren.
Die Kognitionspsychologie vergleicht die Funktionsweise des Arbeitsgedächtnisses mit dem Jonglieren von Tellern. Wenn Sie auch nur einen Moment lang einen vernachlässigen, fällt er herunter. Neurologisch gesehen bleibt eine Information nur so lange in Ihrem Arbeitsgedächtnis, wie die Neuronen, die diese Info bereithalten, feuern. Und die feuern eben nur eine ganz kurze Zeit, nachdem sie aktiviert wurden. Dann erlischt das Feuer und die Info ist weg. Die Neuronen im PFC sind nicht wie in vielen anderen Bereichen des Hirns für das Speichern von Infos zuständig, sondern nur dafür, dass sie online bleiben.
Der Neuroforscher Noah Shamosh hat mit seinen Kollegen 2008 diese Online-Quelle des Gehirns in seinen Studien festgehalten; dieser Bereich ist in der folgenden Abbildung eingekreist. Er wird generell mit einer besseren Arbeitsgedächtnisleistung und besserem Abschneiden bei IQ-Tests in Verbindung gebracht. Bereits 2007 haben Etienne Koechlin und Alexandre Hyafil gezeigt, dass wir diesen Bereich stark nutzen, wenn es um das Integrieren komplexer und abstrakter Ergebnisse aus gleichzeitigen Unteraufgaben geht, die ein übergeordnetes Verhaltensziel stützen.
Studien aus dem Jahr 2013 zeigen: Ein weiterer Teil des PFC, der anteriore PFC, unterstützt unsere Fähigkeit, unsere Kognitionen und Erfahrungen zu überwachen und zu reflektieren. Das ist die sog. Metakognition, das Nachdenken über das eigene Denken, Fühlen und Handeln.
Abb. 3: Der Integrationspunkt nach Koechlin und Hyafil 2007
Je mehr dieser Bereich leistet, desto besser sind auch unsere Leistungen in komplexen Entscheidungssituationen. Denn dann geht es nicht nur um das Integrieren von Infos. Hinzu kommt, dass sich bei jeder neuen Info alles bisher im Stirnhirn Vorhandene aktualisieren muss. Das passiert uns dauernd. Die alltäglichste Situation ist, wenn ein Kollege Sie um Rat fragt. Er erklärt Ihnen das Grundproblem und Ihr Stirnhirn fängt an zu rattern. Sie versuchen, das Problem nachzuvollziehen, und bieten eine Antwort, vielleicht sogar eine Lösung. Doch genau dann kommt Ihr Gesprächspartner mit einer neuen Info um die Ecke. Sei es, dass er bei der ersten Schilderung etwas vergessen hat oder dass Ihre Antwort bei ihm einen Einwand auslöst. Jetzt müssen Sie die neue Info mit zu den bereits bestehenden packen und alles neu interpretieren. Für dieses Update gibt es den frontopolaren Kortex (FPC). 2014 erforschte die Neurowissenschaftlerin Daniella Laureiro-Martínez mit Kollegen, wie dieses System im Entscheideralltag funktioniert. Das Team untersuchte die Entscheidungseffizienz (Leistung geteilt durch Reaktionszeit) von Unternehmern, die die von ihnen gegründete Firma noch leiteten, und von Managern, die zwar fortlaufend strategische Entscheidungen treffen müssen, aber keine vergleichbare Unternehmenserfahrung haben. Das Ergebnis: Die Unternehmer zeigten eine höhere Entscheidungseffizienz und eine stärkere Aktivierung genau dieses FPC, der u.a. auch für erforschendes Wahlverhalten zentral ist. Warum ist gerade das so wichtig? In sich ständig wandelnden Umfeldern besteht ein Konflikt zwischen dem Ausnutzen aktuell bevorzugter Optionen und dem Sammeln von Informationen durch das Erforschen unbekannterer Optionen, die bisher weniger einträglich waren. Optimales Entscheiden bei solchen Aufgaben verlangt die Betrachtung zukünftiger Entwicklungen und das ordentliche Updaten bisheriger Überzeugungen, nachdem wir die möglichen Entwicklungen betrachtet haben.
Das Arbeitsgedächtnis in unserem Stirnhirn orchestriert also alle Informationen, die es zum Entscheiden, zum Aushecken und Durchführen von Plänen braucht. Es ist ein genereller Befehlsposten, ein Regisseur, ein »Martin Scorsese des Gehirns«. Oder um es etwas betriebswirtschaftlicher auszudrücken: eine Art Geschäftsführer des Gedächtnisses, ein mentaler CEO.
Der CEO in Ihrem Kopf: Wer entscheidet was wie?
Die Frontallappen sind der USP des menschlichen Gehirns. Sie machen unser Denkorgan so gut und so einzigartig. Dieser Bereich des Gehirns ist der Chef, der alle anderen Funktionen in unserem Gehirn koordiniert und überwacht. Die Psychologen Michael Kane und Randall Engle stellten 2002 fest, dass wir es mit ihm überhaupt erst schaffen, unsere Aufmerksamkeit auf eine Aufgabe zu fokussieren und die notwendigen Operationen auszuführen, während wir den Rest der Informationsflut links liegen lassen.
Das Arbeitsgedächtnis verfügt selbst über keine bestimmte Funktion, wie es z.B. bei den visuellen Arealen oder den Spracharealen der Fall ist, die passgenau auf die Verarbeitung bildlicher oder sprachlicher Signale zugeschnitten sind. Aber es kann eines, was kein anderer Teil unseres Kopfes kann: dafür sorgen, dass die Einzelteile zusammenarbeiten und aus den vielen Einzelinformationen eine Art Gesamtheit wird; so bekommen wir überhaupt erst die Möglichkeit, neue Gedanken zu entwickeln, zu planen, zu entscheiden, Probleme zu lösen. Der neuronale Verbund im Arbeitsgedächtnis ermöglicht es uns dabei, möglichst mehrere Fakten parallel und gleichzeitig bewusst verfügbar zu halten. Die dazugehörigen Leistungen im Stirnhirn sind sehr komplex und doch annähernd so nachvollziehbar, wie wir es von komplizierteren Kopfrechenaufgaben kennen: Zahlen, Regeln, Operatoren, Zwischenergebnisse, mehr Regeln, mehr Zwischenergebnisse, bis sich alles zu einem Endergebnis verdichtet. Hier ein Beispiel:
Was passiert da in Ihrem Kopf? Schauen wir mal, welche Leistungen Ihr Arbeitsgedächtnis bereits bei einer solchen, relativ einfachen Denkaufgabe zu vollführen hat: Zuerst einmal müssen Sie das Ergebnis von (59 – 14) errechnen. Nun müssen Sie dieses Ergebnis im Gedächtnis behalten und es durch 8 teilen. In der Regel machen wir das im Kopf auch nicht in einem einzigen Schritt. Viel eher rufen wir jetzt ab, welche Zahl durch 8 glatt teilbar ist, und fragen uns, ob diese Zahl dem ersten Ergebnis entspricht oder wie nah sie diesem Ergebnis kommt. Dann müssen Sie diesen Schritt zusätzlich im Kopf behalten und beginnen zu dividieren; allerdings bleibt natürlich noch ein mathematischer Rest, den Sie nun auch noch präsent halten und dann auch noch – unter Abruf weiterer mathematischer Regeln – verarbeiten müssen. Infos abrufen, zwischenspeichern, verändern und zu einem Ergebnis verbinden – darauf beruht unser Denken.
Wow, denken Sie jetzt vielleicht, um all das zu können, muss das Stirnhirn wohl ziemlich weit entwickelt sein und über äußerst komplexe Funktionen verfügen, wenn es die Wahl trifft, welche kognitiven Fähigkeiten zur Ausführung von Plänen herangezogen werden müssen. Außerdem muss es diese dann noch koordinieren, in der passenden Abfolge anwenden, am Ende sogar deren Erfolg bewerten. Unser Arbeitsgedächtnis ist also unser CEO! Übrigens, kein leeres Sprachspiel, sondern eine Metapher, die die Forschung belegt (Buschman/ Miller 2007). Was mentaler und realer CEO gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass beide dafür sorgen, dass Informationen zusammenkommen, über die sie selbst zunächst gar nicht verfügen.
So, jetzt wissen Sie, dass Sie einen mentalen CEO, einen neuronalen Regisseur haben, der sich um die Organisation Ihres Denkens kümmert. Ist es da eigentlich wichtig zu wissen, wie der funktioniert? Ihr Auto fährt ja auch, ohne dass Sie die Ausbildung zum Kfz-Mechaniker abgeschlossen haben! Nun, solange es fährt, ist alles fein, und ein bisschen kümmern Sie sich ja auch drum: schicken es zur Inspektion, geben die jahreszeitliche Bereifung in Auftrag, schütten vielleicht auch als kleines Schmankerl ein paar Liter Premiumöl nach. Das Basiswissen ist da und für die Panne auf der Autobahn gibt es ja schließlich die Gelben Engel! Und wie ist das mit Ihrem Oberstübchen? Da ist es um die eigene Servicebereitschaft eher mager bestellt: Training für das Arbeitsgedächtnis? Premiumernährung für die grauen Zellen? Eher Fehlanzeige. Also machen wir uns auf eine kurze Reise in Ihre mentale Führungsetage und finden heraus, was Ihr CEO so macht.
Frau Müller, zum Diktat, und machen Sie gleich noch eine Skizze!
Wie arbeitet eigentlich der mentale Chef? Die einfachste Antwort lautet: indem er delegiert. Er macht ja nichts selber. Und selbst die Arbeit, die für ihn noch anfällt, ist in kleinen, schnellen Abteilungen organisiert. Eine kümmert sich um die gehörten Informationen, wie z.B. die Sprache; die Forschung nennt das die phonologische Schleife. Eine andere kümmert sich um die Bereithaltung bildlicher Eindrücke und wird als visuell-räumlicher Notizblock bezeichnet.
Seit den 60er-Jahren treibt die Forschung besonders die Frage um, wie das Stirnhirn Infos zwischenspeichert und über eine gewisse Zeitspanne so präsent hält, dass wir auch am Ende eines langen Satzes noch ungefähr wissen, wie der Anfang lautete und wo ein Prädikat, Objekt oder Verb hingehört. Hier ein Beispiel:
Boris Becker schlug Ivan Lendl …
… glatt in drei Sätzen.
… den Schläger aus der Hand.
… auf den Kopf.
Sie merken, Sie müssen den Anfang des Satzes so lange präsent halten, bis das Ende des Satzes die Mehrdeutigkeit auflöst und Klarheit schafft. Und das ist gar nicht so einfach: alles im Kopf präsent zu behalten und es bei Bedarf schnell abzurufen. 1956 forschte der Psychologe George Miller an diesem Problem. Sein Ergebnis: Wir können uns nicht mehr als sieben Informations-Chunks merken. Chunks sind übersetzt so etwas wie Brocken, also inhaltlich zusammenhängende Gebilde wie ein Datum, ein mehrsilbiges Wort oder ein kurzer Satz bestehend aus Subjekt, Prädikat, Objekt. Nelson Cowan stellte 2001 fest, dass nur 4 ± 1 unverbundene Chunks zu einem bestimmten Zeitpunkt im Fokus der Aufmerksamkeit gehalten werden können. Die Wissenschaftler untersuchen die Menge an Infos, die wir behalten können, mit Experimenten wie dem sogenannten Wortlängeneffekt. Machen Sie doch mal einen Selbstversuch. Lesen Sie die nachfolgenden Wörter und verdecken Sie sie danach sofort:
Wind Gras Hirn Duft Keks
Können Sie sie alle aufzählen? Ja, das war jetzt nicht ganz so schwer, oder? Aber wie ist es mit den nachfolgenden Wörtern? Gleiches Prinzip: kurz lesen, abdecken und anschließend alle in der richtigen Reihenfolge niederschreiben:
Lokomotive Vegetation Marionette Aluminium
Stanniol Chemikalie Abiturient
Dieser Wortlängeneffekt lässt sich so beschreiben: Ihre Gedächtnisspanne ist bei kürzeren Wörtern (gemessen an der Silbenlänge und Sprechdauer) größer als bei längeren Wörtern. Hat nicht so geklappt mit dem Erinnern? Macht nichts. Im Originalversuch bekamen die Kandidaten im Schnitt gerade einmal 2,6 der mehrsilbigen Wörter hin! Warum ist das so? Weil ein untrainierter CEO im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf schnell voll hat. Die Menge der behaltenen Wörter ist tatsächlich abhängig davon, wie lange wir für die Aussprache des jeweiligen Wortes benötigen. Dies bestätigte auch ein Versuch der Kognitionspsychologen Alan Baddeley und Giuseppe Vallar: Die Anzahl der richtigen Worterinnerungen nahm parallel zur Zunahme der Wortlängen ab (Baddeley/ Vallar 1982).
Gerade haben Sie das eine Vorzimmer des CEO kennengelernt: Da steht Frau Müller mit dem Diktiergerät – eben jene phonologische Schleife. Die nutzen Sie beispielsweise, wenn Ihnen jemand eine Telefonnummer zuruft und Sie sich diese merken wollen, bis Sie die nächste Gelegenheit nutzen, sie niederzuschreiben. Sie ist eine Art Diktiergerät mit einem ganz kurzen Tonband für die eben beschriebenen sieben Informations-Chunks.
Gehen wir nun ins zweite Vorzimmer. Dort hält Frau Müller schon das Flipchart bereit. Hier haben wir es mit dem schon erwähnten visuell-räumlichen Notizblock zu tun. Sie nutzen ihn hauptsächlich, um mentale Bilder und mentale Karten zu erzeugen und zu manipulieren. Er wird in der rechten Hemisphäre (in der folgenden Abbildung Areal 6, 19, 40 und 47) angenommen und auch seine Kapazität ist begrenzt.
Abb. 4: Das Flipchart in Ihrem Gehirn
Stellen Sie sich ein Stück Ihrer Lieblingstorte vor. Diese Vorstellung können Sie jetzt stufenlos rotieren, sodass sich der hintere Teil nach vorne dreht oder Sie unter das Objekt schauen, indem Sie es vor Ihrem geistigen Auge hochheben. Ein wenig spröder war der Originalversuch Baddeleys. Die Kandidaten hörten zwei Serien von Sätzen. Eine Gruppe bekam eine Serie räumlicher Zuordnungen zu hören, die andere eine Unsinnsserie. Den Inhalt dieser Sätze sollten die Kandidaten dann im Kopf in einem vorgestellten 4 × 4-Gitter mit 16 Quadraten platzieren.
Und wie sieht es jetzt vor Ihrem geistigen Auge aus? Gut, wenn Sie sich eben für die Unfugssequenzen entschieden haben, fühlen Sie vielleicht einen kleinen Schwindel. Aber das geht vorbei. Wenn Sie die sinnvolle Sequenz genutzt haben, sollte das Ergebnis wie folgt aussehen:
Sie haben mithilfe des räumlichen Materials die oben stehende Aufteilung? Dann haben Sie die Aufgabe gelöst. So schafften es auch die Versuchskandidaten. Psychologen hatten bereits in den 80er-Jahren Studien gestartet, in denen sie den Klassiker der mehrdeutigen Figuren, die Ente-Kaninchen-Figur, kurz darboten. Versuchen Sie es einmal selbst. Sie sehen die Figur. Dann schließen Sie die Augen und versuchen, nur mithilfe Ihrer Imaginationskraft die andere Interpretation vor Ihrem geistigen Auge zu sehen!
Abb. 5: Kippbild
Sicher haben Sie festgestellt, dass nach der ersten Interpretation das Wechseln zur zweiten Interpretation allein in der Vorstellung nicht möglich war; das konnten die Probanden in dem Experiment erst leisten, nachdem die Figur aufgezeichnet wurde. Vorgestellte Bilder sind also an eine Interpretation gebunden und werden eventuell anders verarbeitet als gesehene. Ein zweites Beispiel: Bitten Sie Ihre Kollegen, sich den Buchstaben D vorzustellen, diesen nach links zu kippen und ein J unten anzufügen. Was sehen sie? Richtig, einen Regenschirm. Aus den Ergebnissen folgerten Wissenschaftler: Zusammengesetzte mentale Bilder werden genauso gut erkannt wie reale Bilder.
Tatsächliches Sehen und das Vorstellen von Bildern vor dem geistigen Auge scheinen zwei ganz verschiedene Paar Schuhe zu sein. Einig ist die Forschung sich da zwar nicht, aber einen spannenden Selbstversuch bietet der Kognitionspsychologe Benjamin Wallace an (Wallace 1984). Legen Sie doch mal Ihrem Lieblingskollegen folgende Bilder vor:
Abb. 6: Die berühmte Ponzo-Illusion
Legen Sie ihm zuerst Bild a) und dann Bild b) vor. Wenn Sie b) zeigen, bitten Sie noch kurz darum, Ihr Mitspieler solle sich ein umgekehrtes V vorstellen, das über den Linien liegt. Wie schätzt Ihr Kollege die Länge der beiden horizontalen Linien ein? Bei Bild a) liegt es auf der Hand, dass wir einer optischen Täuschung der Länge auf den Leim gehen. Bei b) mit dem vorgestellten umgekehrten V erreicht das Gehirn diese Täuschung sogar, ganz ohne sie zu sehen. Das Vorstellungssystem kann detaillierte optische Täuschungen produzieren.
Davon unterscheidbar ist ein System, das spezifisch bildliche Informationen verarbeitet. Mentale Bilder sind also spiegelbildliche Repräsentationen, die Menschen vor ihrem geistigen Auge entstehen lassen und dann in vielfältiger Art und Weise bearbeiten können. Wie stark unterschiedlich wir gesehene und vorgestellte Bilder verarbeiten, zeigte sich 1993. Der kognitive Psychologe Stephen Kosslyn belegte mit Kollegen in PET-Scans, dass die Aktivität des bildverarbeitenden Bereichs im Gehirn bei vorgestellten Bildern höher ist als bei gesehenen Bildern. Inzwischen können die Forscher mit PET-Scans dabei zuschauen, wie wir z.B. bildliche Inhalte in unserem Arbeitsgedächtnis zwischenspeichern. Wenn wir solche Inhalte im Arbeitsgedächtnis präsent halten, ist eine Aktivität in Areal 47 zu sehen – wenn Sie hingegen verbales Material codieren, ist Aktivität in Areal 8 zu beobachten (s.a. Abb. 7).
Abb. 7: Die Bereiche für das geistige Auge
Hinzu kommt jetzt noch eine Art Meeting-Point, der diese beiden Arten von Information in Episoden zusammenfügt, der sogenannte episodische Puffer. Es handelt sich dabei um ein multimodales Speichersystem mit begrenzter Kapazität. Es kann sowohl visuelle als auch phonologische Informationen in Form von »Episoden« speichern. Das machen wir alle im Alltag, wenn wir Eselsbrücken beim Lernen neuer Infos bauen. Wir bündeln verschiedene Informationen zu einer leicht zu merkenden Episode. Die Verbindung zum Langzeitgedächtnis ist dabei wie eine Art »Download«. Informationen aus dem Langzeitgedächtnis werden im episodischen Puffer zwischengespeichert. Nun stellt sich abschließend die Frage, wie diese Informationen aus den einzelnen Prozessen zusammengeführt und mit bereits gespeichertem Wissen vernetzt werden. Baddeleys Antwort darauf ist gleichzeitig die am wenigsten untersuchte Komponente seines Modells: durch die zentrale Exekutive.