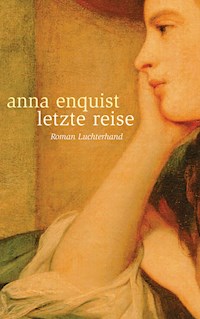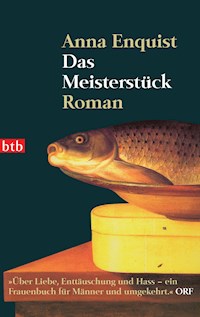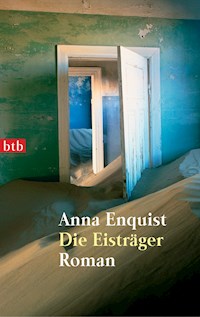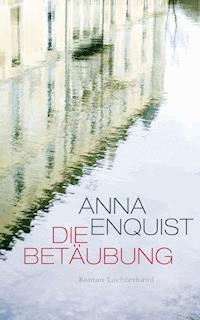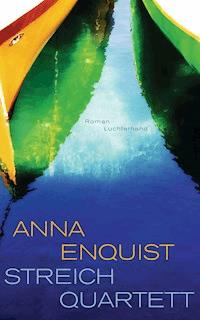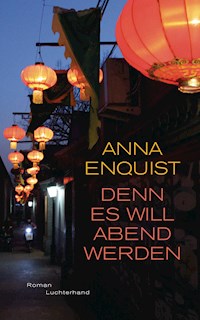
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Wie lebt man weiter nach einer traumatischen Erfahrung? Der Abstand zwischen Menschen, die sich lieben, die guten Absichten, die stillen Verwünschungen und missglückten Annäherungen – all das beschreibt Anna Enquist meisterhaft in ihrem neuen Roman. Nach einer traumatischen Erfahrung findet das Ehepaar Carolien und Jochem keinen Trost mehr im anderen, sie ziehen sich zurück, kapseln sich ab, kämpfen allein mit ihrer Angst und Wut. Ihre Freunde Hugo und Heleen, die das Unglück miterlebt haben, reagieren mit Verdrängung und Flucht. Sie schämen sich, weil sie einander nicht helfen konnten, aber sie reden nicht darüber. Und das Streichquartett, das den vier Musikern stets Freude bereitet und über vieles hinweggeholfen hat, gibt es nicht mehr. Doch als Carolien nach Shanghai aufbricht, wo Hugo einen neuen Job angenommen hat, empfindet sie zum ersten Mal nach langer Zeit wieder so etwas wie Freiheit und sogar Glück. Allmählich scheint Licht ins Dunkel zu dringen … Ein vollkommen eigenständiger Roman der großen niederländischen Autorin, der dort einsetzt, wo ihr letzter Roman »Streichquartett« ein dramatisches Ende nimmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Ähnliche
Zum Buch
Vier Freunde, die in ihrer Freizeit in einem Streichquartett musiziert haben, müssen damit klarkommen, dass sie von einem Verbrecher als Geiseln genommen wurden und das Hausboot, Schauplatz ihrer Musik wie der Gewalttat, bei einer Explosion zerstört wurde. Sie haben überlebt, ziehen sich aber voneinander zurück, kämpfen allein mit ihrer Angst und Wut. Das Streichquartett, das den Musikern stets Freude bereitet und über vieles hinweggeholfen hat, gibt es nicht mehr.
Jeder geht anders mit dem schlimmen Erlebnis um: Hugo, der Besitzer des Hausboots, arbeitet als Konzertmanager in China. Heleen hat ihr Leben komplett umgekrempelt und will von ihren Freunden nichts mehr wissen. Der Instrumentenbauer Jochem hat sich in ein neues Atelier samt Pförtner und Videoüberwachung verkrochen. Und seine Frau Carolien reist, als sie weder in ihrer Ehe noch in ihrem Beruf als Ärztin eine Zukunft sehen kann, zu Hugo nach Shanghai und lernt ausgerechnet in China, wie sich Befreiung, vielleicht sogar Glück anfühlt. Und ganz allmählich scheint Licht ins Dunkel zu dringen …
Der neue, vollkommen eigenständige Roman der großen niederländischen Schriftstellerin setzt dort ein, wo ihr letzter Roman »Streichquartett« ein dramatisches Ende nimmt, und erzählt fesselnd und psychologisch überzeugend von den Folgen einer traumatischen Erfahrung.
Zur Autorin
ANNA ENQUIST wurde 1945 in Amsterdam geboren. Sie wuchs in der niederländischen Stadt Delft auf, studierte Klavier am Königlichen Konservatorium in Den Haag, anschließend Klinische Psychologie in Leiden und arbeitet als Psychoanalytikerin. Seit 1991 veröffentlicht sie Gedichte, Romane und Erzählungen. Anna Enquist zählt neben Margriet de Moor und Harry Mulisch zu den bedeutendsten niederländischen Autoren der Gegenwart. Ihre Werke wurden in 15 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen internationalen Literaturpreisen ausgezeichnet. Anna Enquist lebt in Amsterdam.
Zur Übersetzerin
HANNI EHLERS, geboren 1954 in Ostholstein, studierte Niederländisch, Englisch und Spanisch am Institut für Übersetzen und Dolmetschen der Universität Heidelberg und ist die Übersetzerin von u. a. Renate Dorrestein, Eva Meijer, Connie Palmen und Leon de Winter.
Anna Enquist
Denn es will Abend werden
Roman
Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers
Luchterhand
1 Nichts bleibt, wie es ist, denkt Jochem, während er sich langsam um die eigene Achse dreht und den Blick durch das neue Atelier wandern lässt. Alles ändert sich, so sehr du dich auch anstrengst, den alten Zustand aufrechtzuerhalten. Ich habe große Fenster, auch wenn ich sie hinter einem neumodischen Sonnenschutz mit eleganten Lamellen verstecke, damit ich mich in dem halb unterirdischen Kabuff wähnen kann, wo ich mich zu Hause fühlte. Ich habe weiße Wände, Regale ohne jeden Kratzer, Arbeitsoberflächen aus rostfreiem Stahl und tadellose Schränke mit Schiebetüren. Dagegen ziehe ich zu Felde, bewehrt mit dem mitgebrachten Krempel: verschmierte Leimtöpfe mit eingetrockneten Resten, Beitel mit abgenutzten Griffen, steinalte Innenformen und dreckige Lappen. Um das Neue zunichtezumachen, verstreue ich überall Altes. Aber das Gleiche ist es nicht. Die Decke ist höher, die Leuchtstoffröhren sind greller. Über der Werkbank hängt eine fahrbare OP-Lampe. Nur die Schublade geht noch genauso schwer auf wie früher, darin liegen die Zahnarztspiegel und die Haken, mit denen ich in die F-Löcher komme, zwischen schmutzigen Pinseln und Harzbröckchen.
Das Atelier ist L-förmig, und am Ende vom kurzen Fuß hat es direkt etwas Wohnliches. Da sind eine Spüle und eine Anrichte mit Elektrokochplatten und Kaffeemaschine, hinter einer undurchsichtigen Glaswand Dusche und Toilette. Dazu eine Couch, auf der man schlafen könnte, und ein Esstisch, auf dem jetzt benutzte Tassen und ein Zuckertopf stehen. Dieser häusliche Teil ist durch eine hohe Regalwand vom Atelier abgetrennt. Sie ist zur Küchenseite hin mit Geschirr, Handtuchstapeln und Klamotten bestückt. Zum Arbeitsbereich hin sind die Bretter gefüllt mit Schraubgläsern zur Aufbewahrung von Lacken, Geigenbauzeitschriften in verschiedenen Sprachen und Kartons voll notwendigem Krimskrams: Dämpfer, Stege, Saiten, Stimmstöcke, Schulterstützen. Es sieht schon richtig schön voll aus, stellt er mit Befriedigung fest.
Er knipst die OP-Lampe an und besieht eine Geige, die in einer Wiege aus Schaumgummi auf der Werkbank liegt. Was fehlt dir, darf ich dich kurz untersuchen? Er ist ein freundlicher Kinderarzt. Keine Angst, es tut nicht weh, und das Licht ist nur deshalb so grell, damit ich besser sehen kann. Vorsichtig zupft er mit dem Daumen die Saiten an, eine nach der anderen. In Ordnung. Auf der einen Schulter des Instruments ist der Lack verschlissen. Der Steg steht nicht ganz gerade und sieht aus, als könnte er jeden Moment umklappen. Ein kleiner Riss unter dem rechten F-Loch? Nein, der ist dicht, eine alte Narbe. Jochem fließt über vor Fürsorge, denkt an alles, was er für die Geige tun könnte, gleichzeitig, als fächerten sich seine Gedanken in vier oder fünf verschiedene Bereiche auf. Er wiegt sich auf seinen dicken Schuhsohlen, hin und her und vor und zurück, und erwägt, womit er anfangen soll. Bevor wir uns an die Untersuchung machen, muss das Baby gebadet werden, beschließt er. Aus der Rumpelschublade nimmt er zwei Porzellanschälchen. In das eine streut er feingemahlene Diatomeenerde, in das andere gibt er ein wenig Öl. Dann windet er einen Lappen um seinen Zeigefinger, den er erst in das Öl und dann auch leicht in das Pulver tunkt. Sachte beginnt er über die Geige zu reiben.
Er erschrickt, als das Telefon klingelt. Der Apparat steht auf dem Tisch am Eingang, neben seinem Computer und einem Stapel Papiere. Jochem legt den Lappen weg und nimmt den Telefonhörer ab.
»Eine Dame für Sie, mit einem Kasten«, sagt der Pförtner. »Nach oben gehen lassen?«
»Nein, ich komme sie holen.«
Während des Gesprächs schaut er auf einen Schirm hoch, auf dem in bläulicher Tönung der Empfangsbereich des Gebäudes zu sehen ist. Eine kleine Frauengestalt mit Strickmütze auf dem Kopf steht verloren auf den Marmorfliesen, einen Gambenkasten unter den Arm geklemmt. Er wirft einen letzten Blick auf seinen Arbeitsraum: Terminkalender offen auf dem Tisch, die Verabredung mit der Gambistin steht drin. Alles stimmt. Er geht noch einmal kurz herum, prüft, ob die Tresortür abgeschlossen ist, und zieht an den enormen Schubladen eines niedrigen Schranks. In der obersten liegt großformatiges Papier, die unterste ist noch leer. In der mittleren bewahrt er Schleifpapier unterschiedlicher Stärken auf. Hinten in der rechten Ecke schimmert etwas, silbrig. Eine mittelgroße Pistole. Er nickt und schließt die Schublade.
Drei Treppen runter, dann kann er der Gambistin die Hand drücken.
»Das ist Ulrich«, sagt er, auf den Pförtner in seinem Glaskasten zeigend. Der breitschultrige Surinamer nickt der Gambenspielerin freundlich zu.
»Ich geh dir mal nach oben voraus«, sagt Jochem.
»Gibt es keinen Aufzug?«
»Um die Ecke!«, ruft Ulrich durch sein Fensterchen.
»Ich trag dir dein Instrument, komm.«
Jochem reißt ihr die Gambe aus den Händen und stiefelt die Treppen hinauf. Sie folgt ihm, sich ängstlich ans Geländer klammernd.
»So«, sagt er, als er Instrument und Spielerin hineingelotst und die schwere Tür zugemacht hat. Stiftschloss. Kette davor. »Setz dich, leg deinen Mantel ab.«
Sie zieht sich den Stuhl heran, der am Computertisch steht, knöpft ihren Mantel auf und setzt sich.
»Groß«, sagt sie, während sie im Atelier herumschaut, »viel größer als deine alte Werkstatt. Du bist schon ein gutes halbes Jahr hier, nicht? Sagt es dir zu?«
»Es ist besser. Der Eingang ist immer überwacht, niemand kann einfach reinkommen. Ich hab viel Platz und kann alles überblicken.«
»Du hast einen größeren Panzerschrank angeschafft.«
»Manchmal hab ich kostbare Instrumente hier, die kann man nicht offen rumliegen lassen, wenn man weg ist, finde ich.«
Die Gambistin schweigt. Sie schaut zu der Wäscheleine empor, an der Geigen zum Trocknen hängen, und atmet den Geruch ein.
»Du hast lackiert. Es riecht nach Lavendel. Bist du schon wieder voll in der Arbeit drin, nach allem, was passiert ist? Macht dir das Unglück noch zu schaffen?«
Jochem seufzt, holt sich den Hocker, der an der Werkbank steht, und nimmt darauf Platz. Er reibt sich über die Stirn, kratzt sich am Kopf.
»Tja, arbeiten tut gut. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Ich hab aber auch nicht so viel abgekriegt, bloß eine Kopfwunde und ein zugeschwollenes Auge. Das war schnell verheilt. Carolien hatte mehr Pech, die hat einen Finger verloren. Und Heleen hat sich das Bein gebrochen, ganz blöd. Hugo hatte überhaupt nichts.«
»Ich hab’s in der Zeitung gelesen«, sagt die Gambistin, »und dann haben auch alle davon geredet. Dass es ein Wunder sei, dass ihr das überlebt habt. Ein Hausboot in die Luft jagen, auf dem sich Menschen befinden! Irrsinn!«
»Die Polizei musste diesen Kriminellen fassen. Der Mann war gefährlich und hat uns bedroht. Sie haben das schon überlegt gemacht, Sprengladungen vorn und hinten am Schiff. Wir befanden uns in der Mitte. Und spielten Quartett!« Jochem lacht verächtlich und zuckt die Achseln.
»Wie ist dieser Unhold eigentlich zu euch gelangt, war das Zufall?«
»Zufall, Zufall – der Mann war zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt und wollte sich aus dem Staub machen. Dass ihm das gelang, verdanken wir der logistischen Inkompetenz des Gefängniswesens. Kann man das Zufall nennen? Dass er auf dem Boot landete, war zumindest kein Zufall, denn unsere zweite Geige, Heleen, war in so ’nem idealistischen Verein und korrespondierte mit Häftlingen. Gegen die Einsamkeit. Sie hat diesem Schurken geschrieben. Durch sie wusste er, wo wir waren, was wir machten.«
»Es war also ihre Schuld? Lässt sich das wiedergutmachen? Spielt ihr denn wieder zusammen?«
Jochem wendet sich ab und klickt den Gambenkasten auf. Als er antwortet, hört sich seine Stimme verhaltener und ein bisschen heiser an. »Von zusammen spielen ist keine Rede. Steht auch nicht an. Carolien müsste neu streichen lernen, aber danach ist ihr nicht. Außerdem sind wir unsere Instrumente los. Die sind ins Wasser gefallen.«
Er hört die Frau erschrocken nach Luft schnappen. Ja, ja, das ist schlimm, denkt er, all die prächtigen, alten Instrumente durch Wasser und Dynamit zerstört. Mannomann!
»Aber die Versicherung kommt doch dafür auf, oder?«
Jochem hebt die Gambe aus dem Kasten und hält sie mit gestrecktem Arm von sich. Abstand. Schauen.
»Die anderen haben erkleckliche Summen eingestrichen. Ich hab gar nichts gekriegt. Aus den Verhören sei hervorgegangen, dass ich meine Bratsche selbst zerstört hätte. Na ja, ich hab sie auf dem Kopf dieses Kerls zertrümmert. Eigene Schuld!«
Ungläubig schüttelt die Gambistin den Kopf.
»Wie ungerecht. Das kann doch wohl nicht sein!«
Jochem schweigt. Die Frau windet sich auf dem Stuhl und ringt die Hände.
»Habe ich etwas Falsches gesagt? Ich bin manchmal zu direkt, ich weiß. Wie damals, als ich diesen Prospekt von den Gruppen zur Trauerverarbeitung mitbrachte. Das war aufdringlich. Ich sollte mich nicht in alles einmischen. Es geht mir einfach nahe, und dann tue ich so etwas, ohne nachzudenken. Es tut mir leid.«
Nach dieser Ansprache verschließt sie die Lippen. Jochem presst die Zähne aufeinander, dass die Kiefermuskeln spielen, und knurrt wie ein böser Hund.
»Du meinst es gut. Auch damals. Wir hatten unsere Kinder verloren, du wolltest uns eine Hilfestellung geben. Vielleicht warst du der Meinung, dass es nach so vielen Jahren mal genug sein müsste mit der Trauer. Dass so ’ne Gruppe nichts für uns war, konntest du ja nicht wissen. Es ist oft komplizierter, als man denkt. Ob unser Quartett je wieder zusammenkommt, hängt beispielsweise auch nicht davon ab, ob Instrumente verfügbar sind. Ich hab das ganze Atelier voller Instrumente, darum geht es gar nicht. Was diese Explosion bedeutet, darum geht es. Hat sie uns in eine unvorhergesehene Zukunft gesprengt?«
Er erschrickt über seine eigenen Worte, zieht die Gambe an sich und inspiziert die Fugen. Es ist still. Die Leuchtstoffröhren summen.
»Besser, man begibt sich in die Vergangenheit zurück«, sagt die Gambistin, die sich wieder gefangen hat. »Das ist in der Musik auch so. Die alten Handschriften studieren, die Instrumente so restaurieren, dass sie wieder im ursprünglichen Zustand sind. Zurück nach früher, das ist aufrichtig, das verschafft Befriedigung. Es gibt einem Halt. Oder vergaloppiere ich mich jetzt schon wieder?«
»Ich weiß nicht, ob ich auf so ’ne Art von Halt scharf bin«, brummt Jochem. »Lass uns mal deine Gambe anschauen. Was kann ich tun?«
Mit dem Rücken zu der Frau beklopft er das Instrument, den Kopf ein wenig schief gelegt, um die Resonanz gut hören zu können. Innerlich fluchend. Meinungen, kleinliche Ansichten, denkt er, Gottogott! Zurück nach früher, wie stellt sie sich das vor? Früher hatte meine Frau eine nette Hausarztpraxis, und ich arbeitete mit Vergnügen in einem Atelier zu Hause. Früher hatten wir eine lebendige Familie mit zwei heranwachsenden Söhnen. Früher waren wir Eltern. Hatten wir Freunde, mit denen wir in einem Streichquartett spielten. Im Laufe der Jahre ist alles eingestürzt. Die Kinder verunglückt, das Quartett auseinandergesprengt. Carolien apathisch und zu nichts fähig. Und ich? Ich habe in den Monaten nach diesem hirnrissigen Abend, an dem sie Hugos Hausboot in die Luft jagten, vor Angst gezittert. Habe die Ausziehtusche verkleckst und verschmiert, wenn ich ein Etikett signierte. Bauchschmerzen, wenn ich Schritte im Garten hörte. Wenn das Telefon klingelte, ließ ich vor Schreck alles fallen. Paranoid, sagt Carolien. Realistisch, sage ich. Nur weil ich diesen exorbitant teuren Raum mieten konnte, hab ich’s überhaupt fertiggebracht weiterzuarbeiten. Hier ist es sicher, so sicher wie möglich zumindest. Ich habe mir in Belgien eine Waffe gekauft, über einen befreundeten Kollegen in Brüssel. Ist natürlich nicht erlaubt, aber für mich eine Beruhigung. Aus mir ist einer geworden, der den ganzen Tag seine Angst bezwingen muss und deswegen zu illegalen Mitteln greift. Alles nur, um beschäftigt zu sein und arbeiten zu können, um mich auf harmlose Holzinstrumente konzentrieren zu können, die keinem was zuleide tun. Dieser Schlag mit meiner Bratsche hat überhaupt nichts ausgerichtet; eine Bratsche sollte ja auch singen und nicht als Schlagwaffe herhalten. Und dann kommt so ’ne Kundin rein und fordert mich auf, nach früher zurückzukehren. Ich sollte sie beim Kragen packen und hochkantig rausschmeißen, diese klägliche Gambe gleich hinterher.
Er merkt, dass er keucht. Nicht gut. Diese Frau hilft, sie bringt mir ein Problem, mit dem ich mich befassen kann. Sie ist eine Kundin. Sie hat meine Aufmerksamkeit verdient, vielleicht sogar Dankbarkeit.
»Ich verstehe, was du meinst«, sagt er. »Man ist immer in die Vergangenheit verliebt, wenn man in so ’ner Barocktruppe spielt wie du. Für mich ist das was anderes, ich kann die Gegenwart nicht aussperren. Heutzutage will man Stahlsaiten und ein grotesk hochgeschraubtes Instrument, um einen Saal mit zweitausend Leuten bespielen zu können. Dann kann ich zwar argumentieren, dass so ein Cello zu Mozarts Zeit anders klang, aber das interessiert sie nicht. Und ich sage mir längst, ich kann froh sein, dass es überhaupt noch Menschen gibt, die Musik machen, wenn auch auf andere Art als früher.«
So, daran hat sie jetzt ’ne Weile zu knabbern. Er erzählt ihr, dass die Fugen an zwei Stellen geleimt werden müssen. »Es ist kalt gewesen, da kriegst du’s dann mit trockener Luft zu tun, und das Holz fängt an zu arbeiten. Ich kann auch den Lack etwas nachbessern.« Er zeigt auf die Stellen, wo der Lack stumpf geworden ist. Die Gambistin nickt.
»Unser Consort hat nicht viel zu tun, aber wir proben trotzdem. Das ist ein Muss. Wir sind Träger der Kultur, so empfinde ich es. Du auch, mit dem Bau und der Restaurierung. Wenn wir das bleiben lassen, geht alles in die Brüche.«
»Ja«, sagt Jochem langsam, »mag sein, dass es so ist, wir sind Träger der Kultur. Aber wer trägt uns?«
2 Carolien hat den Küchentisch abgeräumt. Hat das schmutzige Geschirr langsam zur Spüle getragen. Hat mit einem Tuch in der linken Hand die Oberfläche abgewischt. Nun zieht sie sich einen Stuhl heran und setzt sich an den Tisch. Sie blickt in den Garten hinaus, eine trostlose graue Wüstenei. Ärger flammt auf, als sie die verblühten Hortensien sieht. Abschneiden, denkt sie, weg damit, fort mit diesen Zeugnissen eines besseren Lebens. Kahl und leer soll es sein. Das Zimmer der Kinder werde ich auch ausräumen. Alles in Kartons, und die stelle ich in Jochems früheres Atelier. Eine Aufgabe. Wenn ich so weit bin. Zumindest ein Vorhaben.
Sie bettet den Kopf mit der linken Wange auf den Tisch und schielt durch die Wimpern auf ihre rechte Hand, die sie danebengelegt hat. Daumen, aufragender Fingerberg. Als wäre alles in Ordnung. Dann hebt sie den Kopf und betrachtet die entstellte Hand von oben. Wo der kleine Finger sein müsste, ist ein knochiger Knubbel mit straff gespannter Haut darum herum. Weiße Narbenstränge von den Nähten. Schön verheilt, sagte der Chirurg. Weinen, das täte ihr bestimmt gut, um ihren verlorenen Finger und die Dinge trauern, die sie damit machen konnte. Fotomodelle, die sich die kleinen Zehen entfernen lassen, um in enge Schuhe hineinzupassen, fallen um, können nicht mehr laufen. Und dann zu sagen, der Verlust eines kleinen Fingers sei nicht schlimm! Du kannst problemlos streichen lernen, sagt Jochem, es gibt zahllose Beispiele von Musikern, die verstümmelte Hände haben und trotzdem einwandfrei spielen können. Sie könne ihre Tätigkeit als Hausärztin ganz normal ausüben, sagt der Vertrauensarzt, bei dem sie regelmäßig erscheinen muss, um ihre Rückkehr ins Arbeitsleben zu erörtern. Eingaben in den Computer könne man mit zwei Fingern machen. Für das Abklopfen eines Rückens oder einer Brust brauche man den kleinen Finger nicht unbedingt.
Sie stellt sich vor, wie sie aus dem Sprechzimmer kommt und den nächsten Patienten aus dem Wartezimmer holt. Eine im Laufe ihrer fünfundvierzig Jahre in Fleisch und Blut übergegangene Gepflogenheit lässt sich nicht rechtzeitig zurückhalten: Sie gibt dem Patienten die Hand. Eine viel zu schmale, unheimliche Hand. Der Patient erschrickt, er hat mit den Fingern den gruseligen Knubbel gestreift, und sieht sie mit großen, fragenden Augen an. Ja, würde sie denken, du hast recht, geh ruhig zu einem anderen, ich bin unbrauchbar, geh, hau ab.
Ich muss raus, denkt sie, ich darf nicht nur hier rumhocken. Aber sie bleibt wie festgefroren auf dem Küchenstuhl sitzen. Ein bisschen was von Jochems Tatendrang müsste ich haben, von diesem Vermögen, sich unbekümmert zu erheben und in Aktion zu treten. Wenn ich nur die Beinmuskeln anspanne, ist mir, als fiele ein schwerer nasser Lappen auf mich herunter. Wie ausgefüllt meine Tage früher waren. Nicht mehr vorstellbar. Arbeit, Unternehmungen mit Heleen, ein Schwatz mit Daniel, Cello üben, Besuche bei meinem alten Dozenten, das Quartett. Von der noch weiter zurückliegenden Zeit lieber gar nicht zu reden. Mutter sein! Diese Identität ist schon länger gestrichen.
Bin ich depressiv? Und ob ich das bin. Kein Appetit, schlecht schlafen, zu nichts Lust haben, alles grau in grau sehen. Keine Therapie wollen, keine Medikamente in Erwägung ziehen, keine heilsamen regelmäßigen Spaziergänge bei Tageslicht. Also auch noch masochistisch. Als ich vom Konservatorium abging, um Medizin zu studieren, hielt ich das für einen famosen Beschluss. Und jetzt? Wäre ich nicht Ärztin, hätte ich auch keinen Beruf zu verlieren. Dann wäre ich jetzt bloß eine behinderte Cellistin.
Auf einem Ast des Apfelbaums sitzt eine Amsel. Tiefschwarzes Federkleid, orangefarbener Schnabel. Vogelfutter aufhängen, das sollte ich tun, und auch das tue ich nicht. Meisenknödel, Erdnussschnüre, pfui Teufel! In einer fließenden Bewegung lässt sich der Vogel auf den Boden nieder, wo er hastig und schludrig in den verdorrten Blättern zu rascheln und zu picken beginnt. Die souveräne Ruhe, die er ausstrahlte, als er auf dem Ast saß, ist schlagartig verschwunden, so wie er jetzt aufs Geratewohl und planlos herumwuselt, macht er einen aufgeregten Eindruck. Was sucht er? Ausrangiertes, runtergefallenes Zeug. Bescheuert. So ein Trottel. Ungezieltes Handeln bringt überhaupt nichts, sollte man lassen. Aber worauf das Handeln ausrichten? Red doch mal mit dieser netten Cellistin, sagte Jochem, dieser Frau, die am Konservatorium Technik unterrichtet. Wenn Schüler ihre Haltung oder Streichtechnik ändern müssen, gehen sie zu ihr. Sie kennt sich aus und kann dir bestimmt helfen. Ich hab hier auch noch ein hübsches Cello, auf dem kannst du spielen. Er hatte aus seiner neuen Werkstatt einen Bogen mitgebracht und auf den Tisch gelegt. Ein leichter Bogen, sagte er, probier mal. Sie wollte ihn nicht anfassen. Unterricht nehmen, jemandem mit zehn Fingern die ungelenke Hand zeigen – nein.
Sie denkt an ihren alten Lehrer, der bei der Jagd auf den flüchtigen Kriminellen so unglücklich in Mitleidenschaft gezogen wurde – ein harmloser, einsamer Mann, der mit Ach und Krach selbstständig in seinem großen Haus lebte und den sie regelmäßig aufsuchte, um etwas vorzuspielen oder nach ihm zu sehen. Der Verbrecher, der in das Hausboot eindrang, sah die Adresse auf einer Partitur, die sich Carolien von dem betagten Musiker ausgeliehen hatte, und flüchtete in dessen Haus. In dem wirren Handgemenge, das sich dort entspann, als die Polizei das Haus stürmte, entkam der Bösewicht, und der alte Mann wurde umgerannt. Er fiel ins Koma, wird auf der Intensivstation am Leben erhalten. Keine Angehörigen, mit denen man sich über die Einstellung der lebensverlängernden Maßnahmen beraten könnte. Warten auf die tödliche Lungenentzündung.
Ich muss zu ihm. Jetzt den Vorsatz nicht gleich wieder beiseiteschieben, nicht argumentieren, dass es sinnlos ist, dass er seine Umgebung ohnehin nicht wahrnimmt, nicht merkt, ob jemand an seinem Bett steht, seine Hand hält. Einfach aufstehen, Autoschlüssel suchen, Mantel anziehen. Auch ein sinnloser Vorsatz ist ein Vorsatz. Die Haustür muss abgeschlossen werden, Jochem nimmt das sehr genau. Carolien dreht die Schlüssel einen nach dem anderen sorgfältig im Schloss um, mit Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger. Die Außenseite der Hand verschont sie. Es ist mühsam, aber es geht.
Im Auto bricht mit voller Wucht ein Streichquartett los, als sie den Motor startet. Schnell das Radio abstellen, danach ist ihr nun wirklich nicht. Aufpassen jetzt, langsam zum Krankenhaus fahren, den Weg kenne ich ja, und es ist nicht viel Verkehr. Dann einparken. Besuch auf der Intensivstation, ist das überhaupt erlaubt? Wahrscheinlich nicht, ich werde mich reinmogeln müssen. Eins nach dem anderen, nicht jetzt schon darüber nachgrübeln, was später vielleicht passieren könnte. Kreisverkehr, Blinker setzen, einordnen, gut so. Als sie den Wagen ins Parkhaus manövriert hat, bleibt sie sitzen. Sie lehnt sich zurück und schließt die Augen. Besichtigung der Ruinen, denkt sie, ich bin wie eine Touristin, die sich die Überreste einer alten Kultur ansehen geht. Hoffnung auf Genesung – davon kann nicht die Rede sein, das ist keine Option.
Sie nimmt den Aufzug zur Intensivstation. Völlig allein steht sie aufrecht in dem großen Raum, in den jeden Moment ein Bett hereingeschoben werden kann. Aber der Aufzug hält nirgendwo an, und sie kann ungehindert auf den Pfleger am Empfangstisch zutreten, der ganz in seine Bildschirme vertieft ist. Ein Mann um die fünfzig, sympathisches Gesicht, Brille. Er schaut auf, als er Caroliens Schritte hört. Sie stellt sich vor, und er zeigt lächelnd auf ein Schild an der Wand. Wegen Ansteckungsgefahr kein Händedruck!
»Ich komme wegen des Patienten van Aalst«, sagt Carolien. »Hausärztin.«
Halb gelogen. Oder eigentlich zu drei Vierteln.
»Wie geht es ihm?«
Der Mann zieht die Schultern hoch. »Keine Veränderung. Sie dürfen gern nach ihm sehen, das Bett links an der Wand.«
Sie betritt den Pflegeraum. Mit der linken Hand zieht sie einen Hocker unter dem Bett hervor, vorsichtig zwischen den Schläuchen und Kabeln hindurch. Dann setzt sie sich und betrachtet ihren ehemaligen Lehrer. Es dauert einen Moment, bis sie ihn wirklich erkennt, Menschen sehen so anders aus, wenn sie flach liegen, wenn sie keinerlei Kontakt zu ihrer Umgebung haben, wenn eine Röhre in ihrer Kehle steckt und eine Sonde in ihrer Nase. Er hat blutige Fingerknöchel, immer noch von diesem Handgemenge? Nein, das kann natürlich nicht sein. Waschen sie ihn nicht richtig, verheilt es nicht? Habe ich ihn je mit geschlossenen Augen gesehen? Er hat keine Hand frei, dass ich sie in meiner halten könnte. Kanülen, Heftpflaster, Elektroden. Er kennt mich, seit ich achtzehn war. Reinier van Aalst. Er weiß genau, wie ich spiele. Etwas Intimeres gibt es kaum. Nun verkleistern die Erinnerungen an mich, dort, in diesem brachgelegten Schädel. Die werde ich dann später allein mit mir herumtragen müssen. Bei ihm würde ich mich schon trauen, um Hilfe zu bitten, ihn zu fragen, wie ich ohne den kleinen Finger streichen soll. Aber das kann ich vergessen, er bewegt sich auf den Ausgang zu.
Sie legt ihre gute Hand auf die leichte Decke aus Waffelstoff, ungefähr dort, wo sie sein Schienbein vermutet. Wie ein Stock, steinhart und kalt. Muss ich jetzt etwas sagen, fragt sie sich, in dieses große Männerohr, meinen Namen flüstern? Der Pfleger kommt ans Bett.
»Wissen Sie, dass schon ein paarmal ein Junge zu Besuch hier war? Er hatte gestern eine blühende Hyazinthe dabei, er dachte, Herr van Aalst könne vielleicht riechen, auch wenn er nichts hören oder sehen kann. Blumen und Pflanzen haben hier natürlich nichts verloren, aber ich fand, es war ein lieber Einfall. Besuch geht eigentlich auch nicht, aber der Junge durfte ihn kurz sehen.« Er spricht leise, um die Patienten nicht zu stören. Soweit Carolien sehen kann, liegen sie allesamt bewusstlos und halb tot da.
»Wissen Sie, ob der Patient Angehörige hat? Wir würden uns gern absprechen, Sie verstehen. Ob wir weitermachen oder aufhören. Wenn niemand auftaucht, trifft das Team nächste Woche eine Entscheidung. Vorher noch ein EEG. Auf dem letzten war übrigens schon nichts mehr zu sehen, sagte der Neurologe.«
»Ja, dann ist es sinnlos, ihn weiterzubehandeln«, sagt Carolien mit ihrer Arztstimme. »Ob er Angehörige hat, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Er war zuletzt ein ziemlich einsamer Mensch. Dieser Junge mit der Hyazinthe wird das Kind sein, das Besorgungen für ihn machte, davon hat er mir erzählt, darüber war er sehr froh. Aber bis auf den Jungen hatte er kaum noch Kontakte. Ich habe hin und wieder Hausbesuche bei ihm gemacht.«
»Er liegt schon viel zu lange hier. Auf Druck von Instanzen, die uns über die Schulter schauen. Polizei, Justiz, der Bürgermeister. Todesfall infolge eines Polizeieinsatzes, so eine Meldung wollen sie vermeiden oder wenigstens so lange wie möglich hinausschieben. Aber jetzt wird es wirklich Zeit, wir sind auch wieder voll belegt.«
Apparate summen, dann und wann piepst etwas. Carolien erhebt sich und läuft mit dem Mann zum Empfangstisch zurück.
»Anfangs haben wir alles Mögliche ausprobiert, viele Reize, um zu sehen, ob er reagiert. Als dieser Junge erzählte, dass er Musiker war, haben wir ihm sogar Kopfhörer aufgesetzt und Musik vorgespielt.«
»Was denn?«
»Er habe ernste Musik gemacht, sagte der Junge, also haben wir André Rieu genommen.«
Mit Mühe unterdrückt sie ein hysterisches Kichern. Was hatte ich denn gedacht, das Ravel-Quartett oder ein interessanter Beethoven? Sie haben wenigstens etwas tun wollen, haben sich Gedanken gemacht, etwas ausprobiert.
»Und, hatte das irgendeinen Effekt?«
Der Pfleger schüttelt den Kopf. »Nein. Schade, nicht?«
Auf dem Empfangstisch blinkt ein rotes Lämpchen. Ein Telefon klingelt. Der Mann schiebt sich auf seinen Platz und beginnt, auf Tasten zu drücken. Carolien winkt ihm zu und wendet sich ab.
Jetzt herrscht Betrieb im Aufzug. Leute in den verschiedensten weißen und blauen Kitteln, die, verpackte Brötchen in der Hand, auf ihre Handys schauen. Carolien zwängt sich in eine Ecke und starrt über die Köpfe hinweg auf den Schirm, der in quälendem Schneckentempo die Stockwerke anzeigt. Endlich das Untergeschoss, endlich raus. Sie geht langsam zu ihrem Auto. Das lief sehr gut, es ist mir gelungen, und ich habe mich normal verhalten. Dass ich darüber nun derart zufrieden bin, ist wiederum lächerlich. Stattdessen sollte mich bewegen, was dort oben geschieht. Der wer weiß wievielte Verlust. Ein Freund, der stirbt, ohne sich dagegen sträuben zu können.
Sie schüttelt den Kopf, steigt ein und lässt den Motor an. Als sie zur Straße hinaufkommt, erschrickt sie über die gleißende Sonne, die durch die Bewölkung hindurchgebrochen ist. Die Erinnerung an ein Vorkommnis auf der Autobahn befällt sie. Vier Fahrspuren und mittendrin ein mächtiger Schwan, der mit einem Flügel am Asphalt festhing. War ein Lastwagen darübergefahren, ein Bus? Das Tier versuchte, sich mit unbeholfenen Bewegungen seiner schwarzen Füße und Schlägen des anderen Flügels zu befreien, drehte den langen Hals in alle Richtungen, zischte durch den aufgesperrten orangefarbenen Schnabel. Im Mordstempo fuhren zu beiden Seiten Autos an ihm vorbei. Auch sie selbst. Warum fällt mir das jetzt ein? Ist der Schwan Reinier, der sich ohne die geringste Aussicht auf Erfolg gegen den Tod stemmt?
Sie sieht ihre verunstaltete Hand auf dem Lenkrad liegen. Stell dich nicht so dumm, das bist du selbst. Gnadenlos im Hier und Heute festgenagelt, versuchst du in Panik und Schmerz, dich in Bewegung zu setzen, zu fliehen, während alle sehen, dass es hoffnungslos ist. Wie vom Donner gerührt wartest du darauf, dass ein Auto in voller Fahrt direkt auf dich zuhält, über dich hinwegrauscht, dich erlöst.
Zitternd stellt sie den Wagen am Straßenrand ab. Jetzt ruhig warten, bis das Schlottern nachlässt.
3 Jochem kommt nach Hause, es ist schon dunkel. Noch im Mantel zieht er alle Vorhänge zu. Kontrolliert, ob die Tür zum Garten abgeschlossen ist.
»Du hast die Haustür nicht mit dem Nachtschloss verriegelt«, sagt er, als er Carolien auf dem Sofa sitzen sieht. »Bist du weg gewesen?«
Er stellt eine Alupackung vom Fischgeschäft auf die Arbeitsplatte. Fertiggericht. Kabeljau. Der vage Fischgeruch verursacht Carolien Übelkeit.
»Kommende Woche werden sie van Aalst töten; ich war heute da.«
Keine Reaktion. Jochem schusselt herum. Hängt seinen Mantel auf, macht den Fernseher an und wieder aus. Seufzt. Erst als sie vor dem aufgewärmten Fischgericht sitzen, einander gegenüber am Küchentisch, sagt er etwas.
»Das ist der Lauf der Dinge. Hattest du etwas anderes erwartet? Es war längst vorbei mit ihm, da ist es doch gut, wenn das jetzt ein Ende hat. Du solltest nicht so in der Vergangenheit hängenbleiben. Die Dinge ändern sich. Du musst mitziehen.«
Ich muss überhaupt nichts, denkt sie. Schon gar nicht antworten und mich in ein Gespräch verstricken lassen, das sich ein ums andere Mal wiederholt. Er erwartet etwas. Er schaut. Wie? Misstrauisch, auch ermüdet. Wir zerren aneinander, und keiner rückt von der Stelle.
»Hat jemand angerufen?«
»Ja«, sagt Carolien, »aber ich gehe nicht ans Telefon. Deine Kunden werden schon im Atelier anrufen, und mir können Anrufer gestohlen bleiben.«
Sie hört es sich sagen und beginnt sofort, an dieser Aussage zu zweifeln. Würde ich nicht etwas von Heleen hören wollen? Wie ihre Reha verlaufen ist, wie sie sich nach dem Drama durchschlägt, mit welchem Gefühl sie auf ihre eigene Rolle zurückblickt? Nein, ich glaube nicht. Ich würde gern ihre Stimme hören, das schon. Was sie mit dieser Stimme sagt, kümmert mich nicht. Und Hugo, möchte ich mit ihm reden?
Sie merkt, dass sie auf einmal den Tränen nahe ist. Er fehlt mir, mir fehlen die Tage, an denen ich auf seine Tochter aufgepasst habe, ja, Laura fehlt mir, das ist es. Eine feste Einrichtung einmal die Woche, die meine ganze Hingabe verlangte. Heimliche Freude. Übertreib nicht so! Einfach nur ein kleines Mädchen, mit dem ich befreundet war, das mir vertraute und gern in meiner Gesellschaft war. Ich könnte Hugo doch anrufen, nicht? Fragen, wo er jetzt wohnt, welche Pläne er hat, wie es Laura geht. Vielleicht hat er mich ja angerufen. Auf diesem Festnetzanschluss? Nein, das ist Wunschdenken. Aber wenn ich mir etwas wünsche, kann ich doch auch selbst aktiv werden, oder? Bis zu den Knien im Sumpf des Hier und Jetzt, unmöglich, da Bewegung hineinzubringen.
Jochem hat weitergeredet. Wovon spricht er? Von einer Kundin, die voller Bewunderung für seine neue Werkstatt war. Für die Sicherheitsvorkehrungen, die Ruhe, die davon ausgehe. Er würde am liebsten Tag und Nacht im Atelier bleiben, er fühlt sich dort wohler als zu Hause. Warum sie nicht umzögen, sagt er, warum sie nicht woanders wohnten? Am besten irgendwo hoch oben, ohne direkten Zugang vom Erdgeschoss. Ein schönes Penthouse mit bewachtem Eingang. Er habe in letzter Zeit gut verdient, nicht dass Streichinstrumente wieder höher im Kurs stünden, aber immer mehr Leute wüssten ihn zu finden. »Wenn wir das Haus hier verkaufen, können wir überallhin.«
O nein, denkt sie, nicht wieder dieses Dilemma. Eingesperrt in einem Gefängnis hoch über den Häusern. Pflanzen in Kübeln auf dem Balkon, vom Wind gegeißelt. Immer dieser Abgrund, dieser wahnsinnige Abstand bis zum Pflaster unten.
»Es ist besser, unter Menschen zu wohnen«, hört sie ihren Mann sagen. »Hier ist es zu still, so am Stadtrand. Gleich gegenüber dieser Park, man weiß nie, was sich da alles versteckt. Und rund herum Garten, Bäume, Dunkelheit. Jeder x-Beliebige kann mühelos über den Gartenzaun klettern, und kein Mensch kriegt was davon mit und schlägt Alarm.«
Drei T-Shirts und zwei Strickjacken habe ich an, und immer noch ist mir kalt. Er schwitzt, er hat einen roten Kopf und eine feuchte Stirn. Jetzt wird er gleich noch einmal alle Türen kontrollieren, und dann geht er schlafen. Er hat Pläne und eine Tageseinteilung. Er weiß, was er zu tun hat. Erstaunlich. Nicht zu fassen.
Jochem bleibt kurz bei ihr stehen, bittet sie, den Thermostat später etwas runterzudrehen, sieht sie an. »Er war schon weg, Carolien. Und er war alt. So ist das nun mal.«
Sie hört seine schweren Schritte auf der Treppe, das Plätschern im Klo, den Wasserfall aus dem Hahn im Badezimmer. Erst als es oben völlig still ist, erhebt sie sich und geht zur Küchentür. Sie schlüpft hinter den zugezogenen Vorhang und presst das Gesicht an die Scheibe. Als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, kann sie die Placken aus altem Laub auf dem Rasen ausmachen, da und dort mit einem grünen Halm dazwischen, der Ankündigung eines kaum vorstellbaren Frühlings. Im Apfelbaum sitzen Vögel mit aufgeplustertem Gefieder, Daunenbällchen, die geduldig auf das Ende der Nacht warten. Sie tastet nach der Türklinke. Abgeschlossen natürlich. Schlüssel auf der Dunstabzugshaube über dem Herd. Zweimal drehen. Kette lösen. Riegel zurückschieben. Schulter gegen die Tür. Offen.
Es ist windstill. Als sie über den Rasen läuft, steigt ein Geruch von vermoderndem Grün auf, nicht unangenehm eigentlich. Sie tritt mit Absicht gegen das Laub und die Zweige und atmet die Luft tief ein. Am Gartenzaun dreht sie sich um; sie lehnt sich mit weit ausgebreiteten Armen an die bemoosten Latten. Aus der Tasche der äußeren Strickjacke zieht sie ihre Zigaretten. Jetzt still und bedächtig eine rauchen. Zwischen den Bäumen erhebt sich das Haus, mit verdunkelten Fenstern. Das Haus, in dem sie mit ihrem Mann wohnt, in dem sie ihre Kinder haben aufwachsen sehen, aus dem sie die Kinder zum Krematorium hinausgetragen haben und in dem sie danach weitergelebt haben. Das Haus, in dem sie Quartett gespielt haben mit Hugo und Heleen. Das Haus, in dem Jochem seine Instrumente baute, in der Werkstatt neben der Eingangstür; in dem sie ein sogenanntes Arbeitszimmer hat, oben, voll veralteter Lehrbücher und Stapeln von Cellonoten. Etüden, Übungen. Einen Notenständer mit Bachsuiten darauf, als könnte sie jeden Moment wieder dort Platz nehmen. Unvorstellbar. Sie drückt die Zigarette am Holz aus und wirft die Kippe über den Zaun in den Park hinein. Sterne sind keine zu sehen, der Himmel ist wolkenverhangen. Am Fußweg durch den Park steht eine Laterne, die den Garten in spärliches Licht taucht. Lange, vage Schatten. Was tue ich hier, unter den schlafenden Vögeln, warum kann ich selbst nicht schlafen, verspüre nicht den Drang, ins Bett zu kriechen und die Decke über mich zu ziehen?
Es fängt leise an zu regnen, zaghafte, laue Tropfen fallen auf ihr Gesicht. Jetzt, hier, denkt sie, ich bin in der Gegenwart, ich rieche den heranstürmenden Frühling. Nach drinnen gehen? Jochem die Treppe herunterkommen sehen, barfuß, mit grimmigem Gesichtsausdruck. Dass die Tür ihn geweckt habe, dass sie die immer abschließen müsse, dass sie nicht ganz bei Trost sei, mitten in der Nacht durch den Garten zu geistern und den Zugang zum Haus weit zu öffnen. Dass sie mal ein bisschen achtsamer sein müsse, sie lebe jetzt, aber sie wandle durch die Tage wie ein Zombie, man könne nichts mit ihr absprechen, so gehe das nicht weiter, das halte er nicht mehr aus, sie müsse aus diesem Winterschlaf erwachen, und zwar schnell.
Nein, auf so eine Tirade hat sie keine Lust. Sie lässt die Arme auf dem Gartenzaun ruhen und fühlt sich mehr und mehr vom Regen umschlossen. Ihre Wangen sind nass. Sie leckt die Tropfen von ihren Lippen. Hier. Jetzt.
4 »Du fährst einfach mit«, sagt Jochem, während er seinen Mantel anzieht. »Komm jetzt, bitte.«
Carolien steht zögernd vom Küchentisch auf. »Muss das sein? Ist es dir nicht lieber, wenn du allein hingehst? Ich hab überhaupt keine Lust dazu.«
Nein, das sieht man dir an, denkt er. Meine Mutter würde sagen: Dann mach der Lust mal Beine. Ich sage nichts. Ich hole ihren Mantel aus dem Flur und halte ihn ihr auf. Willenlos steckt sie die Arme in die Ärmel.
»Schuhe«, sagt er schroff. In der Diele murkst sie mit ihren Stiefeln herum. Die Haustür steht schon offen. Er atmet tief aus, als sie zusammen im Auto sitzen und er die Türschlösser klicken hört. Jetzt kann sie nicht mehr raus, denkt er. Wir sind pünktlich, es wird gutgehen, und irgendwann ist es auch immer wieder elf Uhr.
Der kleine Konzertsaal befindet sich in einer umgebauten Synagoge, geschmackvoll und ruhig. Heute Abend spielt ein Streichertrio – zu einem Quartett bekäme ich sie nicht mit, weiß Jochem, aber das hier muss machbar sein. Die Musiker spielen alle drei auf Instrumenten, die er selbst gebaut hat, das hat er seiner Frau gegenüber als Grund angeführt. Interesse an seiner Arbeit zeigen, dem Klang lauschen, für den er mitverantwortlich ist, das ist doch wohl nicht zu viel verlangt von einer Ehefrau? Sie nehmen hinten im Saal Platz, Carolien am Mittelgang, sie will niemand Fremdes in ihrer Nähe haben. Ihm fällt auf, dass sie auf ihren Schoß starrt und das Publikum nicht sieht. Er schon, er entdeckt Kunden und Bekannte, die er mit einem Nicken begrüßt. Carolien liest im Programmheft. Alles andere als abenteuerlich: eine Bach-Bearbeitung aus den Goldbergvariationen, ein Beethoventrio und das große Divertimento von Mozart. Einfach schöne Musik. Er ist gespannt, wie seine Instrumente klingen werden.
Als die Musiker aufs Podium kommen, sieht er eher den Glanz seines Lacks als ihre Gesichter. Eine kräftige Frau mit eckigem Gesicht trägt ihr Cello vor sich her und setzt sich in die Mitte. Die Geige wird von einem jungen Mann rechts von ihr gespielt, der mit seinem Notenständer herumfuhrwerkt. Das Instrument hat er derweil auf seine Knie gelegt – bloß nicht, denkt Jochem, der Erbauer, das ist gefährlich, du bist mit dem Ordnen deiner Partien befasst, und eh du dich’s versiehst, rutscht deine Geige runter, rums. Klemm sie dir unter den Arm, leg sie kurz weg! Ruhig Blut, gar nicht drum kümmern. Die Bratsche, auf der anderen Seite der Cellistin, sieht wirklich umwerfend aus. Der Mann, der sie spielt, mittleres Alter, Brille, war vorige Woche noch im Atelier, um das Instrument regulieren zu lassen. Neuer Steg, andere Saiten. Ein warmer und voller Klang mit klarem Kern. Jochem war zufrieden.
Sie fangen an, spielen die Aria und arbeiten sich durch einige der Variationen hindurch. Drei Generationen, denkt Jochem, die Cellistin ist Anfang sechzig, sie bringen technische Brillanz, spielerische Leichtigkeit und Erfahrung mit. Aber sie spielen wie Kinder. Sie geben das Lied wieder, das sie vor der Nase haben, als hätte es keine tiefere Bedeutung, als zählte nur die Oberfläche. Er schaut zur Seite. Carolien starrt zu den Galerien rechts und links vom Saal hinauf. Leer, sicher. Da würde sie wohl gern sitzen, denkt er, mit einem Tuch über dem Kopf und die Hand in einem riesigen Verband. Aber sie sitzt hier, direkt gegenüber von einer Frau, die unbekümmert auf einem Cello streicht. Die Stange des Bogens, mit gespreizten Fingern einer unversehrten Hand gehalten, liegt genau in ihrem Blickfeld.
Ein lauer Applaus nach der letzten Variation. Die Musiker verbeugen sich und setzen sich gleich wieder, um Beethoven in Angriff zu nehmen. Mit einem Mal klingen sie wirklich wie ein Trio, sie verweben ihre Partien und stimmen ihren Klang aufeinander ab. Jochem stupst Carolien an. Sie lächelt, er nickt.
»Was für eine schöne Bratsche«, sagt sie nach dem Finale. Siehst du, denkt er, sie kann es sehr wohl – zuhören, sich eine Meinung bilden, etwas sagen. Nachher gleich Nägel mit Köpfen machen. Ich hab keinen Bock mehr, mich ewig um eine schwermütige Invalidin zu kümmern, es muss was passieren, und das geht noch heute Abend los.
Es gibt keine Pause, aber die Musiker ziehen sich kurz zurück. Ein Schlückchen Wasser, Dehnübungen, neu stimmen.
Jochem lässt sich mitreißen, als das Divertimento beginnt. So gehört es sich auch, die Instrumente sind so gut, dass sie mich nicht mehr ablenken, sie bilden eine Brücke zwischen Mozart und mir. Deswegen die harte Arbeit, dafür tue ich es. Unglaublich, wie gut sie jetzt sind, wo sie am Anfang so lausig waren. Diese Bach-Bearbeitung ist aber auch zum Verzweifeln, wie soll man das spielen? Sie hätten lieber Mozarts Version der Bachfugen nehmen sollen. Im gleichen Idiom bleiben, Wert auf die Qualität der Instrumentation legen. Hätte dem Programm größere Kohärenz verliehen. Aber was regst du dich auf, hör einfach zu, verkneif dir die ewigen inneren Kommentare. Wir sitzen nebeneinander, es ist eine kleine Oase der Harmonie, für den Moment.
Stehende Ovationen am Schluss. Keine Blumen, derlei Frivolitäten hat man im Zuge der Einsparungen abgeschafft. Das Publikum schiebt sich aus dem Saal, überwiegend ältere Leute mit großen Taschen und Krückstöcken. Auch Carolien wendet sich Richtung Ausgang. Er fasst ihren Ellenbogen, um sie zurückzuhalten, zeigt zum Podium, als sie ihn fragend ansieht.
»Wir gehen noch kurz nach hinten. Hatte ich versprochen.«
»Geh du ruhig. Ich warte hier.«
»Du kommst mit.«
Er nimmt ihren Arm mit festem Griff und zerrt sie förmlich auf das Podium, durch die Zugangstür, in den Umkleideraum. Dort liegt die Bratsche im geöffneten Kasten auf dem Tisch. Der junge Geiger zieht sich gerade die Hose aus, um schnell wieder in seine normalen Sachen zu schlüpfen. Die Cellistin trinkt Bier aus der Flasche. Die Musiker begrüßen Jochem überschwänglich. Es entspinnt sich ein sprunghaftes Gespräch über das Programm, Höhepunkte und Patzer, den Zustand der Instrumente nach Jochems Eingriffen. Es kommen Leute herein, die ihre Glückwünsche übermitteln möchten, und eine Frau von den Veranstaltern bringt ein Tablett mit Sekt und Wein. »Es sind noch belegte Brote da«, sagt sie, auf den Tisch zeigend. »Im Kühlschrank stehen Bier und Erfrischungsgetränke.«
Carolien hat sich mit dem Rücken an die Wand gelehnt, sieht Jochem. Sie hat die Hand unter ihrem Blazer versteckt. Er lotst die Cellistin, mit der er sich über die Qualität der Saiten unterhält, zu seiner Frau und macht die beiden miteinander bekannt: »Marije, Carolien.« Freundliches Lächeln, aber kein Händeschütteln. »Ihr hattet denselben Lehrer, aber zu verschiedenen Zeiten, denk ich.«
Eine Unterhaltung in Gang bringen, wie krieg ich das bloß hin? Sie muss selbst auch mal was sagen, ich kann schlecht über ihren Kopf hinweg mit Marije über sie reden. Die freundliche Cellistin mit dem eckigen Gesicht nimmt ihm das Problem ab und kommt mit Carolien über van Aalst ins Gespräch. Er hört Carolien von ihrem Besuch im Krankenhaus und den traurigen Aussichten erzählen. »Er rannte weg, als die Polizei in sein Haus stürmte, fiel auf den Kopf und ist nie wieder zu sich gekommen.« Die Cellistin ist bestürzt und verstummt.