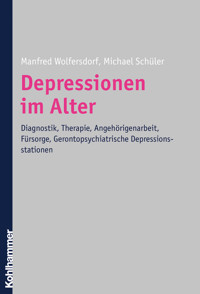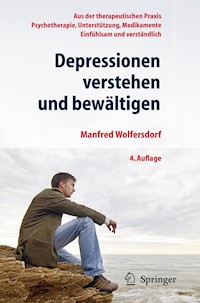Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Depression remained a manageable group of diseases for a considerable period, but today the diagnosis represents an endemic condition and encompasses a whole range of depressive-affective disorders. Due to the high demand for care, a variety of outpatient services, as well as special depression wards in many hospitals, have been developed at the authors= initiative to allow disorder-specific treatment of patients with severe depression. Against the background of the authors= decades of experience concentrating on patients with depression, this book shows the diversity of this clinical picture and of treatments for it & beyond the boundaries of ICD stereotypes & in a professional and scientific manner and with personal points of view, including social aspects and contemporary attitudes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autoren
Prof. Dr. med. Dr. h. c. (Rigas Stradins Universitate, Lettland) Manfred Wolfersdorf
Ehem. Ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses Bayreuth, Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Erlangen-Nürnberg (bis 30.09.2016) und ehem. Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am BKH-Bayreuth (bis 30.09.2016), jetzt tätig in Praxis. Dozent an der Universität Bayreuth. Gründer und Leiter des AK Depressionsstationen Deutschland-Schweiz 1982–2016.
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Gerd Laux
Ehem. Ärztlicher Direktor des kbo-Inn-Salzach-Klinikums (ISK), Wasserburg am Inn, Rosenheim, Freilassing, ehem. Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am ISK, niedergelassener Nervenarzt am MVZ Neuropsychiatrie in Waldkraiburg, Leiter des Instituts für Psychologische Medizin (IPM) in Soyen (Begutachtung Fahreignung), Konsiliararzt Geriatrie Klinik Haag und Professor an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Ludwig-Maximilians-Universität München.
E-Mail: [email protected]
Manfred WolfersdorfGerd Laux
Depressionen
Ein Erfahrungsbuch zu Diagnostik, Verlauf, Therapie und Prävention
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten, d. h. u. a. Angaben von Medikamenten, ihren Dosierungen und Applikationen, verändern sich fortlaufend durch klinische Erfahrung, pharmakologische Forschung und Änderung von Produktionsverfahren. Verlag und Autoren haben große Sorgfalt darauf gelegt, dass alle in diesem Buch gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Da jedoch die Medizin als Wissenschaft ständig im Fluss ist, da menschliche Irrtümer und Druckfehler nie völlig auszuschließen sind, können Verlag und Autoren hierfür jedoch keine Gewähr und Haftung übernehmen. Jeder Benutzer ist daher dringend angehalten, die gemachten Angaben, insbesondere in Hinsicht auf Arzneimittelnamen, enthaltene Wirkstoffe, spezifische Anwendungsbereiche und Dosierungen anhand des Medikamentenbeipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen und in eigener Verantwortung im Bereich der Patientenversorgung zu handeln. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2022
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-030647-9
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-030648-6
epub: ISBN 978-3-17-030649-3
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Depression, Melancholie: Historische Aspekte
2 Epidemiologische und gesundheitsökonomische Anmerkungen
2.1 Deutschland, Europa, weltweit
2.2 Soziodemografie, Alter und Geschlecht
2.3 Abschließende Bemerkungen
3 Klinisches Bild
3.1 Symptome einer depressiven Episode/eines depressiven Syndroms
3.1.1 Depressive Gestimmtheit
3.1.2 Depressives Denken und Erleben, Antrieb und Sprache
3.1.3 Kognitive Störungen
3.1.4 Sogenannte larvierte, d. h. körperbetonte depressive Syndrome
3.2 Burnout-Syndrom
3.3 Depressive Syndrome
3.3.1 Geschlechtsspezifische Depressionsformen
3.3.2 Anhaltende, sog. »chronische« Depression
3.3.3 Depression im Lebenszyklus
3.3.4 Somatogene Depression, Komorbidität somatische Medizin und Depression (u. a. Kardiologie, Onkologie, Dermatologie, Gynäkologie usw.)
3.3.5 Typologien und Sonderformen depressiver Erkrankungen
4 Ätiopathogenese
4.1 Neurobiologisch-somatisches Modell
4.1.1 Genetik
4.1.2 Neuropathologie
4.1.3 Bildgebung
4.1.4 Neurobiochemie
4.1.5 Neurotransmitterdysbalance, Rezeptoreffekte, Signaltransduktion
4.1.6 Neurogenese, neuronale Plastizität, neurotrophe Hypothese
4.1.7 Psychoneuroendokrinologie
4.1.8 Psychoneuroimmunologie
4.1.9 Psychophysiologie, somatische Krankheiten, Pharmaka
4.1.10 Chronobiologie
4.2 Psychologische Modelle
4.2.1 Psychodynamisches Modell
4.2.2 Kritische Lebensereignisse (Life Events), psychosoziale Faktoren/Stressoren
4.2.3 Kognitions- und lerntheoretische Modelle
4.3 Neuropsychologie, Persönlichkeit
4.3.1 Neuropsychologie
4.3.2 Persönlichkeitsfaktoren
4.4 Sozialpsychologische Modell (Brown und Harris), gesellschaftlich-soziologische Risikofaktoren
4.4.1 Sozialpsychologisches Modell
4.4.2 Gesellschaftlich-soziologische Risikofaktoren
4.5 Integrierte Modellvorstellungen – »Final common pathway«
5 Diagnostik, Diagnosekriterien/operationalisierte Diagnosen, Klassifikationen, Psychometrie und Differenzialdiagnosen
5.1 Diagnostik, Diagnosekriterien
5.1.1 Diagnosekriterien
5.1.2 Somatisches Syndrom
5.1.3 Anhaltende affektive Störungen (F34)
5.1.4 Atypische Depression, subdiagnostische Depressionen
5.1.5 Bipolare Depression
5.2 Klassifikationen
5.3 Doppeldiagnose-Problematik
5.4 Psychometrie, Selbst- und Fremdbeurteilungsskalen
5.5 Differenzialdiagnosen und Fehldiagnosen (inkl. »Resignative Trauer«)
5.5.1 Somatische Differenzialdiagnosen
5.5.2 Psychiatrische Differenzialdiagnosen
6 Therapie
6.1 Grundprinzipien
6.2 Akuttherapie
6.3 Erhaltungs- und Langzeittherapie
6.4 Pharmakotherapie
6.4.1 Antidepressiva: Substanzklassen, Einteilung
6.4.2 Wirksamkeit
6.4.3 Wirkpotenz im Vergleich
6.4.4 Akuttherapie
6.4.5 Auswahlkriterien
6.4.6 Risikofaktoren und Nebenwirkungsprofil
6.4.7 Klinisch-psychopathologisches Bild
6.4.8 Komedikation
6.4.9 Responseprädiktoren
6.4.10 Unerwünschte Wirkungen von Antidepressiva
6.4.11 Zusammenstellung der Nebenwirkungen nach Substanzklassen
6.4.12 Interaktionen
6.4.13 Kontraindikationen
6.4.14 Langzeittherapie-Erhaltungstherapie
6.4.15 Rezidivprophylaxe
6.4.16 Schwangerschaft und Stillzeit
6.4.17 Beendigung von Psychopharmakotherapie: Ausschleichen von Medikation
6.4.18 Verordnungspraxis, Pharmakoökonomie, Sozialpharmakologie
6.5 Andere biologische Therapien
6.5.1 Schlafentzugsbehandlung (»Wach-Therapie«)
6.5.2 Lichttherapie
6.5.3 Elektrokonvulsionstherapie (EKT)
6.5.4 Neuere biologische und experimentelle Therapieverfahren
6.6 Psychotherapie
6.6.1 Grundlagen
6.6.2 Psychodynamische Psychotherapien
6.6.3 Verhaltenstherapie und kognitive Verhaltenstherapie
6.6.4 Interpersonelle Psychotherapie, CBASP
6.6.5 Weitere und neuere Psychotherapieformen
6.6.6 Wahl des Psychotherapieverfahrens, Wirksamkeitsvergleiche
6.7 Begleittherapien
6.7.1 Körperliche Aktivität, »Sporttherapie«/Bewegung
6.7.2 Entspannungsverfahren
6.7.3 Soziotherapie
6.7.4 Komplementär alternativmedizinische Therapieansätze
6.7.5 Persönlichkeitsentwicklung – »Weisheitstherapie«
6.8 Kombinationstherapie – Integrierte Ansätze
7 Selbsthilfe – Selfmanagement; Angehörige
8 Verlauf, Prognose, Prädiktoren und Prävention
8.1 Verlauf und Prognose
8.2 Prädiktoren
8.3 Prävention
8.4 Resilienz, Religion
8.5 Fazit
9 Suizidalität und Depression
10 Versorgungsfragen: Wer versorgt depressiv kranke Menschen?
10.1 Allgemeinärztliche ambulante Versorgung
10.2 Fachärztliche Versorgung
10.3 Sektorübergreifende Versorgung
10.4 Stationäre Versorgung, spezialisierte Depressionsstationen
11 Abschließende Bemerkungen
12 Danksagung
Literatur
Sachwortregister
Vorwort
Am Ende unseres Berufslebens haben wir, Manfred Wolfersdorf und Gerd Laux, uns dazu entschlossen, ein Buch über das zu schreiben, was in den letzten Jahrzehnten der persönliche Schwerpunkt unserer Tätigkeit war und uns bis heute sowohl fachlich als auch persönlich beschäftigt, nämlich über »depressive Erkrankungen« und »depressiv kranke Menschen«.
In nun mehr als 40 Jahren hat jeder von uns über 60.000 depressive Patienten1 ambulant und stationär kennengelernt, untersucht, behandelt und auch über längere Strecken, z. T. über Jahrzehnte hinweg – sozusagen durchs Leben – begleitet. Beide Autoren waren und sind nicht nur in der Akuttherapie, sondern auch in der Langzeitbegleitung depressiv kranker Menschen tätig gewesen und haben so Lebensgeschichten über Jahrzehnte hinweg kennengelernt, begleitet und dabei Erfahrungen über das Leben depressiv kranker Menschen in ihrer Umwelt, ihrer Tätigkeit, hinsichtlich ihrer Person und ihrer persönlichen Perspektive, aber auch ihrer Lebensfähigkeit und Vitalität, ihrer Fähigkeit, sich auf neue Situationen einzustellen, sich mit einer manchmal anhaltenden Erkrankung, mit langfristigen therapeutischen Maßnahmen oder auch mit Veränderungen ihrer Lebenssituation zu arrangieren, gesammelt.
Man kann mit einer Depression oder auch mit wiederkehrenden Depressionen im Leben einen Bauernhof betreiben, eine Familie gründen, Manager, Verkäufer, Politiker, Geschäftsführer einer Firma oder auch Professor werden. Detaillierte Kenntnisse zur Diagnostik und Therapie depressiver Erkrankungen stehen zur Verfügung (siehe S3-Leitlinie/Nationale VersorgungsLeitlinie »Unipolare Depression«; DGPPN, BÄK, KBV, AWMF et al. 2015). Unsere Kenntnisse über individuelle Ursachen, zu Langzeitverläufen und zur Lebensgestaltung sind andererseits gering.
Unsere Biografien weisen viele Parallelen auf: Tätigkeit in großen Fachkrankenhäusern in Baden-Württemberg (früher Psychiatrische Landeskrankenhäuser, heute Zentren für Psychiatrie genannt), in Universitätskliniken, in bayerischen Bezirkskrankenhäusern und in den dortigen Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik und auch in Facharztpraxen. Unsere Wege haben sich vielfältig sowohl thematisch wie auch in der konkreten Arbeit immer wieder getroffen, da unser gemeinsames Interesse ja um das gemeinsame Thema »Depression und depressiv kranke Menschen« kreiste.
Vor 50 Jahren standen Depressionen nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit psychiatrischer Kliniken; stationär wurden vor allem sogenannte endogene Depressionen behandelt, bei entsprechender Schwere und/oder Chronifizierung auch »reaktiv-neurotische Depressionen«. Die Standardregel war jedoch, ein depressiv kranker Mensch geht erst dann in ein regionales Versorgungskrankenhaus, wenn die Schwere der Erkrankung so ausgeprägt und sozial beeinträchtigend ist, dass er in eine übliche psychosomatische Klinik nicht passt, wenn er akut suizidgefährdet ist, wenn er an einer »wahnhaften Depression« (heute depressive Episode mit psychotischen Symptomen) leidet oder auch wenn es keinen Kostenträger für eine zeitlich befristete Behandlung in einer psychosomatischen Klinik in schöner Landschaft gibt. »Reaktive Depressionen« und »neurotische Depressionen« gehören doch nicht in einer Klinik stationär behandelt; mit dieser Argumentation hatte einer der namhaften Ordinarien für Psychiatrie in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein vorgestelltes Forschungsprojekt zur stationären Behandlung gerade dieser Patientengruppen und damit die DFG-Förderung abgeschmettert. Depressionen bei Kindern und Jugendlichen wurden als sehr selten angesehen, in der Alterspsychiatrie war das Thema »Depression im höheren Lebensalter« ebenfalls noch nicht angekommen. Unsere klinischen Alltagserfahrungen in der Behandlung und langfristigen Begleitung depressiver Patienten im stationären Rahmen irritierten uns zunehmend und wiesen auf die Notwendigkeit einer klinikinternen intramuralen Differenzierung von Patientengruppen nach Störungsbildern und damit auf eine »Spezialisierung« (wie es damals genannt wurde in der heißen Diskussion um die »Sektorisierung versus Spezialisierung« nach Vorlage der »Psychiatrie-Enquete« in den 1980er Jahren) hin.
Manfred Wolfersdorf gründete 1976 mit seinem Team am Psychiatrischen Landeskrankenhaus Weissenau die »erste Depressionsstation« in Deutschland, Gerd Laux die zweite im Psychiatrischen Landeskrankenhaus Weinsberg. Für Ersteren lag der Behandlungsschwerpunkt in der psychodynamisch-tiefenpsychologischen Psychotherapie, fachliches Spezialgebiet wurde die Suizidologie, die Suizidprävention und die Frage, warum Menschen sich das Leben nehmen. Gerd Laux widmete sich der differenzierten Behandlung mit Antidepressiva (einschließlich Infusionstherapien und Therapeutischem Drug Monitoring), von denen neue Generationen von Präparaten in der Entstehung waren. Als Arzt und Psychologe spezialisierte er sich auf die Verkehrsmedizin und -psychologie (Fahrtauglichkeitsuntersuchungen), psychotherapeutisch lag der Schwerpunkt im Bereich (kognitive) Verhaltenstherapie und interpersonell-humanistischer Psychotherapie.
Heute sind Depressionen zur »Volkskrankheit« geworden. Die Beschreibung des Krankheitsbildes und die Definition der diagnostischen Kriterien erfuhr durch die ICD-10 und vor allem durch das Diagnostische und Statistische Manual (DSM-III bis nun DSM-5) der amerikanischen Psychiatrie eine deutliche Erweiterung. »Depressive Störungen« umfassen nun ein großes heterogenes Spektrum, dessen Grenzen unscharf geworden sind. Die unglückliche Festlegung, dass bei Vorliegen einer »depressiven Episode« nach ICD-10 diese als Achse I-Diagnose an erste Stelle gestellt werden müsste, führte bereits vor Jahren zu den kuriosen Auswüchsen, dass in einem Standardversorgungsfachkrankenhaus plötzlich zwei Drittel aller Patienten unter einer F3-Störung litten.
Das Stigma »Ich bin doch nicht verrückt« scheint bei depressiven Störungen am geringsten ausgeprägt zu sein, die Inanspruchnahme von fachlicher Hilfe auch bei leichten oder mittelschweren depressiven Erkrankungen scheint zugenommen zu haben, zumindest hört man dies von niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen sowie Ärztlichen und Psychologischen Psychotherapeuten, bei denen ein gutes Drittel bis manchmal die Hälfte aller Patienten solche mit primären depressiven Erkrankungen sind.
Aktuell besteht eine Diskrepanz (»Gap«) zwischen einer mit hohem Aufwand betriebenen internationalen (Grundlagen-)Forschung einerseits und einer unbefriedigenden Versorgungsrealität anderseits. Trotz immenser Forschungsbemühungen im Feld der Genetik, der Neurobiochemie, der Endokrinologie, der Psychoimmunologie, der Bildgebung und der Psychotraumatologie bleiben die Ursachen auch für Subtypen von Depressionen im hypothetischen Bereich »multifaktorieller und biopsychosozialer Modellvorstellungen«. Es gelang bisher nicht, die Wirksamkeit der ersten trizyklischen Antidepressiva zu verbessern, zerebrale Stimulationsverfahren wie die Transkranielle Magnetstimulation erreichen nicht die Wirksamkeit der in Deutschland immer noch tabuisierten Elektrokrampftherapie. Im Bereich der Psychotherapie wurden in der Nachfolge und z. T. aus den klassischen verhaltenstherapeutischen und tiefenpsychologisch-psychoanalytischen Konzepten störungsspezifische Verfahren für depressiv Kranke entwickelt; so die Kognitive Verhaltenstherapie (KVT), die Interpersonelle Psychotherapie (IPT) und speziell für chronische Depressionen das »Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy« (CBASP). Jüngst hält die sog. »Online-Psychotherapie« (Internet-basierte kognitive Verhaltenstherapie) Einzug in die moderne zeitgemäße Depressionsbehandlung. Die Zahl der Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, der Ärztlichen Psychotherapeuten und insbesondere der Psychologischen Psychotherapeuten in Deutschland hat zugenommen – dennoch bleiben depressive Patienten in manchen Regionen unversorgt und circa 30 % der Depressionen gelten als »therapieresistent« bzw. nehmen einen chronischen Verlauf.
Konzeptuell legen wir ein Buch mit persönlichen Akzenten vor: Einerseits enthält es wissenschaftlich-empirische Fakten im Sinne der evidenzbasierten Medizin (auf den klinischen Alltag bezogen und mit der Einschränkung, dass die Autoren sie so schildern, wie sie auch von ihnen erlebt wird), andererseits erlauben wir uns die Wiedergabe unserer persönlichen Sicht, basierend auf unseren langjährigen praktischen klinischen Erfahrungen. Diese persönlichen Anmerkungen werden im Folgenden durch einen eingefärbten Kasten hervorgehoben. Das große Spektrum depressiver Störungsbilder verdeutlichen wir durch Kasuistiken und damit »Patientenschicksale« aus dem eigenen Erfahrungsbereich, anonymisiert und auf Vignetten zur Darstellung des Wesentlichen reduziert. Vor allem zu den Themenkreisen Häufigkeit und Ursachen von Depressionen erlauben wir uns gesellschaftliche, sozialwissenschaftliche und zeitgeistkritische Überlegungen. Wir hoffen, so etwas Licht in den Nebel der »Allerweltsdiagnose Depression« bringen zu können.
Wir danken dem Kohlhammer Verlag, der sich mit uns auf dieses Projekt eingelassen hat, unseren Sekretärinnen für ihre langjährige Unterstützung und unseren Patienten, die uns lehrten, was es heißt, »depressiv krank« zu sein.
Im September 2021
Manfred Wolfersdorf Bayreuth/Hollfeld
Gerd Laux Soyen/Waldkraiburg/München
1 Im Text wird aus Gründen der Vereinfachung das generische Maskulinum verwendet; gemeint sind immer Frauen und Männer.
1 Depression, Melancholie: Historische Aspekte
Warum ist es sinnvoll, sich mit »Psychiatrie-Geschichte« zu beschäftigen, hier mit der Geschichte des Depressionsbegriffes bzw. der »Melancholie«, wie er früher genannt wurde? Zum einen erklärt das Wissen um die Entstehung des eigenen Faches, des Berufsstandes und der verwendeten Krankheitsbegriffe den heutigen Status in der gesundheitspolitischen und medizinischen Versorgung von Menschen und natürlich auch das Problem mit dem heute überbordenden Begriff der »depressiven Episode«. Die spezifischen naturwissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen, kulturspezifischen und im engeren Sinne medizinischen Fragen der Psychiatrie und hier bzgl. des Krankheitsbegriffes Melancholie/Depression, von der Symptombenennung über den Norm- und Krankheitsbegriff bis hin zur Psychodynamik, zu Ätiopathogenesekonzepten und zu psychosozialen und sozialpsychiatrischen Themen sind nur aus der Historie zu verstehen. »Depression« einfach als »depressive Episode« operationalisiert zu definieren und damit verstehen zu wollen, führt nicht zu einem vertieften Verständnis depressiv kranker Menschen, sondern bleibt an einer dünnen Oberfläche. Nur der Blick zurück führt zum Verständnis der Gegenwart und zu Perspektiven für eine Zukunft – die für Depressive besonders wichtig ist. Was bei jeder Befunderhebung für eine biografische Anamnese gilt, trifft auch auf das Verständnis von Psychiatrie und hier von Depression/Melancholie zu.
Versucht man eine – zugegebenermaßen ausgesprochen grobe – Gliederung der Geschichte der Psychiatrie zu erstellen, dann kann man drei große Zeiträume unterscheiden. Einen ersten Zeitraum, der vom Altertum bis ca. Ende des 18./Anfang des 19. Jahrhunderts reicht und den man mit »Geschichte des Wahnsinns« überschreiben könnte. Hier ging es um Fragen des »Raptus melancholicus«, um Wahn und Genie, um Tollheit u. ä. Die Psychiatriegeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts ist im engeren Sinne eine Geschichte der sich entwickelnden Krankenhauspsychiatrie, in der nun der krankhafte Aspekt psychischen Andersseins erkannt und akzeptiert wird und die Herausnahme aus der Gesellschaft (»Verwahrung«) und die Pathologie im Vordergrund stehen. Ein dritter Zeitabschnitt beginnt im 20. Jahrhundert und reicht bis in die Gegenwart und sicher weiterhin, der die »Geschichte der Psychiatrie als medizinisches Fach, als Behandlungsauftrag und als Forschungsgegenstand« versteht und in dem wir mit unserer heutigen Problematik um den Begriff »Depression« bzw. die Geschichte der Melancholie angesiedelt sind. Gaebel und Müller-Spahn (2002) haben Psychiatrie bezeichnet als eine »medizinische Disziplin, die sich mit der mehrdimensionalen Diagnostik, Therapie, Rehabilitation und Prävention psychischer Störungen in einem vernetzten System spezialisierter Behandlungseinrichtungen befasst […] und Gegenstand der Psychiatrie sind psychische Störungen«.
Viele Beiträge zur Psychiatriegeschichte beginnen mit dem klassischen Satz, welcher der Schule von Hippokrates von Kos (ca. 460 bis 370 vor Christus) (Mora 1990) zugeschrieben wird: »Man sollte wissen, dass nur im Gehirn, sonst nirgendwo, Freude, Entzücken, Lachen und Spielen entsteht ebenso Trauer, Sorge, Verzagtheit und Klage. Ebenso werden durch das Gehirn auf bestimmte Weise Vorstellungen und Wissen gestaltet, mit seiner Hilfe hören und sehen wir. Durch das gleiche Organ werden wir wahnsinnig und verwirrt, Ängste und Schrecken treten an uns heran, am Tag oder bei Nacht […] und all dies wiederfährt uns durch unser Gehirn, wenn es nicht gesund ist« (Mora 1990).
Bei Hellmut Flashar findet sich eine Zusammenfassung der medizinischen Theorien zur Melancholie und Melancholikern in der Antike.
Hippokrates: »Wenn Furcht und Mißmut lange anhalten, so ist das melancholisch«.
In der Abhandlung »Problemata« von Aristoteles (wahrscheinlich von Theophrast) findet sich eine der ersten Betrachtungen zur Melancholie. Er sieht das »Zuviel an schwarzer Galle« positiv und spekuliert, warum »alle außergewöhnlichen Männer Melancholiker« seien.
Frühchristlich wird krankhafte Traurigkeit als Erscheinung der Acedia, der »Sünde der Trägheit« verstanden. Luther zitiert den damals weit verbreiteten Satz »Caput melancholicum est balneum diabolicum« – der melancholische Kopf ist ein Bad des Teufels, die Kranken wurden zu Sündern.
Der englische Lyriker Samuel Taylor Coleridge stellte im 18. Jahrhundert fest, dass man in der Natur keine Melancholie finde.
Als Bild einer Künstler-Melancholie gilt das berühmte Bild »Melencolia I« von Albrecht Dürer 1514, im Sinne einer Allegorie von Melancholie bzw. Depression. Die dargestellte Figur blickt ins Unbestimmte, ihr Buch ist zugeklappt, Werkzeug liegt unbeachtet auf dem Boden.
1818 benutzte Heinroth, Lehrstuhlinhaber für Seelenheilkunde in Leipzig, als einer der ersten den Begriff »Depression« in Deutschland. Er schrieb »ein böser Geist wohnt in den Seelengestörten, sie sind die wahrhaft besessenen«.
Aretaios von Kappadokien (ca. 80 bis um 130 nach Christus) gilt als Erstbeschreiber des Alternierens der Gestimmtheit bei heute sog. bipolaren affektiven Erkrankungen: »Es scheint mir aber die Melancholie Anfang und Teil der Manie zu sein« (Arenz 2003, S. 34). Grundlage seiner Überlegungen war immer die Vier-Säfte-Lehre von Hippokrates und später Galen, die sich durch das gesamte Mittelalter zog: Blut (Sanguiniker), gelbe Galle (Choleriker), schwarze Galle (Melancholiker), Schleim (Phlegmatiker), entsprechend den vier Elementen Feuer, Luft, Erde, Wasser sowie den vier Himmelsrichtungen und den Qualitäten heiß, kalt, trocken und feucht.
Die Äbtissin und Mystikerin Hildegard von Bingen (1098 bis 1179) schrieb in ihrem Buch »Causae et curae« wohl als Erste über Geschlechtsunterschiede in der Depression bei melancholischen Männern und Frauen. Melancholische Männer hätten »eine düstere Gesichtsfarbe, auch sind ihre Augen ziemlich feurig und denen der Vipern ähnlich. Sie haben harte und starke Gefäße, die schwarzes und dickes Blut in sich enthalten, […] und hartes Fleisch und grobe Knochen, die nur wenig Mark enthalten.« Allerdings werden depressive Frauen als noch beklagenswerter geschildert: »Sie haben mageres Fleisch, dicke Gefäße und mäßig starke Knochen. Ihr Blut ist mehr schleimig wie blutig, ihre Gesichtsfarbe ist wie mit einem blaugrauen und schwarzen Ton gemischt. Solche Frauen sind windig und unstet in ihren Gedanken, auch übler Laune, wenn sie durch eine Beschwerde dahinsiechen. Sie haben ein wenig widerstandsfähiges Naturell und leiden deswegen manchmal an Schwermut. […] Auch das Kopfleiden, das von der Schwarzgalle verursacht wird, werden sie bekommen wie auch Rücken- und Nierenschmerzen.« Bzgl. der Entstehung der »schwarzen Galle« im menschlichen Körper weist sie eindeutig dem biblischen Sündenfall Adams Schuld zu: »Als Adam das Gebot übertreten hatte, wurde der Glanz der Unschuld in ihm verdunkelt, seine Augen, die vorher das Himmlische sahen, wurden ausgelöscht, die Galle in Bitterkalt verkehrt, die Schwarzgalle in die Finsternis der Gottlosigkeit und er selbst völlig in eine andere Art umgewandelt. Da befiehl Traurigkeit seine Seele und diese suchte bald nach einer Entschuldigung dafür im Zorn. Denn aus der Traurigkeit wird der Zorn geboren, woher auch die Menschen von ihrem Stammvater her die Traurigkeit, den Zorn und was ihnen sonst noch Schaden bringt, übernommen haben (zit. nach Liebig 1992, S. 11–18)«. Die Vier-Säfte-Lehre in einen mittelalterlichen christlichen Kontext gestellt. Allerdings, übersetzt in das heutige Verständnis und die heutige Sprache, beschreibt Hildegard von Bingen hier die »Männerdepression«, wie wir sie von depressiven Männern kennen, die Reizbarkeit, den Zorn, die Selbstschädigung z. B. im Abwehrversuch von Depressivität durch extremen Sport, durch übermäßige Arbeit, durch eigentherapeutischen schädlichen Gebrauch von Alkohol, Medikamenten oder Drogen. Denn die »depressive Episode«, wie sie die ICD-10 beschreibt, ist ja eine »weibliche« Depression.
Das Buch von Robert Burton (1. Auflage Oxford 1621) »Anatomie der Melancholie. Über die Allgegenwart der Schwermut, ihre Ursachen und Symptome sowie die Kunst, es mit ihr auszuhalten« gilt als der Klassiker der Melancholie-Literatur. Man muss es gelesen haben und begreift dann den Unterschied zwischen Melancholie als Krankheit des Individuums und als Gestimmtheit und Temperamentslage der Gesellschaft. Eingangs steht ein Gedicht des Autors zur »Melancholie«, wobei er Melancholie einmal als süßeste Lust, dann als schmerzvollste Last, als sauerste Last, dann wieder als süßeste Lust, als verdammte Last, als bitterste Last, als drückendste Last und als verfluchte Last bezeichnet und die letzten Zeilen lauten: »Mein Los, das tausch ich auf gut Glück mit jedem Mistkerl, Galgenstrick, wie Höllenfeuer brennt die Qual, ich muss heraus, hab’ keine Wahl, und das Leben ist mir hassenswert, wer leiht ein Messer, wer hält das Schwert? Anders Leid – Gold gegen die verfluchte Last: Melancholie«. Zwei Hauptthemen ziehen sich durch das vor allem in der ersten Hälfte sehr locker und lebendig erzählende Buch, nämlich die Melancholie als eine Weltsicht, und er zitiert den Prediger Salomo, dass die Menschen überlaunig, schwermütig, verrückt, wirrköpfig sind, der schreibt: »Da wandte ich mich zu sehen die Weisheit und die Tollheit und Torheit« und weiter: »Denn all seine Lebtage hat er Schmerzen mit Grämen und Leid, dass auch sein Herz des Nachts nicht ruht. So kann man unter Melancholie vieles verstehen und sie begreifen als Schwermut im eigentlichen oder uneigentlichen Sinn, als Anlage oder Gewohnheit, als Auslöser von Schmerz- oder Lustempfindungen, als Schwachsinn, Missmut, Furcht, Kummer, Verrücktheit, sie das alles oder nur einen Teil davon umfassen lassen, buchstäblich oder metaphorisch von ihr reden – es ist jeweils Aspekt derselben Sache.« Im zweiten Teil, dem sog. »Hauptteil« setzt Robert Burton sich dann mit der Melancholie als Erkrankung auseinander. Dabei schreibt er: »Melancholie, der Gegenstand dieser Untersuchung, tritt entweder als Stimmung oder als Naturell auf. Als Stimmung bezeichnet sie jene vorübergehende Niedergeschlagenheit, die noch die unbedeutendsten Anlässe von Kummer, Mangel, Krankheit, Ärger, Furcht, Trauer, geistiger Unruhe, Missmut und Sorge begleitet. Sie kommt und geht, löst Bedrücktheit, Stumpfheit, Verdruss aus, macht das Herz schwer, ist folglich dem Vergnügen, Frohsinn, der Freude und dem Genuss in jeder Weise entgegengesetzt und erzeugt in uns Widerspenstigkeit und Abneigung. […] Und von diesen melancholischen Anwandlungen ist keine lebende Seele frei.« (Burton 1651, dtsch. Übers. Hartmann 1988, S. 41 ff und S. 309 ff). Wenige Zeilen später schreibt Burton dann »aber weil so wenige diesen guten Rat annehmen oder ihn richtig in die Tat umsetzen, weil sie vielmehr wie die wilden Tiere den Leidenschaften ihren Lauf lassen, sich ihnen unterwerfen und so in ein auswegloses Labyrinth von Sorgen, Kümmernissen und Nöten geraten, also ihre Seele ausliefern und sich nicht in der Geduld üben, die ihnen anstünde, deshalb geschieht es sehr häufig, dass die Anwandlungen und Stimmungen sich zu habitueller Schwermut verfestigen. Eine vorübergehende Erkältung löst […] nur Husten aus; wird sie aber chronisch, dann ist Schwindsucht die Folge. Ähnlich verhält es sich auch mit den melancholischen Reizen und je nachdem, ob die schwarze Galle auf einen empfänglichen oder einen widerstandsfähigen Organismus stößt, kommt es nur zu geringfügigen oder durchschlagenden Wirkungen […] Vielmehr gibt er bei dem geringsten Anlass, sei es eine eingebildete Kränkung, Kummer, Schande, seien es Verluste, Gaunereien, Gerüchte, seinen Gefühlen nachkommen, dass sich sein Aussehen verändert, seine Verdauung gestört wird, keinen Schlaf mehr findet, seine Lebensgeister schwinden, das Herz schwer und der Leib hart wird. Er laboriert an Blähungen und verdorbenem Magen, und Melancholie überwältigt ihn. […] Im Handumdrehen und wie durch eine geöffnete Tür überfallen ihn alle möglichen anderen quälenden Gedanken, und wie ein hinkender Hund oder flügellahme Gans siecht er dahin und fällt schließlich der habituellen Schwermut und krankhaften Melancholie zum Opfer.« Später definiert er »Melancholie« als »eine Art fieberfreier Verrücktheit, die normalerweise von grundloser Angst und Trübsinn. […] Nur gestört ist der Melancholiker im Gegensatz zum Irren und Wahnsinnigen, bei dem die Hirnfunktionen nicht in Unordnung, sondern ganz ausgefallen sind«. Angst und Sorge grenze sie von gewöhnlichem Irrsinn ab, Angst und Sorge seien die wahren Kennzeichen und unzertrennlichen Weggefährten der meisten Schwermütigen. Er diskutiert, welche Organe hauptsächlich befallen würden, entscheidet sich dann für das Hirn, denn als Geistesstörung müsse die Melancholie dieses Organ in Mitleidenschaft ziehen. Das sei die Position des Hippokrates, des Galen, der arabischen Medizin und der meisten modernen Heilkundigen. Später diskutiert er dann »das Dreierschema« und beschreibt als Ersterkrankungsform die Kopfmelancholie, die allein vom Gehirn ausgelöst werde, die Zweite betreffe den ganzen Körper, in dem die schwarze Galle aus dem Gleichgewicht geraten sei, die Dritte rühre her von Eingeweiden, der Leber, Milz oder dem Gekröse und werde hypochondrische oder blähende Melancholie genannt, wobei die Liebesmelancholie im Allgemeinen zur Kopfmelancholie gerechnet werde. Als Ursachen melancholischer Erkrankungen werden Gott, die Sterne, das Alter, die Vererbung, die Ernährungsgewohnheiten, Betrübnis und Kummer, Scham und Schande, Furcht, Verdruss, Sorgen und Not, aber auch Rivalität, Hass, Rachedurst oder auch Eigenliebe, Aufgeblasenheit, grenzenloser Beifall, Stolz und übermäßige Freude sowie der Verlust der Freiheit, Knechtung und Gefangenschaft diskutiert. Später schreibt er »keine körperliche Qual kommt der Melancholie gleich, keine Folterwippe, keine heißen Eisen und glühenden Ochsen des Phalaris, und selbst die sizilianischen Tyrannen haben keine schlimmere Tortur erdacht. Alle Ängste, Kümmernisse, Unzufriedenheiten, aller Argwohn, alles Ungute und auch alle Unannehmlichkeiten münden und verlieren sich wie Bächlein in diesen Euripus, dieser Irische See, dieser Ozean des Elends, diesen Zusammenfluss allen Grams, […].« (S. 327). Zum Thema Suizid schreibt er: »Selten endet die Melancholie tödlich, außer in den Fällen – und das ist das größte und schmerzlichste Unglück, das äußerste Unheil –, in denen ihre Opfer Selbstmord begehen, was häufig geschieht. So haben schon Hippokrates und Galen feststellen müssen: Wenngleich sie den Tod fürchten, legen sie doch meistens Hand an sich, und das wird aller ärztlichen Kunst zum Verhängnis […]. Ihr äußerstes Elend peinigt und quält diese Menschen derart, dass sie keine Freude mehr am Leben finden und sich gleichsam gezwungen sehen, sich den Kelch abzutun, um ihr unerträgliches Leid abzuschütteln. So begehen […] einige in einem Anfall von Raserei, die meisten aber aus Verzweiflung, Sorge, Angst und Seelenpein Selbstmord, denn ihre Existenz ist unglücklich und jammervoll« (S. 325). Robert Burton (1577–1640) war Theologe, Mönch und Gelehrter am Chris Church College der Universität Oxford. Er schrieb das Buch »Anatomie der Melancholie« als Selbstbetroffener, es kostete ihn seine gesamte Schaffenskraft, so dass nur wenig Sonstiges von ihm erhalten ist.
Romano Guardini (1928–1983) meinte in »Vom Sinn der Schwermut«: »Die Schwermut ist etwas zu schmerzliches, und sie reicht zu tief in die Wurzeln unseres menschlichen Daseins hinab, als dass wir sie den Psychiatern überlassen dürften [Romano Guardini 1949]. Wir glauben, es geht um etwas, was mit den Tiefen unseres Menschtums zusammenhängt.« Romano Guardini spricht damit etwas an, was sich durch die gesamte Literatur und das Denken zur Melancholie und Depression zieht, nämlich die Unschärfe der Trennung der Krankheit Depression von der »melancholischen Gestimmtheit« und er meint damit ein menschliches Phänomen, das per se keine Krankheit ist, aber zu einer werden kann. Romano Guardini war selbst depressiv erkrankt.
Schott und Tölle (2006, S. 402 ff.) schreiben, die Melancholie gelte in der abendländischen Medizingeschichte als eine Hauptkrankheit, die nach der antiken Humoralpathologie (Vier-Säfte-Lehre) von der (hypothetischen) schwarzen Galle herrühre. Die schwarze Galle solle vor allem mit der Milz in Beziehung stehen und vom Hypochondrium bzw. der Kardia (Magenmund) aus auch andere Körperregionen infizieren. Dabei habe die aus dem Bauch in den Kopf aufsteigende Melancholie (Melancholia hypochondriaca) in der allgemeinen Krankheitslehre bis ins 19. Jahrhundert hinein eine wichtige Rolle gespielt. Unzählige Vorstellungen seien im Zusammenhang mit der Melancholie seit der »Schwarzgalligkeit« der griechischen Medizin vorgelegt worden. »Im Begriff der Melancholie spiegelt sich wie in keinem anderen die gesamte abendländische Medizingeschichte wider«. Das sei gerade bezüglich des Leib-Seele-Verhältnisses, der medizinischen Anthropologie und der psychiatrischen Therapeutik höchst aufschlussreich. Dies erinnert erneut stark an die Aussage von Romano Guardine, die Melancholie nicht nur den Psychiatern überlassen zu können.
Nach Schott und Tölle (2006) (S. 406) neigen Psychiatriehistoriker dazu, der mittelalterlichen Heilkunde generell eine »dämonologische Interpretation der Geisteskrankheiten« zu unterstellen, um sie somit von den rationalen Krankheitsmodellen der Antike und den naturwissenschaftlichen Erkenntnisfortschritten der Neuzeit abzugrenzen. Für Schott und Tölle ist dies eine Variante der Legende vom finsteren Mittelalter. Hole und Wolfersdorf (1986, S. 440) haben gezeigt, dass die Verallgemeinerung, dass im Mittelalter die somatische Grundlage der Melancholie zugunsten einer »dämonologischen Interpretation« aufgegeben worden sei, falsch ist. Die Medizin des Mittelalters stand durchaus in der Tradition der antiken Lehre, die keineswegs zugunsten der Dämonologie aufgegeben wurde, wenngleich religiöse und teilweise auch dämonologische Anschauungen integriert wurden. Nach Hildegard von Bingen schien etwa bei der viel zitierten »Mönchskrankheit« (Acedia) die schwarze Galle als Ausdruck der Sünde (der mönchischen Nachlässigkeit) eine Melancholie zu erzeugen, wie sie es schon in Adams Körper in Folge des Sündenfalls getan habe. Melancholie schwäche in dieser Sicht die Abwehrkräfte gegen Dämonen und disponiere somit zur Besessenheit.
Johann Baptist van Helmont (1579–1644), ein bedeutender Mediziner des 17. Jahrhunderts und Wegbereiter der chemischen Medizin aus dem Geiste der Alchemie, hat den Zusammenhang von Melancholie und Imagination beschrieben. Er lehnte die Vier-Säfte-Lehre der schwarzen Galle ab, zumal er sie nicht gefunden habe, sondern spricht von einem »Fehler des Lebens-Geistes«, wobei die Einbildungskraft (Imaginatio), welche die krankmachenden Bilder (Ideae morbosae) eine entscheidende Rolle spielten. Damit sind wir beim Saturn als Stern der Melancholiker angelangt. Van Helmont hält an der astrologischen Lehre fest, dass der Saturn als »Irrstern« über die Milz seinen üblen Einfluss ausübe, es entstünden dort durch Einbildung und Fantasie krankmachende Bilder, die quasi als Krankheitssamen den Lebensgeist im Magen so stark beeindruckten, dass eine Krankheit entstehe.
Neben den biologischen (Vier-Säfte-Lehre) und astrologischen (Saturn) sowie theologisch ergänzten (Vier-Säfte-Überlegungen, Hildegard von Bingen) gibt es auch psychologische und tiefenpsychologische Überlegungen zur Entstehung der Melancholie. Der französische Psychiater Pinel (1800, S. 66) soll als Ursache der Melancholie »Traurigkeit, Schrecken, anhaltendes Studieren, die Unterbrechung eines thätigen Lebens, heftige Liebe, das Uebermass in den Vergnügungen, Missbrauch betäubender und narkotischer Mittel, vorübergehende Krankheiten, die unrichtig behandelt wurden, die Unterdrückung des Hämorrhoidalflusses« gesehen haben. Esquirol (1816 S. 30 ff.) bezeichnete die Melancholie als »Lypémanie« (griechisch Lype ist gleich Betrübnis, Ärger, Schwermut) und schreibt: »Das Delirium bezieht sich nur auf einen oder eine kleine Anzahl von Gegenständen mit einer vorherrschenden traurigen oder niederdrückenden Leidenschaft«. Außerhalb der Psychiatrie wird der Begriff Melancholie häufig in Literatur, Kunst und Sonstigem in einem anderen Sinne verwendet. Dabei wird ein Zusammenhang zwischen der Melancholie und der künstlerischen Kreativität hergestellt, also zwischen »Krankheit und Genie«.
In einem eigenen Kapitel (S. 411 ff.) differenzieren Schott und Tölle zwischen »Melancholie und Depression«. Melancholie sei der ältere Begriff, mit einer mehr als 2.000-jährigen Verwendung, allerdings nur im Hinblick auf das Erscheinungsbild der Krankheit, nicht bzgl. der Theoriebildung. Heute spricht man nicht mehr von Melancholie und auch das Adjektiv »melancholisch« wird kaum verwendet. Der Begriff »Depression« tauchte anscheinend erst um 1800 auf und soll auf eine Anregung des schottischen Arztes William Cullen zurückgehen. William Cullen (1885, S. 57) war besonders interessiert an Nervenkrankheiten und bezeichnete sie als »Neurosen« (Morbi nervosi), er erklärte die Melancholie als Gehirnkrankheit und behauptete, die Krankheit sei vom »Grad der Festigkeit der Substanz des Gehirns« abhängig. Der Begriff Depression wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts immer häufiger benutzt. Heinroth (1825, S. 118) definierte die »Depression« als ein »Übermaß an Passivität«. Die französische Psychiatrie sprach noch von Melancholie, aber gleichbedeutend mit dem Begriff Depression. Im 20. Jahrhundert verwendeten den Begriff Melancholie eher anthropologisch orientierte Psychiater wie L. Binswanger oder H. Tellenbach. Der Begriff Depression erfuhr einen Bedeutungsverlust, indem man nur noch »irgendein Herabgestimmtsein« ohne Differenzierung meinte.
Die deutschsprachige Psychiatrie unterschied bis zur ICD-10 zwischen drei Kernformen von depressiven Erkrankungen: 1) endogene monopolare, monophasische oder rezidivierende Depressionen, 2) exogene Depressionen, zu denen auch somatogene, also aus der körperlichen Sphäre stammende zählten, und 3) psychogene Depressionen, die reaktiven, die neurotischen und die Entwicklungen. Allerdings gibt es auch in der ICD-10 noch die »melancholische« Depression, wenn man sich genauer das somatoforme Syndrom anschaut, welches eben biologische sprich melancholische Symptomatik enthält.
Über Jahrhunderte ist die Krankheit Melancholie im Kern übereinstimmend beschrieben worden. Paracelsus (sämtliche Bände Oldenbourg 1929–1933) schrieb im Band 12 (S. 42): »Melancholia ist ein krankheit, die in ein menschen falt, das er mit gewalt traurig wird, schwermütig, langweilig, verdrossen, unmutig und falt in seltsam gedanken und speculationen, in traurigkeit, in weinen etc., wie dan das gemüt an im selbs anzeigt.«
László F. Földényi (1988), ungarischer Dichter und Schriftsteller, eröffnet sein Buch im Vorwort mit dem Satz »Der Beginn unter Qualen zeugt von der Schwierigkeit des Unterfangens.« Darüber hinaus schreibt er im letzten Kapitel seiner Einführung: »Zu jener Zeit, da die Melancholie zum erstenmal als Begriff erschien, war über sie schon alles gesagt worden. Doch von Anbeginn an ist die Ungenauigkeit des Begriffs, auch der an spätere Epochen nichts ändern konnten, auffallend. Es gibt keine eindeutige oder genaue treffende Bestimmung der Melancholie. Die Geschichte der Melancholie ist auch die Geschichte einer nie zum Abschluss kommenden Präzisierung der Begriffsprägung und gerade daraus ergibt sich auch der Zweifel: sprechen wir über die Melancholie, so ist sie gar nicht Gegenstand unseres Sprechens, es handelt sich vielmehr um einen Versuch, mit den über sie geprägten Begriffen unsere eigene Lage zu erkennen.« (S. 12–13). Der Autor steigt in sein Thema dann mit einem überraschenden Satz ein: »Warum erweisen sich alle außergewöhnlichen Männer in Philosophie oder Politik oder Dichtung oder in den Künsten als Melancholiker?« Und er meint, dass dieser Satz, der aus der Schule des Aristoteles stammte, an seiner Gültigkeit bis in die heutige Zeit nichts eingebüßt habe. Das Gemüt und die Gestalt, der Geist und der Körper sowie die Melancholie sei ihre Krankheit, die Einheit der Seele und die auch den körperlichen Zustand bestimmende Vermengung der kosmischen Elemente. Das sich Auflösen und das Erkranken dieser Zweiheit sei die Melancholie und der Autor fragt, ob es denn eine ärztliche Anschauung gebe, die großzügiger und mütiger wäre. Die Melancholie als Krankheit sei, so in Anlehnung an Hippokrates, daher das »Ergebnis einer Art von Entgleisung, das Gleichgewicht von Mikro- und Makrokosmos hat sich verlagert, die Ordnung (der Kosmos) hat sich gelockert, es hat sich eine Störung eingestellt, und die betroffene Person ist nicht mehr in der Lage, den untrennbaren Gesetzen des Alls und des eigenen Schicksals zu gehorchen.« (S. 19). Weiter schreibt er: »Das Verstehen der Melancholie als endokosmogene Depression dehnt den Begriff derart aus, dass die streng objektivistische Medizin zurecht das Gefühl haben kann, dass man ihr die Basis entzogen hat. Es scheint, als ob ein schicksalhafter Relativismus nicht nur zwischen körperlichen und seelischen Krankheiten die Grenze verwische, sondern auch die Beziehung zwischen Erkrankung und Gesundheit relativieren würde.« (S. 296). Darüber hinaus führt er aus, was er unter Melancholie versteht: »Die Traurigkeit und die Angst, die den Melancholiker befallen, sind der im alltäglichen Sinne verstandenen Übellaunigkeit oder Furcht nicht gleich. Der Melancholiker ist traurig, blickt aber auch auf diese Traurigkeit: er ist sich darüber, dass es ein »sinnloses« Unterfangen ist, zu trauern, im Klaren und verhält sich zu seiner Traurigkeit wie zu einem Gegenstand. Er trauert, und dennoch hat er nichts mit seinem eigenen Zustand zu schaffen und deshalb ist er auch nicht zu trösten.« (S. 346).
Wolfram Schmitt eröffnet seinen Beitrag »Zur Phänomenologie und Theorie der Melancholie« in »Melancholie in Literatur und Kunst« (1990, S. 14–28) mit dem Satz, den er als »Enttäuschung« bezeichnet: »Was Melancholie ist, wissen auch die Psychiater nicht. Es gibt jedoch unter der Mehrzahl der Psychiater einen ungefähren Konsens darüber, was als das Erscheinungsbild der Melancholie zu gelten habe. Es handelt sich hierbei um einen psychopathologischen Symptomenkomplex, ein Syndrom, besser um ein Kern- oder Achsensyndrom oder auch um einen Idealtypus, den man als Melancholie oder zyklothyme Depression bzw. endogene Depression anzusprechen pflegt. Dieser Typus Abnormität, den man auch zu den affektiven Psychosen rechnet, ist auf der phänomenologisch-beschreibenden Ebene durch folgende Erscheinungen gekennzeichnet, die keineswegs vollständig ausgeprägt sein müssen: 1) Verstimmung, 2) Vitalstörungen und 3) Hemmung, 4) Wahn, 5) Suizidalität, 6) körperliche Verstörungen, insbesondere Biorhythmusstörungen« (S. 14).
Jaspers (1913) sah in der »tiefen Traurigkeit« und der Hemmung allen seelischen Geschehens den Kern der Depression. Kurt Schneider (1920) sprach von der »vitalen Traurigkeit«, Schulte (1961) von »Nicht-Traurig-Sein-Können«, Heinrich (1966) von »Herabgestimmtheit«, womit der Versuch gemacht werden sollte, die vom Patienten meist selbst schwer in Worte zu fassende, schwer auch nachvollziehbare depressive Herabgestimmtheit in Stimmung und Gefühlen, die sich deutlich von Trauer und Traurigkeit absetzen lässt, zu benennen (Kohs und Tölle 1987).
Wirft man einen ganz kurzen Blick auf die psychoanalytisch-tiefenpsychologische Literatur, so stößt man als erstes auf die klassische Schrift von Freud »Trauer und Melancholie« (1917): »Trauer ist regelmäßig die Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person oder einer an ihre Stelle gerückten Abstraktion wie Vaterland, Freiheit, ein Ideal etc. Unter den nämlichen Entwicklungen zeigt sich bei manchen Personen, die wir darum unter den Verdacht einer krankhaften Disposition setzen, anstelle der Trauer eine Melancholie. […] Die Melancholie ist seelisch ausgezeichnet durch eine tiefe schmerzliche Verstimmung, eine Aufhebung des Interesses für die Außenwelt und den Verlust der Liebesfähigkeit, durch die Hemmung jeder Leistung und die Herabsetzung des Selbstgefühles, die sich in Selbstvorwürfen und Selbstbeschimpfungen äußert und bis zur wahnhaften Erwartung von Strafe steigert.« Freud (Freud 1917 GWX 428–446) verweist auf die außerordentliche Herabsetzung des Ich-Gefühles, eine »großartige Ichverarmung«, die Störung des Selbstgefühles, und meint, dass bei der Trauer die Welt arm und leer geworden sei, bei der Melancholie sei es »das Ich selbst«. Daniel Hell (2012) schreibt, es scheine ihm angebracht, die heutige Depressionsdefinition der Weltgesundheitsorganisation in der ICD-10 als diagnostische Übereinkunft zu übernehmen, dabei aber offen zu bleiben »für die Vielfalt depressiver Bilder und die Mehrdimensionalität depressiven Leidens« (S. 13). Zudem entwickelt er die grundlegende Vorstellung von der Depression als einer »Gleichgewichtsstörung« und verweist auf Gemeinsamkeiten aller Depressionstheorien und historischen Konzeptionen von Melancholie, Akedia und »dunkler Nacht«, welche »regelhaft von einem Ungleichgewicht ausgehen, sei es von einem Ungleichgewicht körperlicher Stoffe, seelischer Kräfte oder sozialer Verhältnisse.« (S. 15). Ihm erscheint das depressive Geschehen als eine spezifische Störung des Gleichgewichts, ohne dass allerdings schon klar sei, welche Hierarchieebenen in welcher Weise aus dem Gleichgewicht gebracht seien und wie sich die verschiedenen Ebenen gegenseitig beeinflussen würden. Marianne Leuzinger-Bohleber (2005 S. 21 ff.) erinnert daran, dass viele der älteren Arbeiten aus der Tiefenpsychologie und Psychoanalyse Depression im Zusammenhang mit einem Verlust eines realen oder inneren Objekts gesehen haben. Bleichmar (2003) schlug vor dem Hintergrund zahlreicher psychoanalytischer Arbeiten vor, Depression nicht als einen krankhaften Zustand zu betrachten, sondern die Depression als einen Prozess zu verstehen, der abhängig von internalen und externalen Bedingungen ablaufe. Böker und Northoff (2016, S. 15) verstehen Depression als »Psychosomatose der Emotionsregulation« und fassen als wesentliche psychodynamische Merkmale der Depression die Reaktivierung früherer kindlicher Verlusterfahrungen, die Introjektion des verlorenen Objektes in Verbindung mit negativen Affekten und den Verlust aktueller Objektbeziehungen auf.
Griesinger (1845, S. 165–166) war der Meinung, das Zentrale der Melancholie sei »ein psychisch schmerzhafter Zustand. […] Und dieses psychische Wehthun besteht für die Kranken selbst in einem Gefühl von tiefem geistigen Unwohlsein, von Unfähigkeit zu Handeln, von Unterdrückung aller Kraft, von Niedergeschlagenheit und Traurigkeit, in einer totalen Herabgestimmtheit des Selbstgefühls«. Karl Jaspers (1973, S. 90) sprach davon, dass es sich bei der Depression »nicht um Apathie, sondern um ein qualvolles Fühlen eines Nichtfühlens« handle. Die Kranken würden unter dieser subjektiv empfundenen Gefühlsleere ungeheuer leiden. Abschließend schreibt der amerikanische Psychoanlytiker Sidney Blatt (2002, S. 29): »Thus, depression can be defined as a basic affect state that can range from a relatively appropriate and transient dysphoric response to untoward life events to a severe and persisting disorder that can involve serious distortions of reality«.
Fasst man zusammen, so sind Absicht und Versuch, depressive Erkrankungen zu operationalisieren und auf einer eher Symptom- und Verhaltensebene zu beschreiben, gut nachvollziehbar. Wie später noch weiter ausgeführt wird, bieten sich Syndrombeschreibungen wie »depressive Episode« in der ICD-10 – oder früher »depressives Syndrom« – für derartige Vereinheitlichungen an, bergen aber auch immer die Gefahr der Überforderung und der Ausfransung in den Grenzbereichen. Trotzdem ist festzuhalten, dass über Jahrhunderte hinweg im Zentrum des Verständnisses von Melancholie, später der Depression, die Störung der Affektivität gesehen wird, ob nun als Trauer, als Herabgestimmtheit, als Gefühlsleere, als reduziertes Gemüt, als Schwermut oder auch als psychischer Schmerz bezeichnet, und anderseits die Betrachtung der Welt mit den Augen eines Melancholikers; wobei sich hier der Übergang zur melancholischen Weltsicht, ohne Krankheitswert, anbietet. Die somatische Betroffenheit in der Depression mit all ihren psychosomatischen Beschwerden, von den Schlaf- und Appetitstörungen bis hin zu den sexuellen Störungen, insgesamt zu einem veränderten körperlichen Erleben, kommen im engeren Sinne erst in der psychiatrischen Literatur der letzten beiden Jahrhunderte in den Fokus der Betrachtung. Interessant ist dabei, dass von psychiatrisch-soziologischer Seite (siehe Hell 2012) eine Störung des Gleichgewichtes als zentrales Erleben der Depression postuliert wird, von psychoanalytisch-tiefenpsychologischer Seite der Verlust realer Objektbeziehungen und nicht mehr nur unbewusste und triebpsychologische Aspekte gesehen werden (z. B. Böker und Northoff 2016).
Merke
Warum ist Psychiatrie-Geschichte, hier am Beispiel von der Melancholie/Depression hilfreich? Psychiatrie-Geschichte ist ganz früh eine Geschichte des Wahnsinns, dann im Mittelalter eine des Körpers (Vier-Säfte-Lehre) verknüpft mit religiösen Themen (Sünde), dann eine Krankheits- und Krankengeschichte in den letzten drei Jahrhunderten. Die Melancholie war immer besonders: beim »Raptus melancholicus« wird der Suizident auch im Mittelalter exkulpiert und christlich beerdigt; Melancholie und Genie werden gemeinsam gesehen; uni- und bipolare Erkrankungen klar psychopathologisch beschrieben. So groß sind die Unterschiede zum heutigen Bild nicht!
2 Epidemiologische und gesundheitsökonomische Anmerkungen
2.1 Deutschland, Europa, weltweit
Epidemiologische und gesundheitsökonomische Studien belegen die herausragende Bedeutung depressiver Erkrankungen: Verglichen sowohl mit anderen psychischen Erkrankungen als auch mit allen anderen nichtpsychiatrischen Volkskrankheiten wie Diabetes mellitus sowie kardio- oder zerebrovaskulären Erkrankungen kommt nach der »Burden of Disease Study« der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Weltbank – gemessen an den zentralen Indikatoren DALYs (»Disability-adjusted Life Years«) und YLDs (»Years Lived With Disability«) – in den Industrienationen der Major Depression und der Dysthymia größte Bedeutung zu (Ferrari et al. 2013; Murray und Lopez 1996, 2010).
Depressive Erkrankungen verursachen v. a. indirekte Krankheitskosten durch Krankheitstage/Produktionsausfall und Frühberentungen. Nicht erkannte bzw. nicht diagnostizierte Depressionen ziehen wegen körperlicher Beschwerden aber auch zahllose überflüssige somatische Untersuchungen nach sich. Die mit depressiven Erkrankungen assoziierte Suizidalität besitzt angesichts ihrer Häufigkeit neben ihrer persönlich-familiären Tragik ebenfalls große gesundheitsökonomische Bedeutung.
In Deutschland stehen Depressionen heutzutage bei Krankmeldungen und den zu Arbeitsunfähigkeit führenden Gesundheitsstörungen an der Spitze, Frühberentungen erfolgen zu einem Drittel wegen Depressionen. Der Psychoreport 2015 der DAK und des IGES (Institut für Infrastruktur und Gesundheitsfragen) zeigte einen deutlichen Anstieg der AU-Tage vom Jahr 2000 bis 2014 um über 200 %; der Anteil depressiver Störungen (ICD-10: F32/33) ist dabei fast dreimal so hoch wie der schwerer Belastungs- und Anpassungsstörungen. 2015 wurden die Krankheitskosten für die ICD-10-Depressionsdiagnosen F32-34 mit 8,7 Mrd. € (2,9 Mrd. für Männer, 5,8 Mrd. für Frauen) angegeben (www.gbe-bund.de 2018). Die individuellen Behandlungskosten werden auf jährlich ca. 2.500 bis 5.000 € taxiert, die jährlichen Gesamtkosten werden auf ca. 16 Mrd. € geschätzt. Für Altersdepressionen bei Menschen ab 75 Jahren wurden in einer Beobachtungsstudie (AgeMooDe) mittlere Kosten über sechs Monate von 5.031 € kalkuliert (Bock et al. 2016). In Deutschland sind Depressionen bei Frauen die dritthäufigste, bei Männern die siebthäufigste Ursache für durch Krankheit beeinträchtigte Lebensjahre (DALY) (Plass et al. 2014).
In der TACOS-Studie (»Transitions in Alcohol Consumption and Smoking«; Meyer et al. 2000) mit 4.093 Interviews in einer norddeutschen Region fand man eine Lebenszeitprävalenz für depressive Störungen (Major Depression, Dysthymia) von 11,5 % (Männer 6,8 %, Frauen 16,3 %). In der Studie zur »Gesundheit in Deutschland aktuell« (GEDA) des Robert Koch-Instituts (2019) wurden Selbstangaben zu einer diagnostizierten Depression oder depressiven Verstimmung in den letzten zwölf Monaten vor der Befragung erhoben. Die Prävalenzen betrugen für Männer 5,1 %, für Frauen 9,0 %.
Nach neuen Erhebungen liegt die Prävalenz depressiver Symptome und von Depression bei Assistenzärzten bei knapp 30 %, wobei symptomatisch »Hilflosigkeit« dominiert. Ein Großteil der Daten basiert dabei aber auf Fragebögen und nicht auf Interviews.
Für die EU-Staaten wurde eine 1-Jahres-Prävalenz für Major Depression von 6,9 % ohne substanzielle Ländervariation gefunden, die DALY-Rate für die unipolare Depression lag an der Spitze aller psychischen und neurologischen Erkrankungen. Der EU-Report 2010 (Wittchen et al. 2011) stellte dabei Prävalenzraten (12-Monats-Prävalenz) aus den Jahren 2005 und 2011 gegenüber und fand bei der Major Depression in beiden Fällen einen Anteil von 6,9 %, was 30,3 Millionen Personen mit einer diagnostizierten Major Depression bedeutet. Das Risiko, im Laufe des Lebens an einer Depression (alle Formen) zu erkranken,die Lebenszeitprävalenz, liegt national wie international bei 16 bis 20 % (Bijl et al. 1998; Ebmeier et al. 2006; Jacobi et al. 2004). Die Replikation der großen US-amerikanischen National Comorbidity Study (NCS-R) anhand DSM-IV-Kriterien ergab eine 1-Jahres-Prävalenz für Major Depression von 9,5 %.
Nach einer Analyse von Krankenkassendaten (Barmer GEK) aus dem Jahr 2011 von 7,5 Mio Versicherten wurde bei knapp 237.000 eine Depression diagnostiziert. 53 % der schweren Depressionen und 51 % der Depressionen mit schwerer psychiatrischer Komorbidität wurden von Fachärzten behandelt. Knapp die Hälfte der Allgemeinarzt-Patienten wurde mit einem Antidepressivum behandelt, 10 % mit zwei Antidepressiva simultan. 26 % erhielten Psychotherapie (Wiegand et al. 2016).
Die oberbayerische Longitudinalstudie über 25 Jahre, wobei das Durchschnittsalter initial 39,4 Jahre betrug, fand mittels Interviews eine stabile Prävalenz depressiver Syndrome (initial 18,1 %, 16,1 % nach 25 Jahren) sowie für die »depressive Stimmung« (30,8 % bzw. 21,4 % bzw. 23,1 %). Dies unterstreicht die Feststellung, dass Depressionen über die letzten Dekaden nicht zugenommen haben (Fichter et al. 2008).
Das Lebenszeitrisiko, an einer unipolaren Depression zu erkranken, wird auf 11 % bis 26 % geschätzt, bei älteren Menschen auf etwa 10 %.
Untersuchungen zur Prävalenz der Major Depression in verschiedenen Kulturen zeigten eine bis zu 7-fache Varianz, wobei Punktprävalenzen zwischen 4,6 % und 24 % gefunden wurden.
Die Prävalenzraten der Dysthymie variieren stark. Laut DEGS 1-MH-Studie beträgt die 1-Jahresprävalenz etwa 2 % (Frauen 2,5 %, Männer 1,4 %). Für Deutschland (Jacobi et al. 2004) werden 2,5 % Dysthymie neben 8,3 % depressive Episode als Einzelepisode oder im Rahmen rezidivierender Verläufe angegeben. Dabei besteht eine hohe Komorbidität mit anderen psychischen Erkrankungen, vor allem Angststörungen, Substanzmissbrauch und -abhängigkeit sowie Persönlichkeitsstörungen. Einige Autoren bezweifeln deswegen die Eigenständigkeit und die praktische Anwendbarkeit dieser Diagnose, die letztlich einen Sammeltopf aus der früheren (ICD-9) neurotischen Depression, sog. chronischen Depressionen und subsyndromalen depressiv-dysthymen Erkrankungen darstellt.
Die Prävalenzraten für bipolare Störungen werden für Bipolar I mit 0,6 % und für Bipolar II mit 2–6 % angegeben. Hierbei überwiegen Depressionen deutlich (Bauer et al. 2017).
Zu den depressiven Störungen, die noch weiterer Forschung bedürfen, gehören die »Minor Depression«, subsyndromale Formen sowie die rezidivierende kurze depressive Episode (»Recurrent Brief Depression«, RBD), für die Lebenszeitprävalenzen von 2–10 % berichtet werden (Laux 2017b). Der Kliniker und vor allem der niedergelassene Psychiater kennt RBD aus Verlauf und Nachsorge, wo sie als »Einbruch« oder »Absturz«, manchmal mit hoher suizidaler Gefährdung geschildert wird.
Depression bei körperlichen Erkrankungen. Angesichts der altersassoziierten Zunahme (chronischer) körperlicher Erkrankungen wie koronare Herzkrankheit (KHK), Diabetes mellitus, M. Parkinson oder einem Schlaganfall hat die Bedeutung und Häufigkeit komorbider Depressionen zugenommen. Bei Krankenhauspatienten wird die 1-Jahres-Prävalenz von majoren Depressionen mit 4–17 % angegeben. Für einzelne Erkrankungen werden folgende Punktprävalenzen angegeben:
• Diabetes mellitus
10–30 %
• KHK, Myokardinfarkt
20–45 %
• COPD, Asthma
ca. 30 %
• M. Parkinson
40–50 %
• Epilepsie
ca. 30 %
• Schlaganfall
ca. 30 %
• Schädel-Hirn-Traumen
ca. 30 %
• Multiple Sklerose
ca. 40 %
• Dialysepatienten
10–20 %
• Karzinompatienten
ca. 25 %
Bei Krankenhauspatienten wird eine 1-Jahres-Prävalenz von Majoren Depressionen mit 4–18 % angegeben. Hier ist jedoch von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.
Merke
Depressionen gehören heute zu den wichtigsten »Volkskrankheiten«. National wie international liegt die Lebenszeitprävalenz für depressive Störungen bei 13–20 %, die 12-Monats-Prävalenz bei 4–11 %.
Die Zahl der Menschen mit Depressionen steigt weltweit. Nach einer Studie der WHO waren 2015 rund 322 Millionen Menschen betroffen – 4,4 % der Weltbevölkerung. Dies bedeutet eine Zunahme von über 18 % im Vergleich zu einer Erhebnung von vor mehr als zehn Jahren. Ursächlich sind das Bevölkerungswachstum und die längere Lebenserwartung insbesondere von älteren Menschen. Eine Depression ist heute weltweit eine der wesentlichen Ursachen für eine Lebensbeeinträchtigung.
2.2 Soziodemografie, Alter und Geschlecht
Eine depressive Symptomatik anhand des Patient-Health-Questionnaire (PHQ-9 > 10 Punkte) bestand bei 8,1 % der Erwachsenen (Frauen 10,2 %, Männer 6,1 %) mit höchster Prävalenz in der Altersgruppe von 18–29 Jahren.
Frauen haben ein etwa doppelt so hohes Erkrankungsrisiko wie Männer. Mit steigendem Alter und nach einer WHO-Kohortenstudie in den letzten Jahrzehnten nähern sich die Geschlechtsverteilungen an. Ersterkrankungen zeigen bei Frauen einen früheren