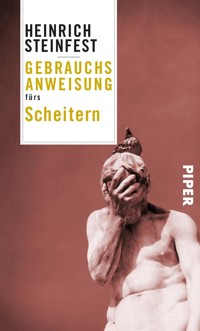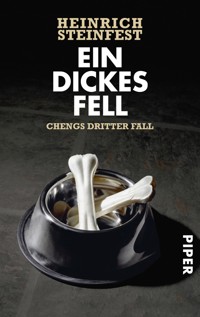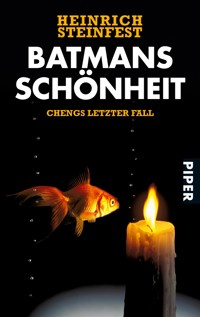10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sixten Brauns vollkommen normales Managerleben implodiert, als in Taiwan ein Wal explodiert, und Sixten von irgendeinem Teil des Wal-Innenlebens k.o. geschlagen wird. Kaum aus dem Krankenhaus entlassen, stürzt er mit dem nächstbesten Flugzeug ab - und überlebt abermals. Aber nicht ohne zwischendurch die große Liebe erlebt zu haben. Und so kommt er Jahre später - Sixten hat sich längst vom Manager zum Bademeister gewandelt - zu einem Kind, das auf gar keinen Fall sein eigenes sein kann, es dann aber doch plötzlich ist … Ein frisch verwaister Junge namens Simon. Ein Junge, der nicht spricht, außer in seiner eigenen, nur ihm selbst verständlichen Sprache. Ein Junge, der sich dann als ganz ungewöhnlich talentiert in ganz ungewöhnlichen Bereichen erweist: Er kann klettern wie eine Gemse und zeichnen wie Leonardo da Vinci. Auch liegt es an Simon, dass sich so manche Gerade in Sixtens Leben zum Kreis schließt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Die Verse auf S. 197 stammen aus dem Gedicht »Die Manager« von W. H. Auden, übersetzt von Erich Fried.
© 1948 by W. H. Auden
Reprinted by permission of Curtis Brown, Ltd.
ISBN 978-3-492-096469-2
Mai 2016
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2014
Covergestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagmotive und Illustrationen: Heinrich Steinfest
Datenkonvertierung: Kösel, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Achtung, Sie hören jetzt Schönberg!Eine Art Vorspann
Der Beginn eines jeden Buchs leidet unter einem großen Manko: Es fehlt die Musik.
Wie gut hat es da der Film, dessen Vorspann getragen wird von einer klanglichen Ouvertüre, die verspricht, was nachher erfüllt wird oder nicht, aber in jedem Fall den Zuseher augenblicklich in ihren Bann zieht, augenblicklich eine Aufregung, eine Rührung oder ein Staunen hervorruft.
Denken Sie zum Beispiel an Der Weiße Hai. Im wirklich allerersten Moment, als mitten im Weltraum die rotierende Erdkugel der Universal Studios sichtbar wird, vernehmen wir die Echolaute aus einem Unterwassersonar, harmlos noch, zwitschernd, plaudernd, ein friedliches Meer, nur daß es friedliche Meere nicht gibt. Und gleich darauf, als die Namen der Produzenten in einfachen weißen Lettern sich vor absoluter Schwärze abzeichnen, setzt die Musik ein, sie nähert sich bedrohlich, die Musik, und mit ihr der große Fisch. Man sieht ihn aber nicht, sondern die Kamera scheint in den Augen des Fisches einzusitzen, zeigt, was er sieht, wie er jetzt durchs Riff gleitet. Dies mutet zwar eher an wie der Ausblick eines Anemonenfisches, aber erstens heißt es ja, selbst diese Winzlinge würden Taucher attackieren, und außerdem ist es weiterhin die Musik – noch kräftiger, noch unheimlicher, mehr Instrumente, mehr Noten –, die so unverkennbar signalisiert, wie groß dieser Fisch sein muß und daß in dieser Geschichte sehr, sehr lange nichts gutgehen wird.
Als nun die Musik endet (beziehungsweise zum biederen Gedudel einer Mundharmonika übergeht), wechselt die Kamera zu einer fröhlichen Gruppe junger Menschen, die spätabends am Strand sitzen und feiern – und wir fragen uns sofort, wer von denen jetzt so blöd sein wird und Steven Spielberg den Gefallen tut, im Meer schwimmen zu gehen.
Es sind zwei Filme und die beiden zu ihnen gehörenden Musiken, die das Verhältnis der modernen Menschen zum Wasser insgesamt geprägt haben: Der Weiße Hai und Psycho. Einmal das Meer, einmal die Dusche. Ohne die Kompositionen von John Williams und Bernard Herrmann wäre der Horror nur der halbe. Der Fisch böse, aber auch nur ein Fisch. Das Messer tödlich, aber trotzdem ein bloßes Artefakt, das mißbräuchlich benutzt wurde. Erst die Musik gibt dem Horror eine Stimme, im wahrsten Sinne, eine Stimme, die aus der Hölle stammt und den Hai wie auch das Messer mit einer finsteren Seele ausstattet. (Man kann das leicht beweisen und braucht sich nur die beiden Filme ohne die Musik anzusehen. Was sich dann offenbart, ist zwar noch immer kein Spaß, aber es fehlt nun jene Dämonie, die die Klänge zu transportieren verstehen. Eine Dämonie, die den Schrecken schrecklicher macht – und zugleich schöner.)
Es stimmt, Titelsequenzen wurden dafür geschaffen, die Namen der Schauspieler, der produzierenden und kameraführenden und anderweitig involvierten Personen in rascher Folge mehr oder weniger prominent zu präsentieren. Doch es ist die Musik, die zu diesem frühen Moment den Zuseher und Zuhörer unmittelbar in den Film hineinzieht. In der Art, wie man ohne jede Vorwarnung einen Kuß erhält oder eine Ohrfeige. Ein Buchumschlag oder Prolog ist dagegen schwächlich. Ein kleines Zittern im Vergleich zum Schüttelfrost.
Ich würde viel darum geben, könnte ich der Geschichte, die hier zu erzählen ist, eine Einleitung verleihen, die mit Musik und verdichteten Bildern unterlegt wird, Bildern, vor deren Hintergrund Personen oder Dinge auftauchen und verschwinden gleich Geistern. Geistern von Bedeutung.
Wie würde ich diese Eröffnungssequenz umsetzen? Welche Musik verwenden? Eine klassische oder eher eine dieser Zwölftonkompositionen, die an unseren Nerven zerren? Aber eben ganz anders, als viele es im Konzertsaal empfinden, dort die Nerven tötend, beim Vorspann hingegen in der Tat an ihnen ziehend: eine Spannung erzeugend.
Ja, ich denke, ich würde etwas von Schönberg nehmen. Und dazu anfangs völlig uneindeutige dunkle Bilder, in die sich nach und nach helle, bläuliche Flecken mischen und den Zuseher begreifen lassen, auf eine in Zeitlupe ablaufende Unterwasserszene zu schauen. Schlußendlich realisiert das Publikum, daß es sich um ein mächtiges Wesen oder Objekt handeln muß, welches hier durchs Wasser gleitet. Keinen Hai, eher ein U-Boot oder einen Wal oder schwimmenden Elefanten, vielleicht auch ein versinkendes Schiff. So klar soll das jetzt noch gar nicht werden, weil der Vorspann etwas verspricht, aber nicht verrät. Ein riesiges Ding eben. Riesig und dennoch verletzlich, zumindest wird diese Verletzlichkeit in einer letzten Einstellung angedeutet, dann, wenn der Name des Regisseurs auf der Leinwand sichtbar wird. Wie bei einer umgekehrten Schöpfung, wo der Name des Schöpfers den Schluß der Schöpfung bildet. Beinahe im Stil eines Geständnisses, einer Reue oder Abbitte. Ein Gott, der sich entschuldigt.
Das Ende des Vorspanns gleicht dem Tod. Danach kommt das Leben. Aber es ist eben ein gewesenes.
1
»Oha!«
Ein Oha! denken oder sagen oder rufen kann eigentlich nur bedeuten, sich in einem Zustand der Verspätung zu befinden. Und damit ist nicht allein die Straßenbahn gemeint, die einem davonfährt. Sondern auch und vor allem die, die auf einen zufährt.
*
Als sich das Ding mit rasender Geschwindigkeit näherte, erstarrte ich. Aber was hätte ich tun sollen? Mich wegducken? Fürs Wegducken ging alles viel zu schnell. Fürs Wegducken hätte es einer Vorbereitung bedurft, einer Warnung, einer Regieanweisung. Wobei ich absolut flink sein konnte, sechsundzwanzigjährig, Hürdensprinter, beinahe Deutscher Meister, jedenfalls im Besitz eines Körpers, der einem möglichen Sich-zur-Seite-Biegen, Sich-auf-den-Boden-Werfen nicht im Wege gestanden hätte. Keine selbstverschuldeten Hindernisse auf Hüfthöhe. Keine fettreichen Anhängsel.
Doch umsonst. Ich war völlig in meiner Fassungslosigkeit gefangen. Eigentlich schon von dem Moment an, als ich den Schwertransporter erblickte, der da die Straße herunterkam und auf dessen Ladefläche sich wahrhaftig ein Wal befand: ein gewaltiger Brocken von Fisch, auch wenn jedes Kind dir sagt, Wale seien keine Fische. Aber mein Gott, genau so schauen sie doch aus. Dieser hier lang wie eine Straßenbahn, aber viel massiver, kastenartig, schwärzlich, der Schädel größer noch als der Rest. Keine Frage, ein Pottwal, so viel Naturkunde hatte ich auch noch intus. Ich konnte mir nicht mal sicher sein, ob der Fisch auf dem Laster tot oder halbtot war oder eher betäubt. Und auf dem Weg wohin? Ins Museum? Ins Aquarium? Nach SeaWorld? – Daß man dort auch schon mit Pottwalen spielen konnte, wäre mir allerdings neu gewesen. Konnten Pottwale, so umständlich groß, wie sie waren, durch Reifen springen? Pirouetten drehen? Schnattern wie Delphine? Ihre schweren Köpfe hochhalten und um kleine Leckerbissen betteln? Autisten heilen? Oder war das, was ich dort auf dem Lkw sah, vielmehr eine Attrappe? Ein Werbegag? Allerdings wirkte das Tier ungemein echt, wie frisch gefangen, als es da keine paar Meter von mir entfernt vorbeikam und ich ihm hinterherglotzte.
Das war genau so ein Moment, wo man sich gerne fragt, ob man träumt oder wacht. Wobei ich noch gar nicht schlafen gegangen war, sondern die gesamte Nacht in mehreren Bars zugebracht hatte, in die wir von den taiwanischen Geschäftspartnern geführt worden waren. Eigentlich nicht meine Sache, die Sauferei, und daß da immer Mädchen neben dir stehen und dich freundlich anlächeln und ein bißchen Englisch reden, so ein gekichertes Englisch, das aus drei zerschnipselten Wörtern besteht. Dabei sind die Mädchen sicher nicht blöd, eher hat man das Gefühl, selbst blöd zu sein, so wie ein schiefes Gebäude an der Theke zu lehnen und ein Glas nach dem anderen hinunterzukippen
Sicher, theoretisch hätte man Nein! sagen können.
Theoretisch hätte man sein Geld auch als Bademeister verdienen können, in der Sonne stehen und gleichzeitig eine Aura der Lebensrettung verströmen. Aber wie viele Bademeister verträgt die Welt?
Die Wirklichkeit sah so aus, daß ich, ohne darum gebeten, aber auch ohne mich gewehrt zu haben, mit einer von den kichernden Hostessen in einem Hotelzimmer gelandet war. Wo ich mich erst mal ins Badezimmer flüchtete. Dort, auf dem Klodeckel sitzend, den pochenden Schädel zwischen die Hände geklemmt, fiel mir ein, daß ich drüben in Europa verlobt war, nicht einmal ungern verlobt. Gleichwohl galt die Regel, nach welcher Prostituierte nicht zählen. Weil man die ja weder heiraten noch sonstwas Außergeschäftliches von ihnen will. Wer hat schon ernsthaft im Sinn, sich für den Rest der Nacht ganz fest an so ein Mädchen zu schmiegen? Niemand, außer ein paar Romantikern, die davon träumen, eine Hure zu retten.
Nein, Prostituierte zählen nicht.
So lautete die Regel, aber es war natürlich keine Regel, die meine Verlobte unterschrieben hatte, sondern eher eine firmeninterne. Darum, weil wir, die Kollegen und ich, viel in der Welt unterwegs waren. An Orten, wo es unhöflich gewesen wäre, sich freundlichen Einladungen zu diesem oder jenem Vergnügen zu verweigern. Moralisch zu werden, statt höflich zu bleiben. Vegetarier zu sein angesichts der von Fleischbergen sich biegenden Tische. (Das war übrigens in der Tat die erste Frage gewesen, als ich mich um diesen Job beworben hatte. Ob ich Vegetarier sei. Wow! Was für eine Frage für jemanden, der in die IT-Branche will. Wobei schon klar gewesen war, die Frage könne allein metaphorisch gemeint sein. Weshalb ich keine Sekunde gezögert hatte, ganz grundsätzlich den Fleischkonsum zu bejahen. – Anscheinend die richtige Antwort.)
Die Menschheit befand sich in einem Jahr, das eben begonnen hatte und die Zahl 2004 trug. Es war Mitte Januar. Ich selbst hielt mich in Tainan auf, einer Stadt im südlichen Taiwan. – Seit ein paar Jahren fuhr ich in Asien herum, ohne je ein Gefühl der Vertrautheit entwickelt zu haben. Aber wäre es denn viel anders gewesen, hätte ich den Norden Deutschlands beackert, das Ruhrgebiet, das fröhliche Frankreich oder die unheimliche Schweiz? Sicher nicht! – Ich war zu dieser Zeit für ein Unternehmen namens Weyland Europe tätig, den Ableger eines amerikanischen Konzerns, der in den Vereinigten Staaten nur in der Fiktion mehrerer Filme und des Internets existierte, auf dem europäischen Kontinent aber Wirklichkeit geworden war. So, als hätte jemand auf der Rückseite des Globus eine Romanfigur erfunden, die dann auf der Vorderseite tatsächlich das Licht dieser Welt erblickte.
Weyland Europe war also real, wenigstens in einem börsennotierten Sinn, und konzentrierte sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Verkauf von Mikroprozessoren. Ich erklärte oft zum Spaß, wir würden mit Bakterien handeln, weil die ja auch so klein sind. Wobei ich mich weniger um den Vertrieb als um die Herstellung kümmerte. Die Bedingungen der Herstellung. Um das Wo und Wie.
Ich will nicht behaupten, man kriegt so was hin, wenn man sich ständig ans Herz greift und einem das Herz vom vielen Hingreifen ganz weich wird. Die Frage ist immer: Was wollen wir? Wollen wir eine gerechte Welt? Was ist denn gerecht? Bessere Arbeitsbedingungen für die armen Schweine? Mein Gott, dann hätte ich aber nicht in Asien herumfahren dürfen, um geeignete Orte für die Produktion zu finden. Wenn die Leute daheim jammern, an diesem oder jenem Ding klebt so viel Blut, kann ich nur sagen: Na klar! Würde nicht Blut dran kleben, wäre es nicht so günstig. Wir wollen konsumieren. Und ich sage das ganz deutlich: Es gibt solche Waren nicht, an denen kein Blut klebt. Auch wenn »Bio« draufsteht oder »Glutenfrei« oder eben »Blutfrei«. Irgendwann werden die Entwickler auf die Idee kommen, Biopanzer herzustellen, Panzer, die, nachdem sie genügend oft geschossen haben, zu Kompost zerfallen oder sich in Joghurtbecher verwandeln. Oder sie erfinden Geschosse, die Kindern und Frauen ausweichen und nur die Männer erwischen. (Um noch mal auf den Vegetarismus zu kommen: Klar, da gibt es jetzt immer mehr Produkte. Das sind solche, bei denen praktisch das Blut heruntergewaschen wird, bevor sie auf den Markt kommen. Dafür zahlt man dann etwas mehr, fürs Waschen.)
Ich bin kein Zyniker. Zynisch sind die, die allen Ernstes meinen, an einem Computer zu arbeiten, auf dem ein angebissener Apfel klebt, sei irgendwie wohltätig. Oder Nudeln zu essen, in denen kein Ei steckt. Als seien solche Nudeln vom lieben Gott persönlich vorgekaut worden.
Ich saß da also mit einem Gefühl leichten Schwindels in diesem Fünf-Sterne-Badezimmer und fragte mich, was ich tun sollte, wenn ich wieder draußen war bei dem kichernden Mädchen. Ich dachte mir: »Gib ihr einen Geldschein, und schick sie nach Hause.« Aber das war natürlich Blödsinn, weil ja alles bereits bezahlt war, jeder Whisky und jede Prostituierte, sämtliche Shrimps und die Zigarren, die gestern auf meinem Zimmer gelegen hatten. Nicht, daß ich rauchte. Mußte ich auch nicht. Zigarren waren ein Symbol, alles war ein Symbol. Auch die Mädchen. Es ging nicht um die Befriedigung, die sich daraus ergab, befriedigt zu werden oder sich tatsächlich eine Zigarre anzuzünden. Sondern darum, daß das Symbol in die Welt getragen wurde und man selbst in diesem Symbol aufging. Sperma war dabei sowenig das Thema wie Tabak. Es drehte sich auch nicht wirklich um Bestechung im Sinne einer Bereicherung. Denn reich oder zumindest halbwegs reich war man ja schon. Es zählten allein die Bilder. Die Entscheidungen, die ich traf, wären keine anderen gewesen, hätte ich mich nicht einladen lassen. Aber ich hätte mich dann außerhalb des Symbols gestellt und damit auch außerhalb der Ordnung, gewissermaßen in einen rechtsfreien Raum. Ich wäre in meiner Verweigerung praktisch zum Kriminellen geworden.
Ich trat aus dem Badezimmer und wollte der Kleinen zu verstehen geben, sie könne gehen. Daß es vollkommen ausreiche, mich einen Abend lang angekichert und schlußendlich auch noch eine Flasche Champagner geöffnet zu haben. Sie zu trinken sei nicht nötig. In den Abfluß geschüttet, hätte sie die gleiche Bedeutung wie in den Leib geschüttet. Es wäre allein ein Sakrileg gewesen, den Champagner zurückzuschicken und damit die taiwanischen Partner, das Hotel, den Kellner, den Importeur von Champagner in Taiwan, ja gewissermaßen eine ganze Kultur zu beleidigen.
Doch als ich nun aus dem Bad kam, war das Mädchen verschwunden. Das Zimmer gähnte. Ich sah auf die Uhr. Meine Güte, ich war eine ganze Stunde auf dem Klodeckel gesessen. Wahrscheinlich hatte die bezahlte Kichererbse gemeint, ich sei in der Badewanne eingeschlafen. Allerdings war das hier gar nicht das Hotel, in dem ich wohnte. Andererseits war alles bereits beglichen, und ich hätte mich augenblicklich ins Bett legen können – ein Designerbett, das aber eher wie der Entwurf zu einem Bett als ein zu Ende gedachtes und zu Ende gebautes aussah.
Nein, ich wollte hier nicht schlafen.
Ich griff nach meinem Jackett, verließ den Raum, verließ das Gebäude und trat hinaus auf die morgendlich helle Straße, um mein eigenes Hotel zu suchen, hatte allerdings nicht einmal mehr dessen Namen im Kopf. Ich ging los ohne Plan.
Ohne Plan? Nicht ganz. Ohne einen solchen zu sein, mußte noch lange nicht heißen, daß es keinen gäbe.
Offenbar hatte jener Dämon, den wir das Schicksal nennen (wie man eine Bombe Little Boy nennt oder einen Kinderdrescher Krampus oder einen, der Krokodile verprügelt, Kasperl), das allergrößte Interesse, mich genau in jenem Augenblick die Straße hinuntermarschieren zu lassen, als eben – halb sieben Uhr in der Früh, der Berufsverkehr in vollem Gange – der Laster mit dem Pottwal vorbeifuhr und mich in ungläubiges Staunen und eine steinerne Körperhaltung versetzte.
Und während ich da fassungslos stand ...
Auch im nachhinein wurde nicht klar, was genau von dem Wal – Teil eines Gedärms oder Teil eines Organs – es gewesen war, das mich mit voller Wucht im Gesicht getroffen hatte. Die Explosion hatte ich gar nicht wahrgenommen, den Knall nicht, nicht den sich öffnenden Tierleib, aus dem das Blut spritzte und die Umgebung in ein Actionpainting verwandelte, sondern allein das dunkle Stück, das auf mich zuflog und dessen Dunkelheit mich sogleich vollständig einhüllte.
Im Film wäre es jetzt zwei oder drei Sekunden schwarz und still gewesen.
2
Im wirklichen Leben dauerte es etwas länger. Als ich zu mir kam, wurde die absolute Schwärze von einer absoluten Weiße ersetzt, als hätten ein paar katholische Anstreicher – Polen natürlich – den Tod aufgehellt.
Aber ich war nicht gestorben. Nachdem die Umgebung sich nach und nach vom Eindruck einer milchigen Ummantelung befreite, begriff ich, in einem Krankenhausbett zu liegen. Neben mir die üblichen Geräte, deren Geräusche und optischen Signale mir bewiesen, am Leben zu sein. Ja, ich konnte mein Herz schreiben sehen. In Schönschrift. Sehr sauber, aber ohne eigenen Stil, ein Durchschnittsherz halt. Von der Seite fiel Tageslicht durch ein hohes Fenster. Dazu ein Geruch, der weniger an Chemie als an Nudelsuppe erinnerte. Vielleicht bloß wegen des Hungers, der mich augenblicklich quälte.
Eine Krankenschwester erschien. Weder kicherte sie, noch war ein Mitgefühl in ihrem Gesicht. Sie sprach kein Wort, überprüfte allein die Apparaturen. Eine Chinesin. Was die Vermutung nahelegte, mich noch immer in Tainan zu befinden.
Ich griff mir an den Kopf und spürte den Verband, der meinen Kopf turbanartig umgab. Mein Gedächtnis freilich funktionierte, ich litt nicht etwa an einer Amnesie. Lag keineswegs neben mir wie neben einem Fremden. Alles war bestens in Erinnerung: das Hotel, die Straße, der Laster, der Wal. Und wie irgend etwas aus dem Wal herausgeschossen war. Gleich einem Torpedo. Einem Torpedo, der zielgenau in meinem Gesicht aufgeschlagen war. Soviel wußte ich. Aber es war ein Wissen, welches ich kaum glauben konnte.
Ein Mann trat ein. Ein Mann im Anzug, ein Weißer, also von der Hautfarbe her ein Weißer, so wie man früher sagte: ein Schwarzer. Er setzte sich an die Bettkante. Wegen der Art, mit der er Platz nahm und dabei seine Fingerkuppen zu einem Münchner Olympiadach zusammenschloß, dachte ich, er müsse hier der Arzt sein. Doch als er seinen Kopf anhob, erkannte ich ihn endlich als einen Kollegen aus meinem Weyland-Team. Er berichtete mir, was geschehen war, wie da ein gestrandeter und schließlich verendeter Pottwal, der größte, den es je an die taiwanische Küste gespült hatte, zum Zwecke einer wissenschaftlichen Untersuchung auf einen Laster gehievt und zur Universität auf der anderen Seite der Stadt gebracht worden war. Um dann genau auf diesem Weg, inmitten der Metropole, inmitten frühmorgendlichen Verkehrs, zu explodieren.
»Eine Gasexplosion«, sagte der Mann und meinte die Gärgase, die sich am hinteren Ende des Tiers einen Ausgang verschafft und den Mageninhalt und andere Teile mit großer Wucht ins Freie befördert hatten. Das »Freie« war in diesem Fall die Straße gewesen: die Häuser, die Lokale und Geschäfte, die geparkten Autos, die Passanten. Und einer von ihnen, der Unglücklichste, war eben ich gewesen. Wäre ich nur einen halben Meter weiter … eine Sekunde früher oder später …
War ich aber nicht.
»Saublöd!« tönte der Mann im Anzug. »Muß der blöde Fisch ausgerechnet dann explodieren, wenn du grad an der Straßenecke stehst. Du hast ein Stück von dem Monster voll abbekommen. Eine Niere oder so. Das müssen die noch rausfinden. Wobei’s ja eigentlich egal ist. Bei der Geschwindigkeit wird ohnehin alles hart wie ein Ziegelstein. Das hätte ganz anders ausgehen können. Aber ich sag mal so: Besser, es trifft dich die Niere von so einem Bullen als dem sein Schwanz, gell?«
Er lachte laut auf und schickte sich an, mir auf die Schulter zu klopfen. Ließ es dann aber bleiben und erklärte vertrauensvoll: »Die sagen, du wirst völlig gesund, versprochen. Die Ärztin wird dir das bestätigen. Sie kommt gleich. Ein wenig eine Strenge. Aber immerhin, sie ist Deutsche. Keine Angst also.«
»Ich habe keine Angst«, versicherte ich ihm.
»Du solltest aber schon zusehen, rasch auf die Beine zu kommen. Du weißt ja, was Maître Schmidt vom Kranksein hält.«
Schmidt saß im Vorstand und bildete sich viel darauf ein, gefürchtet zu sein. Ich fand das eigentlich ganz okay, daß er zu der Angst, die er auslöste, auch stand, stolz war, Schrecken zu verbreiten, und nicht etwa den Wohltäter spielte, der er nicht war, die anderen aber auch nicht. Richtig, er neigte zur Wut, wenn einer seiner Zöglinge und Höflinge ausfiel. Für ihn gab es kein Fremdverschulden und keine höhere Gewalt. Er sagte gerne: »Ein Unglück kündigt sich immer an. Wer aber zu blöd ist, eine solche Ankündigung zu erkennen, ist falsch bei Weyland.«
So gesehen, würde ich einige Mühe haben zu erklären, wie es hatte geschehen können, einem explodierenden Wal in die Quere gekommen zu sein.
Mein Kollege meinte: »Vor allem beeil dich, den Verband von deinem Kopf runterzukriegen. Das schaut wirklich scheiße aus.«
Ich dankte für den freundlichen Hinweis.
»Gerne, Sixten«, sagte er und löste seine Fingerkuppen. Das Olympiastadion fiel auseinander.
Sixten, das war mein Vorname, schwedisch, wegen meines Vaters, der von dort stammte, während die Familie meiner Mutter angeblich schon so lange in Köln lebte, wie Köln existierte. Einen Nichtkölner zu heiraten war eigentlich verboten gewesen, andererseits gab es Schlimmeres als die Schweden, viel Schlimmeres. Und immerhin hatte mein Vater eingewilligt, den Familiennamen meiner Mutter anzunehmen. Das war ihre Bedingung gewesen, damals, 1976, im Jahr der Eherechtsreform, die solches ermöglichte. Er selbst hatte sich erst durchsetzen können, als zwei Jahre danach die Wahl eines Vornamens für mich zur Diskussion stand. – Meines Vaters kleiner schwedischer Sieg. Man taufte mich Sixten. Meiner Mutter hingegen verdankte ich den nicht gerade originellen Familiennamen Braun. Sixten Braun. Wenn man es aussprach, klang es eher englisch als deutsch oder schwedisch. Im Busineß kein Nachteil.
Der Weyland-Kollege beugte sich jetzt nahe zu mir hin und sagte: »Du weißt ja, was Schmidt immer sagt: von einem Auto überfahren werden und trotzdem nicht tot sein.«
Richtig, Schmidt zitierte gerne Robert De Niro in der Rolle eines Geschäftsmannes, der auf die Äußerung seines Gegenübers, krank gewesen zu sein, antwortet: »Krank? In dieser Liga wird man von ’nem Auto überfahren und stirbt trotzdem nicht.«
»Das ist für Schmidt einfacher«, sagte ich, »wenn man bedenkt, daß er höchstwahrscheinlich ein Untoter ist.«
»Du scherzt.«
»Eigentlich nicht. Es ist Scherz genug, daß mich so ein Seeungeheuer fast erschlagen hätte.«
»Stimmt«, sagte er und lachte erneut in seiner bellenden Weise. »Da wirst du dir noch einiges an Spott anhören müssen. Trotz der zwei Tage im Koma. Aber es ist halt ziemlich unheroisch, wenn die verirrte Kugel, die einen getroffen hat, aus einem Haufen schleimiger Walkutteln besteht.«
Da hatte er wirklich recht. Ich würde es in Zukunft soweit wie möglich vermeiden, von dieser Geschichte zu berichten, sosehr sie mein Leben entscheidend verändern sollte. Wobei ich noch nicht ahnen konnte, wie entscheidend.
3
Endlich kam sie. Die Ärztin. Die deutsche Ärztin in Taiwan. Wie man sagt: Endlich ist Sommer. Denn in der Tat glich ihr Gesicht einem warmen Tag, der zuvor in den Wetternachrichten als verregnet angekündigt worden war. Anders gesagt, ich begriff mit einemmal das Glück, das mir beschert war, indem ich auf die Straße getreten, von einem explodierenden Wal erwischt und in dieses Krankenhauszimmer gelangt war, um schlußendlich in ein solches Gesicht schauen zu dürfen. Ein Gesicht, als hätte eines dieser französischen Malergenies eine letzte vollkommene Zeichnung hinterlassen, die sich zauberischerweise in 3-D verwandelt hatte. Ja, diese Frau wirkte auf mich sehr viel mehr französisch als deutsch. Kein roher Kirchner oder saftiger Beckmann, sondern ein Matisse aus ein paar Bleistiftstrichen, die bewiesen, wie sehr auch Schönheit eine Formel besitzt.
Gut, ich will nicht ausschließen, daß sich in meinem Schädel einige Regale verschoben hatten, weil ein Schwärmer war ich doch nie gewesen. Dennoch war ich jetzt so gänzlich auf diese Mimik konzentriert, auf die Bewegungen der Lippen und gar nicht auf die ärztliche Diagnose, die zwischen diesen Lippen hervordrang und beschrieb, was mit mir, was vor allem mit meinem Kopf geschehen war, und wie froh ich sein dürfe, nach zwei Tagen wieder aus dem Koma erwacht zu sein. Ich vernahm Begriffe wie »Schädel-Hirn-Trauma«, »Hirnstammreflex«, »EEG« und »Pupillenbewegung«, blieb aber recht gleichgültig dagegen – nur beim Begriff »Gehirnblutung« zuckte ich kurz zusammen. Aber wirklich nur kurz. Eher so, wie man bemerkt, sich in die Fingerkuppe geschnitten zu haben, und gleich darauf denkt: »Na, ich werd schon nicht verbluten.«
Wie auch immer, ich war in diesem Augenblick sehr viel mehr auf die Sprecherin als auf das Gesprochene konzentriert. Wobei die Stimme der Frau lange nicht so anziehend wirkte wie ihr Gesicht. Ohne darum behaupten zu wollen, sie hätte eine Reibeisenstimme besessen; weder krächzte sie, noch würgte sie die Wörter hervor, aber es war eben kein Vergleich. Vielleicht könnte man auch sagen: Zu so einem Gesicht gibt es gar keine Stimme. So ein Gesicht kann nicht in eine Stimme übersetzt werden.
Klar, das ist pathetisch. Aber mein ganzer Zustand war pathetisch. Zuerst lächerlich, siehe Walexplosion, und dann pathetisch, indem ich nicht vom Antlitz dieser Ärztin lassen konnte. Und wenn, dann nur, um mir auch den Rest anzusehen: einen mittelgroßen, sehr geraden, kompakten Körper, einen strengen Körper, nicht streng im Sadomasosinn, sondern lehrerinnenhaft, das Autoritäre mit der Autorität verbindend. Ihre Hände steckten tief in den Taschen ihres Ärztekittels. Unter dem knielangen beigen Rock weißbestrumpfte schlanke Beine, die in gelben Turnschuhen fußten.
Bald kam mir der Gedanke, diese Person sei eine bloße Halluzination, eine Frau, die allein in meinem Kopf existierte, während ich mich in Wirklichkeit noch immer im Koma befand, ja, niemals wieder daraus erwachen würde. Wobei ich angesichts dieser Schönheit, die da täglich mit gelben Turnschuhen an mein Bett träte, um mich über meinen Zustand zu unterrichten, gerne bleiben wollte, wo ich war, auch wenn es sich um eine Illusion handeln mochte.
Wer wollte einen guten Traum gegen eine schlechte Wirklichkeit tauschen?
Entscheidend war, daß es mir gelang, die Frau Doktor immer länger »an mein Bett zu fesseln«, sie nach ihrem Leben in Tainan zu befragen. Mit ihr zu sprechen, als würden wir uns in einem Restaurant gegenübersitzen.
Seit vier Jahren war sie in dieser Stadt, machte aber nicht den Eindruck, ein Taiwanfan oder auch nur eine Asienbegeisterte zu sein. Sie lebte allein, und das war sicher die beste Nachricht. Offenkundig war sie in erster Linie an Gehirnen interessiert. Sie versuchte, ihnen auf die Schliche zu kommen, ihr eigentliches Wesen zu durchschauen.
Nun, ihre Aufgabe in diesem Spital war weniger, Hirne zu erforschen, als sie zu reparieren. Aber zum Reparieren gehört natürlich eine gewisse Kenntnis des Objekts, das da instand gesetzt werden soll. – Es gefiel mir, wie diese Frau über die rätselhafte Schaltzentrale in unser aller Köpfe redete. Liebevoll, aber kritisch. Wie man vielleicht über einen Schurken spricht, den man jedoch bewundert. Einen genialen und eleganten Gauner. Einen, der auch tötet, aber immer aus gutem Grund.
Wobei sie, die Frau Dr. Senft, ursprünglich von der Psychologie herkam, weshalb ihr einige der jüngsten überraschenden Ergebnisse der Hirnforschung nicht ganz so überraschend erschienen. Sie wußte schon länger, daß das Hirn in der Lage ist, eine Unwahrheit so lange zu wiederholen, bis sie einem als Wahrheit erscheint.
Sie drückte es so aus: »Der Rechner da in unserem Kopf tut alles, um uns das Leben erträglich zu machen. So viel Häßliches wir meinen aushalten zu müssen, kann man trotzdem sagen, das Gehirn ist ständig damit beschäftigt, eine traurige Realität zu verbergen. Es idealisiert, wo es kann. Das Gehirn ist ein Künstler und neigt zur Apotheose. Es ist religiös, aber nur der Ästhetik wegen. Es geht in die Kirche, um die Kirche auszumalen, nicht um zu beten. – Ich hoffe, Sie können mir folgen.«
»Aber klar«, sagte ich, während ich ihr Augenpaar studierte, den Farbton von Karamel, um jetzt nicht von fossilem Harz zu sprechen, dazu die schwarzen, ausladenden Wimpern, an denen die Lider schwer zu tragen schienen, und sah die Müdigkeit, die in diesen Augen einsaß und sie noch schöner machte, als wenn sie frisch und ausgeruht gewesen wären. Ich war mir da ganz sicher: wie sehr Erschöpfung einen Menschen hübscher machte. Wie ja auch so mancher Gegenstand erst als Antiquität seinen vollen Reiz entwickelt.
Irgendwann durfte ich das Bett verlassen und mir in den Gängen des Krankenhauses sowie in einem kleinen, schattigen Innenhof die Beine vertreten. Dort traf ich Dr. Senft, froh darum, einmal nicht aus der Position des Liegenden zu ihr hochsehen zu müssen, sondern nun zu ihr hinunterschauen zu dürfen. – Ich weiß schon, es gehört sich nicht, so was zu sagen, weil auf eine Frau hinunterzuschauen sogleich als anmaßend gilt. Aber seien wir doch ehrlich: Man muß schon ein Hollywoodstar oder Multimillionär oder Modeschöpfer oder so sein, um als Mann ein Vergnügen dabei zu empfinden, zu einer Frau hochzusehen. Es lächelt sich als Mann einfach besser von oben nach unten, auch wenn die Angelächelte die eigene Chefin ist, eine Kapazität, überlegen oder schlichtweg anbetungswürdig. Man kann eben auch von oben nach unten beten. – Ich hoffe, man versteht mich.
Jedenfalls tat ich genau das, als ich nun Dr. Senft über den Weg lief: Ich lächelte zu ihr hinunter, gar nicht weit, denn so viel kleiner war sie nicht, einen halben Kopf bloß, lächelte also bergab und fragte: »Darf ich Sie zum Abendessen einladen?«
»Mein Gott, Herr Braun, Sie sind Patient!«
»Und Sie meinen, ein Patient darf seine Ärztin nicht …«
Sie unterbrach mich und erklärte: »Ich wollte Sie nur daran erinnern, daß Sie sich weiterhin in Behandlung befinden und noch eine gewisse Zeit Ihre Restauranteinladungen auf die Krankenhausküche beschränken müssen. Ist nun mal so.«
Ich atmete erleichtert auf und verabredete mich mit der Ärztin meines Vertrauens zum Abendessen in der Kantine.
Dinner um siebzehn Uhr.
Sicher, der Ort war nicht romantisch, unser Gespräch erstmals stockend. Wobei ich den Umstand des Stockens dahingehend interpretierte, daß sich zwischen uns, wie man so sagt, etwas tat.
Ich erzählte von der Firma, für die ich arbeitete, und in welchen Funktionen. Profanes Zeug. Während ich aber sprach und dabei zusah, wie sich Dr. Senft langweilte, stellte ich sie mir nackt vor. Ihren mittelgroßen, kompakten, festen Körper. Wahrscheinlich war alles fest an ihr, auch der mittelgroße Busen, der den weißen Stoff ihres Ärztekittels straffte.
Richtig, ich hatte nicht vergessen, drüben in Europa, in Köln, wo ich lebte, eine Verlobte zu haben. Sie schrieb mir alle zwei, drei Tage eine Mail. Keinen Roman, das nicht, auch kein Gedicht, eher etwas Sachliches, sachlich, aber freundlich. Wäre sie nicht ihrerseits so stark eingespannt gewesen, sie hätte mich augenblicklich besucht.
Ich konnte mich deutlich an den Zustand von Zufriedenheit erinnern, den das Verlobtsein mit ihr hervorrief, wenngleich ich mir im Moment schwergetan hätte, ihr Gesicht zu beschreiben. Ihr Gesicht lag in einem Nebel, der ganz Köln verdeckte.
Mir war nicht klar, wie sehr im Zuge meiner Kopfverletzung nicht doch mein Gedächtnis in Mitleidenschaft gezogen worden war. Absolut perfekt schien es nicht zu funktionieren. Ich hatte Aussetzer und Lücken. Doch manche Lücke war mir durchaus willkommen.
Freilich wußte ich, daß meine Verlobte Lydia hieß, zudem war mir der leidenschaftliche Sex mit ihr präsent. Allerdings auch, wie sehr dieser zuletzt eine eheähnliche Eintrübung erfahren hatte. Nun, wir wollten ja ohnehin heiraten. Auch waren da noch Lydias Eltern, Walter und Grita, Wallace & Gromit, wie Lydias kleiner Bruder heimlich gerne sagte, reiche Leute, die Eltern, ein bißchen steif, aber … Faktum war, daß ich mir im Moment niemanden weniger an meinem Tisch wünschte als diese Lydia. Diese Lydia.
Dr. Senft hingegen …
Ich fragte sie offen heraus, ob sie verheiratet sei.
»Wieso, haben Sie Interesse?« fragte sie und verzog keine Miene. »Oder wollen Sie nur ein bißchen unverschämt sein?«
»Also, das halte ich eher für das Normalste auf der Welt.«
»Was? Unverschämt sein oder Instant-Heiratsanträge?«
»Instant? Na, wir kennen uns doch schon eine Weile, nicht wahr? Außerdem wissen Sie über mein Gehirn besser Bescheid als irgend jemand anderes.«
»Sie sind ganz schön zuversichtlich«, stellte Dr. Senft fest, schob das Heiratsthema aber zur Seite und ging auf das Kopfthema ein. Sie erklärte mir, daß das Gehirn weniger die Welt abbilde als unsere Vorstellung von der Welt. Es erspare uns gewisse Sachverhalte, zum Beispiel den, für die Dauer des Blinzelns den Kontakt zur sichtbaren Welt zu verlieren. Immer wieder aufs neue, mitten am Tag in eine kurzzeitige Nacht zu geraten. Das Gehirn unterbinde es, diesen enervierenden und durchaus bedrohlichen Zustand wahrzunehmen.
»Das Gehirn lügt uns also an«, stellte ich fest.
»Na, das ist die Frage, ob man das Unterdrücken einer schlechten Nachricht als Lüge interpretieren sollte. – Wenn überhaupt, ist es doch eher eine Notlüge, damit der arme Mensch eben nicht verrückt wird. So, wie es auch besser ist, das schwarze Loch nicht zu sehen, welches da mitten in unserem Auge klafft und das wir Pupille nennen. Ich meine, das Loch ist ja da, notwendigerweise, weil schließlich die sichtbare Welt hineinströmt und unserem Hirn sagt, was draußen so los ist.«
»Viel Schlimmes.«
»Viel Anstrengendes. Lebensmittelpreise, perverse Leute im Fernsehen, bunte Geschmacklosigkeiten … da würde es wirklich noch fehlen, sich unentwegt der Dunkelheit beim Blinzeln bewußt zu sein. Wie bei einem langen Satz, der voll von Beistrichen ist.«
Ich wendete ein, Beistriche seien eigentlich ganz praktisch. »Die verleihen einem Satz eine Struktur. Eine hilfreiche dazu.«
»Nicht, wenn man den Beistrich mitliest, ich mein’s wortwörtlich, also ständig ›Beistrich‹ sagt und ›Punkt‹ und ›Anführungszeichen oben‹ und so weiter. Das würde einen dummen Satz noch dümmer machen und einen gescheiten verunstalten. Oder?«
»Was genau wollen Sie mir sagen?« fragte ich.
»Wir gehen immer davon aus, eine Schädigung spezifischer Hirnareale führe dazu, eine Information nicht zu erhalten, eine Nachricht, einen Reiz nicht zu empfangen. Was aber, wenn es umgekehrt ist? Wenn die Unterbrechung des Strangs, die Abschottung des Areals also dazu führt, daß das Gehirn aufhört, weiter seinen hilfreichen Schwindel mit uns zu treiben. Wir also plötzlich etwas erkennen, etwas bewußt wahrnehmen, was immer schon vorhanden war. Einen Beistrich eben, oder das Schwarz im Moment des Zwinkerns, oder vielleicht, ganz allein auf der Welt zu sein und sich den Rest bloß einzubilden.«
»Bilde ich mir Sie nur ein, Frau Doktor, oder bin ich vielmehr ein Teil Ihrer Einbildung? Weil, das wäre dann ja schon ein Unterschied.«
»Wir können nicht ausschließen, daß jemand Drittes sich uns ausdenkt, oder?«
»Danke«, sagte ich.
»Wieso danken Sie?«
»Ich danke dem, der sich ausgedacht hat, uns beide zusammenzubringen.«
»Sie sind ein übler Schmeichler«, kommentierte sie.
»Übel? Wirklich?«
»Ja. Aber ich mag Sie trotzdem.«
»Echt?«
»Na vielleicht auch nur, weil ich froh bin, mich mit jemandem in meiner Landessprache unterhalten zu können.«
»Wäre das alles, wäre es traurig. Jedenfalls zuwenig für die Liebe.«
»Ich dachte, Sie wollen mich heiraten. Von Liebe war keine Rede.«
Ich sagte ihr, ich würde das gerne verbinden.
»So maßlos?«
»Ja, so maßlos«, beharrte ich. Und fragte: »Gefalle ich Ihnen denn? Ich meine, mal so rein äußerlich.«
»Sie sehen gut aus, das stimmt. Aber bei einem Mann, den man heiraten möchte, muß man sich fragen, ob er auch später noch gut aussieht. Das ist nämlich ebenfalls so eine Sache, die im Gehirn passiert. Obwohl es uns was vorgaukelt, also jemanden, für den wir schwärmen, hübscher aussehen läßt, als er eigentlich ist, neigt das gleiche Hirn leider auch dazu, einen Unsympathler – da kann sein Bauch noch so flach und sein Kinn noch so kantig sein – irgendwann auch unsympathisch erscheinen zu lassen. Da wird dann aus dem Wort kantig das Wort monströs.«
»Ich bin nicht unsympathisch«, insistierte ich.
»Sie könnten es werden«, sagte die Ärztin. »Einmal verheiratet, mutiert der Mensch. Man ehelicht einen hübschen Dracula, und nachher hat man einen häßlichen Werwolf.«
»Merkwürdiger Vergleich.«
»Traurige Wahrheit.«
»Waren Sie schon mal verheiratet?« wollte ich endlich wissen.
»Halten Sie mich denn für so alt?«
Nun, ich schätzte, sie war wohl ein wenig älter als ich. Vielleicht Anfang dreißig. Jedenfalls alt genug, um bereits eine Scheidung hinter sich zu haben. Ich sagte ihr: »Sie sind eine Frau, die zeitlebens schön sein wird. Niemals ein Werwolf beziehungsweise eine Werwölfin.«
Sie aber entgegnete: »Das Femininum ist nicht immer passend.« Um dann die Sprache auf etwas anderes zu bringen. »Wissen Sie, was mich am meisten stört?«
»Ja, was?«
»Daß man hier nichts zu trinken bekommt. Keinen Wein. Mir gehen diese verdammten Tees, die sie einem ständig servieren, derart auf die Nerven. Ein Glas Rotwein würde mir jetzt wirklich guttun.«
Ich war etwas enttäuscht. Ich hätte diese Frau nicht für eine Trinkerin gehalten. Zumindest nicht für eine Person, die den Alkohol nötig hatte, um sich wohl zu fühlen.
Ich fragte: »Genüge ich Ihnen denn nicht?«
»Was heißt schon genügen? Der Wein nährt das Hirn. Der Tee füllt bloß die Blase. Jedenfalls sollten wir bei unserem nächsten Treffen ein Lokal auswählen, wo’s einen anständigen Wein gibt. Ein Grund mehr, Herr Braun, Sie rasch zu entlassen. Auch, damit ich sehen kann, wie Sie wirken, wenn Sie einen Anzug tragen. Ich glaube, Sie gehören zu denen, die im Anzug gewinnen.«
»Und worin verliere ich? In der Unterwäsche?«
»Da verliert ein jeder. Das braucht Sie nicht zu kränken.«
»Vielleicht ändern Sie noch Ihre Meinung«, sagte ich.
Dr. Senft lächelte. Und zwar vielversprechend. Möglicherweise war ihr eigenes Gehirn darangegangen, meiner relativen Hübschheit eine sehr viel attraktivere Anmut zu bescheren. Eine Anmut und ein Geheimnis. Sie hatte mich als Patient untersucht und würde mich vielleicht, nachdem sie mich einmal aus dem Krankenhaus entlassen hatte, auch noch als Mann untersuchen wollen.
4
Ich schlug der Kölner Firmenleitung vor, mich noch einige Tage in Taiwan zu lassen, um einen Termin in Japan vorzubereiten, der demnächst anstand und mir die Möglichkeit geben würde zu beweisen, daß mit mir alles in Ordnung war. Immerhin mußte ich gegen die Befürchtung antreten, in meinem Schädel sei etwas durcheinandergeraten, ich sei ein »vom Wal Geschlagener«. Um so wichtiger, in den kommenden Verhandlungen eine Brillanz zu offenbaren, die jede mögliche Veränderung meiner Hirntätigkeit eher als genial denn als durchgeknallt erscheinen ließe.
Wichtiger aber war, Dr. Senft wiederzusehen. Diesmal an einem Ort, an dem es auch Wein gab. Weshalb ich sie in ein Restaurant einlud, das ihre eigenen Möglichkeiten vermutlich um einiges überstieg. Freilich erschien sie nun ohne den Ärztekittel, den ich an ihr so gewohnt war. Doch ihre Gestalt, ihr Haar – das Blond nahe am Gelb –, die Ohrringe, die sie zu jeder Zeit zu tragen pflegte, vor allem ihre Art zu gehen, vorsichtig auftretend, als schreite sie über heiße Kohlen, wie diese Yogis, die sich niemals verbrennen, dies alles erfüllte sich in der bekannten Weise.
Ich hatte bereits am reservierten Tisch gesessen, erhob mich nun und sagte ihr, wie hübsch sie aussehe und wie gerne ich sie immer wieder aufs neue betrachtete.
»Sie übertreiben.«
»Ach, Sie ahnen gar nicht, wie wenig ich übertreibe.«
Sie schenkte mir ein Lächeln, das als ein schmaler, flockiger Wolkenstreifen den blauen Himmel in ihrem Gesicht kreuzte.
Wir aßen und wir redeten. Dazu gab es den versprochenen Rotwein, eine wirklich teure Flasche, aber kein Wort darüber, was sie kostete, um so mehr, als der Wein nicht sonderlich gut war und sein hoher Preis eher das Klischee von der Blödheit als von der Vornehmheit bestätigt hätte.
Frau Dr. Senft erzählte von Tübingen, wo sie studiert, von Budapest, wo sie eine Zeitlang gearbeitet hatte, erzählte von ihrer Mutter, einer kunstvoll ihr Scheitern kultivierenden Musiklehrerin, die in Stuttgart lebte, sich aber viel zu schade für diese Stadt war.
»Und Ihre Eltern?« fragte sie.
»Kleine Leute«, antwortete ich.
»Zwerge?«
Nein, ich meinte natürlich kleinbürgerlich. So extravagant die schwedische Herkunft des Vaters und das »altkölnische Bewußtsein« der Mutter auch anmuteten, es waren kleine Leute. Nicht ungebildet, nicht dumm, das nicht, der Vater als Arbeiter in einer Kartonagenfabrik, die Mutter als gelernte Friseurin, die später nur noch die eigene Frisur und die des Gatten und der Kinder und von einigen Nachbarn betreute und sich im übrigen um einen Haushalt kümmerte, der nicht einmal geschmacklos war – kein Kitsch oder so –, sondern vor allem gesichtslos. Gesichtslos und staubfrei. Sie jagte den Staub wie einen bösen Geist.
Ich hatte mich für diese beiden Menschen immer geniert, brave Bürger, die sehr spät in ihrem Leben Eltern geworden waren. Im Grunde waren sie nicht peinlich, sondern zurückhaltend in jeder Hinsicht, doch genau diese Zurückhaltung war mir so oft unangenehm gewesen. Diese dumme Demut angesichts der eigenen Mittelmäßigkeit. Dieser Verzicht in allen Dingen. Wie sie ständig sparen mußten, ohne daß dabei eine Ersparnis zutage getreten wäre. Solche Leute arbeiteten und legten Geld zur Seite, aber das Geld blieb immer so klein wie sie selbst.
»Was wollen Sie denn?« meinte meine Ärztin. »Schließlich haben Sie doch selbst Karriere gemacht. Ist das nicht besser als andersherum? Besser, als der Größe seiner Erzeuger hinterherzuhecheln?«
Woraus ich leider den falschen Schluß zog und wieder anfing, von meiner Arbeit zu berichten. Um erneut festzustellen, wie sehr sie das langweilte. Nicht die Mikroprozessoren an sich, die »Bakterien«, doch von denen konnte ich ja wenig erzählen, sondern allein vom Aufbau der Produktionsstätten. Aus purer Selbstachtung blieb ich noch ein wenig beim Jobthema, verlagerte dann aber das Gespräch auf die Kunst, in der Folge auf den Sport, denn dies zu verbinden bewies, daß ich kein Bildungsspießer war. Immerhin pflegte ich regelmäßig über Hürden zu sprinten und wäre dabei beinahe Deutscher Meister geworden.
Sie war keck genug zu fragen: »Und Sie kommen da wirklich drüber?«
Ich erklärte ihr: »Eigentlich fliegt man die meiste Zeit. Das ist das Schöne am Hürdenlauf, das Fliegen.«
»Na, ein bißchen was rennen müssen Sie schon, gell?«
So redeten wir uns durch den Abend, landeten hernach in einer Bar, nahe einer Gruppe kichernder Hostessen. Wobei ich keinesfalls in der Lage gewesen wäre, sagen zu können, ob eine von ihnen …
»Ich bin müde«, sagte Dr. Senft mit einemmal.
Ich aber fragte: »Darf ich Sie Lana nennen?«
»Weil ich müde bin?«
»Nein, weil ich dann eher das Gefühl hätte, Ihnen nahe zu sein. Das Sie kann ruhig bleiben, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich eine Lana sieze oder eine Frau Doktor.«
»Na gut, Sixten.«
»Ich will Sie nicht zwingen …«, sagte ich und griff über den kleinen, runden Tisch nach ihrer Hand. Sie schaute hinunter auf die meine, die da schwer auf der ihren lag. Es war eindeutig, daß sie nachdachte. Wohl ein wenig gegen die Wand dachte, die der viele Alkohol und die Stunden eines langen Tages errichtet hatten. Gleichwohl überlegend, ob sie es später bereuen würde, wenn sie jetzt nachgab.
Im Grunde hätte man sagen können: Morgen ist auch noch ein Tag. Aber erstens ist das ja nie hundertprozentig sicher – Kometen, Tsunamis, explodierende Wale –, und zweitens war ich so voller Sehnsucht, sie hier und jetzt zu küssen. Nicht morgen oder übermorgen. Nein, ich wollte es an diesem Abend, in dieser Nacht geschehen lassen, nicht zuletzt aus der Überzeugung, in diesem Moment über den absolut idealen Gehirnzustand zu verfügen, um die wahre Schönheit eines Kusses zu begreifen.
Gehirnzustand? Na, auch Gehirne haben solche und solche Tage.
Jetzt könnte man freilich einwenden, daß das eine Küssen gerne wie das andere daherkam und sich nur die sauschlechten Küsse wirklich vom Rest der Masse abhoben. Aber vielleicht war ich bisher einfach nicht aufmerksam genug gewesen, zu sehr hingerissen vom Empfinden, zuwenig mit dem Kopf dabei.
Im Zuge solcher Einsicht sagte ich – ich sagte es laut, obwohl ich es eigentlich nur hatte denken wollen –, ich sagte also: »Man muß küssen wie ein Schriftsteller.«
»Wie bitte?«
»Meine Güte, verzeihen Sie, Frau Doktor. Ich behaupte nicht, daß Schriftsteller besser küssen.«
»Wieso auch sollten sie?«
»Ich meine nur, daß man sich auf jede einzelne Nuance so konzentrieren sollte, als würde man einen Bericht verfassen, einen Roman schreiben, ein Gedicht.«
»Sie haben eine merkwürdige Art, mich nach einem Kuß zu fragen. Wo Sie doch vorher nicht gefragt haben, ob Sie nach meiner Hand greifen dürfen.«
Richtig, die Hand war noch immer dort, wo ich sie abgelegt hatte, und im Grunde hätte ich ja erst einmal damit anfangen können, genau diesen Zustand mit schriftstellerischer Eindringlichkeit zu würdigen. Aber ich war jetzt halt ganz aufs Küssen versessen. Darum löste ich meine Hand und näherte dafür mein Gesicht dem ihren. Ich konnte mich in ihren Augen spiegeln.
Und dann der Kuß, das spürbare Zögern, mit dem die Lippen endlich den Mund freigaben. Ein Zögern, das sich fortsetzte, ohne sich aber wie eine Beleidigung anzufühlen. Wie man zögert, ins Meer zu gehen, auch wenn man gerne im Wasser ist.
Ihre Zunge fühlte sich so kompakt und fest an, wie ihr Körper aussah. Kein Brett, nicht steif, aber doch wie ein Stein, wenn man sich vorstellt, Steine wären beweglich. Oder Architektur könnte sich bewegen. Häuser, die sich biegen und dehnen und deren Feuchtigkeit vom Regen stammt, der an den Fassaden herunterperlt. Diese Zunge vermittelte in keiner Weise die totale Hingabe, gab sich nicht auf, erniedrigte sich nicht, nur weil das Wort »Liebe« im Raum stand. Im Grunde spürte ich, daß ich diese Frau niemals, wie man so sagt, besitzen würde. Jetzt nicht und später nicht. Aber es ist eben mehr als bloß eine religiöse oder pädagogische Phrase, wie gut etwas sein kann, das man nicht besitzt. Den warmen Wind besitzt man auch nicht, und er tut trotzdem gut. Er kommt halt oder er kommt nicht, das ist seine Freiheit, der wir unterliegen. Und es braucht gar nicht zu verwundern, daß wir um das Wetter noch mehr Theater machen als um die Liebe. Manche interessieren sich für Politik, manche für den Sport, andere flüchten in die Kunst, das Wetter aber interessiert alle. Und heimlich sind alle froh, daß man es weder bestellen noch kaufen, noch erpressen kann. (Obgleich gewisse Nationen, etwa die Chinesen, einiges versuchen, um das Wetter an die Wand zu stellen und zu erschießen.)
»Und jetzt?« fragte ich, nachdem unsere Münder sich wieder getrennt hatten, und fügte ein gehauchtes »Du« an.
Na, vielleicht hätte etwas weniger Hauch besser gewirkt. Jedenfalls meinte Lana: »Ich würde tatsächlich sehr gerne beim Sie bleiben, wenn das geht.«
»Kein Problem«, beeilte ich mich zu erklären. Und: »Können wir trotzdem miteinander schlafen?«
Sie nickte. Dabei wirkte sie jetzt wirklich müde. Ein Schleier verdeckte den Himmel in ihrem Gesicht, silbriggrau.
Mich packte das schlechte Gewissen. Ich sagte ihr, wenn sie zu müde sei …
»Nein. Lassen Sie uns gehen.«
Wir gingen. Nicht zu ihr und auch nicht zu mir. Sondern in ein Hotel, welches gleich um die Ecke lag. Kein Luxushotel, aber das war ziemlich egal.
Alsbald standen wir im Zimmer und betrachteten uns. Ich dachte mir: »Verdammt, wie bei einem Duell.«
Dann aber kam sie näher und begann mich auszuziehen. Ganz die Frau Doktor, die sie war. Als seziere sie. Doch es war nicht gefühllos, nur sehr präzise und diszipliniert, wie sie da einen Knopf nach dem anderen durch den Schlitz führte. Man hätte nach dem gleichmäßigen Intervall, der das Öffnen der einzelnen Knöpfe bestimmte, wahrscheinlich eine neue Zeitskala entwickeln können.
Ich war von der Art, wie sie mich da »aufknöpfte«, derart fasziniert, daß ich es nicht wagte, den Prozeß dadurch zu stören, ihr Kostüm auch nur anzufassen. So geschah, was mir noch nie passiert war. Nämlich mit einemmal gänzlich nackt vor einer noch vollkommen angezogenen Frau zu stehen.
Sie war einen Schritt zurückgetreten, legte den Kopf schräg, blickte mich ungeniert von oben bis unten an und meinte: »Man sieht Ihnen wirklich an, daß Sie über Hürden springen. Hübsch!«
Ich wollte mich beschweren darüber, wie hier Noten vergeben wurden, einmal abgesehen davon, daß man über Hürden nicht sprang, wie ich bereits ausgeführt hatte, überlegte es mir aber, ging auf Lana zu und nahm sie in die Arme. Ich spürte Jacke und Rock ihres Kostüms auf meiner Haut. Wolle, ein wenig grob, aber nicht unangenehm. Wie bei einem Tier, einem Zebra vielleicht oder einer Giraffe, einem Steppentier jedenfalls.
So nah und fest an ihr, vernahm ich ihre Stimme an meinem Ohr. Sie wollte wissen: »Stört es Sie, wenn ich angezogen bleibe?«
Ich schluckte. Wie sollte ich das verstehen? Gleichzeitig wurde mir klar, wie sehr sich jegliche Gegenfrage verbot. Lana hatte mich um etwas gebeten, nicht fordernd, nicht diktierend, sondern durchaus so, wie ein Liebender den anderen Liebenden um etwas bittet, ohne sich erklären zu wollen.
Und genau darin besteht ja der Sinn der Liebe: keine Erklärungen abgeben zu müssen. Im wirklichen Leben – denn die Liebe ist in der Tat genau das Gegenteil – muß man sich ständig rechtfertigen. Darum wird auch so viel gelogen. Von Kindheit an erscheint das Lügen als ein grundsätzliches Prinzip des wirklichen Lebens. Die Liebe hingegen gipfelt darin, nicht lügen zu müssen. Nicht darum, weil man so ehrlich ist, sondern weil einer den anderen nicht zwingt, die Wahrheit auszusprechen. (Dort, wo es anders ist, ist es keine Liebe, sondern irgendein wackeliger Deal.)
Klar, ich hätte ob dieses Ersuchens, angezogen zu bleiben, beleidigt sein können. Und war es auch für einen Moment. Dann aber begriff ich den Sinn und begriff, daß Lana mir ja weder den Sex noch ihre Zuneigung versagte, sondern bloß einen Teil ihrer Haut. Dafür konnte es Gründe geben, die mit mir zu tun hatten, aber noch viel mehr Gründe, die nicht mit mir zu tun hatten. Ich sagte: »Bleiben Sie, wie Sie sind.«
»Danke«, gab sie zurück und küßte mich jetzt mit großer Heftigkeit. Wenn ich das so dramatisch sagen darf: Ich spürte, wie ihr Körper unter mir zu brennen begann. Zusammen mit dem Kostüm, das passenderweise den gleichen flammenden Farbton wie leicht verdünnter Campari besaß. Wobei ich erst jetzt die kleine Brosche aus rotem Glasstein bemerkte. Als verstecke sich ein durchsichtiges Käferchen auf dem Ornat eines Kardinals.
Ich nackt, sie angezogen, fielen wir gemeinsam aufs Bett. Die Altsteinzeit sich mit der späten Zivilisation verbindend. Ich schob ihr den Rock sachte nach oben, um an ihre Unterwäsche zu gelangen. Aber sie trug keine, was ich weniger schockierend als praktisch fand.
Ich berührte sie am Geschlecht, zunächst einmal nur die Hand dagegen haltend. Ein kleiner Seufzer drang aus dem Spalt zwischen den weißen Zähnen hervor. Ich löste einen Finger und begann Lana zu massieren. Ich bemerkte, wie sehr es mich erregte, daß sie dieses Kostüm trug, unter dessen Kruste ihr Körper zu ahnen war.
Ich streckte die Hand aus und griff nach dem Präservativ, das auf dem Kopfpolster lag. Gleich diesen obligaten Willkommenspralinen. – Hatte ich selbst es dort hingetan? Oder Lana, die vorausschauende Medizinerin? Mitunter war mein Gedächtnis ein verrückter Golfplatz. Nun gut, Hauptsache, das Ding lag bereit. Ich riß das Päckchen auf und war bemüht, so geschickt wie möglich die nötigen Handgriffe zu absolvieren. Sodann zog ich Lanas Beine sachte auseinander, nahm die Hürde eines gestreckten Beins und drang in sie ein.
Keine Frage, als Mann praktiziert man den Sex stets mit dem Gefühl, etwas würde nicht stimmen, gehe zu langsam oder zu schnell, zu heftig oder zu lahmarschig. Die Liebe schließt ja Fehler nicht aus, Ungeschicklichkeiten, daß man Schmerz verursacht, wo man eigentlich ein Glücksgefühl herstellen möchte. Ganz abgesehen von der verdammten Möglichkeit, zu früh zu kommen, sich gleich einem Sechzehnjährigen nicht im Griff zu haben. Man fürchtet, daß einem die Technik versagt. Sich die ganze »Technikgläubigkeit« als Trugschluß erweist.
Ich nahm die Geschwindigkeit heraus, trabte sachte dahin, schaute nach rechts und links, betrachtete die Landschaft des Zimmers und wurde wirklich ruhiger. Ich dachte daran, sobald ich zurück in Köln war, meine Verlobung aufzulösen, die Beziehung zu dieser Frau zu beenden, die in einem Nebel verborgen blieb. Ich verspürte nicht das geringste Bedürfnis, den Nebel zu durchdringen, um alte Gewohnheiten wiederaufzunehmen.
»Wo bist du?« hörte ich Lana sprechen.
»Schon wieder da«, sagte ich und nahm erneut Tempo auf. Das klingt wie bei einer Maschine. Aber aus der kurzzeitigen Ablenkung heraus geriet mein Körper jetzt in einen idealen Rhythmus, jene Abfolge der Schritte, die den Hürdenläufer befähigt, das Hindernis nicht als Übel zu begreifen, im Gegenteil, das Hindernis trägt einen, wie die Luft den Segler trägt.
Nicht eine einzige Hürde fiel, und schließlich war ich ganz in und bei Lana. Keine Frage der Technik, sondern des Hirns. Und das Hirn war jetzt gut und brav und spendierte uns ein Ziel, an das wir beide glücklich gelangten.
Danach lagen wir nebeneinander und hielten uns an der Hand. Ich bemerkte, daß Lana eingeschlafen war. Ich wäre jetzt gerne in ihrem Schlaf gewesen, in ihren Träumen, wie man sich ja auch wünscht, hin und wieder die Gedanken des anderen zu lesen. Aber das ist wahrscheinlich etwas, was man sich für den Tod aufsparen muß. Romantisch gesehen. Romantisch gesehen, ist Gedankenübertragung ein Vorgeschmack auf die Möglichkeiten, die einem das Jenseits beschert. Wenn’s das gibt. Eine andere Art von Sex. Jetzt aber blieb mir nichts als mein eigener Schlaf.
5
Als ich erwachte, lag ich allein im Bett. Ich richtete mich auf und registrierte, daß Lana am Fenster stand. Mit dem Rücken zu mir, erkannte ich ihr Kostüm.
Sie drehte sich um. Ihr Gesicht wirkte noch ein wenig müder als am Abend zuvor, und darum noch ein wenig hübscher. Ich fragte mich, wie Lana aussehen würde, wenn sie hundert war. Wahrscheinlich vollkommen. Auch war ich überzeugt, sie könne ein solch hohes Alter mit Leichtigkeit erreichen.
»Frühstück im Zimmer?« fragte sie, während sie sich neben mich aufs Bett setzte, an die Kante, so nah wie fern, als wäre ich wieder in der Rolle des Patienten.
Ich nickte. Sie griff zum Telefon und bestellte. Auf chinesisch. Und zwar erstklassig. Zur Not hätte sie auf Dolmetscherin umsatteln können. Was mir selbst auch nach einem Dutzend Kurse nicht vergönnt gewesen wäre: diese Art zu reden, schlangenhaft. Für mich klingt Chinesisch, als hätte Walt Disney es erfunden.
Zur deutschen Sprache zurückkehrend, sagte Lana: »Ich muß nachher bald in die Klinik.«
»Wieso? Ist schon wieder ein Wal explodiert?«
Sie lachte mit weißen Zähnen. Ja, auch ihre Zähne erkannte ich. Der Golfplatz meines Gedächtnisses war jetzt ein übersichtliches, hübsch beflaggtes Grün.
Wir frühstückten im Bett, woraus sich ein französisches Gefühl ergab, auch dank der Croissants. Ich bat Lana darum, mich am Abend desselben Tages noch zu treffen. Nicht zuletzt, weil ich tags darauf nach Tokio aufbrechen mußte, um mich dort an den Verhandlungen eines Tochterunternehmens zu beteiligen.
Lana nannte mir den Namen einer Bar, und wir verabredeten uns. Sie schleckte sich ihre Fingerkuppen ab und drückte mir eine ihrer Fingerspitzen an die Stirn, stattete mich solcherart mit einem kleinen, runden, durchsichtigen Kreis aus Speichel und Fett aus: einem dritten Auge. Sie segnete mich auf diese Weise, und dann ging sie. Ich sah ihr nach. Als die Tür zufiel, spürte ich einen Stich in meiner linken Brust, als hätte mir jemand einen Button an die bloße Haut geheftet. Nein zur Atomkraft. Ja zur Sonne. Wobei ich eigentlich für die Atomkraft war, trotz Tschernobyl und Strahlung. Ich war ja auch für den Straßenverkehr, trotz mancher Unfälle hier und da. Aber noch mehr war ich – zumindest seit gestern nacht – für die Sonne.
Mein Herz? fragte ich mich.
Na, ganz sicher mein Herz.
Den Vormittag verbrachte ich damit, meine Tokioreise vorzubereiten, aß mittags in einem kleinen Restaurant und suchte am Nachmittag jene Straße auf, in der das Unglück mit dem Wal geschehen war. Natürlich war nichts mehr zu erkennen, was die kürzlich erfolgte Explosion verraten hätte. Hier waren keine Häuser eingestürzt, das Blut längst weggewaschen. Keine Walreste zu besichtigen. – Ich schaute auf die Uhr. Vier Stunden noch, bis ich Lana treffen würde. Gott, wie ich mich nach ihr sehnte, nach ihrer souveränen Art, mit der sie darauf bestand, mich zu siezen, und mir einen Teil ihres Körpers verweigerte. Mir dann aber höchstpersönliche Aschekreuze auf die Stirn drückte.
Ich begab mich noch einmal in das Hotel, aus dem ich gekommen war, als mich der Pottwal erwischt hatte. Dort setzte ich mich in die Lounge und bestellte mir zum Kaffee (eine schwarze Suppe, um genau zu sein) ein Stück Papier und einen Bleistift. Ich wollte Lanas Gesicht aufzeichnen, ein bißchen Matisse spielen. – Absolut lächerlich! Was dachte ich mir? Daß das Wunder der Liebe ein plötzliches Genie aus mir machte? Nein, das Gesicht, das auf dem Papier entstand, setzte sich zwar aus wenigen Strichen zusammen, doch auch wenige Spielzüge führen nicht unbedingt zum Tor. Das Gesicht, das ich gezeichnet hatte, verspottete die Wirklichkeit. Auch die Wirklichkeit, wie sie vielleicht in siebzig Jahren bestehen mochte, etwas, worauf große Künstler gerne verweisen, wenn die von ihnen Porträtierten sich nicht wiedererkennen.
Ich legte den Bleistift weg und trank meine Suppe.
Um so schöner, als ich abends Lana wiedersah: das Original. Sie trug dasselbe Kostüm wie am Vorabend und Morgen, mit derselben im Rot sich verbergenden Brosche. Was mich dazu verführte, uns zwei Campari zu bestellen, ohne Lana aber zu fragen, ob ihr das überhaupt recht sei.
Sie ließ es geschehen.
Ich hob mein Glas ein wenig in die Höhe und erklärte feierlich: »Auf diesen Abend und diese Nacht!«
»Und danach?« fragte sie und trank einen Schluck.
»Sie wissen ja, Frau Doktor, daß ich morgen nach Tokio muß. Aber ich komme wieder.«
»Hierher?«
»Natürlich. Ich fliege erst Ende der Woche zurück nach Köln.«
»Klar doch, Ihre Verlobte wartet.«
Ich erschrak. »Mein Gott, woher wissen Sie das?«
»Keine Panik! Ich mach ja kein Drama draus«, versicherte sie und erklärte mir, als zuständige Ärztin mit meiner Verlobten in Köln telefoniert zu haben. Es sei ihre Pflicht gewesen.
Ich fragte: »Wieso? Um ihr zu sagen, ich sei verrückt geworden?«
»Nein, so was geb ich nicht weiter«, meinte Lana und lächelte, »das fällt unter die Schweigepflicht. Außerdem, als ich mit ihr sprach, da lagen Sie noch im Koma. Ich mußte Ihre Verlobte über die Aussichten aufklären, und die waren zu diesem Zeitpunkt gar nicht rosig. – Eine gefaßte Frau, wenn ich das sagen darf.«
»Ich glaube nicht, daß ich mit ihr zusammenbleiben möchte.«
»Wieso? Weil sie gefaßt war, anstatt zu schreien und Gott zu verfluchen?«
»Nein, nicht darum.«
»Doch nicht wegen dem, was gestern zwischen uns war und was heute noch zwischen uns sein wird?«
»Wäre das so ungewöhnlich?« fragte ich. »Konsequenzen ziehen?«
»Es wäre eine Übertreibung, deshalb eine Verlobung zu lösen. Sie werden doch sicher wissen, was Sie drüben in Europa an dieser Frau haben.«
Genau das wußte ich eben nicht. Nicht mehr. Und hatte nicht die geringste Lust, es erneut in Erfahrung zu bringen. Ich sagte: »Ich weiß vor allem, was ich an Ihnen habe.«
»Klar doch, nach einer Nacht kennt man sich aus«, meinte sie spöttisch. Und dann, vollkommen ernst: »Hören Sie mir zu, Sixten … Was ist das überhaupt für ein Name, Sixten?«
»Schwedisch.«
»Sixten Braun. Ich dachte mir, als ich ihn das erste Mal hörte, das klingt schon sehr nach Geheimagent. Wie erfunden, wie aus einem Groschenroman.«
»Ist aber echt.«
»Trotzdem sollten Sie aufhören, sich was einzureden. Wir schlafen heute noch einmal miteinander, und das war’s dann. Die Ärztin und ihr Patient, letztes Kapitel. Sie sind völlig gesundet, und ich kann Sie entlassen.«
»Stimmt nicht«, warf ich ein, »ich bin noch immer krank. Ich hatte heute einen heftigen Schmerz in der Brust. Mein Herz. Wenn ich zurückkomme, müssen Sie mich untersuchen.«
»Ich bin für Ihr Hirn, nicht für Ihr Herz zuständig.«
Ich entgegnete: »Sie müssen mich als Ganzes nehmen. Was wäre ein Hirn ohne den, der es trägt?«
»Ein Verdrängungsmechanismus, der sich nicht bewegen kann.«
»He, kommen Sie …«
Sie meinte ganz trocken: »Sie wissen, daß wir keine Zukunft haben.«
»Macht Sie das denn gar nicht traurig?« Es war ein Betteln in meiner Stimme.
»Wenn ich ehrlich bin: sehr!« sagte sie, nun sehr viel weniger trocken. »Aber ich werde nicht nach Deutschland zurückgehen, und Sie werden nicht nach Tainan umziehen. Stimmt doch? Und Brieffreunde wollen wir nicht sein, denk ich mir, oder? Da ist es besser, Schluß zu machen, wenn es schön ist, und nicht anzufangen, dem Unmöglichen nachzulaufen.«
Das war ein schrecklicher Gedanke, daß die Liebe tatsächlich der Geographie unterworfen ist. Dem Umstand von Berufen und Lebensorten. Und darum die Leute, die füreinander bestimmt sind, so selten zusammenkommen. Statt dessen heiraten die, die in derselben Firma arbeiten, in derselben Stadt leben, denselben Tanzkurs besuchen.
Dennoch stellte sich die Frage, wieso es für Lana unmöglich sein sollte, in ihre Heimat zurückzukehren. Ich fragte sie, ob sie so was wie eine Linksradikale oder militante Tierschützerin sei, eine in deutschen Landen Unliebsame.
»Hirnforschung und Tierschutz?« Sie hob ihre Brauen an. »Wie soll das denn gehen? Außerdem würde ich sagen, wenn schon Verbrechen, wäre doch Steuerflucht naheliegender, oder? Sind das nicht die wahren Terroristen? – Jedenfalls brauchen Sie keine Angst zu haben …«
»Ich habe keine Angst«, erklärte ich trotzig.
»Ach!? Auch nicht davor, ich könnte doch noch mein Kleid ausziehen?«
Richtig, ich hatte nicht vermeiden können, während des Tages des öfteren daran zu denken. Mich zu fragen, was das sei, was sich unter ihrem Kleid verbarg. Denn die pure Scham ob der eigenen Nacktheit konnte es kaum sein. Hing es mit einer Operation zusammen? Einer fehlenden Brust? War es eine Hautkrankheit, die sich auf den Rumpf beschränkte? Brandwunden? Eine obskure Tätowierung? Narben? Schlimme Narben?
Neugierig war ich schon, sagte aber, daß meine Liebe zu ihr ganz sicher nicht davon abhänge, welches Geheimnis sich unter ihrem Kostüm befinde.
»Erstaunlich«, fand sie, »wie oft Sie, seitdem wir uns kennen, das Wort Liebe verwendet haben. Ist das immer so bei Ihnen?«
»Absolut nein! Ich kann mich gar nicht erinnern, es vorher überhaupt mal … weiß auch nicht … vielleicht hab ich es mir ein Leben lang nur für Sie aufgespart.«