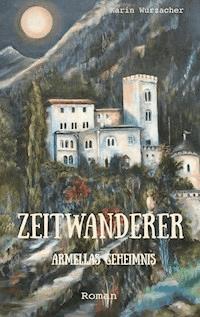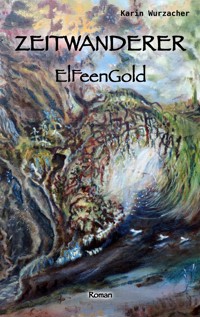Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Alois Berger, ein Prägratner Urgestein aus dem hintersten Iseltal, hat mit 84 Jahren sein Leben Revue passieren lassen. Der Erzähler wurde in seinem Heimatdorf zum "Alpenkönig" ernannt und weit über Osttirols Grenzen hinaus bekannt. Dieses Buch lädt Sie ein, an spannenden, aufregenden, amüsanten, aber auch dramatischen und traurigen Erlebnissen teilzuhaben. Anekdoten, die vorwiegend den aktiven Zeiten als Bergretter und Bergführer entstammen, bringen überraschende, erstaunliche, wie auch schockierende Details zum Vorschein. Machen Sie sich auf Geschichten gefasst, die Sie nie für möglich gehalten hätten. Lesen Sie von lebensbedrohlichen Situationen, erfahren Sie Wissenswertes über die Osttiroler Alpen und tauchen Sie ein in die unglaubliche Welt eines leidenschaftlichen Bergfexes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
40 er Jahre
50 er Jahre
60 er Jahre
70 er Jahre
80 er Jahre
90 er Jahre
2000 er Jahre
2010 er Jahre
Clarahütte & Essener=Rostocker=Hütte
Auszeichnungen („Glufen“)
Vorwort
Kurz nachdem ich meinen ersten Roman veröffentlicht hatte, bat mich der Erzähler dieses Werkes, seine Erlebnisse vorwiegend in den Funktionen als Bergführer und Bergretter, zu verfassen.
Da ich in dieser Aufgabe eine spannende Herausforderung sah, stellte ich meine eigenen Projekte hinten an und begann im Frühjahr 2018 damit, die Berichterstattungen des Protagonisten aufzuzeichnen.
Nachdem ich genügend Material gesammelt hatte, übertrug ich die Aufzeichnungen auf meinen PC und stellte nachfolgenden Text zusammen.
An dieser Stelle möchte ich mich für das entgegengebrachte Vertrauen seitens meines „Auftraggebers“ bedanken und wünsche dem Leser ebenso viel spannende Unterhaltung beim Schmökern, wie ich sie beim Schreiben nachfolgender Geschichten hatte.
Dazu möchte ich noch anmerken, dass ich alle Gegebenheiten genau so übernommen habe, wie sie mir seitens des „Alpenkönigs“ aus dessen Erinnerungsvermögen übermittelt wurden.
Dementsprechend übernehme ich als Autorin keine Gewähr für die Richtigkeit der einzelnen Episoden.
Mein Dank gilt auch all jenen, die mich bei der Entstehung sowie der Veröffentlichung dieses Buches unterstützt haben.
40er Jahre
Blick vom Großvenediger (3674 m) gegen Nordwesten Obersulzbachkees (Bildmaterial: Alois Berger)
Die Faszination der heimischen Bergwelt ergriff mich schon sehr früh. Mit gerade mal 6 Jahren wollte ich unbedingt wissen, wie es wohl auf der anderen Seite des Großvenedigers (3674 m) ausschaut.
Man sieht ja von unserem Tal aus nur eine Seite des gigantischen Massivs und ich dachte mir, wenn ich erst mal dort oben stehe, sehe ich die ganze Welt. Die Vorstellung über eine gigantische Aussicht ließ mir keine Ruhe mehr.
Also ergriff ich an einem sonnigen Bilderbuchtag im August spontan die Gelegenheit von zuhause auszubüchsen, um mich auf den Weg zum zweithöchsten Berg unserer alpenländischen Gefilde zu machen.
Meine Eltern waren glücklicherweise mit ihrer Arbeit auf unserem Bauernhof so sehr beschäftigt, dass ich unbemerkt entwischen konnte. Ich war mir sicher, dass ich längst auf dem Gipfel stehen würde, bis ihnen mein Verschwinden überhaupt erst auffiel.
Als 6-jähriger Bursche, der seinen Pioniergeist entdeckt hatte, dachte man über alles mögliche nach, doch bestimmt nicht darüber, dass sich jemand Sorgen machen könnte.
Schließlich wollte ich nur die Welt in ihrer ganzen Einheit sehen und das schien mir vom Gipfel eines hohen Berges am ehesten möglich.
Ich war viel zu aufgeregt und neugierig, was sich auf der anderen Seite des Großvendigers abspielt, als dass in meinem kleinen Köpfchen noch Platz für andere Gedanken übrig geblieben wäre.
Also marschierte ich, fest entschlossen, dem Abenteuer meines Lebens entgegenzugehen, in leichter Sommerbekleidung zielstrebig aus der Haustür, um nach Hinterbichl zu wandern und nahm dann direkten Kurs in Richtung Großvenediger zu nehmen.
Im Defreggerhaus, der letzten Hütte vor dem eigentlichen Aufstieg, traf ich auf eine Gruppe Bergführer, die für meine Begriffe schon ziemlich alt und somit entsprechend erfahren gewesen sein mussten.
Ein genaues Alter konnte ich natürlich nicht bestimmen, denn wenn man wie ich seinerzeit, gerade mal den Kindergarten hinter sich gelassen hatte, war ein 20-jähriger bereits ein uralter Mann.
Auf die Frage, was ich in dieser Höhe so alleine zu suchen hatte, antwortete ich ganz selbstverständlich: „Ich möchte auf den Venediger, um die ganze Welt sehen zu können“.
Daraufhin sahen sie mich höchst belustigt an. Ich wusste zwar nicht, was daran so komisch sein sollte, da sie selbst ja den gleichen Plan verfolgten, blieb jedoch stumm und blickte die Herren nur erwartungsvoll an.
Anscheinend imponierte ihnen mein Mut und so nahmen sie mich tatsächlich in ihrer Seilschaft auf. Wie ein Honigkuchenpferd strahlte ich in die Runde und konnte den Aufstieg kaum erwarten.
Da ich für eine solche Tour allerdings mehr als unpassend gekleidet war, liehen mir die Bergführer wenigstens Handschuhe und eine Mütze, damit ich der Kälte, die auf 3674 m herrschte, nicht gar so schutzlos ausgeliefert sein würde.
Dann endlich ging es los und die „alten“ Herren bestiegen mit mir den Gipfel.
Ich erinnere mich heute in erster Linie daran, dass an besagtem Tag zwar die Sonne schien, eine entsprechend tolle Sicht herrschte, es aber trotzdem kalt war, sehr kalt sogar. Obwohl mein erstes Bergabenteuer im August stattfand, kämpfte ich gegen Temperaturen von bis zu ca. -16° C an. Auf dem Gipfel angekommen, vergaß ich für kurze Zeit die unglaubliche Kälte, die mir in allen Gliedern steckte.
Der Ausblick von dort oben war unbeschreiblich beeindruckend, obwohl ich zugeben muss, dass ich mir die Welt wesentlich größer vorgestellt hatte. Damals war mir nicht bewusst, dass ich nur einen äußerst bescheidenen Teil davon überblicken konnte.
Jenes einschneidende Gipfelerlebnis fand vor beinahe 80 Jahren statt, doch ich weiß noch sehr genau, dass mir nach dieser Erlebnistour erst wieder einigermaßen warm wurde, nachdem ich bereits eine ganze Weile, mit Decken und heißer Schokolade bewaffnet, im Defreggerhaus saß.
In der Tat war mir ganz schrecklich kalt, doch die Besteigung des Großvenedigers war jeden einzelnen Knieschlotterer wert.
Zudem machte sich eine gewisse Portion Stolz in meiner zarten Kinderbrust breit, nachdem sich die Bergsteiger mit meiner Leistung ziemlich zufrieden zeigten und mich anerkennend lobten.
Während ich meine Neugier befriedigt wusste, wie der Venediger von der anderen Seite aussieht, suchten meine Eltern im Tal verzweifelt nach mir. Da mein Ausflug ja immerhin ein paar Stunden in Anspruch genommen hatte, war ihnen während der langen Zeit meines Ausbleibens dann doch irgendwann aufgefallen, dass ich mich nicht zuhause aufhielt.
Sie suchten mich im Ort und an der Isel, doch hätten sie sich niemals träumen lassen, ihre Suche auf den zweithöchsten Berg Österreichs verlegen zu müssen, um mich zu finden.
Wieder heil und glücklich zuhause angekommen, bekam ich für mein Abenteuer weder Anerkennung noch einen stolzen Schulterklopfer seitens meines Vaters. Stattdessen kassierte ich eine ordentliche Tracht Prügel für meine „Heldentat“. Heute weiß ich, dass sie sich große Sorgen um mich machten und verstehe ihre Reaktion, die aus Angst und Wut resultierte. Mit 6 Jahren allerdings empfand ich die Züchtigungsstrafe mehr als ungerecht, da ich ja nichts böses getan hatte. Vielleicht waren sie aber auch nur erzürnt, dass ich den Venedigergipfel ohne sie erklommen hatte.
Was auch immer, Erwachsene sind im Kindesalter eh schwer zu verstehen und ich war viel zu sehr mit den gewaltigen Eindrücken beschäftigt, die in meinem Kopf stets von Neuem wie ein Film abliefen, als dass mich die Versohlung meines Hosenbodens nennenswert interessiert hätte. Im Gegenteil, für solch ein gewaltiges Abenteuer hätte ich immer wieder Schläge in Kauf genommen.
In Verbindung mit der Nilljochhütte (1990 m) fällt mir spontan eine Anekdote ein, die sich ebenfalls in meiner Kindheit ereignete.
Zu der Zeit, als ich die Volksschule besuchte, unterrichtete uns ein Lehrer, der gebürtig aus St. Veit im Defereggental stammte. Jener Pädagoge war alkoholisierten Getränken sehr zugetan und konsumierte entsprechende Mengen davon.
Anlässlich eines Schulausflugs wanderten wir Schüler in der Obhut eben dieses Lehrers zur Nilljochhütte.
Erstes Etappenziel unseres Fußmarsches war die Grießeralm. Dort kehrten wir zu, um eine Vesperpause einzulegen und unsere sogenannte Aufsichtsperson wusste nichts besseres zu tun, als reihenweise große Gläser mit hochprozentigem Schnaps zu trinken. Obwohl der Lehrer anschließend kaum noch im Stande war, gerade zu stehen geschweigedenn zu gehen, war er noch immer fest entschlossen, die Wanderung fortzusetzen.
Der Weg zur Hütte verlief im Gegensatz zu heute extrem schmal. Ich musste den Lehrer während des gesamten Aufstiegs führen und stützen, sonst wäre er garantiert umgefallen und womöglich gar in den Tod gestürzt.
Unser Rückweg erfolgte allerdings über Obermauern, nachdem ich zu meinen Mitschülern gesagt hatte:“ Diesen gefährlichen Aufstieg gehen wir mit dem volltrunkenen Lehrer nicht wieder zurück!“
Zu dem Zeitpunkt war ich ca. 12 Jahre alt. Eine Schulklasse bestand damals sowohl aus älteren als auch aus jüngeren Kindern zugleich. Demnach waren Schüler im Alter von 8 bis 12 Jahren dabei. Obwohl besagter Lehrer für sein Alkoholproblem ortsbekannt war, vertrauten unsere Eltern darauf, dass nichts passieren würde.
Dabei gab und gibt es auf dem Weg zur Nilljochhütte einige heikle Stellen, die gefährlich sind. Die Route sieht nämlich wesentlich harmloser aus, als sie tatsächlich ist und es verunglückten neben zwei Gästen auch schon Einheimische tödlich.
Unterhalb des Rainertörls (3400m) (Bildmaterial: Alois Berger)
50er Jahre
Großvenediger (3674 m) (Bildmaterial: Alois Berger)
In der Zeit nach Kriegsende hatte ich mit gerade mal 17 Jahren meinen ersten Einsatz als Bergführer. 1945 trafen die Heimkehrer ein, wobei einige – vor allem ältere Männer – fehlten, da sie im Kampf gefallen waren. Andere kamen mit mehr oder weniger schweren Verletzungen in die Heimat zurück.
Einer der heimgekehrten Soldaten, der ausgebildeter Bergführer war, gab mir eines Tages den Auftrag, auf die Neue Essener Hütte (2500 m), die sich weit oben im Umbaltal befand, zu gehen.
Dort warteten bereits mehrere österreichische Bergsteiger auf mein Eintreffen, um in meiner Begleitung die Dreiherrenspitze (3499 m) zu erklimmen.
Obwohl ich selbst bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu diesem Gipfel aufgestiegen war, wusste ich natürlich dennoch sehr genau, welche Route ich nehmen musste.
Meine weitaus erfahreneren Kollegen hatten wohl ebenfalls keine Zweifel an meinen Fähigkeiten, denn sie meinten nur: „Lois, da kommst du wohl hin und auf den Berg schaffst du es auch.“
Da ich schon damals kein ängstlicher Mensch war, marschierte ich entschlossenen Schrittes los. Als ich auf der Neuen Essener Hütte ankam, die nur kurze Zeit später aufgrund eines Lawinenabgangs ein zweites Mal komplett zerstört wurde, erwarteten mich bereits 5 Burschen im Alter so um die 30 Jahre. Nach einer Hüttenübernachtung brach ich mit meiner Gruppe am nächsten Morgen zur Dreiherrenspitze auf.
Nach geraumer Gehzeit ohne nennenswerte Erschwernisse kamen wir dann jedoch an eine Schlucht, die mit gefrorenem Schnee angefüllt war. Nachdem ich die örtlichen Gegebenheiten genauer inspiziert hatte, kam ich zu dem Schluss, dass ein Anseilmanöver nicht nötig war, da es höchstens ca. 20 m bis 30 m Schneefläche zu überwinden galt. Danach ging der Weg im Geröll und somit ungefährlich weiter.
Sicherheitshalber wandte ich mich an die Männer und fragte nach, ob sich jeder einzelne von ihnen zutrauen würde, die Schlucht unangeseilt zu passieren.
Ich ließ die Jungs erst mal stehen, stapfte alleine voraus und schlug mit dem Eispickel sogenannte Kardinalsstufen in den gefrorenen Schnee, um meiner Gruppe die Überquerung der glatten, eisigen Fläche zu erleichtern. Diesen Behelf, der einen sichereren Tritt gewährleistet, taufte ich selbst so, da die von mir ausgeklopften Platten größeren Bodenfliesen ähneln. Ganz ungefährlich war es natürlich nicht, jene Stelle ohne Seil zu meistern, denn es ging sehr steil hinunter und der Schnee war in der Früh noch steinhart. Nachdem ich die Stufen in den Schnee gehauen hatte, ging ich zu den Männern zurück und fragte noch einmal in die Runde, ob es für jemanden ein Problem darstelle, die Schneepassage ohne Seil zu überwinden. Einem von ihnen war es nicht recht geheuer, da der vereiste Abhang eben doch ziemlich steil wirkte.
Um den Zweifler zu beruhigen, wies ich ihn an, unmittelbar hinter mir zu gehen, damit ich ihn leicht zu fassen bekam, sollte er stürzen oder ausrutschen.
Tja und was passierte? Dieser etwas ängstliche junge Mann rutschte tatsächlich aus und ich konnte ihn leider auch nicht mehr abfangen. Somit rutschte er, trotz verzweifelter Versuche, mit dem Pickel irgendwie Halt zu finden, zunächst den steilen Schneehang hinunter und über die im Anschluss befindliche Gerölllage ab.
Während ich seine Rutschpartie verfolgte, dachte ich bei mir: „Na, das fängt ja gut an!“
Als der Knabe endlich zum Liegen kam, stieg ich zu ihm hinunter.
Glücklicherweise trug er nur leichte Verletzungen davon, obwohl er alles andere als gut aussah. Es zeigten sich etliche Blessuren, ein mit Blut verschmiertes Gesicht, zerkratzte Hände sowie abgerissene Fingernägel.
Nachdem ich den Menschen notdürftig verbunden und wieder einigermaßen ansehnlich hergerichtet hatte, stieg er mit mir zu den anderen zurück. Trotz dieses unschönen Zwischenfalls setzten wir unseren Aufstieg zum Gipfel der Dreiherrenspitze fort.
Nach erfolgreicher Besteigung dieses doch ziemlich schwierigen Berggiganten, stieg ich mit der gesamten Truppe wieder zur Neuen Essener Hütte ab.
Für den nächsten Tag stand die Route über das Reggentörl zur Essener-Rostocker-Hütte auf dem Programm. Bevor wir aufbrachen, fragte mich der Verletzte: „Ja, schaffe ich das überhaupt mit meinen Blessuren?“. Darauf gab ich beschwichtigend zur Antwort: „Ja, ja, das ist bei weitem nicht so schwierig wie gestern. Es ist allerdings sehr weit, aber das packst du schon“.
Auf dieser Route gibt es eine Stelle, von der aus man eine atemberaubende Sicht auf den Großvenediger erhält. Dort angekommen, sagte einer aus der Gruppe plötzlich: „Jetzt kann man den Venediger gerade so schön sehen. Bevor wir weitergehen, möchte ich ihn fotografisch festhalten“. Darauf gab ich ihm zu verstehen: „Aber nicht hier, da ist es zu lawinengefährlich“.
Dazu muss ich kurz aufklären, dass es über Nacht gut und gern einen halben Meter geschneit hatte. Wir gingen also noch ein Stück weiter bis zu einem Felsen, der sich als Schutz gut eignete. In der Gesteinsdeckung erlaubte ich dem Mann, ein schnelles Foto zu machen. Wie es der Teufel will, löste sich ausgerechnet in dem Moment, als der Hobbyfotograf gerade sein Stativ samt Kamera positioniert hatte, tatsächlich eine Lawine, die exakt auf unsere Gruppe zusteuerte. Geistesgegenwärtig schnappte ich die Männer und riss sie noch näher an die Felsnase, während die Schneemassen über unsere Köpfe hinwegdonnerten.
Da sich die aufgebaute Kamera außerhalb der felsigen Schutzzone befand, war diese in Sekundenschnelle verschwunden. Die komplette Fotoausrüstung wurde von der Lawine mit in die Tiefe gerissen.
Irgendwo in diesem Gebiet dürfte das Stativ und die Kamera aus längst vergangenen Tagen wohl heute noch liegen.
Viel wichtiger war jedoch, dass wir diese Naturgewalt unbeschadet überstanden hatten.
Da kann man mal sehen, was sich innerhalb einer 2-Tages-Tour so alles ereignen kann.
Bereits am ersten Tag stürzte einer aus der Gruppe ab und am zweiten Tag löste sich eine Lawine, bei der wir glücklicherweise mit dem Schrecken davon kamen. Ohne Fotoausrüstung und auch ohne weitere Zwischenfälle erreichten wir die Essener-Rostocker-Hütte.
Immerhin handelte es sich dabei um meine allererste geführte Bergtour. Gelernt hatte ich nach den zwei Tagen, dass ein Anseilen für die Überquerung der eisigen Schneefläche notwendig gewesen wäre und ich nicht hätte zulassen dürfen, die Leute wegen eins Fotobilds vom Großvenediger unnötig in Gefahr zu bringen. Lawinenabgänge sind eh eine teuflische Sache.
Von der Essener-Rostocker-Hütte marschierten wir dann übers Türmljoch zur Johannishütte (2121 m) und von dort weiter zum Defreggerhaus (2962 m).
Tags drauf bestiegen wir den Venedigergipfel, um sodann nach Hinterbichl abzusteigen.
So begann also meine Bergführerkarriere im jungen Alter von 17 Jahren, in dem sich viele Altersgenossen noch nicht mal in der Lehre befanden.
Als junger Bursch voller Tatendrang meldete ich mich auch beim hiesigen Bergrettungsverein an.
Da ich mich damals noch in der Ausbildung befand, durfte ich bei nachstehend geschilderter Bergungsaktion leider nicht mitwirken. Ich stieg zwar mit meinen erfahrenen Kollegen bis zur Essener-Rostocker-Hütte auf, musste dort jedoch warten, bis die Kameraden von der Bergung zurückkamen. Auch wenn ich am Einsatz selbst nicht teilnehmen durfte, war es doch eine aufregende Sache. Ich wusste, dass es sich um ein Lawinenunglück auf der Simonyspitze (3441 m) handelte, bei dem 5 Bergsteiger den Tod fanden. Diese waren, bis man sie bei den eisigen Temperaturen gefunden hatte, bereits steif gefroren. Während die einen in horizontaler Stellung verharrten, waren andere Körper in eher aufrechter Sitzposition eingeeist.
Ungeduldig vor der Hütte wartend, staunte ich nicht schlecht, als ich meine Kollegen endlich herannahen sah. Meine Kameraden benutzten die gefrorenen Leichen nämlich als Schlitten und fuhren auf ihnen bis zum Haus.
Eine solch unkonventionelle Art der Bergung hört sich für Außenstehende sicherlich äußerst makaber an, doch war es die einfachste Methode, die tödlich Verunglückten abzutransportieren.
Ab der Essener-Rostocker-Hütte ging es allerdings eher ebenerdig weiter und wir mussten die Toten tragen. Zunächst waren sie ja noch starr und ließen sich gut schultern. Je länger wir allerdings unterwegs waren, desto weicher wurden die leblosen Körper. Sie begannen zu schlackern und mutierten zu einer „lehnen“ Last. In aufgetautem Zustand ließen sie sich nicht mehr so kommod tragen, da sie bei jedem Schritt mitwippten.
Die Kollegen, die damals im Einsatz waren, sprachen davon, dass einer der 5 Wiener Touristen, die unter den Schneemassen begraben waren, noch ziemlich lange gelebt haben musste. Diese Vermutung leiteten sie vom Ausmaß des Loches ab, das sein Atem geschmolzen hatte. Da der Schnee locker und somit luftdurchlässig war, bekam er scheinbar genügend Sauerstoff und lag dadurch mindestens eine Woche lang lebendig begraben in dem weißen Sarg.
Hätte er – wie die anderen - höchstens einen Tag überlebt, wäre nur ein kleines Atemloch entstanden.
Die Suche nach den Vermissten nahm sehr viel Zeit in Anspruch, daher kam auch für den so lange durchhaltenden Touristen, die Rettung bedauerlicherweise zu spät.
Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, welche Qualen es bedeuten muss, lebendig begraben zu sein und das noch über mehrere Tage hinweg.
Nun komme ich zu einem tragischen Unglück, das sich auf dem Lasnitzenweg ereignete. Ein einheimischer Bauer machte sich mit mehreren Heuziehern auf den Weg, um von der Lasnitzenalm einige Fuder Heu nach Hause zu ziehen. Sein damals ca. 20jähriger Sohn war ebenfalls dabei, der auf seinem Schlitten ein kleines Restbündel, das man „Braut“ oder „Bräutle“ nennt, geladen hatte. Eine normale Fuhre ist knapp 2 m hoch und wiegt in etwa 250 kg.
Im Dialekt nennt man das Gestell, auf dem das Heu gezogen wurde, „Schloafe“. Dabei handelt es sich um zwei ausgehöhlte Baumstämme, an denen Kufen befestigt waren. Das speziell für die „Schloafe“ auf besondere Art zusammengefasste Heu gleicht einem wahres Kunstwerk. Es benötigt eine ganz eigene Technik, damit das Heu beim Transport nicht verloren geht.
Auf einem eisigen Wegabschnitt ereignete sich dann die Tragödie. Die beladene Schloafe rutschte über den Abgrund hinaus und riss den Bauer mit. Sein Sohn wollte ihn noch halten, konnte ihn jedoch glücklicherweise nicht mehr erwischen, sonst wäre auch er in die Tiefe gerissen worden.
Der Lasnitzenweg war seinerzeit noch sehr schmal und holprig beschaffen. An der Absturzstelle stand an der Bergseite sogar ein Pickel, mit dem das zu Eis gefrorene Wasser, das als Rinnsal über den Weg floss, immer wieder aufgehackt werden konnte. Diese Maßnahme sollte gewährleisten, dass wenigstens eine Kufe des Heuschlittens in der aufgerauten Rinne fährt und somit nicht wegrutscht. Doch als der Landwirt jene Stelle passierte, war wohl bereits wieder alles zugeeist, seine „Schloafe“ kam ins Rutschen und riss ihn über den Abgrund hinweg mit in die Tiefe.
Nachdem der Mann abgestürzt war, stieg der junge Bauernbursche schnellen Fußes das steile Stück hinunter, um seinem Vater zu Hilfe zu eilen.
Die anderen ca. 6 oder 7 Heuzieher, die den beiden schon ein ganzes Stück vorausgegangen und daher bereits beim „Lum“ angekommen waren, vernahmen die lauten Schreie des Verunglückten und liefen daraufhin in Windeseile wieder zurück. Der Verunglückte schlug nach seinem Sturz von ca. 70 m bis 80 m mit der Bauchseite auf einem spitzen Felsabschnitt auf. Seine Wehklagen, die durch Mark und Bein gingen, dauerten über eine Stunde an, bevor sie verstummten und er seinen schweren inneren Verletzungen erlag.
Zwischenzeitlich waren meine Bergrettungskameraden und ich am Unglücksort eingetroffen. Bei den Almhütten der Lasnitzenalm (1900 m) hatten die Heuzieher eine Axt aufgetrieben, damit zwei Baumstämme gefällt und zu einer Trage verschnürt werden konnten, um den leblosen Menschen abzutransportieren. Dabei handelte es sich um ca. 3 m lange Lärchenstämme.
Die Bergung verlief ziemlich schwierig, da wir erst übers Tal hinein in die Schlucht und dann über blankes Eis wieder hinaufsteigen mussten. Dabei war die provisorische Trage schwerer als der leblose Körper selbst, der darauf lag.
Ein Bruder des Bauern sowie der alarmierte Arzt warteten bereits bei der Alm auf uns.
Jener Winter war ziemlich schneearm und nachdem wir den Toten über steiles, eisiges Gelände hinaufgeschleppt hatten, nahm der Doktor einen großen Flachmann aus seiner Tasche und sagte zu uns: „Trinkt mol an Schnaps Manda, um euch a bissl zu stärken!“
Bevor die Truppe loszog, das Heu einzubringen, sagten die anderen Heuzieher zum verunglückten Bauern noch, er solle doch besser zuhause bleiben. Das wollte er allerdings nicht, denn er hatte Sorge, dass denen, die für ihn das Heu nach Hause holten, etwas zustoßen könnte, da er um den eisigen Weg, den es zu nutzen galt, wusste.
Für meine Kollegen und mich war die schlimmste Aufgabe, den Toten nach Hause zu bringen, das ist immer „deppert“.
Noch dazu in einem kleinen Bergdorf, in dem jeder jeden kennt.
Nachfolgend möchte ich einen der schwersten Lawinenabgänge ansprechen, die unser Dorf je erlebt hat.
Im Winter 1951 gab es die größte Schneemenge, an die ich mich erinnern kann. In kürzester Zeit fielen sage und schreibe 15 m Schnee vom Himmel. Die weißen Massen ragten teilweise über die Wohnhäuser hinaus, sodass wir Tunnel von Haus zu Haus graben mussten. Seinerzeit stand mein Elternhaus noch alleine auf weiter Flur.
Auf den Dächern lag so viel Schnee, dass diese 2 – 3 x abgeschöpft werden mussten, damit das Gewicht den Dachstuhl nicht wie ein Streichholz abgeknickt hätte. Der durch die Abschöpfungen entstandene Schneehaufen war dann – wie schon gesagt - höher als das Haus selbst.
Wir hatten auch kein Wasser, denn es gab nur Holzleitungen und die konnte man unter solchen Ausnahmebedingungen nicht unter Druck setzen.
Es schneite mitunter mehrere Tage ununterbrochen. Das war eine ziemlich unheimliche Situation. Vor allem die Stille hatte etwas gespenstisches, denn der Schnee schluckt alle Geräusche.
Die zuvor erwähnte Lawine ging an einem Vormittag von der Kreuzspitze (3155 m) ab und erstreckte sich über die komplette Hangbreite. Jener Schneetsunami war so gewaltig, dass er bis in den obersten Bereich des Dorfes rutschte. Obwohl Mitglieder der Lawinenkomission bereits am Abend zuvor gefährdete Bewohner aufgesucht und sie eindringlich gebeten hatten, ihre Häuser zu verlassen, um im unteren Ortsteil Zuflucht zu suchen, zeigten sich manche von der Warnung relativ unbeeindruckt.
So trank der Bäckermeister mit seinem Kumpel lieber die ganze Nacht Schnaps, anstatt dass sich die Beiden in Sicherheit gebracht hätten.
Als um 9.15 Uhr durch Sirenenalarm signalisiert wurde, dass eine Lawine ins Dorf gerauscht war, befand ich mich – wie die meisten Ortsansässigen – gerade in der Kirche. Damals gehörte es zur Pflicht, den sonntäglichen Gottesdienst zu besuchen.
So schnell mich meine Füße trugen, eilte ich nach Hause und lief, mit einer Schaufel bewaffnet, durch den Ort. Immer mehr Helfer rannten herbei, um Verschütteten das Leben zu retten. Beim Bäckermeister, der ja mit seinem Kamerad eine feuchtfröhliche Nacht verbrachte, waren die gewaltigen Schneemassen durchs Fenster eingedrungen und hatten die beiden Saufkumpanen an die Wand gedrückt, sodass nur noch ihre Köpfe herausschauten. Sie klebten regelrecht an der Zimmerwand und stießen panische Schreie aus. Alleine hätten sie sich aus ihrer prekären Lage niemals befreien können, denn die weißen Massen waren hart wie Beton. Nachdem wir sie ausgeschaufelt hatten, konnten die Trunkenbolde glücklicherweise unverletzt, wenn auch sichtlich geschockt, das Katastrophengebiet verlassen.
Tja, das kommt davon, wenn man entsprechende Warnungen nicht ernst nimmt.
Unser altes Haus, das wir seinerzeit noch bewohnten, verwandelte sich kurzerhand in ein regelrechtes Notlager. An die 50 Leute waren nach Einbruch der Lawine bei uns untergebracht. Jedes Zimmer, der Stadl und sogar der Stall dienten als Unterkunft für jene Dorfbewohner, deren Behausung von der Naturgewalt in Beschlag genommen wurde.