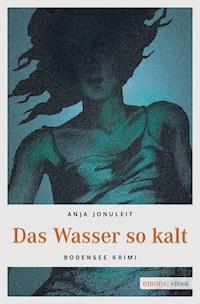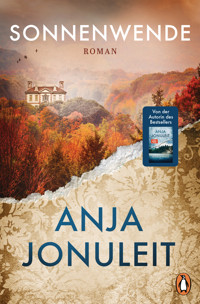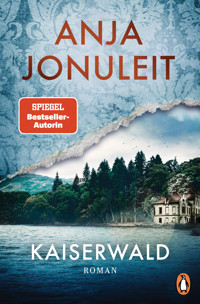9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Nichts ist vergessen Nach der Trennung von ihrem Freund reist Hannah nach Castelnuovo in Umbrien, um das Erbe ihrer geliebten Tante Eli anzutreten: ein kleines Steinhaus voller Rätsel. Beim Aufräumen fallen ihr alte Briefe von Eli in die Hände, und sie beginnt zu lesen … In den folgenden Tagen erkundet Hannah Castelnuovo, Elis zweite Heimat. Als sie zufällig auf ein Grundstück mit seltsam verbrannten Obstbäumen gelangt, wird sie unsanft von dort vertrieben. Dorfbewohner erklären ihr später, dass der schroffe Fremde harmlos und seine Leidenschaft das Züchten alter Obstsorten sei. Aus unerfindlichen Gründen hatte sich Eli einst mit dem »Apfelsammler« angefreundet, und auch Hannah sucht seine Nähe. Ist er der Schlüssel zu Elis Geheimnis? Kennen Sie bereits die weiteren Romane von Anja Jonuleit bei dtv? »Das Nachtfräuleinspiel« »Novemberasche« »Rabenfrauen« »Herbstvergessene« »Die fremde Tochter« »Das letzte Bild«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Ähnliche
Anja Jonuleit
Der Apfelsammler
Roman
Für meinen geliebten Vater
Peter Jonuleit
(1940–1987)
Das blaue Bild
Ich besitze ein Foto von San Lorenzo, aufgenommen an einem Abend, kurz bevor die Dunkelheit kam und man nicht mehr fotografieren konnte. Ich habe die Aufnahme von einem Hügel aus gemacht, mit dem Stativ und einer extrem langen Belichtungszeit. Ich weiß noch, wie lange ich dort wartete, auf einer Art grasbedecktem Vorsprung, bis endlich der Moment gekommen war. Und ohne mich loben zu wollen, muss ich sagen, dass sie mir gut gelungen ist. Alles ist in blaues Licht getaucht, die Scheunen, die Kapelle, der alte Pfarrgarten, das Wohnhaus aus grauem Stein. Und die Obstbäume.
Ich habe es im Frühjahr aufgenommen, bald nach meiner Ankunft in Castelnuovo. Die Bäume blühen, ich glaube, es sind die Hauszwetschgen, i susini, wie du mit weicher Kadenz zu sagen pflegst; ihre Zweige sind wie von einem weißen Gespinst umwoben. Der Zufahrtsweg leuchtet hell, fast weiß in der Abenddämmerung, von oben sieht er aus wie ein breites Band, das jemand in einem sorgfältigen Bogen ausgelegt hat. Das ganze Leben scheint dort blau zu sein, blue, wie der Engländer sagt, ein wenig traurig. Und das ist es ja auch, jetzt, wo sie fortgegangen ist. Aber vielleicht denke ich das auch nur, weil ich selbst gerade ein wenig traurig bin – über die verlorenen Jahre, die man uns gestohlen hat.
In dieser blauen Welt ist nur ein einziges Fenster erleuchtet. Das Fenster vom Salotto, dem Raum mit dem steinernen Kamin und dem wuchtigen Refektoriumstisch, auf dem sich die Unterlagen türmen: Bücher mit vergilbten Seiten, antiquarische Stiche, gefertigt mit einer Raffinesse und Präzision, die heute niemand mehr hinbekommt.
Immer wenn ich das Bild anschaue, denke ich, dass du dort saßt, an ebenjenem Tisch, zu ebenjenem Zeitpunkt, als ich mein Stativ aufbaute und darauf wartete, dass das Licht die richtige Qualität bekäme. Ich sehe dich vor mir, mit gerunzelten Brauen, in der rechten Hand einen Apfel haltend, mit der Linken in einem alten Buch blätternd, im Lichtkegel des Lampenschirms aus honiggelbem Glas.
Und dann lächle ich still vor mich hin, ich kann gar nicht anders, auch wenn ich nicht weiß, wie du reagieren wirst, wenn ich bald zu dir gehen und dir nach langem Überlegen endlich diesen Brief geben werde. So viel Schreckliches ist geschehen, so vieles, das nie mehr gutzumachen ist.
Die Dämmerung fällt auf San Lorenzo und sie ist blau. Wenn die Obstbäume blühen im April, dann ist das Blau von einer Zartheit, die sich kaum beschreiben lässt. Dann leuchten die unzähligen Blüten in das Blau hinein und alles erinnert an Brüsseler Spitze oder an Meeresschaum.
Der Einödhof
Hannah
Schon immer bin ich gerne lange Strecken gefahren. Habe sogar mal darüber nachgedacht, den LKW-Führerschein zu machen, und finde es noch immer ziemlich lässig, so durch die Lande zu tuckern und alles an mir vorbeiziehen zu lassen: Bäume, Häuser, Gedanken. Ich beneide die Trucker um ihre Aussicht, vielleicht auch um das Alleinsein, aber am meisten um ihre Kojen, in die sie sich verziehen, wenn sie ihre Strecke runtergerissen haben. Ich weiß, ich weiß, ich habe ein falsches Bild vom Fernfahren, so ein verträumtes. Aber ist es nicht so, dass Träume irrational sind und es auch bleiben dürfen?
Als ich jedoch an diesem Tag in meinem guten alten VW-Bus hockte, war alles anders. Die Autostrada del Sole hatte überhaupt nichts Verträumtes und meine Gedanken waren alles andere als frei. Und wenn ich mir etwas hätte wünschen dürfen, dann wäre es gewesen, nirgends ankommen zu müssen. Schon gar nicht in Castelnuovo, wo Eli vor drei Wochen gestorben war. Mein Kopf schien nur zwei Themen zur Auswahl zu haben: dass Eli tot war und meine Beziehung zu Martin auch.
Der Anruf war in dem Moment gekommen, als Martin mir eröffnet hatte, dass die Susi krank geworden sei. Das Handy hatte hartnäckig gebimmelt und ich hatte es wie ferngesteuert aus meiner Tasche gewühlt, um diesem verdammten Lloyd Cole und seinem That boy das Maul zu stopfen, wobei Martin schon wieder seinen genervten Gesichtsausdruck bekommen hatte. So guckte er auch immer, wenn ich ihn auf seine Scheidung ansprach. Das Bimmeln verstummte.
»Was soll denn das heißen?«, fragte ich.
»Ich kann jetzt nicht weg hier.«
»Aber unser Urlaub ist gebucht.«
»Jemand muss die Kinder ins Ferienlager fahren. Das musst du doch verstehen.«
Das Handy unternahm einen zweiten Versuch. Mechanisch drückte ich die Taste und hörte eine Frau »Pronto!« rufen. Ein Anruf aus Italien. Mein Blick klebte an Martins Gesicht, der genervter aussah denn je. Zerstreut fragte ich auf Italienisch nach, wer denn da überhaupt sprach.
»Hier ist Roberta Rossi aus Castelnuovo. Ich bin eine gute Bekannte Ihrer Tante …«
Plötzlich pochte es in meinem Schädel und ich umkrampfte das Telefon fester. Im Augenwinkel sah ich, dass Martin eine ungeduldige Bewegung machte. Er konnte es nicht ausstehen, wenn ich bei unseren Treffen vergaß, das Handy auszuschalten.
»Ich …«, hörte ich da die Frau sagen. »Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Tante … dass Eli …«
»Was ist mit ihr?«, rief ich und hörte selbst, wie schrill meine Stimme klang. »Hatte sie einen Unfall?« Sofort dachte ich an Elis rasanten Fahrstil. Ich hatte sie immer wieder beschworen, langsamer zu fahren. Vorsichtig und vorausschauend, so wie andere Sechzigjährige. Doch noch während ich vor meinem inneren Auge Eli am Steuer ihres blauen PT Cruiser Cabriolets sitzen sah, hörte ich die fremde Stimme sagen:
»Nein … nein … Kein Unfall. So wie es aussieht, hatte Eli wohl einen Gehirnschlag. Es tut mir so leid. Meine Mutter, Assunta, hat sie heute Morgen tot in ihrem Haus gefunden.«
Ich ließ das Handy sinken. Löste meinen Blick von Martins Gesicht, starrte durch die Frontscheibe auf die Schrottautos, die hinter dem Zaun, auf dem Gelände von Hottes Abwrackunternehmen, zu einem gigantischen Turm gestapelt waren.
Eli war tot.
Und ich saß hier, auf diesem Parkplatz, neben einem Mann, der nicht meiner war. Und es nie sein würde. Aus weiter Ferne hörte ich die Stimme aus dem Handy in meinem Schoß. Und dann drehte ich mich langsam zu Martin und sagte: »Das war’s mit uns. Bestell der Susi einen schönen Gruß.«
Drei Wochen waren seitdem vergangen, und als mich das Navi jetzt in Città di Castello von der Autobahn lotste, kurbelte ich die Fenster herunter und atmete die unglaubliche Süße dieses italienischen Sommerabends ein. Die Sonne verschwand hinter den umbrischen Hügeln und meine Kehle wurde so eng, dass es wehtat. Eli war tot. Ich hatte sie nach Hause bringen lassen und in Mosisgreuth beerdigt, zwei Gräber neben meinen Eltern. Nie wieder würde ich ihr raues Lachen hören. Nie wieder würde sie mich in den Arm nehmen und »mein Mädle« zu mir sagen.
Es dämmerte, als ich die Nebenstraßen entlangkurvte, durch kleine Orte, vorüber an vereinzelten Bars, die schon die Neonbeleuchtung eingeschaltet hatten. Ich fühlte mich wie in Watte gepackt vor lauter Müdigkeit und hätte am liebsten angehalten und ein wenig gedöst. Aber das Navi zeigte mir, dass es nur noch ein paar Kilometer bis zu Elis Haus waren. Ich drehte die Musik voll auf, Forest Fire und Charlotte Street, so laut, dass die Töne auf dem Armaturenbrett vibrierten und ich sie unter meinen Fingern spürte.
Ich hatte solche Mühe, die Augen offen zu halten, dass ich das abgerockte Schild mit dem Ortsnamen Castelnuovo erst im letzten Moment entdeckte. Als ich den Blinker setzte und abbog, geschah es. Ich schnitt die Kurve und sah einen von diesen dreirädrigen Transportern auf mich zukommen, auf dessen Ladefläche dürre Stöcke hin- und herschwankten. Er hielt genau auf mich zu. Ich riss das Steuer herum, ein bärtiges Gesicht huschte an mir vorbei und im selben Moment ertönte ein lautes Hupen und Poltern. Ich trat auf die Bremse und kam direkt am Abhang zum Stehen. Reflexartig drehte ich mich um und sah gerade noch, wie der Wagen um die Kurve verschwand.
Elisabeth
Alles begann an einem Montag. Bei der Erinnerung daran muss ich fast laut auflachen: Dass sich mein Leben an einem Waschtag entschied. Und dass ich alles, was geschah, im Grunde Schwester Adalberta zu verdanken habe.
Ich heiße Elisabeth, denn ich kam am 17. November auf die Welt, an dem Tag, als meine Namensvetterin, die Heilige aus Thüringen, starb. Vielleicht sah meine Mutter das als Zeichen, vielleicht hielt sie mich ja auch für so etwas wie eine späte Reinkarnation. Jedenfalls glaubte sie an die Macht des Wortes, so viel ist sicher. Der Name sollte mir ein gottgefälliges Leben bescheren.
In jenem Frühsommer 1965 war ich sechzehn Jahre alt und bis heute weiß ich nicht, ob es ein Segen war oder ein Fluch, dass ich mit elf zu den Nonnen kam. Auf jeden Fall durfte ich bei ihnen lernen, und das war im Grunde das Wichtigste, wenn auch mein eigentlicher Traum das Gymnasium gewesen wäre.
Mein Vater war da ganz anderer Meinung gewesen. »Dir die Birn mit einem Haufen Gruscht füllen!«, war der Standardsatz, wenn die Rede auf das Thema »weiterführende Schule« kam. Für ihn lag meine Zukunft offen da: Ich würde die Volksschule zu Ende machen und so lange auf dem Hof arbeiten, bis sich einer erbarmte und mich zur Frau nahm. Doch dieses eine Mal hatte mich der Himmel gerettet.
Er kam zu uns in Gestalt unseres Pfarrers, an einem Samstagnachmittag. Hochaufgerichtet und mit wehenden Rockschößen kam er auf einem Damenrad angefahren, das bei jedem Herabtreten des Pedals ein schabendes Geräusch von sich gab. Ich weiß noch, wie der Vater die Mistgabel senkte und wie die Mutter aus dem Haus gelaufen kam und sich die Hände an der Schürze trocken wischte.
Gemeinsam sahen wir zu, wie der Pfarrer vom Rad stieg, ein wenig umständlich, und in ernstem, ja hochoffiziellem Ton sagte: »Ich muss mit euch über die Eli schwätzen.«
Später stand ich in der Diele, die Ohren gespitzt, und lauschte auf die Stimme des Pfarrers, die gedämpft durch die Stubentür drang: »Die Eli ist ein kluger Kopf. Und im Hafen gibt es jetzt eine neue Mädchenrealschule, das Sankt Elisabeth. Es wird von den Franziskanerinnen von Sießen geleitet, eine gute Schule ist das.«
Ich hielt den Atem an. Lange Zeit war nichts zu hören als das Ticken der Standuhr in der Diele. Schließlich murrte der Vater etwas Unverständliches und die Mutter fragte zaghaft: »Wie heißt die Schul, Sankt Elisabeth?« Als ein Stuhl über den Boden scharrte, machte ich mich davon, bevor der Vater mich beim Lauschen erwischte.
Meine Mutter war eine nachgiebige Frau, die unter der Tyrannei meines Vaters litt. Aber sie deutete Zeichen. Und das war vielleicht der einzige Bereich in ihrem Leben, in dem sie keine Kompromisse einging. So ließen wir in der Nacht niemals auch nur ein einziges Wäschestück auf dem Hof hängen, aus Angst, die Hex könnt hindurchfahren. Und wenn wir auf dem Weg ins Dorf auf die Schafsherde vom Eder Bauern stießen, so hieß es: »Schafe zur Linken, das Glück wird dir winken.« In jeder Walpurgisnacht streute sie geweihtes Salz auf die Türschwellen vor Haus und Stall, um uns und das Vieh vor Unheil zu schützen. Und so war der Name der Schule das Zeichen für sie.
Es amüsiert mich noch heute, dass mir allein diese Namensgleichheit den Weg zu einer besseren Schulbildung ebnete. Natürlich spielte es auch eine Rolle, dass sich ausgerechnet der Pfarrer für mich einsetzte, denn der Weg zu Gott führte für meine Mutter nun einmal ganz allein über ihn. Jedenfalls gelang es ihr, sich dieses eine Mal gegen meinen Vater durchzusetzen. Und so landete ich bei den Nonnen.
Überhaupt spielte Gott eine große Rolle in meiner Kindheit. Die Beichte, die Samstagabendmesse, die Nonnen. Der heilige Antonius, zu dem wir beteten, wenn etwas verloren gegangen war. Das alles klingt heute – angesichts dessen, wie mein Leben verlief – geradezu bizarr. Noch grotesker war, dass mein Vater Franz hieß, benannt nach dem heiligen Franziskus. Ausgerechnet der Vater, der sein Vieh so schlecht behandelte wie kein anderer Landwirt in unserer Gegend, war nach dem Schutzpatron der Tiere benannt!
Unverständlich ist mir auch, dass es gerade der Handarbeitsunterricht war, der mir damals solche Mühe machte. Wenn Schwester Adalberta mich heute sehen könnte! Wie ich an meinen Decken sitze, Nacht für Nacht, und niemals müde werde, nach neuen Motiven und Zierstichen für meine Stickbilder zu suchen. Doch wenn ich, was selten geschieht, darüber nachdenke, wird mir klar, dass es nicht am Handarbeiten selbst lag, sondern an Schwester Adalberta, die mich nicht ausstehen konnte. Sie mochte ganz im Allgemeinen keine Bauernkinder und machte uns das Leben so schwer wie möglich. Viel später erzählte mir Sigrid, Adalberta habe während des Krieges mit ihrer Mutter und drei Geschwistern bei einem Bauern in einem Durchgangszimmer unterkriechen müssen.
An jenem Montag also war wieder einmal eine Naht nicht gerade genug geworden und Schwester Adalberta hatte mir schon zu Beginn der Stunde damit gedroht, mich so lange an der Nähmaschine sitzen zu lassen wie nötig, bis sie vollkommen zufrieden wäre. Doch je öfter ich die Naht wieder auftrennte und die Nadel über den Stoff schnurren ließ, desto krummer wurde das Ganze. Am Ende brach die Nadel, der Stoff war durchlöchert und der Reißverschluss ließ sich überhaupt nicht mehr öffnen. Mein Scheitern hatte allerdings weniger mit Talentfreiheit als mit dem Zugfahrplan zu tun. Unentwegt waren meine Augen zur Uhr gehuscht: noch fünfunddreißig Minuten bis zur Abfahrt des Zuges. Noch zwanzig Minuten. Und vorher musste ich ja noch zum Bahnhof kommen, was zwischen sieben und neun Minuten dauerte. Und wenn ich es nicht schaffte, käme ich zu spät, um das Vieh von der Weide in den Stall zu treiben. Dann würde das Melken zu spät beginnen, die Kühe würden aus dem Rhythmus kommen und die Milch wäre nicht pünktlich in den Behältern, um abgeholt zu werden. Und daran, was dann geschehen würde, mochte ich lieber nicht denken.
Kleinlaut sagte ich also zu Schwester Adalberta: »Bitte, ich muss heim zum Melken.«
Aber sie zeigte nur schweigend auf die Nähmaschine und sagte knapp: »Nadel auswechseln und noch mal.«
Also blieb ich sitzen, mit rundem Rücken über den Reißverschluss gebeugt. Meine Finger waren noch schweißiger als gewöhnlich und meine Füße auf dem Pedal fanden einfach nicht in den Rhythmus. Außerdem hatte ich nie Gelegenheit zu üben, denn zu Hause gab es keine Nähmaschine. Zu Hause musste »was Gescheites« gemacht werden: Unkraut gezupft, gemolken, Äpfel und Birnen und Johannisbeeren gepflückt, eingekocht, die Speis geputzt, das Vieh auf die Weide getrieben und die Kuhfladen mit einem Wassereimer von der Straße gespült werden.
Ein paarmal versuchte ich noch, Adalberta vom Ernst meiner Lage zu überzeugen. Doch je mehr ich bettelte, desto frommer wurde ihr Tonfall und desto eiserner ihr Blick. Am Ende zwang sie mich, den Reißverschluss von Hand einzunähen.
Als ich endlich die Schultreppe hinunterrannte, war mir zum Heulen zumute. Ich weiß noch, dass die Leute mich ansahen und wie peinlich mir das war. Ich war kein Typ, der nah am Wasser gebaut hatte, dafür hatte der Gürtel des Vaters schon gesorgt. Noch zwei Minuten bis zur Abfahrt des Zuges, noch sieben Minuten bis zum Bahnhof. Blieb nur die Himmelshoffnung, der Zug möge Verspätung haben, was hin und wieder vorkam.
Das Dorf, in dem ich wohnte, heißt Mosisgreuth und liegt in einer Gegend, die sogar Fuchs und Hase meiden. Jeden Morgen setzte ich mich auf das Fahrrad meiner Mutter und fuhr die rund fünf Kilometer bis zum nächsten Bahnhof. Dass ich ihr Rad benutzen durfte, war ein großes Privileg und wurde mir nur gewährt, damit ich schneller unterwegs wäre. So konnte ich morgens noch das Vieh auf die Weide treiben und mich auch abends früher wieder nützlich machen.
Natürlich hatte der Zug an jenem Tag keine Verspätung. Wie oft hatte ich in der Vergangenheit eine Ohrfeige für die Unzulänglichkeit der Bundesbahn kassiert.
Zu meiner Schwester war der Vater ganz anders. Ob das nun daran lag, dass sie ein Nachzügler war und ich vorab schon die Prügel für uns beide kassiert hatte, oder daran, dass sie mit ihren blonden Locken und blauen Augen so viel herziger war als ich? Ich weiß es nicht. Jedenfalls waren wir beide, die Sophie und ich, uns schon damals nicht besonders grün.
Sophie war neun Jahre jünger als ich und mit Ingrimm beobachtete ich, wie das »Schätzle« vom Vater verhätschelt und verwöhnt wurde. Als sie zwei Jahre alt war, schnitt er ihr eine Locke ab und legte sie in ein Kästchen. Einmal hätte er mich fast dabei erwischt, wie ich das Kästchen herausnahm, um die Haare auf dem Misthaufen zu verstreuen.
»Was machsch denn?«
»Ich wollt nur mal die Haare von der Sophie anschauen. Sie sind soo schön!«
Ich habe meiner Schwester Unrecht getan, so sehe ich das heute. Aber würde ich, wenn alles noch mal abliefe, anders handeln? Ich glaube nicht. Zu tief steckte ich in meinem Groll gegen den Vater. Zu sehr habe ich unter dem Gürtel gelitten. Und unter der Überzeugung, nichts wert zu sein.
Die Eli ist bockig wie ein Mistkäfer.
Die Eli ist ein fauler Strick.
Die Eli braucht eine harte Hand.
Der Mistkäfer jedenfalls stand noch eine Weile am leeren Gleis herum und dachte an die Prügel, die er nun wieder kassieren würde.
Langsam wandte ich mich vom Bahnsteig ab und setzte mich in Bewegung. Ich würde laufen müssen, so viel war klar. Und während meine Schritte von den Wänden der Unterführung widerhallten, dachte ich das erste Mal darüber nach, wie es wäre, einfach zurückzuschlagen. Ihm eine drüberzubraten, zum Beispiel mit dem Zaumzeug vom Braunen, um dann für immer zu verschwinden.
Ich lief die Friedrichstraße entlang aus der Stadt hinaus, und je schneller meine Schritte wurden, desto wütender wurden meine Gedanken. Als ich die letzten Häuser hinter mir ließ und das Licht langsam grauer wurde, hörte ich plötzlich jemanden rufen.
»Ehi! Signorina!«
Ich verstand nicht gleich, dass ich gemeint war. Erst als der Mann ein Stück vor mir am Straßenrand hielt und ausstieg, glaubte ich ihn zu erkennen. War das nicht einer der Italiener, die bei den Hansers in Oberreute als Zimmerherren wohnten? Er kam auf mich zu und mein Blick huschte zurück zu seinem Wagen, einem schiefergrauen Brezelkäfer mit Rostflecken. Er fragte etwas auf Italienisch, das ich nicht verstand, und sagte dann: »Wo du gehen?«, zeigte erst auf mich, dann auf den Käfer und deutete schließlich mit einer Geste ein Lenkrad an. Ich zögerte nur einen Augenblick, registrierte seinen Blaumann, die schwieligen Hände, die fast schwarzen Augen, hörte die Stimme meines Vaters, sein »Bleib weg von dene Kanake«, und stieg ein.
Im Auto versuchte er eine Art Unterhaltung in Gang zu bringen. Ich umklammerte meine Schultasche und antwortete einsilbig, denn mit einem Mal wurde mir Angst vor der eigenen Courage. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es klug gewesen war, die Warnungen des Vaters in den Wind zu schlagen. Wir fuhren am Seewald entlang und plötzlich dachte ich, wie leicht es für ihn wäre, links abzubiegen und in den Wald hineinzufahren. Und so saß ich da, den Blick starr geradeaus gerichtet und mit hochgezogenen Schultern, bereit, jeden Moment aus dem fahrenden Auto zu springen.
Doch er bog nicht in den Wald ab und nach einer Weile entspannte ich mich. Er schien meine Besorgnis zu spüren und stellte mir in seinem holprigen Deutsch harmlose Fragen, die er mit den entsprechenden Gesten untermalte. Auch erzählte er ein bisschen von sich, dass er aus Civitavecchia stammte und bei der Zahnradfabrik in Friedrichshafen Schicht arbeitete. Erst als wir bei der Abzweigung zu unserem Gehöft ankamen, einem Einödhof etwas außerhalb von Mosisgreuth, fiel mir ein, dass das Fahrrad ja fünf Kilometer weit entfernt am Langenargener Bahnhof stand. Also dirigierte ich ihn in die andere Richtung, was ihn einen Moment lang verwirrte. Als er vor dem kleinen sandfarbenen Bahnhofsgebäude anhielt, überlegte ich kurz, was wohl passieren würde, wenn jemand beobachtete, wie ich aus dem Wagen des Italieners stieg. Jemand, der meine Eltern kannte und nichts Besseres zu tun hätte, als eine Bemerkung fallen zu lassen, ganz nebenbei, beim Stammtisch im Adler oder wenn der Vater Dünger bei der WLZ kaufte.
Nervös blickte ich mich um, wandte mich dann aber wieder dem Mann zu und sagte das einzige italienische Wort, das ich kannte.
»Grazie.«
Ein Lächeln stieg in sein Gesicht und erst in diesem Moment bemerkte ich, wie weiß und ebenmäßig seine Zähne waren.
Wie gerade seine Nase.
Wie dunkel sein Blick.
»Io sono Giorgio«, sagte er und sah mir in die Augen.
»Und ich bin Elisabeth«, stammelte ich, »aber alle nennen mich Eli.«
»Lo so«, sagte er, das wisse er, und dann stieg ich aus und lief über die Straße.
Hannah
Kein schlechter Einstieg, dachte ich, nachdem ich um ein Haar frontal gegen den Transporter geprallt und den Abhang hinuntergestürzt wäre. Eine Ewigkeit blieb ich so hinter dem Steuer sitzen, äußerlich erstarrt, aber mit einem Herzschlag, der mir das Blut durch die Ohren pumpte, und zitternden Händen. Als ich irgendwann ausstieg und ein paar wackelige Schritte tat, musste ich an Eli denken und an meine ständige Sorge wegen ihres Fahrstils. Und nun war nicht sie, sondern ich fast die Böschung runtergebrettert.
Meine Müdigkeit jedenfalls war verflogen, als ich wieder hinters Steuer kletterte. Das Sträßchen mäanderte so vor sich hin, und während ich, nun vorsichtig geworden, Schleife um Schleife schön anständig ausfuhr, zog auf einmal nicht mehr dieses ernste umbrische Grün an mir vorbei. Nein, ich fuhr jetzt mitten durch ein toskanisches Postkartenklischee, mit Zypressenallee und allem, was dazugehört. Irgendwo hinter dem Grün schimmerten rötliche Mauern, und ein Blick aufs Navi zeigte mir, dass es nur noch fünfhundert Meter bis zur eingegebenen Adresse waren. Ich passierte ein Schild, das auf einen Agriturismo hinwies, tauchte kurz darauf in ein kleines Wäldchen ein und staunte, als sich die Landschaft hinter der nächsten Kurve mit einem Schlag wieder veränderte.
Im ersten Moment glaubte ich, durch einen dieser typischen Olivenhaine zu fahren, die in säuberlich angelegten Terrassen ganze Hügel bedecken. Doch gleich drauf wurde mir klar, dass das, was da im Dämmerlicht so schimmerte, Äpfel und Birnen waren. Ich konnte nicht anders, ich musste den Motor abstellen. Die Stille war vollkommen und durch die offenen Fenster wehte so ein wahnwitziger Duft nach frischem Obst herein, dass man hätte glauben können, in einem Märchen gelandet zu sein. Und in dem Moment verstand ich, warum Eli sich von allen Gegenden auf der Welt für diese hier entschieden hatte.
Aber ich musste mich beeilen, das Licht war inzwischen schon ganz grau. Die Straße wurde steiler und ich schaltete zurück. Kurz hatte ich Angst, die Räder meines alten Bullis könnten durchdrehen, Heckantrieb hin oder her. Dann aber schoss ich die Steigung hoch und war im nächsten Moment oben. Ein paar vereinzelte Häuser, in denen Licht brannte, tauchten auf und im Hintergrund ein kleiner Weiler, schwalbennestartig an einem Hügel klebend. Und da war auch Elis Auto, vor einem Haus aus grauem Stein.
Der Anblick traf mich mit einer Wucht, dass sich mir der Magen zusammenkrampfte. Und wenn ich hätte heulen können, so wäre das der Moment dafür gewesen: das kleine blaue PT Cabrio, hinter dessen Steuer sie nie wieder sitzen würde.
Eine Weile lang saß ich da wie betäubt und konnte nichts tun außer atmen. Als es wieder ging, stieg ich aus. Das alles hier gehörte zu Eli, hatte zu Eli gehört. Die Terrakottatöpfe am Eingang, die Mittelmeereiche vor dem Haus, Laub auf einem kiesbestreuten Hof. So lange hatte sie in diesem Haus gelebt – das doch eigentlich nur als Sommerhaus gedacht gewesen war – und ich hatte keine Ahnung gehabt, wie es hier aussah. Hatte nie den Wind in dieser Eiche rauschen hören, hatte mir nie die Zeit genommen, sie zu besuchen. Und nun war es verdammt noch mal zu spät. Ich hatte das vergeigt. Damit würde ich nie fertigwerden, das war mir klar. Dieser Abschied ohne Abschied würde mich nie mehr ganz loslassen. Und auch wenn ich es mir noch so sehr einredete: Es war nicht Martins Schuld, dass ich nie hier aufgekreuzt war. Trotzdem hätte ich ihn, wenn er in dem Moment da gewesen wäre, am liebsten geohrfeigt.
Mit Roberta Rossi hatte ich ausgemacht, dass sie den Haustürschlüssel in einen Blumentopf neben dem Eingang legen würde. Ich sah also im ersten Topf nach, dann, als ich dort nichts fand, im zweiten. Nachdem ich sämtliche Töpfe hochgehoben und am Ende sogar mit den Fingern in der Blumenerde herumgestochert hatte, war klar, dass es hier definitiv nichts zu holen gab.
Ich hasse Unzuverlässigkeit und Unpünktlichkeit. Auch wenn die Leute wegen meiner Dreadlocks manchmal den Eindruck haben, ich sei ein lockerer Typ, bin ich es in der Hinsicht kein bisschen. So war es vielleicht ganz gut, dass ich Roberta in diesem Moment nicht erreichte, auf ihrem Handy nicht und auch nicht zu Hause. Dumm war nur, dass ich für die Nacht nun ziemlich aufgeschmissen war. Klar, zur Not konnte ich in meinem Bulli schlafen. Aber ich sehnte mich nach einer Dusche. Ich fühlte mich schmuddelig und ein Blick auf meine Hände machte es nicht besser. Kurzentschlossen wusch ich mir mit meinen restlichen Wasservorräten die Blumenerde von den Fingern. Ich brauchte ein Zimmer für die Nacht. Und ich wusste auch schon, wo ich es bekäme.
Inzwischen war es dunkel geworden und plötzlich wurde mir bewusst, wie allein ich war. In der Eiche über mir raschelte der Wind und auf einmal war mir kalt. Ich kramte meine Strickjacke aus dem Rucksack – die Jacke, die Eli mir zu meinem Dreißigsten gemacht hatte. Sie bestand (ich hatte mir die Mühe gemacht zu zählen!) aus vierundsiebzig Patchworkquadraten, und irgendwie fühlte ich mich darin immer ein bisschen getröstet. So als würde ich die Stunden spüren, die Eli für mich da hineingesteckt hatte.
Ich schaltete das Navi aus, wendete und fuhr auf dem Sträßchen zurück zu dem Agriturismo-Schild, das ich vorhin gesehen hatte. Erst jetzt, im direkten Scheinwerferlicht, fiel mir auf, dass es ziemlich verwittert wirkte. Aber es war schon spät und ich hatte keine Ahnung, wo ich es sonst hätte versuchen können, also bog ich trotzdem in den Zufahrtsweg ein. Die Zypressen, die eben noch so malerisch gewirkt hatten, ließen mich jetzt an Stephen King denken und der Weg mit den vielen Schlaglöchern ähnelte eher einer Piste in Ghana. Doch da war die Allee auch schon zu Ende und ein paar Gebäude tauchten auf, typisch umbrische Steinhäuser, ein parkendes Auto, ein Motorroller. Immerhin war der Hof offenbar bewohnt. Ich blieb einen Moment im Wagen sitzen und musterte das Gebäude, das offenbar das Wohnhaus war. Da ging die Tür auf und eine Frau, vielleicht um die vierzig, trat heraus. Sie kniff die Augen zusammen und hob eine Hand vors Gesicht. Ich machte die Scheinwerfer aus, sodass die Frau nur noch von dem funzeligen Licht der Laterne über der Haustür beleuchtet war.
Ich stieg aus und rief: »Buonasera!« Als die Frau nicht reagierte, ging ich auf sie zu und erklärte: »Ich habe das Schild gesehen, vorne an der Straße. Das ist doch der Agriturismo hier, oder nicht?«
»Ja«, sagte sie und kam langsam auf mich zu. Plötzlich flammten um uns herum Lichter auf. Offenbar hatte jemand die Hofbeleuchtung eingeschaltet. Und da trat auch schon ein Mann aus dem Haus.
»Buonasera«, sagte ich noch einmal. »Ich suche ein Zimmer für eine Nacht.«
Die beiden schienen nicht die Schnellsten zu sein, denn sie stierten noch immer wortlos zu mir herüber. Um ihnen auf die Sprünge zu helfen, fügte ich hinzu: »Ich wollte eigentlich zum Haus meiner Tante, vielleicht haben Sie sie ja gekannt, Signora Christ. Es muss ein Missverständnis mit dem Schlüssel gegeben haben.«
Da kam Leben in die Frau und sie tat ein paar Schritte auf mich zu. »Die Nichte …«, sagte sie. Auch der Mann kam jetzt näher und reichte mir die Hand. »Mein Beileid«, sagte er leise und nun nickte auch die Frau und murmelte etwas, das sich wie »tut uns leid« anhörte. Aber dann straffte sie die Schultern und sagte: »Leider sind unsere beiden Ferienwohnungen besetzt. Sie könnten es in Città di Castello …« Aber da fiel der Mann ihr ins Wort.
»Wir haben noch ein Zimmer … allerdings nichts Großartiges.«
Ich sah, wie die Frau ihrem Mann einen säuerlichen Blick zuwarf. »Aber Giuseppe, du kannst doch der Signorina nicht diese Abstellkammer anbieten.«
Eilig sagte ich: »Ach, das wird schon passen. Hauptsache, ich bekomme eine Dusche …« Ich sah von einem zum anderen und nickte der Frau aufmunternd zu. Die schien immer noch nicht begeistert von der Idee.
»Also, ich weiß nicht …«, hob sie an, doch der Mann wischte ihre Bedenken mit einer Handbewegung beiseite.
»Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Das ist meine Frau, Mariluisa Santini. Und ich bin Giuseppe. Willkommen in Castelnuovo. Auch wenn der Anlass traurig ist.«
Ich erwachte irgendwie überrascht. Die Luft im Zimmer war kalt. Trotzdem ging ich, in die Decke gehüllt, zuerst zum Fenster und sah hinaus. Die Wolken hingen tief, wie schmutzige Watte, und doch sah es nicht nach Regen aus. Die grünen Hügel hatten etwas Trauriges, das mir in diesem Moment gefiel. Ja, dachte ich, dieser Tag passt zu meinem Leben.
Beim Frühstück, das aus einem frisch gebackenen Hörnchen und einem Caffè Latte bestand, versuchte ich wieder, Roberta zu erreichen. Als sie gleich nach dem zweiten Klingeln abhob, atmete ich tief durch.
»Was? Aber Maddalena wollte das doch machen …«, rief sie, nachdem ich sie auf den neuesten Stand gebracht hatte.
Am Ende erfuhr ich, dass Roberta und Assunta zu einer Beerdigung ins Veneto gefahren waren und eine Bekannte in Santa Maria Tiberina, dem etwas größeren Nachbarort von Castelnuovo, gebeten hatten, das mit dem Schlüssel zu übernehmen. Roberta entschuldigte sich gefühlte hundert Mal, was meinen Ärger verpuffen ließ.
»Am besten, Sie fahren direkt zu Maddalena Bartoli. Sie hat die einzige Osteria am Ort. Die können Sie nicht verfehlen.«
Die Kehren schienen kein Ende zu nehmen, und als ich irgendwann doch noch oben ankam, staunte ich nicht schlecht: Santa Maria Tiberina war ein Schmuckkästchen, sauber und adrett, wie arrangiert für den Prospekt eines Fremdenverkehrsamts. Sogar die Geranien wirkten, als habe sie gerade jemand abgestaubt.
Die Osteria hieß Bella Vista und hatte eine Terrasse, die diesem Namen alle Ehre machte. Doch als ich zwischen den leeren Tischen hindurch zum Eingang ging, hatte ich für all das keinen Blick. Mich interessierten nur die Schlüssel. Und warum sie verdammt noch mal nicht dort gelegen hatten, wo sie hatten liegen sollen.
Nach der Wirtin brauchte ich nicht erst zu fragen, ich erkannte sie sofort. Sie stand hinter dem Tresen, eine schöne Frau mit rot geschminktem Mund und schwarzen Haaren, die in großen Locken ihr Gesicht umrahmten. Sie blickte mir entgegen, und noch bevor sie etwas sagte, war mir klar, dass auch sie wusste, wer ich war. Nicht gerade elegant eröffnete ich das Gespräch: »Ich komme wegen des Schlüssels.«
»Aha, die Deutsche.« Das mochte zwar in meinem Pass stehen, aber der Unterton war ausgesprochen abfällig. »Sie haben ihn also nicht gefunden?«
In dem Moment dachte ich ganz kurz daran, dass es doch gut gewesen war, nach dem Abi ein paar Semester Literatur in Bologna zu studieren, so wie Eli mir geraten hatte. So war ich dieser schnippischen Person wenigstens nicht ganz ausgeliefert. Jedenfalls sagte ich betont kühl: »Stünde ich sonst hier?«
Sie nickte, legte das Tuch, mit dem sie die Gläser poliert hatte, beiseite und sagte: »Na, dann wollen wir mal.« Sie verschwand durch eine Tür hinter dem Tresen und kehrte kurz darauf mit einer Handtasche zurück, in einem blütenweißen Jäckchen, das perfekt zu ihrer blütenweißen Hose passte. In ihrer Hand klimperte ein Schlüsselbund.
Ich stand schon wieder an der Tür, mit der Hand auf der Klinke, als hinter dem Tresen eine Tür aufschwang und eine ältere Frau in einem altmodischen schwarzen Kleid in den Gastraum kam. Flüchtig nickte ich ihr zu und heftete meinen Blick dann wieder auf die Wirtin. Doch im Augenwinkel nahm ich eine irritierende Bewegung der Älteren wahr. Und so huschte mein Blick zu ihr zurück und ich sah gerade noch, wie sie die rechte Hand hob und sich bekreuzigte. Die Frau stand im Halbschatten des Gastraums und das Ganze war so schnell vorbei, dass ich fast glaubte, ich hätte mich getäuscht.
Die Wirtin war schon nach draußen gegangen und ich folgte ihr. Kurz bevor ich die Tür hinter mir zuzog, schaute ich noch mal zu der Alten, die ihre stechenden Augen immer noch auf mich gerichtet hielt.
Signora Bartoli fuhr rasant, ich kam ihrem schwarzen Alfa nur mit Mühe hinterher. Die Strecke war mir unbekannt und erst im letzten Moment sah ich, dass wir Castelnuovo von der anderen Seite her erreichten.
Der Kies spritzte auf, als sie den Wagen vor Elis Sommerhaus zum Stehen brachte. Ich stellte den Motor ab, sah, wie sie auf die Haustür zuging, sich bückte und etwas hinter dem Blumentopf neben der Haustür hervorholte.
Im Näherkommen sah ich, dass es ein Schlüssel war.
Elisabeth
An einem Sonntagnachmittag sah ich ihn wieder.
Es war einer jener Sommertage, die nach Heu und Freiheit dufteten, nach Zukunft und danach, dass einmal alles besser werden würde. Lachend radelten Sigrid und ich am Fluss entlang, unter den in der Sommersonne flirrenden Weiden. Abwechselnd schnitten wir Grimassen, riefen uns einzelne Wörter oder Satzfetzen zu und die andere musste erraten, wer gemeint war. Wir waren gnadenlos und grausam, getragen von der Annahme, dass wir selbst niemals einen nervösen Tick entwickeln würden, niemals ein etwas zu groß und zu weiß geratenes Gebiss bräuchten und dass uns auch niemals Haare aus der Nase wachsen würden.
Am Bodensee angekommen lehnten wir die Räder gegen einen Baum und sprangen ins Wasser. Wie kleine Kinder spritzten und lachten wir und legten uns dann nebeneinander auf Sigrids kratzige Militärdecke. Und obwohl so viele Jahre vergangen sind und ich mich nun oft alt und müde fühle, spüre ich, wenn ich die Augen schließe und an damals denke, noch immer diesen Moment: die Luft in meinen Lungen, das explodierende Licht unter meinen Lidern, den leisen Wind, der über meine nasse Haut streicht.
Und es war in jenem Moment, als ein Schatten auf mein Gesicht fiel und jemand sagte: »Eli?«
Ich blinzelte verwirrt, dann klappte ich hoch wie von einer Feder gezogen. Dort stand Giorgio.
Unsicher drehte ich mich zu Sigrid, die ihrerseits ebenfalls stocksteif dasaß und die Silhouette anstarrte. Einen Augenblick lang schien die Szene wie eingefroren: Sigrid und ich, die dasaßen wie bei einem Tanztee. Giorgio, der wie ein altmodischer Verehrer vor uns stand. Doch dann lief der Film weiter. Von irgendwoher kamen zwei andere Italiener, ein hoch aufgeschossener Mann und ein kleiner, breiter Typ mit einem ebenso breiten Grinsen. Die beiden begannen auf Sigrid einzureden, mit fliegenden Händen. Deutsche Wortfetzen und bunte Sätze, die ich nicht verstand, drangen zu mir herüber, während ich Giorgios Blick erwiderte.
Giorgio war geschmeidig. Das war das Erste, was ich an jenem Nachmittag dachte, als er sich neben mich setzte. Wassertropfen hingen wie Glasperlen in seinem schwarzen Haar und perlten von seinen Oberschenkeln ab, die so viel dunkler waren als meine selbst für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich helle Haut. Als junges Mädchen habe ich viele Stunden damit zugebracht, mich über die unzähligen Sommersprossen zu ärgern, die mein Gesicht und meinen ganzen Körper bedeckten, als habe ein lustiger Clown Farbe von einem Pinsel geschüttelt. Hängen geblieben waren winzige hellbraune Tüpfelchen, die sich an manchen Stellen ballten und am Oberschenkel ein seltsames Mal bildeten, das fast wie eine Blume aussah. Nur mein Gesicht und die Arme waren ein wenig gebräunt, durch die viele Arbeit im Freien.
Ich weiß noch, wie unbeholfen und merkwürdig ich mich fühlte unter Giorgios aufmerksamen Augen, und dass ich mich für meine Sommersprossen schämte. Möglichst unauffällig legte ich eine Hand über das Mal auf dem Oberschenkel. Aber er hatte es bereits entdeckt. Sanft zog er meine Hand beiseite und sagte:
»Una stella!«
Anscheinend hatte ich ihn daraufhin etwas unsicher angesehen, denn er lächelte fast zärtlich, deutete auf das Mal und sagte noch einmal, diesmal auf Deutsch: »Eine Stern.«
Ich erinnere mich, dass mein Gesicht wie Feuer brannte, während ich auf seine Finger sah, die immer noch den Stern zeigten, ihn fast berührten.
Und so sollte stella – abgesehen von grazie – das erste richtige italienische Wort werden, das ich lernte.
Zu diesem Wort gesellten sich an jenem Nachmittag noch andere, ebenso wohlklingende, die in meinem Kopf eine kleine Melodie anstimmten, und als Sigrid und ich viel zu spät durch den kühlen Abend am Fluss entlang nach Hause radelten, begleitete uns ein anderes Lachen als zuvor, durchsetzt von fremden Klängen, die nun in unseren Köpfen widerhallten.
Il sole.
Il lago.
L’amore.
Ich lernte Sätze wie: »Quanti anni hai?« – wie alt ich sei – und antwortete, ohne rot zu werden: »Bald zwanzig.« Ein wenig staunte ich über mich selbst, wie leicht mir all das über die Lippen ging, auch diese Lüge.
Und ganz zum Schluss war da ein Satz gewesen, den ich nie wieder vergessen sollte: »Andiamo a ballare?« Eine Einladung zum Tanz.
Sigrid und ich hatten uns angesehen und erst einmal gelacht. Das würden unsere Eltern niemals erlauben. Doch während wir aufs Rad stiegen und winkend davonfuhren, war ich mir bereits sicher, dass ich mit Giorgio tanzen gehen würde, egal um welchen Preis.
Die Nonnen waren Franziskanerinnen und die Heiligen waren uns vertraut. Allen voran natürlich Franziskus, aber auch Katharina von Ricci, die die Wundmale Christi am Leib trug, und die heilige Lucia, die sich einen Lichterkranz aufs Haupt setzte, um im Dunkeln die Hände frei zu haben für die Speisen, die sie ihren christlichen Glaubensgenossen in die Verstecke brachte. Und manche der Schwestern kamen uns selbst ein wenig wie Heilige vor, allen voran Arcangela, die uns in Mathematik und Physik unterrichtete und die ich nach jenem Sonntag am See nicht mehr aus den Augen ließ. Denn Schwester Arcangela war gebürtige Italienierin.
An einem strahlend blauen Tag im Juni fasste ich mir ein Herz und trat nach dem Unterricht ans Lehrerpult.
»Ich möchte gerne Italienisch lernen.«
Sie blickte auf und ich spürte deutlich ihr Erstaunen.
»Soo?«, fragte sie gedehnt. »Und warum das?«
Ich druckste ein wenig herum und log dann: »Weil ich eine Brieffreundin in Italien habe.«
»Du hast also eine Brieffreundin in Italien, kannst aber kein Italienisch.«
Ich wurde rot. »Nein. Noch nicht.«
Sie musterte mich durchdringend.
»Wird dir das nicht zu viel?«
Ich trat von einem Fuß auf den anderen. Wusste sie von meiner Arbeit zu Hause auf dem Hof? Plötzlich fühlte ich mich noch unwohler. Mitleid war das Letzte, was ich wollte. Und so straffte ich mich ein wenig und antwortete mit fester Stimme: »Nein, das wird mir nicht zu viel.«
»Deine Leistungen sind jedenfalls hervorragend.« Noch einmal sah sie mich prüfend an. Dann schrieb sie etwas in die schwarze Kladde, die sie immer bei sich trug, und sagte: »Ich werde dir ein Buch und Schallplatten mitbringen, mit denen du dich erst mal beschäftigen kannst. Und wenn du dir dann immer noch sicher bist, dass du das lernen willst, komm wieder und wir sehen weiter.«
Das Wetter schlug um und alle Leichtigkeit versank im Matsch. Der Regen fiel in endlosen Schnüren auf die Wiesen und die Kühe drängten sich im Unterstand. Ich kam aus den Gummistiefeln nicht mehr heraus, die Kuhfladen vermischten sich mit der aufgeweichten Erde und der Vater war noch mürrischer als gewöhnlich.
Doch all das berührte mich nicht.
Wann immer es ging, schnappte ich mir das graue Köfferchen mit dem Sprachkurs von Schwester Arcangela und lernte. In einer Intensität, die ich bisher weder für Englisch noch für Französisch aufgebracht hatte – obwohl das mit Abstand meine Lieblingsfächer waren –, versenkte ich mich in die Konjugation italienischer Verben, paukte Vokabeln und analysierte die Lehrsätze im Buch. An Sonntagen, nach der Messe, wenn der Vater beim Frühschoppen im Adler hockte und die Mutter noch in der Kirche half, rannte ich nach Hause, öffnete die Klappe von Vaters Musiktruhe und legte die zu dem Lehrbuch gehörende Schallplatte auf. Wie verzaubert lauschte ich der Stimme, die aus einem Blecheimer zu kommen schien und »andiamo in questo bar« sagte.
Und als der männliche Sprecher den einen, alles bedeutenden Satz aussprach, spürte ich eine so große Freude in mir heraufsprudeln, dass ich aufsprang, im Zimmer herumtanzte und den Satz wie eine Melodie vor mich hinsang.
»Andiamo a ballare.«
Auch ich würde bald tanzen gehen, mit Giorgio, sein samtiger Blick würde auf mir ruhen und er würde mich in seinen Armen halten. Alles war schon bis ins kleinste Detail geplant. Und am nächsten Abend war es so weit.
Natürlich durften meine Eltern auf keinen Fall davon erfahren. Und so erledigte ich an jenem Abend alle Aufgaben auf dem Hof gewissenhaft wie immer, doch etwas schneller als sonst. Das Melken selbst ließ sich zwar nicht beschleunigen, aber den Stall hatte ich schon am Nachmittag ausgemistet und so blieben nur ein paar Restarbeiten übrig. Bereits am vergangenen Samstag hatte ich angeboten, Sophie ins Bett zu bringen, sodass ich mich nicht verdächtig machte, wenn ich es diesmal auch wieder übernahm. Mit großen blauen Augen sah sie von ihrem Kissen zu mir hoch, während wir gemeinsam das Abendgebet herunterleierten, sie immer etwas hinterherhinkend, sich an meinen Worten festklammernd.
Natürlich war das, was ich vorhatte, furchtbar riskant, aber es gab sonst keine Möglichkeit, von zu Hause wegzukommen. Erst hatten Sigrid und ich überlegt, ob ich meine Eltern unter irgendeinem Vorwand davon überzeugen könnte, mich in dieser einen Nacht bei ihr schlafen zu lassen. Aber weil ich die Antwort ohnehin kannte (»Und d’Arbeit macht sich von allein?«), ließ ich jede Anstrengung in diese Richtung bleiben, um mich nicht unnötig verdächtig zu machen.
Als Sophies gleichmäßige Atemzüge erkennen ließen, dass sie tief und fest schlief, war es kurz nach acht. Ich schlich die Treppe hinunter und lauschte. Der Vater war längst im Adler, die Mutter saß wie immer in der Stube. Wahrscheinlich blätterte sie wieder einmal in den Prospekten, die sie heimlich sammelte, und träumte dabei von einem Alibert-Toilettenschränkchen oder dem Linde-Heimgefrierer. Im Radio sang Peter Kraus. Als ich durch die Stubentür hörte, wie die Mutter umblätterte, durchquerte ich leise die Diele und entriegelte die Verbindungstür zum Stall und schlich wieder nach oben.
Wir hatten nicht viel damals und so besaß ich nur ein einziges »gutes« Kleid, ein dunkelblaues mit weißen Tupfen, das ich in den vergangenen Tagen heimlich »auf Figur genäht« hatte.
Ich weiß noch, wie ich mich ankleidete, wie jeder Handgriff, das Rascheln des Stoffes, selbst der Regen am Fenster eine besondere Bedeutung bekamen. Es war kalt im Zimmer und ich fröstelte, als ich den Reißverschluss des Kleides hochzog. Immer wieder linste ich zu Sophie hinüber, während ich mir eine falsche Naht auf meine Wade malte. Aber Sophie rührte sich nicht, und wie ich sie kannte, würde sie das bis zum Morgen nicht tun. Wenn sie erst einmal schlief, konnte man im Zimmer Rad schlagen, ohne dass sie wach wurde. Ich dachte an Giorgio, an seine dunklen Wimpern und die Art, wie er mich ansah, direkt und klar. Sein Blick ließ keinen Zweifel zu. Heute Abend würde ich alles andere vergessen, die Nonnen, den Vater, die ewige Mühsal, alles. Ich wäre eine andere, ein paar Stunden lang. Schon jetzt war ich trunken vor Glück und vor Aufregung.
Hannah
Elis erstes Zuhause war ein Einödhof im Süddeutschen gewesen, ein altes Gemäuer mit einem Birnenspalier, einer Apfelpresse und einer rostigen Westfalia-Melkmaschine in der Scheune.
Ihr letztes war eine Bruchbude in Umbrien. Das schoss mir durch den Kopf, als ich neben dieser fremden Frau vor Elis Häuschen stand. Wie hatte sie das bloß ausgehalten – zwei solche Kaschemmen, in denen man sich durchs Jahr reparieren konnte, ohne dass einem je die Arbeit ausging?
Im Halbdämmer des vergangenen Abends hatte ich den Zustand des Mauerwerks nicht deutlich sehen können. Im erbarmungslosen Vormittagslicht aber bemerkte ich die Natursteinfassade mit den herausgebrochenen Brocken; die Fensterläden mit den schadhaften Lamellen und dem abgeplatzten Lack; den Zustand der Haustür, deren verwaschene Farben man bei anderen immer romantisch findet. Warum um Himmels willen hatte Eli sich so einen Klotz ans Bein gebunden?
Signora Bartoli fing meinen Blick auf und reckte das Kinn.
»Sicher wollen Sie das Haus so schnell wie möglich loswerden?«
Mir fiel auf, wie angespannt sie mich musterte. Und obwohl sie meine Gedanken genau erraten hatte, sagte ich betont lässig: »Ach, ich weiß noch nicht, was ich mit dem Haus mache. Jetzt komm ich erst mal an.«
Ihr Blick schien sich zu verhärten, aber vielleicht bildete ich mir das nur ein, weil sie mir unsympathisch war. Und weil ich mir immer noch nicht vorstellen konnte, dass ich den Schlüssel einfach übersehen hatte.
Sie streckte die Hand aus und reichte ihn mir. Ich nickte knapp, murmelte ein Dankeschön und sah zu, wie sie ihren Wagen bestieg und – ohne mich noch einmal anzusehen – davonfuhr.
Ich weinte nicht, als ich das Häuschen betrat. Ich weinte nie – das war ein Defekt, den ich mir mit neun Jahren zugezogen hatte, genauso wie meine Abneigung gegen die Farbe Weiß. An einem goldenen Tag im Oktober, dem zehnten Hochzeitstag meiner Eltern, waren sie zu einer kleinen Reise ins Altmühltal aufgebrochen. Ich hatte ihnen hinterhergewinkt, neben meiner besten Freundin Sabine stehend. Noch heute sehe ich den Wagen vor mir, einen blauen Passat, und die Hände, die links und rechts aus dem Fenster winkten. Als die Nachricht kam, dass sie im Nebel einen Unfall gehabt hatten, standen Sabine und ich gerade in alte Gardinen gehüllt vor einem Altar, über den ein weißes Bettlaken gebreitet war: Wir hatten heiraten gespielt, als ich erfuhr, dass meine Eltern von einer Brücke gestürzt und gestorben waren. So hat sich in mir für immer das Bild meiner Mutter eingeprägt, wie sie mit wehendem Schleier zu Tale fällt. Seitdem ertrage ich die Farbe Weiß nicht mehr.
In diesem Raum hier war nichts weiß und ich dachte im ersten Moment an alles Mögliche, nur nicht an Elis Tod. Sondern sah ein Bild wie auf einem Gemälde vom Typ Alte Meister vor mir, so eine Licht- und Schattenkomposition, die vielleicht Der Tuchhändler hätte heißen können. Ein alter Kamin. Ein schwerer Tisch. Und darauf Stoffe: rote und gelbe, türkise und grüne.
Wie lange ich wohl so herumstand und meinen Blick nicht lösen konnte? Keine Ahnung, ich erinnere mich nur, dass ich auf einmal das Gefühl hatte, durchs Teleobjektiv meiner Kamera zu gucken und immer neue Details heranzuzoomen. Das Nadelkissen. Die Nürnberger-Lebkuchen-Blechschachtel mit der Delle, die ich ihr mal zum Nikolaus geschenkt hatte und in der sie seitdem ihre Nähseiden aufbewahrte. Die kleinen, mit der Zickzackschere ausgeschnittenen Stoffquadrate. Eine Mappe, auch sie mit Stoffquadraten überzogen, wahrscheinlich Elis Skizzenbuch. Die Weidenkörbe, bis an den Rand gefüllt mit Wollknäueln.
Und dort am Fenster stand der Sessel, dieses rote Ohrenbackending, das sie von zu Hause mitgebracht und in dem Assunta Rossi sie gefunden hatte. »Da hat sie gesessen und die Mamma hat geglaubt, sie würde schlafen.« Nie würde ich Robertas Worte vergessen. In der mittelalterlich wirkenden Fensterhöhlung stand ein leeres Weinglas, daneben lag Elis Strickzeug. Und plötzlich kam mir in den Sinn, dass sie hier an meiner Jacke gestrickt hatte, während ich wie ein Teenie mit Martin, dem Verheirateten, auf einem Parkplatz herumgeknutscht hatte.
Ja, ich hätte gerne geheult. Stattdessen wandte ich den Blick ab und schleppte mich die Treppe hoch.
Oben kehrte ich in die Gegenwart zurück. Hier war alles versammelt, was man zum Leben brauchte: eine Schlafkammer mit Schrank und Nachttisch. Ein Bad mit Wanne, von der aus man in die Eiche vor dem Fenster sehen konnte. Kein Fernseher. Eine Küche, Elis Handy, an ein Ladekabel angeschlossen. Ihr Laptop auf dem Küchentisch. Auf dem Kühlschrank das alte Kombigerät von zu Hause, so ein Radio-CD-Player, der allen Ernstes noch ein Kassettenteil besaß. Im Abtropfgestell das Geschirr von ihrem letzten Abendessen.
Ein kurzer Blick durchs Fenster in Elis Garten zeigte, dass dieser zwar nicht besonders groß war, dafür aber umso hübscher, und ich verstand nun besser, warum es ausgerechnet dieses Haus hatte sein müssen. Ich sah Rosen und Lavendel, der ein wenig zerzaust wirkte, einen runden Tisch, zwei Stühle, und am Ende des Grundstücks ein schmiedeeisernes Geländer, hinter dem der Garten abrupt endete und eine bezaubernde Aussicht auf einen verwilderten Hügel mit alten Obstbäumen bot. Ich versuchte, mir Eli in diesem Garten vorzustellen, wie sie am Tisch saß oder Unkraut jätete, aber es gelang mir nicht. Ich sah nur die Eli im Sessel. Die, die mit mir alte Western und Louis-de-Funès-Filme geschaut hatte. Die, die für mich Mutter und Vater zugleich gewesen war. Die, die ich im Stich gelassen hatte.
Elisabeth
Um Viertel vor zehn lag das Haus in endgültiges Schweigen gehüllt. Sophie schlief immer noch ruhig und auch die Mutter war längst zu Bett gegangen, sodass das einzige Licht im Haus das meiner Nachttischlampe war. Noch einmal blickte ich in den kleinen Handspiegel und betrachtete das Gesicht, das mich daraus anblickte: die schwarz umrandeten Augen, die auf einmal schräg und gefährlich aussahen, die tiefroten Lippen, die mir fremd vorkamen, der Mund einer anderen. Ein letztes Mal kontrollierte ich die Seidenstrumpfnaht, die beinahe perfekt aussah, und bauschte dann das Federbett so auf, dass es aussah, als läge ich darin. Die hochhackigen Schuhe tat ich in meine Tasche, löschte das Licht und tastete im Dunkeln nach dem Treppengeländer.
Unten angekommen zog ich die Gummistiefel an, nahm Regenmantel und Schirm von der Garderobe und verließ das Haus durch den Stall. Draußen lief ich los. Ich weiß noch, dass mir der Himmel in dieser Nacht besonders schwarz vorkam, dass meine Schritte in den schweren Stiefeln dumpf und plump klangen und das Rauschen des Regens übertönten, obwohl ich mir alle Mühe gab, so leise wie möglich aufzutreten. Ein paarmal überlegte ich, was wohl wäre, wenn ich dem Vater – auf dem Rückweg von der Wirtschaft – in die Arme liefe. Aber ich schob den Gedanken beiseite. Schließlich kam er nie vor Mitternacht nach Hause.
Nach zehn Minuten verließ ich den unbefestigten Weg und bog auf die Teerstraße ein, und wenig später erreichte ich auch schon Leuthäusers Schuppen, wo ich mit Sigrid verabredet war. Ich zögerte kurz, dann ging ich um die Ecke, der Eingang lag zu den Obstwiesen hin, und rief nach Sigrid. Ich bekam keine Antwort und fragte mich, was wäre, wenn Sigrid nicht käme. Wenn ihre Eltern sie erwischt hatten und ich nun alleine hier warten würde. Um dann zu drei Italienern, die ich kaum kannte, ins Auto zu steigen. Eine gefühlte Ewigkeit verging, während ich alleine in der Dunkelheit stand. Dann hörte ich den Wagen kommen, erkannte das typische Motorengeräusch eines VW-Käfers. Rasch schüttelte ich die Stiefel von den Beinen und schlüpfte in die Hochzeitsschuhe meiner Mutter, die mir zu klein waren. Durch die Ritzen des Schuppens fiel Licht, der Wagen hielt, stand dort mit laufendem Motor, eine Tür ging auf und ich hörte Giorgios Stimme, die halblaut meinen Namen sagte. Und einen Moment nur, einen winzigen Augenblick, zögerte ich, bevor ich antwortete. »Sono qui«, rief ich und mit einem Mal waren alle Ängste und Zweifel weggewischt. Ich lief um die Ecke und da hörte ich ein Stück entfernt auch schon leichte, klackernde Schritte, die wie ein Rhythmus den Regen begleiteten. Und dann Sigrid, die atemlos rief: »Wartet auf mich!«
Schließlich saß Sigrid hinten zwischen Enrico und Silvio, ich vorne neben Giorgio und so fuhren wir gemeinsam durch die Nacht.
Diese Sorglosigkeit, diese unendliche Ahnungslosigkeit rührt mich im Rückblick sehr. Sie war ein Segen für mich – und überhaupt ist es ja ein Segen, dass wir niemals wissen, was sein wird und was auf uns zukommt. Wüssten wir es, wäre alles verdorben, auch jene raren Momente reinen Glücks, die wir geschenkt bekommen, von einem gnädigen Schöpfer oder den Umständen oder wovon auch immer. Ich jedenfalls tue mir bis heute schwer mit der Religion, obwohl ich unzählige Rosenkränze gebetet, Hunderte von Messen besucht und viel Zeit in Beichtstühlen verbracht habe, diesen Kammern voll dunkler Geheimnisse. Auf dem Beifahrersitz von Giorgios Käfer allerdings wusste ich sicher, dass ich das, was in dieser Nacht geschehen würde, niemals den Ohren eines Priesters anvertrauen würde.
Während die ersten Lichter der Stadt auftauchten, fühlte ich mich mit einem Mal volljährig und vollwertig, zum ersten Mal glaubte ich zu spüren, wie das Leben auch sein konnte. Wie das Leben werden würde, später, wenn ich erst einmal einundzwanzig und mein eigener Herr wäre, wenn nichts und niemand mich daran hindern könnte, das zu tun, was ich wollte. Ich würde weggehen, weit weg. Ich würde irgendwo in einer kleinen Wohnung in der Stadt leben, mitten im größten Verkehr. Und ja, ich würde einen Beruf haben. Ich würde eigenes Geld verdienen und mir einen Mantel mit Pelzkragen kaufen und roten Nagellack, und vielleicht würde auch ich dann ein Auto besitzen. Ich war wie in einem Rausch.
Das Tanzlokal hieß Konrad und schon von Weitem sah man die vielen Wagen vorm Eingang und die rosarot geschwungene Leuchtschrift darüber. Wir fanden einen Parkplatz nicht weit vom Seeufer entfernt, und als wir ausstiegen, im Regen, nahm Giorgio mich unter seinen Schirm.
Vor dem Tanzlokal standen ein paar Franzosen herum. Sie waren damals überall in Friedrichshafen, Gauloises rauchend auf den Straßen, und in der Eisdiele an der Uferpromenade, mit nacktem Oberkörper und raspelkurzen Haaren an der Freitreppe am See.
Bei der Erinnerung daran, wie ich mich fühlte an Giorgios Hand, an seiner Seite, muss ich lächeln. Es war, als hätte ich mich gehäutet und mein altes Ich mit den Gummistiefeln und Stallhosen in Mosisgreuth zurückgelassen. Darunter war die Eli im blau-weiß getupften Tanzkleid hervorgekommen, das sich nun bauschte und bei jedem Schritt mitschwang. Die Eli mit dem frisch gewaschenen Blondhaar, das endlich einmal nicht nach Kuhstall roch, sondern nach dem Maiglöckchenparfüm von Sigrids Mutter. Die Eli, deren Lippen so rot leuchteten, dass die Franzosen vor dem Eingang ihre Bürstenköpfe drehten und zu mir hersahen. Die neue Eli aber glitt an ihnen vorüber, leicht und elegant, mit wippendem Schritt, eine Gräfin für diese eine Nacht.
Als Enrico die Tür öffnete, schwoll die Musik an – und bis heute zerreißt es mir das Herz, wenn ich Diana von Paul Anka höre. Und dann waren wir im Getümmel, im Rauch, in der Musik, mittendrin. Nie zuvor hatte ich so laute Musik gehört, vom Dröhnen der Orgel in der Sonntagsmesse einmal abgesehen. Diese Musik hier war anders, sie drang in meinen Körper und erfüllte ihn mit ihrem Rhythmus, genau wie die Körper der anderen. Der ganze Saal vibrierte.
Die Tür hinter uns schloss sich und wir blieben stehen, um uns zu orientieren. Wie gebannt betrachtete ich die Tänzer, die abenteuerliche Schwünge vollführten, die wippenden Pferdeschwänze der Mädchen, die schwingenden Röcke. Kurz dachte ich daran, dass ich ja gar nicht tanzen konnte. Aber dann zog Giorgio mich auf die Tanzfläche und zeigte mir, was ich zu tun hatte. Und bald spürte ich, wie meine Füße die Schritte wie von selbst machten.
So ging das eine halbe Ewigkeit, bis Sigrid zu mir kam und gegen die Musik anrief: »Ich hab Durst. Und mir ist heiß. Kommst du mit?«
Enrico und Giorgio kauften uns Sinalco an der Theke, dann bahnten wir fünf uns einen Weg durch die Menge nach draußen. Die Luft war frisch und kühl, der Regen hatte aufgehört. Sigrid tupfte sich die Stirn mit einem Taschentuch trocken und ich fuhr mir unauffällig über den Nacken. Giorgio legte den Arm um mich und zog mich zu sich. Und dann küsste er mich. Irgendwo lachte ein Mädchen, und in diesem Moment wünschte ich mir, dass die Zeit stehen bliebe. Es war mein allererster Kuss und er fühlte sich mächtig an, wie eine unterirdische Strömung, die mich in eine Dunkelheit zog, aus der ich niemals wieder erwachen wollte.
Doch da tippte mir jemand auf die Schulter. Irritiert löste ich mich von Giorgio und sah direkt in die Augen eines Franzosen, der offensichtlich zu viel getrunken hatte. Ich erkannte ihn wieder, es war einer von denen, die bei unserer Ankunft draußen gestanden und uns unverhohlen gemustert hatten. Jetzt grinste er mich frech an, knallte in Wehrmachtsmanier seine Hacken zusammen und salutierte vor mir. In nahezu fehlerfreiem Deutsch fragte er: »Darf ich um einen Tanz bitten?«
Ich schüttelte den Kopf und antwortete freundlich: »Danke, aber ich bin in Begleitung.«
Der Franzose legte suchend die Hand über die Augen, drehte sich einmal um sich selbst und sagte: »Wirklich? Ich sehe niemanden …«
Jetzt trat Giorgio, der einen Kopf kleiner war als der Franzose, auf den Mann zu und sagte etwas auf Italienisch zu ihm.
Ein gedehntes »Aaah!« war die Antwort und dann: »Jetzt sehe ich ihn. Diese Makkaronis sind immer so klein … wie ihre Schwänze. Man sieht sie kaum!« Er brach in Gelächter aus und ein paar andere Franzosen stimmten ein.
Wieder sagte Giorgio etwas auf Italienisch, lauter diesmal, aber da fasste ihn Enrico an der Schulter und schob uns beide fort. Aber wir kamen nicht weit, denn der Franzose vertrat uns den Weg.
»Was ist das Besondere an italienischen Panzern? Richtig! Sie haben sechs Rückwärtsgänge.«
Dann ging alles ganz schnell. Ich sah, wie Giorgio nach vorne schoss und dem Franzosen einen Stoß versetzte und wie Enrico seinen Nebenmann am Kragen packte. Sigrid schrie auf, als Enrico einen Schlag auf die Nase bekam und zu bluten begann. Rasch nahm ich ihre Hand und zog sie ein Stück weg.
Aus dem Lokal kamen nun immer mehr Leute, hauptsächlich Franzosen, aber auch ein paar Italiener, die sich sofort zu ihren Landsleuten gesellten. Das Getümmel weitete sich aus und wir wurden mal hierhin, mal dorthin geschubst. Ich versuchte, zu Giorgio durchzukommen, doch ich hatte ihn längst aus den Augen verloren. Da hörten wir auf einmal Motorengebrumm, zuschlagende Autotüren und Männerstimmen, die riefen: »Aufhören, Polizei!« Und ehe ich so recht wusste, was geschah, wurde ich schon von einem Polizisten am Arm gepackt und zu einem Transporter geführt.
Ein verschreckter Blick über die Schulter zeigte mir, dass Sigrid mir folgte, auch sie am Arm eines Uniformierten. Überhaupt wimmelte es plötzlich nur so von Polizisten und ehe ich michs versah, wurden die Türen des Transporters verrammelt und los ging die Fahrt.
Und während der Wagen um die Kurven rumpelte, war alles vorbei: Der Zauber war zerbrochen, die junge Dame wieder das Bauernmädchen, die Nonnenschülerin, die jeden Morgen vor Unterrichtsbeginn betete und jeden Sonntag zur Kirche ging. Nur war ausgerechnet dieses Mädchen nun auf dem Weg zum nächsten Polizeirevier, zusammen mit einer Horde raufender Franzosen und Italiener.
Hannah
Ich schleppte das Gepäck nach oben und begann die wenigen Vorräte, die ich mitgebracht hatte, in die Küchenschränke zu räumen. Meine Bewegungen fühlten sich irgendwie falsch an, und während ich die Schranktüren öffnete, dachte ich plötzlich an einen anderen Tag. Einen Tag vor zweiundzwanzig Jahren, an dem ich ebenfalls Gepäck ins Haus geschafft hatte. Ich war neun Jahre alt gewesen, als meine Eltern verunglückten. Nun war ich einunddreißig und hatte zum zweiten Mal alles verloren.
Auf einmal brach die Erinnerung wie eine verdammte Flut über mich herein. Ich sah Eli neben mir am Steuer des Wagens sitzen, sah, wie sie den Rückwärtsgang einlegte, um vor dem Einödhof zu parken, direkt vor der Treppe, die zur Haustür hochführte. Ich sah sie den Schlüssel abziehen und zu mir herübersehen. Ich sah ihr Haar, das im Sonnenlicht wie Gold leuchtete, die roten Lippen, die lächelten, den schönen blauen Mantel mit dem Pelzkragen. Und das war der Moment, in dem ich erkannte, dass sie mein Engel war, der mich vor der Pflegefamilie oder dem Waisenhaus gerettet hatte. Von nun an, das wusste ich, würde dieser Engel immer über mich wachen.
Doch jetzt war Eli tot.
Wenn es mir so richtig beschissen geht, weiß ich nur zwei Mittel, die mir helfen: Ich steige in meinen Bus und kurve herum, bis es mir besser geht. Oder ich schnappe mir die Kamera und fotografiere, was mir vor die Linse kommt.
Herumgekurvt war ich genug, und weil ich in Elis Küche neben einem Umbrienführer und einigen Straßenkarten auch eine topografische Karte entdeckt hatte, beschloss ich, mir mit der Kamera in der Hand die Umgebung anzusehen. Die Gegend um Castelnuovo – das sah man auf der Karte – war von unzähligen Wegen durchzogen und ein kleines Kreuz deutete darauf hin, dass hier in der Nähe eine Kirche oder sogar ein Kloster sein musste. Genau das, was ich brauchte, um meine Erinnerungen für eine Weile lahmzulegen.
Ich schnappte mir meinen Rucksack, tat eine kleine Flasche Wasser, einen Apfel und die Kamera hinein und machte mich auf den Weg. Vor dem Haus spielte ich kurz mit dem Gedanken, erst mal eine Runde in Castelnuovo zu drehen und mir einen Eindruck von dem kleinen Borgo zu verschaffen, aber dann schlug ich doch gleich die andere Richtung ein. Ich hatte keine Lust auf Leute und neugierige Blicke. Ich folgte dem Weg talwärts, durch das Wäldchen. Bei der Abzweigung zum Agriturismo der Santinis bog ich links ab.