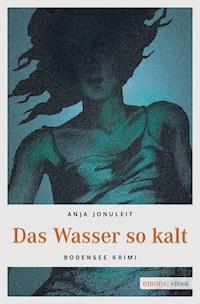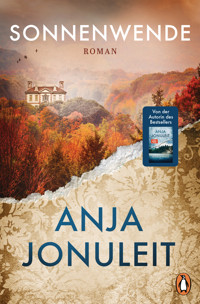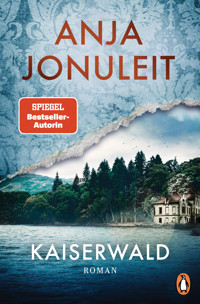6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Ein Weihnachts-Liebes-Märchen Eines winterlichen Tages - es ist nicht mehr lange bis Weihnachten - stolpert Sami über ein Gläschen, gefüllt mit Körnern, die er nicht kennt. Er bringt es zur nächsten Apotheke und findet sich dort vor einer Mohnblüte wieder: Eine kleine rothaarige Apothekerin schnuppert an dem Glas, blickt verschämt zu Sami hoch - und läuft rot an, bevor sie ihm den Inhalt verrät. Ein paar Tage und einige Gewürzgläser später beschließen die beiden, das Rätsel um die Gewürze zu lösen, und finden über das duftende Geheimnis einer alten Dame zueinander.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 76
Ähnliche
ANJA JONULEIT
Eine Weihnachtserzählung
Deutscher Taschenbuch Verlag
Originalausgabe 2011© 2011Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, MünchenDas Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
eBook ISBN 978-3-423-41014-4 (epub)ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-21326-4Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de/ebooks
Inhalt
Sami – Es war in ...
Katharina – Es war nicht ...
Sami – Die meiste Zeit ...
Katharina – Als Apothekerin lernte ...
Sami – In dieser Nacht ...
Katharina – Nach einem ausgedehnten ...
Sami – Als sie mich ...
Katharina – Ich beteiligte mich ...
Sami – Im Kinderheim erfuhren ...
Katharina – Schon ein halbes ...
Sami – Mein Eintreten wurde ...
Katharina – »Weißt du überhaupt, ...
Sami – Während der nächsten ...
Katharina – Für Ruth gab ...
Sami – Obgleich ich ein ...
Katharina – Am Sonntag kam ...
Sami – Katharina hatte sich ...
Katharina – »Ich hole dich ...
Sami – Am 21. Dezember ...
Es war in den ersten Novembertagen, als es mich in diesen Teil des Friedhofs verschlug und ich das Grab in der Ecke entdeckte. Es war nicht besonders ungepflegt oder verwahrlost, strahlte keine besondere Traurigkeit oder Wehmut aus, wie alte Gräber das manchmal tun. Es bestand aus nur einer Platte aus grauem Stein, mit Moos und Flechten bedeckt, und Name und Inschrift waren unleserlich. Von einer plötzlichen, unerklärlichen Neugierde erfasst, blieb ich stehen und bückte mich, nahm einen Stein und schabte etwas von dem Moos ab. Nach und nach verdeutlichten sich die Buchstaben, und ich erkannte zwei Jahreszahlen. Ich entfernte ein wenig mehr von der moosigen Schicht, weil ich doch den Namen wissen wollte. Ich kratzte und rieb und schließlich las ich:
Nomina temporis pulvis.
Mein Latein lag verschüttet unter nützlichem und unnützem Wissen von Jahren, und eine Weile lang grübelte ich, doch es gelang mir nicht, |6|den Worten einen Sinn zu geben. Also nahm ich den Stein noch einmal zur Hand und kratzte weiter und legte einen Schriftzug frei, der nicht zu enden schien. Schließlich hatte ich die ganze Platte saubergeschabt, der Schweiß lief mir in dünnen Rinnsalen die Arme hinunter, und mein Hemd klebte am Körper. Auf dem ganzen Grabstein war kein Name zu finden. Stattdessen stand dort:
Namen sind nichts als der Staub der Zeit. Sie markieren einen Weg, dessen einzige bemerkenswerte Ereignisse Abreise und Ankunft sind.
Ich legte den Stein auf die Platte, ganz rechts an den Rand, und erhob mich.
In den nächsten Wochen führten mich meine nachmittäglichen Spaziergänge wieder über den Friedhof, und es war mir zur Gewohnheit geworden, einen Umweg zum Grab jenes Namenlosen zu machen. Ich stellte mir vor, wie es sei, auf der kalten Granitplatte zu liegen, ich fantasierte davon, mir in dunklen Kreisen einen Revolver zu besorgen und dort, auf der Platte, meinen Tod zu inszenieren. Bei der Vorstellung an die Sudelei, die das unweigerlich nach sich zöge, schwenkte ich gedanklich auf Schlaftabletten um. Schlaftabletten und Alkohol, und das in einer bitterkalten Winternacht, das wäre durchaus |7|erwägenswert. Und unter dem Gesichtspunkt der Ästhetik gerade noch vertretbar.
An einem regnerischen Tag Anfang Dezember trieb mich eine Schaffenskrise – ich war zu jener Zeit ein in Expertenkreisen hoch geschätzter, aber leider mittelloser Dichter und verdingte mich als Schreiber von Romanheften – noch vor dem Mittagessen aus dem Haus. Eine gestaltlose Wut über die von mir zu erfüllende Aufgabe erstickte meine Worte und Ideen, und so lief ich durch die Straßen, vor meinen Ängsten davon und hinter der leichten Muse her, bis ich wieder auf dem Friedhof landete.
Die Adventszeit hatte gerade begonnen, und auf den Nachbargräbern lagen Gestecke aus Tannen und Stechpalmen, Efeu und Ligusterbeeren. Flüchtig dachte ich daran, dass ich unabwendbar auf einen einsamen Heiligabend zusteuerte. Seit Jahren schon fühlte ich eine große Leere und Sinnlosigkeit in mir und einzig einer mir eigenen Trägheit schrieb ich den Umstand zu, es bisher noch nicht geschafft zu haben, meinem Leben ein vorzeitiges Ende zu setzen.
Wer meine Eltern waren, wusste ich nicht, und nach einer überwiegend trostlosen Kindheit in verschiedenen Heimen gab es niemanden, dem ich durch einen Suizid eine Last auferlegt hätte. Nein, mein Tod würde keine schmerzliche |8|Lücke in eine Familie reißen, ein Gedanke, der beinahe Bedauern in mir auslöste: Eine Leich’ war schließlich nur dann schön, wenn vor dem Wirtshaus ein paar Leute weinten.
Ich sah ihn vor mir, diesen versprengten Haufen, dieses Grüppchen Vereinzelter, die wie an einer Vororthaltestelle an einem Sonntagnachmittag im Februar am offenen Grab herumstehen würden. Wahrscheinlich würde es nieseln und der Laienprediger, oder wer sonst die Grabrede bei einem Abtrünnigen hielt, würde sich beeilen, zum Ende zu kommen.
Vielleicht waren es aber auch nicht meine Todesphantasien, sondern die Gedanken an das heranrückende Weihnachtsfest, die mich erneut auf den Friedhof getrieben hatten, aber ich konnte eine gewisse hintersinnige Neugier nicht leugnen, die mich von Grabstein zu Grabstein pendeln ließ, die Inschriften und vor allem die Daten inspizierend. Suchte ich doch so etwas wie Ermutigung, einen letzten Ansporn, der mich zum Handeln animieren würde? Letztlich hielt ich schon immer Ausschau nach einem Vorbild. Mit einer gewissen Enttäuschung stellte ich alsbald fest, dass die überwiegende Mehrheit der Friedhofsbewohner seinerzeit deprimierend lange im irdischen Jammertal herumgeirrt war. Vor den wenigen Gräbern derer, deren Wanderung |9|zwischen dem dreißigsten und vierzigsten Geburtstag zu Ende gegangen war, blieb ich stehen und versuchte anhand der Inschriften zu erkennen, ob sie selbst bei ihrem Ableben ein wenig nachgeholfen hatten. Als ich nach einer Weile noch immer keine Antwort gefunden hatte, schob ich meine Gedanken beiseite, wie man einen lästigen und sperrigen Gegenstand in den Keller oder auf den Dachboden räumt, und streifte weiter die Grabreihen entlang, atmete den Duft von nasser Erde und Buchsbaum.
Der Regen war inzwischen durch meine Hosenbeine gedrungen, meine Schuhe quatschten bei jedem Schritt, und ich fror. Doch nach Hause wollte ich auf keinen Fall: Dort wartete nur der leere Computerbildschirm auf mich.
Erst als ich direkt vor dem Grab des Namenlosen stand, bemerkte ich das Glas auf der Platte. Ich kniete nieder, die Stirn in Falten. Es war ein zierliches, geschwungenes Gefäß mit Deckel, und darin lagen ein paar Körner. Mein Blick huschte nach rechts und links, und als ich niemanden entdeckte, griff ich nach dem Gläschen. Ich hob den Deckel, langsam und vorsichtig, ja beinahe ängstlich, als könnte der aus dem Behältnis kriechende Duft mich vergiften. Irritiert über meinen Mangel an Beherztheit und mir plötzlich bewusst, wie sehr ich doch am Leben |10|hing, roch ich daran, erst zögerlich, dann forscher. Vage glaubte ich, mich an etwas zu erinnern, kam aber nicht darauf, was es war. Ich stellte das Gläschen zurück, und da erst fiel mir ein, dass ich doch vor Tagen einen Stein auf der Platte platziert hatte. Ich richtete mich auf, von der Erkenntnis erfüllt, einer Art Irrtum erlegen zu sein. Wenn es einen Menschen gab, der dieses Grab besuchte, warum sorgte er dann nicht dafür, dass die Platte sauber blieb? Auch fühlte ich einen lächerlichen Anflug von Ärger: In den vergangenen Tagen hatte ich dem Ort gegenüber einen irrationalen Besitzanspruch entwickelt. Ich ließ meinen Blick schweifen in der trotzigen Hoffnung, irgendwo den Menschen zu erblicken, der das seltsame Objekt auf das Grab gestellt und meinen Stein fortgenommen hatte. Als sich ringsum niemand ausmachen ließ, suchte ich einen weißen Kieselstein und legte ihn neben das Glas.
Es war nicht gerade so, dass ich mit der Adventszeit besonders selige Kindheitserinnerungen verband. Auch war ich der festen Überzeugung, so etwas wie Weihnachtszauber gebe es nicht mehr.
Bei uns zu Hause waren die Heiligen Abende immer gleich abgelaufen, und stets hatte es Vater so eingerichtet, dass wir spätestens um acht Uhr vor dem Fernseher landeten, ›Tagesschau‹, und darauf sahen wir zu, wie andere Leute Weihnachten feierten. Während Vater seine Bierchen zischte und Mutter eine Orange nach der anderen schälte (hin und wieder knackte sie auch eine Nuss), stopfte ich mich mit Aachener Printen und Nürnberger Lebkuchen voll und sehnte mich nach Weihnachten in Bullerbü. Meist machte ich den Abgang, bevor Vater vor dem Fernseher einschlief und Mutter sich, mit einem Seufzer, erhob, den Fernseher ausstellte und allein ins Bett ging.
Im Grunde genommen war ich der festen Überzeugung, dass es diese Heiligen Abende |12|gewesen waren, die Mutter letztendlich dazu bewogen hatten, sich noch einmal aufzumachen, weil doch gewissermaßen alle damals unterwegs waren: Josef und Maria, die Hirten und die Heiligen Drei Könige. Vielleicht dachte sie, es könnte sich lohnen, noch ein wenig mehr zu sehen in diesem Leben.
Als sich abzeichnete, dass ich mein Abitur bestehen würde, verkündete sie, dass sie den LKW-Führerschein