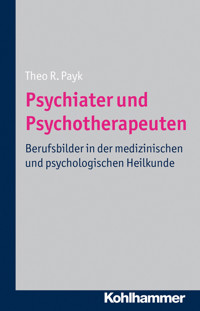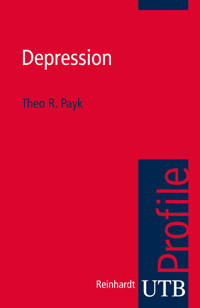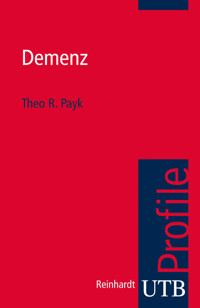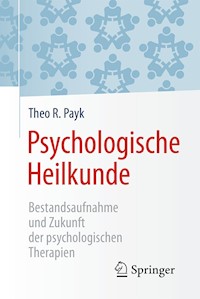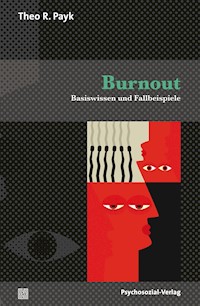13,99 €
13,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In Frieden und ohne Angst sterben.
Viele Menschen fürchten sich vor Verfall, Krankheit und einsamem Sterben. Wen wundert es, wenn daher zurzeit erregt über verschiedene Formen der aktiven und passiven Sterbehilfe diskutiert wird. Der erfahrene Psychiater Theo R. Payk stellt sich diesen Fragen. Entschieden plädiert er dafür, dass alle Menschen das Recht haben, in Frieden und ohne sozialen Druck zu sterben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2009
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 - Vorwort
Kapitel 2 - Bestandsaufnahme
Lebensrecht
Ökonomie
Copyright
1
Vorwort
... Die Beendigung zahlloser in Wechselbeziehung stehender neuraler und biochemischer Austauschprozesse suggerieren dem bloßen Auge die Illusion eines erloschenen Funkens oder das schlichte Entweichen eines einzigen notwendigen Elements. Wie wissenschaftlich unterrichtet wir uns auch wähnen, in der Gegenwart von Toten werden wir immer noch von Furcht und Ehrfurcht überwältigt. Vielleicht ist es recht eigentlich das Leben, über das wir uns verwundern.
(Ian McEwan: »Liebeswahn«)
Den meisten Menschen graut vor der Vorstellung, das Lebensende - gekennzeichnet von Verfall und Siechtum - in einem tristen Altenheim oder auf einer unruhigen Intensivstation erleiden zu müssen, womöglich verkabelt und mittels Sonden oder Schläuchen künstlich am Leben gehalten. Nicht weniger unerträglich scheint der unaufhaltsame Verlust geistig-seelischer Teilnahme am Leben zu sein, wie etwa bei einer fortschreitenden Demenzerkrankung, erst recht eine auf bloße vegetative Funktionen reduzierte Existenz im Wachkoma. Jahre- und jahrzehntelange Pflegebedürftigkeit, z.B. bei einer kompletten Lähmung, fordert dem Betroffenen und seinen Angehörigen ein ungeheures Maß an Kraft und Belastbarkeit ab.
Es wäre in der Tat Ausdruck von Herzensträgheit und Gleichgültigkeit, gegenüber dem Elend blind und taub zu sein, das Krankheit und Leiden über die Menschen bringen kann. Große Resonanz fand daher erwartungsgemäß der mehrfach preisgekrönte, 2004 unter der Regie von Alejandro Amenábar gedrehte, spanisch-italienische Spielfilm »Das Meer in mir« (Original: »Mar adentro«). In ihm wird - unter Bezug auf einen authentischen Fall aus dem Jahr 1998 - in bewegenden Bildern das selbstbestimmte Lebensende eines seit 27 Jahren ab dem Hals komplett querschnittsgelähmten, 50-jährigen Mannes dargestellt. Die Hauptfigur Ramón trinkt gelassen im Kreise seiner Freunde und Verwandten das todbringende Zyankali, um sich aus dem Gefängnis seines Körpers endgültig zu befreien.
Umfragen zufolge schätzt fast die Hälfte der Deutschen die Situation Sterbender als quälend und unwürdig ein, und ein Drittel kann sich angeblich mit dem Gedanken an irgendeine Art von Sterbeunterstützung anfreunden. Laut einer Befragung von 1786 Personen ab 16 Jahren im Juli 2008 durch das Allensbacher »Institut für Demoskopie« bejahten 58% aktive Sterbehilfe bei unheilbar Schwerkranken, 19% waren dagegen, 23% unentschieden. Passive Sterbehilfe befürworteten sogar 72%, während 11 bzw. 17% ablehnend bzw. ohne Meinung waren.
Ein ähnliches Bild lieferte das Institut »Erforschung der öffentlichen Meinung, Marktforschung, Nachrichten, Information und Dienstleistungen« (EMNID) nach Befragung von 1000 Bürgern zum selben Zeitpunkt. Derzufolge votierten 55% für eine freie Entscheidung, und 87% sprachen sich gegen das derzeitige Verbot aktiver Sterbehilfe in Deutschland aus. Eine nähere Analyse der Ergebnisse erbrachte allerdings zugleich das nachdenklich stimmende Fazit, dass die Befürwortung aktiver Sterbehilfe umso größer war, je weniger Kenntnisse über den Sinn und Zweck von Palliativmedizin und Hospizpflege vorhanden waren. Waren die Möglichkeiten heutiger Schmerzbekämpfung, Pflege und Betreuung Schwerst- und Todkranker bekannt, stimmte nur noch ein Drittel aktiver Sterbehilfe zu.
Von den im Jahr 2008 etwa 844.000 Verstorbenen erlebte allenfalls ein Zehntel das Ende in vertrauter häuslicher Umgebung. Die allermeisten versterben in der meist unpersönlichsachlichen Atmosphäre eines Krankenhauses oder Pflegeheims, oft auf geschäftigen Intensivstationen, bisweilen in der trostlosen Umgebung eines Sterbezimmers. Noch vor 100 Jahren verhielt es sich umgekehrt: Mehr als 90% der Todkranken verblieben bis zuletzt im Kreis der Familie. Angesichts dieser Gepflogenheiten, die sich in den europäischen Ländern angleichen, ist der Wunsch nach einem möglichst friedlichen und schmerzfreien Abschiednehmen von dieser Welt vollauf verständlich, eingeschlossen der nach stillem Beistand und persönlicher Hilfe in der unabänderlich letzten Lebensphase, einer existenziellen menschlichen Grenzsituation, aus der kein Weg mehr zurückführt.
Spiegelt dieser Trend eine schleichende Entsolidarisierung unserer Gesellschaft wider? Es hat jedenfalls den Anschein, als würde sich die zunehmend beklagte Abnahme sozialer Eigenschaften wie Mitgefühl, Anteilnahme, Hilfsbereitschaft, Geduld und Verlässlichkeit auch in einer Verarmung von Fürsorge und Pflege für die Fußkranken der Gesellschaft bemerkbar machen. Die derzeit staatlich gewährten Hilfen und Stützen, die ohnehin in Zeiten von Kosteneinsparungen und finanzieller Knappheit als erste zur Disposition gestellt würden, dürfen nicht über eine Mentalität hinwegtäuschen, die keineswegs von Engagement für Mitmenschlichkeit und Gemeinwohl geleitet wird, sondern eher von Ichbezogenheit und Durchsetzungsvermögen. Das biblische Gleichnis vom Barmherzigen Samariter (Lk 10,30-37), der sich auf dem Weg nach Jericho um einen Schwerverletzten kümmerte und in eine Herberge brachte, passt nicht in die glitzernde, leistungsfixierte und spaßorientierte Vorstellungswelt des modernen Menschen. Auf der anderen Seite sind in unserem geschäftigen Streben nach Anerkennung und Beifall, nach Erfolg und Bewunderung Alter, Gebrechlichkeit, Behinderung, Krankheit und Tod als Stigmata des Versagens und der Niederlage ohnehin unwillkommene Negativposten. Die bisweilen etwas aufgesetzt wirkende Munterkeit der Senioraktivisten täuscht; sie bildet nur oberflächlich einen Aspekt des Älterwerdens ab, das ja zwangsläufig früher oder später mit einem Nachlassen der geistigen und körperlichen Kräfte einhergeht, manchmal sogar infolge eines Verlustes an Alltagskompetenz mit drastischen Einschnitten in die vertrauten Lebensgewohnheiten.
Die fortschreitende Ausgrenzung von Verfall und Tod aus dem Alltag leistet einer Entwicklung Vorschub, die sich auch in gesetzlichen Regelungen zur Legalisierung der Euthanasie auskristallisieren könnte. Möglicherweise ist darin die Botschaft enthalten, doch den »Leistungsträgern« nicht im Weg zu stehen, Platz zu machen, sich aus dem Leben zu verabschieden, um anderen nicht zur Last zu fallen, kurzum: keine Ansprüche mehr zu stellen und endlich zu verschwinden.
Vielleicht sind Mitleidsbekundungen in erster Linie nicht Zeichen einer echten Teilnahme an der Lebenssituation eines Leidenden und Sterbenden, sondern in Wirklichkeit Ausdruck eigenen Unbehagens, ja der Unfähigkeit, das Ringen eines Menschen mit dem Tod mit anzusehen und erleben zu müssen. Selbst von Pflegepersonal und Ärzten wie auch anderen Menschen in sozialen Berufen ist bekannt, dass sie nach anfänglichem Engagement in einen Zustand von »Ausgebranntsein« (»Burn-out«) geraten können, einem sich allmählich einstellenden Gefühl innerer Leere, Depressivität, Frustration und Gleichgültigkeit. Dies kann im Einzelfall dazu führen, Selbsttötungsgedanken ihrer Pfleglinge gegenüber gleichgültig zu werden oder gar bei einer beabsichtigten Lebensbeendigung Hilfestellung zu leisten oder sogar - ungefragt und widerrechtlich - selbst Hand anzulegen.
Vor diesem Hintergrund ist die derzeit wieder besonders ins öffentliche Rampenlicht geratene Diskussion über das Für und Wider der Euthanasie im Sinne einer »Sterbehilfe« als beabsichtigte Beendigung des Lebens zu bewerten, die inzwischen in Deutschland und anderen europäischen Ländern Bürger und Politik stark beschäftigt.
Die Vertreter aktiver Sterbehilfe streben eine Entkriminalisierung der bislang in den meisten Staaten Europas nicht zulässigen Euthanasie an und sprechen sich für deren Legalisierung nach holländischem Vorbild aus. Eine gesetzliche Regelung soll Missbrauch verhindern, beispielsweise dahingehend, dass aus allgemein-ökonomischen Erwägungen oder spezifischen persönlichen Interessen Menschen getötet werden, die sich dazu selbst nicht geäußert haben oder sogar damit nicht einverstanden wären. Dabei soll sichergestellt werden, dass als Tötungsanlass tatsächlich eine zweifelsfrei schwere, zum Tod führende Krankheit belegt ist, der Sterbewille des Betroffenen respektiert wird und keine psychischen Störungen vorliegen, welche die Urteils- und Testierfähigkeit beeinträchtigen könnten.
Die Sterbehilfebefürworter berufen sich zum einen auf das Grundrecht eines jeden Menschen, nicht nur über seine Lebensgestaltung, sondern auch sein Sterben selbst bestimmen zu können. Sie verweisen in diesem Zusammenhang auf den verfassungsrechtlich höchstrangig im Artikel 1, Abs. 1 des Grundgesetzes kodifizierten Schutz der Würde des Menschen, wozu die freie Entscheidung gehöre, Umstände, Zeitpunkt und Art und Weise des eigenen Todes selbst festzulegen, ohne dass dies moralisch bewertet oder juristisch geahndet würde. Zum anderen verweisen sie auf die humanitäre Pflicht zu jeglicher Hilfestellung bei unerträglichem Leid, auch um den Preis einer Lebensbeendigung. Innerhalb eines engen Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Krankem dürfe nicht eine Situation entstehen, in der unerträgliches Leid sinnlos um jeden Preis verlängert wird.
Ein prominentes Beispiel hierfür wäre die Sterbehilfe, die Max Schur seinem berühmtesten Patienten Sigmund Freud im Jahr 1939 leistete. Schur, als langjähriger Hausarzt enger Vertrauter Freuds, kam - wie mit ihm abgesprochen - dessen Wunsch nach, ihn mit einer erhöhten Morphiumdosis über die Schwelle des Todes zu geleiten, wenn seine Schmerzen unerträglich würden. Freud, der 83-jährig im Londoner Exil verstarb, litt seit Jahrzehnten an einem sich ausbreitenden, sehr schmerzhaften Mund- und Gaumenkrebs. Ähnlich verhielt es sich wohl bei dem 80-jährigen Thomas Mann, der 1955 im Kantonsspital Zürich nach mehreren Morphininjektionen entschlief. Er war zuvor erfolglos wegen einer Beinthrombose, inneren Blutungen und einer fortgeschrittenen Arteriosklerose behandelt worden.
Es ist davon auszugehen, dass dieserart - gleichermaßen fachliche wie menschliche - Beistand mit Einverständnis aller Beteiligten keine seltene Ausnahme darstellt, sondern ohne viel Aufhebens im Alltag praktiziert wird. Er beruht auf einem engen Vertrauensverhältnis, dessen Intimität nicht durch gesetzliche Sanktionen beschädigt werden sollte.
Gegner der aktiven Sterbehilfe warnen demgegenüber unter Verweis auf die staatlich organisierte Nazi-Euthanasie vor der Gefahr einer aus persönlichen, ideologischen oder sozioökonomischen Gründen betriebenen Absenkung der Hemmschwelle gegenüber angeblich »gerechtfertigten« Tötungen. Außerdem sollten die Potenziale einer palliativ-medizinischen, psychologischen und psychosozialen Sterbebegleitung ohne Beschleunigung des Sterbens nachdrücklicher gefördert und intensiver genutzt werden.
Die emotionsgeleiteten und ideologisch aufgeladenen kontroversen Auseinandersetzungen, unterfüttert mit interpretationsbedürftigen Meinungsumfragen, verschleiern bisweilen die Unklarheiten und Informationsmängel bezüglich der tatsächlichen rechtlichen, ethischen, psychosozialen und psychologischen situativen Verhältnisse schwer kranker und sterbender Menschen. Der in Deutschland verständlicherweise belastete Begriff »Euthanasie« scheint zudem eher zu einer Vorurteilsbildung beizutragen, als dass er der Versachlichung dient.
Unter Reflexion der kulturgeschichtlichen Einflüsse sowie Berücksichtigung der gegenwärtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen und gesellschaftspolitischen Blickrichtungen wird nachfolgend eine Bestandsaufnahme der diesbezüglichen aktuellen, nationalen und internationalen Erwartungen, Gepflogenheiten und Erfahrungen vorgenommen. Im Mittelpunkt steht dabei eine Darstellung der gegensätzlichen Positionen »Sterbehilfe« versus »Sterbebegleitung« mit den jeweils unterschiedlichen Konsequenzen, deren Spektrum sich von der geplanten und organisierten Tötung bis zum natürlichen Ausklingen des Lebens in einer beschützenden und versorgenden Umgebung erstreckt. In diesem Zusammenhang werden die jeweiligen Besonderheiten der entsprechenden Instrumente und Einrichtungen - Sterbehilfeorganisationen auf der einen und palliativmedizinische Abteilungen bzw. Hospizarbeit auf der anderen Seite - näher beschrieben.
Besonderes Augenmerk gilt schließlich dem individuellen Recht auf Selbstbestimmung mit dem Anspruch auf Respektierung der freien Willensbekundung bezüglich eigener Behandlungswünsche am Lebensende, insbesondere der Bedeutung und Tragweite von Patientenverfügungen, Bevollmächtigungen und Betreuungseinrichtungen. Trotz aller Umsicht kann es allerdings keine verlässliche, alles regelnde Vorsorge geben, weil Lebensumstände, Empfindungen und Erwartungen während der letzten Tage und Stunden des Lebens nicht vorhersehbar und noch weniger kalkulierbar sind. Sterben lässt sich nicht normieren. Das Leben selbst bedarf als einzigartiges, zu bestaunendes Geheimnis und zu bewältigende Aufgabe uneingeschränkter Wertschätzung und Fürsorge.
Der genannte Bereich »Euthanasie« berührt noch andere Themenkreise wie beispielsweise den Suizid oder den Opfertod, seit jeher anthropologisch-philosophische und gesellschaftspolitische Gegenstände, die immer wieder ins Blickfeld geraten. Es erschien daher nützlich, im Folgenden auch auf diese ethischen Konfliktpotenziale einzugehen.
2
Bestandsaufnahme
Die höchstrangige Achtung des Lebens stellt eine exklusive Leistung menschlicher Zivilisation und Kultur dar. Sie hat ihren Ursprung in der Balance zwischen dem zur Selbstbehauptung und Fortpflanzung unerlässlichen Aggressionspotenzial höher entwickelter Lebewesen und der im Laufe der Evolution genetisch einprogrammierten Tötungsblockade gegenüber Artverwandten. Diese für das Zusammenleben der Gemeinschaft unentbehrliche soziale Errungenschaft wurde spätestens seit den babylonischen und ägyptischen Hochkulturen als gesetzliches Tötungsverbot sanktioniert. Am bekanntesten wurde das Diktum »Du sollst nicht töten« als 5. Gebot im Dekalog, dem Eckpfeiler aller abendländischen, jüdisch-christlich-humanistisch ausgerichteten Verfassungen (Ex 20,13). Selbst Tieren ist - bis auf wenige Ausnahmen - das Töten außer zur Arterhaltung und Reviersicherung fremd.
Das Recht auf Leben wurde neben den Freiheitsrechten zum zivilisatorischen Dreh- und Angelpunkt der Völkerfamilien. In einem weltweiten ethischen Konsens gibt es - jenseits aller Staatsformen, Weltanschauungen und Konfessionen - die Auffassung von der Unantastbarkeit des menschlichen Lebens als einer Art Naturrecht. Die von der UNO repräsentierte Staatengemeinschaft hat im Jahr 1948 klar und deutlich das elementare Recht auf Leben, Würde und Freiheit als unveräußerlichen und unverhandelbaren Anspruch aller Menschen deklariert.
Wie in anderen modernen Gesellschaften ist es als eines der Grundrechte auch in Deutschland in Artikel 2 des Grundgesetzes verankert.
Dessen ungeachtet wurde das evolutionsbiologisch verwurzelte und kulturgeschichtlich geschützte Tötungstabu bis auf den heutigen Tag immer wieder missachtet oder gar konterkariert, nicht nur - den Gesetzen der Natur folgend - zum Selbsterhalt. Der Hominide musste töten, um sein Überleben zu sichern und sich und seine Artgenossen zu verteidigen. Er lernte, zwischen der Bedeutung der eigenen Sippe und dem »Unwert« anderer zu unterscheiden. Hand in Hand mit der Befreiung aus der Maschinerie von Reflexen und Instinkten entwickelten sich Fähigkeiten und Fertigkeiten, die den angeborenen, zweckgerichteten Aggressionsimpulsen neue Ziele eröffneten, einhergehend mit vielseitigen, kreativen Eigenschaften und praktischen Erfahrungen. Der Frühmensch tötete bald aus Besitzansprüchen und Habgier, Machtbedürfnis und Dominanzstreben, Hass und Rivalität. Schon in jungsteinzeitlichen Höhlenzeichnungen lassen sich Darstellungen gewaltsamen Tötens nachweisen, und selbst an den paläontologischen Skeletten von Frauen und Kindern sind Spuren tödlicher Hiebund Schlagverletzungen erkennbar.
Homo sapiens, der sozialisierte Mensch, tötete fortan und tötet weiterhin seinesgleichen aus unzähligen Gründen - ebenso zur eigenen Befriedigung wie im Namen der Gottheit, der Gerechtigkeit, aus verletzter Ehre oder aus Rache. Er beruft sich dabei auf seinen Glauben, auf seinen Stolz, auf seine Pflicht, bisweilen auch auf tatsächliches oder vermeintliches Mitleid. Zum anderen wurde (und wird) er mit dem Tode bestraft für Ketzerei und Aberglauben, Ungehorsam und Fahnenflucht, sogar Diebstahl und Untreue, ja für ein paar Quadratmeter Land oder eine falsche Gesinnung.
Je nach Zivilisation und Zeitgeist, Kultur und Menschenbild, Religion und Weltanschauung, Gesetzgebung und ethischen Normen wurde und wird das gleiche Handeln einmal unter Strafe gestellt, ein anderes Mal nicht nur geduldet, sondern sogar gutgeheißen bis hin zur Ausrottung ganzer Völker. Die moralische Lizenz zum Töten liefern bedarfsweise Überlieferungen, Einstellungen und Gepflogenheiten der jeweiligen Gesellschaft, zu denen auch - wie oben erwähnt - tatsächliche oder vorgegebene Barmherzigkeit und Humanität zählen. Mit sophistischer Begründungsakrobatik wird auf der einen Seite abgesegnet, was auf der anderen geahndet wird; es gibt den Kriegsgott und die Friedensgöttin, den »Heiligen Krieg« auf der einen Seite und die todeswürdigen Frevelhaftigkeiten der »Ungläubigen« auf der anderen. Die Deutungshoheit über Billigung oder Missbilligung des Tötens scheint mitbestimmt von Rang und Macht derer, die das Leben anderer auslöschen oder per Dekret auslöschen lassen.
Die philosophisch-theologischen Antworten auf kritische Fragen nach derlei Widersprüchlichkeiten verlieren sich im Verweis auf die Unzulänglichkeit der »conditio humana«, die stete Fehlerhaftigkeit menschlichen Denkens und menschlichen Handelns. Nach christlicher Auffassung ist der sündige Mensch stets dem teuflischen Einwirken des »Bösen« ausgeliefert, seitdem Stammvater Adam sich im Paradies dazu anstiften ließ, gegen Gottes Gebot zu verstoßen.
Lebensrecht
Ein Tötungsdelikt ist rechtsphilosophisch im Spektrum einer Mordtat als Verbrechen aus »Heimtücke oder niedrigen Beweggründen« auf der einen Seite und einer barmherzigen »Erlösung« von Qual und Schmerz im Sinne einer Sterbehilfe auf der anderen Seite angesiedelt.
In den meisten Zivilgesellschaften wird Mord mit hohen Strafen, sogar mit dem Tod, geahndet, Totschlag weniger hart. Notwehr bleibt in der Regel straffrei. Bei psychisch gestörten Tätern wird deren Schuldfähigkeit überprüft. Über die strafrechtliche Positionierung der Sterbehilfe wird - wie wir sehen werden - derzeit lebhaft debattiert.
Die Erforschung von Sterben und Tod - Thanatologie genannt - richtet sich auf Einstellung und Verhalten von Individuum und Gesellschaft zu Sterben und Tod. Hierzu gibt es sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen. Beispielsweise waren im Mittelalter des christlichen Europas Sünde, Sterben und Höllenstrafe eng miteinander verknüpft, weswegen im diesseitigen, ohnehin kurzen und mühevollen Leben Reue und Buße eine große Rolle zur Vorbereitung auf das göttliche Strafgericht nach dem Tode spielten. Mildtätigkeit, Spenden und Stiftungen gehörten üblicherweise zu den letzten Versuchen, beim »Dies irae« im Jenseits noch einige gute Taten auf die Waagschale legen zu können, um der ewigen Verdammnis zu entgehen. Das Ideal war ein gefasstes Abschiednehmen »zur rechten Zeit«, mythisch überhöht als »Kunst des Sterbens« (»Ars bene moriendi«), als ein Hinscheiden im Einklang mit sich selbst, im Frieden mit der Welt und in demütiger Erwartung göttlicher Gnade. Selbst ehemals grausame Despoten, gottlose Frevler und Räuber wurden - damals wie heute - im Angesicht des Todes zu bußfertigen Wohltätern.
Vor allem im Gefolge der wiederholten Pestepidemien, die bis Ende 1351 mehr als ein Drittel der europäischen Bevölkerung dahinrafften, fanden zahlreiche einstimmende Traktate und Büchlein über ein »gutes Sterben« großen Anklang. Eindringliche bildhafte Darstellungen des stets unter den Menschen weilenden Sensenmannes als »Totentanz« verbreiteten sich zu Beginn des 15. Jahrhunderts über ganz Europa. Gefürchtet war der allgegenwärtige, rasche Tod, der keine Zeit zu einer Vorbereitung, zum Empfang der Sterbesakramente und einem Ablassgebet ließ. Die Lebensdauer zu jener Zeit war ohnehin kurz: Im 14. Jahrhundert lag die durchschnittliche Lebenserwartung für eine Frau um 25, für einen Mann um 30 Jahre.
Erst mit dem Ende der Renaissance und dem Beginn des Barocks, vor allem jedoch mit der Epoche der Aufklärung gerieten die Höllenängste mehr und mehr in den Hintergrund, da auch der Tod säkularisiert wurde. Er bedeutete zwar die Auflösung zwischenmenschlicher Bindungen und das Ende diesseitiger Daseinsfreude, jedoch wurde das Damoklesschwert womöglich drohender Verurteilung im Jenseits durch eher romantisch verklärte Auffassungen von einem Wiedersehen im Himmel entschärft (siehe Kapitel »Wert des Lebens«). Beisetzung und Leichenfeier wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts zunehmend beruflichen Experten übertragen, verloren aber auch gleichzeitig an Nachhaltigkeit und wurden der öffentlichen Aufmerksamkeit entzogen, zumindest sprachlich verschleiert und beschönigt. Waren noch im 17. und 18. Jahrhundert stundenlange Leichenpredigten und tagelange Begräbnisfeierlichkeiten üblich, wurden später Todesthematik und Trauerkultur mehr und mehr in den Alltag integriert, ausgenommen die Auswirkungen des verheerenden Massensterbens in den Weltkriegen, die in der Gesellschaft schon durch die Fülle an Sterbeanzeigen und Nachrufen zwangsläufig präsent waren. Im Übrigen wurde das Sterbenmüssen umso mehr ausgeblendet, je wirksamer die enormen Fortschritte der Medizin ab dem 19. Jahrhundert Krankheiten beherrschbar machten und heute sogar Fantasien in Richtung einer womöglich unbegrenzten Verlängerung des Lebens beflügeln.
Leben und Tod als dessen zwangsläufiger Ausgang sind unauflöslich miteinander verbunden. Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, wie wenig seit dem 20. Jahrhundert das Lebensende - neben der Geburt der andere unkorrigierbare Markierungspunkt menschlicher Existenz - im Alltag des abendländisch enkulturierten Menschen reflektiert wird. Vermutlich sind zum einen das ebenso sinnlose wie grausame Massensterben in den beiden Weltkriegen, Holocaust und Genozide mit Abermillionen von Toten, nicht rational zu bewältigen und werden aus dem Bewusstsein abgespalten, gar aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht. Zum anderen scheint den Protagonisten der postmodernen, ebenso rastlosen wie ichbezogenen Konsum- und Spaßgesellschaft allem Anschein nach das Sterben an den äußersten Rand ihres Horizonts geraten oder gänzlich aus dem Gesichtskreis entschwunden zu sein. Dass alles Empfinden und Handeln, Erleben und Schaffen, Glück und Leid letzten Endes nur eine mehr oder weniger flüchtige Episode gewesen sein könnte, ist mit den propagierten Lebensattributen wie Gesundheit und Jugend, Schönheit und Erfolg, Leistungsfähigkeit und Ansehen, Präsenz und Mobilität nur schwer vereinbar.
Sicherlich ist es angesichts einer mehr oder weniger unbefangenen, auf die aktuellen Probleme und Aufgaben des Alltags gerichteten, kreativen Lebensgestaltung weder sinnvoll noch erstrebenswert, in Sack und Asche zu gehen. Sich ständig Gedanken über Unheil, Krankheit und Tod zu machen, wäre lähmend und lebenshinderlich. Der Hypochonder, stets eine schwere Krankheit oder gar den nahen Tod vor Augen, ist bereits gestorben, ehe er überhaupt richtig gelebt hat. Hypochondrie kann im Übrigen - über eine belächelte Marotte weit hinausgehend - Ausdruck einer quälenden Angstkrankheit im Sinne einer sogenannten Herzphobie sein, die durch panikartige Attacken von Todes- und Vernichtungsangst gekennzeichnet ist. Hier lebt der Betroffene in ständiger Angst vor einem plötzlichen Herztod, die ihm den Aufenthalt außerhalb der Reichweite von Arztpraxen oder Krankenhäusern verleidet.
Das tiefe Unbehagen bei dem Gedanken an den endgültigen Abschied ist trotz aller Ablenkungsmanöver, Tabuisierungen und Verdrängungen nicht aus der Welt geräumt. Auch wer an ein Fortleben nach dem Tode glaubt, fürchtet sich vor dem ungewissen Fortgang, vor der unbekannten Sphäre, aus der noch nie jemand zurückgekehrt ist. Die kreatürliche Angst vor dem Sterben wird bedrückender und lähmender mit der wachsenden Anonymisierung und Vereinsamung vieler Menschen. In den westlichen Kulturen beenden die allermeisten nicht mehr im Kreis der Familie ihr Leben und werden zu Hause aufgebahrt, sondern in der unpersönlichen Atmosphäre eines Krankenhauses oder Heims, ganz zu schweigen von dem elendigen Ende durch einen Unfall auf der Straße, eine Granate an der Kriegsfront oder eine Bombenexplosion mitten in der Stadt. Am Sterbebett wacht nicht mehr schweigend der Todesengel, sondern eine blinkende Apparatur, deren wachsame, aber seelenlose Elektronik vortäuscht, man habe alles unter Kontrolle.
Zur Verdrängung des Todes tragen zudem sprachliche Verschleierungen und Beschönigungen bei: Der Zustand sei unverändert ernst, aber stabil; es gebe keine Zeichen einer Verschlechterung, heißt es beispielsweise in ärztlichen Verlautbarungen. Sie suchen den unaufhaltsamen Sterbeprozess und die Unausweichlichkeit des Verlöschens schonend zu umschreiben. Der Todgeweihte selbst gerät hierdurch in einen Zwiespalt von Akzeptanz seines Sterbenmüssens einerseits und von aufs Weiterleben ausgerichteten Hoffnungen andererseits, die ihm ein Loslassen in Frieden erschweren. Für eine angemessene Sterbekultur, ein würdiges Abschiednehmen am Lebensende bleibt nur wenig Raum.
Im deutschen Grundgesetz werden an erster Position Achtung und Schutz der Menschenwürde hervorgehoben (Art. 1). Dies schließt - wie erwähnt - die besondere Wertschätzung menschlichen Lebens ein, ohne das es keine Würde und keine Freiheit, keine Entfaltung und keine Entwicklung gibt. Die Unantastbarkeit des Rechtsguts »Leben« ist daher hochrangig strafbewehrt, Mord, Totschlag und Körperverletzungen werden - mit Ausnahme der Notwehr- und Kriegshandlung - als schwere und schwerste verbrecherische Handlungen bestraft. Bereits in den frühen Kulturen waren die meisten Tötungsdelikte tabuisiert und wurden streng geahndet, oft mit der Hinrichtung des Täters; Evolutionsbiologie, Kultur und Moral haben hier dieselbe Zielrichtung, nämlich den Erhalt und Schutz des Lebens.
Es gibt indes keine Garantie dafür, dass dieses Grundrecht immer und überall respektiert wird. Eher lehrt die Geschichte der Menschheit das Gegenteil: Stets wurde (und wird) das Leben anderer - wie eingangs beschrieben - mit unterschiedlichsten Begründungen beendet, zu ihnen gehören ebenso die Erlösungsidee (»Gnadentod«) aus dem Repertoire der Euthanasie wie die Berufung auf den Respekt vor der menschlichen Autonomie zur Begründung der Tötungshilfe bei einer lebensmüden Person.
Nicht zu leugnen ist, dass der Wert eines Menschen vom Sinnen und Trachten des Gegenübers bestimmt wird. Schon der Sklavenhandel zeigte, dass der Kaufpreis für einen Menschen beispielsweise an dessen sozialem Nutzen oder der individuellen Leistungsfähigkeit festgemacht wurde oder einfach nur am Aussehen, an der Fitness, Ausdauer, Kraft, sexuellen Attraktivität oder Reproduktionsfreude des Verkaufsobjektes. Längst werden Menschenleben von Zivilgerichten und Assekuranzen in Euro und Cent taxiert, wobei Gesundheitszustand, Lebensalter und Einkommen als wichtigste Parameter gelten.
Ökonomie
Nach Bekanntwerden der Massentötungen psychisch Kranker und des rassistischen Völkermords an den Juden während der Nazizeit wurde in Deutschland über 30 Jahre lang das Thema »Sterbehilfe« in der öffentlichen Debatte gemieden. Im Zusammenhang mit den großen Fortschritten bezüglich der Intensivund Transplantationsmedizin kam es während der 1970/1980er-Jahre wieder ins Gespräch. Der unbefangenere Umgang mit diesem Problem in den europäischen Nachbarländern, vor allem in den Niederlanden, trug ebenfalls zur Wiederbelebung der Euthanasiediskussion bei.
Hintergründig spielten wohl auch Fragen nach der sozioökonomischen Belastbarkeit unseres Gemeinwesens dabei eine Rolle. Die Sterbehilfedebatte ist nämlich nicht frei von unterschwelligen, längst überwunden geglaubten Ideen einer Sozialeuthanasie, einer Art »Gnadentod« aus Kostengründen. Sie entspringen der Vorstellung, dass lebensverlängernde Maßnahmen ohne Einbußen an Lebensqualität für die gesamte Bevölkerung nicht auf Dauer bezahlbar sein werden.
In der Tat hat sich in den westlichen Industriestaaten und Schwellenländern aufgrund zunehmender Lebenserwartung die Relation zwischen den jüngeren, nachrückenden Bevölkerungsanteilen zu den älteren Personengruppen erheblich verschoben - ein heute in Westeuropa geborenes Mädchen kann mit einem Alter von voraussichtlich mindestens 83 Jahren rechnen. Immer mehr ältere müssen durch immer weniger jüngere Menschen über die Gesundheits- und Rentenkassen alimentiert werden; die üblicherweise sich nach oben verjüngende Bevölkerungspyramide ist von der Basis auf die Spitze gedreht worden.
Es ist davon auszugehen, dass diese seit Jahrzehnten immer deutlicher werdende Entwicklung mit einschneidenden Korrekturen der bisherigen Ressourcenverteilung im Bereich von Krankheits- und Pflegeaufwendungen verbunden sein wird. Inzwischen verursachen Patienten über 65 Jahre fast die Hälfte der Ausgaben im Gesundheitswesen, wobei in Deutschland seit 2002 allein für diese Bevölkerungsgruppe bislang eine jährliche Steigerung von zuletzt 7,8 Milliarden Euro zu verzeichnen war bei einem Gesamtetat von ca. 253 Milliarden Euro im Jahr 2007. Der hauptsächliche Grund für diesen altersbedingten Anstieg ist die intensivere Inanspruchnahme medizinischer und pflegerischer Leistungen mit dem Älterwerden, wobei während des letzten Lebensjahres im Durchschnitt die höchsten Kosten anfallen. Insbesondere die aufwendige Pflege mehrfach chronisch (multimorbider) und Demenzkranker wird insofern drastisch zu Buche schlagen, als sich die Zahl solcher Alterspatienten - in Deutschland jetzt mindestens 1,5 Millionen, wovon die meisten an einer Demenz leiden - voraussichtlich während der nächsten 50 Jahre verdoppeln wird. Schon jetzt kostet allein die Behandlung dementer Patienten jährlich etwa 15 bis 20 Milliarden Euro. Hoch sind auch die Aufwendungen für eine Intensivbetreuung, etwa von Komapatienten, die mit jährlich rund 500.000 Euro pro Pflegefall zu veranschlagen sind.
Eine auf Komfort und Luxus ausgerichtete Gesellschaft wie die deutsche wird sich bei der Frage nach einer ausgewogenen Verteilung ihrer Reichtümer entscheiden müssen, wie viel ihr Gesundheit und angemessenes soziales Auskommen für alle wert sind. Lebensverlängerung und Lebensqualität von Menschen sollten freilich nicht vorrangig unter wirtschaftlichen Aspekten
Copyright © 2009 Kösel-Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlagmotiv: Johner Images/gettyimages
Lektorat: Silke Uhlemann, München
eISBN : 978-3-641-03671-7
Weitere Informationen zu diesem Buch und unserem gesamten lieferbaren Programm finden Sie unter www.koesel.de
Leseprobe
www.randomhouse.de