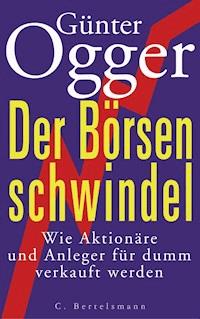
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Zufall oder Absicht? Erst boomt die Börse, dann stürzt sie ab. Erst verspricht man den Anlegern hohe Gewinne, dann überlässt man ihnen die Verluste. Günter Ogger nimmt das Phänomen »Börse« unter die Lupe: Wie funktioniert das Geschäft mit den Aktien wirklich? Oggers Schwarzbuch Börse entlarvt die Tricks und Winkelzüge der Banker und Broker - und zeigt, wie man im riskanten Börsen-Spiel ums Geld dennoch gewinnen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2001
Ähnliche
Günter Ogger
Der Börsenschwindel
Wie Aktionäre und Anleger abkassiert werden
Copyright
eBook zur vollständigen Taschenbuchausgabe Mai 2002, Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
PeP eBooks erscheinen in der Verlagsgruppe Random House
Copyright © 2001 der Originalausgabe C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Design Team München
ISBN 3-89480-666-4
www.pep-ebooks.de
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur aktualisierten Taschenbuchausgabe1 | Profis & Amateure2 | Fiebrige & Verarschte3 | Mächtige & Ohnmächtige4 | Trickser & Täuscher5 | Aufseher & Insider6 | Makler & Manipulateure7 | Herrscher & Knechte8 | Reichrechner & Armmacher9 | Artisten & Bruchpiloten10 | Cold Calls & Old Tricks11 | Kurspfleger & Bilanzfälscher12 | Möchtegerne & Milliardäre13 | Aufgeblasen & abgesoffen14 | Bubble & Crash15 | Sparer & SpielerGlossarLiteraturverzeichnisFirmenregisterSachregisterPersonenregisterÜber das BuchÜber den AutorCopyright
Vorwort zur aktualisierten Taschenbuchausgabe
Rund 900 Milliarden Mark gingen den Anlegern allein an den deutschen Aktienmärkten zwischen März 2000 und Dezember 2001 verloren. Eine Summe, nahezu so gewaltig wie die Transferleistungen für die Neuen Bundesländer seit der deutschen Wiedervereinigung.
Auch wenn das Vermögen »nur« in den Büchern stand, auch wenn es großenteils zuvor an der Börse entstanden war – nun fehlt es definitiv in den Taschen der Konsumenten. Kein Wunder, dass die Wirtschaft lahmt, dass Investitionen gekürzt, Mitarbeiter entlassen werden.
Es lohnt, darüber nachzudenken, wie eine solch gigantische Spekulationsblase entstehen konnte, die die wirtschaftlichen Verhältnisse der ganzen Nation veränderte. Auf der einen Seite sammelten sich unerhörte Vermögenswerte an – bei Banken, Gründern, Großaktionären, auf der anderen blieben die Verluste hängen – bei Millionen von Sparern, Anlegern, Kleinaktionären.
Das Ergebnis der Umverteilung legt den Schluss nahe, dass der Börsenwahn nicht ganz zufällig über die Deutschen kam. Finanzwirtschaft und Medien haben kräftig nachgeholfen, um aus dem Volk der Bausparer und Versicherten eine Horde spekulationswütiger Aktionäre zu machen – mit dem klaren Ziel, sie um ihre Ersparnisse zu bringen. Einige der Schuldigen sind inzwischen identifiziert und gebrandmarkt worden – großmäulige Firmenchefs wie Thomas Haffa oder bedenkenlose Fondsmanager wie Kurt Ochner.
Damit ist die Gefahr jedoch keineswegs beseitigt. Die nächste Runde im großen Börsenspiel hat nämlich längst begonnen. Gestützt auf den Willen der Bundesregierung, das Aktiensparen für Arbeitnehmer zur Pflicht zu machen, tüfteln Banken und Versicherungskonzerne immer neue Finanzprodukte aus, die das Unmögliche möglich machen und eine hohe Rendite ohne jedes Risiko erbringen sollen. Letztlich aber geht es der Geldbranche auch bei der so genannten Riester-Rente nur darum, das Eingemachte der Bürger in die eigenen Taschen zu lenken.
Auch nach den dramatischen Kursstürzen an den Weltbörsen bleibt der Aktienmarkt ein heißes Pflaster, das mehr Risiken als Chancen birgt. In Zahlen ausgedrückt: Vor dem ersten Börsengang der Deutschen Telekom, mit dem der Aktienrausch begann, stand der Dax (Deutscher Aktienindex) bei 2500 Punkten, Anfang 2002 aber notierte das wichtigste deutsche Börsenbarometer immer noch bei rund 5000 Punkten – doppelt so hoch also als 6 Jahre zuvor. Die 30 größten deutschen Aktiengesellschaften wurden im Frühjahr 2002 an der Börse mit dem 20fachen Jahresgewinn bewertet – im Durchschnitt der letzten 50 Jahre aber betrug das Kurs-Gewinn-Verhältnis nur etwa 10:1.
Viele Aktien sind deshalb weder billig noch zum Kauf zu empfehlen. Umso wichtiger ist es für den Anleger, die zehn goldenen Regeln (Kapitel 15) zu beachten, die ihn vor weiteren herben Verlusten schützen können.
München, im Februar 2002.
1 | Profis & Amateure
Die Party ist vorbei, die Verluste bleiben. Noch immer sitzen Deutschlands Aktionäre auf Bergen hoffnungslos überbewerteter Börsentitel, noch immer haben viele von ihnen an den herben Verlusten zu knabbern, die ihnen der Kurssturz auf Raten seit März 2000 bescherte. Aber unverdrossen wirbt die Propagandamaschinerie der Finanzwirtschaft um weiteres Geld für die Börse. Banken, Fonds und Vermögensverwalter rechnen uns reich und machen uns arm.
Dieses Buch will nicht die Aktie verteufeln, es richtet sich auch nicht gegen die Börse. Einziges Anliegen des Autors ist es, die Leser zum vernünftigen Umgang mit den riskanten Wertpapieren anzuleiten und sie auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die auf dem verminten Gelände des Aktienmarktes drohen.
Nicht von den tollen Gewinnen ist die Rede, mit denen uns Börsensendungen und Wirtschaftsmagazine ständig den Mund wässrig machen, sondern von den Fallen, die für Aktionäre aufgestellt wurden. Es geht hier also nicht darum, wie Sie Ihr Geld mühelos vermehren, sondern wie Sie es vor dem dreisten Zugriff der Finanzprofis retten können.
Die Geldbranche nämlich hat aus dem Handel mit Aktien. Investmentfondsanteilen und tausenderlei derivaten Finanzprodukten ein globales Geschäft gemacht, das bereits mehr Gewinn abwirft als alle ihre übrigen Geschäftszweige zusammen. Und diese Gewinne sprudeln letztlich nur aus einer einzigen Quelle: den Taschen der Anleger.
Am beispiellosen Börsenboom der letzten Jahre haben sich nicht nur die Banken- und Versicherungskonzerne bereichert, die das »Asset-Management« zu ihrem Goldesel machten. Auf der Geschäftsgrundlage des Traums vom schnellen, mühelos verdienten Geld ist eine riesige Industrie erblüht, die allein in Deutschland einige hunderttausend Menschen ernährt. Analysten und Anlageberater, Banker und Broker, Finanzdienstleister und Fondsmanager stießen, dank der Aktionäre, in Einkommensregionen vor, von denen die Angestellten anderer Branchen nicht mal zu träumen wagen.
Allenfalls die Medien können, als Trittbrettfahrer des Aktiengeschäfts, noch einigermaßen mithalten. TV-Sender, Buch-, Zeitungs- und Zeitschriftenverlage labten sich, im Verein mit Onlinediensten, Werbeagenturen, Börsenbrief-Herausgebern und Finanzjournalisten, am Informationshunger der Anleger wie am Mitteilungsbedürfnis der Aktienverkäufer. Indem sie allezeit für eine »positive« Stimmung sorgten und dem Publikum auch dann noch Gewinnchancen vorgaukelten, als es mit den Kursen bergab ging, haben sie sich mitschuldig gemacht am Vermögensverlust von Millionen Sparern.
Von einem Komplott gegen die Aktionäre zu sprechen wäre vielleicht ein wenig übertrieben. Schließlich hat niemand die Sparer gezwungen, einen immer größeren Teil ihrer Finanzreserven in den Aktienmarkt zu investieren. Doch viele Beteiligte, vom Bankberater in der Schalterhalle bis zum scheinbar neutralen Börsenkolumnisten, haben das Vertrauen missbraucht, das ihnen ihre Kunden entgegenbrachten, indem sie ihnen
überteuerte Aktien andrehten,
Schrottfonds verkauften,
Falschinformationen lieferten,
Wucherpreise abverlangten,
Risiken verschwiegen.
Der Finanzbranche und den ihr verbundenen Medien ist es gelungen, ein Schneeballsystem loszutreten, das 1999 bereits ein Drittel des gesamten neu gebildeten Geldvermögens der Nation absorbierte. Wie viel davon am Ende, wenn die Spekulationsblase geplatzt ist, noch übrig sein wird, wissen nur die Götter. Binnen eines einzigen Jahres flossen, nach den Erhebungen der Deutschen Bundesbank, 87 Milliarden Mark an die Börse, und ein nicht geringer Teil davon ging nach dem Crash auf Raten, der im März 2000 begann, bereits wieder verloren. Jeder fünfte erwachsene Deutsche hat mittlerweile Aktien oder Anteile von Investmentfonds im Depot, und längst nicht allen ist bewusst, wie flüchtig die dort angesammelten Vermögenswerte sind.
So rasant, wie die Kurse der Aktiengesellschaften in den letzten Jahren emporgeschossen sind, stürzten sie auch wieder ab, ohne dass sich am Zustand der Unternehmen Gravierendes verändert hätte. Längst hat sich nämlich die Börse abgekoppelt von der realen Wirtschaft. Die Unternehmen dienen ihr nur noch als Staffage und Spielmaterial, dessen Wert beinahe nach Belieben rauf- oder runtermanipuliert wird. Gespeist von einem scheinbar unerschöpflichen Kapitalstrom der Anleger aus aller Welt, führen die Finanzmärkte mittlerweile ein Eigenleben, das für den privaten Anleger so unberechenbar bleibt wie die Roulettekugeln in den Spielcasinos von Bad Wiessee bis Las Vegas.
Was ist davon zu halten, wenn ein Konzern wie ThyssenKrupp an der Börse heute mit 30 Milliarden und morgen bloß noch mit 15 Milliarden Euro bewertet wird, obwohl sich doch Umsätze und Gewinne im gleichen Zeitraum beinahe verdoppelt haben? Wer versteht noch, warum ein kleiner Filmrechtehändler aus München-Unterföhring, der gerade mal 600 Angestellte beschäftigte, doppelt so viel wert war wie der größte Touristikkonzern der Welt, die Preussag AG?
Bedeutungsloses Gesäusel
Bestes Beispiel für die Willkür, die an den Finanzmärkten herrscht, ist die Deutsche Telekom. Wurde die aus der Bundespost hervorgegangene Telefongesellschaft 1996 sowohl von ihrem Eigentümer, der Bundesregierung, als auch von mehreren sachkundigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auf einen Gesamtwert von 60 Milliarden Mark taxiert, so gestand ihr die Börse im März 2000 bereits zehnmal so viel zu, nämlich rund 640 Milliarden Mark. Dies aber nur, um ihr in den folgenden Jahren das meiste davon wieder wegzunehmen: Ende 2001 war die Ron-Sommer-Company nur noch bescheidene 80 Milliarden Euro wert. Das alles hat mit der Realität nichts mehr zu tun, und manchem Telekom-Aktionär ist nach der Achterbahnfahrt seiner Papiere schwindlig geworden.
Trotz der offensichtlichen Willkür der Bewertungen und der Irrationalität des gesamten Börsengeschehens reden uns alle, die in irgendeiner Weise davon profitieren, unverdrossen ein, dass der Erfolg einer Aktienanlage plan- und berechenbar sei. Nur solange der Aktionär glaubt, dass er mit den richtigen Tipps und Informationen den Erfolg an der Börse herbeispekulieren könne, haben sie Macht über ihn.
Nichts fürchten Analysten und Anlageberater, Banker und Börsenkolumnisten mehr als den desillusionierten Aktionär. Ihm können sie nichts mehr vormachen, er lässt sich nicht mehr manipulieren, sein Geld ist für sie verloren. Also werden sie nicht müde, uns die seltsamen Bewegungen der Kurse im Nachhinein zu erklären. Nur zu dumm, dass auch die klügsten Köpfe beim Versuch, die Notierungen des nächsten Tages vorherzusagen, regelmäßig so jämmerlich versagen. Kein Aufwand ist ihnen zu groß, wenn es gilt, den Aktionär bei Laune zu halten. Da leisten sich die Banken und Investmentfonds ganze Heerscharen hoch bezahlter Analysten, die uns auf scheinbar rationaler Basis täglich mit Informationen über die an der Börse notierten Gesellschaften überschütten, da veröffentlichen Tageszeitungen und Wirtschaftsmagazine permanent irgendwelche »Aktienchecks«, plaudern angebliche Koryphäen vor den Kameras von Börsensendern wie n-tv, 3sat oder N24 tiefgründig über die Aussichten einzelner Papiere, und doch erzeugen alle zusammen nur ein völlig bedeutungsloses Gesäusel, das an den Märkten bereits verhallt ist, noch bevor die Anleger es wahrgenommen haben.
So gern die Experten über die »Potenziale« reden, die angeblich in diesen oder jenen Titeln, diesen oder jenen Märkten stecken, so zugeknöpft geben sie sich, wenn man sie nach ihren Provisionen fragt. Kaum einer von ihnen gibt zu, dass Kurse manipuliert werden, dass sich nicht nur Banken und Aktienhändler, sondern auch Journalisten mit bestimmten Papieren eindecken, ehe sie ihre Tipps und Empfehlungen ans Publikum weitergeben. Wer die so beliebten »Performance«-Listen der Investmentfonds anzweifelt, weil sie Gewinne vorgaukeln, die in Wirklichkeit viel geringer ausfielen, wird in der Geldbranche wie ein Aussätziger behandelt.
Tatsächlich verliert ein Anleger in dem Moment, wo er eine Aktie oder ein Investmentzertifikat ordert, die Kontrolle über sein Geld. Von einer Sekunde zur anderen kann es nun wachsen oder schrumpfen, ist es Kräften ausgeliefert, auf die sein Besitzer nicht den geringsten Einfluss hat, von denen er oftmals gar nicht weiß, dass es sie gibt.
Er kann sich noch so viel Mühe bei der Auswahl gemacht, kann auf die richtige Branche und die richtige Firma gesetzt – und am Ende doch total danebengelegen haben. Denn ob ein bestimmter Börsentitel zu- oder abnimmt, das hängt oft von ganz anderen Einflüssen ab, als sich das ein Aktionär vorzustellen vermag.
Marktenge Werte »gecornert«
Ist die Gemeinde der internationalen Großanleger, unter denen die Verwalter der volumenstärksten Investmentfonds den Ton angeben, beispielsweise der Meinung, dass es opportun sei, den deutschen Markt zu meiden, so werden die Kurse an der Frankfurter Börse in den Keller rauschen, auch wenn die Geschäftsaussichten der Unternehmen noch so günstig erscheinen. Und wenn hierzulande irgendeine Bank ein größeres Aktienpaket in »Streubesitz« verwandeln möchte, dann wird sie diesen Titel nicht nur ungefragt in alle von ihr verwalteten Kundendepots drücken, sondern auch ihre Analysten anweisen, die weiteren Aussichten des Unternehmens in den rosigsten Farben auszumalen. Selbst wenn das nicht ganz gelogen sein sollte und die Firma tatsächlich gut im Rennen liegt, wird der Anleger an diesem Papier wenig Freude haben, denn die massenhaften Verkäufe seiner Bank drücken den Kurs für längere Zeit nach unten.
In der völlig undurchschaubaren Gemengelage an den Aktienmärkten gibt es nur eine Konstante: das Profitinteresse der Geldbranche. Egal, ob die Kurse steigen oder fallen, ob man kauft oder verkauft, ob man sich für Aktien, Fonds oder Optionsscheine entscheidet – die Bank gewinnt immer. Dafür sorgt schon das wenig kundenfreundliche Regelwerk der Börse, das sich Banker und Makler ganz nach ihren Interessen zurechtschneiderten und das den staatlichen Aufsichtsbehörden wenig Chancen lässt, Gesetzesverstöße zu ahnden. Dies gilt im besonderen Maße für Deutschlands Wachstumsbörse Nummer eins, den so genannten Neuen Markt, der als private AG firmiert und längst zur Spielwiese für Abzocker verkommen ist.
Anders als in den USA, wo die Börsenaufsichtsbehörde SEC selbst den raffiniertesten Betrugsmanövern auf die Schliche kommt und die Täter unnachsichtig aus dem Verkehr zieht, werden am Neuen Markt in Frankfurt nach wie vor verbotene Insidergeschäfte abgewickelt oder marktenge Werte »gecornert«. Gemeint ist die Manipulation bestimmter Kurse etwa durch vollmundige Statements mächtiger Fondsmanager, die sich zuvor mit diesen Werten billig eingedeckt hatten. Wenn dann die Privatanleger sich verführen lassen und in größeren Stückzahlen das am Neuen Markt gehandelte Papier ordern, steigt der Fondsmanager mit einem ordentlichen Zwischengewinn aus und überlässt die Kleinanleger ihrem Schicksal.
Angesichts solcher Zustände erscheint das Konzept der staatlich geförderten »Riester-Rente« reichlich verwegen: die Bundesregierung macht das Aktiensparen für Arbeitnehmer quasi zur Pflicht. Weil die staatliche Rentenversicherung wegen der Vergreisung der bundesdeutschen Gesellschaft nicht mehr in der Lage ist, aus den Beiträgen der Jungen die Renten der Alten zu finanzieren, soll künftig jeder Bürger verpflichtet werden, seinen Lebensabend wenigstens zum Teil privat zu finanzieren. Geringverdiener erhalten deshalb Zulagen bis zu 350 Mark im Jahr, und Normalbeschäftigte dürfen bis zu vier Prozent ihrer Bruttolöhne steuerfrei anlegen. Und diesen Milliardenstrom erwarteter Altersruhegelder möchte die Finanzbranche dahin umleiten, wo sie das meiste davon hat, nämlich an den Aktienmarkt. Wie gut die Finanzreserven der Bürger dort tatsächlich aufgehoben sind, sollen die folgenden Kapitel zeigen.
2 | Fiebrige & Verarschte
Deutschland im Frühjahr 1996. Der Dax, das wichtigste Aktienbarometer, steht bei 2500 Punkten, und die Bürger legen ihr Geld so konservativ und risikobewusst an wie eh und je. Den Löwenanteil ihrer Ersparnisse des letzten Jahres, rund 95 Milliarden Mark, lassen sie, trotz der geringen Zinsen, auf dem Sparbuch stehen, 87 Milliarden zahlen sie in ihre (Lebens-)Versicherungen ein, und weitere 62 Milliarden Mark investieren sie in Häuser, Wohnungen, Bausparverträge. Lediglich ein kleiner Rest von 10 Milliarden findet den Weg an die Börse. Laut Allensbach interessieren sich überhaupt nur 19 Prozent der erwachsenen Bevölkerung für das Thema Aktien.
In Düsseldorf brütet derweil ein Team qualifizierter Werbeexperten an einem Auftrag aus Bonn. Der Bundesfinanzminister, er heißt Theo Waigel, will 26 Prozent des ehemaligen Postbetriebs »Telekom« ans Publikum verkaufen und einen möglichst hohen Preis dafür erzielen. Die Werber von Spiess, Ermisch & Andere sollen ihm dabei helfen, den Deutschen die Telekom-Aktie schmackhaft zu machen.
Viel Geld steht auf dem Spiel: Theo Waigel rechnet mit Einnahmen von annähernd 20 Milliarden Mark und hat die Summe bereits zur Sanierung des Bundeshaushalts fest eingeplant. Die ganze Telekom wurde von Fachleuten auf einen Wert von etwa 60 bis 80 Milliarden Mark taxiert, da durfte man nicht am falschen Platz sparen. Die Werber bekommen freie Hand und einen Etat von annähernd 100 Millionen Mark, um die notorisch risikoscheuen deutschen Sparer aus der Reserve zu locken.
Sie planen einen Dreifrontenfeldzug mit großflächigen Plakaten in der Telekom-Farbe »Magenta«, ebenso leuchtenden Inseraten in den meinungsbildenden Printmedien und schließlich einem wahren Trommelfeuer aus Funk- und Fernsehspots mit dem Schauspieler Manfred Krug als Zugpferd. Der kauzige Rechtsanwalt aus der Fernsehserie »Liebling Kreuzberg« wird nun auch zum Darling der deutschen Geldanleger. Massenhaft wie nie zuvor ordern sie das scheinbar risikoarme Telekom-Papier, von dem erst 400, dann 600, schließlich 713 Millionen Stück zum Preis von je 28,50 Mark verkauft werden. Weil die größte Aktienemission der Nachkriegszeit mehrfach überzeichnet ist, bekommt jeder Interessent höchstens 300 Papiere zugeteilt.
Als der Handel am 18. November 1996 eröffnet wird, meldet das »Big Board« im großen Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse den Kurs: 33 Mark. Über zwei Millionen Deutsche haben praktisch über Nacht mühelos und ohne erkennbares Risiko einen Gewinn von insgesamt 3,2 Milliarden Mark gemacht, und das bleibt nicht ohne Folgen. Viele steigen sofort wieder aus und realisieren das Waigel-Geschenk, doch es gibt noch mehr, die bei der Zeichnung leer ausgingen und jetzt nachkaufen.
Der Kurs trippelt in kleinen Schritten aufwärts, und Deutschland hat ein neues Thema. Statt über Fußball, Autos und die Verhältnisse von Claudia Schiffer palavert man an den Stammtischen der Nation immer häufiger über Anlagestrategien, Finanzwerte und Kurs-Gewinn-Verhältnisse. Nicht mehr das Duell Kohl gegen Lafontaine findet das meiste Interesse, sondern die Fragen: Siemens oder Daimler? Bayer oder BASF? Halten oder verkaufen?
Kaum zwei Monate nach dem Börsengang der Telekom springt der Dax über die 3000er-Marke, und die Finanzgemeinde wittert Morgenluft. Die öden Jahre der Witwen- und Waisenpapiere – endlich vorbei? Die Zeichen stehen günstig: Die Umlaufrendite, wichtigste Kennzahl für die Erträge festverzinslicher Wertpapiere, ist auf einen »historischen Tiefstand« gefallen, und Deutschlands Sparer sind beunruhigt. Das viele Geld, das sie auf Giro- und Sparkonten gebunkert haben, wirft, nach Abzug der Inflationsrate, so gut wie nichts mehr ab, und auch Rentenpapiere wie Anleihen, Pfandbriefe, Kommunalobligationen haben ihren Charme verloren.
Der Finanzindustrie kommt die Zinsflaute wie gerufen. Solange die Kundschaft an ihren »Bundesschätzchen« klebt, ist im Anlagegeschäft wenig zu verdienen. Kauf und Verkauf der Bundeswertpapiere haben spesenfrei zu erfolgen, und häufig fallen nicht mal Depotgebühren an, wenn die knauserigen Käufer ihre Werte bei der Bundesschuldenverwaltung in Bad Homburg einlagern lassen – gratis!
Jetzt könnten, Manfred Krug sei Dank, andere Zeiten anbrechen. Aktien machen reich – die Bank natürlich. Aktien bringen Geschäft – dem Vertrieb logischerweise. Aktien sind etwas Wunderbares – für die ganze Branche. Aktien liegen nicht wie Blei in den Depots, Aktien werden umgeschichtet. Und an jeder Schichtung gibt es was zu verdienen. Kauf und Verkauf – immer fallen Spesen an, Gebühren, Provisionen, was für herrliche Zeiten!
Nur am Erfolg interessiert
Die Leute sind wie wild auf Aktien. Wer bei der Telekom leer ausging, kauft jetzt Allianz, Bayer, Siemens, Daimler usw. Die Kurse klettern, und die Zeitungen sind voll mit Geschichten über die wundersame Vermögensvermehrung, die in den USA schon seit Jahren vor sich geht. Technologie ist gefragt, und in ihren Sonntagsreden bejammern die Politiker die Verhältnisse, an denen sie selbst schuld sind.
Deutschland drohe der Rückfall in die Steinzeit, wenn es nicht gelänge, in Sachen Internet und Gentechnik den angeblichen Rückstand gegenüber den USA schleunigst aufzuholen. Ein bayerisches, preußisches, westfälisches oder auch hessisches Silicon Valley müsse her, koste es, was es wolle. Die mutige Stimmung im Lande macht sich ein Mann in der Geldmetropole Frankfurt zunutze, der als Schweizer Gastarbeiter bislang ein eher unbeachtetes Dasein fristet. Und der obendrein Angst um seinen Job hat.
Werner G. Seifert, Vorstandschef der Deutschen Börse AG, hat guten Grund zu der Befürchtung, dass ihm die amerikanische Computerbörse Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) einen Teil seines Geschäfts wegnehmen möchte. An der Nasdaq werden vornehmlich Anteilsscheine junger Firmen gehandelt, die ihr Geschäft mit neuen Technologien machen und die noch zu klein und unbedeutend für die NYSE (New York Stock Exchange) sind. Etwas Ähnliches gibt es mit der Brüsseler Easdaq (European Association of Securities Dealers Automated Quotations) und dem Londoner AIM (Alternative Investment Market) auch in Europa schon, doch die Nasdaq möchte das lukrative Geschäft mit den Hightech-Firmen weltweit an sich ziehen und plant einen Ableger direkt vor der Haustür des Herrn Seifert.
Die gesamte Börsenlandschaft ist im Umbruch, denn der Handel mit Aktien findet immer weniger auf dem so genannten Parkett statt, wo Makler wild gestikulierend und schreiend ihre Aufträge abwickeln, sondern auf elektronischen Handelsplattformen in völliger Geräuschlosigkeit, aber mit höchster Präzision und Geschwindigkeit. Verfügt man über die entsprechende Software, kann man heutzutage eine solche Handelsplattform für Tausende von Wertpapieren ohne größere Schwierigkeiten an jedem Punkt der Erde installieren.
Kauf- und Verkaufsaufträge laufen über Telefon, Fax oder Internet ein, und die Kurse lassen sich auf den Bildschirmen rund um den Globus in Echtzeit verfolgen. Um nicht einen Teil ihres Geschäfts zu verlieren, treiben Seifert und sein ebenfalls aus der Schweiz stammender Vorstandskollege Reto Francioni die Gründung einer eigenen Technologiebörse voran, die sie, nach einigem Hin und Her, schließlich »Neuer Markt« nennen.
Verkauft wird das Projekt der Öffentlichkeit mit dem Argument, dass hier ein Finanzplatz entstünde, auf dem sich junge, innovative Hightech-Firmen mit dem dringend benötigten Risikokapital versorgen könnten. Damit der volkswirtschaftliche Zweck erfüllt werden kann, darf es den Firmen nicht zu schwer gemacht werden, ihre Papiere an den »Neuen Markt« zu bringen. Um jedoch das Vertrauen der Anleger zu gewinnen und gleichzeitig die staatlichen Aufsichtsbehörden fern zu halten, verordnet Werner G. Seifert seiner Babybörse ein paar durchaus sinnvolle Spielregeln.
So dürfen am Neuen Markt nur stimmberechtigte Stammaktien gehandelt werden, der Ausgabewert muss mindestens fünf Millionen Euro betragen und wenigstens 20 Prozent des gesamten Kapitals einer gelisteten Firma ausmachen. Vorstände und Aufsichtsräte müssen ihren Aktienbesitz offen ausweisen und dürfen ihre Papiere frühestens sechs Monate nach dem Börsenstart verkaufen.
So schön diese Regeln auch sein mögen, sie können nicht darüber hinwegtäuschen, dass an der amerikanischen Nasdaq weit strengere Sitten herrschen und dass sie ihre Wirksamkeit nur dann entfalten können, wenn sie auch eingehalten werden. Darüber aber wacht am Neuen Markt nicht, wie beim so genannten amtlichen Handel, das Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel, sondern allein der Vorstand der Deutschen Börse AG.
Der kann die selbst gesetzten Regeln mal schärfer, mal großzügiger auslegen, ganz so, wie es dem Geschäft förderlich ist. Sein oberstes Interesse gilt also nicht der Gleichbehandlung aller Marktteilnehmer, sondern dem wirtschaftlichen Erfolg der Veranstaltung »Neuer Markt«.
Die Mäuse der Anleger gefangen
Den hat er zweifellos erzielt. Klingelte die Telekom einst die deutschen Anleger wach, so trieb sie das Geschrei vom Neuen Markt vollends aus den Betten. Schon am ersten Handelstag, dem 10. März 1997, melden die Sender sensationelle Gewinne. Von den beiden zuerst gestarteten Aktien erzielt der Telefonanbieter Mobilcom einen Kursanstieg von 52 Prozent, und auch die Nummer zwei, der Ingenieurdienstleister Bertrandt, liegt mit 10 Prozent im Plus. Ob das private Publikum zugegriffen hat oder ob massive Käufe der Banken und Investmentfonds für das Kursfeuerwerk sorgten, bleibt der Öffentlichkeit verborgen.
Die Kunde von den wundersamen Gewinnen, die sich hier so schnell und mühelos erzielen lassen, sorgt für Unruhe, auch im Volk der Bausparer und Couponschneider. Der Speck, mit dem die Finanzwirtschaft die Mäuse der Anleger einfangen will, duftet verführerisch in den kargen Zeiten der Minizinsen. Sachte erst, dann immer heftiger, wird das Land der Häuslebauer und Kontensparer vom Börsenfieber geschüttelt. An den Stammtischen interessiert man sich plötzlich weniger für die Tagesform eines Lothar Matthäus als für jene von Nokia, und in den Büros begrüßt man sich halb im Scherz, halb im Ernst immer häufiger mit der Schicksalsfrage, die die Nation bewegt wie kaum eine andere: »Wie stehen die Aktien?«
Jeder dritte Deutsche bekundet bereits ernsthaftes Interesse am Börsengeschehen, und die Medien schüren das Feuer nach Kräften. Begeistert meldet Bild am 27. Juni 1997: »Aktienrausch! Jeder will mitkassieren«, und das Manager Magazin kürt das Börsenfieber zum »Trend des Jahres 97«. Selbst das Wachpersonal im Gebäude der Deutschen Börse registriert einen wachsenden Besucherstrom. Über 80000 Anleger und Interessenten wollen das Geschehen im großen Handelssaal von der Zuschauertribüne aus live beobachten, 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor.
Dabei kaufen die Deutschen 1997 kaum mehr Aktien als bisher, jedoch ordern sie in rauen Mengen jene Papiere, die die Banken noch lieber verkaufen: die Zertifikate ihrer Investmentfonds. Vergessen ist der Finanzskandal um einen gewissen Bernie Cornfeld, der den Deutschen in den späten 60er-Jahren massenhaft Investmentfondsanteile verkauft hatte, die nach dem Zusammenbruch seiner IOS (Investor Overseas Services) nahezu wertlos geworden waren.
Fonds, so viel erzählen die Bankberater ihren Kunden, seien weniger risikoreich als Aktien, daher zur langfristigen Vermögensanlage besser geeignet. Was sie nicht erzählen, ist, dass die Banken an Fondspapieren noch mehr verdienen als an den Anteilsscheinen der Unternehmen. Das hält die Anleger jedoch nicht davon ab, die scheinbar sicheren Fondspapiere zu ordern, und der anschwellende Kapitalstrom, der von Spar- und Festgeldkonten rüber zur Börse fließt, lässt die Kurse munter klettern.
Obwohl nicht wenige Fachleute schon im Januar, als der Dax gerade die 3000er-Marke genommen hat, deutsche Aktien bereits für überbewertet halten, ziehen die Notierungen so kräftig an, dass der Index im Juli einen vorläufigen Rekordstand von 4439 Punkten erreicht. Ihre gute Laune lassen sich die Anleger auch nicht nehmen, als am 15. August die Wall Street erbebt und der Dow Jones um 250 Punkte absackt. Zum ersten Mal in der jüngeren Börsengeschichte wagt sich der deutsche Markt aus dem Schatten des großen Bruders heraus. Die Freude der heimischen Börsenkolumnisten über den kleinen Emanzipationsversuch ist freilich nur von kurzer Dauer, denn beim nächsten Beben im Oktober erwischt es auch den Dax. Die Asienkrise lässt den deutschen Aktienindex auf 3400 Punkte zurückfallen, und viele hoffnungsfrohe Anfänger machen zum ersten Mal in ihrem Leben die Erfahrung, dass die Börse keine Einbahnstraße ist.
Die Katastrophen-Hausse
Echte Verluste erleiden freilich nur jene ängstlichen Naturen, die nach dem Kurssturz in Panik geraten und sich von ihrem Börsentiteln trennen. Das große Geschäft hingegen machen hartgesottene Spekulanten, die die abgestoßenen Papiere zu Tiefstpreisen einsammeln, denn schon bald ist der Spuk vergessen, und der Dax beschließt das Jahr 1997 beinahe auf Juli-Niveau bei 4250 Punkten. Die zwei glimpflich überstandenen Krisen machen die Anleger nicht vorsichtiger, sondern mutiger. Wie im Vorjahr ordern sie auch 1998, von ihren Bankberatern kräftig ermuntert, mehr Aktien und Fondsanteile als je zuvor.
Weder die Furcht vor einer Ausweitung der Asienkrise noch Gerüchte über bevorstehende Zinserhöhungen in den USA vermögen den Dax zu bremsen, der im April 5000, im Juli gar über 6000 Punkte erreicht. Doch mitten in der Sommerhausse stürzen in Hongkong die Kurse ab, und der japanische Yen verliert deutlich an Wert. Plötzlich ist auch in Frankfurt, Düsseldorf und München die Zuversicht wie weggeblasen. Banker und Broker, Fondsmanager und Vermögensverwalter werden nervös und werfen als Erste ihre Papiere massenhaft auf den Markt, um die erzielten Kursgewinne sicherzustellen. Ende August rutscht der Dax wieder unter die 5000er-Marke, und im notorischen Crashmonat Oktober sackt er wegen des drohenden Staatsbankrotts in Russland auf den tiefsten Stand des Jahres ab. Wer sich im Vertrauen auf die steigenden Kurse im Mai oder Juni mit Aktien eingedeckt hatte, liegt jetzt dick im Minus. Doch auch diese Krise geht so plötzlich vorüber, wie sie gekommen ist, obwohl die Welt wahrlich kein freundliches Bild bietet. Im Irak herrscht Krieg, NATO-Bomber zerstören die Hauptstadt Bagdad, in den USA sieht sich ein angeschlagener Präsident mit peinlichsten Enthüllungen über seine außerehelichen Eskapaden konfrontiert, und in Deutschland wählen die Bürger, nach 16 verschlafenen Reformjahren, eine rot-grüne Bundesregierung. Was in früheren Zeiten für einen Kollaps ausgereicht hätte, lässt die Börsianer diesmal kalt. Der Druck des nach rentierlichen Anlagen suchenden Kapitals ist stärker als die depressive Wirkung der Nachrichten aus der Politik, und an Silvester 1998 steht der Dax bereits wieder bei 5400 Punkten.
So irrational, wie das Auf und Ab der Kurse anmutet, so schwer verständlich ist das naive Zutrauen, das die Anleger mittlerweile zur Börse gefasst haben. Zählte das Deutsche Aktieninstitut (DAI) 1997 insgesamt 5,6 Millionen Besitzer von Aktien oder Fondspapieren, so waren es Ende des folgenden Jahres bereits 6,78 Millionen und weitere zwölf Monate später 8,23 Millionen. Dabei war 1999 zunächst kein berauschendes Börsenjahr, der Dax bewegte sich ständig in der Zone zwischen 5000 und 5500 Punkten. Erst im Oktober ging die Post ab, aber dann so vehement, dass der Index binnen fünf Monaten so viel an Wert zulegte wie in den vergangenen fünf Jahren.
Verächtlich sprachen erfahrene Börsianer von einer »Dienstmädchenhausse«, und sogar den Finanzprofis, die das alles mit angezettelt hatten, wurde es allmählich mulmig. Vorsichtshalber wusch das von den Banken finanzierte Deutsche Aktieninstitut seine Hände in Unschuld: »DAI warnt Anleger vor ‘Aktieneuphorie’«, meldete die Börsenzeitung am 2. März 2000. Mit dem Zeitpunkt dieser Veröffentlichung bewies DAI-Chef Rüdiger von Rosen mal wieder, dass er ein wenig mehr wusste als die anderen, denn kurz danach brachen die Kurse ein.
So schnell freilich ließen sich die Deutschen ihren Aktienwahn nicht nehmen. Allein oder in Investmentclubs, am Bankschalter oder übers Internet karrten sie so viel Geld an die Börse, dass deren Buchungssysteme zeitweilig streikten. Mitte des Jahres 2000 zählte das DAI bereits 11,3 Millionen Aktien- und Fondsbesitzer, jeder sechste Deutsche über 14 durfte sich für einen Börsianer halten.
Aus den Umkleidekabinen des FC Bayern ließ Präsident Franz Beckenbauer den Fernseher entfernen, damit seine Kicker nicht in der Halbzeitpause die Börsenkurse auf n-tv verfolgten, anstatt sich aufs laufende Spiel zu konzentrieren. In Baden-Württemberg musste ein 13-jähriger Schüler das Klassenzimmer verlassen, nachdem er dabei erwischt worden war, wie er per Handy die Börsenkurse abgefragt hatte. Und in Köln hieß der Schlachtruf beim Rosenmontagszug nicht, wie in früheren Zeiten, »Kamellen, Kamellen«, sondern »Aktien, Aktien!«.
Der Spekulant, einst personifizierter Klassenfeind der werktätigen Bevölkerung, war zum Idol gereift, und ungestraft durften sich Publikumslieblinge wie TV-Unterhalter Harald Schmidt als Börsenjunkies outen. Deutlicher noch als solche Beispiele bestätigte der Dax den Wertewandel in der Gesellschaft: Am Tag nach dem Rücktritt des linken SPD-Matadors Oskar Lafontaine von seinem Posten als Finanzminister sprang der Index um 300 Punkte nach oben. Das Jobbern an der Börse war gesellschaftsfähig geworden, und wer im Kreise von Freunden und Kollegen anerkannt werden wollte, brüstete sich jetzt nicht mehr mit 300 PS, sondern mit 300 Prozent Gewinn.
Eigennütziger Medienrummel
Denn natürlich handelte es sich bei dem Kursanstieg nicht um einen Zufall, sondern um das wohlverdiente Ergebnis harter Arbeit. Der Erfolg an der Börse steigerte das Sozialprestige, er war geradezu die Voraussetzung für die Anerkennung im Kreis der Leistungsträger. Nicht mehr der Karrierist, der es mit Können, Kraft und Ellbogen bis an die Spitze seiner Firma schaffte, genoss das höchste Ansehen, sondern der clevere, mit allen Wassern gewaschene Spekulant, der ohne erkennbare Mühe den großen Reibach machte.
Dem Reiz des schnell verdienten Geldes erlag jetzt nicht mehr, wie in früheren Zeiten, eine schmale Schicht von Geschäftsleuten und reichen Müßiggängern, sondern die halbe Bevölkerung. Die Börsenspekulation gedieh zum Breitensport, und die Medien machten ein Bombengeschäft daraus. Fristeten Fachblätter wie Börse Online früher ein kaum beachtetes Nischendasein, so lagen sie jetzt in dicken Stapeln ganz vorne an den Kiosken.Immer mehr neue Titel drängten auf den Markt, von der Deutsch-landausgabe der ehrwürdigen Financial Times über den Handelsblatt-Ableger Telebörse bis hin zu Focus Money aus dem Hause Burda.
Sogar die Bild-Zeitung verbannte zeitweilig Kampfhunde, Massenmörder und Verona Feldbusch auf die hinteren Seiten, wenn das Volk nach Infineon-Aktien lechzte. Die Tagesschausprecher mussten lernen, »Dow Jones« richtig zu artikulieren, und dem einstigen Pleitesender n-tv gelang mit einem voll auf die Börse fokussierten Programm ein glänzendes Comeback. N-tv-Moderatoren wie Friedhelm Busch und Carola Ferstl nutzten ihren Bekanntheitsgrad, um auch noch mit Büchern am Börsenboom zu partizipieren.
Der ganze Medienrummel freilich diente nicht dazu, die Anleger wahrheitsgemäßüber die Risiken des Aktiengeschäfts aufzuklären oder gar die Machenschaften der Anbieter aufzudecken. Die Branche war sich vielmehr einig in dem Bestreben, die Börse zu einer dauerhaften Verdienstquelle zu machen. Deshalb mussten die Redaktionen permanenten Optimismus verbreiten, gaben sie ständige Kauf-, aber kaum Verkaufstipps, suggerierten sie ihren Lesern und Zuschauern, dass der Erfolg an der Börse nur von der richtigen Information abhinge – und die zu liefern, war ihr Privileg.
Das Konzept kam an, obwohl die Börse gewiss zuletzt auf Journalisten hört. Solange die Kurse stiegen, machte das Spekulieren allen Spaß, und am spaßigsten war es im Club. Wie früher Skat- und Sangesbrüder, so trafen sich nun in immer größeren Scharen Börsenbrüder und -schwestern zum gemeinsamen Spekulieren. Über 500 Investmentclubs mit so seltsamen Namen wie »Panzerknacker«, »Käsch Marie«, »Dagoberts Töchter« oder »Lucky Share« registrierte die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. bereits Ende 1999, und etwa 6000 weitere Zockergruppen dieser Art waren ohne Registriernummer am Markt aktiv.
Obwohl manche der privaten Investmentclubs beträchtliches Kapital und Know-how bündelten, sahen die Profis aus der Geldbranche in ihnen keine unliebsame Konkurrenz, sondern, ganz im Gegenteil, willkommene Förderer des Geschäfts. Klar: Je mehr Kleinanleger ihr Geld zur Börse tragen, desto mehr Provisionen fallen an – und außerdem: Damit wenige gewinnen können, müssen viele verlieren.
Mit Freude registrierten Banker und Börsenkommentatoren, dass die deutschen Kleinanleger, sofern sie sich erst mal an Aktien gewagt hatten, ihre Papiere rasch lieb gewannen und sie nicht gleich beim ersten Kursbeben wieder wegwarfen. So entwickelte sich der »Streubesitz«, wie das Aktionärvolk im Jargon der Börsianer verächtlich genannt wird, zur verlässlichen Stütze in schlechten Zeiten. Wenn die Profis längst ausgestiegen sind und die Börse ihrem Schicksal überlassen, ist die Masse der Kleinaktionäre für gewöhnlich noch voll involviert.
So war es auch bei der Millenniums-Spielrunde: Kaum hatte der Dax die 8000er-Marke gestreift, warfen Großanleger und Investmentfonds im Frühjahr 2000 ihre Aktien paketweise aus den Depots, nachdem an der Wall Street neue Zinsängste aufgekommen waren, während hunderttausende Kleinanleger gerade ihre ersten Börsenpapiere gekauft hatten und nun mit ansehen mussten, wie diese täglich an Wert verloren. Schon André Kostolany, der im September 1999 in Paris verstorbene Altmeister der Börsenspekulanten, wusste: Anfänger kaufen immer zu spät und verkaufen zu früh.
»Kann ich auch reich werden?«
Erst waren es die erstaunlichen Gewinne der Zocker vom Neuen Markt, die die Aktionäre in Unruhe versetzten. Wer etwa beim Börsengang des Münchner Trickfilmhändlers EM.TV im Oktober 1997 mit 10000 Mark dabei war, hatte im März 2000 drei Millionen im Depot. Auch wenn die meisten an sichere, aber eben inzwischen äußerst magere Zinsen gewöhnten Anleger dem seltsamen Treiben ratlos zusahen, weil sie oft nicht mal begriffen, mit was Firmen wie Edel Music, Mobilcom, Artnet oder Ricardo.de eigentlich ihr Geld verdienten, so schien es doch eine unbestreitbare Tatsache zu sein, dass sich die Gewinne real einstellten. Egal, wie übertrieben die Bewertungen der meisten Firmen inzwischen sein mochten – da die Kurse immer weiter stiegen, war man doch bescheuert, wenn man sich nicht auch ein paar der einträglichen Papiere zulegte.
So griff das Aktienfieber immer weiter um sich, bis es beim Börsengang der Siemens-Tochter Infineon zur Epidemie ausartete. Zahlreich wie nie zuvor rissen sich die deutschen Sparer ausgerechnet um das Papier einer Firma, die der Münchner Elektrokonzern dringend loswerden wollte. Unter dem Kunstnamen Infineon gliederte Siemens-Chef Heinrich von Pierer einen Unternehmensbereich aus, an dem er bis dahin wenig Freude hatte. Das Geschäft mit Halbleitern – jenen winzigen elektronischen Bauteilen, die heute überall die Funktionen von Industrieprodukten steuern – erwies sich als äußerst riskant, da es einem mörderischen Wettbewerb ausgesetzt ist und stark von den Konjunkturzyklen abhängt.
Einen Teil dieses Unternehmensbereichs hatte Siemens zuvor schon unter dem Namen »Epcos« an die Börse gebracht und damit dem deutschen »Streubesitz« zu beträchtlichen Kursgewinnen verholfen. Bei Infineon schien die Sache freilich etwas problematischer zu sein, denn hier handelte es sich um ein ungleich größeres Unternehmen, das die besonders konjunkturanfälligen Speicherchips herstellte. Heinrich von Pierer bewilligte deshalb der Konzerntochter für ihren Börsengang einen Werbeetat von 100 Millionen Mark, so viel also wie einst auch die Telekom.
Der Werberummel löste dieses Mal beinahe eine Massenhysterie aus. Obwohl nicht weniger als 174 Millionen Aktien verkauft werden sollten, war die Emission 50fach überzeichnet worden, das heißt, es wurden 50-mal mehr Infineon-Aktien bestellt, als geliefert werden konnten. »Geld-Rausch!«, schrie die Bild-Zeitung in übergroßen Lettern am Tag vor dem Börsengang und gab der Sorge ihrer Leser in der Unterzeile Ausdruck: »Kann ich auch reich werden?«
Tatsächlich durfte sich glücklich schätzen, wer ein paar der raren Infineon-Papiere zum Ausgabepreis von 35 Euro per Losentscheid zugeteilt bekam, denn schon am nächsten Tag waren sie das Doppelte wert. Die wundersame Geldvermehrung an der Börse, die sich einstellte, ohne dass man sich dafür irgendwie anstrengen musste, brachte bei vielen Jungaktionären die Maßstäbe durcheinander. Statt der acht bis zehn Prozent Rendite, die eine gute Aktienanlage in früheren Jahren pro Jahr abwarf, forderten sie jetzt gebieterisch die Vervielfachung ihres Kapitals, und zwar nicht in Jahren, sondern in Monaten. Und die Medien unternahmen wenig, die Spekulationswut zu bremsen, sondern heizten sie, im Gegenteil, weiter an.
Auf den Videotextseiten von n-tv erschienen reißerische Ankündigungen wie »Neuer 15000-Prozent-Kracher« oder »Kursrakete gezündet«, und Direktbanken warben mit Sprüchen wie: »Du musst gnadenlos sein. Friss oder stirb. Kaufen, Verkaufen, Bingo.«
Für nicht wenige der aufgeputschten Aktionäre wurde die Spekulation zur krankhaften Sucht, die sie häufig in Gemeinschaft Gleichgesinnter zu befriedigen versuchten. In Großstädten zuerst, dann auch in der Provinz, entstanden überall Internetcafés oder so genannte Trading Centers, von denen aus die Börsensüchtigen ihrer Spielleidenschaft nachgehen können.
Vom frühen Morgen bis spät in den Abend hocken die Daytrader vor ihren angemieteten Computerterminals, starren gebannt auf die Kurse, die in Echtzeit über die Bildschirme flimmern, und platzieren per Mausklick ihre Kauf- und Verkaufsorders direkt an den Börsen von Frankfurt, Tokio oder New York. Der Daytrader ist ein unruhiger Geselle, er will nicht wochen- oder monatelang warten, bis eine Aktie im Kurs zugelegt hat, sein Ziel ist die schnelle Mark. Deshalb schichtet er sein Depot jeden Tag viele Male um, kauft und verkauft pausenlos irgendwelche Papiere, stets mit dem Ziel, hier ein paar Pfennige, dort ein paar Cents abzustauben. Er ist zufrieden, wenn er am Abend 2000 bis 3000 Mark Gewinn verbuchen kann, denn sein eigentlicher Lohn ist der Nervenkitzel beim Spiel.
Suchtkranke Börsenjunkies
In den Börsenjunkies sehen Fachleute wie der Bremer Sozialpsychologe Gerhard Meyer extrem gefährdete Patienten, die sich nur durch die Art ihrer Sucht von Drogenabhängigen unterscheiden. Der »Arbeitskreis gegen Spielsucht e.V.« im westfälischen Unna kümmert sich ebenfalls seit geraumer Zeit nicht mehr nur um die Opfer von Spielcasinos und »einarmigen Banditen«, sondern immer häufiger auch um jene armen Teufel, die an der Börse schon Hab und Gut verzockten und dennoch immer weitermachen. Geschäftsführer Jürgen Trümper: »Wie jedem Spieler geht es auch dem notorischen Spekulanten nicht eigentlich ums Geld, sondern um das Glücksgefühl beim Spielereignis.«
Das Geschäft machen denn auch nicht die Daytrader, sondern die Betreiber der Trading Centers sowie die mit ihnen verbundenen Broker und Wertpapierhändler. Zwischen 500 und 800 Euro kostet der Arbeitsplatz in einem Trading Center, hinzu kommen teilweise horrende Spesen für jede Transaktion. Wer zum Beispiel mit dem Index spekulieren will und einen Dax Future erwirbt, muss für Kauf und Verkauf etwa 18 Euro an Spesen abführen. Bei der Vielzahl der Transaktionen summieren sich die Gebühren, die in den Trading Centers anfallen, zu stattlichen Summen. Für deren Betreiber sind denn auch die Spekulanten, selbst wenn sie mit ein paar Mark Gewinn nach Hause gehen, nichts anderes als verlässliche Cash-Lieferanten.
Anders als die von ihnen misstrauisch beäugten Abkassierer in Gestalt der Daytrader sind die im Aktiengeschäft tätigen Banken längst nicht mehr nur auf Kauf- und Verkaufsprovisionen angewiesen. Ihre besten Geschäfte machen sie nämlich nicht mit den Nachfragern, sondern mit den Anbietern neuer Aktien. Kam es früher eher selten vor, dass sich ein Unternehmer entschloss, seine als Personengesellschaft organisierte Firma in eine AG umzuwandeln und wenigstens einen Teil davon klein gestückelt ans Börsenpublikum zu verkaufen, so ist dieses »Going Public« mittlerweile zur fettesten Melkkuh der Finanzwirtschaft herangewachsen.
Denn seit es sich herumgesprochen hat, welche Preise die von den Banken aufgewiegelten Aktionäre zu zahlen bereit sind, eilen Deutschlands Firmengründer zahlreich wie nie zuvor zur Börse, und die ist für sie in erster Linie der Neue Markt. Trauten sich im Gründungsjahr 1996 gerade mal 17 das IPO (Initial Public Offering) zu, so waren es 1998 bereits 36 und 1999 erstaunliche 194 Neuzugänge, die um das Geld der Anleger buhlten. So ein Börsengang hat für einen Gründer nicht nur angenehme Seiten: Wenn sein Unternehmen an der Börse gelistet ist, muss er die Macht mit anderen teilen und der Öffentlichkeit Einblick in seine Geschäfte geben – für viele Unternehmer immer noch eine Horrorvorstellung.
Wenn dennoch Deutschlands Aktionären beinahe jede Woche Aktien umgewandelter Personenfirmen zur Erstzeichnung angeboten werden, dann lässt sich daraus schließen, dass so ein Börsengang für die Anbieter immer noch verlockend genug sei. Tatsächlich machte der Boom am Neuen Markt nicht nur ein paar Spekulanten zu Millionären, sondern auch ein paar Gründer zu Milliardären. Legendär ist etwa die Geschichte des Thomas Haffa, dessen Firma EM.TV & Merchandising AG im Jahr vor dem Börsengang gerade mal 24 Millionen Mark umsetzte und dabei noch einen Millionenverlust machte. Kaum aber brach am Neuen Markt die Euphorie für Medienaktien aus, war die Haffa-Firma, die ihr Geld mit dem Rechte- und Lizenzhandel an Filmfiguren wie den Muppets verdient, plötzlich so viel wert wie die Deutsche Lufthansa und ihr Gründer sechsfacher Milliardär. Die Westdeutsche Landesbank, die den Münchner Filmrechtehändler an die Börse brachte, verdiente nicht schlecht an ihrer Emission, ebenso die vielen Haffa-Freunde, die der Gründer vor dem Börsengang an seiner Firma beteiligt hatte. Bezahlen musste den unerhörten Reichtum des ehemaligen Schreibmaschinenverkäufers natürlich niemand anders als die Aktionäre, die nur dann auf der Gewinnerseite blieben, wenn sie früh genug verkauften. Wer zu Höchstkursen um 90 Euro bei EM.TV einstieg, verlor 98 Prozent seines Einsatzes, als der Kurs auf unter 2 Euro fiel.
Reich werden nur die Anbieter
Thomas Haffa jedenfalls legte bereits einen Teil seines schnell erworbenen Vermögens in kostspieligen Statussymbolen an. So standen für ihn an dem für Privatflieger reservierten »General Aviation Terminal« des Münchner Flughafens gleich zwei Düsenmaschinen (Learjet 60 und Challenger 604) bereit, die er von seiner privaten Airline »Air Independent« verwalten ließ. Unabhängig ist Deutschlands Börsengewinnler auch zu Lande und auf dem Wasser. Haffas Villa im Münchner Prominentenviertel Herzogpark kostete 27 Millionen, seine 35-Meter-Yacht nur ein bisschen weniger.
Dass man an der Börse reich werden kann, erzählen uns Wirtschaftsmagazine (Capital, Börse Online, Focus Money etc.) und Ratgeber in Buchform (»Erfolgreich investieren am Neuen Markt« etc.) jeden Tag. Doch Thomas Haffa machte vor, wie es wirklich geht: nicht indem man Aktionär wird, sondern indem man Aktionäre zur Kasse bittet.
Dennoch möchte die Geldwirtschaft nun sogar mithilfe des Staates aus den Deutschen ein Volk von Aktionären machen. Wenn es nach den Wünschen der Banken ginge, sollte jeder berufstätige Bürger auch privat fürs Alter vorsorgen und regelmäßig Geld in Aktien oder Aktienfonds anlegen. Gerne verweisen die Geldhäuser in diesem Zusammenhang auf die USA, wo das Aktiensparen tatsächlich noch verbreiteter ist als bei uns. Bei näherem Hinsehen freilich entpuppt sich der angebliche »Nachholbedarf«, den die Deutschen beim Aktiensparen hätten, schnell als Chimäre.
Denn erstens besitzen auch in Deutschland über 17 Prozent der Bevölkerung Aktien oder Investmentfonds, zweitens beträgt der Aktionärsanteil in den USA nicht 50 Prozent, wie immer wieder behauptet wird, sondern tatsächlich nur 25,4 Prozent, drittens schließlich sparen führende US-Ökonomen nicht mit ihrer Kritik an der finanziellen Abhängigkeit ihrer Landsleute von den Launen der Börse. Die deutlichen Kursrückschläge zehrten seit März 2000 gewaltig an den zu erwartenden Altersbezügen der demnächst aus dem Arbeitsprozess ausscheidenden US-Bürger.
Vollends zum Lotteriespiel wird die finanzielle Versorgung im Alter, wenn man, wie viele Amerikaner, seine Aktien auch noch auf Pump kauft, in der Hoffnung, die Kursgewinne fielen höher aus als die zu zahlenden Zinsen. Bereits 1999 hatten die Amerikaner Wertpapierkredite über 278,5 Milliarden Dollar aufgenommen – für Notenbankchef Alan Greenspan Grund genug, von einer »sehr ernsten Lage« zu sprechen. Haben die Deutschen also einen »Nachholbedarf« in Sachen Aktien? Eher wohl im Verzehr von Hamburgern oder im Tragen von Cowboyhüten!
Wie wenig Verlass auf Aktien ist, wenn sie der Altersvorsorge dienen sollen, erfuhren in den Wochen nach dem Frühjahrscrash 2000 nicht nur viele Deutsche und Amerikaner, sondern auch unsere europäischen Nachbarn. Ausgestattet mit einer guten Portion Galgenhumor, ließ sich die französische Opernsängerin Mireille Diovine in Paris öffentlich zur »Königin der Verarschten« (»reine de cons«) küren, nachdem sie sich zu ihrem Börsenflop bekannt hatte. Ersparnisse von 1,2 Millionen Francs investierte sie 1987 in Aktien jener Gesellschaft, die den Bau des britisch-französischen Kanaltunnels finanzierte: Der Kurs der mit gewaltigem Werberummel angepriesenen Kanal-Aktie fiel von 125 auf zuletzt sieben Francs ab.
Zur Schadenfreude besteht kein Anlass, denn: »Finanzgenie ist man nur bis zum Bankrott«, warnte bereits John Kenneth Galbraith, einer der scharfsinnigsten Nationalökonomen der Gegenwart, vor den Folgen hemmungsloser Aktienspekulationen.
3 | Mächtige & Ohnmächtige
»Gebt uns euer Geld, und wir machen euch reich«, versprachen die smarten jungen Herren, die Ende der 60er-Jahre an vielen deutschen Haustüren klingelten. Sie kamen als Abgesandte eines Amerikaners, der in der Nähe von Genf feudal in einem Schloss residierte und sich anschickte, den Slogan des populären Wirtschaftsministers und Adenauer-Nachfolgers Ludwig Erhard endlich in die Tat umzusetzen: »Wohlstand für alle.« Während die von Rudi Dutschke aufgeputschten Studenten für eine freie Gesellschaft ohne Klassenschranken auf die Straße gingen, stellten die gut geschulten Vertreter des Midas vom Genfer See ihrer Kundschaft überzeugend ein Leben in ewigem Reichtum in Aussicht.
Die wundersame Geldvermehrung sollte natürlich nicht durch Arbeit zustande kommen, sondern allein durch die Erträge von Wertpapieren, die bis dahin in Deutschland weitgehend unbekannt waren. Es handelte sich um Anteile an einer Firma, die sich Fund of Funds nannte und die wiederum an einer Vielzahl angeblich höchst lukrativer Unternehmen, vornehmlich in den USA, beteiligt war. Mit ihrem neuartigen Haustürvertrieb und beeindruckenden Gewinnausweisen versetzten die IOS-Vertreter Deutschlands Geldanleger für eine Weile in so gute Stimmung, dass sie binnen kurzer Zeit viele Milliarden Mark einsammeln konnten.
Das Ergebnis ist bekannt: Ende 1968 krachte das auf luftigen Prognosen gebaute Geldimperium des »Midas« Bernie Cornfeld in sich zusammen, und Tausende gutgläubiger Anleger mussten ihre Einlagen abschreiben. Am Ende waren Cornfelds Investmentzertifikate nicht mal mehr das Papier wert, auf das man sie gedruckt hatte.
Es war nicht das erste und wohl auch nicht das letzte Mal, dass Deutschlands Geldanleger einem groß angelegten Schwindel aufsaßen. Nichts wirkt auf Leute mit Geld offenbar verführerischer als das Versprechen von noch mehr Geld. Und wer dieses Versprechen nur glaubwürdig genug vorbringt, wird auch dann reich, wenn er es mit der Einlösung nicht mehr so genau nimmt. Als wirksamstes Vehikel für die Mär vom mühelosen Reichtum hat sich immer mal wieder die Börse bewährt. Zwar fanden auch Spielbanken, Lotterien und Glücksspielautomaten zu allen Zeiten ihre Opfer, doch nichts beflügelt Fantasie und Intellekt auch aufgeklärter Bürger so sehr wie die Vorstellung, sich mit Glück und Cleverness ein Vermögen zu erspekulieren.
Von den Jägern verlorener Schätze unterscheidet sich der Aktienspekulant ebenso wie von den reinen Glücksspielern: Das eine ist ihm zu mühselig, das andere zu sehr vom Zufall abhängig. Im Innersten ist er davon überzeugt, schlauer zu sein als die anderen, und der Gewinn an der Börse liefert ihm den unwiderlegbaren Beweis für seine Selbsteinschätzung. »Wenn mir eine Spekulation glückt«, bekannte einst André Kostolany, »dann freue ich mich in erster Linie nicht über das Geld, das ich dabei einstreiche, sondern über die Tatsache, mit meiner Idee gegen die Meinung der anderen Recht bekommen zu haben.«
Der langjährige Kolumnist des Wirtschaftsmagazins Capital sprach seinen Lesern aus dem Herzen, als er sein Glaubensbekenntnis offenbarte: »Für mich ist der Spekulant der intellektuelle, mit Überlegung handelnde Börsianer, der die Entwicklung der Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft richtig prognostiziert und davon zu profitieren versucht.«
Was Kostolany, der in Wahrheit mehr Journalist als Spekulant war, seinen Lesern und Zuhörern wohlweislich verschwieg, ist die Tatsache, dass der Idealtypus des mit Geld und Geist gesegneten Spekulanten in der Wirklichkeit so selten vorkommt wie ein kindskopfgroßer Goldbrocken im Treibsand des River Klondike in Kanada. Im Normalfall nämlich ist der kleine Aktionär, auch wenn er über ein paar Milliönchen verfügt, an der Börse immer das Wild, das von anderen gejagt und gefleddert wird.





























