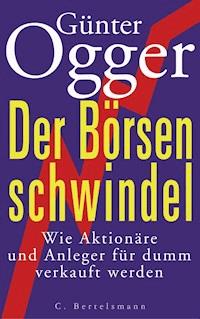Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kapitel 1 – Das Drama der Angestellten
Entlassungen mit Kursgewinnen belohnt
Der Mittelstand bricht weg
Zugeknöpfte Personalchefs
Die Inside-Outside-Ökonomie
Der Mitarbeiter ersetzt den Angestellten
Einmal Bosch, immer Bosch
Angst und Verzweiflung
Verfall der guten Sitten
Die Stimme der Enttäuschten
Aus Stallhasen werden keine Tiger
Von Machern und Gemachten
Ein Leben jenseits der Anstellung
Die Masse muss nicht arbeiten
Kapitel 2 – Ausgelagert und abgeschoben
Die vergeudete Arbeitskraft
Schreckensbilanz der Konzerne
Ein Streik um Sein oder Nichtsein
Die neuen Konkurrenten lernen schnell
Offshoring und Outsourcing
Lufthansa-Rechnungen aus Polen
Die Angestellten ziehen stets den Kürzeren
Kostenfaktor Kind
Getrickst, getäuscht, gelogen
Das Logistikzentrum leer geräumt
Das goldene Dreieck der Dänen
Soziale Absicherung in den Niederlanden
Kapitel 3 – Verblichener Luxus
Keine Zeit für Problemlösungen
Ein Rundum-sorglos-Paket geschnürt
Verpatzte Gelegenheiten
Worauf es ihm wirklich ankam
Banker treiben den größten Aufwand
Im Büro feindliche Städte niedergebrannt
Warum er Meetings liebte
Heimlich ein Dossier angelegt
Kapitel 4 – Der Flexifaktor
Das Beschäftigungsrisiko wird abgewälzt
Das Instrumentarium ausgereizt
Leiharbeiter sind teurer als Festangestellte
Sicherheitsbedürfnis der Angestellten
Lieber arbeitslos als umgezogen
Die Konzerne machen sich locker
Der Markt bestimmt die Regeln
Die Zone der Verwundbarkeit
Jeder Zweite hat die Schnauze voll
Arbeitskräfte on demand
574-mal den Vertrag verlängert
Die Zukunft gehört den Jobbern
Putzen für 1,92 die Stunde?
Man spricht wieder Deutsch
Die Not der Geisteswissenschaftler
Die Welt der Projektarbeiter
Kapitel 5 – Gier, Frust und Angst
Luftrechnungen über 50 Millionen Euro
Auf dem Golfplatz ging man ins Detail
Geldbündel im Heizungskeller versteckt
Schaffen und Anschaffen
Eine Zelle für den Vorstand
Ein Milchwerk wird gemolken
Amigos im unmöglichen Möbelhaus
Leistungsgerechte Bezüge – leistungslose Bereicherung
Bananenrepublik Deutschland?
Kapitel 6 – Zu Tode gesiegt
Die Rezepte von früher greifen nicht mehr
Machtverlust, Heuchelei und Disziplinlosigkeit
Nach den Regeln der Kunst eingeseift
Einladung zum Schmieren
Schlimmer als der finsterste Kapitalist
Zwangsdarlehen abgepresst
Brüder des Kapitals
Bürgernahes Kontrastprogramm
Rückwärts gepolte Protestmaschine
Hoffen auf die Billiglöhner
Kapitel 7 – Der unaufhaltsame Aufstieg
Mit »Privatbeamten« fing es an
Das Drei-Klassen-System eingeführt
»Diese ewigen Betrügereien...«
Erfindungen gehören der Firma
Bismarck und die soziale Frage
Lohnarbeiter der besonderen Art
Pufferzone Neuer Mittelstand
Der Dienst am Vaterland macht arm
Ein US-Dollar kostete 40 Milliarden
Der Linksruck der Büromenschen
Hass auf die Reichen und Mächtigen
Keine Sonderrechte für die Angestellten
Es gab nur noch »Soldaten der Arbeit«
Angst vor dem »Lumpenproletariat«
Die unsichtbaren Kraftlinien
Links war schick
Das Revier der Frauen
Symbiose mit den Selbstständigen
Kapitel 8 – In der Wagenburg
Der Job wird zum Risikofaktor
Angestellte bestimmen, was der Chef verdient
Die erste und die zweite Klasse
Malochen bis zum Umfallen
Downshifting – ein exklusives Vergnügen
Müde vom ständigen Umorganisieren
Bluffen und Blenden
Bosse mögen keine Schlaumeier
Großfahndung nach den Entlassenen
Warum die »Greencard« floppte
Kapitel 9 – Die Zukunftsarbeiter
Im Ozean der Arten
Banker halten die Taschen zu
Kurzweiliges Leben
Virtuell oder nur beweglich?
Zum Arbeiten nach Hause geschickt
Der »Hot Desk« ersetzt den Schreibtisch
Alles mitgemacht, was verlangt wurde
Vom Change- zum Self-Management
»Multiple Vermittlungshemmnisse«
Nicht jeder ist ein Picasso
Kapitel 10 – Schöne Gesellschaft
»Ehrliche Arbeit« wird entwertet
Allein in der Teeküche
Edle Vertreter des Leistungsgedankens
Keine Zeit fürs Privatleben
Wenn Verlierer die Wahl gewinnen
Eine Schicksalsfrage der Nation
Der Vorsprung schmilzt
Eine Zone des Mangels
Für jeden ein Scheck über 706 Euro
Die Mächtigen dulden kein Schlaraffenland
Die deutschen Angestellten haben es in der Hand
Literaturverzeichnis
Personen- und Sachwortverzeichnis
Copyright
Einleitung
Meine kurze Karriere
Der Kanzler hieß Adenauer und der Golf war ein Käfer, als ich mich um einen Ausbildungsplatz bewarb. Ende der 1950er-Jahre hießen Azubis noch Lehrlinge, und mein erster Chef machte mir schnell klar, was sie darunter verstand: Herr im Haus der Buchhandlung J. Schmoldt in Schwäbisch Gmünd war nämlich Frau Jörg. Sie ließ mich Staub wischen, Pakete schleppen und ins Schaufenster kriechen. Ich war ihr dennoch dankbar für meinen ersten Job, der mir 60 Mark Monatslohn und 14 Tage Jahresurlaub einbrachte. Er war der Einstieg in meine Angestelltenkarriere.
Ich wollte Journalist werden, und in dem schwäbischen Provinzstädtchen, in dem ich aufwuchs, gab es zwei Zeitungen. Die Gmünder Tagespost hatte keinen Bedarf an einem Volontär, und bei der Rems-Zeitung sagten sie mir, mit meinen 17 Jahren und der Mittleren Reife sei ich zu jung und zu wenig gebildet. Das mit dem Alter erledigte sich im Lauf der Zeit von allein, und die Bildung verschaffte ich mir in der Buchhandlung, wo ich las, was an Gedrucktem ins Haus kam. Weil mich auch Bücher interessierten, für die es in Schwäbisch Gmünd keine Leser gab, erfand ich welche. Für meine fiktiven Kunden bestellte ich Werke von Hegel und Kant, Arno Schmidt und Enzensberger, Marx und Sartre, welche ich nach der Lektüre mit Bedauern an die Verlage zurücksandte.
Den Kontakt zur Redaktion hielt ich aufrecht, indem ich Berichte über Volkshochschulvorträge und Jazzkonzerte ablieferte, sodass sie mich schließlich, nachdem ich den Kaufmannsgehilfenbrief erworben hatte, im Frühjahr 1960 als Volontär anstellten. Von nun an hatte ich einen festen Platz in der Redaktion, verdiente 580 Mark im Monat, und schrieb fleißig Artikel über das weltbewegende Geschehen in unserer kleinen Stadt. Als ich nach einem Jahr zum Redakteur befördert wurde, hielt ich mich für den nach Augstein zweitbesten Journalisten des Landes und hatte keine Zweifel, eines Tages ganz oben anzukommen. Nach meinem damaligen Verständnis war das etwa das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen, die Chefredaktion der Zeit, zur Not auch eine Ressortleitung beim Spiegel.
Dreizehn Jahre und einige Verlage später war ich zwar Chefredakteur, verdiente satte 7000 Mark im Monat und hatte Anspruch auf einen Dienstwagen der oberen Mittelklasse, doch die Tücken des Angestelltendaseins blieben mir nicht verborgen. Die Willkür von Vorgesetzten habe ich ebenso zu spüren bekommen wie die Missgunst mancher Kollegen. Bei meinem vorletzten Job, in der Redaktion des Wirtschaftsmagazins Capital, wurde mir ein Boss vor die Nase gesetzt, der mir nicht passte, und mein Aufstieg in die Chefetage eines Offenburger Großverlags war eine Farce.
Das Blatt, das ich künftig leiten sollte, verschwand nach einem einsamen Entschluss des Seniorverlegers von der Bildfläche, noch ehe ich meine Talente unter Beweis stellen konnte. Seine alternativen Vorschläge – ich hätte entweder eine Programmzeitschrift machen oder gar für seine bunte Illustrierte arbeiten sollen – empfand ich als Zumutung. Also fasste ich mit 31 den folgenschweren Entschluss, auf Karriere und sicheres Einkommen zu verzichten und nie mehr im Leben eine abhängige Stelle anzutreten. Bis heute habe ich mich daran gehalten – und dies nie bereut.
München, im Juli 2007
1
Das Drama der Angestellten
Was mir vor 35 Jahren relativ leicht gelang, ist heute für viele Angestellte eine bittere Notwendigkeit. Nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil ihnen keine andere Wahl bleibt, verabschieden sich immer mehr Deutsche aus dem, was die Arbeitsmarktstatistiker ein unbefristetes sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis nennen. Millionen halten sich bereits mit Mini- oder Midi-Jobs über Wasser, malochen als Teilzeitkräfte oder vorübergehend. Beschäftigungslose Zeiten überbrücken sie mit einer Ich-AG, und nicht wenige von ihnen hoffen, als Mikro-Unternehmer in freier Wildbahn überleben zu können. Flexibilität heißt das Gebot der Stunde, und wer nicht schnell genug den nächsten Auftrag an Land zieht, bleibt auf der Strecke.
Die Kündigungswelle, die derzeit durchs Land rollt, ist deswegen so erschreckend, weil sie unsere Gesellschaft grundlegend verändern wird. Die Jobs, die jetzt wegrationalisiert werden, kommen in dieser Qualität nicht wieder. Ersetzt werden sie allenfalls durch flexible Beschäftigungsverhältnisse, die schlechter bezahlt, weniger geschützt und jederzeit kündbar sind. Als Krupp das Stahlwerk Rheinhausen dichtmachte, Opel Tausende von Autobauern nach Hause schickte und im Osten die Industriekombinate der DDR abgewickelt wurden, da war das für die Betroffenen zwar eine Katastrophe, aber Deutschland blieb, was es war – ein Wohlfahrtsstaat, der auch unter der Last von fünf Millionen Arbeitslosen nicht zusammenbrach. Was ihn zusammenhielt, war jene staatstragende Schicht der gut verdienenden Angestellten, die sich jetzt allmählich aufzulösen beginnt.
Der Niedergang der Arbeiterklasse erscheint harmlos im Vergleich zu dem Drama, das die rund 18 Millionen Angestellten der Nation erfasst hat. Eliminiert, ersetzt oder ausgelagert werden jetzt nicht mehr die Muskeln der deutschen Wirtschaft, sondern ihr Gehirn. Optimierte Betriebsabläufe und verschlankte Organisationsstrukturen machen einen Großteil des bisherigen Middlemanagements überflüssig. Moderne Informationstechnik ersetzt in immer schnellerem Tempo Entwickler und Konstrukteure, Buchhalter und Controller, Produktionsplaner und Vertriebsleute. Und was sich nicht automatisieren lässt, wird dort erledigt, wo die Kosten gering sind. Im früheren Ostblock wie in China, auf dem indischen Subkontinent wie in Südostasien warten Millionen gut ausgebildeter Ersatzleute auf ihre Chance, für einen Bruchteil der deutschen Gehälter Daten einzugeben und auszuwerten, Rechnungen zu kontieren oder Computerprogramme zu schreiben. Jeder zweite Büroarbeitsplatz ist, nach einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, akut gefährdet.
Entlassungen mit Kursgewinnen belohnt
»Büroflächen zu vermieten« – die Plakate zieren Neubauten in bester Zentrumslage ebenso wie leer gefegte Industriedenkmäler am Rande der Stadt. Wohin sind wohl all die Menschen verschwunden, die hier einst den Schriftverkehr abwickelten, Tabellen tippten, Kalkulationen erstellten oder Angebote verfassten? Und wo sind die, die hier einziehen sollten? Sitzen sie vielleicht irgendwo in Ungarn, wo Audi Motoren bauen, Lufthansa Tickets abrechnen und SAP Software entwickeln lässt? In Rumänien, wo Hunderte von Ingenieuren für Conti an Steuerungssystemen für Fahrwerke tüfteln? Oder gar in Indien, wo die Deutsche Bank zuletzt drei Milliarden investierte und 4000 Mitarbeiter einstellte? Jedenfalls sind sie nicht mehr da, wo sie eigentlich hingehörten, und das ist das Thema dieses Buches.
Es ist noch nicht lang her, da wurde Deutschlands Mittelklasse in der ganzen Welt bewundert und beneidet. Nirgendwo sonst verdienten abhängig Beschäftigte so viel Geld für so wenig Arbeit. Selbst die saturierten Schweizer oder die ölreichen Norweger mussten fürs gleiche Gehalt länger malochen als die Bewohner des Angestelltenparadieses zwischen Füssen und Flensburg. Die Privilegien deutscher Arbeitnehmer, vom Kündigungsschutz über die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bis hin zum Weihnachtsgeld, waren ebenso sprichwörtlich wie ihr in Blech gestanzter Wohlstand. Mit ihren Urlaubsbudgets finanzierten sie halb Südeuropa, und ihr Hunger nach immer teureren Autos machten Daimler & Co zur mächtigsten Industrie des Kontinents. Sie selbst hielten ihre sozialen Besitzstände für selbstverständlich und Kanzler Helmut Kohl, als er über den »kollektiven Freizeitpark Deutschland« lästerte, für einen Spielverderber.
Inzwischen hat sich, jeder weiß es, das Blatt gewendet. Maßen die Bosse der Wirtschaft ihre Bedeutung einst an der Zahl der Leute, die sie beschäftigten, so gilt in ihren Kreisen heute jeder, der noch viele Leute auf der Payroll stehen hat, als bedauernswerter Tropf. Gnadenlos strafen die Finanzmärkte Konzerne mit überdimensionierten Belegschaften ab – wie Post und Telekom. Entlassungen hingegen werden mit Kursgewinnen belohnt – bei VW und DaimlerChrysler wie bei Allianz, Deutscher Bank und Siemens. Die Rendite aufs eingesetzte Kapital ist jetzt die Messzahl, auf die es ankommt. Das einst hochgelobte »Humankapital« steht nur noch als Kostenfaktor in der Bilanz, und die Möglichkeiten, ihn zu minimieren, sind heute größer denn je.
Binnen weniger Jahre hat sich das weltweite Angebot an ausgebildeten Arbeitskräften von 1,46 auf 2,98 Milliarden Menschen verdoppelt; China verfügt bereits über 1,6 Millionen Ingenieure, die zu lächerlichen Stundensätzen auch für europäische Auftraggeber arbeiten, und jedes Jahr verlässt eine weitere Million die Hochschulen; Indiens Ingenieure vermehren sich jährlich um 400 000. Angesichts der für sie paradiesischen Zustände stellen Deutschlands Arbeitgeber ihre Beschäftigten vor die Wahl: schlechtere Jobs oder keine Jobs. Der nach Haustarif bezahlte Luxusangestellte ist, ob man es zugeben mag oder nicht, ein Auslaufmodell, und die alte, sozialdemokratisch legitimierte Arbeitnehmerherrlichkeit wird nie wieder zurückkehren.
Zu besichtigen ist eine sterbende Kaste. Auch wenn sich unsere Politiker ob der aktuell wieder etwas freundlicheren Botschaften aus der Nürnberger Bundesanstalt auf die Schultern klopfen und regierungsfromme Medien voreilig von einem »Durchbruch am Arbeitsmarkt« schwadronieren – der jüngste Konjunkturaufschwung verdeckt in Wahrheit nur die Tatsache, dass die meisten der neu eingestellten Arbeitskräfte in atypischen Jobs landen. Sozialwissenschaftler verstehen darunter geringfügig oder befristet Beschäftigte ebenso wie Teilzeitkräfte oder Leiharbeiter.
Der Mittelstand bricht weg
Während das Heer der atypisch Beschäftigten von Tag zu Tag mit erstaunlichem Tempo wächst, schrumpft der große Rest immer weiter zusammen. Erfreuten sich 1968 noch über 75 Prozent aller Erwerbspersonen in Westdeutschland einer unbefristeten Vollzeitstelle, so waren es Ende 2006 nur noch gut die Hälfte; rund 4,6 Millionen steckten bereits in Teilzeitjobs. Alarmierend ist der hohe Anteil der »prekären« Arbeitsverhältnisse, die so wenig abwerfen, dass es kaum zum Leben reicht. Nach einer 2006 veröffentlichten Studie der IG Metall muss sich jeder vierte Arbeitnehmer unter 30 mit einem Hungerleiderjob zufriedengeben.
Alle Welt redet über den »demographischen Faktor«. Wegen der drohenden Überalterung der Gesellschaft sorgen sich Politiker um die gesetzlichen Renten- und Krankenkassen, fürchten Unternehmer und Manager die nachlassende Kaufkraft der Kundschaft, beklagen Sender, Verlage und Werbeagenturen das schwindende Medieninteresse. Kaum jemand hat den mindestens ebenso bedeutsamen »Flexibilitätsfaktor« auf dem Radarschirm: Wenn der Großteil der erwerbsfähigen Bevölkerung nur noch »flexibel« beschäftigt ist, schwinden Stabilität und Zukunftsvertrauen. Junge Leute werden sich kaum noch auf Ehen und Kinder einlassen, die mittleren Jahrgänge auf Häuser und Hypotheken verzichten. Man lebt von der Kreditkarte in den Mund, scheut langfristige Verpflichtungen, wechselt den Partner fast ebenso leicht wie die Partei, den Wohnort oder die Automarke. Wer sich jung und stark fühlt, verlässt das Land, wer über gefragte Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, bietet sein Knowhow auf dem Weltmarkt an. Etwa 150 000 Deutsche wanderten im Jahr 2006 aus; die meisten zog es in die Schweiz.
Nicht einmal die Wiedervereinigung hat die Nation so sehr durcheinandergewirbelt wie die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Altbewährte Strukturen werden über Nacht obsolet, ganze Wirtschaftszweige geraten in Gefahr. Das fängt mit den vielen unvermieteten Büros an und hört mit dem nachlassenden Interesse an Lebensversicherungen und Bausparverträgen nicht auf. Banken und Bausparkassen, Geburtskliniken und Gesangsvereine, Kindergärten und Kreditkartenorganisationen, Makler und Möbelhäuser müssen sich auf die neue Mobilität der Deutschen einstellen. Die Frage ist nur, ob die neu gewonnene Freiheit zu so viel mehr Dynamik führt, dass die Nation überleben kann.
Beklagten Politiker, Unternehmer und Medien in den letzten Jahren Verkrustung und Bräsigkeit der deutschen Gesellschaft, so fährt ihnen jetzt, da der Mittelstand wegzubrechen beginnt, der Schreck in die Knochen. »Schluss mit den Reformen«, forderte kategorisch der SPD-Vorsitzende Kurt Beck, und auch in der Union entdecken Spitzenpolitiker wie NRW-Landesvater Jürgen Rüttgers ihr soziales Gewissen. Ein Deutschland ohne seine teuren, aber verwöhnten, fleißigen, aber schwer kündbaren Angestellten vermag sich niemand vorzustellen. Ein Land, das nicht mehr von braven Häuslebauern, sondern von unberechenbaren Jobnomaden bewohnt wird, stellt nicht nur für seine Nachbarn, sondern auch für seine Gläubiger ein erhöhtes Risiko dar. Wer soll die überbordenden Staatsschulden zurückzahlen, wer die maroden Sozialkassen füllen, wenn die Konzerne in Steueroasen flüchten und ihre freigesetzten Angestellten sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten?
Lassen sich demographische Faktoren wie Geburtenzahlen und Altersdurchschnitte anhand der Bevölkerungsstatistik ohne größeren Aufwand präzise bestimmen, so umgibt den »Flexibilitätsfaktor« ein dichter Nebel. Eigenartigerweise weisen weder die offizielle Arbeitsmarktstatistik noch die Erhebungen der verschiedenen Forschungsinstitute den Anteil der flexibel Beschäftigten zuverlässig aus. Gezählt werden neben der Gesamtzahl der Erwerbstätigen (2006: durchschnittlich 39,0 Millionen) nur die sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze: 2006 waren das 26,36 Millionen.
Zugeknöpfte Personalchefs
Noch zugeknöpfter geben sich die Personalchefs in den Unternehmen, wenn man sie nach dem Anteil von Zeitarbeitern, Teilzeit- oder Kurzfristbeschäftigten an ihren Belegschaften fragt. Überall heißt es: Dazu möchten wir nicht Stellung nehmen. Bei Siemens zum Beispiel weiß angeblich nicht einmal der Betriebsrat genau Bescheid, obwohl seine Vertreter im mitbestimmten Aufsichtsgremium des Münchner Elektrokonzerns sitzen. Auch die Autoindustrie verschweigt geflissentlich, dass ihre Karossen schon zu einem erheblichen Teil von Leiharbeitern zusammengebaut werden. »Weder BMW, Ford, Mercedes, Opel und VW noch die großen Zulieferer wie Bosch oder Conti sprechen offen über das Thema Zeitarbeit«, wundert sich Professor Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research an der Fachhochschule Gelsenkirchen.
Fast schon beleidigt reagierte man bei der schnell wachsenden PIN Group auf unsere Anfrage. Das Logistikunternehmen mit Sitz in Luxemburg, an dem die führenden deutschen Pressekonzerne beteiligt sind, will zwar für Brief- und Paketzustellung binnen eines Jahres bis zu 35 000 Leute einstellen, verschweigt aber, dass es sich überwiegend um gering bezahlte oder prekäre Jobs handelt.
Über die Motive der Geheimniskrämerei lässt sich nur spekulieren. Möglicherweise wollen die Personalchefs den Gewerkschaften keinen Anlass für eine neue Beschäftigungskampagne bieten, vielleicht befürchten sie auch einen offenen Konflikt zwischen den beiden Arbeitnehmerklassen.
Bezeichnend für die wahren Verhältnisse am Arbeitsmarkt ist der jüngste Boom der Zeitarbeitsbranche. Als die US-Firma Manpower Mitte der 1970er-Jahre ihre erste Deutschland-Filiale eröffnete, kam sie schnell in den Ruf, so etwas wie ein moderner Sklavenhalter zu sein. Mit aller Macht versuchten die Gewerkschaften zu verhindern, dass die Unternehmen Leiharbeiter in nennenswerter Zahl einstellten, und die jeweiligen Bundesregierungen leisteten Schützenhilfe, indem sie die aufstrebende Branche harten Restriktionen unterwarfen. So durften die Leiharbeitskräfte höchstens drei Monate ununterbrochen an derselben Stelle jobben, und die Verleiher mussten ihnen ähnlich großzügige Sozialleistungen gewähren wie sie die fest angestellten Stammbelegschaften genossen. Derart geknebelt, gelangte die Verleiherbranche in Deutschland nie zu jener Bedeutung, die sie in Ländern wie Frankreich, den Niederlanden oder der Schweiz längst erreicht hatte. Erst mit dem Scheitern der Hartz-Reform – und unter dem Druck der EU-Kommission – wuchs auch in Regierungskreisen die Einsicht, dass ein Leiharbeiter immer noch besser ist als ein Nichtarbeiter.
Kaum wurden die gesetzlichen Bremsen ein wenig gelockert, vollbrachten die »Sklavenhalter« ein wahres Beschäftigungswunder. Bis zu 700 000 Deutsche jobben mittlerweile bei den Zeitarbeitsfirmen, und es sind beileibe nicht nur Hilfskräfte, mit denen die Auftraggeber Urlaubszeiten oder Auftragsspitzen abzufedern versuchen. Verleiher wie Adecco, Randstad, DIS oder Brunel beschäftigen immer öfter hoch qualifizierte Ingenieure und Informatiker, die für DaimlerChrysler Autos, für Airbus Flugzeuge oder für Siemens Transformatoren konstruieren. Sogar Manager und Mediziner finden sich im Leihangebot und tragen dazu bei, dass Bewegung in den Arbeitsmarkt kommt. Doch jeder auf Zeit beschäftigte Kollege ist für Deutschlands Vollzeitangestellte eine leibhaftige Prognose: Die Zukunft riecht nach Risiko, und das ist nicht nur für Arbeitnehmer eine grausige Vorstellung.
Der Umgang mit der Ungewissheit spaltet die Nation wie kaum ein anderer Tatbestand. Religionen, Parteien und ethnische Gruppen bewegen sich aufeinander zu, doch der Graben zwischen der risikoscheuen Mehrheit und einer risikobereiten Minderheit vertieft sich von Tag zu Tag. Viele Angestellte und ihre Gewerkschaftsfunktionäre zucken zusammen, sobald das Wort »Reform« fällt, gleichzeitig sehnen die Selbstständigen und die Jüngeren immer ungeduldiger den schon vom Altpräsidenten Roman Herzog erhofften »Ruck« herbei, der das Land endlich nach vorne bringen möge.
Die Inside-Outside-Ökonomie
Dieser Ruck blieb bislang aus, dennoch schmelzen die sozialen Besitzstände so unaufhaltsam dahin wie die Alpengletscher in der Mittagssonne. Fürs gleiche Geld muss jetzt in vielen Betrieben länger gearbeitet werden, Standortgarantien gibt es nur noch gegen Verzicht auf Sonn- und Feiertagszuschläge, am Kündigungsschutz sägt bereits die Regierung. Die einst so mächtigen Gewerkschaften führen lautstarke Rückzugsgefechte, aber zum Angriff auf die »Arbeitsplatzvernichter« fehlt ihnen die Kraft: Arbeitslose zahlen keine Beiträge, die Mitgliederzahlen bieten ein Bild des Erbarmens.
Was Ver.di und der IG Metall, den beiden mächtigsten Arbeitnehmerorganisationen, zu schaffen macht, ist die Aufspaltung ihrer Klientel in »die da drinnen« und »wir da draußen«. Wer noch auf einem weich gepolsterten Bürostuhl sitzt, will ihn nicht gefährden, und wer alle paar Wochen woanders jobbt, kämpft nicht für Arbeitnehmerrechte. Abgesehen davon fehlt es den Arbeitnehmervertretern an Ideen, wie sie der schleichenden Erosion der Belegschaften Einhalt gebieten könnten.
Als in der Münchner Hofmannstraße 2300 Siemens-Angestellte freigesetzt werden sollten, da war es nicht die sonst so wortmächtige IG Metall, die den Kahlschlag aufhielt, sondern privat organisierter Widerstand. Nach ihrem Rausschmiss gründete die Softwareentwicklerin Inken Wanzek ein Netzwerk der Betroffenen, das den Konzernoberen schwer zu schaffen machte. Auf ihrer Internethomepage nci-net informierten die Widerständler laufend über die Maßnahmen der Gegenseite und verbreiteten Tipps für juristisch richtiges Verhalten. Mithilfe des Betriebsrats und guten Anwälten führten sie rund 200 Kündigungsschutzprozesse – und verloren keinen einzigen. Genervt von der unerwünschten Publicity, reduzierte der Konzern die Zahl der Kündigungen auf die Hälfte. Doch die Gewerkschaftsfunktionäre, um ihren Einfluss bangend, zollten den Netzwerkern keinen Beifall, sondern sagten ihnen den Kampf an.
Der Spaltprozess ist nicht mehr aufzuhalten. Schon sprechen die Wirtschaftswissenschaftler von einer »Inside-Outside-Ökonomie«: Wenige privilegierte »Insider« dirigieren in den Unternehmen wachsende Heere von »draußen« auf Zeit beschäftigten Billiglöhnern. Überall in den Konzernzentralen wird darüber nachgedacht, wie die Unternehmen noch »schlanker« gemacht, welche Bereiche noch »outgesourct« werden könnten. Bei Unternehmensberatern kursieren Konzepte für rein virtuelle Firmen, deren Sitz in irgendeiner Steueroase angesiedelt ist und die nur noch aus einer Handvoll Managern bestehen. Alles, was sie zur Herstellung der geplanten Produkte benötigen, kaufen sie preiswert auf dem Weltmarkt ein, mitsamt dem Wartungsservice und der Reklamationsabteilung. Auf eigene Angestellte kann eine solche Gesellschaft weitgehend verzichten.
Der Angestelltenrepublik gehen also die Angestellten aus. Höchste Zeit, sich mit jener Spezies näher zu beschäftigen, die den Wohlstand und die Kultur der Nation ebenso repräsentierte, wie sie ihren Bewusstseinszustand prägte.
Der Mitarbeiter ersetzt den Angestellten
Vieles, was gut und teuer ist in Deutschland, hat dieses Land den Angestellten zu verdanken. Einer Gruppe von Beschäftigten also, die stets Gefahr lief, zwischen den ehemals dominierenden Mächten zerrieben zu werden. Die Klassenkämpfer aus dem Gewerkschaftslager verachteten die Weiße-Kragen-Täter lange Zeit als Handlanger des Kapitals, und die bürgerlichen Oberschichten akzeptierten sie nie als ihresgleichen. Dennoch blieben die belächelten Büroarbeiter am Ende Sieger im Wettkampf der gesellschaftlichen Gruppen: Keine andere Bevölkerungsschicht wuchs im 20. Jahrhundert so schnell wie die der Angestellten, und keine gewann so viel Macht hinzu. Zählte der Soziologe Gustav Schmoller im Reich Kaiser Wilhelms I. anno 1895 gerade mal 600 000 Untertanen, die er »dem neuen Mittelstande« zurechnete, so werkelten hundert Jahre später in den Büros und Labors der wiedervereinigten Bundesrepublik Deutschland genau 18 688 567 Menschen in einem Angestelltenverhältnis. Dies jedenfalls vermutet das Statistische Bundesamt in Wiesbaden.
Vielleicht waren es mehr, vielleicht auch weniger, denn eine der Schwierigkeiten, über die rarer werdende Spezies zu berichten, besteht darin, dass niemand mehr so recht weiß, was eigentlich ein Angestellter ist. Im Jahr 2001 ging die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft (DAG) in Ver.di auf, und am 1. Mai 2005 wurde die Bundesanstalt für Angestellte von der Deutschen Rentenversicherung übernommen. Seither gibt es kein zuverlässiges Unterscheidungsmerkmal zwischen Arbeitern und Angestellten mehr. Die Lohntüten sind abgeschafft, die Gehälter werden aufs Konto überwiesen, die Betriebe kennen offiziell nur noch »Mitarbeiter«.
Nicht die blauen, sondern die weißen Kragen entwickelten den erfolgreicheren Lebensentwurf. Angestellte hielten nichts vom Klassenkampf, dafür umso mehr vom sozialen Aufstieg. Der allerdings sollte möglichst ohne Risiko vonstatten gehen – Schritt für Schritt in eine planbare Zukunft. Der biedere Lebenszuschnitt mit Bausparvertrag und garantierter Rente hatte für Deutschlands Arbeitnehmer mehr Reiz als die Idee von der Herrschaft des Proletariats und der amerikanische Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Traum zusammen.
Auf den goldenen Mittelweg der Angestellten stimmten sich, bis auf ein paar Randgruppen, nach und nach die Arbeitermassen ebenso ein wie die bürgerliche Oberschicht. Das Angestelltenmodell bescherte der Bundesrepublik ein halbes Jahrhundert lang wachsenden Wohlstand und innere Stabilität. Es half, die Nation in den westlichen Wirtschafts- und Militärbündnissen zu verankern und die finanziellen Lasten der Wiedervereinigung zu schultern. Nun aber steht ihm seine bislang härteste Bewährungsprobe bevor.
Die Wurzeln des Problems reichen zurück bis in die fröhlichen 1970er-Jahre. Als nach Studentenrevolte und Großer Koalition Willy Brandt Bundeskanzler wurde, kam die Zeit der sozialen Wohltaten. Mitbestimmung und Arbeitszeitverkürzung hatten plötzlich Vorrang vor wirtschaftlichem Erfolg. Den Durchbruch schaffte ein schwergewichtiger Gewerkschaftsboss: Indem er seine Busfahrer und Müllmänner, Kraftwerksingenieure und Bahnschaffner in einen wochenlangen Streik schickte, kochte ÖTV-Chef Heinz Kluncker die öffentlichen Arbeitgeber weich. Die Genossen von IG Metall und DAG mochten nicht zurückstehen, und so machten Löhne und Gehälter bald zweistellige Sprünge. Gleichzeitig schnurrten die Arbeitszeiten zusammen, und die Rentner erfreuten sich dynamisch wachsender Altersbezüge. Statt der gewohnten drei gönnte man sich nun sechs Wochen Urlaub, und die IG Metall rief die 35-Stunden-Woche aus. Das neue Betriebsverfassungsgesetz erschwerte Kündigungen und räumte den Betriebsräten mehr Rechte ein, als sie einst zu träumen wagten. In die Aufsichtsräte der Großunternehmen zogen Leute ein, die vom Wirtschaften wenig, von Agitation und Klassenkampf aber eine Menge verstanden. Das Wort vom Ende der Leistungsgesellschaft machte die Runde.
Einmal Bosch, immer Bosch
Während Deutschlands Angestellte sich vom Stress der Aufbaujahre erholten und die neu gewonnenen Errungenschaften bald als selbstverständliche Besitzstände betrachteten, begann – ohne dass sie es merkten – die ökonomische Basis ihres neuen Wohlstands abzubröckeln. Die Unternehmen reagierten nämlich auf die drastisch gestiegenen Arbeitskosten mit verstärkten Rationalisierungsbemühungen und dem Aufbau ausländischer Produktions- und Vertriebsstätten. Unaufhaltsam kletterten die Arbeitslosenzahlen, sodass SPD-Kanzler Helmut Schmidt eines Tages entnervt dagegenhielt: Vier Prozent Inflation seien ihm lieber als vier Prozent Arbeitslose.
Nachfolger Helmut Kohl indes hätte nichts dagegen gehabt, wenn es bei den vier Prozent geblieben wäre. Bald hingen nämlich bis zu elf Prozent der Beschäftigten am Tropf des Staates. Die stetig steigenden Soziallasten ließen sich nicht mehr über die Steuereinnahmen bezahlen und zwangen den Bund zur Finanzierung auf Pump. Spätestens gegen Ende der 1980er-Jahre war das »Modell Deutschland« gescheitert und der Kanzler am Ende seines Lateins. Dass es noch für ein weiteres Dutzend Jahre reichte, war der deutschen Wiedervereinigung zu verdanken, die zunächst eine Scheinblüte der Wirtschaft entfachte und danach den Regierenden das Alibi für weiteres Schuldenmachen lieferte. Nachdem Kohls Erbe Gerhard Schröder mit seiner Agenda 2010 zaghafte Versuche startete, die Sozialkosten zu deckeln und den Arbeitsmarkt zu liberalisieren, wurde auch er abgewählt. Der Block der Reformgegner erwies sich als stärker.
Deutschlands Angestellte sind nicht verantwortlich für die Probleme der Globalisierung, und dennoch sind sie das Problem. Ihr Beharrungsvermögen und ihre Abneigung gegenüber Risiken erschwert die notwendigen Reformen des Arbeitsmarkts. Ihre große Zahl und ihre hohen Einkommen zwingen die Unternehmen zu Rationalisierung und Landflucht. Ihre Privilegien und ihr Sozialkomfort provozieren den Angriff neuer Konkurrenten überall auf der Welt.
Deutschlands Angestellte haben die Wirtschaft ihres Landes groß gemacht: eines Landes, das nach dem verlorenen Weltkrieg weder über Kapital noch über nennenswerte Bodenschätze (von Braun- und Steinkohle abgesehen) verfügte. Ihr Fleiß und ihr Erfindergeist, ihr Engagement und ihre Intelligenz, ihr Lerneifer und ihre Loyalität brachten die Unternehmen nach vorne, manche gar an die Spitze des internationalen Wettbewerbs. Nicht immer Hand in Hand, aber geeint durch den Willen zum Erfolg, marschierten Chefs und Belegschaften durch die Wirtschaftswunderjahre. Anders als ihre Kollegen in Italien, Frankreich oder Großbritannien waren die deutschen Angestellten mehr an Überstunden als an Streiks interessiert und kannten den Begriff Wirtschaftskriminalität höchstens aus der Zeitung. Einmal Bosch, immer Bosch hieß die Devise nicht nur im Schwabenland.
Risse bekam der stillschweigende Sozialpakt zwischen Kapital und Arbeit, als eine elitäre Minderheit unter den Angestellten anfing, ihr eigenes Süppchen zu kochen. Die Rede ist von den Managern, die sich nach dem schrittweisen Rückzug der Unternehmerfamilien aufführten, als wären sie die Eigentümer der Deutschland AG. Im Unterschied zu den geschmähten Kapitalisten aber gehörte ihnen an den Firmen, die sie regieren durften, rein gar nichts. Das Wohl ihrer Belegschaften kümmerte sie – im Gegensatz zu den Patriarchen vom Schlag eines Krupp, Thyssen oder Bosch – nicht die Bohne, denn dafür war ihrer Ansicht nach allein der Staat zuständig. So richtete sich der Angestelltenadel in den Chefetagen bequem ein, seine Mitglieder beförderten sich gegenseitig in Vorstände und Aufsichtsräte und hielten sich unliebsame Konkurrenz vom Leibe.
Dann machten die Kapitalmärkte Druck, und die Nachfolger der »Nieten in Nadelstreifen« fingen an, ihre Konzerne mithilfe japanischer und US-amerikanischer Managementmethoden (»Kaizen« oder »Lean Management« hießen die Stichworte) auf Effizienz zu trimmen und die Überkreuzverflechtungen zwischen den Konzernen aufzudröseln. Für ihre Mühen ließen sie sich so reichlich entschädigen, dass alsbald eine Debatte über die Höhe der Managerbezüge losbrach. Verdiente ein Vorstand in den 1970er-Jahren etwa das Zwanzigfache eines Durchschnittsbeschäftigten, gönnte er sich 30 Jahre später das Zweihundertfache.
Angst und Verzweiflung
Im Unterhaus der Wirtschaft wähnten sich die nach Tarif bezahlten Angestellten von der allgemeinen Wohlstandsmehrung abgekoppelt. Der Eindruck täuschte nicht, doch vorübergehend wurde er gemildert durch das wundersame Erblühen der New Economy. Ein einig Volk von Aktionären verdrängte für eine Weile die Mühsal des täglichen Bürokrieges mit der Hoffnung auf immerwährenden Wohlstand, den ihnen die neuen Börsenstars aus der Telekom-, Internet- oder Biotechbranche zu bescheren versprachen.
Der Traum, wir wissen es, endete im Frühjahr des Jahres 2000 mit Kursstürzen, die ein erspartes Vermögen von etwa 800 Milliarden D-Mark vernichteten und sich noch bis zum März 2003 hinzogen. Die zuvor schon gering ausgeprägte Risikobereitschaft der deutschen Arbeitnehmer erhielt einen gewaltigen Dämpfer. Derweil kamen die Volkswirtschaften Chinas, Indiens, Brasiliens und Russlands in Schwung, und die deutschen Unternehmen begannen, die Vorzüge der globalisierten Waren- und Arbeitsmärkte zu entdecken. Jetzt setzte die Angestelltendämmerung erst richtig ein.
Die Härte, mit der die Manager beim Umbau und der Verlagerung der Unternehmen vorgingen, ließ die Stimmung der Beschäftigten kippen. Ihre Zuversicht, mit den Problemen der Globalisierung irgendwie fertig zu werden, schlug um in Angst und Verzweiflung, Trotz und Hass. Als die Kündigungswelle selbst durch scheinbar betonsichere Häuser brandete wie Allianz und DaimlerChrysler, Deutsche Telekom und HypoVereinsbank, lagen die Nerven blank. Sensible Naturen griffen vermehrt zur Flasche oder zum Tranquilizer, ließen sich therapieren oder wenigstens coachen. Nicht wenige flüchteten in Selbsthilfegruppen, vereinzelt kam es gar zu Selbstmorden.
Wie gespannt das Verhältnis zwischen »denen da oben« und »uns da unten« inzwischen ist, erfuhr eine staunende Öffentlichkeit durch den seltsamen Briefwechsel zwischen einem Berliner Telekom-Mitarbeiter und seinem obersten Chef. Am 9. März 2007 verschickte der Angestellte aus dem Bereich T-Com eine E-Mail an René Obermann und seine Vorstandskollegen Höttges und Welslau, die es in sich hatte: »Ich habe erlebt, wie aus uns Mitarbeitern Humankapital wurde und wie wir alle nur noch als Kostenfaktoren angesehen werden, von denen man sich, so schnell es nur geht, trennen muss und will... Sie und Ihre Vorgänger jedoch geben sich im Vorstand die Klinke in die Hand... Sie ziehen mit vollgestopften Taschen weiter, um im nächsten Unternehmen das Gleiche zu tun, und Sie hinterlassen skrupellos einen immer größer werdenden Scherbenhaufen. Wenn wir... uns dann von Ihnen sagen lassen sollen, dass wir zu schlecht, zu teuer, nicht motiviert, faul und unproduktiv seien, dann steigt ob dieser Unverschämtheit eine ungeahnte Wut in uns auf...« Dieser Brandbrief war umso bemerkenswerter, da er von einem noch nicht gekündigten Mitarbeiter kam.
Kurze Zeit später zirkulierte der Brief im Internet, und unversehens avancierte der Absender zum bewunderten Helden der Telekom-Angestellten. »Viele Hunderte Kollegen« hätten ihm ihre Sympathie bekundet, erzählte der T-Com-Techniker später einem Redakteur von Spiegel online.
Der gescholtene Konzernchef wehrte sich ebenfalls per E-Mail: »Kritik ist stets willkommen, und sei sie noch so kontrovers. Vor der Beleidigungsgrenze sollten wir aber haltmachen. Diese Grenze wurde in den jüngsten Briefen mehrfach überschritten...« Obermann wies die Vorwürfe zurück, beklagte Kostennachteile gegenüber Wettbewerbern und verteidigte sein Restrukturierungsprogramm. Den Zorn der aus ihrem Nest vertriebenen Telekom-Angestellten aber konnte er nicht besänftigen.
Verfall der guten Sitten
War es Zufall oder logische Konsequenz, dass sich, als der Graben zwischen Management und Belegschaften aufriss, die Korruptionsskandale, Betrugs- und Untreuefälle zu häufen begannen? Der Mannesmann-Prozess um die millionenschweren Abfindungen raffgieriger Manager, der VW-Skandal um gekaufte Betriebsräte, die Siemens-Affäre mit ihren unappetitlichen Details um Schwarze Kassen und bestochene Auftraggeber, Schmiergelder bei Ikea und Infineon, korrupte Einkäufer bei BMW und betrügerische Vertriebsleute bei DaimlerChrysler, der 400-Millionen-Betrug bei der Geldtransportfirma Heros – ziemlich eindeutige Belege für den Verfall der guten Sitten in der deutschen Wirtschaft. Loyalität war gestern, jetzt leben wir in der EGO-AG. Hier kämpft nicht das solidarische Volk gegen das Kapital, sondern jeder gegen jeden.
Wie kräftig es im Biotop der Angestellten mittlerweile brodelt, dokumentieren nicht nur die überhandnehmenden Diebstähle und Durchstechereien, sondern auch zahlreiche Studien. Regelmäßig untersucht das renommierte Gallup-Institut die Befindlichkeit in den Betrieben – und registriert von Jahr zu Jahr mehr Frust bei den Beschäftigten. 2006 meldeten die Gallup-Forscher neue Tiefststände des Betriebsklimas: Nur noch 13 Prozent der Befragten zeigten eine emotionale Bindung an ihr Unternehmen, eine Mehrheit von 68 Prozent hingegen begnügte sich mit Dienst nach Vorschrift, und immerhin 19 Prozent waren so frustriert, dass sie gegen die Interessen ihres Arbeitgebers handelten. Jeder fünfte Angestellte sabotiert also seine Firma.
Schuld an der Misere haben nach einer im November 2006 veröffentlichten Umfrage von TNS Emnid die Manager, denn 79 Prozent der Befragten gaben an, sie seien davon überzeugt, dass die Bosse nur ihre eigenen Interessen verfolgten, und 42 Prozent hielten sie ohnehin für korrupt. Wen wundert es, wenn das Volk die Konsequenzen zieht?
Entgegen ihrem Ruf, besonders gesetzestreue Bürger zu sein, schlagen die Deutschen mittlerweile heftiger über die Stränge als die europäischen Nachbarn – das fand eine im British Journal of Criminology veröffentlichte Studie der beiden Sozialforscher Susanne Karstedt und Stephen Farrall heraus. Zum Erstaunen der britischen Wissenschaftler, die eng mit der Universität Halle zusammenarbeiteten, gaben 70 Prozent der West- und 60 Prozent der Ostdeutschen zu, notfalls auch zu lügen, zu betrügen und zu täuschen, wenn dabei ein Vorteil für sie herausspringt. Kriminalisierung als Reflex auf Unzufriedenheit und Existenzängste?
Befragt man die Angestellten hingegen nach dem, was sie bei der Arbeit glücklich und zufrieden macht, so offenbart sich das ganze Dilemma ihrer gegenwärtigen Situation: 92 Prozent geben ein festes und verlässliches Einkommen an, 88 Prozent nennen die Sicherheit des Arbeitsplatzes, 85 Prozent eine sinnvolle Tätigkeit und 84 Prozent die Anerkennung durch ihre Vorgesetzten. Jedenfalls ergibt sich das aus dem 2006 veröffentlichten Panel »Was ist gute Arbeit?«, herausgegeben von der »Initiative Neue Qualität der Arbeit« im Auftrag von Bund, Ländern und den Sozialpartnern, und diese Studie belegt damit wohl auch, was die Angestellten am meisten vermissen, wenn sie abgestellt werden: Sie klammern sich an das Beschäftigungsmodell von gestern, wünschen die stabilen Verhältnisse aus der Vergangenheit zurück und sehnen sich nach der persönlichen Wertschätzung von Leuten, die nur ihre eigene Karriere im Kopf haben. Dabei erleben sie eine völlig andere Gegenwart: Kein Job ist mehr sicher, die Kündigung kann täglich jeden treffen. Statt überschaubarer Hierarchien und planbarer Laufbahnen erwartet sie auf dem Arbeitsmarkt das Chaos und der Kampf ums Überleben. »Wir kamen uns vor wie Stallhasen, die plötzlich im Dschungel ausgesetzt wurden«, erinnert sich Inken Wanzek an die Zeit, als Siemens ihre Abteilung in der Münchner Hofmannstraße dichtmachte.
Die Stimme der Enttäuschten
Im Dschungel der untergehenden Angestelltenrepublik kämpft jeder gegen jeden: Junge gegen Alte, Frauen gegen Männer, Rangniedere gegen Ranghöhere, Arbeitsplatzbesitzer gegen das Heer der Bewerber. Und alle eint die Angst vor dem sozialen Abstieg in einer unsicheren Zukunft. »Wir haben die Arschkarte gezogen«, vermutet die Berliner Chefredakteurin Mercedes Bunz. Wie viele aus der sogenannten »Generation Praktikum« hielt sich die Online-Journalistin nach dem Studium mit Gelegenheitsjobs über Wasser. In einer Titelgeschichte über die »urbanen Penner« aus ihrer Altersgruppe bekannte die Dreißigjährige in der Hauptstadtgazette Zitty: »Meine Armut kotzt mich an.« Nicht die soziale Not, die Siegfried Kracauer in seinem 1930 erschienenen Klassiker »Die Angestellten« beschrieb, spricht aus solchen Sätzen, eher dürfte es sich um eine Stimme der Enttäuschten aus der Spaßgesellschaft handeln.
Auch wenn ältere Jahrgänge die Klagen der Jungen nicht so ernst nehmen, weil sie von wirklicher Armut eine etwas andere Vorstellung haben, so ist es doch eine unbestreitbare Tatsache: Selten zuvor war der Einstieg ins Berufsleben so schwierig wie heute. Rund 30 000 Schulabgänger und ein Viertel der Hochschulabsolventen blieben im Jahr 2006 auf der Strecke. Viele, die als Praktikanten jobben, werden gar nicht oder so schlecht bezahlt, dass sie auf Zuschüsse der Eltern angewiesen sind. Jeder zweite Praktikant jobbt nach einer Studie des DGB umsonst.
Die Jungen sind die Verlierer der Globalisierung, bestätigt der Bamberger Soziologe Hans-Peter Blossfeld, der für das Projekt »Globalife« mit einem internationalen Team von Sozialwissenschaftlern die gebrochenen Biografien junger Erwachsener in 18 OECD-Staaten verfolgte.
Dabei sind die heute 30-Jährigen besser auf die Globalisierung vorbereitet als jede Generation vor ihnen. Viele sprechen mehrere Sprachen, verbrachten Schul- oder Studienjahre im Ausland und verfügen über Netzwerke von Bekannten aus aller Welt. Gerade ihre Vielseitigkeit aber wird ihnen mitunter zum Verhängnis. Im Wohlstand aufgewachsen und zur Selbstverwirklichung erzogen, tun sich die Kinder der Achtundsechziger schwer mit den Anforderungen der Wirtschaft. Disziplin empfinden sie als Stumpfsinn, Unterordnung als Zumutung, und nur wenige haben nach dem Studium ein klares Berufsziel vor Augen.
Die Alten sind aus anderem Holz, doch auch sie werden nicht mehr gebraucht. Wenn die Kostensenker von McKinsey und anderen Beratungsgesellschaften die Belegschaften ihrer Klienten durchkämmen, dann geraten als Erste die über 50-Jährigen auf die Abschusslisten. Das noch immer gültige Anciennitätsprinzip, das die Bezüge mit zunehmendem Dienstalter steigen lässt, macht die Senioren zur lohnenden Beute. Lieber verzichten die Unternehmen auf das Wissen und die Erfahrung der Älteren, als dass sie ihnen weiter hohe Gehälter und Pensionen zahlen. Die schädlichen Auswirkungen des Jugendlichkeitswahns sind zwar inzwischen erkannt – die Autohersteller zum Beispiel beklagen eine nachlassende Fertigungsqualität – ihre Personalpolitik ändern aber wollen sie nicht. DaimlerChrysler gab älteren Angestellten bis zu 250 000 Euro mit auf den Weg, wenn sie nur freiwillig die Firma verließen.
Die Frühverrentung ganzer Jahrgänge – nur jeder dritte Angestellte arbeitet noch bis 65 – entlastete zwar die Personaletats der Unternehmen, riss jedoch so tiefe Löcher in die Sozialkassen, dass das Rentenalter auf 67 angehoben werden musste. Wo die Jobs für die Alten herkommen sollen, vermögen allerdings weder Kanzlerin Angela Merkel noch ihr Vize Franz Müntefering schlüssig zu erklären.
Aus Stallhasen werden keine Tiger
Alle haben sie Angst vor der Zukunft: die Jungen, weil sie keinen Job finden, die Alten, weil sie dessen Verlust befürchten. Seit das soziale Netz gerissen ist, graut den Deutschen vor dem Absturz. Hartz IV – das schöne Gesetz soll umbenannt werden, nachdem sein Erfinder im VW-Prozess vor Gericht stand – gewährt Arbeitslosen nach einem Jahr nur noch das Existenzminimum, und die Rentner müssen sich auf kärglichere Altersruhegelder einstellen. Die noch gut bezahlten Angestellten fürchten um ihren Lebensstandard.
Frontal kollidiert die jetzt so dringend geforderte Eigenverantwortung der Bürger mit dem »Prinzip Angestellter«: Aus Stallhasen werden eben keine Tiger, zumal Staat und Gesellschaft jeden Ausbruchsversuch aus dem Käfig der Paragrafen konsequent zu unterbinden suchen. Ein Gemeinwesen, das sich anmaßt, jede Aktivität seiner Bürger bis ins Kleinste durch Gesetze und Verordnungen zu regeln, kann nicht erwarten, dass diese den Schock der Globalisierung aus eigener Kraft abzufedern vermögen.
Ob sie wollen oder nicht – die Angestellten von morgen müssen ihr berufliches Leben ständig neu erfinden. Ein guter Schulabschluss ist kein Garant für einen Job, eine Summa-cum-laude-Promotion keine Eintrittskarte für den Club der Überflieger. Karrieren gleichen künftig eher mäandernden Flussläufen als geradlinigen Autobahnen. In den Erwerbsbiografien werden sich häufigere Jobwechsel, gelegentlich auch Wechsel der Branchen, ebenso finden wie Phasen der Arbeitslosigkeit oder selbstständige Tätigkeiten.
Ein gutes Gehalt sollte deshalb nicht zu exzessiven Ausgaben verleiten, denn schon morgen muss man vielleicht von den Reserven leben. Finanzielle Unabhängigkeit ist das oberste Ziel der Abhängigen, und je früher sie es erreichen, desto gelassener können sie der Zukunft entgegensehen. Die Sparquote kletterte von sieben auf elf Prozent, aber dreieinhalb Millionen Haushalte sind bereits hoffnungslos überschuldet.
In den Zeiten der Globalisierung ist auf keinen Arbeitgeber mehr Verlass. Kommt Papi des Abends müde, aber bedeutungsschwer als »Mr. Allianz« nach Hause, kann er am nächsten Tag wieder der einfache Hugo Müller sein – und die freundliche »Mrs. Deutsche Bank« muss morgen vielleicht als freiberufliche Anlageberaterin ihr Glück versuchen. Wer helle ist, weiß: Statt sein Schicksal in die Hände der Personalabteilung zu legen, wird man sich in jeder Lebensphase selbst vermarkten. Nicht die Firma zählt, sondern allein die Marke »Ich«. Man hält Kontakt zur Konkurrenz und zögert nicht, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Die durchschnittliche Verweildauer der deutschen Angestellten beim selben Arbeitgeber verkürzte sich seit 1990 von 10,4 auf 5,4 Jahre.
Das Verhältnis zwischen den Chefs und ihren Belegschaften hat sich nachhaltig verändert, und schuld daran sind nicht die Angestellten. Manager, die den Börsenkurs pushen, indem sie das Unternehmen »neu aufstellen«, brauchen sich nicht zu wundern, wenn die heimatlos gewordenen Mitarbeiter in die innere Emigration gehen. Wenn Vorstände sich, um den Wert ihrer Aktienoptionen zu steigern, bedenkenlos von Unternehmensteilen mit Tausenden von Leuten trennen, haben sie jeden Kredit verspielt. Angestellte, die an irgendwelche Finanzinvestoren verscherbelt wurden, gehen mit der Absicht ins Büro, es denen mal richtig zu zeigen.
Möglicherweise aber kommt alles ganz anders. Vielleicht geraten die managergesteuerten Konzerne, die heute die Wirtschaftslandschaft dominieren, durch die nachlassende Leistungsbereitschaft ihrer Angestellten in solche Turbulenzen, dass sie von kleineren, gut gemanagten Familienunternehmen überholt werden. Inhabergeführte Betriebe, das belegen zahlreiche Studien, gehen mit ihren Leuten nämlich im Allgemeinen verantwortungsvoller um als Kapitalgesellschaften.
Von Machern und Gemachten
Hoch motivierte Belegschaften sind das Erfolgsgeheimnis vieler »hidden Champions« aus dem deutschen Mittelstand, hat der Bonner Unternehmensberater Hermann Simon herausgefunden. Auch die für ihre offene Gesprächskultur bekannte Softwarefabrik SAP verdankt den Aufstieg zu einem der wertvollsten Dax-Konzerne in erster Linie engagierten Mitarbeitern. Eine Renaissance des partnerschaftlich geführten Unternehmens sollte man also nicht ausschließen – denn es ist längst nicht entschieden, ob das aus den USA importierte Modell der »kapitalmarktgetriebenen« Company auf Dauer tatsächlich besser funktioniert. Vorstände, die ständig steigende Gewinne vorzeigen und dafür bei Forschung und Entwicklung sparen, werden eines Tages mit leeren Händen bei Kunden und Aktionären erscheinen.
Wie eine Gesellschaft aussehen wird, die überwiegend aus jenen »flexiblen Menschen« besteht, die der amerikanische Soziologe Richard Sennett eindrucksvoll beschrieb, lässt sich nur erahnen. Mit Sicherheit wird sie nicht mehr so homogen und stabil, so überschau- und berechenbar sein wie heute. Ober-, Mittel- und Unterschicht werden sich stärker voneinander abgrenzen. Den immer vermögenderen Funktionseliten wird eine Masse sozialer Absteiger gegenüberstehen, die breite Mittelschicht zerbröckeln. Gut verdienende Angestellte und Selbstständige orientieren sich in ihren Lebens- und Konsumgewohnheiten noch stärker an der Oberschicht – der Rest wird weniger verdienen als heute und ständig vom Abstieg ins Prekariat bedroht sein. Zu erwarten ist allerdings, dass die Grenzen zwischen den Gesellschaftsschichten durchlässiger werden. Eine auf Intelligenz und Kreativität angewiesene Wissensgesellschaft kann es sich nicht leisten, Talente brachliegen zu lassen. Sie wird also die Bildungsanstrengungen verstärken und fähigen Leuten aus den unteren sozialen Schichten den Aufstieg erleichtern – was die Politik in den vergangenen Dekaden nicht zu leisten vermochte. Sozialkonflikte werden dennoch an Schärfe gewinnen; sie könnten die erhöhte Dynamik wieder zunichte machen.