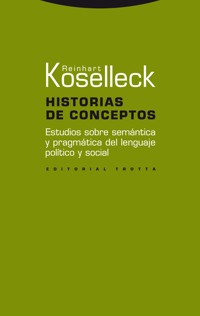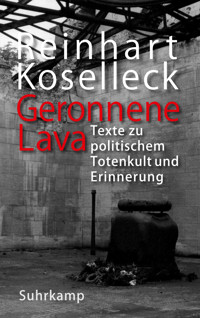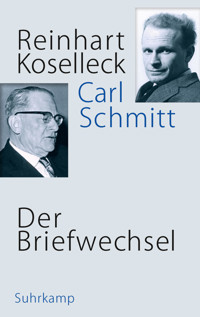
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Drei Jahrzehnte lang, von 1953 bis 1983, korrespondierten der Staatsrechtler Carl Schmitt (1888-1985) und der Historiker Reinhart Koselleck (1923-2006) miteinander. Der Austausch zwischen dem ehemaligen »Kronjuristen des Dritten Reiches« und dem späterhin »bedeutendsten deutschen Historiker des 20. Jahrhunderts« (Die Zeit) behandelt nicht nur die zentralen Schriften der beiden Protagonisten, sondern auch Kosellecks Werdegang im westdeutschen Hochschulbetrieb und Schmitts Lage am Rand des akademischen Feldes. Maßgebliche Zeitgenossen wie Blumenberg, Habermas und Heidegger finden darin ebenso ihren Platz wie historische Fragen und Begriffe sowie aktuelle politische Entwicklungen. Eine Gelehrtenkorrespondenz im Zeichen von »Kritik und Krise« – und zugleich ein wichtiges Kapitel der bundesrepublikanischen Ideengeschichte.
Die Edition gilt einerseits Reinhart Kosellecks bedeutendstem Briefwechsel, dem an Umfang, Dauer und Intensität kein anderer gleichkommt – eine zentrale Quelle für die intellektuelle Biografie des Historikers. Auf der anderen Seite gewährt sie neue Einblicke in Leben und Werk Carl Schmitts, eines Juristen und politischen Theoretikers, an dem das öffentliche kritische Interesse ungebrochen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
3Reinhart Koselleck Carl Schmitt
Der Briefwechsel
1953-1983
und weitere Materialien
Herausgegeben von Jan Eike Dunkhase
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
5Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Der Briefwechsel
Briefe Carl Schmitts an Felicitas Koselleck
Materialien
Abbildungen
Nachwort
Asymmetrische Korrespondenz Reinhart Kosellecks Briefwechsel mit Carl Schmitt
Editorische Notiz
Siglen und Abkürzungen
Literaturverzeichnis
Verzeichnis der Briefe und Materialien
Signaturen der Archivalien im Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland (LAV NRW R)
Namenregister
Abbildungsverzeichnis
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
5
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
447
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
446
7Der Briefwechsel
9[1]KOSELLECK AN SCHMITTHeidelberg, 21. Januar 1953
Heidelberg, Sandgasse 10 21. 1. 53.
Sehr verehrter Herr Professor:
Haben Sie für die liebenswürdige Gastfreundschaft, die Sie mir in Ihrem Hause gewährt haben, meinen herzlichen Dank! Nur mit Zögern hatte ich die kurzfristige Anfrage abgesandt, ob Ihnen mein Besuch genehm sei. Sie aber, sehr verehrter Herr Professor, haben mich mit einer Selbstverständlichkeit und Grosszügigkeit empfangen, bewirtet, in Ihrem Arbeitsraum übernächtigen lassen und schliesslich ganz geheim meinen Benzintank aufgefüllt, dass Sie auch meine Bedenken rückwirkend zerstreut und aufgelöst haben. An ihre Stelle ist das Gefühl einer persönlichen Dankbarkeit getreten, das mich auf dem Felde meiner Studien bereits seit Jahren begleitet hat.
Es erfüllt mich mit besonderem Dank, dass Sie so gründlich auf meine Arbeit eingegangen sind. Die Schwierigkeiten einer Verbindung »systematischer« und »historischer« Betrachtungsweisen, an denen die heutige Historie in so hohem Grade krankt – man denke nur an die Trennung von Soziologie und Historie! – sind mir in verschärftem Masse klar geworden, und ich bin Ihnen für die strenge Mahnung dankbar, die Begriffe im Zuge ihrer Klärung stets auf die ihnen entsprechende Situation zurückzuführen. Es liegt in diesem Ansatz zweifellos der einzige Ausweg für die Geschichtswissenschaft, wenn sie überhaupt bestehen will, aus dem 10Historismus, soweit man unter ihm die Wissenschaft von der »Relativierung der Werte« versteht. Diese Relativierung (die auch Meinecke vor Augen hat) konnte natürlich nur dann zu einem »Problem« werden, wenn man die einzige Relation, ohne die es keine Historie gibt, nämlich die des »Betrachters« zum historischen »Stoff«, gerade ignoriert. Dieser vermeintlichen Isolation des Historikers entspricht, dass man die »Werte« – immer noch ein Erbe des Naturrechts aus dem 18.ten Jahrhundert, wie an Meinecke zu sehen ist – als eigentlich »an sich« bestehende Grössen aufgefasst hatte. Die meisten neuzeitlichen Werte waren in einem geschichtsphilosophischen Jenseits zur Geschichte entstanden und verloren ihre Geltung, im Masse als sich die konkrete Geschichte gewandelt hat, d. h. im Masse als die den Werten vorgeordnete Geschichtsphilosophie ihres konkreten Sinnes, den sie in der Situation des achtzehnten Jahrhunderts hatte, beraubt wurde. Die Rückbeziehung der Werte auf die Geschichte als einen sich wandelnden Prozess, wie sie die Historiker – zum Teil im Gegenzug gegen den »Marxismus« – dann vollzogen haben, bleibt solange eine unzureichende Auskunft, als die stillschweigenden Voraussetzungen der Geschichtsphilosophien nicht gebrochen sind. Die sogenannte Relativierung der Werte durch ihre Einordnung in den geschichtlichen Prozess ist in hohem Masse geschichtsphilosophisch vorbelastet und spezifisch ungeschichtlich, da sie nur durch einen unendlichen, in der Vergangenheit verschwimmenden Fluchtpunkt ermöglicht wird. Die Werte verflüchtigen sich zu schemenhaften Tendenzen, die aus irgendwelchem Dunkel emporsteigen, um sich zu verfilzen, ihre Vorzeichen einzutauschen und was dergleichen mehr geschieht. Immer aber bleiben diese Tendenzen und auch ihre Rückbeziehung auf den geschichtlichen »Prozess« (im eingebürgerten naturalistischen Sinne) gebunden an die linienhafte Zeitkonstruktion der Geschichte, deren Evidenz mathematisch und geschichtsphilosophisch ist. Der Abbau der fortschrittlichen Zukunft hat die Historie nicht davor bewahrt, eine linienhafte Vergangenheit beizubehalten, in der jede 11Situation, die eigene sowohl wie die »betrachtete«, verschwimmt. Der Historismus ist so sehr eine historistische Erscheinung, dass er selber seine geschichtliche Grundlage in einer Geschichtsphilosophie hat, die der Situation des Bürgertums im 18.ten Jh. zugeordnet ist, nicht aber seiner eigenen. Er ist ein Restprodukt, das Macht und Dauer der bürgerlichen Denkform manifestiert, und nicht wie Meinecke meint, eine genuine Leistung. Er ist so wenig eine Antwort auf unsere Situation, als er vielmehr selbst ein Teil dieser Situation ist, da er sie nicht, wie es seine Aufgabe wäre, zum Begriff erheben kann. Infolgedessen fällt er unter die geistigen Tätigkeiten, die zu Recht ideologisiert werden können.
Der Historismus ist bei der resignierenden Feststellung angelangt, dass die Relativität aller geschichtlichen Ereignisse und Werte als »Relativität« absolut anzusetzen sei. Hier setzen – soweit ich sehe – alle Analysen der Geschichtlichkeit ein. Man sollte durch diese immer noch sehr historiographische Einsicht endlich durchstossen zu einer Geschichtsontologie, die nicht mehr methodisch letzte Auskunft ist, sondern der Anfang einer Begriffsbildung, die es ermöglicht, den Geschichtsphilosophien das Wasser abzugraben, und somit eine Antwort auf unsere konkrete Situation darstellen kann. Das Fehlen einer solchen Ontologie – in Hinblick auf die historische Begriffsbildung – verhinderte dauernd einen sicheren Zugriff auf meinem Studiengebiet. Freyer hat mit seiner »Weltgeschichte Europas« in dieser Richtung viel geleistet, und besonders liegt natürlich Ihren Schriften und Büchern eine solche Ontologie der Geschichte zugrunde, die von Golo Mann nur deshalb verkannt werden konnte, weil er die juristischen Begriffe als einen immanent wissenschaftsgebundenen Überbau auffasste.
Die Reduktion aller geistigen Äusserungen auf die Situation setzt allen weiteren Relativierungen nach vorne und hinten, nach oben und nach unten ein absolutes Ende. Die Endlichkeit des geschichtlichen Menschen wäre also in den Blickpunkt zu rücken, nicht in Hinsicht auf das individuelle Dasein und auch nicht in Hinsicht auf eine unendlich ferne Grenze, an der die »Totalgeschichte« ein12mal ein Ende nehmen wird (und an der der Historiker jetzt schon seine »Grenzerfahrungen« sammelt), sondern in Hinsicht auf den dauernden Ursprung der Geschichte: also in Hinsicht auf die Strukturen einer »Situation«, ohne die es soetwas wie Geschichte gar nicht gibt. Die Geschichte ist dem Menschen nicht transzendent, weil sie weitergeht, wenn dieser oder jener Mensch stirbt, sondern es durchherrscht eine Endlichkeit die menschlichen Dinge, die den Geschichtsraum, der den jeweiligen Menschen zugeordnet ist, dauernd in Frage stellt. Die Lehre von dieser Endlichkeit ist als Eschatologie auch aller Geschichtswissenschaft ontologisch vorzuordnen. »Herr und Knecht«, »Freund und Feind«, Geschlechtlichkeit und Generation und alle »geopolitischen« Fragen gehören hierher. Heidegger ist an allen diesen Phänomenen im Zuge seiner Existenzanalyse in »Sein und Zeit« vorbeigegangen, und das Ergebnis zeigt sich in der historisierenden Seinsgeschichte als Gesamtkonstruktion, die mit den Vorsokratikern und dem darauffolgenden geistigen Sündenfall ähnlichen Lächerlichmachungen ausgesetzt bleibt wie Jaspers' Ziele und Ursprünge, deren Fragestellung das ontische Ende der Geschichte zum Problem erhebt. (Jaspers verbleibt damit, gar nicht ontologisch denkend, durchaus auf der Ebene der Utopisten, die zu bekämpfen er ausgezogen ist!)
Der Ausgangspunkt einer geschichtsontologischen Analyse müsste, um nicht der erkenntnistheoretischen Resignation in das Formale zu verfallen, und um nicht wie immer bei den Ägyptern anzufangen, der gegenwärtige Bürgerkrieg sein. Mit den Kategorien, wie sie Ihrem »Nomos der Erde«, sehr verehrter Herr Professor, zugrundeliegen, liesse sich dann jedenfalls zeigen, dass der herrschende Weltbürgerkrieg kein ontisches oder kontingentes Ereignis ist, das eigentlich nicht sein dürfte (für die Amerikaner), sondern ein Ereignis, das durchaus in den Seinsstrukturen unserer Geschichtlichkeit wurzelt, dann aber, wenn man diese Strukturen achtet, nicht so sein muss, wie es ist. (für die Russen).
Die Wahrheit einer solchen Geschichtsontologie müsste sich an jeder zugetroffenen Prognose aufweisen lassen, wie sie anderer13seits insofern selber prognostischen Charakter haben muss, als sie die geschichtsphilosophischen Zwangsprophezeiungen ausser Kurs setzen kann. (Ob sie dazu die Macht hat, ist eine andere Frage; aber mehr kann die »historische Wissenschaft« als Wissenschaft nicht leisten.) Ein Beispiel für den Gegensatz einer geschichtsträchtigen und einer geschichtsphilosophischen Voraussage bietet die Kontroverse zwischen Voltaire und Rousseau. R. sagte die Herrschaft Russlands über Europa und die der Tartaren über Russland voraus. V. diffamierte diese Prognose als prophetische Allüre, und glaubte sie widerlegen zu können durch historische Kritik, im Grunde aber am Leitfaden einer nicht gerade ausgesprochenen, aber implizierten Fortschrittsphilosophie, die gerade die Kategorien ignorierte und verdeckte, die Rousseau in seiner ressentimenthaften Scharfsichtigkeit befähigt hatten, seine berühmte Prognose zu stellen. Im geschichtsphilosophischen, d. h. heute bereits ideologischen Sinne hat Voltaire (im Namen der Russen) immer noch Recht behalten; faktisch nähert sich die Prognose von Rousseau ihrer bedenklichen Erfüllung.
Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch die Formulierung von Kant im Zuge seiner Hiobinterpretation schreiben: »Denn Gott würdigt Hiob, ihm die Weisheit seiner Schöpfung vornehmlich von seiten ihrer Unerforschlichkeit vor Augen zu stellen. Er lässt ihn Blicke auf die schöne Seite der Schöpfung tun …; dagegen aber auch auf die abschreckende, indem er ihm Produkte seiner Macht und darunter auch schädliche, furchtbare Dinge hernennt …« (1791) Hiobs Freunde, die mehr nach Gunst der Mächtigen als nach Wahrheit streben, werden nicht initiiert.
Indem ich mir gestatte, Ihnen, sehr verehrter Herr Professor, als kleines Zeichen meines Dankes einige Zeichnungen mitzuschicken, bin ich mit freundlichen Grüssen auch an Ihr Fräulein Tochter
in Verehrung
Ihr Reinhart Koselleck
14ÜBERLIEFERUNG O: Ts.; mit hs. Korrektur Kosellecks sowie Notizen und Unterstreichungen Schmitts; Landesarchiv NRW, Nachlaß Carl Schmitt.
Gastfreundschaft: Aus Nr. 5 läßt sich schließen, daß Kosellecks erster Besuch in Plettenberg um den 12. Januar herum stattfand.
meine Arbeit: Koselleck stand kurz vor dem Abschluß seiner Doktorarbeit Kritik und Krise (1954). Siehe Nr. 3 und 5.
Meinecke: In seiner »in bejahender Gesinnung« gehaltenen Geschichte des Historismus von 1936 traut der Historiker Friedrich Meinecke (1862-1954) dem Historismus die Kraft zu, »die Wunden, die er durch die Relativierung der Werte geschlagen hat, zu heilen – vorausgesetzt, daß er Menschen findet, die diesen -ismus in echtes Leben umsetzen« (Die Entstehung des Historismus, hg. v. Carl Hinrichs, 2. Aufl. München: Oldenbourg 1965, S. 1 und 4).
Freyer: Der Soziologe Hans Freyer (1887-1969) hatte 1948 seine zweibändige Weltgeschichte Europas (Wiesbaden: Dieterich; annotiertes Exemplar in BRK) vorgelegt. In einer unveröffentlichten Rezension vom April 1950, in der er zugleich Karl Jaspers' Werk Vom Ursprung und Ziel der Geschichte (München: Piper 1949; annotiertes Exemplar in BRK) kritisiert, würdigt Koselleck Freyers »Reduktion der Geschichtsphilosophie auf ›Tatsachen‹«. Konzediere man dem Autor, »dass Historie dem Historismus nie ganz entrinnen kann, dass sie notwendigerweise auch antiquarisch ist«, bleibe »seine Konzeption der ›Weltgeschichte Europas‹ ein grosser Wurf« (Ts. in NL Koselleck).
Golo Mann: Der Historiker und Schriftsteller Golo Mann (1909-1994) veröffentlichte im Oktober 1952 in der Zeitschrift Der Monat eine kritische Besprechung von Schmitts Werk Der Nomos der Erde (1950). Sein Hauptvorwurf geht dahin, Schmitt denke »selber nicht geschichtlich genug« und überschätze die historische Wirkmächtigkeit völkerrechtlicher Theorie, die »das politische und moralische Chaos der Welt« nicht erklären könne. Zugleich verurteilt Mann die Einseitigkeit, mit der Schmitt dem amerikanischen Rechtsdenken die Schuld an der Entgrenzung des Zweiten Weltkriegs zuweise. Vgl. Golo Mann, »Carl Schmitt und die schlechte Juristerei«, in: Der Monat 5 (1952), H. 49, S. 89-92.
15in Hinsicht auf den dauernden Ursprung der Geschichte: Schmitt notierte neben diese von ihm auch unterstrichene Stelle: »das ist es«.
Heidegger: Von Kosellecks intensiver Auseinandersetzung mit dem Denken Martin Heideggers (1889-1976) zeugen neben den Lektürespuren in seinem Exemplar von Sein und Zeit (5. Aufl. Halle a. d. S.: Niemeyer 1941; in BRK mit Besitzvermerk) auch zwei Referate, die er laut nachträglicher Beschriftung etwa 1949 bzw. 1950 in Seminaren von Franz Josef Brecht hielt (NL Koselleck, »Die Wahrheit in ›Sein + Zeit‹«, Hs.; »Die Zeit des Weltbildes«, Ts.). In einem Lebenslauf von 1962 heißt es: »Die nachhaltigste Wirkung auf mein historisches Verständnis ging von Heideggers ›Sein und Zeit‹ aus« (»Mein Lebenslauf«, Dezember 1962, in: UAH, PA-4614). Auch in späteren Jahren bezeichnete Koselleck Sein und Zeit trotz kritischer Abgrenzung (vgl. etwa: »Historik und Hermeneutik« [1987], in: Zeitschichten, S. 97-118, hier S. 99-101; »Über die Theoriebedürftigkeit der Geschichte« [1972], in: ebd., S. 298-316, hier S. 299) als »Initiationsbuch« (Hettling/Ulrich, S. 56) und verortete sich selbst »in der Folge der Heidegger-Rezeption« (»Zeit, Zeitlichkeit und Geschichte – Sperrige Reflexionen. Reinhart Koselleck im Gespräch mit Wolf-Dieter Narr und Kari Palonen«, in: Jussi Kurunmäki und Kari Palonen [Hg.], Zeit, Geschichte und Politik. Zum achtzigsten Geburtstag von Reinhart Koselleck, Jyväskylä: University of Jyväskylä 2003, S. 9-33, S. 9). Siehe auch Koselleck/Dutt, S. 40.
Jaspers' Ziele und Ursprünge: Karl Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, München: Piper 1949. Koselleck hörte noch Vorlesungen von Jaspers (1883-1969), bevor der Philosoph 1948 von Heidelberg nach Basel wechselte, und empfand ihn dabei als »Bildungsapostel« (Koselleck/Dutt, S. 37). In seiner Rezension von 1950 (siehe oben Anm. »Freyer«) bemängelt er u. a., Jaspers bewege sich »noch in den Bahnen säkularisierender Geschichtsmetaphysik«. Vgl. aber auch: Reinhart Koselleck, »Jaspers, die Geschichte und das Überpolitische« (1986), in: Vom Sinn und Unsinn, S. 306-318.
Nomos der Erde: Carl Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Köln: Greven 1950 (annotiertes Exemplar in BRK mit Besitzvermerk vom Dezember 1950) [im Folgenden: Nomos]. Siehe auch Nr. 10, 11, 13, 14, 21, 31, 32, 79, 83 und 89.
16Kontroverse zwischen Voltaire und Rousseau: Im 8. Kapitel (»Du peuple«) des zweiten Buches seines philosophischen Hauptwerkes Du contrat social ou Principes du droit politique (1762) äußerte Jean-Jacques Rousseau sich skeptisch über die Modernisierungsmaßnahmen des russischen Zaren Peters des Großen. Seine Kritik richtete sich implizit gegen Voltaire, der den Zaren zuletzt im ersten Band seiner Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand (1759) als genialen Reformer dargestellt hatte. Voltaire reagierte darauf in dem Artikel »Pierre le Grand et Jean-Jacques Rousseau« seines Dictionnaire philosophique (1778).
Kant: Vgl. Immanuel Kant, »Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee«, in: ders., Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie und Pädagogik 1, hg. v. Wilhelm Weischedel, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1977, S. 103-124, hier S. 118. Siehe dazu Hiob 38-42.
Zeichnungen: In Schmitts Nachlaß sind drei Karikaturen überliefert: 1. Zwei ältere Herren – »Der Mensch ist nicht, was er ist / und ist, was er nicht ist. Sartre« (1948); 2. Karl Jaspers – »Das umgreifende Umkreisen der Permanenz des transzendentalen Schenkungsbewusstseins überhaupt.« (1953) (siehe Abb. 3); 3. Alexander Rüstow – »Expithecanthropos: ›Ich bejahe die Freiheit und verneine die Herrschaft, ich bejahe die Menschlichkeit und verneine die Barbarei, ich bejahe den Frieden und verneine die Gewalt. Und diese Gegensatzpaare sind demgemäß die großen Polaritäten, zwischen denen sich für mich die Weltgeschichte abspielt.‹ (Ortsbestimmung der Gegenwart Zürich 1950 S. 18f.)« (1953) (siehe Abb. 4). – Der Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler Alexander Rüstow (1885-1963), Mitbegründer des Ordoliberalismus, lehrte von 1950 bis 1956 als o. Prof. für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität Heidelberg. Im türkischen Exil (1933-49) entstand sein dreibändiges Werk Ortsbestimmung der Gegenwart. Eine universalgeschichtliche Kulturkritik (Bd. 1: Ursprung der Herrschaft, Erlenbach-Zürich: Rentsch 1950, Zitat S. 18f.).
Fräulein Tochter: Anima Schmitt (1931-1983), seit 1957 verh. Otero, Tochter aus Carl Schmitts zweiter Ehe mit der Serbin Dušanka (Duška) Todorović (1903-1950) und sein einziges Kind, kannte Koselleck bereits aus Heidelberg, bevor sie nach zwei Semestern an der Münchner 17Hochschule für Bildende Künste (Bühnengestaltung), einer Assistenz am Landestheater Darmstadt und einem Semester an der Universität Hamburg (Anglistik) im Sommersemester 1954 am Dolmetscher-Institut der Universität Heidelberg zu studieren begann.
[2]SCHMITT AN KOSELLECKPlettenberg, 2. Februar 1953
Herrn
stud. phil. R. Koselleck
Heidelberg
Sandgasse 10
Pl. 2/[2] 53
Lieber Herr Koselleck, vielen Dank für Ihren Brief vom 21/1 und die 4 Zeichnungen, die ich mir mit ungeheurem Vergnügen immer von neuem besehe, vor allem natürlich die mit der Schale der Gerechtigkeit. Lassen Sie sich durch keine historistische Zerredung in Ihrer Arbeit aufhalten und setzen Sie dem Geschwafel Ihr einfaches, dreiteiliges, festes Bild entgegen, weiter nichts. Die Redlichkeit in Hinsicht auf den dauernden Ursprung der Geschichte, das ist es. Hoffentlich können wir bald einmal wieder darüber sprechen. Sehen Sie sich unbedingt in Darmstadt einmal den Sommernachtstraum und (noch wichtiger) das Käthchen von H. an! Mit allen guten Wünschen
Ihr alter Carl Schmitt.
Die Hiob-Stelle ist eine Fundgrube. Hier erscheint ja schon die Macht als Recht.
18ÜBERLIEFERUNG O: Hs.; Ansichtskarte: Frankfurt a. M., Dom und Gerechtigkeitsbrunnen; DLA Marbach, Nachlaß Reinhart Koselleck.
Pl. 2/[2] 53: Monatsangabe Schmitts (wohl »1«) durch Poststempel geklärt.
Brief vom 21/1: Nr. 1.
4 Zeichnungen: Überliefert sind nur drei. Siehe Nr. 1 und Anm.
Darmstadt: Anima Schmitt war von September 1952 bis Ende Februar 1953 Assistentin am Darmstädter Landestheater. Im Oktober 1952 wurde dort unter der Leitung des Intendanten Rudolf Sellner die fünfte Version von Carl Orffs Vertonung von Shakespeares Schauspiel Ein Sommernachtstraum uraufgeführt. 1953 inszenierte Sellner auch Heinrich von Kleists Käthchen von Heilbronn.
Hiob-Stelle: Siehe Nr. 1 und Anm.
[3]KOSELLECK AN SCHMITTHeidelberg, 8. Juli 1953
Sehr verehrter Herr Professor,
wenn Sie jetzt die Spanne von fünfundsechzig Jahren durchmessen haben, und sich meine Wünsche dahin richten, daß Sie uns noch lange erhalten bleiben, dann sind diese Wünsche von einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit getragen. Sie haben bisher unsere Zeit in Begriffe gefasst, mit denen wir aus der jungen Generation diese Zeit begreifen lernen. Mögen Sie persönlich durch Ihre Erkenntnis bereits der Zeit enthoben sein, der Sie sich heute ausgesetzt sehen, so scheint es mir gerade deshalb keine Unbescheidenheit, Ihnen, sehr verehrter Herr Professor, für die Zukunft noch ein fruchtbares Feld der Arbeit zu wünschen. Denn was alles vermag Ihr Wort nicht auszusprechen und damit aufzuwiegen!
Ich gestatte mir, eine kurze Besprechung des Hamlet-Buches beizulegen, die ich vor einiger Zeit für die hiesige Studentenzeit19schrift, das Forum Academicum geschrieben hatte. Im Abdruck fehlen zwei Sätze, die zugunsten einer eingerückten Reklame-Rubrik (von Reklame lebt dieses Blatt) von einem findigen Lektor gestrichen wurden. Darunter befand sich natürlich der letzte Satz, den ich wegen seiner Ambivalenz mit Bedacht zitiert hatte, ist sein Inhalt doch zugleich auf das Vorwort selbst zu beziehen.
Meine Dissertation ist abgeschlossen. Es ist mir nicht gelungen, das geplante dreiteilige Bild – den Zusammenhang der Kritik, Geschichtsphilosophie und Welteinheit mit der »Krise« der beginnenden Neuzeit – durchzuführen. Der Zwang zur Beweisführung in den Dingen der Historie hat mich nolens volens über methodische Hindernisse stolpern lassen, die von einer recht verstandenen Geschichtlichkeit her gesehen überflüssig sein sollten. Zudem bin ich immer wieder in Soziologisierungen abgerutscht, die wenn überhaupt erst seit der Revolution und ihrer Dialektik berechtigt sind. Die Fragestellung ist nunmehr auf Kritik und Krise eingeschränkt geblieben. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen, sobald die Arbeit getippt ist, ein Exemplar übersenden dürfte. – (Zur Zeit habe ich noch allerhand Sorgen wegen meiner mündlichen Prüfung. Professor Kühn ist nämlich seit April schwer erkrankt und hat die Arbeit noch nicht einsehen und beurteilen können. Auf diese Weise ist der Ablauf der Prüfungsmaschinerie gefährdet und es droht mir die Gefahr, daß ich ohne mündliches Examen im Oktober mein Lektorat in England antreten muss. Aber ich hoffe, daß dieser Art Sorgen bald beseitigt sind).
Mit herzlichen Wünschen und Grüssen – auch an Ihr Fräulein Tochter – bin ich in tiefer Verehrung Ihr
Reinhart Koselleck
Heidelberg, am 8. 7. 53.
Sandgasse 10
20ÜBERLIEFERUNG O: Hs.; mit Anstreichung Schmitts; Landesarchiv NRW, Nachlaß Carl Schmitt.
Siehe Abb. 1.
Spanne von fünfundsechzig Jahren: Carl Schmitts 65. Geburtstag war am 11. Juli 1953.
kurze Besprechung des Hamlet-Buches: Lilian Winstanley, Hamlet. Sohn der Maria Stuart, Pfullingen: Neske 1952 (engl. Original: Hamlet and the Scottish Succession, London: Cambridge University Press 1921), übersetzt von Anima Schmitt und von Carl Schmitt mit einem Vorwort (S. 7-25) sowie einem »Hinweis für den deutschen Leser« (S. 164-170) versehen. Carl Schmitt macht sich Winstanleys zeitgeschichtlich-wirkungsästhetische Interpretation zueigen, wonach Shakespeares Theaterstück von Maria Stuarts Sohn, König Jakob VI. von Schottland (ab 1603 Jakob I. von England), handle. Der Hamlet sei »die dramatisierte Wirklichkeit eines Königs, der die sakrale Substanz seines Königtums zerdenkt und zerredet, aber wenigstens auf der Bühne doch noch wie ein König stirbt« (S. 17). Schmitts autoidentifikatorische Auseinandersetzung mit Hamlet mündete in seinen Essay Hamlet oder Hekuba. Der Einbruch der Zeit in das Spiel von 1956 (Düsseldorf: Diederichs [im Folgenden: Hamlet]; 6., korrigierte und erweiterte Aufl., mit einem Nachwort v. Gerd Giesler, Stuttgart: Klett-Cotta 2017). – Koselleck sekundiert Schmitt in seiner Besprechung: »Erst das Eindringen in den geschichtlichen Gehalt erschließt die Wahrheit der Dichtung. Denn nur aus dem geschichtlichen Ursprung nährt sich die mythische Kraft des ›Hamlet‹. Diesen inneren Zusammenhang von Geschichte, Dichtung und Mythos hat Carl Schmitt in einem Vorwort sichtbar gemacht.« Siehe R.[einhart] K.[oselleck], »Hamlet historisch«, in: Forum Academicum 4/4 (Mai 1953), S. 6. Der gestrichene letzte Satz zitiert aus dem letzten Satz von Schmitts Vorwort: »Doch hier soll nicht vorgegriffen werden: Lesen wir und wir erfassen ›ein wesentliches Ereignis unserer europäischen Geschichte: die Geburt des Hamlet-Mythos aus einem Schauspiel zeitgeschichtlicher Präsenz.‹« Die Rezension (Reinhart Koselleck, »Hamlet, Sohn der Maria Stuart«, Ts. in: DLA, C: Koselleck, Einlagen 870, sowie LAV NRW, RW 265-20302) ist wiederveröffentlicht als »Appen21dix zum Text von Reinhard Mehring: Ein bisher unbekannter Rezensionsentwurf von Reinhart Koselleck«, in: Hans Joas und Peter Vogt (Hg.), Begriffene Geschichte. Beiträge zum Werk Reinhart Kosellecks, Berlin: Suhrkamp 2011, S. 169f. Siehe zur Hamlet-Thematik auch Nr. 4, 24-34, 44-47, 54, 69a und 93.
Meine Dissertation: Vgl. Reinhart Koselleck, Kritik und Krise. Eine Untersuchung der politischen Funktion des dualistischen Weltbildes im 18. Jahrhundert, phil. Diss., Universität Heidelberg, 1954. Die Arbeit war zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig abgeschlossen: »[…] als ich das Manuskript einreichte, – bevor ich über den Kanal nach England entfleuchte –, fehlten noch die Anmerkungen, also das dicke Polster der Arbeit. Die Fakultät […] akzeptierte den halben Text, – ein Freund reichte die ins reine getippten Anmerkungen später nach« (Dankrede, S. 52). Die Arbeit wurde am 3. Oktober 1953 zur Begutachtung eingereicht, die Doktorurkunde der Philosophischen Fakultät am 20. November 1954 ausgestellt. Zum weiteren Verlauf des Promotionsverfahrens siehe Nr. 5-7, 10, 11, 13 und 14.
Johannes Kühn: Kosellecks Doktorvater und Pate Johannes Kühn (1887-1973) lehrte von 1949 bis 1955 als o. Prof. für Neuere Geschichte an der Universität Heidelberg. Zuvor war er o. Prof. für Geschichte an der Technischen Universität Dresden (1928-45) und an der Universität Leipzig (1947-49). Rückblickend bemerkte Koselleck: »Kühn war ein hochgelehrter, ein rundum gebildeter, immer neugieriger Universalhistoriker, wie viele seiner Kollegen einem protestantischen Pfarrhaus entstammend, privatissime ein Mystiker, deshalb von bedingungsloser Toleranz, niemandem etwas aufzwingend, manch einen freilich durch bedeutsames Schweigen belehrend. […] Von Kühn wurde ich angeregt, […] den neuzeitlichen Utopien auf die Spur zu kommen« (Dankrede, S. 50f.).
Lektorat in England: Im Oktober 1953 trat Koselleck eine einjährige Stelle als Lektor (Assistant Lecturer) im Department of German an der University of Bristol an, die 1954 um ein weiteres Jahr verlängert wurde. Siehe Nr. 5 und 10 mit Anm.
22[4]SCHMITT AN KOSELLECKPlettenberg, 29. September 1953
Plettenberg, 29/9 53.
Lieber Herr Koselleck,
vor einigen Tagen wurde ich wieder lebhaft an unser Gespräch vom Januar dieses Jahres erinnert, als ein junger Romanist, H. K. Weinert aus Tübingen, zu Besuch kam und mir einen Sonderdruck aus der Festgabe für Mecking (Hannover 1949) gab, der den aufregenden Titel trägt: Voltaire und die Geographie im Zeitalter der Aufklärung. Leider ist es ein ziemlich unbedeutender Aufsatz. Aber das Thema bleibt, und in den verschiedenen Enzyklopädien wird man wahrscheinlich vieles entdecken können. Ich schicke Ihnen den Aufsatz gern. Jedenfalls wurde ich dadurch an unser Gespräch erinnert und zugleich an meine Versäumnis. Ich habe mich bei Ihnen noch nicht einmal für Ihren Glückwunschbrief vom 8. Juli bedankt, und den Empfang der Besprechung des Hamlet-Buches noch nicht einmal bestätigt. Ich hole das jetzt nach, und füge hinzu, dass ich mit grosser Spannung auf das MS Ihrer Dissertation warte. Für den Weg durch das Examen wünsche ich Ihnen Glück, Geistesgegenwart, eine unauffällige désinvolture und ähnliche, nach Lage der Situation nützlichen Geschenke und Gaben der Vorsehung. Für eine Nachricht wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Wenn Sie einen Massstab für meine grosse Freude über Ihre Bemerkungen zu dem Hamlet-Buch brauchen, dann lesen Sie bitte zum Vergleich die Besprechung, die der Geschäftsführer der Shakespeare-Gesellschaft, Prof. Heuer in Freiburg, im letzten Jahrbuch der Sh. Gesellschaft veröffentlicht hat. Jedes Adjektiv ein mühsam präpariertes Gift-Klümpchen, sodass die Anstrengung, die er aufbringt um sich in seinem alten Kram nicht stören zu lassen, einen schon beinahe wieder rührt.
23Anima ist in diesen Tagen bei dem Darmstädter Gespräch, wo sie einige meiner Freunde trifft: Heinrich Popitz, Armin Mohler, Sava Kličković und Enrique Tierno Galván, der übrigens bald auch in Heidelberg Vorlesungen halten soll. Ich würde Ihnen gern, wenn Sie Zeit zum Lesen haben, Tiernos Beitrag zu der Festgabe zu meinem Geburtstag schicken, einen herrlichen Aufsatz über: Benito Cereno, der Mythos Europas.
Herzliche Grüsse und alle guten Wünsche für Ihr Examen!
Stets Ihr alter
Carl Schmitt.
ÜBERLIEFERUNG O: Hs.; DLA Marbach, Nachlaß Reinhart Koselleck.
H. K. Weinert: Hermann Karl Weinert (1909-1974), von 1946 bis 1953 wiss. Assistent, von 1956 an apl. Prof. für Frankreichkunde am Romanischen Seminar der Universität Tübingen.
Sonderdruck: Hermann Karl Weinert, »Voltaire und die Geographie im Zeitalter der Aufklärung«, in: Festschrift zum 70. Geburtstag des ord. Professors der Geographie Dr. Ludwig Mecking. Gewidmet von seinen Freunden und Schülern, hg. v. Geographischen Institut der Universität Hamburg in Verbindung mit der Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Bremen-Horn: Walter Dorn 1949, S. 239-249. (Auf dem Umschlagstitel ist als Erscheinungsort Hannover angegeben.)
Glückwunschbrief vom 8. Juli: Siehe Nr. 3.
Besprechung des Hamlet-Buches: Siehe Nr. 3 und Anm.
désinvolture: Franz., Ungezwungenheit, Lässigkeit.
Besprechung: Vgl. Hermann Heuers Rezension von Lilian Winstanleys Hamlet-Buch (siehe Nr. 3 und Anm.) in: Shakespeare-Jahrbuch 89 (1953), S. 235-238. In Anspielung auf Schmitts polemische Bezugnahme auf Kritiken an der englischen Originalausgabe schreibt Heuer: »Die Frage lautet also: muß dem von Carl Schmitt mit solch bestechender Eleganz aufgerollten Revisionsverfahren zugunsten der Schrift von 1921 beigepflichtet werden? Die prachtvollen Formulierungs24künste ihres literaturhistorisch trefflich versierten Protektors lassen es geboten erscheinen, sich seiner essayistischen Suggestionskraft zu entziehen und sich unmittelbar mit dem ausgezeichnet übersetzten (und wohl auch von überflüssigem Gestrüpp gereinigten?) Text auseinanderzusetzen« (S. 235) – Der Anglist Hermann Heuer (1904-1992), von 1950 bis 1972 o. Prof. an der Universität Freiburg, war von 1950 bis 1964 Vizepräsident der Shakespeare-Gesellschaft und Hauptherausgeber des Shakespeare-Jahrbuches.
Darmstädter Gespräch: Die Darmstädter Gespräche waren eine Veranstaltungsreihe, in deren Rahmen sich zwischen 1950 und 1975 namhafte Wissenschaftler und Schriftsteller zu Podiumsdiskussionen einfanden. Das 4. Symposium vom 26. bis 28. September 1953 stand unter dem Motto »Individuum und Organisation«. Als Diskussionsleiter fungierten Theodor W. Adorno und René König, zu den Gästen gehörten neben vielen anderen Jean Beaufret, Max Horkheimer, Alexander Mitscherlich und José Ortega y Gasset.
Heinrich Popitz: Der Soziologe Heinrich Popitz (1925-2002), Sohn von Schmitts Freund Johannes Popitz, wurde 1949 von Karl Jaspers in Basel mit einer Arbeit über die Geschichtsphilosophie promoviert (Der entfremdete Mensch. Zeitkritik und Geschichtsphilosophie des jungen Marx, Basel: Verlag für Recht und Gesellschaft 1953). Nach der Habilitation in Freiburg und mehrjähriger Tätigkeit an der Sozialforschungsstelle an der Universität Münster in Dortmund wurde er Prof. in Basel (1959) und Freiburg (1964).
Armin Mohler: Der Schweizer Schriftsteller und Publizist Armin Mohler (1920-2003) gilt als wichtiger Vordenker einer neuen Rechten in der Bundesrepublik. Er desertierte 1942 aus der Schweizer Armee, um sich der Waffen-SS anzuschließen. Nach dem Scheitern dieses Planes kehrte er noch im selben Jahr in die Schweiz zurück. 1949 wurde Mohler von Herman Schmalenbach und Karl Jaspers in Basel mit seiner einschlägigen Arbeit über die »Konservative Revolution« promoviert (Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. Grundriß ihrer Weltanschauungen, Stuttgart: Vorwerk 1950); anschließend war er für drei Jahre Privatsekretär von Ernst Jünger, über den er 1948 Schmitt kennenlernte. 1961 wurde er Sekretär, 1964 Geschäftsführer der Carl Friedrich von Siemens Stiftung in München. Vgl. BW Mohler.
25Sava Kličković: Der serbische Jurist und Schriftsteller Sava Kličković (1916-1990) war zwischen 1935 und 1940 Doktorand und seither enger Freund Carl Schmitts. Nach dem Krieg war er im diplomatischen Dienst Jugoslawiens in den Handelsvertretungen in der Bundesrepublik, in den USA, Pakistan und Mexiko tätig.
Enrique Tierno Galván: Der spanische Jurist, Philosoph und sozialdemokratische Politiker Enrique Tierno Galván (1918-1986), Gegner der Franco-Diktatur und zu Lebzeiten wichtigster Staatsrechtler seines Landes, war Prof. an den Universitäten Murcia (1948-53), Salamanca (1953-65) und Princeton (1966-67) und von 1979 bis zu seinem Tod Bürgermeister von Madrid.
Tiernos Beitrag zu der Festgabe: Enrique Tierno Galván, »Benito Cereno oder der Mythos Europas«, in: Epirrhosis. Festgabe für Carl Schmitt, hg. v. Hans Barion u. a., 1. Teilband, Berlin: Duncker & Humblot 1968, S. 345-356. Von der geplanten Festschrift zu Schmitts 65. Geburtstag 1953, die ebenfalls den Titel »Epirrhosis« (griech., Ermutigung) tragen sollte, wurde nur die Bibliographie publiziert. Tierno veröffentlichte seinen Beitrag bereits 1952 auf spanisch mit der Widmung »Al profesor Carlos Schmitt«: »Benito Cereno o el mito de Europa«, in: Cuadernos Hispanoamericanos 36 (1952), S. 215-223.
Benito Cereno: Die Titelfigur von Herman Melvilles Erzählung Benito Cereno (1855; dt. 1938), der gefangene Kapitän eines von meuternden Sklaven übernommenen spanischen Handelsschiffes, diente Schmitt seit 1941 als Interpretament sowohl der geschichtlichen wie seiner persönlich-individuellen Lage. Vgl. Carl Schmitt, »Ex Captivitate Salus« (1946), in: ders., Ex Captivitate Salus. Erfahrungen der Zeit 1945/47, Köln: Greven 1950, S. 55-78, hier S. 75 (annotiertes Exemplar in BRK mit dem Besitzvermerk »Koselleck 1950/56«) [im Folgenden Ex Captivitate]; Glossarium, S. 309; BW Jünger, S. 114, 118f. u. a.
26[5]KOSELLECK AN SCHMITTBristol, 2. November 1953
Bristol, 2. 11. 1953.
Sehr verehrter Herr Professor,
haben Sie meinen herzlichen Dank für Ihren liebenswürdigen Brief. Und entschuldigen Sie bitte die verzögerte Antwort, aber ich befand mich gerade im Aufbruch nach England, um hier in Bristol ein Lektorat zu übernehmen, in das mich einzuarbeiten ich auch eine Weile brauchte. Als ich Ihren Brief erhielt, hatte ich gerade meine Dissertation abgeschlossen, die ich Ihnen nun in der Hoffnung übersende, daß einiges darin Ihre Anerkennung oder wenigstens Ihre Zustimmung finden möge. Die Arbeit ist völlig anders ausgefallen, als ich es im Frühjahr noch erhoffte. Das Begriffsnetz ist zu weitmaschig geblieben, um völlig stringent zu sein. Im Grunde liegt nur eine Reihe von Einzeluntersuchungen vor, die ich unter dem mehr oder weniger heuristischen Titel Kritik und Krise zusammengefaßt habe. Das Grundthema des moralischen und kritischen Prozeßes, den das Bürgertum mit dem Staat angestrengt hat, und der als solcher zugleich ihre Geschichtsphilosophie konstituiert, ist mir erst im Zuge der Einzelanalysen völlig klar geworden und daher in voller Schärfe noch nicht herausgearbeitet. Dies habe ich vor allem an der Einleitung bemerkt, die in der vorliegenden Fassung schnell zusammengestückt noch einer gründlichen Ausarbeitung bedarf. – Doch will ich nicht mit einer Selbstkritik aufwarten, die die eigentlichen Lücken ja am wenigsten erfassen kann, auch wenn man als Verfasser immer eine solche zu liefern vermag. Umso dankbarer wäre ich, von Ihnen, sehr verehrter Herr Professor, der Sie meine Fragestellung im Grunde veranlaßt haben und diese souverän überschauen, ein sachgerechtes Urteil hören zu dürfen.
Das mündliche Examen konnte ich im Sommer leider nicht mehr 27absolvieren. Der Termin hängt nunmehr von dem Referat Professor Kühns ab, der nach einer ersten Durchsicht nicht sehr erfreut schien, und ebenso von dem Korreferat Professor Löwiths, dem ich mit einigem Bangen entgegenschaue. Das Rigorosum selbst, das von Prof. Kühn abgesehen die Professoren Gadamer und Forsthoff abhalten werden, hoffe ich – mit Ihren Wünschen, die Sie mir haben zukommen lassen, im Rücken – gut zu überstehen.
Vorläufig versehe ich das hiesige Lektorat für Germanistik, das sich zum guten Teil in gesellschaftlichen Funktionen erfüllt, wie überhaupt die hiesige Universität weit mehr als bei uns ein soziales Ereignis darstellt. Die Universität ist ein halbes Wirtschaftsunternehmen, das von einem Wirtschaftsfachmann mit pädagogischen Intentionen geleitet, und das mit gewaltigen Aktienbündeln der zweitgrößten Zigarettenfabrik Englands versehen eine große Anerkennung genießt. Die innere Selbstsicherheit gewinnen die englischen Akademiker in ihrem Klubleben, das im Hintergrund der Institution diese beherrscht. Die Bibliothek birgt leider nicht allzuviel Schätze, daß ich meinen engeren Studien nicht ungehindert nachgehen kann.
Den Aufsatz über Voltaire und die Geographie im 18. Jahrhundert, der mir noch nicht zugänglich war, würde ich sehr gern lesen, aber weit mehr würde mich freuen, wenn Sie mir, sehr verehrter Herr Professor, Tiernos Beitrag zu Ihrer Festschrift – es muß ja der Schlüssel zu ihr sein – zukommen lassen würden. Aber vielleicht kann ich beide einsehen, wenn ich Sie – wie ich hoffe – in den Weihnachtsferien, wieder um den 12. Januar herum, aufsuchen darf? – Zum Schluß habe ich noch eine Bitte: Könnten Sie wohl das Exemplar meiner Dissertation, wenn es sich ermöglichen lässt, Herrn Kesting zustellen? Es ist eigentlich mein Handexemplar, da ich die anderen Exemplare zur schnelleren Lesung der Referate in Heidelberg zurückgelassen habe. Mehr Durchschläge habe ich leider noch nicht zur Verfügung. Herr Kesting arbeitet, wie er mir schrieb, gerade an einem Aufsatz über die Entstehung der Geschichtsphilosophie. Ich würde mich freuen, wenn er aus meiner 28Arbeit, an der er ja mitgewirkt hat, noch einigen Gewinn ziehen könnte.
In der Hoffnung, nicht zuviel der Bitten ausgesprochen zu haben und mit herzlichen Grüßen, auch an Ihr Fräulein Tochter, bin ich in Verehrung Ihr
Reinhart Koselleck
ÜBERLIEFERUNG O: Hs.; mit Notizen Schmitts; Landesarchiv NRW, Nachlaß Carl Schmitt.
Bristol, 2. 11. 1953: Schmitt notierte sich darunter Kosellecks Anschrift: »43 Sylvan Way / Sea Mills«.
Ihren liebenswürdigen Brief: Nr. 4.
Lektorat: Siehe Nr. 3 und 10.
Meine Dissertation: Siehe Nr. 3, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 20 und 20a.
Löwith: Der Philosoph Karl Löwith (1897-1973) nahm 1952 einen durch Hans-Georg Gadamer vermittelten Ruf an die Universität Heidelberg an. Nach seiner Habilitation bei Heidegger in Marburg (1928) hatte er bis 1934 an der dortigen Universität unterrichtet, wo ihm 1935 während eines Forschungsaufenthalts in Italien wegen der jüdischen Herkunft seines Vaters der Lehrauftrag entzogen wurde. Von 1936 bis 1941 war Löwith Prof. an der Universität Tōhoku in Sendai/Japan. Nach seiner Übersiedlung in die Vereinigten Staaten lehrte er erst am Hartford Theological Seminary, 1949 wechselte er an die New School for Social Research in New York. Im selben Jahr erschien sein Werk Meaning in History. The Theological Implications of the Philosophy of History (Chicago und London: University of Chicago Press 1949), an dessen von Hanno Kesting besorgter Übersetzung (Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie, Stuttgart: Kohlhammer 1953) auch Koselleck mitarbeitete (vgl. Koselleck/Dutt, S. 37f.). Drei Jahrzehnte später setzte Koselleck sich für die Veröffentlichung von Löwiths Lebensbericht aus dem Jahr 1940 ein und steuerte ein von tiefem Respekt durchdrungenes Vorwort bei (in: Karl Löwith, Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein Bericht [1986], neu hg. v. Frank-Rutger Hausmann, Stuttgart 29und Weimar: Metzler 2007, S. IX-XIV). – Schmitt vermittelte 1949 über den Merkur-Herausgeber Hans Paeschke Hanno Kesting für die Übersetzung von Meaning in History und veröffentlichte selbst eine Rezension des Werkes (»Drei Stufen historischer Sinngebung«, in: Universitas 5 [1950], S. 927-931; unter dem von Schmitt gewählten Titel »Drei Möglichkeiten eines christlichen Geschichtsbildes« wieder abgedruckt in: BW Blumenberg, S. 161-166). Daß Löwith der Autor der 1935 unter dem Pseudonym Hugo Fiala publizierten Schmitt-Kritik »Politischer Dezisionismus« (in: Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts 9 [1935], H. 2, S. 101-123) war, wußte Schmitt seinerzeit wohl nicht.
Gadamer: Hans-Georg Gadamer (1900-2002) war nach dem Existenzphilosophen Franz Josef Brecht Kosellecks zweiter philosophischer Lehrer in Heidelberg. Nach seiner Habilitation bei Heidegger (1929) lehrte er wie Löwith in Marburg, von 1933 an vertrat er aus rassepolitischen Gründen vakant gewordene Lehrstühle in Kiel und Marburg, bis er 1939 eine Professur an der Universität Leipzig erhielt, wo er – nach eher zurückhaltender Anpassung an den Nationalsozialismus – 1945 Dekan der Philosophischen Fakultät und 1947 Rektor wurde. 1949 folgte er dem Ruf an die Universität Heidelberg als Nachfolger von Karl Jaspers. Mit Gadamers Hermeneutik, nicht zuletzt seinem Hauptwerk Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik (Tübingen: Mohr 1960), hat sich Koselleck immer wieder auseinandergesetzt. Vgl. nur: »Historik und Hermeneutik« (1987), in: Zeitschichten, S. 97-118.
Forsthoff: Der Staatsrechtler Ernst Forsthoff (1902-1974), ein Bonner Schüler Schmitts, wurde 1943 an die Unversität Heidelberg berufen und 1946 wegen politischer Belastung aus dem Amt entlassen. 1952 erhielt er seinen Lehrstuhl zurück. Mit seinem Doktorvater stand Forsthoff vor allem nach dem Krieg in engem Austausch. Mit den Ferienseminaren im oberfränkischen Ebrach (siehe Nr. 52) öffnete er dem späten Schmitt einen akademischen Wirkungsraum. Vgl. BW Forsthoff.
Wirtschaftsfachmann mit pädagogischen Intentionen: Rektor (Vice-Chancellor) der University of Bristol war von 1946 bis 1966 der Pädagoge Philip Morris (1901-1979); das ihm nominell übergeordnete Ehren30amt des Kanzlers (Chancellor) bekleidete von 1929 bis 1965 Winston Churchill.
Zigarettenfabrik: Imperial Tobacco. Der erste Kanzler der Universität (1909-1911) und ihr maßgeblicher Stifter war Henry Overton Wills III (1828-1911), dessen Familienunternehmen W. D. & H. O. Wills sich 1901 mit zwölf kleineren Tabakfirmen zu Imperial Tobacco zusammenschloß.
Aufsatz über Voltaire: Siehe Nr. 4 und Anm.
Tiernos Beitrag: Siehe Nr. 4 und Anm.
Herr Kesting: Der Soziologe Hanno Kesting (1925-1975) kam schon früher als sein Heidelberger Studienfreund Koselleck mit Schmitt in Kontakt. Er wurde 1952 von Franz Josef Brecht und Hans-Georg Gadamer mit der Arbeit »Utopie und Eschatologie. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts« promoviert; sieben Jahre darauf erschien sein Werk Geschichtsphilosophie und Weltbürgerkrieg. Deutungen der Geschichte von der Französischen Revolution bis zum Ost-West-Konflikt (Heidelberg: Winter 1959). 1966 habilitierte er sich als Assistent von Arnold Gehlen an der RWTH Aachen mit der Arbeit Öffentlichkeit und Propaganda. Zur Theorie der öffentlichen Meinung (Bruchsal: San Casciano 1995), 1968 wurde er o. Prof. an der Ruhr-Universität Bochum.
Aufsatz über die Entstehung der Geschichtsphilosophie: Hanno Kesting, »Utopie und Eschatologie. Zukunftserwartungen in der Geschichtsphilosophie des 19. Jahrhunderts«, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 41 (1954), H. 2, S. 202-230. Der Sonderdruck in BRK trägt die Widmung: »Für Reinhart Koselleck – in der Hoffnung auf baldige Fortsetzung unseres ›ewigen Gesprächs‹«.
31[6]SCHMITT AN KOSELLECKPlettenberg, 11. November 1953
Prof. Dr. Carl Schmitt
Plettenberg II (Westf.)
Brockhauserweg 10
11. 11. 53
Lieber Herr Koselleck,
Ihr Geistes-Kind hat die Ueberfahrt von Bristol nach Plettenberg gut überstanden und ist hier glücklich gelandet. Ich habe es mit großer Freude in Empfang genommen und mich gleich vorzüglich mit ihm unterhalten. Das Manuskript werde ich dieser Tage an Hanno Kesting weitergeben. Ich habe es bereits durchgelesen und mir für unser Januar-Gespräch, auf das ich mich sehr freue, eine Reihe Notizen gemacht. Außerdem lege ich für dieses Gespräch den (an sich unergiebigen) Aufsatz von Weinert zurecht; ferner den wunderbaren Aufsatz von Enrique Tierno; ferner einen Aufsatz aus dem Jahre 1929: Ueber das Zeitalter der Entpolitisierungen und die Stufen der Neutralisierung. Im Augenblick beschäftigt mich am meisten die Frage: wie werden denn die Heidelberger Examinatoren/Rhadamantesse vor dieser außerordentlichen Arbeit bestehen? Werden sie Ihnen mit Lessing sagen: Weißt du, daß du schon ein halber Freimaurer bist? Werden sie es als Verletzung eines Tabu empfinden, wenn man an den Dualismus von Politik und Moral rührt und werden sie darin nicht eine Gefährdung ihrer eigenen geistigen Existenz erblicken? Alles aufregende Fragen, die aber für mich die Lektüre nur noch spannender gemacht haben. Und wird man es erlauben, daß Sie den in der Stratosphäre seiner Berühmtheit längst sakrosankten Friedrich Meinecke zu behandeln wagen, ohne in einen Taumel gesinnungstüchtiger Verehrung hinein zu geraten?
Alles weitere (insbesondere auch ein Problem des Aufbaues) also im Januar, wenn Sie nach Plettenberg kommen. Ich wollte Ihnen noch sagen, daß ich zwei wichtige Bücher von Collingwood: Au32tobiography und The New Leviathan, inzwischen in England aufgetrieben und endlich erhalten habe.
Herzliche Grüße und alle guten Wünsche für Ihren Aufenthalt in England! Ihr alter
Carl Schmitt.
Hobbes war Aussen. Und Innen. Emigrant. Richtig. Sogar Remigrant. Aber er gehörte nicht zu den siegreich zurückkehrenden Remigranten von 1660! Locke dagegen war siegreicher Remigrant.
ÜBERLIEFERUNG O: Ts., gedruckter Briefkopf; mit hs. Korrekturen und Ergänzungen von Carl Schmitt; DLA Marbach, Nachlaß Reinhart Koselleck.
Ihr Geistes-Kind: Kosellecks Dissertation. Siehe Nr. 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 20 und 20a.
Aufsatz von Weinert: Siehe Nr. 4 und Anm.
Aufsatz von Enrique Tierno: Siehe Nr. 4 und Anm.
Aufsatz aus dem Jahre 1929: Carl Schmitt, »Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen«. Im Oktober 1929 auf einer Tagung des Europäischen Kulturbunds in Barcelona gehaltene und erstmals im Dezember 1929 in der Zeitschrift Europäische Revue veröffentlichte Rede, die später gemeinsam mit der Abhandlung »Der Begriff des Politischen« (1927) erschien. Vgl. Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen. Mit einer Rede über das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen, München: Duncker & Humblot 1932 (zahlreiche Neuauflagen; zuletzt: ders., Der Begriff des Politischen. Synoptische Darstellung der Texte, hg. v. Marco Walter, Berlin: Duncker & Humblot 2018).
Rhadamantesse: Hs. Zusatz über »Examinatoren«. – Rhadamanthys ist in der griech. Mythologie ein kretischer Herrscher und Totenrichter in der Unterwelt (Hades). In Thomas Manns Roman Der Zauberberg (1924) wird Hofrat Behrens häufig als »Rhadamanth« oder auch »Rhadamanthys« bezeichnet.
Weißt du, daß du schon ein halber Freimaurer bist?: Diese Frage stellt der 33Freimaurer Falk dem jüngeren und wißbegierigen Ernst im zweiten Gespräch von Gotthold Ephraim Lessings Werk Ernst und Falk. Gespräche für Freimaurer (1778). In Kosellecks Dissertatonsschrift ist die Freimaurerei das zentrale Thema des zweiten Kapitels über den »Dualismus von Moral und Politik als Voraussetzung und als Ausdruck einer indirekten Gewaltnahme« (Kritik und Krise [1954]), S. 57-92). Dort wird auch jene Frage zitiert (S. 83).
im Januar / Plettenberg: Siehe Nr. 5 und 7-9.
Collingwood: Bei den genannten Werken des englischen Geschichtsphilosophen R.[obin] G.[eorge] Collingwood (1889-1943) handelt es sich um: An Autobiography, London: Oxford University Press 1939; The New Leviathan: or Man, Society, Civilisation and Barbarism, Oxford: Clarendon Press 1942.
Hobbes: Der für Schmitts wie Kosellecks politisches Denken zentrale englische Philosoph Thomas Hobbes (1588-1679) floh 1640 nach Frankreich. Nachdem er sich auch dort von politischer Verfolgung bedroht sah, kehrte er 1651 nach England zurück, wo er sich mit seinem im selben Jahr erschienenen staatstheoretischen Hauptwerk Leviathan erneut Feinde schuf. Nach der Restauration des Stuart-Königtums 1660 geriet er unter noch stärkeren Druck. Schmitt bezieht sich auf einen Passus in Kosellecks Doktorarbeit, wo Hobbes als »ein zwiefacher Emigrant der inneren sowohl wie der äusseren Emigration« bezeichnet wird (Kritk und Krise [1954], S. 27).
Locke: Der englische Philosoph John Locke (1632-1704) lebte zwischen 1683 und 1688 im holländischen Exil. Nach dem Sieg der protestantisch-bürgerlichen Partei, der Glorious Revolution (1688/89), erfreute er sich in seinem Heimatland großer Wertschätzung. – In der Charakterisierung Lockes als »siegreicher Remigrant« klingt die ablehnende Haltung des ›Besiegten‹ Schmitt gegenüber Remigranten in der frühen Bundesrepublik an.
34[7]KOSELLECK AN SCHMITTBristol, 29. November 1953
43, Sylan Way Sea Mills Bristol 29. 11. 53.
Sehr verehrter Herr Professor,
Mit grosser Freude habe ich Ihren Brief erhalten, für den ich Ihnen herzlich danke. Mit sehr unterschiedlicher Spannung warte ich nun auf das Gespräch, das ich mit Ihnen führen darf, und auf den Ablauf der Heidelberger Promotionsmaschine. Die Warnung Lessings wird mir niemand zurufen. Wohl aber wird man sich auf die vermeintliche Neutralität einer wissenschaftlichen Methodik berufen können, um mir im Namen eines methodisch jeweils anderen Zugriffs Unwissenschaftlichkeit vorwerfen zu können. Und zweifellos habe ich mich taktisch zu wenig darauf eingestellt. – Professor Kühn ist wesenhaft so tolerant, dass er meine Fragestellung gelten lässt, aber ich fürchte, dass ich mit der vorliegenden Arbeit seine Toleranz schon so sehr ausgelastet habe, dass er keinen Schritt darüber hinaus unternimmt, wenn es nötig sein sollte, (In dem Urteil über Meinecke weiss ich mich übrigens mit ihm einig). So bleibt das Referat von Professor Löwith noch abzuwarten, zu dessen geschichtsphilosophischer Skepsis – wenn sie nicht der Emigration entspränge! – meine Arbeit keineswegs in notwendigem Widerspruch stehen muss.
Vorläufig scheinen beide Referate noch auszustehen, und ich bin mir über den Termin einer mündlichen Prüfung noch völlig im Ungewissen. Da es sehr unwahrscheinlich ist, dass das Rigorosum noch vor Weihnachten angesetzt wird, andererseits die Prüfung vielleicht in der ersten Januarwoche stattfindet, habe ich die Frage, ob ich Sie, sehr verehrter Herr Professor, anstatt im Januar kurz 35vor Weihnachten besuchen darf? Ich werde zwischen dem 17. und 20. Dezember über Westfalen nach Hause fahren und wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir schreiben würden, ob ich Sie etwa in diesen Tagen einmal besuchen darf. Wenn die Prüfung im Januar angesetzt werden sollte, gerate ich vielleicht in Zeitknappheit, da das Semester hier am 15. Jan. beginnt.
Ich habe gerade die hervorragende Einleitung zu Hobbes' Leviathan von Michael Oakeshott (London 1946) in die Hand bekommen, die Sie ja wahrscheinlich kennen. Die entscheidenden Unterschiede von Autorität und Macht, von Natur-und-Staatsrecht, die vor allem rationale Konstruktion und die Bedeutung des christlichen Staates bei Hobbes werden sehr scharf herausgearbeitet. Sollten Sie diese Ausgabe noch nicht kennen, oder nicht besitzen, aber Wert darauf legen, würde ich sie gerne für Sie erwerben; (in Bristol ist die Oakeshottsche Edition z. Z. nicht zu haben). Das Gleiche gilt natürlich für jedes andere Buch, das Sie vielleicht aus England brauchen.
Mit herzlichen Grüßen bin ich in Verehrung
Ihr Reinhart Koselleck
ÜBERLIEFERUNG O: Ts.; mit Notiz Schmitts; Landesarchiv NRW, Nachlaß Carl Schmitt.
Sylan Way: Korrekt lautet der Straßenname »Sylvan Way«.
Ihren Brief: Nr. 6.
das Gespräch: Siehe Nr. 9.
Warnung Lessings: Siehe Nr. 6 und Anm.
Urteil über Meinecke: Siehe Nr. 6.
Einleitung zu Hobbes' Leviathan: Thomas Hobbes, Leviathan. Edited with an introduction by Michael Oakeshott, Oxford: Blackwell 1946.
36[8]SCHMITT AN KOSELLECKPlettenberg, 2. Dezember 1953
Prof. Dr. Carl Schmitt
Plettenberg II (Westf.)
Brockhauserweg 10
2. 12. 53
Lieber Herr Koselleck, natürlich sind Sie mir auch in der Zeit vom 17. bis 20. Dezember hier willkommen. Die Leviathan-Ausgabe von Michael Oakeshott besitze ich. Nachdem ich auch die beiden Bücher von Collingwood (Autobiography und The New Leviathan) erhalten habe, brauche ich im Augenblick kein englisches Buch. Vielen Dank für Ihr freundliches Angebot!
Auf ein gutes Wiedersehen
stets Ihr
Carl Schmitt.
Kleine, praktische
Reiselektüre folgt
gleichzeitig als Drucksache!
ÜBERLIEFERUNG O: Ts.; gedruckter Briefkopf; mit hs. Ergänzung; DLA Marbach, Nachlaß Reinhart Koselleck.
Leviathan-Ausgabe: Siehe Nr. 7 und Anm.
Bücher von Collingwood: Siehe Nr. 6 und Anm.
Reiselektüre: Carl Schmitt, »Nehmen / Teilen / Weiden. Ein Versuch, die Grundfragen jeder Sozial- und Wirtschaftsordnung vom Nomos her richtig zu stellen«, in: Gemeinschaft und Politik 1 (1953), H. 2, S. 17-27 (laut Schmitts Verzeichnis der Empfänger von Freiexemplaren, Sonderdrucken u. ä. in: LAV NRW, RW 265-19600). In Kosellecks Bibliothek (BRK) ist der Sonderdruck nicht überliefert.
37[9]KOSELLECK AN SCHMITTHannover, 30. Dezember 1953
Hannover-Waldheim Brandensteinstr. 37 30. 12. 1953.
Sehr verehrter Herr Professor,
für die freundliche Aufnahme, die ich bei Ihnen gefunden habe, danke ich Ihnen herzlich. Auf meiner Heimfahrt erfuhr ich von Kestings unglücklicherweise zu spät, daß Ihnen der Sonnabend eigentlich gelegener war. So hoffe ich nun, daß meine unsicher gemeldete Ankunft Sie nicht allzusehr gestört hat.
Wenn man aus dem grünen Einerlei der englischen Atmosphäre zurückkehrt, ist es beruhigend zu wissen, daß die Spannungen, denen man sich als Deutscher und Kontinentaleuropäer ausgesetzt sieht, ihren geschichtlichen Ort haben und nicht »abstrakt« sind, wozu sie der »Common Sense« zu stempeln sucht. Und wenn man zu diesem Ort – gleichsam persönlich in Ihrem Hause – Zutritt findet, dann darf ich darin einen zusätzlichen Grund erblicken, Ihnen, sehr verehrter Herr Professor, dankbar zu sein.
Einen besonderen Dank möchte ich hinzufügen für die Kritik, der Sie meine Dissertation unterworfen haben. Ihr Hinweis auf die Priorität des Historischen vor dem Systematischen in meiner Arbeit, die ich im Aufbau nicht genügend berücksichtigt habe, trifft eine Hauptschwäche meiner ganzen Dissertation. Ich habe im Stillen dauernd mit dieser Schwierigkeit gerungen, und an meiner eigentlichen Intention gemessen habe ich unentwegt Konzessionen an die Historie gemacht, ohne mir das so recht einzugestehen. Es fehlt eben an einer klaren Grundlegung der »Geschichtlichkeit«, um das Problem der Differenz zwischen Geschichte als Historie und Geschichte als der eschatologischen Struktur mensch38lichen Handelns und Leidens ungehindert umgehen bzw. hinterfragen zu können.
Ihr zweiter Einwand, daß ich zuviel ausgesprochen habe und zu unvorsichtig war in der Niederschrift, hängt mit dem ersten eng zusammen, denn was heißt er anderes, als das zu verschweigen, was man – gleichsam systematisch – in der Geschichte erfahren hat und was man durch die Historie nicht erlernen kann. Dieser Einwand hat mich während der Niederschrift ständig begleitet und verfolgt. Und ich habe meine ganze Energie darauf verwandt, meine Skrupel niederzuhalten, um überhaupt zu einer Aussage zu kommen, anstatt meine Feststellungen durch die Skrupel zu regulieren. Ich scheine noch etwas von jener unreifen Penetranz an mir zu haben, die sagen zu müssen glaubt, was sie weiß.
Freilich verbirgt sich dahinter die ganze Frage nach der Wissenschaftlichkeit der »Geschichte«. Was darf einer sagen und was kann und was hat einer zu sagen? Die Träger dieser Möglichkeiten sind offensichtlich nicht mehr identisch. Die wissenschaftliche Objektivität der Historie beruht eben immer noch auf der vorgängigen Einheit der Personen, die etwas zu sagen haben und dies auch dürfen. Die Fähigkeit zur Beschränkung zeugt heute nicht mehr aus methodischen, sondern aus politischen Gründen von grösserem Wissen.
Das Hobbes-Zitat, das ich Ihnen zu senden versprochen habe, kann ich in Hannover nicht ermitteln. Ich schicke es Ihnen, sobald ich es finde, voraussichtlich aus Heidelberg (von wo ich übrigens immer noch keine Nachricht habe).
»Die britische Verfassung« von H. R. G. Greaves ist 1951 im Metzner-Verlag/Frankfurt am Main erschienen und von Dr. jur. W. Kalisch/Göttingen übersetzt worden. (Die aktuellen Angaben sind, wie mir ein informierter Engländer sagte, seit der englischen Auflage von 1946 überholt. Die soziologischen Analysen bleiben dennoch sehr aufschlußreich).
Den Hume-Aufsatz werde ich Ihnen gleich nach meiner Rückkehr aus England senden.
39Mit den besten Wünschen für das kommende Jahr und für das Gelingen Ihrer Mexiko-Reise
bin ich in Verehrung
Ihr Reinhart Koselleck
ÜBERLIEFERUNG O: Hs.; Landesarchiv NRW, Sammlung Carl Schmitt.
Hannover-Waldheim: Wohnort von Kosellecks Eltern.
freundliche Aufnahme: Kosellecks zweiter Besuch bei Schmitt in Plettenberg fand wohl am 20. Dezember statt. Vgl. den Eintrag in Schmitts Verzeichnis der Empfänger von Freiexemplaren, Sonderdrucken u. ä. (LAV NRW, RW 265-19600), hier in Bezug auf Schmitts Formel »Homo homini Radbruch« (dazu auch: Glossarium, S. 103, 235, 298f., 302f., und 441).
Kestings: Hanno Kesting lebte zu dieser Zeit mit seiner Frau Brigitte (geb. Albrecht) in Dortmund, wo er an der dortigen Sozialforschungsstelle (siehe Nr. 10 und Anm.) arbeitete.
Hobbes-Zitat: Siehe Nr. 10.
»Die britische Verfassung«: H. R. G. Greaves, Die britische Verfassung, übers. v. Werner Kalisch, Frankfurt a. M.: Metzner 1951.
Hume-Aufsatz: Siehe Nr. 10 und Anm.
Mexiko-Reise: Schmitt war zu der am 23. März 1954 von Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard eröffneten Deutschen Industrie-Ausstellung in Mexiko-Stadt eingeladen worden, wurde jedoch Weihnachten 1953 von der Deutschen Botschaft wieder ausgeladen.
40[10]KOSELLECK AN SCHMITTBristol, 14. Februar 1954
Bristol, 14. II. 1954 43, Sylvan Way Sea Mills
Sehr verehrter Herr Professor,
es war ein erfreuliches Zeichen für mich, und nicht ohne Sinn für den Ablauf meines Studiums, dass ich noch eine Stunde vor meiner Abfahrt aus Heidelberg so ganz unvermutet Ihre freundlichen Glückwünsche zum bestandenen Rigorosum übermittelt bekam. Nehmen Sie für die Glückwünsche und ebenso für die vielfachen Hilfen, mit denen Sie persönlich und durch Ihr Werk meinen Studiengang gefördert haben, meinen herzlichen Dank entgegen.
Den unerwartet schnellen Ablauf meiner mündlichen Prüfung verdanke ich im Wesentlichen Professor Kühn, der, kaum dass ich ihn in Heidelberg aufsuchte, impulsiv einen Brief an den Dekan verfasste, in dem er sich offensichtlich sehr lobend über meine Arbeit aussprach, die ganz durchzulesen er immer noch nicht die Zeit gefunden habe, und in dem er schliesslich auf meine Tätigkeit in England verwies. (Kühns erste, recht strenge Kritik an meiner Arbeit war anscheinend mehr an meine Hausadresse gerichtet, als grundsätzlicher Natur). Der Dekan, Professor Preiser, willigte in Kühns Bitte um eine vorzeitige Prüfung ein, vorausgesetzt, der Korreferent, Professor Löwith, würde zustimmen. Löwith sagte schließlich auch zu, vorausgesetzt, dass seine Instanz als Korreferent auf diesem Wege in keiner Weise umgangen würde. Es stehen also sowohl das schriftliche Gutachten von Kühn selber als auch das Korreferat von Löwith noch aus. Vor dem Sommersemester kann ich sie kaum erwarten, und vor allem auf das letztere bin ich begreiflicherweise sehr gespannt. Ob sich Löwiths Kritik gegen die ganze Arbeit als solche oder nur gegen ihre wissenschaft41liche Qualifikation oder ersteres auf dem Wege des zweiten richten wird, bleibt also noch offen.
Die mündliche Prüfung selber verlief dank der Besonnenheit und Loyalität meiner Prüfer sehr ruhig. Professor Forsthoff, den ich bis dahin nur zweimal kurz gesprochen hatte, vollzog die Prüfung in Form eines Gespräches über geschichtliche Fragen des Staatsrechtes, die immer wieder in der gegenwärtigen Situation endeten. Professor Gadamer prüfte mich – mit Rück- und Vorgriffen auf Descartes, Leibniz und Heidegger – wesentlich über Kant, holte manche Antworten durch Seitenfragen aus mir heraus und liess mich über den geschichtsphilosophischen Strang, der sich durch das Werk von Kant zieht, frei sprechen. Kühn schliesslich machte mit mir einen Gang durch die Weltgeschichte am Beispiel Deutschlands, dessen historisches Motto »immer zu spät« sei. Stichfragen nach konkretem Wissen und Beurteilungen geschichtlicher Probleme, z. B. der Rolle der Reformation für die verschiedenen europäischen Staaten, hielten einander die Waage. Ich habe die Examina, wie ich von Forsthoff selber und sonst von vierter Seite erfuhr, mit zwei »magna« und in Geschichte mit »summa« passiert und darf also inoffiziell mit einer gewissen Zufriedenheit auf sie zurückblicken.
Ich muss noch eine meiner letzten Äusserungen in unserem Plettenberger Gespräch berichtigen: Professor Kühn kennt sehr wohl Ihren »Nomos der Erde« und beruft sich in seiner neuesten Veröffentlichung ausdrücklich auf das Werk im ganzen und zitiert die »zwei Wahrheiten« über das Völkerrecht und die Frage der Abschaffung des Krieges (S. 219 Mitte) im besonderen. Das Zitat befindet sich in einem Aufsatz über »Das Geschichtsproblem der Toleranz« in einer internationalen Gedenkschrift: »Autour de Michel Servet et de Sebastien Castellion«, Recueil publ. sous la dir. de B. Becker, Prof. à l'univ. d'Amsterdam, H. D. Tjeenk Willink u. Zoon N. V. Haarlem 1953 p. 28, und zwar insofern an exponierter Stelle, als es zur Unterstützung des letzten Satzes herangezogen wird. Dieser Satz lautet: »Jeder Versuch, ein Zeitalter reinen Gel42tenlassens mit Gewaltmassnahmen heraufzuführen, führt zu neuer Zerstörung und Unterdrückung«, und ist für Kühn bezeichnend, da er echte geschichtliche Einsichten (»Geschichte duldet keine Dauersicherheit«, 14) immer mit neukantianischen Termini auffrisiert. Der Begriff der Toleranz ist für ihn »das Ertragen des Anderen. Besser noch (weil positiver): das Geltenlassen des ›Anderen‹« (3). K. bemüht sich in dem Aufsatz, wie wir heute sagen würden, um ein Problem der Geschichtlichkeit, und zeigt, dass es keine »Toleranz überhaupt« gibt, sondern dass Macht, Gesellschaft und Religion immer zur Intoleranz hin tendieren, Toleranz daher nur als das Ergebnis historischer Konstellationen, Gewichtsverschiebungen (wie vor allem im 16. bis 18. Jh.) und Akzentverlagerungen möglich ist, die gleichsam einen freien Raum für Toleranz aussparen. Solche Gewichtsverschiebungen stünden heute auf der politischen Ebene freilich nicht in unserer Gewalt. So rekurriert Kühn auf eine andere Möglichkeit für Toleranz, die sein eigentliches »Anliegen« ist, auf die Betonung »religiös-universaler (aus mystischer Wurzel stammender) Anschauung« (27). Schliesslich sieht er die dritte Möglichkeit von Toleranz in gegenseitiger Rücksichtnahme und Anerkennung von Spielregeln und Grenzen, wofür er den Oberbegriff der Apparatur und Maschinerie verwendet. Indem er heute, im Zeitalter der Technik, diesen Begriff der Maschinerie weiterhin im Sinne einer politischen Balancierung verwendet, zeigt er, dass er trotz seines ernsten Kampfes gegen allen Utopismus aus den liberalen Denkformen nicht herausfindet. Obwohl er weiter sieht und weiter denkt, entrinnt er nicht dem Schicksal, dass seine Worte verhallen, weil sie, abgebraucht, nicht mehr gehört werden.
Kühn schlug mir übrigens vor, an einer Geschichte des Neuplatonismus in der NZ zu arbeiten, was ich bestimmt nicht tun werde, zumal Taubes das Feld schon weitgehend bearbeitet hat und dies wohl noch tut. Die Frage, was ich demnächst arbeiten soll, hängt eng mit meiner hiesigen Stellung zusammen. Mein hiesiger Professor bot mir ein zweites Jahr Lektorat an. Wenn ich zusage, mei43ne auf die Dauer gesehen nicht gerade anregende Stellung an der hiesigen Universität beizubehalten, hätte ich die Gelegenheit, relativ gut bezahlt, in ausgedehnter »Freizeit« und in bezahlten Ferien, ein englisches Thema zu behandeln, das ich in Amerika, wohin man vielleicht durch ein Stipendium gelangen könnte, fortsetzen kann. Ich könnte dann in beiden folgenden Jahren auf den Spuren meiner bisherigen Arbeit versuchen, die Fortschritts (und Kreislauf-) Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts mit ihren politischen und geschichtlichen Implikationen zu untersuchen. Ich weiss freilich nicht, ob in diesem Fragenkreis: England-Kontinent, Europa-Amerika, Welteinheit und Revolution, über Ihre Feststellungen hinaus im Augenblick Neues gesagt werden kann, wenn mir auch eine entsprechende Quellendurchsicht und Materialanordnung viel Freude machen würde. Es fragt sich für mich, ob ich auf diesem Gebiet, das mir relativ wenig Vorarbeit kosten würde, eine Habilitationsschrift zusammenzustellen versuchen soll. Es gäbe natürlich noch eine Fülle anderer Themen, die wie ich glaube noch keine sachgerechte Darstellung gefunden haben, z. B. die zunehmende »Demokratisierung« Englands und die diesem Vorgang korrespondierende Rolle des Empires, oder Disraeli und Marx. Mit solchen Fragen kann ich mich gut beschäftigen, wenn ich in England bleibe.
Dem gegenüber steht die Anfrage oder der Vorschlag, den Popitz in den Weihnachtstagen mir machte, ob ich nicht Lust habe, im Dortmunder Institut mitzuarbeiten. Obwohl ich mit den Einzelheiten der dortigen Arbeit natürlich nicht vertraut bin, glaube ich doch, dass ich nach dem, was ich von ihr gesehen habe und soweit ich auch durch Herrn Kesting Einblick in sie gewonnen habe, an dem Dortmunder Institut eine sinnvolle und zufriedenstellende Tätigkeit leisten könnte.