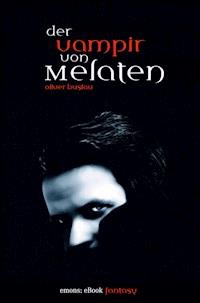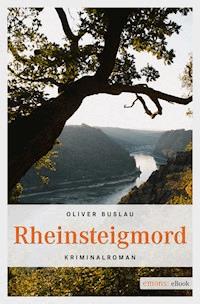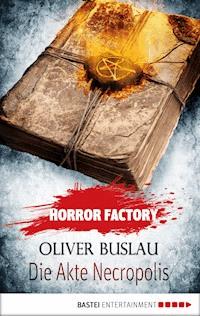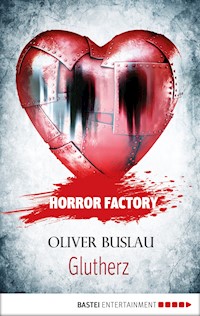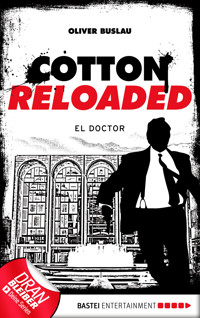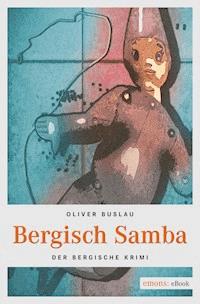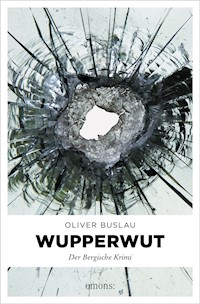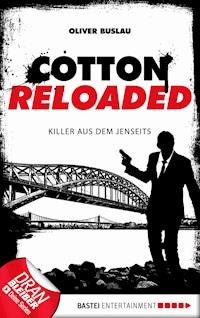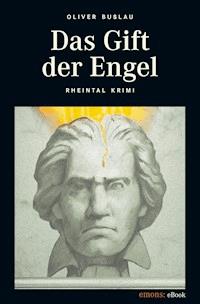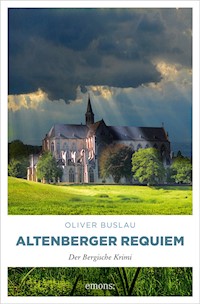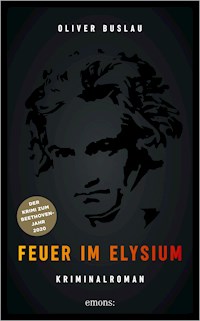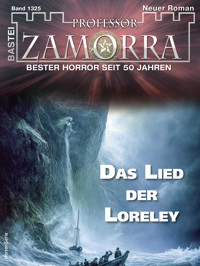Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Bergischer Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine Frau wird tot am Fuß von Schloss Burg aufgefunden - erstochen mit einem Schwert. Während Privatdetektiv Remigius Rott zu ergründen versucht, warum der Täter sein Opfer ausgerechnet mit dieser außergewöhnlichen Mordwaffe getötet hat, erkennt er, dass es um eine sehr alte Rechnung geht - und um die Nibelungensage. Die Rätsel häufen sich, und Rott wird klar: Auch ihm ist der Täter auf den Fersen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oliver Buslau wurde 1962 in Gießen geboren. Er wuchs in Koblenz auf, studierte in Köln und Wien Musikwissenschaft und Germanistik und lebt heute in Bergisch Gladbach. Er ist Gründer, Chefredakteur und Mitherausgeber der Zeitschrift TextArt – Magazin für Kreatives Schreiben. »Der Bulle von Berg« ist der achte Band seiner Detektivromanreihe um den Wuppertaler Privatdetektiv Remigius Rott. Im Emons Verlag erschienen außerdem mehrere Kriminalromane mit Schauplätzen im Rheintal, der Fantasy-Roman »Der Vampir von Melaten« und der historische Kriminalroman »Schatten über Sanssouci«, der am Hofe von Friedrich II. in Potsdam und Berlin spielt. Darüber hinaus ist Buslau Autor der Thriller »Die fünfte Passion« und »Die Orpheus-Prophezeiung« sowie diverser Kurzkrimis für Zeitschriften und Anthologien. In der 2011 gegründeten Krimiautorenband »Hands up! & The Shooting Stars« spielt er Bratsche und Klavier.www.oliverbuslau.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2014 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: iStockphoto.com/Aifos Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-381-1 Der Bergische Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Prolog
Im ersten Morgengrauen taumelte ich aus dem Wagen.
Meine Hände bluteten.
Der Golf stand einsam auf einem großen Platz aus platt gefahrenem Schlamm. Dahinter befand sich ein Schild: »Fußweg zum Brückenpark Müngsten«. Darunter ein Pfeil.
Meine Muskeln kamen nur schwer in Gang, aber es gelang mir nach und nach zu rennen.
Ich gelangte auf einen Plattenweg, der am Rand des Parkplatzes entlangführte. Dann ging es durch einen Fußgängertunnel unter der Hauptstraße hindurch.
Die Bewegung trieb die Kälte aus meinen Gliedern.
Das zehnte Rätsel kam mir in den Sinn.
Sie sitzt dir im Nacken. Sie lässt dich schwitzen. Sie kann dich lähmen. Aber sie verleiht dir auch Flügel.
Das stimmte.
Und wie das stimmte!
Weiter.
Worte klangen mir in den Ohren. Worte, die ich heute Nacht gehört hatte.
»Komm an die Brücke. Vielleicht sehen wir uns da ja noch.«
Alles war frühmorgendlich still. Nur mein eigener Atem rasselte laut. Vom Parkplatz bis zur Brücke – das war sicher mehr als ein Kilometer. Meine Lungen schmerzten.
Neben mir floss träge die Wupper. Ein Vogel stob irgendwo hinter den Bäumen auf, aufgeschreckt von meinen Schritten und meinem Keuchen. Das Licht wirkte, als würde die Sonne durch eine fahle Staubschicht gefiltert.
Und da war die Brücke.
Der riesige Bogen – ein Schattenriss vor dem milchigen Himmel. Die Rundung hatte etwas von einem gigantischen Auge, das ernst auf mich herabblickte.
Haus Müngsten lag da wie ein seltsames Relikt aus uralten Zeiten. Sehr klein verglichen mit dem das Tal überspannenden stählernen Monstrum.
Ich stoppte, als die Brücke fast direkt über mir aufragte und ich vor mir auf dem Weg etwas liegen sah. Zuerst erinnerte es mich an ein Stoffbündel. Dann erkannte ich die Gliedmaßen. Und den riesigen dunklen Fleck.
Ich blieb stehen, beugte mich schwer atmend nach vorne. Schweißtropfen fielen auf den Weg.
Ich war zu spät gekommen.
1
Vier Tage zuvor lechzten alle nach dem Frühling. Karneval war vorbei, es ging bereits auf Ostern zu, aber man musste sich immer noch in dicke Mäntel packen, Eis von den Autoscheiben kratzen und immer und ständig die Heizung anmachen. Der Winter hatte die Welt noch fest im Griff. Als stünde Weihnachten vor der Tür. Oder als hätten wir gerade erst Silvester gefeiert.
Urlaub, dachte ich. Urlaub wäre schön.
Das war mein erster Gedanke, als ich in Wonnes Wohnung aufwachte.
Vielleicht waren die Gedanken an den Winter, an die Kälte und die Sehnsucht nach dem Urlaub der Grund, dass ich nicht sofort merkte, was los war. Dass etwas nicht stimmte. Oder ich war einfach überarbeitet.
Am Abend zuvor war ich spät von den Recherchen zu einem Fall zurückgekommen, der mich fast das ganze Wochenende und noch den gestrigen Montag in Beschlag genommen hatte. Eine typische Ehepartnerüberwachung. Die Frau eines Verwaltungsbeamten aus Burscheid mutmaßte, dass ihr Gemahl fremdging. Hauptindiz: Er war in dem Fitnessstudio, das er angeblich hin und wieder aufsuchte, gar nicht angemeldet. Das hatte die Gattin zufällig herausbekommen, als sie im Studio anrief, weil sie ihren Mann wegen irgendetwas dringend sprechen musste.
Ich hatte den Herrn bis nach Köln verfolgt und herausgefunden, dass er einen Tanzkurs besuchte. Gestern Abend hatte ich ihn vor der Tanzschule in Ehrenfeld abgepasst und mit ihm gesprochen. Eigentlich war das gemäß Auftraggeberin untersagt. Die Überwachung sollte auf jeden Fall geheim bleiben. Aber im Gespräch erfuhr ich, was ich mir schon gedacht hatte: Der Mann wollte seine Frau zum anstehenden sechzigsten Geburtstag überraschen. Kreuzfahrt mit allem Schnick und Schnack, Kapitänsdinner und eleganten Tanzabenden in Ballsälen auf dem Schiff. Dafür musste man in Sachen Foxtrott, Walzer, Rumba, Tango und was noch alles fit sein.
Ich brachte ihn dazu, seiner Frau möglichst bald die Wahrheit zu sagen, und leierte ihm mein Honorar aus dem Leib. Im Gegenzug versprach ich, meine Auftraggeberin hinzuhalten. Ich hatte beschlossen, erst mal eine Woche so zu tun, als gäbe es keine neuen Hinweise. Mit dem Geld des Herrn Gemahls bezahlte ich meine Schulden.
Gegen halb zwölf war ich nach Hause gekommen – in meine Wohnung in Wuppertal. Ich hatte meine Sachen abgestellt und Wonne angerufen, um ihr zu sagen, dass ich noch käme. Dann hatte ich mich in meinen Golf gesetzt und war die Strecke von Wuppertal hierhergefahren, in dichtem Schneetreiben und eingekesselt von Lkws.
Wonne wohnte seit einem Jahr in Bergisch Gladbach, in einem Seitenarm der Mülheimer Straße, der langen Verbindungsstrecke nach Köln. Als sie mir damals ihre Umzugspläne mitgeteilt hatte, war ein leichter, aber deutlicher Schmerz durch mich hindurchgezuckt. Ich hatte es nie offen zugegeben und mir vielleicht auch selbst nicht richtig eingestanden, aber ich hatte mir schon gewünscht, den Schritt zu einer gemeinsamen Wohnung zu tun – vielleicht in Elberfeld. Leider wurde mir das erst in dem Moment klar, als Wonne schon ihren Umzug plante.
Nun wohnte sie etwa sechzig Kilometer von mir entfernt, ging weiter ihrem Job als freie Journalistin nach, und ich hatte mich damit abgefunden, dass wir zwar zusammen waren, aber eben getrennt lebten.
Ein einziges Mal hatten wir darüber gesprochen.
Ein einziges Mal.
Nicht öfter.
»Du bist eben ein einsamer Wolf, Remi. Ich bin mir nicht sicher, ob du überhaupt mit jemandem zusammenleben kannst. Und wir haben doch unsere Jobs, unsere Arbeit. Ist es nicht schöner, wenn wir uns die Zeit, die wir zusammen verbringen, auch selbst aussuchen? Sie ist doch dann viel … intensiver.«
Solche Reden kannte ich aus Fernsehfilmen, aus Serien. Fast immer waren sie der Anfang vom Ende.
Sie hatte mich mit ihren türkisfarbenen Augen angesehen, und mir war aufgefallen, dass das herzerfrischende Lächeln, das mich schon am ersten Tag so fasziniert hatte, verschwunden war. Was sollte ich darauf antworten?
Was sagten denn die Helden, die die Frauen am Ende dennoch erfolgreich in eine eigene Wohnhöhle brachten, in so einem Fall? Ich musste es wissen, denn Fernsehen gehört zu meinen liebsten Freizeitbeschäftigungen. Aber mir fiel nichts ein. Ums Verrecken nicht.
Und so hatte ich nur genickt. Nach dem Motto: Wenn du es so willst, dann soll es so sein.
War ich denn ein Macho, der bestimmte, was gemacht wurde? Der einfach eine Wohnung mietete, die Frau eines Tages hinbrachte und vor vollendete Tatsachen stellte?
»Hallo Schatz, könntest du dir vorstellen, hier zu leben? Sag nichts, ich habe den Vertrag schon unterschrieben. Das hier ist jetzt alles unseres. Deins. Freu dich gefälligst.«
Und die Frau sagt nicht: »Sag mal, was fällt dir denn eigentlich ein, hier einfach Alleingänge zu machen – wo ich wohne, wo ich lebe, will ich selbst bestimmen, dass das mal klar ist. Außerdem ist es besser, wir lassen unsere Beziehung erst mal ruhen, bis du das gelernt hast. Tschö.« Worauf sie hinausstürmt und die Tür der neuen Wohnung zuknallt.
Nein, die Frau macht erst ein sehr überraschtes, dann sehr glückliches Gesicht, fällt dem Geliebten um den Hals und stößt gerührt hervor: »Ist das wirklich wahr? Das hast du für mich getan?« Und der Mann streicht ihr eine Strähne – in Wonnes Fall eine goldblonde – aus dem Gesicht und sagt sanft: »Nein, Baby, nicht für dich, nicht für mich. Für uns.«
Woraufhin dann natürlich keine Türen knallen. Stattdessen gibt es in der kahlen Wohnung auf dem nackten Boden, vielleicht auf dem Wohnzimmerparkett, den ersten Sex im neuen Zuhause.
Als ich an besagtem Dienstagmorgen in Wonnes Schlafzimmer endlich wach war, streifte mich die Erinnerung daran, wie sie mir mitten in der Nacht die Tür geöffnet hatte. Sie hatte schon geschlafen und sich dann, ohne etwas zu sagen, gleich wieder hingelegt, während ich mich auszog und zu ihr unter die Decke kroch.
Ich tastete nach rechts. Dort sollte eigentlich Wonnes warmer Körper liegen. Aber das Bett war leer, die Decke zurückgeschlagen.
Der Wecker zeigte kurz nach acht.
Langsam kamen meine Gedanken in Gang.
Und es gab mir einen Stich, als mir klar wurde, dass ich natürlich völlig vergebens gekommen war.
Ich hatte mir eingebildet, so etwas wie den Rest eines schönen, nur kurz durch etwas Arbeit unterbrochenen Wochenendes zu erleben. Aber es war eben nur eine Einbildung. Ich hatte gut sieben Stunden in Wonnes Bett geschlafen, und wenn ich mich gleich angezogen und einen Kaffee getrunken hatte, würde ich wieder auf die Piste gehen und zurück nach Wuppertal in mein Wohnbüro an der Ecke Luisenstraße in Elberfeld fahren. Ich konnte mich dann weiter mit angeblichen Fremdgehern, heimlichen Tanzkursbesuchern und Ähnlichem herumschlagen. Meine Schulden war ich zwar los, aber schon bald war wieder der Erste, und im Moment sah es nicht danach aus, dass ich genug beisammenhaben würde, um die Miete bezahlen zu können.
Eins war klar: Mit Wonne in einer Wohnung zu leben, wäre sicher billiger.
Ich setzte mich auf, rubbelte durch mein Haar und seufzte.
Aus dem Nebenraum kamen Geräusche von einer Tastatur. Aha, Wonne arbeitete. Das Tippen kam unregelmäßig. Sie schien keinen Text zu schreiben, sondern im Internet zu surfen.
Ich erhob mich, ging nach nebenan und sah sie an ihrem kleinen Schreibtisch sitzen, der mit Papierkram bedeckt war. Auch sie hatte eine Büro- und Wohnungskombination. Neben der Schreibecke stand ein rosa Sofa. Wenn man sich draufsetzte, konnte man gerade so die Füße ausstrecken, dann stieß man gegen den Fernseher, der an der Wand gegenüber stand.
»Morgen«, sagte ich und lauschte meiner eigenen Stimme nach, wobei ich bemerkte, dass sie direkt schüchtern klang.
Seltsam, wenn ich Wonne arbeiten sah, fühlte ich mich immer als der Unterlegene, der Schwächere, und glaubte, dass ich sie nicht stören dürfe. Wonnes Arbeit war etwas Heiliges, während sie mich dauernd störte.
Sie tippte, klickte, las.
»Morgen«, sagte sie, ohne sich umzudrehen.
Ich nahm meine Schüchternheit mit unter die Dusche.
Der Gedanke, dass ich im Grunde einhundertzwanzig Kilometer umsonst gefahren war, saß irgendwo in meinem Bauch fest. So darfst du aber nicht rechnen, sagte irgendetwas in mir, während mir das Wasser auf den Körper prasselte. Es gibt gute und schlechte Tage. Vielleicht ist es auch das Wetter. Es macht die Leute melancholisch und ungeduldig, manche sogar aggressiv.
Eine Großstadtgegend in spätwinterlichem Schmuddelwetter, wem gefiel das schon?
Ich kam aus der Dusche und schaltete mein Smartphone ein, das ich mir vor Kurzem zugelegt hatte.
Eigentlich war ich mit meinem normalen Handy wunderbar zurechtgekommen, aber dann war mir bewusst geworden, welche Möglichkeiten man hatte, wenn man die ganze Welt des Internets mit sich herumtrug. Man konnte auf dem Ding sogar Bücher lesen. Zum Beispiel auf langweiligen Überwachungen. Oder man schoss Vögel durch die Gegend, die sich an irgendwelchen Schweinen rächen wollten und dabei die Gebäude zum Einsturz brachten, in denen die Schweine lebten. Was genau die Story hinter dem Spiel war und warum die Szenen zum Teil sogar im Weltraum spielten, hatte ich nicht verstanden – ich würde aber wetten, dass es den Erfindern des Spiels genauso ging.
Ich wollte wieder zu Wonne ins Arbeitszimmer gehen und mir zumindest den morgendlichen Kuss abholen. Immerhin hatte ich mir die Zähne geputzt.
Doch Wonne war nicht da. Der Computer blinkte, der Bildschirm war schwarz.
Sie war nicht in der Wohnung.
Was war jetzt los?
Im Schlafzimmer surrte mein Handy in kurzen Stößen. Das hieß, es gab Nachrichten für mich.
Das ist der Fluch eines solchen Gerätes.
Es gibt immer Nachrichten.
Allerlei blödsinnige Mails hatten sich angesammelt: Jemand machte sich Sorgen über meine Krankenversicherung und behauptete, dass ich schon für fünfundzwanzig Euro im Monat eine private haben konnte. Wusste der Mensch, dass ich demnächst einundfünfzig Jahre alt wurde und einen gefährlichen Beruf hatte? Sicher nicht.
Ich öffnete eine Mail, in deren Betreffzeile ich persönlich angesprochen wurde: »Auftrag für Herrn Remigius Rott«.
Im Ernst? Ein neuer Kunde, der mich via Mail engagierte? Das hatte ich noch nie erlebt.
Aber ich sah sofort, dass etwas nicht stimmte. Es war kein richtiges Anschreiben. Es war kein Auftrag. Jedenfalls nicht im normalen Sinne. Es war ein Rätsel.
»Sie kann heilen. Auch wenn du sie totschlägst. Du willst sie gern festhalten. Aber sie fließt trotzdem weiter.«
Ich sah nach dem Absender, aber da war kein Name, nur eine kryptische Mailadresse, zusammengesetzt aus einer sinnlosen Zeichenkombination.
Ich setzte mich in Wonnes Schreibtischsessel und überlegte einen Moment, ob ich dem Spaßvogel antworten sollte oder nicht. Die Lösung seines Rätsels war klar: Es war die Zeit, die da umschrieben wurde.
Ich machte eine Bewegung mit dem Arm, und der Laptop erwachte aus dem Schlaf. Die Website, die Wonne zuletzt besucht hatte, erschien.
Es war die Seite eines Studios für Brautkleider. Ein Laden namens Noni in Köln-Mülheim. Sehr modern und recht schick. Aber ich konnte mich an den Bildern gar nicht erfreuen. Ich fragte mich, wieso sich Wonne dafür interessierte.
Und wo war sie überhaupt?
Genau in diesem Moment knirschte der Schlüssel in der Wohnungstür. Ich war wie elektrisiert. Wenn sie mich hier so sitzen sah, würde sie denken, dass ich ihr nachspionierte. Andererseits hatte ich keine Ahnung, wie ich den Computer so schnell wieder in den Tiefschlaf versetzte. Da gab es sicher eine Tastenkombination, aber ich kannte sie nicht.
Ich sprang auf und trat die Flucht nach vorne an. Jetzt war mir auch klar, weshalb Wonne verschwunden war. Sie hatte sicher Brötchen geholt.
Tatsächlich. Sie hatte eine Kamps-Tüte in der Hand.
»Hast du Kaffee gemacht?«, fragte sie.
Ich schüttelte den Kopf und folgte ihr in die Küche. Sie holte ein Croissant aus der Tüte. Und das war alles, was darin war.
»Und ich?«, fragte ich und versuchte eine morgendliche Umarmung. Sie entwand sich mir.
»Ich dachte, du wärst schon weg.«
»Schon weg? Als du zum Bäcker gegangen bist, stand ich noch unter der Dusche.«
»Wir haben alle unsere Arbeit.« Sie drängte sich an mir vorbei zu ihrem Arbeitsplatz.
»Du hast mir noch nicht mal richtig Guten Morgen gesagt.«
Sie drückte auf die Tastatur, schloss innerhalb eines Sekundenbruchteils das Fenster mit der Brautmoden-Website, sodass der blaue Desktop sichtbar wurde.
»Klar habe ich.«
»Wonne, ich …«
Jetzt tönte elektronische Musik durch den Raum. Es war wieder mein Handy.
Bestimmt die Ehefrau des heimlichen Tanzschulenbesuchers. Wahrscheinlich hatte sie ein neues Indiz entdeckt.
»Wir haben alle unsere Arbeit«, wiederholte Wonne und sah mich mit einem Gesichtsausdruck an, in dem ich deutlich Resignation erkannte.
Das Display zeigte keine Telefonnummer. Ich meldete mich.
»Rott?«
»Remi, hier ist Anja.«
Anja …
»Äh, ich weiß nicht …«
»Remi, du kennst mich doch. Anja!«
Die Anja? Meine uralte Freundin? Beziehungsweise nicht direkt eine Freundin – eher eine Frau, die mir in den vielen Jahren meines Daseins als Detektiv immer wieder über den Weg gelaufen war.
Anja: erst Prostituierte und dann Ehefrau eines bürgerlichen Typen, der Lehrer war und als Hobby mit Modelleisenbahnen spielte.
Wann hatte ich zuletzt mit ihr gesprochen?
Das musste Jahre her sein.
Was wollte sie? Einen Plausch halten?
Ich sah Wonne nachdenklich in ihr Croissant beißen.
»Anja, kann ich dich gleich zurückrufen? Es passt gerade schlecht.«
»Du bist nicht im Büro, oder?«
»Woher weißt du das?«
»Weil ich es dort gerade probiert habe. Und jetzt über dein Handy mit dir spreche.«
»Ach so, ist ja klar.«
»Ich habe einen Auftrag für dich. Es wäre toll, wenn du Zeit hättest.«
»Ich rufe dich an. Ich hab ja deine Nummer.«
»Hast du nicht. Sie ist unterdrückt. Und das aus gutem Grund. Schreib auf.«
Ich nahm einen Zettel und notierte die Adresse und Telefonnummer, die sie mir nannte.
»Das ist die Bambi-Bar in Leichlingen«, erklärte sie.
»Die Bambi-Bar in Leichlingen«, wiederholte ich, und Wonne runzelte die Stirn. »Es ist beruflich«, flüsterte ich.
»Klar ist es beruflich«, sagte Anja.
Ich lachte gekünstelt. »Ja, also, meine Freundin ist da, das heißt, ich bin gerade bei meiner Freundin …« Ich spürte, wie mir warm wurde.
Endlich hatte ich alles aufgeschrieben, verabschiedete mich und drückte den roten Knopf.
Wonne hob die Schultern. »Du siehst, Remi, es ist, wie ich gesagt habe. Wir haben alle unsere Arbeit. Du gehst deiner nach und ich meiner.«
»Du hast ja recht, Wonne. Aber wir sollten mal Urlaub machen. Mal was anderes erleben. Mal raus aus dem Trott.«
»Vielleicht erleben wir ja schon genug«, sagte sie rätselhaft und wandte sich wieder ihrem Laptop zu.
Ich zog meine Jacke an und verließ die Wohnung. Unten im Wagen rief ich Anja zurück.
»Komm in die Bambi-Bar«, sagte sie nur. »Dort können wir alles besprechen.«
2
Der Morgenverkehr war so heftig, dass ich darauf verzichtete, mich auf der Bergisch Gladbacher Straße in Richtung A3 durchzuquälen. Ich wählte statt der Pest die Cholera und arbeitete mich durch bis zur Bergisch Gladbacher Stadtmitte, wo ich auf die Odenthaler Straße abbog. An der Ecke stand die alte Kneipe »Im Waatsack«, deren Tage gezählt waren, denn man wollte die Kreuzung verbreitern, um es dem Verkehr leichter zu machen. Die Stadtväter hatten vor, das Gebäude aus dem 18.Jahrhundert zu versetzen. Wonne hatte mir allerdings erzählt, dass genau so etwas in der Region schon mehrmals schiefgegangen war. Die Einzelteile der alten Gebäude vergammelten in irgendwelchen Lagern, und am Ende kümmerte sich keiner mehr darum.
In langer Kolonne mit vielen Mitstreitern, die die Strecke hinauf nach Burscheid bevölkerten, erreichte ich nach gefühlten Stunden die A1. Die Musik von Radio Berg versüßte mir die Fahrt. Über die Landstraße schlug ich mich in Richtung Witzhelden durch. Hinter dem Horizont tauchte der Funkturm auf und starrte auf mich herab wie ein riesiges außerirdisches Wesen.
Hinter St.Heribert lag mir die Kölner Bucht zu Füßen. Ich erkannte im Dunst Häuserblocks und nadelfeine Schornsteine, deren Rauchfahnen den winterlichen Himmel mit neuem Grau zu versorgen schienen. Eine Kette von Hochspannungsmasten verlor sich in der Ferne.
Am Beginn einer schnurgeraden, unordentlich gepflasterten Straße war in Leichlingen in riesigen Lettern die mir von Anja genannte Hausnummer zu lesen. Über eine enge Zufahrt erreichte ich einen kleinen, versteckten Parkplatz.
Ein braun angelaufenes ehemaliges Wohnhaus ragte dahinter auf. Eine geschwungene Neonschrift, die im trüben Licht des bewölkten Morgenhimmels rosa leuchtete, formte die Buchstaben »Bambi-Bar«.
Wie bei vielen solcher Etablissements gab es vom Parkplatz aus einen kleinen Durchschlupf – in diesem Fall in einer Hecke. So konnte man fast unbemerkt das Gelände betreten und wurde nicht gesehen, wenn man vor der Tür stand und wartete. Diskretion war Ehrensache und Geschäftsgrundlage.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!