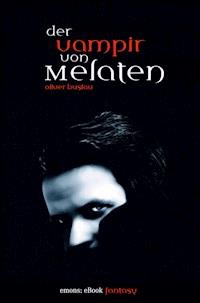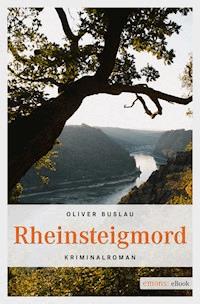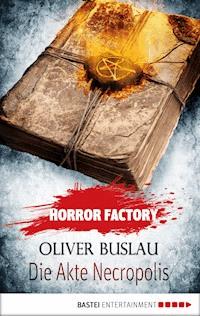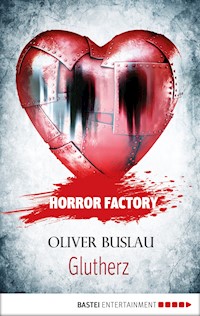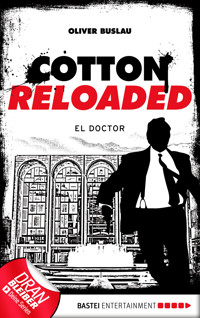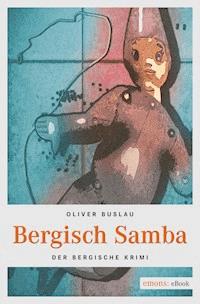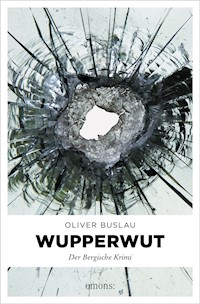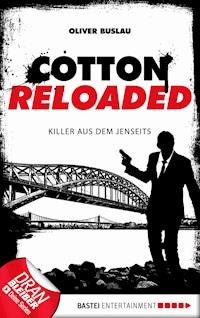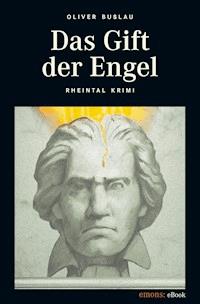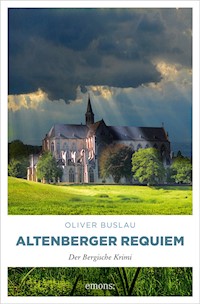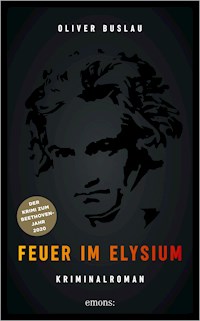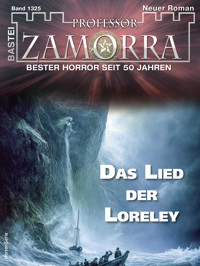Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Remigius Rott
- Sprache: Deutsch
Zwischen Naturschutz, Fluglärm und alten Munitionsdepots: Remigius Rott ermittelt in der Wahner Heide. Ein Routinefall führt Privatdetektiv Remigius Rott in die Wahner Heide. Doch bald folgt ein Rätsel dem nächsten: Eine Frau wird von einem Auto angefahren und verschwindet, der Fahrer nimmt sich kurz darauf das Leben, und geheimnisvolle prophetische Botschaften werden in der Heidelandschaft verteilt. Rott sucht nach Verbindungen – und gerät dabei selbst ins Fadenkreuz der Polizei . . .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oliver Buslau begann Ende der 1990er Jahre seine Autorenkarriere als Erfinder des Wuppertaler Privatdetektivs Remigius Rott, der seither in zehn Krimis seine Fälle gelöst hat. Darüber hinaus schrieb er unter anderem Krimis rund um das Thema Musik sowie das Sachbuch »111 Werke der klassischen Musik, die man kennen muss«.
www.oliverbuslau.de
Dieses Buch ist ein Roman. Die Figuren und manche Schauplätze sind erfunden. Ähnlichkeiten der handelnden Personen mit realen Menschen wären Zufall.
© 2017 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Radius Images
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, Tobias Doetsch
Lektorat: Marit Obsen
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-277-9
Der Bergische Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die Menschen werden den Vögeln nachahmen und in die Lüfte fliegen wollen.
Weissagung des »rheinischen Nostradamus« Bernhard Rembold (1689–1783) aus Siegburg, genannt »Spielbähn«
1
Ein lächelndes Gesicht sah mich an.
Eingerahmt in blondes Haar.
Daneben eine zweite Person. Ich selbst blickte mir entgegen. Ebenfalls lächelnd, aber ein bisschen gezwungen und verkrampft.
Wie man eben so schaut, wenn man auf den Selbstauslöser wartet.
Das Foto steckte in einem breiten, chromglänzenden Bilderrahmen und stand vor mir auf dem Schreibtisch. In der spiegelnden Fläche konnte ich die Fenster meines Büros erkennen. Mit ein bisschen Phantasie zeichneten sich darin auch die fernen Hügel auf der anderen Seite von Wuppertal ab. Und die dunklen kantigen Kästen der Bergischen Universität, die südlich von Elberfeld wie eine Ritterburg auf den Höhen thronte.
Ich konzentrierte mich auf das Foto, während ich – den Telefonhörer ans Ohr gepresst – die Kurzwahl einer Bergisch Gladbacher Nummer eintippte.
In das gleichmäßige Tuten mischte sich ein mechanisches Geräusch.
Tack, tack, tack.
Tuuut … tuuut.
Tack, tack, tack.
Tuut … tuut.
Draußen vor dem Fenster tropfte Wasser aus einer Dachrinne und traf ein tiefer liegendes Dach. Wahrscheinlich die Oberseite des »City Store«. Das war der Kiosk, der sich unterhalb meiner Wohnung befand.
Gelegentlich hatte ich mir da unten eine Packung Zigaretten besorgt. Seit einem halben Jahr rauchte ich aber nicht mehr. Die Glimmstängel waren auch viel zu teuer für meine Verhältnisse.
Zwei Jahrzehnte arbeitete ich nun schon als Privatdetektiv. Am Anfang meiner Karriere hatte ich tatsächlich geglaubt, damit finanziell irgendwann mal auf einen grünen Zweig zu kommen. Jetzt schien ich weiter davon entfernt zu sein als je zuvor. Und das in einem Alter, in dem sich andere ihrer Midlife-Crisis hingaben.
Ich hatte für so was keine Zeit.
Tack, tack, tack.
Tuuut … tuuut.
Tack, tack, tack.
Tuut … tuut.
Es war Freitagnachmittag. Mein letzter Auftrag lag bereits vier Wochen zurück.
Wie so oft hatte ich mich eingeigelt und auf bessere Zeiten gehofft. Doch die kamen nicht. Ich konnte hier in meiner Wohnung, wo Luisenstraße und Kasinostraße zusammentrafen, versauern, und es interessierte keinen.
Auch Wonne nicht, die ich gerade zu erreichen versuchte.
Tack, tack, tack.
Tuuut … tuuut.
Tack, tack, tack.
Tuut … tuut.
»Remi. Ich hab dir doch gesagt, du sollst das lassen.«
Ihr Tonfall war weder verärgert noch genervt. Eher resigniert.
Ich klammerte mich an den Klang ihrer Stimme wie an einen Strohhalm. Dazu fixierte ich das Foto in dem silbernen Rahmen, das ich vor einigen Jahren an der Wuppertalsperre von uns gemacht hatte. Als könnten Bild und Stimme in irgendeiner Weise Wonnes Gegenwart ersetzen.
»Wir haben doch darüber gesprochen«, fügte sie hinzu.
Ja, das hatten wir. Wir hatten darüber gesprochen, eine Weile keinen Kontakt mehr zu haben. Aber wie sollte man das aushalten?
»Wonne, ich …«
Keine Ahnung, was ich sagen sollte.
Sag irgendwas, was sie zum Antworten zwingt, befahl ich mir innerlich. Was dich ihre Stimme hören lässt.
»Du klingst müde«, sagte ich.
»Ja …« Es klang, als sei mit der Erwähnung ihrer Müdigkeit tatsächlich die letzte Kraft aus ihr gewichen. »Ja, das bin ich auch.«
»Ich will dir helfen.« Ich räusperte mich. »Lass mich dir helfen.«
Ich wusste schon, was ihre Entgegnung sein würde. Wir hatten das alles zigmal durch.
»Remi. Du hilfst mir, indem du mich eine Weile in Ruhe lässt.«
»Was ist eine Weile?«
»Bitte … Fang nicht wieder damit an.«
»Ich brauche aber etwas, woran ich mich orientieren kann.«
Sie holte langsam Luft. »Du weißt, dass ich dir keine Orientierung geben kann. Es dauert die Zeit, die es dauert.«
Wieder eine Pause. Wieder dieses langsame Atmen. Ein Schnaufen. Ein leichtes Zittern war auch darin.
Weinte sie etwa? Ich wollte sie fragen, aber ich ließ es. Solange sie nicht auflegte, bestand noch eine Chance, dass wir weitersprechen konnten. Ich würde am Telefon bleiben, solange es ging. Und wenn es das ganze Wochenende war.
»Ach, Remi …« Ihre dünne Stimme war zerbrechlich und fern.
»Ja, Wonne?«
Ich musste mich zügeln. So viele Fragen gingen mir im Kopf herum. Seit Monaten schon. Seit dem großen Fall, in den auch Wonne verwickelt gewesen war. Jemand hatte versucht, sie zu erschießen. Sie hatte tagelang im Koma gelegen, während ich voller Wut und geradezu rasend das Bergische Land durchpflügte, um den Täter zu finden.
»Es strengt mich zu sehr an«, sagte sie jetzt etwas bestimmter, als habe sie dazu ihre ganze Kraft zusammengenommen.
Sie leitet den Abschied ein, dachte ich. Gleich legt sie auf. Dann kriege ich sie wieder wochenlang nicht an die Strippe. Ich hätte das Telefonat aufnehmen sollen, damit mir ihre Stimme erhalten bleibt. Aber dafür war es nun zu spät.
Mein Herz klopfte stärker. Nutz die Chance, die dir bleibt, hämmerte es in mir. Sag irgendwas. Los.
»Was ist nicht in Ordnung mit uns?«, fragte ich – getrieben von der völlig irrsinnigen Vorstellung, sie würde darauf eingehen und mir wirklich endlich die Antworten geben, nach denen ich suchte. Von denen ich allerdings wusste, dass sie sie selbst nicht kannte. Sie litt ja genauso unter der Situation wie ich.
»Ach, Remi.«
Bitte leg nicht auf.
Stille.
Stille, in die wieder das Tack-Tack vom Blechdach eindrang wie bei der berühmten chinesischen Folter, bei der sie einem Wassertropfen auf den Kopf fallen lassen, was dann eine unglaubliche Qual auslösen soll.
Tack, tack, tack.
Ich hatte das Geräusch während der letzten Minuten nicht bemerkt. Jetzt war es wieder da.
»Ach, Remi, du weißt es doch …«
Nichts wusste ich. Gar nichts. Ich wollte bei Wonne sein. Wollte, dass alles wieder so wurde wie früher, wie damals, als es mit uns angefangen hatte. Gemeinsam waren wir in einen Kriminalfall am Altenberger Dom geschlittert. Wonne hatte es rasend scharf gefunden, mit einem echten Detektiv unterwegs zu sein. Hatte es genossen, mit mir auf Ermittlungstour zu gehen.
Und genau in dem Moment, in dem das Knacken in der Leitung zeigte, dass sie aufgelegt hatte, dass es mal wieder vorbei war mit ihrer Stimme, mit dem ersehnten Kontakt, genau in diesem Moment wurde mir klar, dass sie mich nicht mehr liebte.
Oder dass sie glaubte, sie liebte mich nicht mehr.
Und mir wurde auch klar, warum.
Weil ich eben kein echter Detektiv mehr war. Weil ich nur hier herumsaß und auf Fälle wartete. Weil ich ihrer Vorstellung von einem Mann, der sie heißmachte, indem er abenteuerliche Kriminalfälle löste, nicht mehr entsprach.
Ich war ein arbeitsloser Selbstständiger, weiter nichts. Keiner, der eine Frau wie Wonne noch begeistern konnte.
Ich legte das Telefon hin und stierte in die Gegend. Das Foto mit uns beiden an der Wuppertalsperre mied ich jetzt. Es würde nie wieder so sein.
Stattdessen richtete ich den Blick auf die Bücherregale an der Wand. Dort hatte ich ein bisschen juristische und kriminologische Fachliteratur versammelt. Nicht um sie zu lesen, sondern um meine Kundschaft zu beeindrucken. Auf einem anderen Brett reihten sich sämtliche Romane um den legendären Detektiv Philip Marlowe. Eine Chandler-Gesamtausgabe. Von »Der große Schlaf« bis »Die Tote im See«. Von »Playback« bis »Der lange Abschied«.
Ein Geschenk von Wonne. Zum Geburtstag.
»Der lange Abschied«.
Schon der Titel tat weh.
Ich wandte den Blick zur Tür. Neben dem Durchgang zum Flur gab es einen Garderobenhaken an der Wand. Daran hing ein heller Trenchcoat. So einer, wie ihn Philip Marlowe, verkörpert von Humphrey Bogart, trug.
Auch ein Geschenk von Wonne. Zu einem anderen Geburtstag.
Hast du es noch immer nicht kapiert, Remi? Sie will nicht dich. Jedenfalls nicht so, wie du jetzt dahinvegetierst. Sie will einen bergischen Marlowe. Keinen Loser.
Mir egal, schaltete sich eine andere Stimme in meinen Inneren ein. Ich will diese Frau. Wenn es noch eine Chance gibt, dass ich sie kriegen kann, tue ich alles dafür. Ich nehme die seltsamsten Fälle an. Von mir aus bin ich auch Philip Marlowe. Um wie er zu sein, muss ich die Romane allerdings erst mal lesen.
Ein Stich durchfuhr mich, als mir klar wurde, dass ich genau das nicht getan hatte.
Ich hole alles nach, redete ich mir ein. Ich lerne alle Marlowe-Krimis auswendig. Wir schauen uns alle Verfilmungen an. Ich kaufe alle DVDs. Ich werde alle Dialogzeilen mitsprechen können.
Ich stand auf, ging zum Regal, nahm wahllos eines der Bücher heraus und blätterte. Ich schlug irgendeine Seite auf, las ein bisschen, blätterte weiter und kam ganz ans Ende. Auf der letzten Seite standen nur wenige Zeilen, die den Schluss der Geschichte bildeten: Es war ein kühler Tag und sehr klar. Man konnte weit in die Ferne sehen – aber nicht so weit, wie Velma gegangen war.
Ich sah mir das Cover an. Das Buch hieß »Lebwohl, mein Liebling«.
Abschiede, wohin ich sah.
Verdammter Mist.
In diesem Moment klingelte das Telefon.
Ich stopfte den Roman ins Regal zurück und stürzte zum Schreibtisch, nahm ab und meldete mich.
Es war nicht Wonne. Laute Fahrgeräusche lagen wie eine dicke Schicht Dämmmaterial über der Stimme, die zu mir sprach. Ich verstand nichts.
»Detektei Rott«, rief ich.
»… Adresse?«
Ich gab sie durch.
»… in zehn Minuten da.«
Dann herrschte Stille in der Leitung.
Ich war allein in meinem Büro.
Tack, tack, tack.
Der Mann, der sich nach einer Viertelstunde schnaufend die Treppe heraufkämpfte und sich dann durch meine Wohnungstür schob, kam mir vor wie ein Gespenst. Nicht in dem Sinne, dass er wie ein weißes Handtuch durch die Welt geschwebt wäre und mit Ketten gerasselt hätte. Eher in der Art, dass ich ihn aus dem Fernsehen kannte.
Der gleiche verschlagene Blick aus winzigen Schweinsäugelchen. Die gleiche ungesunde rötliche Gesichtsfarbe und – ja, wirklich – die gleichen gelbblonden Haare, die direkt aus einem Beispielvideo für katastrophale Haarfärbeunfälle zu kommen schienen. Nur die seltsame Tolle über der Stirn war nicht so ausgeprägt wie bei dem Amateurpolitiker von der anderen Seite des Atlantiks. Auch die Kleidung war anders: Das Exemplar hier in meinem Büro trug keinen blauen Anzug, kein Hemd, keinen Schlips in Rot oder anderen comichaften Primärfarben. Beziehungsweise wenn er das tat, konnte ich es nicht erkennen, denn sein unförmiger Leib war mit einem dunkelgrünen Lodenmantel bedeckt, dem ein penetranter Schweißgeruch entstieg.
Er ließ sich auf meinen Besuchersessel fallen, wobei ihm ein Stapel von Prospekten entglitt, die er unter dem Arm getragen hatte. Sie rutschten auf den Boden. Sofort machte er sich daran, sie wieder einzusammeln. Es waren Kataloge für Outdoor-Ausrüstungen. Kleidung in Tarnfarben, Zelte, Ferngläser.
»Gut, dass ich es noch einrichten konnte«, begann ich jovial, um enorme Beschäftigung vorzutäuschen. »Was kann ich denn für Sie tun, Herr …?«
»Trampmann«, kam es von unten. Er war immer noch mit Aufsammeln beschäftigt. Dann tauchte sein Gesicht auf. »Jochen Trampmann.«
Ich schluckte und musste an mich halten, ihn nicht zu fragen, ob ihm schon mal jemand gesagt habe, dass er wie der Trump-Man-Trampmann von drüben aussah. Und dann auch noch diese entfernte Namensgleichheit mit jenem Menschen besaß, der sich zu diesem Zeitpunkt im Herbst 2016 gerade im Wahlkampf befand – mit den bekannten Folgen. Stattdessen fragte ich: »Worum geht es denn?«
»Um meine Frau«, erklärte er. »Ich muss übers Wochenende weg«, fügte er hinzu. »Da wird sie wieder hinfahren.«
»Wo hinfahren?«
Er schüttelte ungläubig den Kopf, als sei das sonnenklar.
Ich raffte meine Erfahrung zusammen und beschloss zu ahnen, was er sagen wollte. »Sie meinen, sie hat einen …?«
»Ganz genau. Und Sie sind doch dafür da, so was aufzuklären. Ich will wissen, wer das ist.«
»Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte?«
»Tausend Kleinigkeiten. Sie sagt, sie geht zum Sport. Aber da ist sie nicht. Sie sagt, sie besucht eine Freundin. Aber das kann nicht stimmen, wie ich später rausgefunden habe. Kam schon mehrmals vor.«
»Wie genau haben Sie das rausgekriegt?«
»Testanrufe. Im Fitnessstudio.« Er grinste verschlagen. »Hab so getan, als wollte ich meine Frau sprechen, aber sie war nicht da.«
Ich zog einen Block und einen Kuli heran.
»Also gut. Ich verstehe. Wo wohnen Sie denn?«
Er nannte eine Adresse in Leichlingen.
»Wo treibt Ihre Frau Sport?«
»Kieser Training in Leverkusen.«
Ich fragte nach allem, was ich brauchte. Ein Bild von der Dame, die Beschreibung ihres Wagens, ihr Kennzeichen und natürlich die Personalien.
Frau Trampmann hieß mit Vornamen Rita und war dreiundvierzig Jahre alt. Mein neuer Kunde hatte ein Foto dabei. Ihre Attraktivität gewann durch kurzes rotes Haar, das ihr Gesicht umschloss und von dem etwas schmalen Mund ablenkte, den man als einzigen Makel in puncto Aussehen hätte betrachten können, denn er verlieh ihr etwas leicht Zickiges.
»Haben Sie irgendeine Ahnung, mit wem sie sich trifft?«
Er schüttelte sein blond geschmücktes Haupt und blickte auf den Prospektstapel, den er jetzt auf dem Schoß hielt.
»Handeln Sie mit diesen Sachen?«
»Bin Handelsvertreter«, entgegnete er. »Viel unterwegs. Jetzt gerade auf dem Weg Richtung Hamburg.«
Die Erwähnung von etwas Beruflichem brachte ihn auf ein anderes Thema: »Was wird das denn kosten?«
Ich nannte ihm meinen Tagessatz. Dreihundert Euro. »Zwei Tagessätze sind als Vorschuss fällig«, fügte ich hinzu und freute mich darüber, dass ich die Miete nächste Woche nun wahrscheinlich doch noch würde überweisen können. Sechshundert fehlten mir dafür nämlich noch.
Der falsche Trump machte dem Ruf seines Doppelgängers als ebenso reicher wie verhandlungsstarker Geschäftsmann jedoch alle Ehre. Er warf die Stirn wichtigtuerisch in Falten und teilte mir mit: »Zwei Tage zahlen für einen Tag Arbeit? Nein. Sie fahren morgen zu uns. Sie behalten Rita im Auge und besorgen mir Fotos, die zeigen, was sie so treibt. Fertig. Dann gibt’s dreihundert, und gut ist.«
»Es kann aber sein, dass ich mehrmals ausrücken muss«, gab ich zu bedenken.
Trampmann stand kopfschüttelnd auf. »Müssen Sie nicht. Und kommen Sie mir jetzt nicht mit Wochenendzuschlag, weil morgen Samstag ist.«
»Ich wollte das tatsächlich gerade erwähnen«, sagte ich, weil mir der Typ irgendwie auf die Nerven ging.
Wenn ich nicht ernsthaft in finanziellen Schwierigkeiten gewesen wäre, hätte ich den Auftrag wahrscheinlich gar nicht angenommen. Überwachungen von Ehepartnern zogen meist Riesenärger nach sich. Gelang es einem nicht, einen Beweis dafür zu liefern, dass der oder die Liebste ein Auswärtsspiel betrieb, entlastete das nicht den beklagten Ehepartner, sondern man hatte in den Augen des Auftraggebers schlecht gearbeitet. Fand man allerdings den Beweis, neigten manche dazu, den Überbringer mit der Botschaft zu verwechseln – und zeigten plötzlich wenig Bereitschaft, die geleisteten Dienste zu bezahlen und sich mit dem Desaster auseinanderzusetzen, das sie selbst ans Tageslicht bringen ließen.
Und dann die Zielperson: Sie wusste, dass sie etwas Verbotenes tat. Sie war also unter Umständen darauf vorbereitet, überwacht zu werden. Zumal dann, wenn der oder die Gehörnte schon einmal einen Privatermittler eingeschaltet hatte und die Sache schiefgegangen war.
Es gab sogar Fälle, in denen sich die Fremdgänger selbst Hilfe zulegten – Bodyguards oder ganz einfach irgendwelche Schläger, gelegentlich auch aus der eigenen Familie. Dann hatte man den Ärger mit denen.
»Quatsch«, fuhr mir Trampmann schnodderig über den Mund. »Erstens ist der Samstag nach dem Gesetz auch ein Werktag. Zweitens brauchen Sie schon mal nicht früh aufzustehen. Es reicht, wenn Sie ab Nachmittag parat stehen.«
»Wieso das denn?«, fragte ich. »Kriegen Sie von Ihrer Gattin einen Plan mit den Terminen, wann sie ihren Lover trifft?«
»Ich kenn doch meine Frau. Die pennt bis elf. Dann braucht sie anderthalb Stunden im Bad. Frühstück dauert eine Stunde mindestens. Samstags kommt meistens auch noch eine Freundin dazu. So eine Schwarzhaarige, die sehen Sie dann schon. Dann wird geplaudert und ferngesehen. Vor zwei Uhr geht die nicht weg. Halber Tag Arbeit also. Sie kriegen aber das Honorar für einen ganzen Tag. Kein Grund zum Meckern.«
Fast hätte ich ja noch angemerkt, dass es bei mir angebrochene Tage in den Abrechnungen gar nicht gab, aber ich ließ es.
Er arbeitete sich schnaufend in Richtung Tür vor. Kurz bevor er sie erreichte, drehte er sich um und warf mir etwas auf den Tisch. Es war eine Visitenkarte.
»Da steht meine Handynummer drauf. Sie rufen an, wenn Sie alles haben. Am Sonntag weiß ich, wann ich wieder zurück bin. Geld gegen Fotos. Saubere Sache.«
2
Ich hielt mich an Trampmanns zeitliche Vorgaben. Auch wenn es mir ziemlich bescheuert vorkam. Aber wenn die rote Rita ihren Typen doch schon am Samstagvormittag traf und ich das verpasste, war es seine eigene Schuld. Dann musste ich halt am Sonntag noch mal ran. Und vielleicht auch noch mal das Wochenende drauf.
Als ich zu meinem roten Golf ging, der in der Luisenstraße in einer gemieteten Garage auf mich wartete, sahen mich die Passanten seltsam an. Ich wusste, warum. Sie erkannten sicher die flackernden Eurozeichen in meinen Augen.
Eine knappe Dreiviertelstunde später stand ich mit dem Wagen an der Ecke Am Heidchen/Opladener Straße in Leichlingen.
In der Nacht hatte ich ein wenig in Chandlers Marlowe-Krimi »Die Tote im See« gelesen. In dieser Geschichte sucht der amerikanische Detektiv eine verschwundene Ehefrau und muss dafür ebenfalls ein Haus in einem ruhigen Wohngebiet überwachen. Das Hauptproblem dabei ist, nicht aufzufallen. In Trampmanns Fall hatte ich Glück. Die Straßenecke war ein großer leerer Gästeparkplatz eines aufgegebenen kroatischen Restaurants. Dunkle Fenster, ein brauner Rollladen versperrte den Eingang. Über der Tür verkündete ein nicht mehr ganz intakter Schriftzug den Namen des früher hier befindlichen Etablissements: »Bella Croatia«. Irgendwie kam mir das ja eher italienisch vor. Vielleicht war es dieser sprachliche Widerspruch, der dem Laden das Genick gebrochen hatte. Auch am anderen Ende der Asphaltfläche, an der breiten und viel befahrenen Opladener Straße, stand der Name – und zwar auf einem Schild an einem etwa drei Meter hohen weißen Metallmast, illustriert durch das überdimensionale Foto einer Portion Cevapcici mit Fritten und einer etwas versteckten Salatbeilage. Darunter war der Hinweis angebracht, dass widerrechtlich parkende Fahrzeuge abgeschleppt würden.
Ich parkte ja nicht. Ich wartete nur.
Die Straße Am Heidchen war schmal. Sie verlief schnurgerade zwischen Wohnhäusern. Im Rückspiegel hatte ich drei Garagen von zwei benachbarten Wohnhäusern gut im Blick. In einer von ihnen wartete Rita Trampmanns Fiat Panda darauf, mit seiner Besitzerin auf erotische Entdeckungsreise zu gehen.
Ich musste die Garagen ständig im Auge behalten. Trotzdem bekam ich mit, wie vor mir auf der Opladener ein Bus der Linie 250 vorbeikam, der Leichlingen mit Solingen verbindet.
Von Zeit zu Zeit warf ich einen Blick auf den Straßenatlas, der neben mir auf dem Beifahrersitz lag. Dabei fiel mir auf, dass der Leichlinger Ortsteil, in dem ich mich befand, den seltsamen Namen »Trompete« aufwies.
Trampmann aus Trompete.
Donald Trump plays the trumpet.
Gern hätte ich Musik gehört. Aber das Radio einzuschalten bedeutete, abgelenkt zu werden. Außerdem belastete das die Batterie. Sollte ich Trampmann später erklären, mein Auto sei nicht angesprungen?
Wieder kam ein 250er Bus. Er musste an der Ampel halten. Neugierig musterten mich die Insassen hinter der Scheibe. Hatten die sonst nichts zu gucken? Oder versprühte ich immer noch Eurozeichen?
Es wurde halb drei. Die von Trampmann erwähnte schwarzhaarige Freundin hatte sich noch nicht blicken lassen. Als Rita Trampmann dann gegen halb vier endlich das Haus verließ, war sie immer noch nicht da gewesen. Egal, ich konzentrierte mich auf die Ehefrau. Das war ja der Auftrag.
Sie trug einen beigefarbenen Mantel und stöckelte zu den Garagen. Mit einer kleinen Kraftanstrengung öffnete sie die mittlere und ging hinein. Eine Auspuffwolke drang nach draußen, dann setzte der Wagen zurück. Sie stieg aus und schloss das Tor wieder. Der Panda besaß eine blassgelbe Farbe, als hätte jemand Zitronensaft mit Milch gemischt. Im grauen Frühnovember wirkte der Wagen wie ein heller Lichtfleck.
Ich hatte mich in der Zwischenzeit in Position gebracht. Als Rita Trampmann die Abbiegerampel an der Opladener erreichte, stellte ich mich hinter sie, setzte wie sie den Blinker links und wartete auf Grün.
Zuerst ging es in Richtung A 3. Rita Trampmann fuhr jedoch nicht auf die Autobahn. An der Kreuzung, an der eine weithin sichtbare Pferdekopfsilhouette den Krämer-Pferdesport-Megastore bewirbt, hielt sie auf die direkt daneben verlaufende Parallelstraße zu. Dann ging es weiter in Richtung Süden.
Hier war siebzig erlaubt. Als die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben wurde, trieb die rothaarige Rita ihr Gefährt an eine dreistellige Geschwindigkeit heran, wurde jedoch von der nächsten roten Ampel gebremst. Immer wieder gab es Gelegenheiten, die Autobahn in Richtung Westen zu überqueren, immer wieder schlug Rita Trampmann diese Gelegenheiten aus. Und immer wieder bremsten uns die Ampeln aus. Grüne Welle war hier nicht. Vor allem, wenn man brav die zugelassene Höchstgeschwindigkeit einhielt. Dafür wurde man nicht belohnt.
Wir überquerten die Wupper, umrundeten den Kern von Opladen, ich grüßte die Ausschilderung des Remigius-Krankenhauses, das aber wahrscheinlich nicht nach mir benannt war. Dann ging es in Gebiete abseits der Autobahn. Schließlich bog Rita Trampmann von einem Kreisverkehr in ein kleines Industriegebiet ein.
Rechts erschien ein stahlgrauer Kasten mit dem kantigen Schriftzug des genannten Instituts für Krafttraining. An der Ecke des Gebäudes hing ein riesiges Foto: Eine äußerst fitte, gestählte Frau saß an einem Wildbach, sicher in einem anderen Land als dem Bergischen, und grinste in die Landschaft. Daneben bekam man einen männlichen muskulösen Rücken geboten. Die Wirbelsäule war blau hervorgehoben und leuchtete wie bei einem Cyborg.
Der blassgelbe Panda verschwand um die Ecke in Richtung Besucherparkplatz. Ich blieb an der Straße stehen und fand eine Lücke zum Parken.
Die Straßenseite, an der das Trainingszentrum lag, war offenbar voll und ganz der körperlichen Ertüchtigung gewidmet. Gleich nebenan beobachteten mich aus einem Fenster zwei Figuren in Sportkleidung. Es dauerte einen Moment, bis ich kapierte, dass es Schaufensterpuppen waren. Sie präsentierten, was der dortige Laden namens »Sports of Ultra« anzubieten hatte.
Nach zehn Minuten klingelte mein Handy. Es war die Nummer, die auf Trampmanns Visitenkarte gestanden hatte, dieselbe wie gestern. Ich meldete mich. Trampmann saß diesmal wohl in einem ruhigen Raum. Keine Geräusche im Hintergrund.
»Und?«, fragte er.
»Ihre Frau hat das Haus verlassen. Wie Sie gesagt haben, recht spät. Allerdings ist die Freundin nicht gekommen.«
»Wo ist Rita jetzt?«
»In Leverkusen.«
»Haben Sie die Adresse von dem Typen?«
»Es gibt noch keinen Typen.«
»Wieso nicht?«
Ich informierte ihn darüber, dass seine Frau gerade Sport trieb. Eine Art von Sport, die ich für nicht besonders ehegefährdend hielt.
»Hm«, machte Trampmann. Ich hörte die Unzufriedenheit in seiner Stimme und versuchte automatisch, meine Arbeit ein wenig aufzuwerten. Ein Rückschluss, ein Ergebnis, irgend so was musste her.
»Mir ist allerdings was aufgefallen«, sagte ich.
»Was denn? Meinen Sie, sie trifft sich mit dem Typen beim Sport?«
»Sie haben doch gesagt, Sie hätten sie überprüft. Und festgestellt, dass sie den Sport als Alibi benutzt.«
»Stimmt. Und?«
Ich begann zu phantasieren. »Als sie zum Auto ging, hatte sie keine größere Tasche dabei. Die hätte sie aber vielleicht, wenn sie vorhätte, bei jemandem zu übernachten. Oder sie hat schon vorher was im Wagen deponiert.«
Jetzt ärgerte ich mich, dass ich nicht beobachtet hatte, wie sie auf dem Besucherparkplatz des Instituts ausgestiegen war und den Kofferraum geöffnet hatte.
»Klingt schlüssig«, meinte er. »So wird es sein. Das ist verdächtig. Bleiben Sie dran, junger Mann.«
Damit legte er auf.
Ich stieg aus und ging an dem Gebäude vorbei. Hinter der Glasscheibe sah man Trainierende, die sich in die verschiedensten Geräte gezwängt hatten und mit den chromglänzenden und grauschwarzen Gestängen und Aufbauten ihre Körper stählten. Ein Philosoph hätte wahrscheinlich die Frage gestellt, wer hier wen beherrschte, der Mensch die Maschine oder die Maschine den Menschen? Eine interessante Überlegung, vor allem, wenn man bedachte, dass beim Training Glückshormone ausgeschüttet wurden, von denen man sogar abhängig werden konnte. Die Maschinen entwickelten ihre Macht also möglicherweise über Suchterzeugung! Ich wusste schon, warum ich mich von so was grundsätzlich fernhielt.
Der Besucherparkplatz befand sich auf der Rückseite. Auch hier gab es reichlich Gelegenheit, in den Saal der Trainierenden zu blicken. Ich tat harmlos, schlenderte an der Reihe der Autos entlang, bis ich Rita Trampmanns Panda erreicht hatte. Nichts lag drin. Kein Gepäck. Wenn sie welches dabeihatte, befand es sich im Kofferraum. Der war natürlich verschlossen.
Eine gute Stunde musste ich warten, bis sie wieder aus der Zufahrt zum Parkplatz gefahren kam. Erneut nahm ich die Verfolgung auf. Und schloss innerlich mit mir selbst eine Wette ab, ob sie nach Hause zurückfahren würde oder ob es woandershin ging.
Zuerst sah es so aus, als habe sie vor, die Rückkehr nach Trompete anzutreten. Doch dann ordnete sie sich in die Abbiegerspur zur Autobahn ein. Zur A 3 Richtung Frankfurt. Und eine Minute später ging es weiter in Richtung Süden.
Immer weiter weg von Trompete.
Die rote Rita hatte sich ordentlich fit gemacht.
Und jetzt war ich gespannt, wofür.
Mein Golf hatte ein paar PS mehr als der Fiat. So konnte ich mit Leichtigkeit an ihr dranbleiben.
Das Jahr war jetzt, im November, schon so weit vorangeschritten, dass einen die Dunkelheit lange vor dem eigentlichen Abend überraschte. Ich schaltete also die Scheinwerfer ein, dann übertönte ich das Fahrgeräusch mit dem Radio. Vor Kurzem hatte WDR 4 die Musikrichtung gewechselt. Vom Schlagerradio zum Oldie-Sender. Rock und Pop aus den Sechzigern, Siebzigern und Achtzigern. Genau die Zeit, in der ich den größten Teil meiner Jugend verlebt hatte.
Was Rita Trampmann im Wagen vor mir hörte, wusste ich nicht. Für mich versank die Welt hinter den Scheiben in herbstlicher Dunkelheit, während »Lady d’Arbanville« von Cat Stevens aus den Lautsprechern dröhnte, gefolgt von »Girls, Girls, Girls« von Sailor. Dann legte auf einmal Desireless mit »Voyage, voyage« los. Gerade als ich mich fragte, wie man ohne Sehnsucht ans Reisen denken konnte, setzte Rita Trampmann den Blinker. Wir hatten Rath/Heumar und Rösrath hinter uns gelassen und waren am rechten Saum der Wahner Heide entlanggefahren. Jetzt kam die Abfahrt Lohmar.
Mittlerweile war es völlig dunkel geworden. Die Wagen um uns herum waren nur noch schwarze Schemen und rote oder weiße Lichter. Ich musste höllisch aufpassen. Es konnte jetzt leicht passieren, dass mir die Zielperson durch die Lappen ging. Genauso wenig, wie ich Trampmann mit dem Argument kommen konnte, mein Auto habe mich im Stich gelassen, konnte ich der Dunkelheit die Schuld geben, wenn ich seine Frau verlor.
Ich blieb eng an dem Panda dran, als es durch die Kurven der Abfahrt ging. Danach wandte sich Rita Trampmann nach links in Richtung des Lohmarer Ortskerns.
Der Verkehr war dicht. Es hatte ein wenig geregnet. Der Asphalt glänzte, die Lichter spiegelten sich darin. Die vielen Rückscheinwerfer vor mir schienen eine Art leuchtende Blutspur zu legen.
Ich rekapitulierte, was ich über Lohmar wusste. Im Prinzip lag die Stadt lang gezogen an der Durchgangsstraße, auf die wir jetzt abgebogen waren. Weiter nördlich zweigten links und rechts verschiedene Nebenstraßen ab. In Richtung Osten ging es tief ins Bergische Land. Wenn das Ziel dort lag, durfte ich mich auf eine dunkle Überlandfahrt gefasst machen.
Aber es kam anders.
Sie setzte erneut den Blinker und bog bei nächster Gelegenheit nach links in eine Querstraße ab.
Es gab Gegenverkehr. Ich musste warten. Aber ich konnte sehen, dass sie gleich wieder rechts abbog und auf einer Straße weiterfuhr, die parallel zur Hauptstraße verlief. Dazwischen gab es einen Streifen mit Bäumen, die kein Laub mehr trugen. Rita Trampmann fuhr etwa hundert Meter weit. Dann stoppte sie. Die Lichter ihres Wagens verloschen.
Jetzt war für mich der Weg frei. Ich bog ab und gelangte ebenfalls an die Abzweigung. Rechts lag ein geschlossenes Wohngebiet. Links deuteten Erdhaufen auf eine Baustelle hin. Davor hatte ich auf matschigem Untergrund genug Platz, um den Wagen abzustellen.
Hinter dem Erdwall befanden sich ein paar mehrstöckige Häuser mit nackten Fenstern ohne Gardinen. In einigen Zimmern brannte Licht.
Ich schnappte mir meine Kamera, stieg aus und schloss den Wagen ab. Die Straße, in die Frau Trampmann eingebogen war, hieß Ziegelfeldweg.
Von der Hauptstraße her kamen mir zwei dunkelhäutige Männer mit dick gefüllten Plastiktüten in beiden Händen entgegen. Sie strebten den Häusern hinter dem Erdhügel zu. Jetzt wurde mir klar, dass es wohl Flüchtlingsunterkünfte waren – ein Stück abseits des alten Wohngebiets gelegen, dem ich mich nun zuwandte.
Ich folgte dem Ziegelfeldweg. Außer mir war niemand auf der Straße. Doch von Stille konnte keine Rede sein. Erstens nervte der Verkehr jenseits der kahlen Bäume. Zweitens verlieh die Nässe auf den Straßen dem Krach zusätzlich eine zischende, helle Note. Die Häuser, die sich hier aneinanderreihten, ergaben ein buntes Sammelsurium. Es gab gesichtslose weiße Kästen, geduckte Bungalows, zweistöckige breite Fronten mit Fachwerkimitat, altersschwache graue Hütten und weit hinter einer Rasenfläche zurückliegende Häuser, über die eine längere Zufahrt zu den Gebäuden führte.
Der kleine Panda stand still und dunkel rechts am Straßenrand.
Wo war Rita Trampmann hingegangen?
Während ich mich suchend umsah, kam ein unerwarteter Terror vom Himmel. Ein Grollen näherte sich von irgendwoher, wurde schlagartig lauter – und dann donnerte ein Flugzeug über die Siedlung hinweg. Ich blickte nach oben und konnte das weiß beleuchtete Wunderwerk der Technik in all seiner Schönheit betrachten, wie es quer zur Straße am Nachthimmel dem nahen Flughafen Köln/Bonn entgegenstrebte. Gleichzeitig nahm ich etwas in den Augenwinkeln wahr. Am Eingang eines schmalen hellen Hauses war ein Licht ausgegangen.
Wenn ein Licht über einer Tür ausging, hatte es jemand ausgeschaltet, der hineingegangen war. Oder es handelte sich um einen Bewegungsmelder und war automatisch an- und wieder ausgegangen. Hier war also eben noch jemand gewesen.
Ich ging die paar Schritte und merkte mir schon mal die Hausnummer. Jetzt konnte ich Trampmann wenigstens die Adresse seines Nebenbuhlers nennen. Fehlte noch der Name. Das mit den Fotos war hoffentlich auch noch hinzukriegen.
Die Fenster waren dunkel – sowohl im Erdgeschoss als auch im ersten Stock. Wahrscheinlich hatte man sich ins Wohnzimmer verzogen. Oder in die Koje. Beides lag wohl nach hinten raus.
Direkt an dem Gebäude klebte eine Garage, neben der die Grundstücksgrenze verlief. Auf der anderen Seite gab es an einem Maschendrahtzaun einen winzigen begehbaren Streifen neben dem Haus.
Der Name war mit Edding auf den Briefkasten gekritzelt und kaum leserlich. Ich entzifferte so was wie »Rosulowsky« und notierte mir das auf einem der vielen Zettel, die ich immer in der Tasche habe.
Was nun?
Ich musste auf die Rückseite.
Ich sah mich um, stellte fest, dass ich immer noch allein in der Straße war, und ging unbeobachtet zum Eingang, dann die Mauer entlang. Als ich um die Ecke bog, sah ich, dass Licht von einem Fenster auf der Rückseite nach draußen drang. Eine Rasenfläche lag in mattem Schein.
Vorsichtig setzte ich einen Fuß vor den anderen. Ich erreichte die hintere Hausecke. Mitten auf dem Rasen erhob sich ein Busch. Einer von der Sorte, die man normalerweise auf Friedhöfen erwartet. Aber hier gab er eine prima Deckung ab. Ich huschte hinüber und duckte mich dahinter. Erst jetzt prüfte ich, was man am und im Haus erkennen konnte.
Hinter der hell erleuchteten Scheibe breitete sich die ganze Behaglichkeit eines spießigen Wohnzimmers aus – mit Eichenschrankwand, Sitzgruppe und einem Fernseher, der fast vollständig die Wand bedeckte. Rita Trampmann hatte auf einem der Sofas Platz genommen und die Beine übereinandergeschlagen. In der Hand hielt sie ein halb gefülltes Weinglas. Die dazugehörige Flasche stand auf dem Tisch.
Sie prostete irgendwem zu, den ich nicht erkennen konnte, weil die Zweige im Weg waren. Sie sagte etwas. Für mich bewegte sie natürlich nur die Lippen.
Rechts im Zimmer gab es eine Bewegung. Ich bog mutig die Äste weg und brachte die Kamera in Position. Da stand ein schlanker dunkelhaariger Mann in Jeans und weißem Hemd. Nicht unattraktiv. Die beiden waren allerdings nicht allein. Auch er sprach mit jemandem, in die andere Richtung.
Komisch. Lud man sich noch jemanden ein, wenn man seine Geliebte empfing?
Jetzt wandte sich der Mann um, ging zur Couch und nahm ebenfalls ein Glas. Er und Frau Trampmann prosteten sich lächelnd zu. Ich machte ein paar Aufnahmen. Aber natürlich zeigten sie nicht das, was ich brauchte. Es wurde Zeit, dass die beiden ein wenig körperlichen Kontakt aufnahmen. Die Couch war wie geschaffen dafür.
Jetzt macht schon, dachte ich.
Aber nichts in dieser Richtung geschah.
Sie redeten. Der Mann setzte sich ebenfalls. In respektabler Entfernung.
Dann stand er wieder auf. Er schien ihr etwas zu erklären. Und schließlich tat er etwas, was ich beim besten Willen nicht erwartet hätte.
Er ging zur Seite und öffnete eine Klappe an dem monströsen dunkelbraunen Wandschrank. Er holte etwas heraus, das wie ein dickes Buch aussah. Es war ein Album.
Heute sagt man, wenn man jemanden in privater Umgebung treffen will: »Zu mir oder zu dir?« In meiner Jugend ging das anders. Da sagte man noch: »Soll ich dir meine Briefmarkensammlung zeigen?«
Ich hatte das immer für einen Witz gehalten. Doch jetzt, mit Mitte fünfzig, musste ich erfahren, dass da wirklich was dran war.
Ich war baff.
Was mich nicht davon abhielt, weiter auf den Auslöser zu drücken. Ich fotografierte, wie der Mann, der übrigens etwa im gleichen Alter wie Rita Trampmann war, an seine Besucherin heranrückte. Wie er das Album aufschlug. Wie sie sich sorgfältig die Seiten ansah. Wie sie langsam umblätterte. Wie er dazu irgendwas erklärte.
Null körperlicher Kontakt.
Ich war so in meinen Beobachtungen versunken, dass mir die Schritte viel zu spät auffielen.
Mit brutaler Gewalt wurde der arme Busch, hinter dem ich mich versteckt hatte, zurückgebogen. Ein grobes Gesicht erschien. Rötlicher Bart. Furchen in der Haut. Finsterer Blick. Eine Mischung aus Rübezahl und Gimli, dem Zwerg aus dem »Herrn der Ringe«.
»Jetzt möchte ich aber mal wissen, was du hier machst«, giftete er mich an.
Ich wollte antworten. Leider fiel mir überhaupt nichts ein, was ich hätte sagen können. Ich wich einen Schritt zurück, aber da kam der Typ schon durch den Busch auf mich zu und packte mich am linken Arm. In der rechten Hand hielt ich die Kamera.
»Nun lassen Sie mich doch mal los«, rief ich. »Ich sage Ihnen ja alles.«
Der Mann machte eine Bewegung, und schon hatte er mich im Schwitzkasten. »Headlock« nennt man das im Fachjargon der Profikämpfer. Aber es nützte mir natürlich gar nichts, das zu wissen. Wichtiger wäre die Information gewesen, wie man sich daraus befreit. Aber die hatte ich nicht.
»Das ist ein Privatgrundstück«, geiferte er. »Das ist Hausfriedensbruch. Es ist jetzt schon das dritte Mal, dass ihr euch hier herumtreibt.«
»Also ich bin das erste Mal hier«, rief ich gepresst.
Er brummte irgendwas Unverständliches und drückte mich weiter nach unten.
»Jetzt lassen Sie endlich los«, versuchte ich zu schreien, aber ich brachte nur ein hässliches Krächzen zustande.
Der Mann verstand mich anscheinend trotzdem, denn er grunzte deutliche Ablehnung. In dieser Sekunde erkannte ich, in welcher Lage ich war. Ja, manchmal kann das Gehirn, das in vielen Situationen zu träge ist, ein X von einem U zu unterscheiden, unglaubliche Analysen anstellen.
Mein Auftrag für Trampmann war geplatzt. Die Fotos konnte ich vergessen. Ich kannte noch nicht mal den Namen des Auserwählten, dem sich seine Frau hingab. Wer von den beiden Rosulowsky oder so ähnlich hieß, konnte ich nicht sagen. Irgendwie hatte ich auch den Verdacht, dass es hier gar nicht um Ehebruch ging. Ich würde die Beteiligten aber vermutlich nicht dazu bringen, mir das alles haarklein zu erklären.
Ein weiterer Tiefflug einer Maschine in Richtung Flughafen peitschte meine Gedanken weiter an. Der Rübezahl, der mich immer noch festhielt, schien auf den Fluglärm nicht so ganz eingestellt gewesen zu sein. Er zeigte sich von dem Donner aus den Wolken überrascht.
Offenbar ist er hier nur auf Besuch, schlussfolgerte ich messerscharf.
Für einen winzigen Moment lockerte er den Griff. Ich nutzte die Chance und riss meinen Kopf aus der Umklammerung.
Wir hatten uns ein Stück weit von dem Busch entfernt. Als ich mich aufrichtete, sah ich Rita Trampmann und den anderen Mann am Fenster stehen – wie Zuschauer am Rande einer Ringerarena. Sie wussten, was hier lief.
Der Rübezahl versperrte mir den Fluchtweg in Richtung Straße. Als er mich wieder zu packen versuchte, versetzte ich ihm einen verzweifelten Stoß vor die Brust, und es gelang mir tatsächlich, ihn kurz zum Taumeln zu bringen.
Sofort wandte ich mich dem hinteren Teil des Grundstücks zu, und mir gelang zu meinem eigenen Erstaunen der Sprung über den – zugegebenermaßen niedrigen – Zaun. Nun lag eine dunkle Rasenfläche vor mir. Dieses Grundstück musste zu einem Haus an der nächsten Parallelstraße gehören.
Ich rannte blind in das Areal hinein. Das dazugehörige Gebäude lag, von ein paar schläfrigen Außenlampen beleuchtet, ein gutes Stück entfernt.
Ein heftiges Schnaufen hinter mir zeigte, dass Rübezahl die Verfolgung aufgenommen hatte. Das war nicht gut. Er kannte sich hier bestimmt besser aus als ich.
Wenn er aber andererseits nur zu Besuch war …
Ich unterließ weitere Überlegungen und rannte.
Am Haus traf ich auf eine Terrasse. Das Gebäude war ein Bungalow. Selbst im Schein der müden Lampen konnte ich erkennen, dass es ziemlich runtergekommen war. Der Putz war von den Wänden abgeplatzt, an einigen Stellen hatten sich unter den offenbar undichten Dachrinnen spitzbartförmige dunkle Flecken an der Mauer gebildet. Auf der Terrasse wuchs Moos aus den Fugen.
Ich versuchte, den Schein der Funzeln zu vermeiden. Neben dem Gebäude gab es auch hier eine Garage. Mit Durchgang in den Garten. Eine alte Holztür, die gut ins Bühnenbild zur Hexenhaus-Szene in »Hänsel und Gretel« gepasst hätte, stand offen.
Ich hielt mich im Schatten und wandte mich um. Rübezahl war auf halber Strecke stehen geblieben und schaute suchend nach links und rechts. Sicher würde er gleich näher kommen. Wenn er das Haus erreichte, würde er mich finden.
Also ging ich das Wagnis ein und betrat die Garage.
Absolute Schwärze. Meine Hände stießen auf kaltes Metall. Es roch nach alten Reifen, Dreck und Feuchtigkeit. Was da vor mir im Dunkel stand, entpuppte sich als Fahrrad. Dahinter ein Wagen. Das wenige Mondlicht, das durch die Tür hereindrang, sorgte für einen kleinen roten Reflex am Rücklicht. An der Seite lehnten Gartengeräte an der Wand. Vorsichtig tastete ich mich weiter vorwärts. Meine Hände stießen an die glatte Kühlerhaube.
Jetzt wurde draußen gesprochen.
Rief Rübezahl etwa nach mir?
Ich verhielt mich still. Wenn er so blöd war, nach mir zu rufen, war er vielleicht auch so dämlich, den Eingang zur Garage und damit mein Versteck zu übersehen.
Ich beschloss, darauf zu hoffen.
Dann wurde mir klar, dass draußen zwei Männer sprachen. Ich konnte nicht genau verstehen, was sie sagten. Aber der eine wollte den anderen wohl vom Grundstück scheuchen.
»… hole ich die Polizei … lasse mir das nicht gefallen.«
»… geflohen … Immer wieder gibt’s hier den Ärger, dass uns einer bespitzelt …« Das war Rübezahls Stimme.
Dann wurde es still. Schritte näherten sich meinem Versteck. Die Holztür der Garage quietschte leise, als sie ganz aufgestoßen wurde. Neonbeleuchtung flackerte auf. Im kalten weißen Licht stand jemand vor mir.
Nicht Rübezahl. Ein schlanker junger Mann. Etwa Anfang dreißig. Jeans, Sweatshirt. Sehr glatt rasiert. Sandfarbenes Haar.
»Ich geh gleich wieder«, sagte ich. »Ich habe mich nur verlaufen.«
Er machte einen Schritt auf mich zu, und schon an dieser kleinen Bewegung merkte ich, dass er recht sportlich sein musste. Dann kam er noch näher. Dabei fixierte er mich, als wollte er mich unter Kontrolle behalten. Als hätte er irgendwas vor.
»Hören Sie, es tut mir leid. Aber der Mann dort drüben hat mir Angst gemacht. Da bin ich weggerannt und auf Ihr Grundstück geraten. Ich hatte nicht vor …«
Ich wusste nicht, wie der Typ es so schnell hinbekam, mich anzugreifen, kurz festzuhalten und dann nach hinten zu schubsen. Ich hatte ihn kaum kommen sehen und wurde mir der Sache erst bewusst, als er mich schon wieder losgelassen hatte. Immerhin war meine Kamera heil geblieben.
»He«, rief ich. »Was soll das?«
Auf einmal hatte er das Mäppchen mit meinen Ausweisen und Visitenkarten in der Hand. Er holte eine heraus und studierte sie. »Privatdetektiv Remigius Rott«, sagte er. »Das sind Sie?«
»Äh, ja, genau … Wie gesagt. Ich wurde sozusagen bei einem Auftrag unterbrochen. Es hat aber nichts mit Ihnen zu tun. Es war reiner Zufall, dass ich hier gelandet bin. Geben Sie mir das bitte zurück.«
Noch immer sah er mich scharf an.
»Ich könnte einen Privatdetektiv gebrauchen«, sagte er.
»Sie haben ja meine Karte in der Hand. Rufen Sie mich an.«
»Sie sind doch schon da. Können wir nicht jetzt gleich sprechen?«
»Nun, das stimmt, aber ich …«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Jetzt war mein Kopf wieder ein bisschen langsam. Hatte ich nicht noch vor wenigen Minuten messerscharf geschlossen, dass der Trampmann-Auftrag im Eimer war? Musste ich nicht einen neuen Auftrag finden, um nächste Woche meine Miete bezahlen zu können?
Sollte ich mich nicht freuen, wenn ich jetzt was Neues bekam?
Okay, ich hatte keine Ahnung, was das alles zu bedeuten hatte, und ich überlegte immer noch, mit welchem Kampfsporttrick der Mann mir das Mäppchen entwendet hatte. Aber anhören konnte man ihn ja mal. Gefährlich wirkte er jedenfalls nicht.
Und auf einmal kam mir eine neue Idee.
Vielleicht wusste der Mann ja etwas über seinen Nachbarn und dessen Verhältnis zu oder mit Rita Trampmann? Dann könnte ich das Honorar von dem Handelsvertreter womöglich doch noch bekommen.
»Ich denke, Sie sind mir was schuldig«, sagte er. »Die anderen sind nicht so leicht davongekommen.«
»Welche anderen?«
Er sah mich abschätzig an. Als wäre ich schwer von Begriff oder so was.
»Wenn es Sie interessiert, erkläre ich es Ihnen. Gehen wir ins Haus.«
3
Wir betraten das Gebäude durch die Terrassentür und gelangten in ein recht großes Wohnzimmer, das ausreichend Platz bot, um sich gemütlich darin niederzulassen und eine angenehme Zeit zu verbringen. Doch leider gab es Leute, die von viel Raum dazu verleitet wurden, selbigen unbegrenzt auszunutzen und die Bude dann noch nicht mal durch regelmäßiges Putzen in Schuss zu halten.
Der Mann, auf den ich getroffen war, gehörte zu dieser Sorte. Manche nennen so was Messie.
Seltsam – vom Aussehen her hätte ich ihn gar nicht so eingeschätzt.
Vor lauter Zeitschriften- und Bücherstapeln, vor achtlos aufgehäuften Klamottenbergen und offenbar ausrangierten Geräten fand man keine vernünftige Sitzgelegenheit. Die wenigen Stellen, an denen der Fußboden zu sehen war, zeigten verkratztes, abgeschabtes Parkett. In den Ecken lehnten irgendwelche Stangen. Ich glaubte, Walkingstöcke zu erkennen. Überreste eines auseinandergebauten Staubsaugers.
Hinter einer ähnlich spießigen Schrankwand wie drüben in dem Haus, in dem Rita Trampmann zu Besuch war, schien eine indirekte Beleuchtung, die dem ganzen Raum die Gemütlichkeit eines Bahnhofwartesaals verlieh. Dazu roch es muffig und streng. Ich kam erst nicht drauf, wonach, aber dann fiel es mir wieder ein.
Schimmel.
»Setzen Sie sich doch«, sagte der Mann, und für einen Moment fürchtete ich, in die Gewalt eines Irren geraten zu sein, der in dem Chaos als Einziger eine Sitzgelegenheit zu erkennen glaubte, die es aber in Wirklichkeit gar nicht gab. Doch ich folgte seinem Fingerzeig und entdeckte die freie Sitzfläche eines ehemals weißen, jetzt vergilbten Ikea-Klappstuhls, auf dem ich mich vorsichtig niederließ. Auch dem Mann gelang es, ein Objekt zum Daraufsitzen zu finden. Etwas Wackliges offenbar, denn er saß vorsichtig, mit angezogenen Beinen, und balancierte das Gewicht aus.
»Möchten Sie was trinken?«
Auf einmal hielt er eine Bierflasche in der Hand, die irgendwo auf dem Boden gestanden haben musste. Sie war geöffnet. Und nur halb voll.
Hinter ihm auf der Fensterbank registrierte ich eine ganze Batterie von leeren Flaschen, die in überraschender Ordnung nebeneinanderstanden. Nicht nur Bier, auch Wodka, dazu grüne Weinflaschen und Whisky.
»Nein danke«, sagte ich. »Übrigens, nachdem Sie jetzt meinen Namen kennen …«
»Pütz«, stellte er sich vor. »Ich heiße Simon Pütz.«
Er nahm einen Schluck.
»Okay, Herr Pütz. Sie haben gerade erwähnt, dass …«
»Ja, es waren immer wieder mal Leute drüben und haben das Haus beobachtet. Das dürften ebenfalls Privatermittler gewesen sein. Ich glaube, ich weiß auch, warum. Da kommt ab und an eine Frau zu Besuch, und die scheint einen ziemlich eifersüchtigen Ehemann zu haben.«
»Besteht denn Grund zur Eifersucht?«
»Kann ich nicht sagen.« Er trank wieder.
»Sie haben aber offenbar genug Zeit, die Vorgänge auf dem Nachbargrundstück zu beobachten?«
Er schluckte und nickte. »Ich bin arbeitslos. Wie gesagt – ich könnte einen Privatdetektiv gebrauchen.«
Das klang nicht gut. Für Arbeitslose zu ermitteln hatte einen gewaltigen Haken. Ich glaube, ich brauche nicht zu erklären, welchen.
»Ich weiß, Sie haben normalerweise andere Kunden«, sagte er. »Aber hören Sie mir erst mal zu. Nur zuhören. Bitte.«
Seine Stimme hatte auf einmal einen aggressiven Unterton. Eine eigenartige Beimischung von der Sorte, die auf tiefen Frust schließen lässt.
»Okay?« Er sah mich ernst an. »Habe ich Ihre Aufmerksamkeit? Ich habe Ihnen schließlich geholfen, oder nicht? Dann können Sie mir doch wenigstens zuhören.«
Bisher hatte er ziemlich beherrscht gewirkt. Nun brach sich eine Ungeduld Bahn, die er vorher gut verborgen hatte.
»Herr Pütz …«
»Nur zuhören. Das geht doch, oder?«
Ich sah ihn an und bemühte mich, so sanft wie möglich zu klingen. »Ist ja schon gut. Ich höre Ihnen zu. Aber wenn Sie Geld brauchen, kann ich Ihnen auch nicht helfen.«
»Geld …« Er schüttelte den Kopf. »Geld habe ich eine Menge. Ich muss nur drankommen.«
Ich versuchte, meine Idee von eben unterzubringen. »Aber vielleicht haben Sie ja Interesse daran, mir einen Gefallen zu tun – gegen Bezahlung natürlich. Der Typ, der da drüben wohnt, dieser Rosulowsky oder wie er heißt, hat etwas mit einer verheirateten Frau. Ich brauche Fotos, die das beweisen. Wobei mir nicht klar ist, wie dieser Rübezahl dazu passt, der mich verfolgt hat.«
»Vergessen Sie das«, fuhr er auf. »Der Mann, der Sie verfolgt hat, ist Rosulowskys Bruder. Das mit der Frau ist Quatsch. Da läuft nichts, glauben Sie mir. Und nachdem ich Ihnen das gesagt habe, könnten Sie mir jetzt bitte endlich mal zuhören.«
»Woher wissen Sie das so genau?«, fragte ich. »Dass das mit der Frau Quatsch ist?«
»Rosulowsky ist schwul. Das weiß hier jeder. Lassen Sie mich jetzt also endlich erklären, was ich zu sagen habe? Ja? Nur zuhören. Bitte.«
Gut, dachte ich. Eine neue Wendung. Ich würde Trampmann die frohe Botschaft überbringen, dass seine Frau ihm treu war. Gab er sich damit zufrieden, stellte sich trotzdem noch die Frage, was die rothaarige Rita dann überhaupt hier wollte. Es könnte ja sein, dass Trampmann mich beauftragte, das herauszufinden, dann wären ein paar weitere bezahlte Tage drin. Eventuell bekam ich auch noch den Auftrag, herauszufinden, ob das mit Rosulowskys Neigung wirklich stimmte.
Ich nahm den frischen Duft neuer Hoffnung wahr.
»Ich brauche Ihre Kohle nicht«, sagte Pütz bestimmt. Er stellte die Flasche neben einen Stapel Zeitschriften auf einem Beistelltisch und stand auf. »Hier geht’s nicht um Kleinkram. Die sollen mir nur das zurückgeben, was mir zusteht.«
»Die?«, fragte ich.
»Ich erklär’s Ihnen.« Nervös fuhr er sich durchs Haar, suchte nach Worten.
Jetzt erst bemerkte ich, dass es auf einem Viertelquadratmeter dieses Raumes eine kleine Oase der Ordnung gab. Auf einem winzigen wackligen Tischchen mit gedrechselten Beinen der Stilrichtung »Gelsenkirchener Barock« wartete ein Festnetztelefon in seiner Ladeschale. Daneben gab es gerade noch Platz genug für ein sorgfältig aufgestelltes, gerahmtes Foto. Pütz und eine schwarzhaarige, ebenfalls recht sportlich wirkende Frau lehnten an einem Felsen neben einem See. Das Foto erinnerte mich an das Bild von mir und Wonne auf meinem Schreibtisch. Na gut, es war nichts Besonderes, gerahmte Bilder von sich und seinen Lieben zu haben, aber diese Übereinstimmung – noch dazu inmitten dieser chaotischen Umgebung – berührte mich auf seltsame Weise.
»Nur zuhören, klar?«, rief Pütz wieder, dabei hatte ich gar nichts gesagt. »Jetzt rede ich.«
Ich schwieg. Er umrundete die Stapel von Papier, Geräten und undefinierbarem Zeug und steuerte eine bestimmte Stelle in einem Regal an. Dort wetteiferten Aktenordner mit Büchern und Zeitschriften um jeden Millimeter Platz. Er zog einen davon heraus, kam zu mir zurück und reichte ihn mir.
»Haben Sie so was schon mal gesehen?« Seine Alkoholfahne wehte mir entgegen. Die kam nicht nur von dem Bier, das er eben getrunken hatte. »Schauen Sie sich das ruhig genau an.« Er blieb vor mir stehen.
Der Ordner war blau. In gelber Schrift prangten die Wörter »Mit Sicherheit anlegen« auf dem Deckel.
Es waren Bankunterlagen. Listen mit Zahlen und irgendwelchen konstruierten Namen von Investmentfonds. Auf den ersten Blick sieht so was immer langweilig aus, bis man die Ziffern mal genauer betrachtet. Ich kannte derartige Aufstellungen von meiner Tante Jutta, die gerade irgendwo in der Sonne herumjettete. So wurde mir schnell klar, dass es sich um Verträge über Schiffsfonds handelte. Hinten gab es einige farbenprächtige Prospekte mit Fotos von dick bepackten Containerschiffen, die in herrlichem Sonnenlicht die tiefblaue See durchpflügten. Mit blendend weißen Schaumwellen vor dem Bug. Davor weiße Blätter mit den erwähnten Übersichten. Ich las Zahlen: Siebzigtausend. Vierzigtausend. Dreißigtausend.
Ganz vorne im Ordner dann ein Brief mit dem blau-roten Logo einer Bank mit zwei Adressen, einer Hauptanschrift im Ruhrgebiet und der der kontoführenden Filiale in Bergisch Gladbach.
Sehr geehrter Herr Pütz,
vielen Dank, dass Sie sich an uns gewandt haben. Sie sind unzufrieden mit der Aufklärung zu den Beitritten bezüglich der geschlossenen Beteiligungen MSZ Magnifica, RSU Asia Ships und MS MAC Lohengrin. Wir haben den Sachverhalt geprüft, können jedoch keine Ansprüche aufgrund einer angeblich fehlerhaften Aufklärung feststellen. Sie wurden mündlich und schriftlich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den von Ihnen gewählten Anlagen um unternehmerische Beteiligungen handelt, die gewisse Risiken bergen.
Hier hörte ich auf zu lesen, schlug den Ordner zu und blieb wieder an dem Schriftzug »Mit Sicherheit anlegen« hängen.
Der blanke Hohn.
Ich wusste genug. Solche Geschichten hatten in den letzten zehn Jahren immer wieder in der Zeitung gestanden. Pütz hatte vor der großen Wirtschaftskrise 2008 in angeblich sichere Schiffsfonds investiert. Und jetzt war alles im Eimer.
»Alle drei Fonds sind pleite«, sagte Pütz klar und sachlich. »Ich brauche das Geld. Vor allem für meinen Vater. Er lebt im Altersheim, und das kostet eine Menge Geld. Er hat seine Ersparnisse extra angelegt, um später niemandem auf der Tasche zu liegen. Die Ausschüttungen sollten das Heim finanzieren. Er ahnte damals schon, dass er Pflege benötigen würde.«
Was sollte ich dazu sagen? Und vor allem – was erwartete Pütz von mir? Ich konnte das Geld nicht wieder herbeizaubern. Wenn die Fonds pleite waren, war das Geld weg. Man konnte es natürlich mit einer Schadensersatzforderung versuchen. Zum Beispiel wegen mangelhafter Beratung. Offenbar hatte Pütz genau das mit einem Beschwerdebrief bereits versucht. Denn was ich gerade gelesen hatte, war die Antwort der Bank, die natürlich jeden Fehler weit von sich wies.
Pütz machte eine unbestimmte Bewegung und hatte auf einmal eine Pistole in der Hand. Auch sie musste irgendwo zwischen den Kisten gelegen haben. Wahrscheinlich neben der Bierflasche. Er zielte jedoch nicht mit der Waffe, sondern wog sie nur nachdenklich in der Hand.
»Es wird Zeit, dass da mal was passiert«, sagte er.
Ich räusperte mich. »Jetzt machen Sie mal halblang. Was haben Sie vor? Legen Sie das Ding weg.«
Er sah nicht mich, sondern die Pistole an. »Mir bleibt nichts anderes übrig.«
»Tun Sie das nicht. Wie alt sind Sie? Mitte dreißig? Sie kommen aus der Sache wieder raus, glauben Sie mir.«
Er hob den Kopf. Dann schien er zu verstehen, lächelte gequält. »Die ist nicht für mich. Was denken Sie denn? Die ist natürlich für den Banker. Mirko Grub heißt er. Wohnt in Porz-Lind. Er hat meinem Vater und mir damals diese Fondsanteile verkauft. Hat uns tolle Gewinne versprochen. Als wir ihn fragten, ob die Firmen pleitegehen könnten, hat er behauptet, allein der Stahlwert der Schiffe sei so hoch, dass wir unser Geld auf jeden Fall zurückbekommen. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Aber er … Er hat die dicken Provisionen kassiert. Wissen Sie, was der für einen Wagen fährt? Einen Tesla. Eins von diesen sauteuren Elektroautos. Zieht Leute über den Tisch und schützt mit deren Geld das Klima. Der wohnt in einem schicken Haus in Porz und macht auf braver Bürger. Ich habe alles überprüft.«
»Legen Sie endlich die Pistole weg. Wollen Sie diesen Grub umbringen? Was nützt Ihnen das? Sie gehen in den Knast, und was soll dann aus Ihrem Vater werden? Das Geld sehen Sie dadurch auch nicht wieder.«
Er sah wieder die Waffe an, als würde sie ihm die Antwort geben. Dann legte er sie auf einen Zeitschriftenstapel.