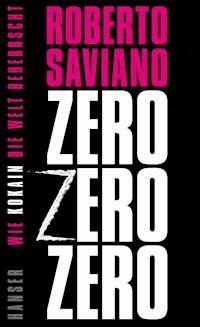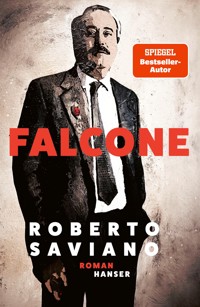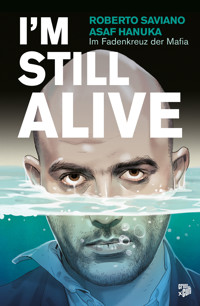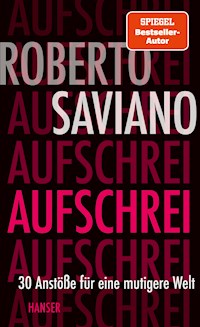Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zehn Jungen rasen auf ihren Motorrollern durch die Stadt. Sie heißen Maraja, Dentino, Lollipop, Drone, sie tragen Markenschuhe und den Namen der Freundin auf die Schulter tätowiert – und sie wollen alles haben. In Neapel ist das nur eine Frage der richtigen Camorra-Bande. Der Weg vom Pusher zum Killer ist kurz. Auf den Dächern der Stadt üben die 15-jährigen mit Sturmgewehren, zielen auf Mülltonnen und Fensterscheiben. Bald gilt ein Menschenleben weniger als ein gebrochenes Wort. Sie fühlen sich unsterblich, bis der Glanz ihres rasanten Lebens sie schließlich selbst blendet. Roberto Savianos erster großer Roman erzählt von einer Jugend ohne Gott: schnell, brutal und ohne Pardon.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Zehn Jungen rasen auf ihren Motorrollern durch die Gassen von Neapel, um neue Reviere zu erobern. Sie heißen Maraja, Dentino, Lollipop, Drone, sie tragen Markenschuhe und den Namen der Freundin auf die Schulter tätowiert. Der Weg vom Pusher zum Killer ist kurz – fressen oder gefressen werden lautet das Gesetz ihres Anführers Nicolas. Zusammengekauert auf den Dächern der Stadt üben sie mit Sturmgewehren, zielen auf Mülltonnen und Fensterscheiben. Bald gilt ein Menschenleben weniger als ein gebrochenes Wort. Sie fühlen sich unsterblich, bis der Glanz ihres zu schnellen Lebens sie schließlich selbst blendet.
Hanser E-Book
Roberto Saviano
Der Clan der Kinder
Roman
Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki
Carl Hanser Verlag
Den schuldigen Toten. Ihrer Unschuld.
Inhalt
1. Teil Die Paranza kommt vom Meer
In der Scheiße
Das Nuovo Maharaja
Böse Gedanken
Die Hochzeit
Die chinesische Pistole
Luftballons
Raubüberfälle
Baby-Paranza
Lötkolben
Der Fürst
2. Teil Gearschte und Verarscher
Gericht
Menschliches Schild
Alles in Ordnung
Das Versteck
Adda murì mammà
Capodimonte
Ritual
Zoo
Der Kopf des Türken
Training
Champagner
3. Teil Sturm
Kommandieren
Piazze
Wir kriegen sie am Arsch
Walter White
Tanklaster
Ich werde ein guter Mensch sein
Brüder
Die Botschaft
Rotes Meer
Die Paranza
MARAJA Nicolas Fiorillo
BRIATÒ Fabio Capasso
TUCANO Massimo Rea
DENTINO Giuseppe Izzo
DRAGÒ Luigi Striano
LOLLIPOP Vincenzo Esposito
PESCE MOSCIO Ciro Somma
STAVODICENDO Vincenzo Esposito
DRONE Antonio Starita
BISCOTTINO Eduardo Cirillo
CERINO Agostino De Rosa
Wo Kinder sind, da ist ein goldenes Zeitalter.
NOVALIS
1. Teil Die Paranza kommt vom Meer
Das Wort Paranza kommt vom Meer.
Wer am Meer geboren wird, kennt nicht nur ein einziges Meer. Er wird vom Meer besetzt, durchnässt, besessen, vom Meer beherrscht. Er kann den Rest seines Lebens weit weg vom Meer verbringen und bleibt doch meerdurchtränkt. Wer am Meer geboren wird, weiß, dass es das Meer der Mühsal gibt, das Meer des Ankommens und Weggehens, das Meer der Abwasserentsorgung, das Meer, das isoliert. Es gibt die Kloake, den Fluchtweg, das Meer als unüberwindliche Barriere. Es gibt das nächtliche Meer.
Nachts fährt man zum Fischen hinaus. Tintenschwarze Dunkelheit. Flüche, nie ein Gebet. Stille. Nur Motorengeräusch.
Zwei Boote fahren davon, klein und morsch, mit so vielen Fischerlampen beschwert, dass sie fast sinken. Eins fährt nach links, eins nach rechts, die Leuchten am Bug sollen die Fische anlocken. Nachtfischerleuchten. Blendend helles Licht, Elektrizität aus Salz. Erbarmungslos durchsticht der starke Lichtstrahl das Wasser bis auf den Grund. Der Anblick des Meeresgrunds macht Angst, es ist, als sähe man, wo alles endet. Das soll es sein? Dieser armselige Haufen Steine und Sand, bedeckt von all dieser Unermesslichkeit? Bloß das?
Paranza wird ein Boot genannt, das Fische mit Licht in die Falle lockt. Die neue Sonne ist elektrisch, das Licht erobert das Wasser, nimmt es in Besitz, und die Fische suchen es, vertrauen ihm. Sie vertrauen dem Leben, stürzen sich, vom Instinkt getrieben, mit weit geöffnetem Maul hinein. Währenddessen öffnet sich rasch das Netz, das sie umgibt, die Maschen legen sich auf den Schwarm, hüllen ihn ein.
Dann bleibt das Licht stehen, scheint endlich erreichbar für die aufgerissenen Mäuler. Bis die Fische einer nach dem andern aneinandergedrückt werden, bewegen sie noch die Flossen, suchen Raum. Und als würde das Meer zu einer Pfütze, werden alle zurückgeworfen, die meisten stoßen gegen etwas, wenn sie das Weite suchen, stoßen gegen etwas, das nicht weich ist wie Sand, aber auch kein Fels ist, es ist nicht hart. Es scheint überwindbar, aber man kann ihm unmöglich entkommen. Sie zappeln hoch, runter, hoch, runter, rechts, links und wieder rechts, links, doch dann schwächer, immer schwächer.
Das Licht geht aus. Die Fische werden hochgezogen, für sie steigt das Meer plötzlich an, als würde der Grund selbst sich zum Himmel erheben. Es sind nur die Netze, die hochgezogen werden. Von der Luft erstickt, öffnen die Mäuler sich zu kleinen verzweifelten Kreisen, und die erschlaffenden Kiemen sehen aus wie offene Blasen. Das Rennen ins Licht ist zu Ende.
In der Scheiße
»Alter, glotzt du mich an?«
»Dich? Mit’m Arsch nicht.«
»Was gibt’s zu glotzen?«
»Ey, Bruder, falsche Adresse! Mach nicht so ’n Wind.«
Renatino stand zwischen den anderen Jungen, sie hatten es schon länger in der Menge der Körper auf ihn abgesehen, doch als er sie bemerkte, umringten sie ihn bereits zu viert. Der Blick ist Revier, ist Heimat, jemanden ansehen heißt, unerlaubt in sein Haus eindringen. Jemanden anstarren bedeutet, ihn anzugreifen. Den Blick nicht abzuwenden ist eine Demonstration von Macht.
Sie besetzten die Mitte der Piazza. Ein kleiner Platz, umschlossen von einer Bucht aus Häusern, mit einer einzigen Zugangsstraße, einer einzigen Bar an der Ecke und einer Palme, die für einen exotischen Anstrich sorgte. Allein dieses in wenigen Quadratmetern Erdreich steckende Gewächs veränderte den Anblick der Fassaden, Fenster und Haustüren, als wäre es mit einem Windstoß von der Piazza Bellini hergekommen.
Keiner von ihnen war älter als sechzehn. Sie kamen näher, ihr Atem vermischte sich. Sie waren jetzt kurz davor, anzugreifen. Nase gegen Nase, bereit zum Kopfstoß aufs Nasenbein, wenn ’o Briatò nicht mit seinem ganzen Körper dazwischengegrätscht wäre, eine Mauer, die eine Grenze zog.
»Laberst immer noch! Halt deine Scheißfresse und Augen runter …!«
Aus Scham blickte Renatino nicht zu Boden, doch wenn er mit einer Unterwerfungsgeste aus dieser Situation herausgekommen wäre, er hätte es gern getan. Den Kopf senken, sogar hinknien. Sie waren viele gegen einen: Wenn man jemanden schlagen muss, gilt kein Ehrenkodex mehr. Das neapolitanische vattere lässt sich aber nicht einfach nur mit »schlagen« übersetzen. Wie bei anderen Ausdrücken des Körpers geht sein Gebrauch über die Grenzen seiner einfachen Bedeutung hinaus. Wenn die Mama, dein Vater oder Großvater dich schlagen, ist es vattere, draufhauen, während die Polizei und der Lehrer nur schlagen, aber deine Freundin »haut drauf«, wenn du eine andere zu lange angesehen hast.
Heißt es »draufhauen«, schlägst du mit aller Kraft, mit echter Wut und ohne Regeln. Vor allem schlägst du aus einer gewissen Nähe, einer zweideutigen Nähe. »Draufhauen« sind die Prügel, die man jemandem verpasst, den man kennt, der einem nahe ist, durch Wohnort, Bildung, Bekanntschaft, der Teil des eigenen Lebens ist; einen Fremden, der nichts mit dir zu tun hat, schlägst du bloß.
»Du markierst alle Fotos von Letizia mit ›Gefällt mir‹. Batzt überall Kommentare hin, und hier auf der Piazza glotzt du mich noch an!?«, beschuldigte ihn Nicolas. Und spießte Renatino mit den schwarzen Nadeln, die er anstelle der Augen hatte, wie ein Insekt auf.
»Ich glotz nicht …! Und wenn Letizia Fotos postet, kann ich Kommentare schreiben und ›Gefällt mir‹ anklicken.«
»Da soll ich dir nicht einen aufs Maul geben?«
»Ey, du nervst, Nicolas …!«
Nicolas fing an, ihn zu schubsen und anzurempeln, Renatino stolperte über die Füße der anderen und prallte an den Körpern vor Nicolas ab wie an der Bande eines Billardtischs. ’O Briatò warf ihn Dragonbò zu, der ihn mit einem Arm packte und gegen ’o Tucano schleuderte. Der tat so, als wollte er ihm einen Kopfstoß verpassen, schubste ihn dann aber zu Nicolas zurück. Sie hatten etwas anderes vor.
»Was soll der Scheiß! Eeh!«
Das kam heraus wie der Schrei eines Tieres, nein, wie das Winseln eines verängstigten kleinen Hundes. Er wiederholte einen einzigen Laut, der wie ein um Rettung flehendes Gebet klang: »Eeeeh …!«
Ein trockener Laut. Ein gutturales »E«, äffisch, verzweifelt. Um Hilfe bitten ist die Unterschrift unter die eigene Feigheit, doch er hoffte, dieser eine Vokal, der letzte Buchstabe des Wortes »Hilfe«, könnte wie ein flehentlicher Hilferuf verstanden werden, damit ihm die äußerste Demütigung erspart blieb, ihn aussprechen zu müssen.
Niemand griff ein, die Mädchen gingen weg, als begänne ein Schauspiel, bei dem sie nicht dabei sein wollten oder konnten. Viele blieben, gaben sich unbeteiligt, waren in Wirklichkeit aber hellwache Zuschauer, und jeder, falls er verhört wurde, sofort bereit, zu schwören, er habe die ganze Zeit auf sein iPhone geguckt und nicht das Geringste bemerkt.
Nicolas warf rasch einen Blick auf die Piazzetta, dann brachte er Renatino mit einem harten Stoß zu Fall. Der versuchte aufzustehen, doch ein Fußtritt von Nicolas mitten in die Brust warf ihn wieder zu Boden. Zu viert stellten sie sich um ihn herum auf.
’O Briatò packte seine Beine an den Fußgelenken. Manchmal entglitt ihm eins, wie ein Aal, der sich entwindet, doch obwohl Renatino verzweifelt nach Briatòs Kopf trat, gelang es dem immer, auszuweichen. Schließlich fesselte Briatò ihm die Beine mit einer Kette, eine dieser leichten Ketten, mit denen man Fahrräder am Laternenpfahl festmacht.
»Die hält!«, sagte er, nachdem er das Schloss hatte zuschnappen lassen.
’O Tucano sicherte Renatinos Hände mit Handschellen aus Metall, das mit rotem Plüsch überzogen war, wahrscheinlich in irgendeinem Sexshop aufgelesen, und gab ihm Tritte in die Nieren, damit er sich beruhigte. Dragonbò hielt seinen Kopf fest, es sah fast zartfühlend aus, wie bei Sanitätern, wenn sie nach Unfällen eine Halskrause anlegen.
Nicolas zog seine Hose herunter, drehte Renatino den Rücken zu und ging über seinem Gesicht in die Hocke. Mit einer raschen Bewegung packte er die gefesselten Hände und hielt sie fest, dann fing er an, ihm ins Gesicht zu scheißen.
»Dragò, was meinst du, wenn einer ’n Scheißer ist, frisst er dann auch Scheiße?«
»Klar doch.«
»Da kommt sie …! Guten Appetit.«
Renatino wand sich und schrie, doch als er die braune Masse herauskommen sah, hielt er plötzlich still und machte alles dicht. Verschloss seine Lippen, rümpfte die Nase, verzog das Gesicht, hoffte, es würde zur Maske. Dragò hielt den Kopf fest und ließ ihn erst los, als das erste Stück auf Renatinos Gesicht sank. Aber das tat er nur, um nicht selbst getroffen zu werden. Sofort bewegte sich der Kopf wieder wie verrückt hin und her, Renatino versuchte, das Stück Scheiße loszuwerden, das sich zwischen Nase und Oberlippe gelegt hatte. Er schaffte es, das Stück fiel auf den Boden, und er schrie wieder sein verzweifeltes »Eeh!«.
»Jungs, die zweite Ladung ist im Anmarsch … festhalten!«
»Mann, hast du gefressen, Nicolas …!«
Dragò hielt den Kopf fest, wieder mit dem Sanitätergriff.
»Ihr Wichser! Eeh …! Eeeh! Arschlöcher!«
Er schrie verzweifelt, um sofort zu verstummen, als er das zweite Stück aus Nicolas’ After kommen sah. Ein haariges, dunkles Auge, das die Schlange aus Exkrement mit zwei Krämpfen in zwei rundliche Stücke zerteilte.
»Baah, Nicò, das wär fast bei mir gelandet …!«
»Willst auch bisschen was vom Tiramisu, was, Dragò?«
Das zweite Stück fiel Renatino auf die Augen. Er spürte, wie Dragòs Hände ihn losließen, und fing wieder an, hysterisch den Kopf zu bewegen, bis ihn ein Brechreiz überkam. Nicolas nahm einen Zipfel von Renatinos T-Shirt und wischte sich damit den Hintern ab, sorgfältig, ohne Eile.
»Renatì, kannst dich bei meiner Mutter bedanken, weißt du warum? Sie gibt mir gute Sachen zu essen. Bei dem Fraß von deiner Mutter, der Schlampe, hätt ich jetzt Dünnschiss und du ’ne Dusche aus Scheiße.«
Gelächter. Gelächter, das allen Sauerstoff im Mund verbrauchte. Es klang wie das Eselsgeschrei von Pinocchios Freund Lucignolo. Der dümmste aller ostentativen Lacher. Jungengelächter, grob, frech, ein bisschen gespielt, um zu beeindrucken. Sie nahmen Renatino die Kette ab, befreiten ihn von den Handschellen. »Kannste behalten, schenk ich dir.«
Renatino richtete sich auf, hielt die plüschverkleideten Handschellen umklammert. Die anderen gingen laut redend davon, schwangen sich auf ihre Mopeds und verließen die Piazza. Wendige Käfer, die ohne Grund beschleunigten, nur bremsten, um nicht gegeneinanderzustoßen. Im Nu waren sie verschwunden. Nur Nicolas hielt seine schwarzen Nadeln bis zuletzt auf Renatino geheftet. Ein Windstoß zerzauste ihm die blonden Haare, die er sich eines Tages, so hatte er beschlossen, bis auf die Kopfhaut abrasieren würde. Dann brachte ihn das Moped, auf dem er als Beifahrer saß, von der Piazza weg, und sie waren nur noch schwarze Umrisse.
Das Nuovo Maharaja
Forcella ist Materie der Geschichte. Materie aus jahrhundertealtem Fleisch. Lebendige Materie.
Drinnen, in den Falten der Gassen, die es zeichnen wie ein vom Wind gegerbtes Gesicht, steckt die Bedeutung dieses Namens. Forcella, von forca, Gabel, Galgen, Engpass. Ein Weg hinein und eine Gabelung. Etwas Unbekanntes, das dir immer anzeigt, wo du losgehen musst, doch nie, wo du ankommst, ob du ankommst. Eine Straße als Symbol. Von Tod und Auferstehung. Sie empfängt dich mit dem riesigen, auf eine Hauswand gemalten Bildnis von San Gennaro, der dich beobachtet, wenn du hereinkommst, und dich mit seinen Augen, die alles sehen, daran erinnert, dass es nie zu spät ist, sich wieder zu erheben, dass man die Zerstörung aufhalten kann wie die Lava.
Forcella ist eine Geschichte von Neuanfängen. Von neuen Städten über alten Städten, von neuen Städten, die alt werden. Von lärmenden, menschenwimmelnden Städten aus Tuffstein und Basalt. Steine, die hier jede Mauer errichtet, jede Straße trassiert, alles verändert haben, auch die Menschen, die seit jeher mit diesem Material arbeiten. Nein, es anbauen. Man sagt nämlich, dass Basalt angebaut wird wie eine Reihe von Weinstöcken, die gewässert werden müssen. Steine, die zur Neige gehen, denn man verbraucht den Stein, den man anbaut. In Forcella sind auch die Steine lebendig, auch sie atmen.
Die Häuser kleben aneinander, die Balkone küssen sich in Forcella wirklich. Sogar leidenschaftlich. Auch wenn dazwischen eine Straße verläuft. Und wenn es nicht die Wäscheleinen sind, die sie verbinden, sind es die Stimmen, die sich die Hände schütteln, einander zurufen, dass dort unten kein Asphalt liegt, sondern ein von unsichtbaren Brücken überquerter Fluss.
Immer wenn Nicolas am Cippo vorbeikam, den alten Steinen aus griechischer Zeit, packte ihn diese Fröhlichkeit. Dann fiel ihm ein, wie sie vor zwei Jahren, aber es fühlte sich an wie Jahrhunderte, den Weihnachtsbaum aus der Galleria Umberto geklaut und geradewegs hierher gebracht hatten, mitsamt den leuchtenden Kugeln, die ohne Strom aber nicht mehr leuchteten. Damit hatte er Letizia auf sich aufmerksam gemacht, die am Morgen vor Weihnachten aus dem Haus gegangen war und, als sie um die Ecke bog, die Spitze gesehen hatte. Wie in den Märchen, wo man abends sät, und wenn die Sonne aufgeht, steht da hoppla ein Baum, der bis in den Himmel reicht. An dem Tag hatte sie ihn geküsst.
Den Baum war er nachts holen gegangen, mit der ganzen Gruppe. Sobald ihre Eltern schlafen gegangen waren, waren sie los und hatten sich zu zehnt den Baum auf ihre mageren Jungenschultern geladen, eine herkulische Schufterei, leise fluchend, um keinen Lärm zu machen. Dann hatten sie ihn auf die Mopeds gebunden: Nicolas und Briatò mit Stavodicendo, »Sag ich doch«, und Dentino, dem »Zähnchen«, vorne, dahinter die anderen, die den Stamm hochhalten mussten. Es hatte stark geregnet, und es war nicht leicht gewesen, mit den Mopeds durch die breiten Pfützen und die reißenden Bäche zu fahren, die die Gullys ausspuckten. Motorroller hatten sie, das erforderliche Alter nicht, aber sie waren »gelernt« geboren, wie sie es ausdrückten, und konnten sich besser durchhangeln als die Älteren. Doch mit diesem Wasserfilm hatten sie kämpfen müssen. Mehrmals hatten sie angehalten, um Luft zu holen und die Stricke festzuziehen, aber schließlich hatten sie es geschafft. Sie richteten den Baum im Viertel auf, sie hatten ihn zwischen die Häuser, mitten unter die Leute gebracht. Wo er stehen sollte. Am Nachmittag waren dann die Falken vom Überfallkommando gekommen, um sich den Baum zurückzuholen, doch das zählte dann schon nicht mehr. Sie hatten die Sache durchgezogen.
Lächelnd ließ Nicolas den Cippo hinter sich und parkte vor Letizias Haus, er wollte sie abholen und in die Bar einladen. Doch sie hatte schon die Posts auf Facebook gesehen: die Fotos von Renatino, mit Scheiße beschmiert, die Tweets, in denen die Freunde seine Demütigung verkündeten. Letizia kannte Renatino und wusste, dass er hinter ihr her war. Er hatte nur einen einzigen Fehler gemacht, er hatte ein paar ihrer Fotos mit »Gefällt mir« kommentiert, nachdem sie ihn auf Facebook als Freund akzeptiert hatte – eine unverzeihliche Schuld in Nicolas’ Augen.
Nicolas stand vor ihrem Haus, geklingelt hatte er nicht. Nur Postboten, Wachleute, Polizisten, der Unfallwagen, Feuerwehrmänner und Fremde benutzen die Gegensprechanlage. Wenn du deine Freundin rufen willst, deine Mutter, deinen Vater, einen Freund oder die Nachbarin, die sich als Teil deines Lebens fühlen darf, schreist du. Alles steht offen, sperrangelweit, alles wird gehört, und wenn man nichts hört, ist das ein schlechtes Zeichen, dann ist etwas passiert. Von unten schrie Nicolas sich die Kehle aus dem Hals: »Letì! Letizia!« Das Fenster ihres Zimmers lag nicht zur Straße hin, es ging auf einen lichtlosen Schacht. Das Fenster zur Straße, das Nicolas sah, beleuchtete einen breiten Treppenabsatz, der Gemeinschaftsraum für mehrere Wohnungen. Wer gerade durchs Treppenhaus ging, hörte seine Rufe und klopfte an Letizias Wohnungstür, ohne zu warten, bis sie öffnete. Die Leute klopften und gingen weiter, das war der Code: »Man will was von dir.« Wenn Letizia aufmachte und niemanden im Hausflur sah, wusste sie, dass jemand auf der Straße nach ihr rief. Doch an diesem Tag schrie Nicolas so laut, dass sie ihn bis in ihr Zimmer hörte. Schließlich zeigte sie sich auf dem Treppenabsatz, wütend, und brüllte: »Du kannst abziehen. Ich geh nirgendwohin.«
»Los, komm runter, beweg dich.«
»Ich komm nicht runter …!«
In dieser Stadt läuft das so. Alle wissen, dass du Streit hast. Sie müssen es wissen. Jede Beleidigung, jede Stimme, jeder scharfe Ton hallt zwischen den Steinen der Gassen wider, die Zank zwischen Liebespaaren gewöhnt sind.
»Was hat Renatino dir überhaupt getan?«
Halb ungläubig, halb erfreut fragte Nicolas: »Also weißt du’s schon?«
Im Grunde reichte es ihm, dass seine Freundin Bescheid wusste. Die Heldentaten eines Kriegers gehen von Mund zu Mund, erregen Aufsehen und werden zur Legende. Er sah Letizia am Fenster und wusste, dass sein Bravourstück zwischen abgeblättertem Putz, Aluminiumfensterrahmen, Regenrinnen und Terrassen und weiter oben zwischen den Antennen und Satellitenschüsseln widerhallen und weitergetragen würde. Und während er Letizia betrachtete, wie sie über der Brüstung lehnte, die Haare nach dem Duschen noch lockiger als sonst, erhielt er eine Nachricht von Agostino. Eine dringende und rätselhafte Nachricht.
Damit endete der Wortwechsel. Letizia sah ihn auf den Motorroller steigen und mit quietschenden Reifen davonfahren. Ein Minotaurus, halb Mensch, halb Räder. Durch Neapel fahren heißt, alles überholen und überall durchkommen, Straßensperren, Einbahnstraßen, Fußgängerzonen gibt es nicht. Nicolas fuhr zu den anderen zum Nuovo Maharaja, dem Restaurant in Posillipo. Ein imponierendes Lokal mit einer großen Terrasse direkt über der Bucht. Diese Terrasse allein, die für Hochzeiten, Erstkommunionfeiern und Partys vermietet wurde, hätte genug Geld eingebracht. Seit seiner Kindheit faszinierte Nicolas dieses weiße Gebäude, das mitten über einem Felsen von Posillipo aufragte. Das Maharaja gefiel ihm, weil es so unverschämt protzig war. Es stand da wie auf die Klippen geschweißt, eine uneinnehmbare Festung, alles war weiß, die Fensterrahmen, die Türen, sogar die Rollläden. Majestätisch wie ein griechischer Tempel blickte es aufs Meer, mit seinen schneeweißen Säulen, die direkt aus dem Wasser aufzuragen schienen und ebenjenen breiten Balkon trugen, über den, so stellte sich Nicolas vor, die Männer schlenderten, von denen er einer werden wollte.
Nicolas war mit dem Maharaja aufgewachsen, so oft war er daran vorbeigegangen, hatte die Scharen von Motorrädern und Autos betrachtet, die Frauen, die Männer, ihre Eleganz und den zur Schau gestellten Reichtum bewundert und sich geschworen, dass er um jeden Preis dort hineinkommen werde. Das war sein Ehrgeiz, ein Traum, mit dem er seine Freunde angesteckt hatte, sodass sie ihm irgendwann den Spitznamen »Maraja« verpassten. Dort eintreten, nicht als Kellner, auch nicht, weil jemand dir einen Gefallen tut – »du kannst eine Runde drehen und dann Abmarsch« –, nein, er und die anderen wollten Gäste sein, möglichst diejenigen, denen der größte Respekt entgegengebracht wurde. Wie viele Jahre würde er brauchen, fragte sich Nicolas, bis er sich erlauben konnte, dort drinnen den Abend und die Nacht zu verbringen? Was würde er tun müssen, um das zu erreichen?
Die Zeit ist noch Zeit, wenn du von etwas träumen kannst, dir zum Beispiel vorstellst, dass du, wenn du zehn Jahre lang sparst oder einen Wettbewerb gewinnst oder ein bisschen Glück hast oder alles dransetzt, vielleicht … Aber das Gehalt von Nicolas’ Vater war das eines Sportlehrers, und seine Mutter hatte ein kleines Geschäft, eine Wäscherei. Die von seiner Familie vorgezeichneten Wege hätten eine unzumutbar lange Zeit erfordert, um ins Maharaja hineinzukommen. Nein. Nicolas musste es jetzt schaffen. Mit fünfzehn.
Und es war alles ganz einfach gewesen. Die wichtigen Entscheidungen, von denen es kein Zurück gibt, sind immer die einfacheren. Das Paradox in jeder Generation: Entscheidungen, die sich rückgängig machen lassen, sind gründlich überlegt, durchdacht, abgewogen. Unumkehrbare Entscheidungen verdanken sich einem plötzlichen Entschluss, werden durch eine instinktive Regung hervorgerufen und widerstandslos hingenommen. Nicolas tat das, was alle in seinem Alter taten: Nachmittage auf dem Moped vor der Schule, Selfies und die Sucht nach Sneakers – für ihn waren sie schon immer der Beweis, dass er mit beiden Beinen auf der Erde stand, ohne diese Schuhe hätte er sich nicht mal als ein menschliches Wesen gefühlt. Dann war es passiert: Vor ein paar Monaten, Ende September, hatte Agostino mit Copacabana geredet, einem wichtigen Mann des Striano-Clans von Forcella.
Copacabana war an Agostino herangetreten, weil er ein Verwandter war: Agostinos Vater war sein Brudercousin, ein Cousin ersten Grades.
Gleich nach der Schule war Agostino zu seinen Freunden gelaufen. Er kam mit krebsrotem Gesicht angerannt, ungefähr dieselbe rotglühende Farbe wie seine Haare. Von weitem sah es aus, als würde er vom Hals aufwärts brennen, nicht umsonst nannten sie ihn ’o Cerino, das »Streichholz«. Keuchend berichtete er alles, Wort für Wort. Diesen Moment sollten sie nie mehr vergessen.
»Kapiert ihr überhaupt, wer das ist?«
In Wirklichkeit hatten sie nur von ihm reden gehört.
»Co-pa-ca-ba-na!«, hatte er betont. »Capo vom Viertel, einer von den Striano. Sagt, er braucht Hilfe, guaglioni, Jungs, die in Ordnung sind. Und dass er gut zahlt.«
Keinen hatte die Nachricht sonderlich begeistert. Weder Nicolas noch die anderen der Gruppe sahen in dem Kriminellen den Helden, der er früher für die Jungen von der Straße gewesen war. Ihnen war völlig egal, wie man zu Geld kam, was zählte, war, Geld zu scheffeln und es zu zeigen, Autos zu haben, teure Klamotten und Uhren. Von Frauen begehrt und von Männern beneidet zu werden.
Nur Agostino wusste mehr von Copacabanas Geschichte. Sein Name rührte von einem Hotel, das er an einem Strand der Neuen Welt gekauft hatte. Eine brasilianische Frau, brasilianische Kinder, brasilianische Drogen. Groß gemacht hatte ihn der Eindruck, ja, die allgemeine Überzeugung, dass alle in sein Hotel kamen: von Maradona bis George Clooney, von Lady Gaga bis Drake, denn er postete Fotos mit ihnen auf Facebook. Geschickt nutzte er die Schönheit der Dinge, die ihm gehörten, um alle dorthin zu locken. Das hatte ihn zum Sichtbarsten unter den Mitgliedern einer Familie gemacht, die in großen Schwierigkeiten war, die Striano. Copacabana musste den Jungen nicht einmal ins Gesicht sehen, um zu beschließen, dass sie für ihn arbeiten konnten. Nach der Verhaftung von Don Feliciano Striano ’o Nobile war er jetzt seit fast drei Jahren der einzige übriggebliebene Capo von Forcella.
Aus dem Prozess gegen die Striano war er heil herausgekommen. Ein Großteil der Anklagen gegen die Organisation wurde erhoben, als er schon in Brasilien war, damit hatte er der Anklage auf Mitgliedschaft in einer mafiaartigen Vereinigung entgehen können, der gefährlichsten Anklage für Leute wie ihn. Es war die erste Instanz. Die Staatsanwaltschaft würde Berufung einlegen. Also stand Copacabana das Wasser bis zum Hals, er musste zeigen, dass er dem Schlag standgehalten hatte, und neu anfangen, neue Jungs finden, denen er einen Teil vom Geschäft anvertrauen konnte. Seine eigenen Leute, seine Paranza, die Capelloni, waren tüchtig, aber unberechenbar. So ist das, wenn man zu schnell zu weit nach oben kommt, oder wenigstens glaubt, dort angekommen zu sein. ’O White, ihr Anführer, hielt sie im Zaum, war aber ständig auf der Hut. Die Paranza der Capelloni konnte bloß schießen, einen neuen Umschlagplatz eröffnen konnte sie nicht. Für diesen Neuanfang brauchte er Material, das sich leichter formen ließ. Doch wer? Und wie viel Geld würden sie von ihm verlangen? Wie viel musste er zur Verfügung haben? Das Geschäft und das eigene Geld sind zwei Paar Schuhe: Geld zum Investieren ist das eine, Geld in der Tasche das andere. Wenn Copacabana nur einen Teil seines Hotels in Südamerika verkauft hätte, hätte er fünfzig Männer in seinem Sold haben können, aber es war sein eigenes Geld. Um ins Geschäft zu investieren, braucht man Geld vom Clan, und das fehlte. Forcella stand im Visier, Staatsanwälte, Fernsehtalkshows, sogar die Politik befassten sich mit dem Viertel. Ein schlechtes Zeichen. Copacabana musste alles wieder aufbauen, es gab keinen mehr, der das Geschäft in Forcella weiterführte. Die Organisation war zerschlagen.
Also war er zu Agostino gegangen und hatte ihm kurzerhand ein Päckchen Haschisch unter die Nase gehalten. Agostino stand vor der Schule, dort hatte Copacabana ihn gefragt: »Wie lange brauchst du, um so einen kleinen Ziegel loszuwerden?« Den Stoff loswerden war der erste Schritt auf dem Weg zum Pusher, obwohl man sich von ganz unten hocharbeiten musste, um diesen Titel zu verdienen. Den Stoff loswerden bedeutete, ihn an Freunde, Verwandte und Bekannte zu verkaufen. Die Verdienstspanne war sehr gering, aber es gab praktisch kein Risiko.
»Weiß nicht, ’n Monat?«, hatte Agostino hingeworfen.
»’n Monat? Der geht in einer Woche weg.«
Agostino war gerade alt genug fürs Moped, und dieses Alter interessierte Copacabana. »Bring mir alle deine Freunde, die bisschen was arbeiten wollen. Alle aus Forcella, die ich immer vor dem Lokal in Posillipo stehen seh. Ihr habt’s doch satt, nur so mit’m Finger im Arsch rumzustehn … oder was?«
So hatte alles angefangen. Copacabana bestellte sie in einen Palazzo am Eingang vom Viertel, doch er selbst zeigte sich dort nie. An seiner Stelle war immer ein Mann da, dem Worte schnell, Gedanken jedoch sehr langsam kamen, sie nannten ihn Alvaro, weil er dem Schauspieler Alvaro Vitali ähnelte. Er war um die fünfzig, sah aber viel älter aus. Alvaro war fast Analphabet und hatte mehr Jahre im Gefängnis als auf der Straße verbracht: in der Zeit von Cutolo und der Nuova Famiglia als blutjunger Mann im Knast, während der Fehde zwischen den Kartellen der Viertel Sanità und Forcella, den Mocerini und den Striano, im Knast. Er hatte Waffen versteckt, war Ausspäher gewesen. Lebte mit seiner Mutter in einem winzigen Loch im Erdgeschoss, hatte nie Karriere gemacht. Sie zahlten ihm einen Hungerlohn, und manchmal schenkten sie ihm eine slawische Prostituierte, dann schickte er seine Mutter zu den Nachbarn. Aber er war einer, dem Copacabana vertraute. Seinen Job machte er gut: Er fuhr ihn mit dem Auto herum, gab die Päckchen Shit selbständig an Agostino und die anderen Jungen weiter.
Alvaro hatte ihnen gezeigt, wo sie stehen mussten. Die Wohnung, wo der Stoff gebunkert wurde, lag im letzten Stock. Sie mussten unten am Eingang, im Torweg verkaufen. Hier gab es keine Gitter und Straßensperren wie im Scampia-Viertel, nichts von alledem. Copacabana wollte einen freieren, weniger abgeschirmten Verkauf.
Ihre Aufgabe war einfach. Kurz bevor das Kommen und Gehen begann, waren sie schon an Ort und Stelle, um die Stücke selbst mit dem Messer zurechtzuschneiden. Alvaro gesellte sich zu ihnen, schnitt ein paar Bröckchen und größere Stücke ab. Stücke zu zehn, fünfzehn, fünfzig Euro. Danach wurde der Stoff in die übliche Alufolie gewickelt, und sie hielten die Stücke griffbereit, das Gras steckten sie in Plastiktütchen. Die Kunden kamen mit dem Moped oder zu Fuß in den Torweg des Palazzo, zahlten und gingen wieder. Der Ablauf war sicher, denn das Viertel konnte sich auf die von Copacabana bezahlten Schmieresteher und viele andere Leute auf der Straße verlassen, die Polizisten, Carabinieri und Finanzpolizei in Zivil und in Uniform melden würden.
Sie verkauften nach der Schule, doch manchmal gingen sie gar nicht erst hin, zur Schule, denn sie wurden nach verkauften Stücken bezahlt. Diese fünfzig, hundert Euro in der Woche machten den Unterschied. Und hatten eine einzige Bestimmung: Foot Locker. Den Laden stürmten sie förmlich. Kamen im geschlossenen Block rein, als wollten sie ihn besetzen, und wenn sie drin waren, zerstreuten sie sich. Von den T-Shirts rissen sie zehn, fünfzehn Stück auf einmal aus den Regalen. ’O Tucano zog eins über das andere an. Just Do It. Adidas. Nike. Die Markenzeichen verschwanden und wurden sekundenschnell ersetzt. Nicolas hatte sich gleich drei Air Jordan genommen. Knöchelhoch, weiß, schwarz, rot, Hauptsache, sie waren von Michael, der mit nur einer Hand einen Slam Dunk warf. Auch Briatò hatte sich auf die Basketballschuhe gestürzt, er wollte sie in Grün mit Leuchtsohle, doch als er sie in die Hand nahm, hatte Lollipop ihn aufgehalten: »Grün? Bist du ’ne Scheißschwuchtel oder was!?«, und Briatò hatte sie wieder weggestellt, um sich auf die Baseballjacken zu stürzen. Die Yankees oder die Red Sox. Fünf von jeder Mannschaft.
Und so hatten nach und nach alle Jungen, die vor dem Nuovo Maharaja standen, angefangen, Stoff zu schieben. Dentino hatte versucht, sich rauszuhalten, das klappte ein paar Monate, dann verkaufte er ein bisschen auf der Baustelle, wo er arbeitete. Lollipop wurde den Stoff im Fitnesscenter los. Auch Briatò hatte angefangen, für Copacabana zu arbeiten, er hätte alles getan, was Nicolas von ihm verlangte. Der Markt war nicht mehr so riesig wie noch in den achtziger und neunziger Jahren: Das Viertel Secondigliano hatte alles an sich gerissen, dann war der Markt von Neapel nach Melito gewandert. Doch jetzt verschob er sich wieder ins Zentrum, in die Altstadt.
Jede Woche rief Alvaro sie zusammen und bezahlte sie. Wer mehr verkaufte, bekam mehr Geld. Sie schafften es fast immer, mit irgendeinem Deal außerhalb des Platzverkaufs etwas für sich abzuzweigen, indem sie kleine Brocken zerteilten oder irgendeinen reichen oder besonders dämlichen Freund reinlegten. Doch nicht in Forcella. Hier waren der Preis und die Menge festgelegt. Nicolas machte nur wenige Schichten, weil er auf Partys verkaufte und an die Schüler seines Vaters, doch erst mit der Besetzung der Schule, dem Liceo Artistico, hatte er angefangen, richtig gut zu verdienen. An alle hatte er Stoff verteilt. In den Klassenzimmern ohne Lehrer, in der Turnhalle, auf den Fluren, im Treppenhaus, auf den Klos. Überall. Und die Preise stiegen, je mehr Nächte in der Schule verbracht wurden. Lästig war nur, dass er sich auch die politischen Diskussionen anhören musste. Einmal hatte er sich geprügelt, weil er während einer Versammlung gesagt hatte: »Ich finde, Mussolini hatte es drauf, der war intelligent, aber eigentlich sind alle in Ordnung, die sich Respekt verschaffen. Auch Che Guevara gefällt mir.«
»Den Namen von Che Guevara darfst du nicht mal in den Mund nehmen.« Einer mit langen Haaren und offenem Hemd war auf ihn zugekommen. Sie waren aufeinander losgegangen, hatten sich angerempelt, aber Nicolas war dieses Reichensöhnchen aus der Via dei Mille völlig egal, der ging ja nicht mal auf seine Schule. Was wusste der von Respekt und Ernsthaftigkeit. Wenn du aus der Via dei Mille kommst, ist dir Respekt von Geburt an sicher. Wenn du aus dem armen Neapel kommst, musst du dir den Respekt erobern. Der Genosse redete von moralischen Kategorien, aber für Nicolas, der nur ein paar Fotos und Fernsehreportagen über Mussolini gesehen hatte, gab es so was überhaupt nicht, und er hatte ihm einen Kopfstoß auf die Nase verpasst, als wollte er damit sagen: So bring ich dir bei, Wichser, dass die Geschichte nicht existiert. Gerechte und Ungerechte, Gute und Böse. Alle gleich. Auf seiner Facebook-Pinnwand hatte Nicolas sie aufgereiht: den Duce, der aus einem Fenster schreit, den König der Gallier, der sich vor Cäsar verbeugt, Muhammad Ali, der seinen am Boden liegenden Gegner anbrüllt. Starke und Schwache. Der einzig wahre Unterschied. Und Nicolas wusste, auf welcher Seite er stehen musste.
Dort, auf seinem privaten Verkaufsplatz, hatte er Pesce Moscio, den »Schlappschwanz«, kennengelernt. Nicolas drehte sich gerade fette Tüten, und da war dieser Junge, der das Zauberwort kannte.
»Ey, hab dich vorm Nuovo Maharaja gesehen …!«
»Ja und?«
»Da häng ich auch manchmal ab.« Dann hatte er gesagt: »Hör mal diese Musik …!« Und hatte Nicolas, der bis zu dem Moment nur italienische Popmusik gehört hatte, in den härtesten amerikanischen Hiphop eingeführt, den richtig bösen, wo in dem ausgekotzten unverständlichen Wortbrei manchmal ein »Fuck« auftaucht, das für Ordnung sorgt.
Nicolas gefiel der Typ unheimlich gut, er war frech, behandelte ihn aber mit Respekt. Darum ließ er Pesce Moscio, der nach der Besetzung angefangen hatte, in seiner Schule Stoff zu verschieben, manchmal auch in ihrem Palazzo arbeiten, obwohl er nicht aus Forcella war.
Es war unvermeidlich, früher oder später mussten sie auffliegen. Ausgerechnet kurz vor Weihnachten gab es eine Razzia. Agostino hatte Schicht, Nicolas kam gerade an, um ihn abzuwechseln, und hatte nichts gemerkt. Die Falken waren schneller gewesen als der Ausspäher. Sie hatten ein Auto angehalten und so getan, als überprüften sie die Papiere, dann hatten sie sich auf die Jungen gestürzt, während die noch versuchten, den Stoff verschwinden zu lassen.
Die Polizei hatte Nicolas’ Vater benachrichtigt. Im Polizeipräsidium angekommen, blieb er vor seinem Sohn stehen und betrachtete ihn mit einem leeren Blick, der sich allmählich mit Wut füllte. Nicolas hielt lange die Augen gesenkt. Als er dann zu ihm aufschaute, ohne Demut im Blick, versetzte sein Vater ihm zwei Ohrfeigen, eine Vorhand und eine Rückhand, beide sehr kraftvoll, das war der alte Tennisspieler. Von Nicolas kam kein Ton, ihm stiegen nur zwei Tränen in die Augen, vor Schmerz, nicht vor Ärger.
Erst dann kam die Mutter wie eine Furie herein. Bei ihrem Erscheinen füllte sie die ganze Tür, die Arme ausgebreitet, die Hände gegen die Türpfosten gestemmt, als müsste sie die Polizeikaserne stützen. Ihr Mann trat zur Seite, um ihr die Bühne zu überlassen. Und die nahm sie sich. Sie ging auf Nicolas zu, langsam, mit dem Schritt eines wilden Tieres. Als sie so dicht vor ihm stand, dass sie ihn hätte umarmen können, zischte sie ihm ins Ohr: »Was für eine Schande.« Und: »Mit wem treibst du dich rum, mit wem?« Ihr Mann hörte es, ohne zu verstehen, und Nicolas wich mit einem so heftigen Ruck zurück, dass sein Vater sich wieder auf ihn stürzte und ihn gegen die Wand presste: »Guck ihn dir an. Den Dealer. Wie kommst du bloß auf so einen Scheiß?«
»Von wegen Dealer«, sagte die Mutter, während sie den Vater wegzog. »Eine Schande ist das!«
»Was glaubst du denn«, platzte Nicolas los, »wie mein Schrank ’n Schaufenster von Foot Locker geworden ist, hä? Weil ich samstags und sonntags an der Tankstelle arbeite?«
»So ein Idiot …! Wirst schon sehen, sie stecken dich ins Gefängnis«, sagte die Mutter.
»Ins Gefängnis? Was quatschst du da von Gefängnis?« Darauf verpasste sie ihm eine Ohrfeige, schwächer als die des Vaters, aber entschiedener, schallender.
»Halt’s Maul. Jedenfalls gehst du nicht mehr aus dem Haus, nur noch unter Bewachung«, sagte sie, und dann zu ihrem Mann: »Den Dealer gibt’s nicht, verstanden? Den gibt’s nicht, und den wird’s nicht geben. Jetzt regeln wir die Sache hier, und dann ab nach Hause.«
»So eine gottverdammte Scheiße …!«, brummte der Vater noch. »Jetzt muss ich auch noch einen Anwalt bezahlen!«
Von seinen Eltern wie von zwei Carabinieri eskortiert, kehrte Nicolas nach Hause zurück. Der Blick seines Vaters war nach vorn gerichtet, auf diejenigen, die sie empfangen würden: Letizia und Christian, der jüngere Bruder. Sie sollten den Mistkerl sehen, ihm direkt ins Gesicht schauen. Seine Mutter aber, die neben Nicolas ging, hielt die Augen am Boden.
Kaum hatte er seinen Bruder erblickt, schaltete Christian den Fernseher aus, sprang auf und überwand den Abstand zwischen Sofa und Tür mit drei großen Schritten, um ihn zu begrüßen, wie sie es in Filmen gesehen hatten – Hände geben, Arm umfassen und dann Schulter gegen Schulter, wie zwei Brò, zwei Gangsta-Brüder. Doch als der Vater das Kinn hob, erstarrte Christian. Nicolas musste sich zusammenreißen, um nicht zu lachen vor seinem Bruder, dessen Idol er war, aber er wusste, dass er genug zu erzählen hatte, um Christians Neugier noch am Abend in ihrem Zimmer zu befriedigen. Sie würden bis tief in die Nacht reden, und dann würde Nicolas ihm die Stoppelhaare reiben, wie er es immer tat, bevor er ihm gute Nacht sagte.
Auch Letizia hätte ihn gern umarmt, aber nur, um ihn zu fragen: »Was war denn los? Warum denn?« Sie wusste, dass Nicolas Stoff verschob, und der Anhänger, den sie zum Geburtstag bekommen hatte, hatte ihn sicher einiges gekostet, aber sie hätte nicht gedacht, dass die Situation so ernst war, obwohl sie in Wirklichkeit gar nicht so ernst war.
Am nächsten Tag verbrachte sie den Nachmittag damit, ihm die Lippen und Wangen mit Nivea einzureiben. »Damit schwillt alles ab«, sagte sie. Solche Zärtlichkeiten schweißten sie schon seit einiger Zeit zusammen. Er hätte sie gerne verschlungen, sagte: »Ich fühl mich wie dieser Vampir in Twilight!«, doch ihre Jungfräulichkeit war zu wichtig. Er akzeptierte, dass sie alles entschied, also aßen sie sich an Küssen satt, an strategischen Reibetechniken, hörten stundenlang Musik, ein Kopfhörer zu zweit, jeder mit einem Stöpsel im Ohr.
Nach dem Verhör im Polizeipräsidium kamen sie alle auf freien Fuß, wurden nach Hause geschickt, sogar Agostino, der während seiner Schicht in flagranti erwischt worden war und riskierte, dass er den Kürzeren zog. Sie brachten Tage damit zu, sich zu erinnern, was sie sich in den Chats geschrieben hatten, denn alle Handys waren beschlagnahmt worden. Am Ende fiel die Entscheidung leicht: Alvaro würde die Schuld auf sich nehmen. Copacabana sorgte dafür, dass jemand Alvaro verpfiff, und die Carabinieri fanden die ganze Ware in seiner Wohnung. Er übernahm auch die Verantwortung dafür, dass er den Jungen den Stoff gegeben hatte. Als Copacabana ihm mitteilte, dass er in den Knast gehen würde, sagte er: »Was …?! Schon wieder? So ’n Mist!« Das war alles. Zum Ausgleich würde er eine monatliche Entschädigung bekommen, Peanuts, tausend Euro. Und bevor er nach Poggioreale ging, eine Rumänin. Aber die wollte er heiraten, das wünschte er sich. Und Copacabana sagte nur: »Mal sehn, was sich machen lässt.«
Unterdessen besorgten sie sich neue Smartphones für ein paar Euro, geklaute Ware, um wenigstens die Gruppe wieder zusammenzubringen. Sie verpflichteten sich, nichts von dem, was passiert war, in dem Chat zu schreiben, den sie neu eröffnet hatten, vor allem einen Gedanken nicht, der allen im Kopf rumging, den aber nur Stavodicendo in Worte fassen konnte: »Leute, früher oder später sind wir reif für Nisida. Wär vielleicht sogar besser, da zu landen.«
Jeder von ihnen hatte sich mindestens einmal die Fahrt mit dem Polizeitransporter in die Jugendstrafanstalt ausgemalt. Die Brücke überqueren, die die kleine Insel mit dem Festland verband. Reinkommen und ein Jahr später verändert wieder rauskommen. Bereit. Zum Mann geworden.
Für manche war das etwas, was einfach getan werden musste, also ließen sie sich bei einer kleineren Straftat erwischen. Zeit gab es sowieso noch genug, wenn man wieder draußen war.
In der schwierigen Situation damals aber hatten die Jungen sich zusammengerissen, hatten dichtgehalten, und wie es schien, hatte man aus den Chats nichts Beweiskräftiges herausholen können. Darum wurden Nicolas und Agostino von Copacabana endlich ins Nuovo Maharaja eingeladen. Aber Nicolas wollte noch mehr, er wollte dem Capo des Viertels vorgestellt werden. Agostino hatte den Mut aufgebracht, Copacabana persönlich darum zu bitten. »Klar doch, meine Kinder will ich kennenlernen«, hatte der geantwortet. Und so waren Nicolas und Agostino in Begleitung von niemand Geringerem als Copacabana ins Nuovo Maharaja gekommen.
Nicolas sah ihn zum ersten Mal. Er hatte ihn sich alt vorgestellt, aber er sah einen Mann, der soeben die vierzig überschritten hatte. Im Auto, auf dem Weg zum Lokal, sagte Copacabana, wie zufrieden er mit ihrer Arbeit sei. Er behandelte sie wie seine Laufburschen, aber nicht ohne Freundlichkeit. Nicolas und Agostino ärgerten sich nicht darüber, sie hatten nichts anderes im Kopf als den Abend, der vor ihnen lag.
»Wie ist es? Wie ist es da drin?«, fragten sie.
»Eben ein Lokal«, antwortete er, aber sie wussten genau, wie es aussah, sie hatten auf YouTube Filme von Konzerten und Festen gesehen. Die beiden Jungen wollten wissen, wie es sich anfühlte, in der Welt des Nuovo Maharaja zu sein, dort einen eigenen Raum zu haben. Wie es war, zu dieser Welt zu gehören.
Copacabana ließ sie durch einen Privateingang gehen und führte sie in sein Separee. Sie hatten sich fein gemacht, hatten es ihren Eltern und Freunden angekündigt, als wären sie vor den wichtigsten Hofstaat geladen. In gewisser Weise war das richtig, das Neapel der Arrivierten, die Schickeria, alle Schönen und Reichen trafen sich hier. Das Lokal hätte eine Symphonie auf den Kitsch, ein Loblied auf den schlechten Geschmack sein können. Doch es hatte mit seinen pastellfarbenen Majoliken ein elegantes Gleichgewicht zwischen der besten Handwerkstradition der Küste und einem scherzhaften Zitat des Orients gefunden: sein Name Maharadscha, Nuovo Maharaja, rührte von einem riesigen Gemälde mitten im Lokal her, das aus Indien stammte. Ein Engländer, der dann nach Neapel gekommen war, hatte es gemalt. Der Bart, der Schnitt der Augen, die Seidenstoffe, der weiche Diwan, ein Schild, auf den Edelsteine und ein nach Norden zeigender Halbmond gemalt waren – fasziniert betrachtete Nicolas das große Bildnis des Maharadscha. Hier sollte sein Leben beginnen.
Den ganzen Abend hingen Nicolas’ und Agostinos Augen hingerissen an den Gästen, während im Hintergrund unablässig die Korken der Champagnerflaschen knallten. Alle kamen hierher. Es war der Ort, wo Unternehmer, Sportler, Notare, Anwälte und Richter den richtigen Tisch fanden, wo sie zusammensitzen, einander kennenlernen und sich zuprosten konnten. Ein Ort, wo man sich sofort himmelweit entfernt fühlte von der Stammkneipe, dem rustikalen Restaurant, Miesmuscheltellern und der Familienpizzeria, vom Lokal, das Freunde empfohlen hatten oder wo man mit der Ehefrau hinging. Ein Ort, wo man jeden treffen konnte, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen, denn hier war es, als wäre man sich zufällig auf der Piazza begegnet. Es war das Normalste von der Welt, im Nuovo Maharaja neue Bekanntschaften zu machen.
Copacabana redete pausenlos, und in Nicolas’ Kopf entstand ein klares Bild, das den Speisen und den aufgestylten Gästen ein klingendes Wort hinzufügte. Es war ein exotischer Lockruf: Lazarat.
Das albanische Gras war zur neuen Macht geworden. Copacabana hatte nämlich zwei Aktivitäten: eine legale in Rio und eine illegale in Tirana. »Musst mich mal mitnehmen«, sagte Agostino, während er sich vorbeugte, um nach dem x-ten Glas Wein zu greifen. »Die größte Plantage auf der Welt, guagliù. Gras, so weit das Auge reicht«, sagte Copacabana. Er meinte Lazarat, das zum Stützpunkt geworden war, weil man dort so viel Gras ernten konnte wie nirgendwo sonst. Copacabana erzählte, er habe große Mengen eingekauft, doch es war noch nicht klar, wie er das Zeug nach Italien bringen sollte, die See- und Luftwege aus Albanien waren nicht sicher. Die Ladungen mussten durch Montenegro, Kroatien und Slowenien bis ins Friaul gebracht werden. So wie er redete, klang das alles sehr verworren. Benommen von der blendenden Welt, die um ihn herumwirbelte, bekam Agostino von diesen Geschichten kaum etwas mit. Nicolas aber hätte endlos zuhören können.
Jede Ladung bedeutete eine Unmenge Geld, und wenn das zu einem reißenden Fluss wird, lässt es sich nicht mehr verstecken. Ein paar Wochen nach ihrem Abend im Nuovo Maharaja hatte die Antimafia-Behörde mit ihren Ermittlungen begonnen, alle Zeitungen berichteten darüber: Man hatte einen von Copacabanas Schmugglern geschnappt, und prompt war gegen ihn Haftbefehl ergangen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als unterzutauchen. Er verschwand, vielleicht nach Albanien, vielleicht konnte er sich nach Brasilien absetzen. Monatelang sahen sie ihn nicht mehr. Dem Umschlagplatz in Forcella ging der Nachschub aus.
Agostino hatte versucht, etwas herauszukriegen, aber das war unmöglich, weil Copacabana wer weiß wo war und Alvaro im Gefängnis saß.
»Die Paranza von ’o White hat trotzdem reichlich zu tun … Mir soll’n die Eier abfallen, wenn bei denen kein Stoff ankommt«, hatte Lollipop bemerkt.
Für Nicolas und seine Freunde war es zum Problem geworden, wo sie sich die Ware holen konnten, wie viel sie davon nehmen, wie sie verkaufen und welche Schichten sie machen sollten. Die Familien teilten die Verkaufsplätze der Stadt unter sich auf. Es war wie ein Stadtplan mit neuen Namen, und hinter jedem Namen stand eine Eroberung.
»Was machen wir jetzt?«, hatte Nicolas gefragt. Sie waren in ihrem Treffpunkt, einem Niemandsland, entstanden aus der Verbindung von Bar, Tabakladen, Spielhalle und Wettbüro, das sie Saletta nannten. Hier war jeder willkommen. Der eine schimpfte, den Kopf zu den Bildschirmen gereckt, über ein zu langsames Pferd, ein anderer saß auf einem Hocker und steckte die Nase in eine Tasse Kaffee, ein Dritter verspielte sein Gehalt an den Automaten. Außer Nicolas und seinen Freunden waren die Capelloni da. ’O White hatte gedrückt, er war eindeutig auf Kokain, das er nicht mehr schnupfte, sondern sich immer öfter spritzte. Er spielte am kleinen Billardtisch allein gegen zwei seiner Leute, Chicchirichì und ’o Selvaggio, dem »Wilden«. Wie von der Tarantel gestochen wechselte er andauernd den Queue. Redete ununterbrochen, achtete aber aufmerksam auf alles, auf jedes Wort, das zufällig an seine Ohren drang. Und das »Was machen wir jetzt?« von Nicolas hatte er aufgefangen.
»Wollt ihr ’n Job, Kinder …?«, hatte er gefragt, ohne mit seiner Hopserei aufzuhören. »Okay, dann macht ihr jetzt die Einspringer …! Ich schick euch, ihr arbeitet für paar andere Plätze, die Leute brauchen …«
Sie hatten ungern eingewilligt, aber sie hatten keine andere Wahl. Nach Copacabanas Abtritt von der Bühne war der Umschlaglatz von Forcella endgültig geschlossen.
So hatten sie angefangen, für alle zu arbeiten, die Löcher zu stopfen hatten. Verhaftete Marokkaner, Pusher mit Fieber, unzuverlässige guaglioni, die aussortiert worden waren. Sie arbeiteten für die Mocerino im Sanità, für die Pesacane vom Cavone-Viertel, und manchmal kamen sie bis nach Torre Annunziata, um den Vitiello zu helfen. Der Ort, an dem sie verkauften, wechselte ständig. Manchmal war es die Piazza Bellini, manchmal der Bahnhof. Sie wurden immer im letzten Moment gerufen, der ganze Camorra-Abschaum des Gebiets besaß ihre Handynummern. Nicolas verlor bald die Lust, er hatte nach und nach aufgehört, Stoff zu verschieben, und blieb öfter zu Hause. Alle, die älter waren als er, machten Geld, auch wenn sie Loser waren, Typen, die sich hatten erwischen lassen, die in Poggioreale ein und aus gingen – und ihnen hatte ’o White eine miese Arbeit ohne Perspektive verschafft.
Doch das Fähnchen des Schicksals begann sich zu drehen.
Wenigstens war das die Bedeutung der Botschaft, die Agostino an Nicolas geschickt hatte, als der, vor Letizias Haus stehend, gerade versuchte, ihr begreiflich zu machen, dass Renatinos Demütigung nichts anderes als ein Liebesbeweis gewesen war.
»Guagliù, Copacabana ist zurück«, sagte Agostino, als Nicolas mit seinem Moped neben dem von Briatò hielt. Sie standen mit laufenden Motoren an der letzten Straßenecke vorm Nuovo Maharaja. Auch von hier aus sah man das Restaurant, und geschlossen wirkte es sogar noch imposanter.
»So ein Idiot, sie kriegen ihn garantiert«, sagte Briatò.
»Nein, Copacabana ist zurück wegen ’ner ernsten Sache.«
»Ja, wir soll’n seinen Stoff verkaufen!«, sagte Briatò und sah Agostino grinsend an. Sein erstes Lächeln an diesem Tag.
»Nee! Ernste Sache … ich schwör, er kommt zurück, um die Hochzeit von Micione zu organisieren, der heiratet nämlich Viola Striano!«
»Kein Scheiß …?«, fragte Nicolas.
»Ja!« Und damit es keinen Zweifel gab, fügte er hinzu, wenn das gelogen sei, solle seine Mutter tot umfallen: »Adda murì mammà!«
»Dann haben die von San Giovanni hier bei uns das Sagen …«
»Was hat das damit zu tun?«, entgegnete Agostino. »Copacabana ist hier und will uns sehen.«
»Wo denn?«
»Hier, hab ich doch gesagt, und jetzt sofort …« Er zeigte auf das Lokal. »Die andern kommen auch gleich.«
Das war der Moment, um sein Leben zu ändern. Nicolas wusste es, er hatte gespürt, dass die Gelegenheit kommen würde. Und jetzt war sie da. Man antwortet, wenn man gerufen wird. Bei den Starken muss man stark sein. In Wirklichkeit hatte er keine Ahnung, was passieren würde, aber er hatte so seine Vorstellungen.
Böse Gedanken
Copacabana saß in einem mit Besen und Putzmitteln vollgestopften Fiorino, der auf dem Platz vor dem Lokal parkte. Er stieg sofort aus, als man ihm sagte, die Jungen seien angekommen. Zur Begrüßung kniff er ihnen in die Wangen wie Kleinkindern, und sie ließen ihn gewähren. Dieser Mann konnte sie wieder groß ins Geschäft bringen, obwohl er abgemagert und blass war, die Haare lang, der Bart verfilzt. Das Weiß seiner Augen war rot von geplatzten Gefäßen. Das Leben im Versteck schien keine Vergnügungsreise gewesen zu sein. »Da sind ja meine Kleinen … also, guagliù, bleibt dicht hinter mir, ihr müsst Eindruck machen … alles andre besorge ich.«
Copacabana umarmte Oscar, der im Nuovo Maharaja das Sagen hatte. Der Vater seines Vaters hatte es vor fünfzig Jahren gekauft. Oscar war ein Fettwanst, der maßgeschneiderte Hemden mit aufgestickten Initialen liebte, aber er trug konsequent immer eine Nummer zu klein, darum sah man die Knöpfe in den Knopflöchern ächzen. Verlegen erwiderte Oscar die Begrüßung, fast hielt er Copacabana auf Distanz, damit diese Umarmung nicht von den Falschen gesehen wurde.
»Ich werde dir eine große Ehre erweisen, mein lieber Oscar …«
»Worum geht’s?«
»Diego Faella und Viola Striano werden ihre Hochzeit bei dir feiern … hier …«, und er breitete die Arme aus, um das ganze Lokal in seine Umarmung einzuschließen, als gehörte es ihm.
Schon als Oscar die beiden Nachnamen in einem Satz verbunden hörte, lief sein Gesicht rot an.
»Copacabana, ich mag dich, aber …«
»Das ist nicht die Antwort, die ich erwartet habe …«
»Ich bin mit allen gut Freund, das weißt du, aber als Inhaber dieses Lokals … es ist unsere Politik, uns fernzuhalten von …«
»Von was?«
»Von komplizierten Situationen.«
»Aber das Geld von komplizierten Situationen, das nehmt ihr.«
»Wir nehmen Geld von allen, aber so eine Hochzeit …« Er beendete den Satz nicht, das war nicht nötig.
»Warum lehnst du einen so ehrenvollen Auftrag ab?«, fragte Copacabana. »Kannst du dir vorstellen, wie viele Hochzeiten daraus für dich folgen?«
»Und dann bauen sie mir hier Wanzen ein.«
»Quatsch, was denn für Wanzen? Außerdem werden die Kellner nicht deine Leute sein, hier sind die Jungs, die das machen.«
Agostino, Nicolas, Pesce Moscio, Briatò, Lollipop, Dentino und die anderen hatten nicht erwartet, dass sie kellnern sollten, das konnten sie gar nicht, so was hatten sie noch nie gemacht. Aber wenn Copacabana das beschlossen hatte, würde es so sein.
»Ach ja, Oscar, vielleicht hast du nicht verstanden, dass du von ihnen zweihunderttausend Euro bar auf die Kralle kriegst … für diese Hochzeit, dies schöne Fest.«
»Weißt du, Copacabana … ich verzichte sogar auf das viele Geld, aber für uns ist es wirklich …«
Copacabana machte eine Handbewegung, als würde er die Luft vor seinem Gesicht mit dem Handrücken wegwedeln, hier war nichts mehr zu machen. »Hier sind wir fertig.« Tödlich beleidigt ging er aus dem Zimmer. Die Jungen folgten ihm wie hungrige Welpen der Mutter.
Nicolas und die anderen waren sicher, dass das nur ein Bluff war, dass er noch wütender als vorher zurückkehren würde, mit noch röteren Augen, und Oscar das Gesicht zu Brei schlagen oder eine wer weiß wo versteckte Pistole ziehen würde, um ihm das Knie zu zerschmettern. Nichts davon geschah. Er stieg wieder in den Fiorino. Durchs Fenster sagte er: »Ich lasse euch rufen. Wir werden diese Hochzeit in Sorrento feiern. Servieren werden nur eigene Jungs, keine Kellner über eine Agentur, die schickt uns sofort die Finanzpolizei auf den Hals.«
Copacabana fuhr nach Sorrento und organisierte die Hochzeitsfeier der beiden königlichen Familien. »Die machen eine galaktische Hochzeit an der Küste, aber unsere wird noch viel schöner!!!«, schrieb Nicolas an Letizia, die wegen der Sache mit Renatino immer noch sauer auf ihn war und eine Stunde später antwortete: »Wer sagt denn, dass ich dich heirate?« Nicolas war davon fest überzeugt. Die geplante Zeremonie brachte ihn zum Träumen und trieb ihn dazu, andauernd neue Nachrichten zu schreiben, ausgeschmückt mit immer prächtigeren Details und voller Hoffnung. Sie hatten aus Liebe zueinandergefunden, aus keinem anderen Grund, und alles andere musste er sich jetzt holen, angefangen beim Dienstboteneingang der Welt, die zählte, wenigstens im Moment noch, denn sie war dem Untergang geweiht.
Feliciano Striano saß im Gefängnis. Sein Bruder saß im Gefängnis. Seine Tochter hatte beschlossen, Diego Faella zu heiraten, ’o Micione, den »fetten Kater«. Die Faella aus dem Viertel San Giovanni a Teduccio waren führend im Geschäft mit Schutzgelderpressung, Baugewerbe, Wählerstimmen und Lebensmittelvertrieb. Ihr Markt war riesig. Ihnen gehörten die Duty-free-Läden in den osteuropäischen Flughäfen. Diego Faella war unerbittlich streng, alle mussten zahlen, sogar Kioskbesitzer und Straßenverkäufer, alle zahlten in die Kassen des Clans, natürlich jeder nach seinem Verdienst, darum fühlte Micione sich als ein großherziger, ja sogar liebenswerter Mensch. Viola, der Tochter von Feliciano Striano, war es gelungen, viele Jahre lang weit weg von Neapel zu leben, sie hatte studiert und einen Abschluss in Modedesign gemacht. Viola war nicht ihr richtiger Name, sie nannte sich so, weil sie den Namen Addolorata, den sie von ihrer Großmutter geerbt hatte, unerträglich fand und seine akzeptablere Version, Dolores, schon im Besitz zahlloser Cousinen war. Also hatte sie sich selbst einen Namen ausgesucht. Sie war fast noch ein Kind, da war sie zu ihrer Mutter gegangen und hatte ihren neuen Namen verkündet: Viola. Nach Neapel war sie zurückgekehrt, weil ihre Mutter sich von Violas Vater trennen wollte. Don Feliciano hatte sich eine neue Frau gesucht, doch Violas Mutter hatte nicht in die Scheidung eingewilligt – eine Ehe ist und bleibt eine Ehe –, und Viola war gekommen, um sie in den Tagen der Trennung zu unterstützen. Das Haus der Familie in Forcella hatte ihre Mutter nicht verlassen, Don Feliciano dagegen war ins Nachbarhaus gezogen. Die Familie ist heilig, und für Viola war sie das noch mehr, für sie war die Familie die DNA, die man in sich trägt, und das Blut kann man sich schließlich nicht aus den Adern reißen, oder? Damit wird man geboren, damit stirbt man. Doch dann hatte Don Feliciano beschlossen, als Kronzeuge für die Polizei zu arbeiten, und da hatte sie sich von ihrem Vater scheiden lassen. Der Name Addolorata Striano war sofort ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen worden. Als die Carabinieri in Zivil bei ihr vorfuhren, um sie mit einem gepanzerten Wagen abzuholen und so weit wie möglich von Forcella wegzubringen, veranstaltete sie auf dem Balkon ein Schauspiel. Sie tobte, schrie, bespuckte und verfluchte die Eskorte: »Verschwindet! Gottlose Dreckskerle, korrupte Verräter! Mein Vater ist tot, nein, es hat ihn nie gegeben, er war nie mein Vater! Haut ab!« So hatte sie das Zeugenschutzprogramm verweigert und nie bereut, ihren Vater und ihre Onkel verleugnet zu haben. Lange Zeit war sie nicht aus dem Haus gegangen, hatte Kleider, Handtaschen und Schmuck entworfen, während Beleidigungen jeder Art auf ihren Balkon prasselten: Tüten mit Hundescheiße, tote Vögel, Eingeweide von Tauben. Dann Brandflaschen, die die Gardinen in Brand setzten, Schmierereien auf Hauswänden, die angesengte Gegensprechanlage. Niemand hatte ihr geglaubt, aber sie hatte durchgehalten. Bis zu dem Tag, an dem Micione in ihr Leben getreten war. Indem er Viola heiratete, befreite Diego Faella sie auf einen Schlag von allen Anschuldigungen, die sie in einen Käfig gesperrt hatten. Und er selbst bekam, indem er sich das gesunde Blut der Familie nahm, Forcella.
Man erzählte, dass Micione sie lange umworben hatte. Viola hatte einen wohlgeformten Körper, die strahlend blauen Augen ihres Vaters und eine bedeutsame Nase. Lange hatte sie gegrübelt, ob sie sich die Nase richten lassen oder so behalten sollte, bis sie zu der Überzeugung kam, dass genau diese Nase ihr Monogramm war. Viola war eine der Frauen, die alles wissen, was um sie herum vor sich geht, deren Grundprinzip aber ist, so zu tun, als wüssten sie von nichts. Die Ehe zwischen den beiden bedeutete die Verschmelzung zweier bedeutender Familien. Es sah ganz nach einer arrangierten Hochzeit aus, wie beim Adel. Denn im Grunde waren sie die Blüte der Camorra-Aristokratie und gebärdeten sich genauso wie die Dynastien, die die Boulevardblätter füllen. Vielleicht opferte sich Viola, Micione aber schien ernsthaft verliebt. Viele waren überzeugt, dass der entscheidende Schachzug für ihr Jawort gewesen war, sie zur Designerin in einem vom Clan der Faella kontrollierten Betrieb zu machen, der Luxushandtaschen herstellte. Doch wen kümmern Klatschgeschichten, für Viola sollte diese Hochzeit der Triumph der Liebe sein. Sie hatte sich selbst einen Namen ausgesucht, sie durfte auch entscheiden, wie ihre Zukunft aussehen sollte.
Wenige Tage später kam der Anruf, wie Copacabana angekündigt hatte. Nicolas sagte es seiner Mutter:
»Ich geh als Kellner bei einer Hochzeit arbeiten. Mach ich wirklich.«
Seine Mutter musterte seine Miene unter den leicht gewellten blonden Haaren, die ihm wirr in die Stirn fielen. Sie suchte in diesem Satz und im Gesichtsausdruck ihres Sohnes das, was sie wusste und was sie nicht wusste, das, was wahr sein konnte und was nicht wahr sein konnte. Die Tür zu seinem Zimmer stand offen, und sie kam an mit diesem Blick, der nach Zeichen sucht: an den Wänden, auf einem alten Rucksack am Boden oder auf den Shirts, die am Fußende des Bettes aufgestapelt lagen. Sie versuchte, die Nachricht (»Ich geh als Kellner arbeiten«) über die Schranken zu stellen, die ihr Sohn pausenlos errichtete, seit man sie ins Polizeipräsidium bestellt hatte. Wenn er nicht im Jugendgefängnis Nisida gelandet war, lag das sicher nicht daran, dass er unschuldig war, das wusste sie. Was Nicolas unternahm, kam bei ihr an, und was nicht bei ihr ankam, konnte sie sich leicht vorstellen, anders als ihr Mann, der in diesem Sohn Zukunft sah, die gute Zukunft, und sich darum nur wegen seines schlechten Benehmens Sorgen machte. Die Mutter aber hatte Augen, die durchs Fleisch drangen. Sie scheuchte den Verdacht in den hintersten Winkel ihres Herzens zurück und drückte Nicolas an sich. »Bravo, Nicolas!« Er wehrte sich nicht, da legte sie den Kopf auf seine Schulter und überließ sich ihren Gefühlen wie noch nie zuvor. Schloss die Augen und sog Luft ein, um diesen Sohn zu riechen, den sie verloren geglaubt hatte, der aber jetzt mit einer Ankündigung zurückkehrte, die den Geschmack der Normalität trug. Das genügte ihr, um zu hoffen, dass ab hier alles neu beginnen könnte. Nicolas erwiderte ihre Umarmung, wie es sich gehörte, aber nicht fest, er legte nur seine Hände auf ihren Rücken. Hoffentlich fängt sie nicht an zu weinen, dachte er, Zuneigung mit Schwäche verwechselnd.
Sie lösten sich voneinander, und die Mutter ließ nicht zu, dass Nicolas sich wieder in seinem Zimmer einschloss. Sie musterten sich schweigend, abwartend, was als Nächstes geschah. Für Nicolas war diese Umarmung eine von denen, die Mütter austeilen, wenn ihre Söhne als Diener arbeiten, wenn sie irgendetwas tun, was immer noch besser ist als gar nichts. Sie dachte, dass er ihr ein kleines Trostpflaster gewährt hatte, sie dank einer merkwürdigen Form von Großzügigkeit mit ein bisschen Normalität belohnt hatte. Von wegen Normalität! Der Junge hat Gedanken im Kopf, die mir Angst machen. Sehe ich sie etwa nicht, diese Gedanken? Einen nach dem anderen, böse, schlechte Gedanken, als müsste er sich für ein Unrecht rächen. Aber es hatte kein Unrecht gegeben. Was denn für ein Unrecht? Ihrem Mann konnte sie diese Gedanken nicht sagen. Ihm nicht, nein. In der offenen, fragenden Miene seiner Mutter ahnte Nicolas dieses Suchen, dieses planlose Sicheinmischen, dieses Hinken zwischen Wissen und Verdacht. »Hättest du nicht gedacht, was, Mama? Ich mach jetzt Kellner.« Und er spielte, wie er einen Teller auf dem Unterarm balancierte. Er brachte sie zum Lachen, im Grunde hatte sie es verdient. »Warum habe ich einen blonden Jungen gekriegt?«, sagte sie, das Murren in ihrem Inneren abwehrend. »Warum habe ich wohl einen so schönen Jungen geboren?«
»Hast ’n schönen Kellner hingekriegt, Mama.« Und er drehte ihr den Rücken zu, aber er hatte das Gefühl, dass ihr Blick noch immer auf ihm lag, und so war es.
Filomena, Mena, Nicolas’ Mutter, hatte eine Wäscherei mit Heißmangel aufgemacht, in der Via Toledo, Richtung Piazza Dante, zwischen der Basilika Spirito Santo und der Via Forno Vecchio.