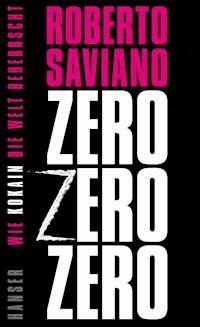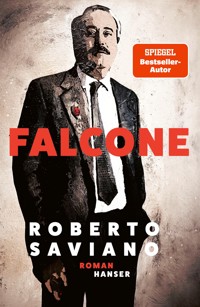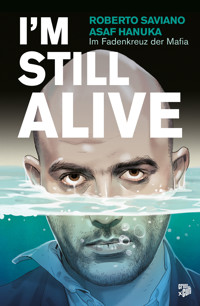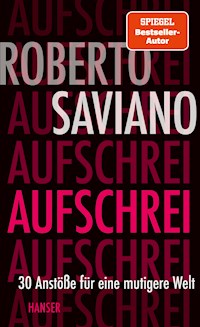Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Roberto Saviano wirft einen völlig neuen Blick auf die Mafia – und erzählt die bisher unbekannte Geschichte der Frauen
Erstmals ein Buch über die Rolle der Frauen in der Mafia – Roberto Saviano zeigt, wie die Strukturen und Werte des organisierten Verbrechens das Liebes- und Familienleben bestimmen. Packend erzählt „Treue“ von realen Frauen in der Mafia: beispielsweise von Maria Grazia Conte, deren heimlicher Sohn mit einem Mafiaboss ihr zum Verhängnis wird. Von Vincenzina Marchese, durch deren erzwungene Heirat der Frieden zwischen zwei rivalisierenden Mafiafamilien besiegelt werden soll. Und von Anna Carrino, die die Geschäfte ihres Mannes übernimmt, während er im Gefängnis sitzt – bis sie von seiner heimlichen Geliebten erfährt und auspackt. Saviano gibt einmalige Einblicke in weibliche Schicksale in der männlich dominierten Welt der Mafia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Roberto Saviano wirft einen völlig neuen Blick auf die Mafia — und erzählt die bisher unbekannte Geschichte der FrauenErstmals ein Buch über die Rolle der Frauen in der Mafia — Roberto Saviano zeigt, wie die Strukturen und Werte des organisierten Verbrechens das Liebes- und Familienleben bestimmen. Packend erzählt »Treue« von realen Frauen in der Mafia: beispielsweise von Maria Grazia Conte, deren heimlicher Sohn mit einem Mafiaboss ihr zum Verhängnis wird. Von Vincenzina Marchese, durch deren erzwungene Heirat der Frieden zwischen zwei rivalisierenden Mafiafamilien besiegelt werden soll. Und von Anna Carrino, die die Geschäfte ihres Mannes übernimmt, während er im Gefängnis sitzt — bis sie von seiner heimlichen Geliebten erfährt und auspackt. Saviano gibt einmalige Einblicke in weibliche Schicksale in der männlich dominierten Welt der Mafia.
Roberto Saviano
Treue
Liebe, Begehren und Verrat — die Frauen in der Mafia
Aus dem Italienischen von Anna Leube und Wolf Leube
Hanser
Für Michela, weil ich ihr alle diese Geschichten zum ersten Mal am Tisch des Cambio ganz hinten links in der Ecke erzählt habe. Weil wir immer noch an diesem Tisch zusammensitzen.
Prolog
Der Typ heißt Lou, arbeitet bei einem Steuerberater, und das gibt einem zu denken, denn er hat es nicht so mit dem Steuerzahlen und auch nicht mit dem Zählen von Geld. Zumindest nicht, was sein eigenes angeht. Hundert Dollar sind ihm geblieben, an sich gar nicht wenig, aber wenn man die Einsätze des Abends bedenkt, schon. Am Tisch wird hoch gepokert. Es ist das Spiel, das sich Lou allwöchentlich mit den Freunden gönnt und das auf seine Wochenendpartien in den Sälen von Atlantic City, wo das Glücksspiel legal ist, folgt.
Alle haben begriffen, dass Lou krank ist. Jetzt begreifen sie, in welchem Ausmaß.
Der Abend hatte gut angefangen, das Glück hatte sich in die richtige Richtung geneigt, nämlich auf die Seite von Lou. Dann ging es bergab, und er verlor am laufenden Band.
Er kaut an seinem Fingernagel, und ab und zu beißt er ein Stück ab, sodass der Nagel noch ein wenig kürzer wird. Bald wird er ihn bis zum Fleisch abgenagt haben. Lou täte gut daran, an einem anderen Finger als dem Zeigefinger zu kauen, aber den Daumennagel hat er bei den vorhergehenden Spielen aufgebraucht, genauso wie sein Geld. Natürlich könnte er auch am Mittelfinger kauen, doch er will vermeiden, dass seine Kumpel ihn dabei beobachten, wie er den langen Finger in den Mund steckt. Da er mit der anderen Hand die Karten hält, bleibt ihm nichts anderes übrig, als den Ringfinger zu nehmen. Und das macht er auch. Aber es ist trotzdem lächerlich. Es sieht so aus, als wolle er die Geste des Telefonierens nachahmen. Er ist offensichtlich am Ende. Und aus Mitleid steht einer der Anwesenden auf und sagt: »Letzte Hand, okay?« Die anderen nicken. Widerstrebend nickt auch Lou: »Letzte Hand.«
Der Spieler, der ihm gegenübersitzt, teilt die Karten aus. Lou deckt sie vorsichtig auf, was er sieht, gefällt ihm. Als erfahrener Spieler kann er ein Lächeln unterdrücken sowie die Begeisterung, als er sagt: »Bedient.« Er hat drei Damen und zwei Buben. Ein Full House. Das ist göttliche Vorsehung. Vielleicht schafft er es, mit genauso viel Geld nach Hause zu kommen, wie er hatte, als er sich an den Tisch gesetzt hat. Oder, wenn einer dumm genug ist zu erhöhen, vielleicht sogar ein hübsches Sümmchen einzustecken. Er wirft seine letzten hundert Dollar auf den Tisch.
Der Erste, der passt, steht auf. Die beiden anderen sind offenbar ziemlich dämlich. Einer sagt: »Lass sehen.« Es ist ein Gebrauchtwagenhändler aus Belleville, New Jersey. Er ist nicht reich, aber es fehlt ihm an nichts. Der andere muss jedoch ein Vollidiot sein, denn er erhöht um fünfhundert Dollar. Er ist einer der DeCavalcante-Jungs, seine Verbindung zur Mafia muss ihm zu Kopf gestiegen sein, er will zeigen, wer den Größeren hat. Sein Problem. Lous Problem ist hingegen, dass er die fünfhundert Dollar nicht hat.
Mit den DeCavalcante-Jungs treibt man keine Spielchen. Das weiß Lou, hin und wieder macht er Gelegenheitsjobs für sie, kümmert sich um die Buchhaltung, gibt ihnen Finanztipps, wäscht manchmal Geld. Aber nie mehr als das, denn sie wissen, mit wem er verwandt ist. Einer mit solchen Verwandten kann niemals ein Ehrenmann werden. Na ja, und wenn schon.
Die anderen schauen ihn an und warten darauf, zu hören, dass er am Arsch ist. Auch der Autohändler hat seine fünfhundert Dollar gesetzt. Was nun? Lass gut sein, Lou, denken sie, geh nach Hause, morgen ist ein neuer Tag, vielleicht hast du da mehr Glück. Aber Lou hat nicht die geringste Lust, auf diese Weise zu verlieren, mit diesem Full House auf der Hand, bloß weil ihm die Kohle ausgegangen ist.
Er nagt weiter an seinem Ringfinger. Eigentlich will er das nicht, er weiß, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, aber er kann es einfach nicht lassen. Er muss sich auf etwas anderes konzentrieren als auf die Gesichter der beiden Halunken.
»Mach schon, Lou. Wir haben nicht die ganze Nacht Zeit. Hast du das Geld oder hast du es nicht? Wenn du es nicht hast« — dabei sehen sie sich an —, »machen nur wir beide weiter.«
»Ich hab’s.«
»Und wo zum Teufel ist es?«
»Warte.«
»Ich warte keinen beschissenen Moment länger«, sagt der DeCavalcante-Typ. »Zwei Minuten, und ich hole mir den ganzen Einsatz.«
»Nur die Ruhe«, sagt der Autohändler. »Notfalls spielen wir beide allein weiter.« Der andere zuckt mit den Schultern.
Zwei Minuten, um in den Taschen zu kramen und nachzusehen, ob da noch etwas herauskommt. Lou nimmt den Finger aus dem Mund, greift in seine Hosentasche und fingert seine Brieftasche heraus.
»Was willst du denn da finden? Los, machen wir Schluss.«
»Kümmre dich um deinen eigenen Scheiß.« Lou öffnet das lederne Portemonnaie, das jetzt so krumm und dünn wie ein Zehennagel ist, und kramt darin. Der DeCavalcante-Typ schlägt mit der Hand auf den Tisch, der leicht bebt. Dann schnaubt er verärgert und schüttelt den Kopf. »Was willst du ausspielen, die Karte des Wein- & Spirituosengeschäfts?« Lou sagt nichts und stochert mit den Fingern in den Fächern des Portemonnaies.
Etwas in seinem Gesichtsausdruck hat sich verändert. Er hat eine Idee. Vielleicht ist nicht alles verloren. Vielleicht hat er noch eine Karte auszuspielen, einen Chip auf den Tisch zu werfen. Oder vielleicht ist es auch nur, wie der Typ sagt, die Punktekarte des Spirituosengeschäfts.
Die Jungs sehen sich an: Vielleicht hat er ein paar große Scheine gefunden, und sie haben sich geirrt. Nein, ausgeschlossen. Dann hätte er sie schon längst herausgeholt. Lou ist schnell, und er zeigt auch Leidenschaft, wenn er dabei ist, ins Verderben zu stürzen. Geld hat er keines mehr. Er war ein Mann mit tausend Ressourcen, neunhundertneunundneunzig davon hat er verbrannt. Aber was er noch besitzt, wollen alle, die hier am Tisch sitzen. Lou weiß das. Es ist sein kleiner Schatz. Sein letzter Trumpf ist das Foto seiner Frau. Er nimmt es aus seiner Brieftasche und wirft es auf den Tisch, als wäre es ein Hundertdollarschein, nicht mehr und nicht weniger. Ich werde um sie spielen. Wollen doch sehen, ob es da noch etwas zu lachen gibt.
Die Jungs verstummen. Sie werfen sich fragende Blicke zu. Sie wollen sicher sein, dass sie ihn richtig verstanden haben.
Sie haben sehr wohl verstanden. Sie sehen sich wieder die Karten an, die sie in der Hand halten. Mit seiner Frau als Spieleinsatz wird dieser verdammte Kerl vielleicht einen Flush haben, gar einen Royal Flush. Aber nein, das kann nicht sein. Er hätte sich viel entschlossener gezeigt. Er hätte nicht so lange gezögert und sich nicht die Nägel bis aufs Fleisch abgekaut. Er hat sich Zeit gelassen, zu kalkulieren, und wer kalkulieren muss, steht nicht ganz oben, absolut nicht. Also … entweder ist er ein Meister des Bluffs, oder … er ist völlig am Arsch.
»Und?« Jetzt ist es Lou, der sie bedrängt. Jetzt ist es er, der den Griff des Messers in der Hand hat. »Also, was ist jetzt?«
Schweigen.
»Nehmt ihr an oder nicht?« Die beiden anderen sehen sich noch einmal an, reichen sich das Foto, ihre derben, schmutzigen Pfoten hinterlassen auf dem Gesicht der jungen Frau Fingerabdrücke. Sie mustern sie genau und taxieren ihren Wert in puncto sexueller Befriedigung. Der Autohändler seufzt und nickt zustimmend. Der DeCavalcante-Mann macht Anstalten, die Karten auszuspielen. Doch einen Moment später hebt er die Hand.
»Alle beide«, und zeigt dabei auf sich und den Autohändler.
»Was?« Lou tut so, als würde er nicht verstehen. Er spürt einen kleinen Stoß, als hätten sie unter dem Tisch einen Schubs mit dem Knie ausgetauscht.
»Alle beide«, wiederholt der Typ.
Er will ihn demütigen. Sie verstehen es, sich zu amüsieren, diese Jungs der DeCavalcante-Familie. Ihre Gelüste und ihre Launen, denen sie in den Hinterzimmern ihrer Lokale frönen. Die Demütigung ist Teil des Spiels, egal ob es um Männer, Frauen oder sonst wen geht. Es ist Teil ihres sexuellen Vergnügens.
Wäre er bei klarem Verstand, wäre Lou schon längst nach Hause gegangen. Stattdessen ist er hier und setzt die Würde seiner Frau aufs Spiel im Bann eines Fiebers, das er nicht zu dämpfen vermag. Sie bluffen. Das ist bloß eine Strategie, um ihm den Einsatz zu klauen. Sie wissen, dass sie am Arsch sind, und wollen ihn zwingen aufzugeben. Von wegen!
Lou spielt seine drei Damen aus. Dann, nach einem spannungsgeladenen Moment, legt er die beiden Buben dazu. Der Typ aus Belleville seufzt erneut, diesmal noch lauter. Er ist sichtlich in Schwierigkeiten.
»Tut mir leid.« Er deckt seinen Royal Flush auf. Lou plumpst das Herz in die Hose.
»Mir auch, Mann.« Der DeCavalcante-Typ deckt seine Karten auf, er hat ein Full House mit Königen, auch sein Blatt gewinnt gegen das von Lou.
Der hat jetzt ein großes Problem. Und seine Frau zwei.
Sie ist schon lange im Bett, als sie hört, wie sich der Schlüssel im Schloss dreht. Sie schläft sofort wieder ein. Als Lou das Zimmer betritt, hört er sie schnarchen.
»He …« Er berührt ihre Schulter. Sie seufzt. »He«, versucht er es noch einmal. Sie seufzt noch lauter und wendet sich ihrem Mann zu.
»Was ist denn los?«, grummelt sie. »Was …« Durch die halb geschlossenen Augenlider erkennt sie zwei Schatten hinter ihm und sieht, dass er nicht allein ist. Sie reibt sich die Augen und setzt sich erschrocken auf.
»Schatz …«, sagt ihr Mann. »Diese beiden …« Jetzt reißt sie die Augen auf und sieht einen der beiden Männer in ihrem Schlafzimmer. Sie bemerkt die Pistole, die in seinem Hosenbund steckt.
»Was ist hier los, Lou?«
»Ich …«, stammelt ihr Mann. »Ich … habe eine Wette verloren …« Sie sagt nichts. Sie hat schon verstanden, was er mit Wette meint: Er hat wohl schon wieder beim Poker verloren. Sie hatten vereinbart, dass er nur noch am Wochenende in Atlantic City spielen würde, dort und sonst nirgends, keine Partien mehr mit den Freunden. Offensichtlich hat er sich nicht an die Abmachung gehalten.
»Was wollen die?«
»Dich …«
»Was?«
»Wenn du nicht mit ihnen schläfst, bringen sie mich um.« Entgeistert starrt sie die beiden Männer an. Der Autohändler zögert, blickt zu Boden, dann schaut er wieder hoch, entschlossen, den Blick nicht mehr zu senken. Der andere, der aus der DeCavalcante-Familie, zeigt nicht einmal die geringste Andeutung von Verlegenheit. Er ist hergekommen, um sich seinen Gewinn abzuholen. Und bei Spielschulden weiß man ja, wie das läuft. Da wird nicht lang gefackelt.
Im Schlafzimmer wird es still. Keiner spricht mehr ein Wort. Äußerst langsam, mit einer mechanischen Bewegung schlägt Lous Frau die Decke zurück.
Die beiden lösen ihren Gewinn ein. Bis zum Morgen, als Lou verstört und halluzinierend auf das Bett fällt und einschläft. Seine Frau nicht. Sie kann es nicht und wird es auch lange, lange Zeit nicht können. Während Lou schläft, verlässt sie das Haus, geht in ein Schnellrestaurant und bittet darum, telefonieren zu dürfen.
Sal Romano und Pino D’Aquana kennen sich seit ihrer Kindheit, als sie in den Gassen von Catania Fußball spielten. Ihre Familien kennen sich schon seit einem halben Jahrhundert. Beide sind gemeinsam in die USA emigriert. Das war in den Sechzigerjahren. Danach verloren sie sich aus den Augen, und jeder hat sich ein Leben aufgebaut. Oder besser gesagt: Jeder ging seinen eigenen Weg, und deshalb haben sie sich aus den Augen verloren. Pino ist ein hohes Tier bei der italo-amerikanischen Mafia, er lebt in New York. Sal ist ein Bulle, er arbeitet in Newark, New Jersey. In den letzten zwanzig Jahren hätten sie sich begegnen können: In der italienischen Community braucht es nicht viel, um an diesen oder jenen heranzukommen. Sie hätten sich leicht treffen können, haben es aber nie getan, und der Grund dafür ist verständlich. Meinungsverschiedenheiten. Wenn Sal eines Tages zu Pino geht, dann bestimmt nicht, um ihm einen Kaffee zu spendieren. Wenn umgekehrt Pino irgendwann Sals Büro betreten wird, dann höchstwahrscheinlich in Handschellen.
Sal kam in die Staaten zusammen mit seiner Schwester, auch sie ein anständiges Mädchen. Sie heiratete einen Typ namens Lou, der in einer Steuerkanzlei arbeitet und dem Laster des Pokerspiels verfallen ist. Es ist früh am Morgen, als bei Sal das Telefon klingelt. Er hebt den Hörer ab und hört seine Schwester weinen, schreien. Er redet ihr gut zu, sie soll sich beruhigen und ihm erklären, was geschehen ist. Sie schildert es ihm, Sal hört ihr zu, zähneknirschend. Wenige Minuten später versucht er, sich mit Pino D’Aquana in Verbindung zu setzen. Und natürlich geht es nicht darum, ihm einen Kaffee zu spendieren, sondern um fünftausend Dollar.
Am späten Vormittag kommt Sal in Pinos Restaurant. Die Sonne steht hoch am Himmel. Pino sitzt, entgegen seiner üblichen Vorsicht, draußen an einem Tischchen, das Gesicht mit einem seligen Lächeln der Sonne zugewandt. Als er Sal kommen sieht, steht er auf und umarmt ihn herzlich, sie küssen sich zweimal, klopfen sich auf die Schultern. Pino schiebt einen Stuhl beiseite und fordert Sal auf, Platz zu nehmen. Dann lässt er von einem seiner Kellner eine Flasche Wein und zwei Gläser bringen. Es ist kein Problem, wenn man sie, ihn und Sal, beisammen sieht. Sie müssen sich sogar zusammen zeigen. Pino D’Aquana ist keiner, der sich mit der Polizei anlegt. Sal Romano ist ganz in Ordnung, ein alter Freund von ihm, das ist alles. Er ist wohl gekommen, um sich Geld von ihm zu leihen. Ehrliche Bullen verdienen kaum etwas und sind immer pleite, das ist nichts Neues.
»Du erinnerst dich doch an meine Schwester?«, fragt ihn Sal. Pinos Miene verwandelt sich. Er begreift, dass sein früherer Freund nicht an Geld interessiert ist, versteht aber immer noch nicht den Grund seines Besuchs.
»Natürlich erinnere ich mich an sie! Wie geht es der Kleinen, grüß sie von mir, ja?«
»Mach ich. Aber es geht ihr nicht besonders gut.«
»Was meinst du damit? Deine Familie liegt mir am Herzen, ich würde alles für sie tun, das weißt du doch, oder?«
»Ich weiß, und ich danke dir. Genau darüber wollte ich mit dir sprechen. Also, meine Schwester hat einen Kerl geheiratet, einen Vollidioten, einen Buchhalter. Folgendes ist passiert«, und er erzählt ihm alles, genau wie sie es ihm geschildert hat, jedes Detail, auch vom Abkommen zwischen seiner Schwester und diesem Deppen von einem Ehemann, demgemäß er ausschließlich am Wochenende in Atlantic City Poker spielen durfte. Er berichtet ihm von allen Schwierigkeiten, in die der Schwager geraten ist, von all dem Geld, das er am Pokertisch verbrannt hat. Und er erzählt ihm von der vergangenen Nacht. Von den beiden, die sie in ihrem Haus vergewaltigt haben, und zwar bis in die Morgenstunden und auf Geheiß von Lou. Während er spricht, muss Sal mehrmals trinken, denn seine Hände zittern, er verhaspelt sich, seine Kiefer sind verkrampft.
Pino hört sich das alles an, dann spuckt er voller Verachtung auf den Boden.
»Solche Männer gehören unter die Erde«, sagt er.
Sal atmet tief durch und nickt. Dem stimmt er zu. Deshalb ist er überhaupt zu ihm gegangen, nachdem sie sich zwanzig Jahre lang nicht gesehen haben. Pino weiß es, er hat es kapiert, sobald Sal angefangen hat, zu erzählen. Aber er kann nichts weiter dazu sagen. Sal muss seine Bitte präzisieren, damit sie sich einigen können. Sie starren sich eine Weile an, trinken noch ein Glas Wein. Das Schweigen wird peinlich. Sal wartet darauf, dass Pino eine Lösung vorschlägt, aber Pino, der eine Lösung hat, wartet darauf, dass Sal seine Wünsche offiziell äußert. Der stumme Wettstreit dauert endlos. Dann hebt Sal den Blick und fixiert seinen Freund.
»Pino, unsere beiden Familien kennen sich schon seit einer Ewigkeit, du bist ein Freund von uns, und wir haben dich immer gemocht. Ich bitte dich, hilf uns, die Sache zu regeln. Lou muss weg. Du bist der Einzige, dem ich vertraue. Hilfst du uns?«
Pino runzelt die Stirn, tut so, als würde er einen Moment darüber nachdenken. Dann reicht er ihm die Hand.
»Natürlich helfe ich dir. Bei den Gräbern unserer Eltern verspreche ich dir, dass alles erledigt wird. Du darfst mit niemandem mehr darüber sprechen, nicht einmal erzählen, dass wir uns getroffen haben. Du weißt nichts von dieser Angelegenheit, klar? Die Familie D’Aquana kümmert sich darum. Jetzt verabschieden wir uns lieber.« Der Polizist beugt sich über den Tisch, führt Pinos Hand an die Lippen und küsst seinen Ring. Mit glänzenden Augen steht er auf. Er muss schnell weg, er möchte nicht, dass so ein hartgesottener Typ wie Pino ihn weinen sieht wie ein Weib.
»Das ist ein Geschenk der Familie Romano«, sagt Sal und fingert einen Umschlag mit fünftausend Dollar aus seiner Tasche, legt ihn auf den Tisch. »Zum Zeichen der Dankbarkeit.«
»Wenn es so weit ist«, sagt Pino, »ruf ich dich an. Ich lass dich wissen, wo und wann. Überlass alles mir, mein Freund.« Pino geht in sein Restaurant, Sal zur Polizeiwache zurück.
Pino D’Aquana und Sal Romano sind seit eh und je befreundet, das steht fest. Ihre Familien waren schon immer befreundet, und auch das steht fest. Aber der Boss hätte einen solchen Auftrag nicht angenommen, ohne zuvor die Lage sorgfältig einzuschätzen. Er weiß genau, wer Lou ist, womit er zu tun hat, welche Geheimnisse er kennt. Und er weiß, dass ein Mann, der bereit ist, seine Frau beim Poker aufs Spiel zu setzen, das Gleiche mit den geheimen Geschäften der Familie tun kann, mit ihren Geschäftsbüchern, ihren Girokonten. Dies ist eine günstige Zeit für die amerikanischen Familien. Es herrscht Frieden zwischen den Mafia-Clans. Man setzt auf Kooperation. Und so kooperiert auch Pino D’Aquana.
Kaum zurück im Restaurant, öffnet er eine hinter einem Möbelstück verborgene Tür und betritt den Raum unter der Treppe, wo sich sein privates Büro mit einem riesigen Schreibtisch aus dunklem Holz und einem Ledersessel befindet. Er greift zum Telefon und wählt die Nummer von Giuseppe Mirabile, einem Mann der Gambino. Er schildert ihm die Situation. Der Job ist schlecht bezahlt, fünf Riesen, um diesen Typ zu erledigen, sind mickrig, aber immerhin nutzt er der Familie. Unter dem Strich geht es darum, ein Risiko zu beseitigen. Mirabile ist einverstanden: Von den fünftausend gehen tausend an ihn als Provision, viertausend an den Killer. Mit Lou wird sich ein gewisser Luigi befassen, der das Handwerk versteht und dauernd Geld braucht. Er wird sich mit den viertausend begnügen.
Tags darauf trifft sich der Killer mit Giuseppe Mirabile und Sal Romano in Mirabiles Club in der Achtzehnten Avenue in Bensonhorst. Sie lassen sich abseits in einer dunklen Ecke nieder, damit Sal sich Zeit nehmen kann, alles genau zu erklären. Er erklärt auch, warum er sich, obwohl er in New Jersey arbeitet, an die New Yorker Mafia gewandt hat: Er will nicht, dass die Mafia von New Jersey danach hinter ihm her ist. So einfach ist das. Außerdem würde es ein Riesenschlamassel geben, wenn einer ihrer Leute gefasst würde. Aber Pino D’Aquana … der ist ein langjähriger Freund. Bei Pino hat er keine Angst, dass der ihn verraten könnte. Er schildert ihm die Geschichte, die er Pino bereits erzählt hat, von Lous Spielsucht und jener verhängnisvollen Nacht, in der zuerst er, dann seine Frau ihre Würde verloren haben. Er nennt ihm alle Einzelheiten, die Adresse des Hauses, in dem Lou mit seiner Schwester wohnt, die Adresse seines Arbeitsplatzes, das Auto, das er fährt, die Zeiten, zu denen er ungefähr unterwegs ist.
New Jersey ist nicht New York, Luigi kennt sich dort kaum aus. Er braucht etliche Ortsbegehungen, um herauszufinden, wie die Dinge liegen, um keine Überraschungen zu erleben. Lou wohnt in einem kleinen Einfamilienhaus unweit vom Garden State Parkway, der Straße nach Atlantic City. Die Wohnhäuser sind weit voneinander entfernt. Die Straße ist auf beiden Seiten von Bäumen gesäumt. Es ist eine ruhige Gegend mit wenig Verkehr, Bäume und Büsche bieten guten Sichtschutz.
Eines Morgens folgt Luigi Lou zu dessen Büro in Newark. Sofort ist ihm klar, dass er dort den Auftrag nicht erledigen kann: ein belebter Ort voller Polizisten, überall Menschen. Das kommt nicht infrage. Es sind Leute wie Pino D’Aquana, Giuseppe Mirabile, die Gambino-Familie mit im Spiel, da darf es keine Fehler geben. Sein Plan sieht stattdessen vor, Lou frühmorgens vor seinem Haus zu töten, aber gerade weil es eine so ruhige Straße ist, muss Luigi aufpassen, dass er die Nachbarn nicht aufweckt.
Die Gelegenheit bietet sich um sieben Uhr morgens. Der Killer wartet im Auto vor Lous Haus, als dieser herauskommt und zu seinem Auto geht, in der Hand ein paar Gerätschaften, darunter eine Angel. Er hat nicht die Absicht, zur Arbeit zu gehen: Er geht angeln. Umso besser. Luigi steigt aus, bückt sich und geht langsam zum Heck des Fahrzeugs, wo er sich hinter dem Kotflügel hervorlehnt. Lou geht inzwischen um seinen Wagen herum, öffnet den Kofferraum, um den Kasten mit dem Angelzubehör und die Angelrute zu verstauen.
Es handelt sich nicht um eine Exekution im herkömmlichen Stil, bei der sich der Killer von hinten an das Opfer heranschleicht und abdrückt. Nein. Luigi ist ein Experte. Er will nicht von Nachbarn gesehen werden. Er hält sich von seiner Zielperson fern.
Auf der anderen Straßenseite stellt er einen Fuß auf den Kotflügel seines Wagens und zielt mit seiner Neun-Millimeter. Ein einziger Schuss. Er trifft Lou ins Genick.
Luigi hält einen Moment inne, ohne sich dem Körper zu nähern. Er muss nur sicherstellen, dass sich Lou in den folgenden Augenblicken nicht mehr bewegt. Das ist der Fall. Getroffen und erledigt.
Luigi steigt in sein Auto, lässt den Motor an und fährt auf dem Garden State Parkway Richtung Atlantic City. Unterwegs wirft er die Waffe in eine Mülltonne.
Ich sitze mit Joe Pistone an einem Tisch, als er irgendwann mit dieser Geschichte daherkommt. Joe höre ich immer besonders aufmerksam zu: Keiner weiß besser, wie die italo-amerikanischen Gangster ticken. Immerhin war er einer von ihnen, allerdings in falschem Gewand. Von 1976 bis 1982 schleuste er sich als Donnie Brasco in die Mafiafamilien Bonanno und Colombo ein. Das war die längste Undercover-Operation eines FBI-Agenten in der New Yorker Mafia. Er stand kurz davor, ein Ehrenmann zu werden. Er genoss das uneingeschränkte Vertrauen des Paten, und selbst als er enttarnt wurde und die von ihm gesammelten Beweise zu zweihundert Verurteilungen führten, konnten seine ehemaligen Kumpane nicht glauben, dass der gute Donnie in Wirklichkeit ein Cop war.
Auf ihn wurde ein Kopfgeld von einer halben Million Dollar ausgesetzt. Jemand wurde umgebracht, weil er ihm Glauben geschenkt hatte: Dominick Napolitano, genannt Sonny Black, der Capo der Bonanno-Familie. Zuerst schossen sie auf ihn, dann hackten sie ihm zur Strafe für seine Unvorsichtigkeit die Hände ab. Er hatte Joe bis zuletzt geglaubt. Als er erfuhr, dass der gute Donnie in Wirklichkeit ein Bulle war, hätte Sonny abhauen oder vielleicht Reue zeigen können, aber er tat es nicht. Ungläubig und schockiert ging er zum Komitee der Cosa Nostra und erklärte, es könne nicht sein, er habe mit diesem Mann gegessen und das Zimmer mit ihm geteilt, und nein, er sei kein Bulle, basta.
Aber natürlich war er ein Bulle. Und dazu ein guter.
Sonny Black kann man keine mangelnde Vorsicht vorwerfen. Für Donnie Brasco alias Joe Pistone ist die italo-amerikanische Mafia ein offenes Buch. Er kennt ihre Regeln, ihre Geschichte, ihre Mentalität. Sogar ihre Art, sich zu bewegen, ihre Ausdrucksweise, einfach alles. Ungeniert und souverän bedient er sich der Codes und des Repertoires der Mafia. Im Zuge des Undercover-Einsatzes war Donnie ein hundertprozentiger Mafioso. Durch und durch ein Gangster, bis auf jenes Detail, den FBI-Ausweis, den er in einem Schrank in seinem Privatbüro sorgfältig verwahrt hatte. Jeder wäre auf ihn hereingefallen.
Wenn also Donnie, alias Joe, spricht, muss man ihm genau zuhören. Seine Geschichten sind Gold wert.
Er erzählt mir von diesem spielsüchtigen Mann, diesem nur halbwegs tüchtigen Typ, der nie ein affiliato war, nie richtig dazugehört hat und der, wenn er wirklich nichts mehr auf den Tisch zu legen hat, in seine Brieftasche greift, darin herumkramt und ein Foto seiner Frau herauszieht. Er erzählt mir, dass die Frau mit ihrem Bruder darüber spricht und dass er, der Ehemann, am Ende ins Gras beißt. Warum, das braucht er mir nicht zu erklären. Ich kann es mir denken.
Manch einer mag das Ende sogar befriedigend finden. Was war er denn, dieser Lou, wenn nicht ein Feigling der übelsten Sorte? Wer, wenn nicht Lou, hätte ein solches Ende verdient? Folglich geschieht ihm die exemplarische Bestrafung recht. Allerdings ist der Unterschied zwischen dem von Lou verübten Vergehen und dem über ihn verhängten Todesurteil nicht allzu groß. Dahinter steckt die gleiche Logik, die gleiche Denkweise. Beides ist sehr konsequent, wenngleich absurd. Ist es so weit gekommen, dass man seine Frau verkauft, kann man jeden verkaufen, auch seine Kumpane, den Boss, die ganze Familie, die Bankgeheimnisse. Dann ist man nicht mehr vertrauenswürdig. Man könnte sagen, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zerrüttet ist, und in diesen Fällen gibt es keine Gewerkschaft, keinen Arbeitsrichter, die Streitigkeiten schlichten könnten, sondern es gelten die Regeln der Mafia.
Die Schlüsselfigur ist natürlich nicht die Frau, die Ehefrau, die wie eine Ware gehandelt wird und wie ein Autoschlüssel, eine Uhr, ein Zwanzig-Dollar-Schein beim Pokern auf den Tisch geworfen wird, sondern immer und überall der Gangster, der Familienvater. Lou wird nicht für das, was er der Frau angetan hat, bestraft: Bestraft wird er für seine offenbare Unzuverlässigkeit. Weil er zur Gefahr geworden ist. Weil er zum Verräter werden könnte. Lou, der sich mit dem Rücken zur Wand sieht, reagiert, indem er seinen Gläubigern sagt: »Wenn ihr mich verschont, gebe ich euch meine Hausschlüssel, lasse ich euch in mein Haus, lasse ich euch in meine Frau.« Wie hätte er sich gegenüber einem Polizisten verhalten, der erdrückende Beweise gegen ihn gehabt hätte? Oder gegenüber dem Capo einer rivalisierenden Familie, der mit einem Handkoffer voller Geld, mit einem verlockenden Jobangebot oder dem Versprechen auf einen Aufstieg an die Spitze des Clans vor ihm gestanden hätte?
Ich habe diesem Buch die Geschichte von Lou vorangestellt, weil sie einerseits eine plastische Darstellung bietet, eine deutliche Inszenierung dessen, wer was auf der Werteskala der Mafia darstellt, und weil sie andererseits dank einer einzelnen Skizze ein facettenreiches Bild davon zeichnet, wie die Mafia mit dem Gefühlsleben, dem Romantischen, der Sexualität umgeht, um die Grenzen der Macht zu definieren, Kontrolle auszuüben, Nachfolgeregelungen zu ersinnen, neue Allianzen zu schmieden oder alte zu beenden. Wenn im Übrigen Sex Imperien geschaffen und zerstört hat, wäre es töricht, zu glauben, dies geschehe nicht auch im Mafia-Imperium. Für jeden, der wie ich in der westlichen Welt geboren und aufgewachsen ist, ist offenkundig, dass militärische und religiöse Macht das Wasserzeichen jeder geopolitischen Beziehung ist und dass beides sehr viel mit Sexualität und romantischen Beziehungen im Allgemeinen zu tun hat.
Nicht von ungefähr begrüßt es die Mafia, wenn ihre Mitglieder heiraten: Mann und Frau sind ein Prüfstein für die Mafiafamilie. Man verhält sich in der Familie so, wie man sich in der Großfamilie seiner Geschäftspartner verhält (und damit ist Gewalt akzeptabel, nicht aber Verrat); wer eine Familie hat, kann erpresst werden, wer eine Beziehung herkömmlicher Art hat, kann schon allein damit seine unbestreitbare Männlichkeit unter Beweis stellen, kann den Verdacht einer nichtbinären Sexualität zerstreuen, die vom Clan als Zeichen von Schwäche, als Hinweis auf Laster und Exzentrik betrachtet wird. Wer eine Familie hat, kann tagtäglich beweisen, dass er imstande ist, den Laden zu schmeißen, dass er als echter Mann die Situation im Griff hat, sich Respekt verschaffen kann und in der Lage ist, die Seinen zu schützen und neben dem Wohlstand möglichst Nachwuchs zu garantieren.
So wie die Familie zum Kontrollinstrument innerhalb der kriminellen Organisation wird — und zwar in doppelter Hinsicht, nämlich in Bezug auf das Handeln, aber auch auf das Weitergeben von Informationen —, so werden auch die romantische Beziehung selbst und auch der Sex ein Mittel zur Kontrolle. Warum sollte man auf ein so verdammt effizientes Instrument verzichten, wenn man es doch ausnutzen, sich seiner bedienen und es letztlich zu Geld machen kann? Und so werden in den Reihen der Mafiosi auf jeder Ebene und in jedem Winkel der Welt Männer und Frauen aufgrund sexueller Motive gefangen genommen, ermordet, verbannt, verstümmelt oder, umgekehrt, befördert, gekrönt, gefeiert.
Wilhelm Reich, einer der originellsten Denker des 20. Jahrhunderts und ein Schüler Freuds, schrieb in der Massenpsychologie des Faschismus: »Man untersucht die Geschichte der Sexualunterdrückung […] und findet, dass sie nicht am Beginn der Kulturentwicklung einsetzt, also nicht die Voraussetzung der Kulturbildung ist, sondern erst relativ spät sich mit dem autoritären Patriarchat und dem Beginn der Klassenteilung herauszubilden begann.« Die Unterdrückung der Sexualität und damit die Kontrolle darüber erscheinen uns daher als Instrument des Autoritarismus, als Voraussetzung für die Aufrechterhaltung einer starren Einteilung in soziale Klassen. Als Absicherung und Verteidigung des Status quo. Nach Reich ist die autoritäre Familie der erste entscheidende Ort der Reproduktion jeglicher reaktionären Mentalität, »sie ist zur Struktur- und Ideologiefabrik geworden«. In der Sexuellen Revolution stellt er fest, dass »die Zwangsmoral der ehelichen Pflicht und der familiären Autorität eine Moral von lebensängstlichen Feiglingen und Impotenten [ist], die nicht fähig sind, durch natürliche Liebeskraft zu erleben, was sie sich mit Hilfe der Polizei und des Eherechts vergebens zu verschaffen versuchen«.
Autoritäre Organisationen — allen voran die der Mafia — verfügen über eine mächtige Waffe, die biologische Waffe schlechthin. Die wunderbarste und zerstörerischste aller Waffen. Solide Fesseln, die den eigenen Leuten angelegt werden, um sie zu zügeln, zu knechten, zu vereinen oder zu spalten. Diese Fesseln fest in der Hand zu halten bedeutet, eine nachgerade göttliche Macht zu besitzen. Sie zu verlieren, sie aus der Hand zu geben bedeutet hingegen, keine Kontrolle mehr zu haben. Über den Clan, die Familie, über sich selbst.
Vergessen wir jegliche Spontaneität, jegliches Spiel oder zweckfreies Vergnügen, jegliche Leidenschaft. Vergessen wir komplett die Liebe, die jeden Anspruch auf Kontrolle zunichtemacht. Die Liebe ist reine Entropie, sie ist Unordnung, Chaos. Sie ist der Wind, der durch das Fenster hereinbraust, wenn der Croupier die Karten schon gemischt, seine Pläne zum maximalen Gewinn gemacht hat. Er kannte das Ergebnis schon im Voraus.
Die Liebe schert sich einen Dreck darum. Sie wirbelt die Karten nach Gutdünken durcheinander, kommt wie ein anarchischer Windstoß und wirft alles um.
Tritt man einer ’ndrina bei, dann lernt man, das Fenster zu schließen. Ist man in einer paranza, muss man gut aufpassen. Pasquale Condello, ein Oberboss der ’Ndrangheta, genannt ’u supremu, der Oberste, will, dass seine Tochter ein Mafiamitglied heiratet. Die Tatsache, dass sie einen anderen Mann liebt, spielt überhaupt keine Rolle. Condello ist unerbittlich: Man heiratet nie aus Liebe, die Vorstellung von einer Liebesheirat ist eine bürgerliche Tradition, die Mafia dagegen, nun ja … die Mafia ist aristokratisch. Und der Mafioso kann nicht wirklich lieben, zumindest nicht im Rahmen der Ehe. Er kann es sich nicht leisten. Er kann nicht zulassen, dass die Ehe, eine für die Kontrolle, die Bündnisse, die Nachkommenschaft so wichtige Institution, von den ungebärdigen Regungen des Herzens befleckt wird. Die beschwörenden Briefe seiner Frau Maria Morabitu an die anderen Mitglieder des Clans, die ’u supremu davon überzeugen sollen, seiner Tochter die Wahl ihres Bräutigams zu überlassen, führen zu nichts. Condello duldet keine Ausnahme von der Regel. Geheiratet wird mit dem Verstand, nicht mit dem Herzen. Und damit basta. Seine Tochter wird den Mann seiner Wahl heiraten.
In einem friedlichen sizilianischen Orangenhain oder in einer Vela in Scampia, an der blühenden Küste Latiums oder in einem Fertighaus vor den Toren von Mailand, im Getümmel von New York, von Nord nach Süd und von Ost nach West, von Italien nach Amerika über Breitengrade hinweg und an Meridianen entlang, in jedem denkbaren Winkel des kriminellen Universums gilt: Mit Liebe und Sex ist nicht zu spaßen.
Viele der Menschen, von denen ich berichten werde, haben dies zu ihrem Leidwesen erfahren müssen.
1
Das Laster ist weiblich
Dies ist eine Geschichte von Entdeckungen und Wiederannäherungen, eine Geschichte wiedergefundener Zuneigungen, von Abstammungslinien und verstreuten Verwandten, die sich eines Tages wundersamerweise wiederfinden, Umarmungen und gerührte Blicke tauschen. In gewisser Weise ist es eine beispielhafte Geschichte, da sie dem altbekannten, doch immer aufs Neue bewegenden Drehbuch vom Verlorenen Sohn folgt. Da in diesem Fall zum Sohn auch noch der wiedergefundene Bruder hinzukommt, werden die Regungen des Herzens noch verstärkt. Kurzum, es ist eine Geschichte voller Emotionen. Aber da eine Geschichte das natürliche Kind der Umstände ist, unter denen sie sich abspielt, und ihr Ausgang von ihren eigenen Protagonisten bestimmt wird, kulminieren die Gefühle, von denen ich erzählen will, in Verachtung und Groll. Weil der Schauplatz, auf dem sich die Geschichte abspielt, der der Camorra ist und ihr Regisseur einer der skrupellosesten und blutrünstigsten Bosse Kampaniens, sind ihre Elemente Wut, Grausamkeit, abscheulicher Wahnsinn, und die Abstammungslinien vereinen sich nicht nur, sondern werden zu einem scharlachroten See, der sich auf den Asphalt ergießt.
Die Geschichte der Familie der chiuovi, der Nägel, kennt jeder in Caserta und in weiten Teilen Kampaniens. Die Herkunft ihres Spitznamens verliert sich im Dunkel der Zeiten, und nicht einmal ihre heutigen Nachkommen sind sich über seinen genauen Ursprung sicher. Ihr berühmtester Vertreter, Augusto La Torre, der mittlerweile dreißig Jahre im Gefängnis verbracht hat, erzählt, dass einer seiner Vorfahren gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein paar Räuber, die seine Kutsche überfallen hatten, getötet und auf dem Dorfplatz an eine Wand genagelt habe. Die chiuovi, gewalttätige Männer, gedungene Mörder, terrorisierten viele Jahre lang das Umland von Caserta und besonders das Gebiet von Mondragone. Ein Bruder von Augustos Großvater war der erste Auftragsmörder, der in jener Gegend von sich reden machte, und brachte schon als Sechzehnjähriger einen Mondragoner Adligen aus dem Hause Cerqua für fünftausend Lire um, während ein anderer aus seiner Verwandtschaft sieben Menschen samt ihren sieben Pferden auf einmal tötete und zu dreißig Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Damit nicht genug, warf er während des Prozesses einen Schuh auf den Gerichtsvorsitzenden, was ihm eine zusätzliche Strafe von weiteren sechs Monaten einbrachte. Das ist keine zartbesaitete Familie. Die La Torre sind keine Männer, die sich von Blut beeindrucken lassen. Wenn es sich allerdings um ihr eigenes handelt, sehen die Dinge möglicherweise anders aus.
Vor Augusto war es sein Vater Tiberio, der auf diesem Stückchen Land, das für seinen exquisiten Mozzarella und seine Schwarzbauten bekannt ist, das Gesetz des Clans verordnete: ein donnaiolo, ein Schürzenjäger, wie er sich selbst bezeichnete. Einer, der aus seinen Affären kein Geheimnis machte, außer gegenüber Paolina Gravano, seiner rechtmäßigen Frau, die in ihn verliebt und sehr eifersüchtig war.
Ein donnaiolo, ein Frauenheld, ein Verführer zu sein ist für einen Camorrista ein klarer Beleg für seine Ausstrahlung: Es ist ein Beweis dafür, dass viele Frauen — und deshalb auch viele Männer — ihn als Mann und Anführer schätzen, es ist ein Ausweis seiner eigenen Größe. Charisma, sexuelle Potenz, ökonomische Leistung: Die Beziehung zur Geliebten spiegelt das Verhältnis zur gesamten kriminellen Gruppierung und zur eigenen Familie. Darin unterscheidet sich die Cosa Nostra von Corleone gewaltig von der Camorra. Ein donnaiolo ist ein unzuverlässiger Boss, der nicht imstande ist, einen Pakt einzuhalten. Der Camorrista hingegen muss Loyalität gegenüber seiner Familie beweisen, aber er muss auch zeigen, dass er das Leben kennt, es genießt und Erfahrung besitzt. Bei der Cosa Nostra ist der Beweis für die Vertrauenswürdigkeit die Loyalität des Bosses gegenüber seiner Frau, bei der Camorra gilt die umgekehrte Logik: Dem Boss, der mehrere Frauen hat, sind viele treu — er demonstriert damit seine Führerschaft.
Sogar der junge Augusto wusste von den Affären seines Vaters, hin und wieder bat Tiberio ihn sogar um Hilfe, um an diese oder jene Frau heranzukommen, als er ihm zum Beispiel vorschlug, für einen Zehntausend-Lire-Schein eine Flasche Champagner an den Tisch einer schönen Signora zu bringen mit der Botschaft, sein Vater lasse sie ihr überreichen. Oder wenn er, bevor er zu Paolina nach Hause ging, zu Augusto sagte, dass er angesichts möglicher Verdächtigungen immer leugnen müsse, selbst wenn der Tatbestand offensichtlich war. Fest steht, dass eines Tages, als der inzwischen erwachsene Augusto anstelle seines Vaters die Zügel des Clans in der Hand hatte, die Beweise für beider Augen dermaßen offensichtlich waren, dass sie kaum noch zu leugnen waren.
Wir schreiben das Jahr 1984. Ein Ehepaar, Mann und Frau, gehen praktisch mit einer Zielscheibe auf dem Rücken spazieren. Es handelt sich um Maria Grazia Conte und Franco Sorvillo, Unternehmer mit Verbindung zur Camorra, die in den Bereichen Gebrauchtwagen, öffentliche Aufträge, Betrug und Erpressung tätig sind. Sie müssen sterben, doch sie wissen es nicht: Sie werden beschuldigt, ein paar Busse in Brand gesteckt zu haben, die einem Cousin von Francesco Schiavone gehörten, der unter dem Namen Sandokan bekannt ist. Er ist unbestrittener Boss des Casalesi-Clans, der seinen Hauptsitz in der Gemeinde Casal di Principe in der Nähe von Caserta hat, dessen Einfluss aber in ganz Kampanien, im südlichen Latium und in vielen Ländern weltweit präsent ist. Das Todesurteil über Maria Grazia und Franco, die beide aus Mondragone stammen, wurde von den Bossen des Caserta-Clans gefällt, die sich aufgrund ihrer territorialen Zuständigkeit auf ihre Kollegen aus Mondragone verlassen müssen. An dieser Stelle kommt der Chef der chiuovi, Augusto La Torre, ins Spiel.
Für ihn sind Maria Grazia und Franco alte Bekannte. Franco war mehrmals zu Gast bei den La Torre, als Augusto noch ein kleiner Junge war, während Maria Grazia, so der Boss der chiuovi, aus anderen Gründen berüchtigt war: In seinen Erinnerungen beschreibt er sie als »lasterhafte Frau«, die »Tausende von sexuellen Abenteuern« hatte. Sie umzubringen wird kein Problem sein. Vor allem, weil sie überall über Sandokan herziehen, scheint es, als hätten sie nicht die geringste Angst vor ihm. Es ist ein bisschen so, als hätten sie sich ihr eigenes Grab geschaufelt. Allein diese Tatsache würde reichen, sie in den Sarg zu stoßen. Die in Brand gesteckten Busse sowie ein Erpressungsversuch sind nur eine weitere Beleidigung. In diesen Breitengraden zählt allein der Respekt, und Gerüchte verbreiten sich wie vom Wind verwehter Sand an den heißen Stränden des Litorale Domitio, wo traurige Wohnblocks und trostlose Monsterbauten unter Missachtung aller städtebaulichen Kriterien und Bauvorschriften die Küste säumen unter den verschlafenen, häufig komplizenhaften Blicken einer Politik, die nur Helfershelfer der kriminellen Macht ist. Nicht von ungefähr wird Mondragone eine der ersten italienischen Gemeinden sein, die 1991 wegen Unterwanderung durch die Mafia aufgelöst wird.
Wem es leichtfällt, kaltblütig zu morden, für den scheint alles ganz einfach zu sein. Alles wird bis ins kleinste Detail vorbereitet. Maria Grazia und Franco werden zu Alberto Beneduce gebeten, eine Einladung, die sie nicht ablehnen können. Beneduce hat den Beinamen ’a cocaina, weil er direkte Beziehungen zum kolumbianischen Medellín-Kartell unterhält. Es heißt, er verhandle persönlich mit Pablo Escobar über die Lieferungen des weißen Pulvers. Er ist bei den Casalesi für den Kokainhandel zuständig, und das macht ihn zu einem sehr mächtigen Mann: Wäre er bei Pirelli, würde er den Reifensektor leiten. Würde er bei Intel arbeiten, wäre er der Chefentwickler für Mikroprozessoren. Zwei wie Maria Grazia und Franco, die sich auf einer viel niedrigeren Ebene der Kriminalität bewegen, können sich durch die Einladung in Beneduces Haus nur geschmeichelt fühlen. Sie ahnen nicht, dass neben dem Hausherrn Antonio Iovine, genannt ’o ninno