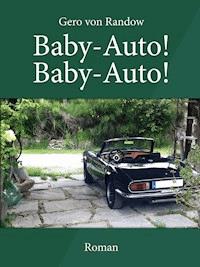Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition Körber-Stiftung
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ob Handy, Waschmaschine oder Auto: Ein Leben ohne Technik können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Sie hilft, sie macht Spaß - und treibt uns manchmal zur Weißglut... Der ZEIT-Redakteur Gero von Randow liefert ein geistreiches Porträt unseres Lebens im Takt der Technik: »Greifen Sie sich ein beliebiges Stück Technik heraus, und nach kürzester Zeit landen Sie bei nichttechnischen Themen.« Blinder Technikoptimismus liegt ihm ebenso fern wie düsterer Pessimismus: Wir alle leben mit Maschinen und technischen Errungenschaften, oft weit bequemer und sicherer als früher, zugleich aber auch abhängiger von Dingen, die wir nicht verstehen. Unsere Aufgabe ist es, unsere natürliche menschliche Intelligenz mit der künstlichen Intelligenz in Einklang zu bringen: Begegnen wir der Technik mit Interesse und ohne Angst, mit kritischem Bewusstsein und Spieltrieb!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Für Luis
Wir sind nicht allein
Rrrrring! Der Tag beginnt mit einem technischen Signal. Die meisten von uns lassen sich morgens von einer Maschine wecken.
Mittlerweile können wir zu diesem Zweck sanfte Töne auswählen oder ein technisches Dudelidu, Mozartmelodien, Walgesang; es gibt Wecker, die im Schlafzimmer herumrollen und erst dann aufhören zu lärmen, wenn wir sie eingefangen haben. Andere weinen wie ein Baby.
Die Digitalisierung hat aus der Weckmaschine einen anpassungsfähigen Mitbewohner gemacht. Er tut das, was wir wollen. Sein Wesen ist die Software, und die kann in unterschiedliche Körper kriechen. Die meisten Leute lassen sich von ihrem Smartphone wecken, einem Ding, das formbar ist wie Knetmasse.
Scheinbar hat unsereiner die Macht über das Ding. Die Wahrheit ist eine andere. Denn die Grundfrage lautet immer noch: Wer weckt wen? Wir sicherlich nicht den Wecker.
Aber entscheiden denn nicht wir, wann er weckt?
Wie man’s nimmt. Untersuchen Sie einmal Ihre Gründe, den Wecker auf eine bestimmte Uhrzeit zu programmieren – Sie werden auf ein unentwirrbares Knäuel aus eigenen und fremden Anforderungen stoßen, auf ein Gewusel aus Müssen und Wollen.
Beispielsweise: Sie müssen um neun Uhr im Büro sein, denn Sie wollen Ihren Job behalten. Sie müssen diesen Job behalten, denn Sie wollen Geld verdienen. Sie müssen Geld verdienen, denn Sie wollen essen. Sie müssen essen, denn Sie wollen leben.
Aber wieso deswegen um sieben und nicht um acht aufstehen?
Weil Sie sich morgens nicht hetzen wollen, Sie müssen schließlich Stress abbauen, sagt der Arzt. Weil Sie noch frühstücken müssen oder wollen und dabei ins Netz schauen. Denn Sie wollen, nein Sie müssen informiert am Arbeitsplatz erscheinen. Ach so, natürlich: Sie müssen auch die Kinder zur Schule bringen. Die beginnt ihrerseits zu einer pädagogisch unsinnig frühen Stunde, weil … Und so geht es endlos weiter.
Wer verleiht also letztlich Ihrer Weckmaschine die Macht, den Tag einzuläuten? Sie allein?
Jeder Mensch lebt in einem Netz von Austausch- und Machtbeziehungen. Die Knoten in diesem Netz sind nicht nur Menschen, sondern auch Dinge. Je mehr Dinge, desto engmaschiger das Netz. Blicken Sie sich um: Das Netz ist sehr, sehr engmaschig geworden.
Die menschliche Gesellschaft arbeitet sich an Dingen ab. Einer stellt ein Ding her, ein anderer benutzt es, ein weiterer macht es kaputt, noch jemand repariert es, wieder jemand klaut es, schließlich wird es entsorgt, recycelt und geistert selbst dann noch durch die soziale Welt, und sei es nur, weil es nach seiner Verbrennung als klimavergiftendes Atmosphärenteilchen weltweite politische Aktivitäten auslöst.
Die Gesamtheit dieser Dinge, verstanden als Knoten im gesellschaftlichen Netz, können wir auch »Technik« nennen.
Manche sprechen wegen der Komplexität lieber von »Technologie«. Andere halten begriffsgeschichtlich dagegen, »Technologie« bedeute ursprünglich die Lehre von der Technik. Kann man so sehen. Aber was ist eigentlich dadurch verloren gegangen, dass der Sprachgebrauch den Unterschied zwischen den beiden Begriffen eingeschliffen hat? Zumindest dieses Buch wird nicht pedantisch zwischen Technik und Technologie unterscheiden. Es versteht Technik durchgehend als Zusammenhang aus Wollen und Müssen, vermittelt durch Sachen. Wie diese Vermittlung funktioniert und wie wir in ihr leben, das ist das Thema dieses Buches.
Der Wecker ist, als Ding, bloß ein Krachmacher. Aber als Technologie ist er ein Taktgeber des Alltags. Er synchronisiert gesellschaftliches Leben und bringt es auf den Punkt. Morgens um sieben!
Wir gehorchen ihm. Und schalten sodann die Kaffeemaschine an. Sowie die ganze übrige Maschinerie, die uns vom morgendlichen Aufstehen an umgibt – lauter Dinge, die zugleich Routinen verkörpern: die Lampen, das Radio und die Dusche, womöglich die elektrische Zahnbürste, vom Handy oder dem Computer ganz zu schweigen. Das sollten wir uns schon einmal merken: Dinge verweisen auf Handlungen.
Überall Maschinen. Und leben wir nicht auch im Inneren einer Maschine, einer Wohnmaschine nämlich, wie der legendäre Architekt Le Corbusier unsere Häuser nannte?
Wir verlassen die Wohnmaschine, um uns in eine weitere Maschine zu begeben, eine Transportmaschine nämlich, die uns zur Arbeit bringt.
In die Arbeitsmaschine.
Der Arbeitsprozess lässt sich durchaus als maschineller Vorgang beschreiben. Gegeben sind: Arbeitskräfte, Dinge, Verfahren. Das Resultat: Dinge und Dienstleistungen sowie Individuen, die ihre Arbeitskraft verausgabt haben. Ein Input wurde nach Regeln in einen Output umgewandelt, ganz nach dem algorithmischen Prinzip, das uns in diesem Buch noch mehrmals begegnen wird.
Der Verwandlung des Inputs in den Output folgt eine Rückkopplung: Wenn der Output des Arbeitsprozesses die Prüfung durch den Markt besteht, dann ist genug Geld dafür vorhanden, dass die Arbeitsmaschine weiterlaufen kann. Das Ganze ist also eine sich selbst reproduzierende Struktur, in der die Menschen und Dinge als vermittelnde Bindeglieder operieren.
Eine Gesellschaftsstruktur.
Die Vermittlung durch Dinge hat ihre eigene Geschichte, die wir auch als Verdichtungsprozess auffassen können. Vergleichen wir die Jetztzeit einmal mit dem Leben vor ein paar hundert Jahren, wie es der Londoner Beamte Samuel Pepys im späten 17. Jahrhundert beschrieben hat. Er führte ein geheimes Tagebuch, dessen Reiz in Pepys’ Liebe zum Detail besteht sowie in seiner Unerbittlichkeit, auch gegen sich selbst. Die Eintragungen vermitteln eine Ahnung von dem, was damals Alltag war: all die ergebnislosen Wege. Pepys will jemanden aufsuchen, der aber befindet sich woanders, worüber Pepys wiederum keineswegs erstaunt ist.
Wir können uns kaum mehr vorstellen, wie kompliziert es gewesen sein muss, Verabredungen ohne Telefon, SMS, WhatsApp, Facebook oder E-Mails zu treffen, abzuändern, abzusagen. Einst, als das Telefon aufkam, wurde die Sorge geäußert, es werde zur Vereinzelung seiner Benutzer führen, die nur mehr telefonieren würden, anstatt einander zu treffen: Tja, Irrtum. Man hatte die Zeitgenossen unterschätzt, denn ganz im Gegenteil wurde das Telefon bald von Teenagern, Geschäftsleuten und überhaupt von aller Welt dazu genutzt, sich zu verabreden.
Was aber konnte Pepys in seiner Zeit tun, um eine Verabredung zu treffen, abzuändern, abzusagen? Allenfalls einen Boten schicken. Was er manchmal auch tat. Aber doch nicht mehrmals am Tag! Pepys war ein vielbeschäftigter Mann, seine Aufgaben im Flottenministerium sowie als Privatsekretär bestanden in hohem Maße aus Besichtigungen und Besprechungen – unmöglich, insbesondere zu teuer, dafür ein botengestütztes Terminmanagement zu betreiben, wie man heute sagen würde.
Interessant, dass diese über Jahrhunderte währende Widrigkeit des urbanen Lebens von dessen literarischen Beobachtern ansonsten nie erwähnt wird, selbst von denen nicht, die, wie Honoré de Balzac oder Theodor Fontane, gerne ins alltägliche Detail gingen. Die Leichtigkeit, mit der wir Heutigen uns verabreden, war ihnen unbekannt. Sie lebten in einer anderen Gesellschaft als wir.
Greifen Sie sich ein beliebiges Stück Technik heraus, und nach kürzester Zeit landen Sie bei nichttechnischen Themen.
Ich gehe beispielsweise gerne zu Fuß zur Arbeit. Weil ich ein elektronisches Fitnessarmband trage. Freunde von mir finden das ganz schrecklich. Sie sehen das als Zeichen meiner Fremdbestimmung.
Ich habe das Armband darauf eingestellt, dass ich 12.000 Schritte pro Tag marschieren muss. Gelingt es mir, vibriert das Armband freudig – nun gut, es vibriert einfach nur; das »freudig« ist eine Projektion. Auch das ist typisch: Wir projizieren menschliche Eigenschaften auf Dinge, um ihr Verhalten (aber ist es ein »Verhalten«?) begrifflich zu fassen. Über mein iPhone und das Notebook synchronisiere ich die Aufzeichnungen des im Armband versenkten Schrittzählers mit einer Website, die auch mein Gewicht sowie andere Gesundheitsdaten kennt. Hin und wieder sendet sie mir lobende oder aufmunternde E-Mails und SMS.
Wer herrscht hier über wen? Die Macht meines Fitnessarmbands ist nur delegiert. Ich kann es jederzeit ablegen (aber sagt nicht jeder Süchtige, er könne jederzeit aufhören?). Zumindest dass ich mir eine bestimmte Körpernorm zu eigen mache, nämlich einen anzustrebenden Body-Mass-Index, das ist nun wirklich meine eigene souveräne Entscheidung.
Obwohl – auch sie ist ein Müssen-wollen-Komplex. Unsere Selbst- und Wunschbilder sind nicht angeboren, sie sind kulturell bedingt. Fett zu sein ist peinlich, und Peinlichkeit ist ein gesellschaftlich erzeugtes Gefühl. Ärztliche Empfehlungen wiederum müssen zwar wissenschaftlich gestützt sein, doch sind auch sie in hohem Maß kulturbedingt. Und so ergibt sich, dass mein Fitnessarmband als vermittelndes Glied sozialer Beziehungen verstanden werden kann.
Für dezidierte Kommunikationstechnik wie Smartphones gilt das erst recht; in ihrem Fall ist es geradezu offenkundig. Mithilfe von Smartphones hatten sich die tunesischen Jugendlichen koordiniert, die im Januar 2011 die Avantgarde der Bewegung gegen den Diktator Ben Ali bildeten, und so geht es bis heute überall, wo Unterdrückte sich erheben. Ebenso mithilfe von Smartphones und Diensten wie Google Maps, Facebook und WhatsApp finden Flüchtlinge den schwierigen Weg aus entlegenen Kriegsgebieten nach Europa, entgehen sie den Gefahren, die unterwegs lauern, und helfen sie einander.
Das Smartphone, das so vielfältig genutzt werden kann, ist ein Bindeglied der Gesellschaft: Seine Benutzer spielen gegeneinander Quizduell (ohne sich deswegen persönlich kennen zu müssen), kaufen ein, treffen Verabredungen, womöglich auch für kriminelle Handlungen, bewegen sich in sozialen Netzwerken und was nicht alles. Dass sein Gebrauch zur Vereinzelung führe, ist wieder so ein Gerücht, das von der Alltagspraxis pausenlos dementiert wird.
Allzu pausenlos, könnte man sogar sagen; wer sich mal in Ruhe vereinzeln möchte, stellt sein Smartphone besser aus. Es gibt übrigens noch jemanden außer mir, der die Vereinzelungsthese für Unsinn hält: Das ist der Staat. Seine Überwachungsapparate behandeln das Smartphone ganz im Gegenteil als idealen Sensor dafür, wie sich bestimmte Personengruppen vergesellschaften.
Es erweist sich, dass soziale Technikanalyse recht schnell unübersichtlich werden kann. Die Gesamtheit der Sozialbezüge einer bestimmten Technik sieht nicht geordneter aus als eine Schüssel voller Spaghetti.
Dieses Buch stellt Ihnen daher ein Schema vor, die Stufen der Beziehung von Mensch und Technik ein wenig zu sortieren. Das Schema erhebt gewisslich nicht den Anspruch, eine Philosophie der Technik zu sein. Aber es hilft womöglich, unser Leben mit der Technik etwas besser zu begreifen. Sein Zentralbegriff heißt Immersion. Das Wort stammt aus dem Lateinischen, immersio bedeutet »das Eintauchen«. Der Mensch ist in die technische Welt eingetaucht, die er sich errichtet hat.
Das muss erklärt werden. Vor der Epoche des Werkzeuggebrauchs waren unsere Vorfahren der vorgefundenen Natur unterworfen, wie alle anderen Lebewesen auch. Totale Immersion. Als dann einige Primaten begannen, die Natur zu manipulieren, mit Feuer, Jagdspeeren, Steinwerkzeugen, wurden sie dadurch zwar nicht von ihr unabhängig, wie denn auch, aber doch autonomer.
Autonomie bedeutet wörtlich: den eigenen Gesetzen folgend. Es ist ein Maßbegriff. Nichts und niemand ist vollständig autonom, denn das hieße ja: vollkommen unbeeinflusst, absolut isoliert. Also ohne jeden Energieaustausch mit der Außenwelt. In unserem Universum existiert so etwas nicht (man ist sich sogar beim Universum selbst nicht ganz sicher, ob es nicht doch in einem Austausch mit anderen Universen steht). Infolgedessen: Alles ist nur mehr oder weniger autonom. Auch der Mensch, schauen Sie sich einmal in Ihrem Bekanntenkreis unter diesem Gesichtspunkt um.
Nun, und je mehr Werkzeuge die Menschen zu verfertigen lernten, desto autonomer wurden sie, desto besser konnten sie ihrer Umwelt abringen, was sie haben wollten. Sie arbeiteten sich mithilfe der Technik aus ihrer ursprünglichen Immersion in die Natur heraus.
Dann jedoch setzte etwas Erstaunliches ein: neuerliche Immersion. Diesmal in die Technik. Sie verläuft in drei Stufen; zwei davon durchleben wir derzeit, die dritte ist nur eine Möglichkeit (mit der ich allerdings rechne).
Die erste Stufe, die wir »Immersion Eins« nennen können, besteht darin, dass der Mensch sich vollständig mit Artefakten umgibt. Er baut sich ein technisches Gehäuse. Darin lebt der Mensch heute. Will er einmal unberührte Natur erleben, muss er enorme Anstrengungen unternehmen.
In Wahrheit trifft er nirgends auf unberührte Natur. Die Niagarafälle zum Beispiel, die als Naturschauspiel bewundert werden, sind in Wirklichkeit ein Wunderwerk der Ingenieurskunst; ohne aufwendige Konstruktionen aus Stahlbeton sowie das Kraftwerk an ihrem Rande existierten sie schon längst nicht mehr. Wer die Regenwälder des Amazonasgebiets überfliegt, wird nach der Landung auch nicht mehr von Unberührtheit sprechen wollen, sondern von Gefährdung durch Brandrodung und Goldbergbau. Karibische Inseln sind oft mit künstlichen Sandstränden versehen, Wälder werden gepflegt und Wanderwege angelegt, und wenn man die Sache gänzlich zu Ende denkt, dann machen Klimaveränderung und Umweltverschmutzung ohnehin jeden Ort der Erde zu einem technisch veränderten Gebiet. Wer über die heutigen Lebensformen des Menschen nachdenken will, muss sich infolgedessen mit seinen Dingen beschäftigen.
In den vergangenen zwei, drei Jahrzehnten hat sich ein Forschungszweig der Kultur- und Geschichtswissenschaften herausgebildet, der die Dingwelt des Menschen umkreist. Er ist weithin unter seinem englischen Namen material studies bekannt. Die Forscher können aus den Traditionen der Ethnologie und Archäologie schöpfen, die seit eh und je viele ihrer Schlüsse aus Artefakten ziehen, also aus hergestellten Sachen, von Sakralgegenständen bis hin zu Alltagsdingen.
Letztere haben es den Autoren der material studies besonders angetan. Sie schreiben über Bleistifte, Küchengeräte, Fernbedienungen und so weiter; das kann manchmal unterhaltend sein, in anderen Fällen ist die Vollständigkeit der Untersuchungen ihr einziger Vorzug. Wirklich interessant wird diese Forschung, wenn sie etwas über das menschliche Verhalten ausfindig macht: wenn sie die Dinge, die uns umgeben, als Medien begreift, als Zwischenglieder in einem Netz von Handlungen. Ein besonders instruktives Beispiel dieser Literatur ist das Buch Am Beispiel der Gabel von Bee Wilson, das die Koevolution des Kochens, Essens und der zugehörigen Technik beschreibt.1
Alle Artefakte stehen in einem Handlungszusammenhang. Nennen wir eine Handlung Hn und ein Ding Dn, dann sagt uns die Formel Hn→Hn+1, dass eine bestimmte Handlung eine andere auslöst. Beispiel: Sie grüßen, ein anderer lächelt Sie an. Und die Formel Hn→Dn→Hn+1 beschreibt, dass eine Handlung ein Ding hervorbringt, das wiederum eine andere Handlung auslöst. Beispiel: Sie hupen, und jemand springt von der Fahrbahn. In diesem Fall ist das Ding Dn ein vermittelndes Glied zwischen Handlungen, es ist ein Medium.
Die leicht kompliziert wirkende Indizierung von H und D mit n und n+1 soll lediglich daran erinnern, dass diese Formeln miteinander verkettet werden können, verknüpft zu Netzen aus vielen verschiedenen aufeinanderfolgenden H und D. Das gesellschaftliche Leben lässt sich als Netz aus Beziehungen beschreiben, dessen Knoten Handlungen und Dinge sind und die entweder per Hn→Hn+1 oder Hn→Dn→Hn+1 miteinander verbunden sind.
Na gut, und jetzt, wo wir das wissen, merken wir es uns und können die Indizierung auch wieder weglassen.
Das Verdienst des material turn in den Kulturwissenschaften besteht darin, den Blick auf die D-Glieder gelenkt zu haben. Vor mir liegt ein 700-seitiger Wälzer, A History of the World in 100 Objects, herausgegeben vom British Museum.2 Der Band präsentiert beispielsweise eine »lackierte chinesische Tasse aus der Han-Zeit« oder ein »goldenes Lama der Inka«. Das Buch ist ein schönes Beispiel dafür, dass Dinge mehrere soziale Funktionen zugleich ausüben können. Denn zum einen ist es eine populäre Vermittlung von Archäologie und Geschichtswissenschaft, zum anderen ist es selbst ein sozial hochgradig besetztes Objekt, nämlich ein coffee table book, gedruckt auf schwerem Papier. Es ist eindeutig als Gegenstand demonstrativer Beschäftigung gestaltet worden, als Buch von der Sorte, die man scheinbar achtlos so auf dem Sofatischchen liegen lässt, dass die Gäste es bemerken. Vielleicht knüpfen sie ja eine Unterhaltung daran? Dann ist das Buch, das Ding, ein conversation piece, und mehr HDH geht nun wirklich nicht.
Das Buch erinnert mich wiederum an ein weiteres Buch (also an noch ein Ding!): Es heißt Theory of the Leisure Class, ist im Jahr 1899 erschienen und wurde verfasst von dem amerikanischen Ökonomen und Soziologen Thorstein Veblen.3 Dieser zählt in einer Passage seiner Studie die Zeichen ostentativer Muße auf, die zu seiner Zeit, also um die vorvorherige Jahrhundertwende, die »feinen Leute« vom Rest der Welt abhoben: »quasigelehrte oder quasikünstlerische Leistungen sowie Kenntnis von Vorgängen oder Ereignissen, die nicht direkt zum Fortkommen der Menschheit beitragen … Kenntnisse toter Sprachen oder okkulten Wissens, korrekter Orthographie, Syntax und Aussprache, vielerlei Formen von Hausmusik, Kleidung, Möbeln, Kutschen, Spielen, Sportarten sowie der Züchtung von Luxustieren wie Hunden und Rennpferden«. Sinn und Zweck der Pflege dieses müßigen Wissens hätten sich vom ursprünglichen Motiv abgelöst, es diene nur noch »dem Beweis unproduktiver Zeitverwendung feiner Leute« – eben der leisure class.
Dinge als soziale Zeichen sind seit Veblen zum Gegenstand eines ganzen Zweiges der Soziologie geworden, dem der Stoff nicht ausgeht. Der sozialrepräsentative Dingfetischismus unserer Tage heftet sich an Fahrräder, an Espressomaschinen, Uhren, Wein und was nicht alles. Porsche-Fans treffen sich jährlich in einem Zuffenhausener Konzertsaal zur »Porsche Sound-Nacht«, um das Röhren ihrer angebeteten Fahrzeuge anzuhören, BMW bietet wiederum eine »Nacht der weißen Handschuhe an«, in der das Publikum Edelkarossen befingern kann.
Und was ist zum Beispiel von Leuten zu halten, die darauf bestehen, nur mit einem ganz besonderen Schrubber ihren Haushalt rein zu halten, wie er im Manufactum-Katalog angeboten wird? »Sein Korpus aus unbehandeltem Schweizer Buchenholz ist nicht flächig mit Borsten ausgestattet«, heißt es da, »sondern in zwei Reihen ringförmig mit einem sogenannten Unionbesatz bestückt. Union nennt man ein Gemisch von Naturfibre – Säure, Lauge und Hitze widerstehenden, äußerst elastischen Agavenfasern – und Bassine, den kräftigen Blattfasern der Sagopalme.«
Putzlappen, Duschköpfe, Weinkühlschränke, in unserer Epoche der Sachenverherrlichung existiert kaum eine Gattung von Haushaltsgegenständen, die nicht oberhalb ihrer normalen Vertreter eine Adelsklasse aufweist, handgefertigt aus seltenen Materialien etwa, oder mit einer überschüssigen Präzision funktionierend, wie sie ansonsten allenfalls industrielle Höchstleistungsapparate aufweisen.
Den Höhepunkt des Fetischismus allerdings stellt die sogenannte Autostadt bei Wolfsburg dar. Die ist eine Art Themenpark rund ums Auto, vor allem aber bietet sie den Kunden des VW-Konzerns die Auslieferung eines neuen Autos als sakrale Handlung an. Zuvor können sie in einem Fünfsternehotel auf dem Gelände einen Abglanz von Luxus genießen und in einem Dreisternerestaurant mit Champagner anstoßen. Eine als Ausstellung getarnte Propagandastrecke lockt sie mit interaktivem Gedöns; wenn sie die museumspädagogische Zone wieder verlassen, halten ihre gewaschenen Gehirne den Erwerb eines Autos für eine umweltrettende Tat. In einem linsenförmigen Flachgebäude umwandert das Publikum stumm vor Staunen einen komplett verspiegelten Bugatti Veyron 16.4, als sei er das goldene Kalb; treffend beschreibt der offizielle Prospekt die Wirkung des Objekts: »Die harmonischen Flächen und strukturierten Linien des eleganten Fahrzeugs werden zur Reflexionsfläche für den Betrachter, dem der Eindruck vermittelt wird, in die Installation hineingezogen und damit selbst auf Zeit zum Teil des Kunstwerkes zu werden. Nicht nur die perspektivischen Grenzen des Raumes verschwimmen, sondern auch die Grenze zwischen Objekt und Betrachter.«
Ein Sog ins Zentrum. Und das Zentrum ist, nun ja, ein Auto. Es ist so beschaffen, dass sich die Leute in ihm bespiegeln können. Im Fall des umwanderten Bugattis sogar im Wortsinn, aber auch im übertragenen, denn was die Leute dort erblicken, ist ihr Realität gewordener Traumgegenstand.
Technik nimmt teil an der Gesellschaft und trägt deren Züge, bis in ihre Einzelteile, die Oberflächen, das Innenleben. Zuweilen ist das offensichtlich, etwa im Fall des iranischen Atomprogramms: Welche Anlagen und Verfahren können ausschließlich zivilen, lediglich militärischen oder eben doch beiden Zwecken dienen (dual use)? Da muss man ins technische Detail gehen, um politisch richtigzuliegen.
Das gilt ebenso für die Technik der Arbeitsprozesse, die mit Genauigkeit analysiert werden muss. Sie ist sowohl die Widerspiegelung der Interessenkonvergenz aller am Unternehmen Mitwirkenden als auch ein Kompromiss ihrer widerstreitenden Interessen. Betriebsräte kennen das: Wenn sie eine Vereinbarung über Technik im Betrieb abschließen wollen, dürfen sie keine Einzelheit übersehen. Sie wissen, dass Technik in jedem Fall nach Interessen gestaltet wird und nicht einfach einer dinglich vorgegebenen Rationalität folgt.
Weshalb die Grundfrage aller Technologiepolitik lautet, ob und wie die Technik selbst gestaltet werden soll, die Schrauben, die Rädchen, die Bits. Das kann eine Lebensfrage sein. Spätestens das 20. Jahrhundert mit seinen Panzern, Gasangriffen und Atombomben, seinen Chemieunfällen sowie der klimaschädlichen Öl- und Kohleverbrennung hat die Frage dringlich werden lassen, was die Kriterien einer ethischen Gestaltung der Technik sein sollen. In der Formel HDH, so spielerisch sie anmuten mag, steckt auch tödlicher Ernst.
An diese Formel schließt sich zwanglos die Frage an, wie es um andere denkbare Kombinationen von Dingen und Handlungen bestellt sein mag, also DHD. In ihr wären die menschlichen Handlungen eine Vermittlung der Dinge. Ein Übergangsmoment innerhalb einer Dingwelt.