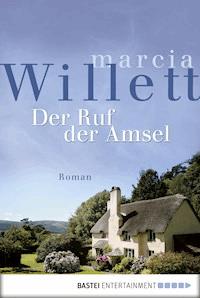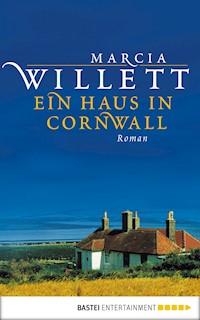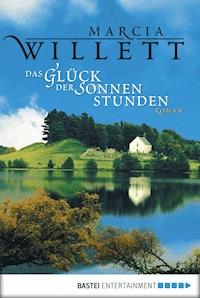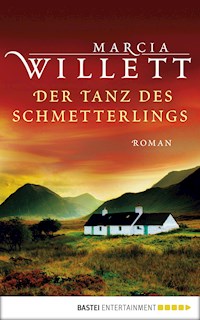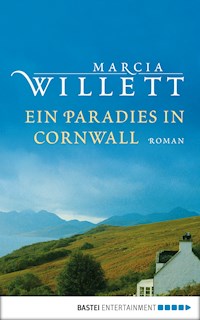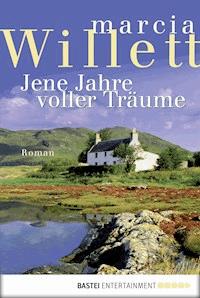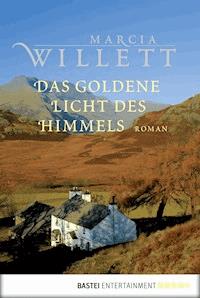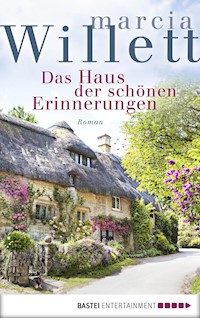4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Freundschaft, Liebe und jede Menge Turbulenzen in einem idyllischen Küstenort in Cornwall.
In der Nachbarschaft eines wunderschönen alten Klosters hat Dossie gerade ihr eigenes Catering-Unternehmen gegründet, und das Geschäft blüht. Überdies freut sie sich, dass Sohn und Enkel beschlossen haben, in ihre Nähe zu ziehen. In dem malerischen Örtchen ist jeder für den anderen da, nicht zuletzt die freundlichen Nonnen, die ihren Teil dazu beitragen, dass Dossies Enkel Jakey sich schon bald wie in einer Großfamilie fühlt. Doch die heile Welt wird bedroht, als eines Tages ein Immobilienhai das Kloster in ein Luxushotel umbauen will ...
Ein herzerwärmender Roman um die Suche nach dem richtigen Platz im Leben.
»Marcia Willetts Bücher sind Kostbarkeiten, die das Leben der Menschen einfühlsam und liebenswert darstellen.« FREUNDIN
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Epiphanias
Lichtmess
Fastenzeit
Pfingsten
Trinitatis
Christi Verklärung
Michaeli
Allerheiligen und Allerseelen
Advent
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
In der Nachbarschaft eines wunderschönen alten Klosters hat Dossie gerade ihr eigenes Catering-Unternehmen gegründet, und das Geschäft blüht. Überdies freut sie sich, dass Sohn und Enkel beschlossen haben, in ihre Nähe zu ziehen. In dem malerischen Örtchen ist jeder für den anderen da, nicht zuletzt die freundlichen Nonnen, die ihren Teil dazu beitragen, dass Dossies Enkel Jakey sich schon bald wie in einer Großfamilie fühlt. Doch die heile Welt wird bedroht, als eines Tages ein Immobilienhai das Kloster in ein Luxushotel umbauen will …
Marcia Willett
Der Duft desApfelgartens
Aus dem britischen Englisch vonBarbara Röhl
Epiphanias
Die Heilige Familie wohnt in einem alten leinenen Schuhbeutel. Der Beutel ist dunkelbraun und hat ein Namensschild, das direkt unterhalb des gefältelten, gerafften Tunnelzugs aufgenäht ist, wo der Beutel mit einer dicken Kordel zusammengezogen wird. Jedes Jahr zu Heiligabend wird er geöffnet. Die Familie wird hervorgeholt und zusammen mit den Weisen aus dem Morgenland, den Hirten, einem Engel mit einem angeschlagenen Heiligenschein und verschiedenen Tieren auf einem Tisch neben dem Weihnachtsbaum aufgestellt. Die Figuren haben ihren eigenen Stall, ein offenes Gebäude aus Holz, das einmal zu einem schmucken Spielzeugbauernhof gehört hat, und sie passen genau hinein: der goldene Engel, der andächtig hinter der Krippe steht, und darin das kleine Jesuskind in weißen Windeln. Seine ganz in Blau gekleidete Mutter kniet am Kopfende der Krippe, gegenüber einem Hirten, der vor dem Kind auf die Knie gefallen ist und freudig und anbetungsvoll die Arme ausstreckt. Josef in seinem roten Umhang und ein zweiter Hirte, der ein Lamm um den Hals trägt wie einen Pelzkragen, stehen ein wenig abseits und sehen zu. Ein schwarz-weißer Ochse hat sich schläfrig in einer Ecke zusammengerollt, nicht weit entfernt von dem grauen Esel, der den Kopf leicht gesenkt hält. Und draußen, gleich vor diesem häuslichen Bild, kommen die drei Weisen aus dem Morgenland in ihren farbenprächtigen wehenden Gewändern heran. Sie schreiten hintereinander her und bringen ehrfürchtig Geschenke; Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Jakey steht dicht vor dem Tisch und betrachtet die Krippenfiguren, die sich in seiner Augenhöhe befinden. Ab und zu hebt er vielleicht eine der Figuren hoch, um sie genauer anzusehen: den angeschlagenen Heiligenschein des Engels; das Lamm, das sich so friedlich um den Hals des Hirten schmiegt; die winzigen Kästchen, die die Weisen aus dem Morgenland tragen. Einmal hat er das Jesuskind fallen lassen, und es ist unter das Sofa gerollt. Oh, was für ein schrecklicher Augenblick, als er flach auf dem Gesicht gelegen und unter dem schweren Möbel herumgetastet hat! Ganz heiß vor Frustration war ihm, weil er es nicht bewegen konnte. Und dann die gewaltige Erleichterung, als sich seine Finger um die kleine Gestalt schlossen und er das Jesuskind unbeschädigt hervorholte und es wieder in seine blau ausgeschlagene Krippe legte.
Als Jakey jetzt bei der Weihnachtskrippe steht, wird er sich langsam der Geräusche bewusst, die ihn umgeben: die gewichtig tickende Uhr, deren Pendel wie ein ärgerlich wackelnder erhobener Zeigefinger wirkt; das Seufzen und Rascheln aschebedeckter Scheite, die auf dem Feuerrost zusammensacken; sein Vater, der nebenan in der Küche telefoniert; und das monotone Quaken des leise gestellten Radios. Heute wird die Dekoration abgenommen, weil Dreikönigstag ist: Weihnachten ist vorüber.
Jakey singt leise vor sich hin. »Die Heiligen Drei König’ mit ihrigem Stern, sie suchen das Kindlein, den Heiland, den Herrn …«
Er fühlt sich unruhig und ist traurig darüber, dass die winzigen strahlenden Lichter und der hübsche Baum nicht mehr da sein werden, um die kurzen, dunklen Wintertage aufzuhellen. Jakey singt immer noch halblaut, als er auf das Sofa klettert und einen Kopfstand versucht: den Kopf in den Kissen und die Beine an die Lehne gestützt, bis er zur Seite sinkt und langsam auf den Boden rutscht. Seine Füße liegen immer noch auf dem Sofa. Auf dem Teppich dreht er den Kopf und sieht Tante Gabriel an, die auf dem Bücherregal steht und die Oberaufsicht über die weihnachtlichen Feierlichkeiten zu führen scheint. Der Engel ist über einen halben Meter groß, trägt robuste Holzschuhe und ein Kleid aus weißem Krepppapier und hat wattierte goldene Flügel. Tante Gabriels Haar besteht aus Bindfäden, aber ihr mit scharlachrotem Garn aufgestickter Mund lächelt mitfühlend und doch freudig. Die plumpen Füße stehen eckig und fest auf dem Boden, aber wenn man ihr die Krone aus Golddraht auf das flachsblonde Haar setzt, hat sie etwas Überirdisches. Behutsam hält sie ein rotes Satin-Herz in den Händen – vielleicht ein Symbol für die Liebe? So zumindest hat Dossie es erklärt.
In dem Zimmer hängen noch mehrere andere, kleinere Engel an praktisch angebrachten Haken, doch keiner von ihnen kann es mit Tante Gabriel aufnehmen. Sie ist nicht so wild und kalt und prachtvoll wie der Erzengel selbst, der in all seiner Macht und Herrlichkeit vom Himmel heruntergeflogen kommt und einen Glorienschein hinter sich herzieht; aber sie ist trotzdem eine entfernte Verwandte von ihm, das menschliche, fehlbare Gesicht der Liebe.
Mit einem tiefen Seufzer hebt Jakey die Beine vom Sofa, sodass er eine Rolle rückwärts beschreibt, und steht auf. Er geht zum Bücherregal hinüber und sieht zu Tante Gabriel hoch, die ihn mit ihrem leicht schiefen Stickseide-Lächeln freundlich anlächelt. Er möchte nicht, dass sie in die weiche Stoffhülle eingerollt wird, die ihr empfindliches Kleid und die wattierten Flügel schützt. Ihre Goldkrone wird getrennt verpackt, und dann wird alles in eine große Plastiktüte gesteckt und in die Schublade der alten Kommode gelegt. Weihnachten soll nicht vorbei sein. Jakey ist zutiefst unglücklich. Mutwillig tritt er gegen das Bücherregal, stößt sich den Zeh in dem weichen Lederhausschuh an der Ecke an und spürt einen scharfen Schmerz. Seine Mundwinkel ziehen sich nach unten, und er beschließt, ein bisschen zu weinen, obwohl er weiß, dass er jetzt ein großer Junge ist; er wird schon fünf. Versuchsweise stößt er einen Schluchzer aus, lauscht ihm interessiert nach und kneift die Augen zusammen, um eine Träne hervorzuquetschen.
Clem beobachtet seinen kleinen Sohn von der Tür aus. Sein Herz zieht sich in einer Mischung aus Mitgefühl und Belustigung zusammen.
»Rate, wer am Telefon war«, sagt er. Als Jakey seine Stimme hört, fährt er zusammen und dreht sich schnell um. »Dossie«, erklärt Clem. »Sie ist auf dem Weg hierher, und sie bringt etwas Besonderes mit.«
Jakey zögert bedrückt. Er streckt immer noch die Unterlippe vor und ist nicht wirklich bereit, sich aus seinem Selbstmitleid reißen und aufheitern zu lassen.
»Wasss denn?«, fragt er und tut, als wäre er nicht besonders interessiert. »Wasss bringt sie mit?«
»Das ist ein Geheimnis.« Clem setzt sich und zieht einen in leuchtenden Farben gestrickten Hasen mit langen Ohren und Schlenkerbeinen auf sein Knie. »Stimmt’s, Streifenhase? Ein Geschenk zum Dreikönigstag. Etwas, das du noch hast, wenn der Schmuck abgenommen ist.«
Jakey schaut sich im Zimmer um und sieht die Heilige Familie an, den glitzernden Baum und Tante Gabriel. Er zögert und geht mit sich zurate, aber Clem entdeckt Anzeichen dafür, dass er schwächelt, und dankt seiner Mutter im Stillen für ihre Idee.
»Er ist schrecklich niedergeschlagen«, hat er ihr am Telefon erklärt. »Er kann den Gedanken nicht ertragen, dass Weihnachten vorbei ist, und ich kann ihm nicht wirklich begreiflich machen, dass wir den ganzen Schmuck abnehmen müssen. Das wird ein schlimmer Abend.«
»Armer Schatz«, sagte sie. »Er hat mein tiefstes Mitgefühl. Ich hasse es auch. Aber ich habe einen Plan. Soll ich nicht kommen und etwas mitbringen? Den Schokoladenkuchen, den ich heute Morgen gebacken habe, und etwas aus meiner Geschenkeschublade? Ich habe eine von diesen Figuren aus Thomas, die kleine Lokomotive. James, glaube ich. Oder doch Edward? Jakey wird es wissen. Wir haben eine Geschichte darüber gelesen.«
Clem zögerte. »Er hat schon so viel zu Weihnachten bekommen, Dossie. Ich will ihn nicht verwöhnen.«
»Ach, Liebling. Eine kleine Lok. Weißt du noch, wie du dich früher gefühlt hast? Außerdem können wir Jakey gar nicht verwöhnen. Dazu ist er viel zu ausgeglichen. Ein Geschenk zum Dreikönigstag. Was meinst du?«
»Okay. Warum nicht? Bekomme ich auch eins?«
»Auf gar keinen Fall. Du bist nicht annähernd so ausgeglichen wie Jakey, und ich kann es nicht riskieren, dich in deinem reifen Alter noch zu verwöhnen. Aber du kriegst Kuchen. Bis gleich.«
Jetzt schlendert Jakey heran und lehnt sich an Clems Knie. Er dreht die langen, weichen Ohren des Streifenhasen und lässt sich zum Nachgeben überreden.
»Wann kommt Dosssie denn?«
»Bald.« Clem schaut zur Uhr hoch: Die Fahrt von St. Endellion nach Peneglos dürfte ungefähr eine halbe Stunde dauern. »Lass uns noch schnell einen kleinen Spaziergang unternehmen, bevor es dunkel wird. Du kannst dein neues Fahrrad mitnehmen und den Streifenhasen auf den Gepäckträger setzen.«
Jakey kräht vor Freude und rennt zur Tür. Er hat seine gute Laune wiedergefunden.
»Zieh Stiefel an«, ruft Clem. »Und deinen Mantel. Warte, Jakey! Warte, habe ich gesagt …«
Bald gehen sie zusammen in den winterlichen Sonnenuntergang hinaus.
Dicker Reif liegt über den Straßengräben und hat die rot, gelb und violett gefleckten Brombeerblätter gefrieren lassen, die über dem verblassten, schlaffen Gras und dem gefrorenen Boden hängen. Vorsichtig fährt Dossie über die kurvenreiche Straße und hält Ausschau nach Eisflächen, die sich gebildet haben können, wo die Sonne den Schnee über Tag aufgetaut hat. Ein Schwarm Stare steigt von einem Feld auf, das hinter der kahlen Dornenhecke liegt. Sie schießen umher wie ein wendiger Fischschwarm, der durch die kalte blaue Luft schwimmt, und lassen sich aufs Geratewohl auf den Telefondrähten nieder wie Noten, die jemand auf ein Notenblatt wirft.
An der A39 biegt Dossie westwärts nach Wadebridge ab. Sie ist voller Freude über den herrlichen Sonnenuntergang, die goldenen und scharlachroten Wolken, die über den rosigen Himmel ziehen, und den Anblick eines Halbmonds, der schon ziemlich hoch steht und einen einzigen großen Stern hinter sich herzieht. Sie hofft, dass Jakey den Stern sehen kann, denn er liebt das Firmament bei Nacht. Um diese Jahreszeit können sie gemeinsam den Himmel beobachten, bevor er ins Bett muss, und zu seinem vierten Geburtstag hat sie ihm einen Sterngucker-Kuchen gebacken: einen traditionellen Fischauflauf mit ganzen Sardinen, deren Köpfe durch den Teigdeckel schauen. Die Erinnerung an seine Miene, als er die vielen kleinen Sardinen sah, die zum Himmel zu starren schienen, bringt Dossie zum Lächeln; doch gleichzeitig fühlt sie den vertrauten schmerzhaften Stich. Wie traurig – wie traurig und grausam –, dass das Schicksal seine kleinen Gemeinheiten wiederholt; denn genauso, wie Clem seinen Vater nie kennengelernt hat, ist Jakeys Mutter nur Stunden nach seiner Geburt an einer Nachblutung gestorben. Dossie stößt einen tiefen Seufzer aus: Oh, der Schock und der Schmerz sind immer noch frisch. Damals hat sie so sehr versucht, Clem zu überreden, sein gerade begonnenes Theologiestudium am St. Stephen’s House in Oxford nicht abzubrechen, und ihm angeboten, zu ihm zu ziehen und ihm bis zu seiner Priesterweihe den Haushalt zu führen. Angefleht hatte sie ihn, er möge ihr erlauben, sich um Jakey zu kümmern, entweder in Oxford oder in ihrem Elternhaus in Cornwall.
»Mo und Pa würden gern helfen«, sagte sie. »Er ist schließlich ihr Urenkel, Clem. Sie haben mir geholfen, dich großzuziehen, und jetzt könnten sie das Gleiche für Jakey tun.«
Es war sinnlos gewesen. Höflich, aber standhaft hatte er sich geweigert, auf seine Tutoren und seinen spirituellen Ratgeber zu hören, die ihn von seiner Berufung zu überzeugen versuchten und ihm erklärten, sein Kummer mache ihn blind für seine wahre Bestimmung. Er nahm seinen lukrativen Computer-Job in London wieder auf, arbeitete zu Hause in ihrer kleinen Wohnung, stellte ein Kindermädchen für Jakey ein und kümmerte sich, so gut er konnte, um seinen kleinen Sohn.
Dossie wusste ganz genau, dass Clem nicht von ihr verlangen wollte, ihre eigene Arbeit – sie hatte sich mit einem Partyservice selbstständig gemacht – aufzugeben oder die Kontakte und den Ruf aufs Spiel zu setzen, deren Aufbau sie an der hohen, windumtosten Atlantikküste so viele Jahre gekostet hatte. Und Mo und Pa waren nicht mehr jung. Er müsse für sich selbst und Jakey einstehen, hatte er gesagt. Aber sie wusste, dass er den Gedanken hasste, an den Ort zurückzukehren, wo er zuerst das empfunden hatte, was er einmal in ungläubigem Staunen als »Gottes drängenden Ruf« beschrieben hatte.
Jetzt hat Dossie die New Bridge vor sich, die den Camel-Fluss überspannt. Es herrscht Ebbe, und nur ein silbriges Rinnsal durchzieht das Flussbett. Kleine Boote liegen an ihren Ankerplätzen leblos in dem blassen, schimmernden Schlamm und warten darauf, dass der Pulsschlag des Ozeans ihnen erneut Leben einhaucht. Sie fährt über die Brücke, vorbei an Wadebridge und der flussaufwärts gelegenen alten Brücke, biegt von der A39 ab und schlägt die Straße nach Padstow ein. Dabei denkt sie an Clems Anruf vor etwas über einem Jahr.
»In der Church Times steht ein Stellenangebot«, hatte er gesagt. »Es ist irgendwo in deiner Nähe, in einem Ort namens Peneglos. Darin steht: Kräftige Hand zur Bewirtschaftung von zweieinhalb Hektar Land gesucht, zusätzlich einige Wartungsarbeiten. Niedriges Gehalt, aber mietfreie Wohnung in einem Nebengebäude mit drei Zimmern. Ein anglikanisches Kloster.«
Seine Stimme, die schroff, aber merkwürdig begierig klang und sie geradezu zu einer Bemerkung herausforderte, verschlug ihr einen Moment lang die Sprache. Sie hatte keine Ahnung gehabt, dass er die Church Times immer noch las.
»Das muss Chi-Meur sein«, meinte sie dann scheinbar unbekümmert. »Ein wunderschönes altes Gebäude; ein kleines elisabethanisches Gutshaus. Eine alte Jungfer aus der Familie Bosanko, der es damals gehörte, hat es den Nonnen geschenkt. Und Peneglos ist das kleine Dorf, das zwischen Stepper Point und Trevose Head zum Meer hinunter verläuft. Das Kloster liegt im Tal darüber.«
Sie wartete. Das Schweigen zwischen ihnen zog sich fast unerträglich in die Länge.
»Ich überlege, ob ich mich um die Stelle bewerben soll«, erklärte er schließlich in herausforderndem Ton. »Ich könnte die Wohnung verkaufen, das Geld investieren und sehen, wie wir zurechtkommen. Schließlich hat Mo mich früher im Garten wie einen Sklaven arbeiten lassen, und Pa hat dafür gesorgt, dass ich mit einem Malerpinsel umgehen kann.«
Dossie war so aufgeregt, dass sie kaum zu atmen wagte. »Klingt großartig«, sagte sie trotzdem beiläufig. »Ich bin mir sicher, dass es nichts ist, womit du nicht fertig wirst, und für Jakey wäre es fantastisch. Es ist doch wunderschön, wenn ein Kind am Meer aufwachsen kann.«
Wieder wartete sie; sie würde Clem weder ins Verhör nehmen noch fragen, was er mit Jakey vorhatte, während er arbeitete.
»Ich muss mich nach einer Kinderbetreuung erkundigen«, sagte er. »Wenn er erst zur Schule geht, wird es natürlich einfacher; aber in Padstow müsste es einen Kindergarten geben. Und du wohnst auch nicht weit entfernt.«
»Höchstens eine halbe Stunde, würde ich sagen. Wir können dir alle helfen, bis du dich eingelebt hast.«
»Okay.« Er klang aufgeregt und hoffnungsvoll. »Wenn man mich zu einem Vorstellungsgespräch einlädt, könnten wir ein paar Tage im Court bleiben. Das wäre doch okay, oder?«
An diesem Punkt lachte sie. »Natürlich wäre es das. Halt mich auf dem Laufenden!«
»Ch’Muir?«, wiederholte Clem nachdenklich. »Wird das so ausgesprochen?«
»Mehr oder weniger«, antwortete sie. »Das ist Kornisch und heißt so viel wie ›großes Haus‹.«
»Klingt gut.« In seiner Stimme lag plötzlich eine Art Nostalgie.
Vor ihrem inneren Auge sah Dossie seine hochgewachsene, schlanke Gestalt, das silbrig-blonde Haar – ihres hatte die gleiche Farbe –, das er kurz geschnitten trug. Sie erinnerte sich daran, wie glücklich er gewesen war. Er hatte seine Berufung gefunden, seine hübsche französische Frau geliebt und sich auf ihr gemeinsames Baby gefreut. Ihr Herz schmerzte um seinetwillen. Es wäre sinnlos gewesen, ihn zu fragen, ob er seinen gegenwärtigen Beruf bedeutungslos fand, sie kannte die Antwort.
»Wenn es richtig ist, wird es passieren«, sagte sie mit einem Mal fröhlich. Irgendein sechster Sinn schenkte ihr Zuversicht.
Und so kam es. Die Schwestern von Christkönig im Kloster Chi-Meur und ihr Geistlicher und Vorsteher, Vater Pascal, hatten Clem und Jakey gleich ins Herz geschlossen und Clem die Stellung und das rustikale Pförtnerhäuschen, das dazugehörte, angeboten.
Als Dossie jetzt auf die Straße nach Peneglos abbiegt, ist ihr Herz froh und voller Dankbarkeit. Clems Wunden heilen, Jakey wird größer – und die beiden sind glücklich. Sie passiert das Tor des Klosters, und da liegt das Häuschen. Licht strömt auf den Vorplatz hinaus, und Jakey steht am Fenster und wartet auf sie.
»Ich hatte überlegt«, sagt Clem und sieht zu, wie Dossie die Reste des Kuchens zurück in die Blechdose legt, die mit Motiven aus Raymond Briggs’ Weihnachtsmann-Geschichte geschmückt ist, »ob ich den Weihnachtsschmuck nicht draußen lassen soll, bis Jakey im Bett ist. Verstehst du, ich könnte ihn abnehmen, wenn er schläft.«
Sie haben in der großen, fröhlich bunten Küche Tee getrunken, und jetzt sitzt Jakey nebenan im Wohnzimmer und sieht eine DVD von Shaun das Schaf an. Er hat den Streifenhasen unter den Arm geklemmt und lässt sich von einer Herde liebenswürdiger Schafe und den Kapriolen eines etwas dümmlichen Schäferhundes fesseln.
»Auf gar keinen Fall«, erklärt Dossie energisch. »Auf eine merkwürdige Art wird er es genießen. Es ist doch wichtig, dass er lernt, etwas nicht nur anzufangen, sondern es auch zu Ende zu bringen, oder? Wenn er aufwacht und feststellt, dass alles weggepackt ist, wird das eine schreckliche Ernüchterung für ihn sein. Das ist wie mit dem Trauern. Es hat seinen eigenen Rhythmus und seine eigenen Rituale. Letztes Jahr war er zu klein, um mit anzupacken, aber dieses Jahr kann er mithelfen. Das wird ihm gefallen.« Sie wirft Clem einen Blick zu. »Bin ich rechthaberisch, Schatz? Du musst natürlich tun, was du für das Beste hältst.«
»Wahrscheinlich hast du recht.«
Er wendet sich ab, steht einen Moment lang gegen das Spülbecken gelehnt da und schaut ins Dunkel hinaus. Zwischen den kahlen Ästen der Bäume leuchten die Lichter des Klosters, aber Dossie weiß, dass er an Madeleine denkt und daran, wie Jakeys Mutter wohl in dieser Situation gehandelt hätte. Sie überlegt, dass Clem nur allzu gut weiß, was Trauer bedeutet.
»Er kann Tante Gabriel verpacken«, meint Dossie munter und verbirgt, dass sie selbst bedrückt ist. »Er liebt Tante Gabriel. Und die Heilige Familie, für sie kann er auch die Verantwortung übernehmen. Und nachher bekommt er sein Geschenk, und wir spielen mit dem Zug, bis er badet. Was meinst du?«
Clem dreht sich wieder um und lächelt ihr zu. Sein Lächeln ängstigt sie, denn es liegt etwas Leeres darin, eine stoische Entschlossenheit. Am liebsten würde Dossie die Arme um ihn legen, aber sie weiß, dass ihr Wunsch, ihn zu trösten, für ihn nur eine Bürde wäre; er würde sich verpflichtet fühlen, seinen Schmerz noch tiefer zu vergraben, damit sie sich keine Sorgen macht.
Jakey kommt in die Küche, den Streifenhasen immer noch unter dem Arm.
»Shaun ist zu Ende«, sagt er. »Packen wir den Sssmuck jetzt weg?«
Er ist noch nicht ganz bereit, seine betrübte Miene aufzugeben, die ihm bis jetzt ein großes Stück Kuchen und die Ankündigung eines Geschenks eingebracht hat, und Dossie beobachtet ihn amüsiert. Er beherrscht sich sehr und hat noch nicht nach seinem Dreikönigsgeschenk gefragt, aber er vermutet eindeutig, dass es etwas mit dem Wegpacken des Weihnachtsschmucks zu tun hat, und ist jetzt bereit für den nächsten Schritt. Sie zieht die Augenbrauen hoch und wirft Clem einen Blick zu. Er nickt.
»Könntest du Tante Gabriel übernehmen? Und die Heilige Familie? Es wäre eine große Hilfe, wenn du das allein schaffen würdest, denn ich werde eine ganze Weile damit beschäftigt sein, den Baum abzuschmücken.«
Jakey reißt die Augen auf und kommt sich wichtig vor. Er scheint ein Stück zu wachsen und nickt. »Aber ich komme nur an Tante Gabriel dran, wenn ich mich auf einen Sssstuhl ssstelle.«
»Ich helfe dir«, sagt Dossie. »Ich kümmere mich um den Baum, und dann kann Daddy ihn nach draußen bringen.«
Zusammen gehen sie ins Wohnzimmer, und Dossie zieht die schwere unterste Schublade der großen Kommode auf. Sie holt die leeren Schachteln und Beutel heraus und legt sie aufs Sofa. Jakey nimmt den leinenen Schuhbeutel und betrachtet das Namensschild mit den rot gestickten Buchstaben: C PARDOE. Er weiß, dass die Buchstaben Daddys Namen – und seinen eigenen – bedeuten und dass der Schuhbeutel Daddy gehört hat, als er klein war und in die Schule gegangen ist. Jakey zieht den Beutel so weit auf, wie er kann, und trägt ihn zu dem niedrigen Tisch neben dem Baum.
Welche Figur soll er zuerst nehmen? Er legt den Ochsen hinein, danach den Esel, schiebt sie ganz an den Boden des Beutels und späht dann hinein, um sich davon zu überzeugen, dass es ihnen gut geht. Sie wirken ganz zufrieden, wie sie da in dem leicht muffig riechenden Inneren liegen. Als Nächstes kommen der kniende Hirte mit den weit ausgestreckten Armen und die Weisen an die Reihe: eins, zwei, drei. Wieder späht er in den Beutel, in dem alle durcheinanderliegen.
»Sie ruhen sich aus«, erklärt er Dossie. »Das mögen sie.«
»Natürlich. Sie haben schließlich vierzehn Tage gestanden oder gekniet. Wenn du vierzehn Tage auf den Beinen gewesen wärst, würdest du auch eine Pause brauchen.«
Jakey fühlt sich schon froher und greift nach Josef und dem zweiten Hirten. Josef lässt sich gemütlich am Boden des Beutels nieder, und Jakey legt Maria neben ihn. Der Erzengel Gabriel, der mit angeschlagenem Heiligenschein und ausgefahrenen Flügeln erhaben ins Nichts starrt, kommt als Nächster an die Reihe, und ganz zuletzt nimmt Jakey die kleine Krippe und das Jesuskind. Die Krippe schiebt er hinein, hält jedoch das schlafende Kind noch in der Hand.
»Das Jesussskind musss nicht ausssruhen«, meint er beinahe zu sich selbst. »Esss hat die ganze Zeit gelegen.«
»Aber es möchte bei seiner Familie sein«, gibt Dossie zurück. »Sie fehlt ihm sonst.«
Kurz überlegt er, ob er sich ein wenig anstellen und Einwände erheben soll, doch dann denkt er an das versprochene Geschenk und entscheidet sich dagegen. »Okay«, sagt er fröhlich.
Er schiebt das Jesuskind in den Schuhbeutel, wirft einen letzten Blick auf alle Figuren und zieht dann mit einiger Mühe die Schnur zu.
»Gut gemacht«, sagt Dossie. »Den Stall legen wir getrennt in die Schublade. Könntest du jetzt Tante Gabriel verpacken?«
Sie nimmt die große, sperrige Figur vom Bücherregal und lehnt sie neben den weichen Einwickeltüchern an die Sofakissen. Jakey betrachtet den Engel bedauernd: Sein Lächeln und das tröstliche Gefühl, dass er über ihn wacht, werden ihm fehlen. Eine Erinnerung an einen Traum, den er schon mehrmals gehabt hat, flackert in ihm auf: die reglose, schweigende Gestalt, die, in blasse Tücher gehüllt, auf der anderen Seite der Einfahrt zwischen den Bäumen steht und zum Haus sieht. Jakey weiß jetzt nicht mehr, ob er wirklich aus dem Bett gestiegen ist und die Gestalt von seinem Fenster aus gesehen hat oder ob alles bloß ein Traum war. Mit den Fingern streicht er über den schweren Sockel, der Tante Gabriels Füße bildet, und die weichen gepolsterten Flügel und berührt das Herz aus rotem Satin, das sie in ihren dicklichen Fingern hält.
»Vergiss nicht, ihr die Krone abzunehmen«, sagt Dossie, »und sie getrennt zu verpacken. Arme alte Tante Gabriel! Also, sie muss wirklich ausruhen. Dann kann sie nächste Weihnachten ausgeschlafen wieder herauskommen.«
Ehrfürchtig nimmt Jakey die Krone aus Golddraht von dem dicken Bindfadenhaar und beugt sich so weit vor, dass sein Mund sich dem mit Seide gestickten Lächeln nähert.
»Bisss nächssstes Weihnachten«, flüstert er. »Ruh dich sssön aus!«
Er legt sie auf das weiche Stück Stoff und hüllt sie darin ein wie in ein Umschlagtuch. Er möchte es nicht über ihr Gesicht ziehen, weil sie sonst keine Luft kriegt. Sehr vorsichtig legt er sie in die große Einkaufstüte, dann schlägt er die Krone in Seidenpapier ein und schiebt sie ebenfalls hinein. Plötzlich überkommt ihn wieder die Traurigkeit: Er kann es nicht ertragen, dass Tante Gabriel in einer Tüte steckt wie irgendwelche normalen, langweiligen Einkäufe. Doch bevor er etwas sagen kann, spricht Dossie ihn an.
»Kannst du mir helfen, Schatz?«, fragt sie. »Ich bin so dumm gewesen. Ich habe diese Figuren abgenommen, und jetzt finde ich die Schachtel nicht, in die sie gehören. Ist sie da auf dem Sofa? Oh, ja. Das ist die richtige. Komm und schau dir diese hübschen Figürchen an, Jakey! Dein Daddy hat sie geliebt, als er so alt war wie du.«
Und er sieht sich die kleinen geschnitzten Holzfiguren an – einen Trommler, einen Schneemann und einen Jungen mit einer Laterne – und hilft Dossie, sie in die grüne Schachtel zu legen; sie zeigt ihm die empfindlichen Christbaumfiguren aus Glas – eine Eule, eine Uhr und eine Glocke –, und seine Traurigkeit verfliegt.
In dieser Nacht träumt er wieder von der Gestalt, die, in helle Gewänder gehüllt, zwischen den Bäumen steht und das Haus beobachtet. Aber er hat keine Angst: Jetzt weiß er, dass es Tante Gabriel ist.
Die Auffahrt führt an dem Haus mit seinen Doppelbogenfenstern und der massiven Eichentür vorbei, beschreibt eine Kurve auf die offenen Ställe zu, die als Garage genutzt werden, und endet vor dem ehemaligen Kutschenhaus. Es ist zu einem Gästehaus für den kleinen Teil der Besucher umgebaut worden, die sich lieber selbst versorgen, als im Haupthaus zu wohnen und im Gäste-Speisesaal zu essen. Die Gäste wandern gern über den Küstenweg, besuchen Padstow und nehmen an den täglich stattfindenden Gottesdiensten in der Kapelle teil. Das Gästehaus ist ein ansehnliches Gebäude, das nordwestlich auf die Atlantikküste und das Meer und südöstlich auf den Obstgarten hinausgeht, wo zwischen den Apfelbäumen der Wohnwagen steht.
Früher einmal hatte sich eine Nonne zur Klausur in den Wohnwagen zurückgezogen; jetzt ist er Jannas Zuhause. Sie kommt das Treppchen herunter, bindet sich einen bunten Seidenschal über ihre Löwenmähne und wappnet sich gegen die kalte Luft. Drinnen, wo die tief stehende Wintersonne durch die Fenster des Wohnwagens strömt, ist es gemütlich warm; das blendend helle Licht scheint auf ihre wenigen kostbaren Besitztümer und lässt die kleine Silbervase, die Clem und Jakey ihr zu Weihnachten geschenkt haben, aufblitzen. Unter den Bäumen hat Janna ein paar blasse, von grünen Äderchen durchzogene Schneeglöckchen gefunden, um sie hineinzustellen; und jeden Morgen, wenn sie sich zum Frühstücken an den kleinen Tisch setzt, sieht sie die zarten Blüten voller Freude an.
Die Vase ist aus echtem Silber, und dieses kostspielige Zeichen der Zuneigung zu ihr hatte sie sowohl schockiert als auch entzückt. Behutsam hatte sie das Geschenk geöffnet und war sich Jakeys Aufregung und Clems leichter Besorgnis bewusst gewesen. Ihr Entzücken hatte beide gefreut, und sie hatten einen erleichterten Mann-zu-Mann-Blick gewechselt, der Janna belustigt hatte.
»Ich finde sie wunderbar«, sagte sie. »Sie ist wirklich schön«, und sie stellte die Vase auf den Tisch, zog die verschlungenen Ziselierungen mit dem Finger nach und umarmte dann Jakey. Clem umarmte sie nicht: Clem ist kein Mensch, den man so einfach in den Arm nimmt; nicht wie Dossie, seine Mum, oder Schwester Emily zum Beispiel. Zum einen ist Clem sehr groß und sehr schlank, und er hat etwas Asketisches an sich. Dossie hatte das Wort einmal gebraucht: »Der gute Clem ist ein wenig asketisch, nicht wahr?« – ziemlich wie Vater Pascal. Janna liebt Vater Pascal, weil er niemals in Zweifel zieht, was sie sagt, und kein Urteil über sie fällt. Daher hat sie ihm nach einer Weile von sich erzählt: vom Verschwinden ihres Vaters noch vor ihrer Geburt, als ihre Mum noch selbst fast ein Kind gewesen war. Davon, wie sie auf der Straße gelebt haben und wie sie dann, später, in Pflegefamilien gekommen war, weil ihre Mum zu viel getrunken hatte, und wie sie immer wieder aus ihren Pflegestellen weggelaufen war und versucht hatte, ihre Mum zu finden.
»Das Reisen hat uns gefehlt«, erklärte sie ihm. »Immer unterwegs zu sein. Andere Orte zu sehen. Am Ende, als sie im Rollstuhl saß, konnte sie es nicht ertragen. Ich bin genauso. Trains and boats and planes …« Sie summte die Melodie. »Keine Ahnung, warum.«
»Wir alle sind Pilger«, meinte Vater Pascal nachdenklich. »Auf die eine oder andere Weise, nicht wahr? Immer auf der Suche nach etwas.«
Janna verknotet den Schal im Nacken und hält inne, um dem großen Topf mit Winter-Stiefmütterchen, der neben dem Treppchen steht, Ehre zu erweisen. Die Blüten, die cremeweiß, golden und lila sind, wenden der Wintersonne ihre hübschen, seidigen Gesichter zu. Sie erschauert und kriecht tiefer in die warme Wolljacke. Dossie hat sie ihr geschenkt. Sie ist fast knielang, aus weicher violetter Wolle, elegant und wunderbar warm. Als Janna dieses Mal ihr Geschenk geöffnet hat, konnte sie ihre Rührung nicht verbergen. Sie und Dossie umarmten sich, und auch in den Augen der Älteren glänzten Tränen. Es war das, was Dossie »einen dieser Momente« nennt; aber sie hat viele solcher Augenblicke: Schokoladenkuchen zum Kaffee kann einer sein oder schnell für eine Stunde nach Padstow hineinzufahren, um die Sonne zu genießen und dann an der Hafenmauer Fish and Chips zu essen. »Ich glaube, wir brauchen einen ›Moment‹, Liebes.« Mit ihren »Momenten« zelebriert Dossie das Leben, und Janna akzeptiert sie voller Freude, denn sie versteht sie. Auch sie hat eine Leidenschaft für Picknicks, improvisierte Mahlzeiten und spontane Ausflüge.
Ihre eigenen Weihnachtsgeschenke an die anderen fielen weit einfacher aus: für Jakey ein Malbuch mit Thomas, der kleinen Lokomotive, zwei gepunktete Taschentücher für Clem und ein hübsches Stück Porzellan vom Markt für Dossie. Janna verdient nicht viel, lebt aber in ihrem Wohnwagen mietfrei, und sie bekommt in der Klosterküche gut zu essen und schätzt sich glücklich: Das ist viel besser, als in der Sommersaison in Pubs zu kellnern und während der Wintermonate jeden Job anzunehmen, der sich einem bietet.
Von dieser Stelle hat Janna gehört, als sie am Ende der Saison in Padstow arbeitete, und eines windigen Nachmittags kam sie zu Fuß von Trevone hier herauf. Sie ließ die Surfer, denen sie sich angeschlossen hatte, am Strand zurück und ging im Sonnenschein des späten September über die Klippen. Sie kam über den Klippenpfad. Die Möwen kreischten über der auslaufenden Flut, und der Wind wehte in ihrem Rücken.
»Der Westwind hat sie hergeweht«, pflegt Schwester Emily strahlend zu sagen, »und das war ein wunderbarer Tag für uns.«
Merkwürdig, denkt Janna, wie schnell sie sich hier zu Hause gefühlt hat. Schon als sie zwischen den beiden hohen Granitsäulen hindurchschritt, das Pförtnerhäuschen passierte und die Auffahrt entlangging, hatte sie das Gefühl, nach Hause zu kommen. Das große Gebäude aus Granit inmitten seiner Felder, das sich, umgeben von Gärten und dem Obsthain, gen Westen wandte, war so wunderschön und friedlich. Doch sogar trotz des freundlichen Empfangs, den man ihr bereitete, und dieses seltsamen Gefühls, hierher zu gehören, entschied sie sich doch, lieber in dem Wohnwagen im Obstgarten zu leben als in dem bequemen Einzimmer-Apartment im Haus, das die Schwestern ihr anboten. Der Wohnwagen ist abgesondert und bietet Privatsphäre und Unabhängigkeit.
»Er erinnert mich an meine Kindheit«, erklärte sie den freundlichen Schwestern, die darauf brannten, sie willkommen zu heißen und ihre Bedenken zu zerstreuen, »als wir auf der Straße gelebt haben.«
Falls die guten Frauen erstaunt waren, ließen sie sich nichts davon anmerken. Warmherzig und höflich überließen sie Janna den Wohnwagen, wo sie ihre Freiheit haben würde, und umrissen ihre Pflichten, die einfach waren: das Haus sauber halten, waschen und bügeln und, wenn nötig, auf Schwester Nicola achtgeben, die mit ihren zweiundneunzig Jahren immer vergesslicher wird.
»Früher waren wir vollkommen autark«, sagte Mutter Magda betrübt zu Janna. »Nach innen und außen. Aber damals waren wir zahlreicher, und wir waren jung. Außerdem lebte immer ein Ehepaar im Pförtnerhäuschen, das uns half. Doch der Mann ist gestorben, und seine Frau ist dann zu ihrer Tochter gezogen. Jetzt haben wir Clem, der ein echter Segen ist.«
»Und Jakey«, setzte Schwester Emily hinzu und zwinkerte.
»Also, ich weiß nicht«, gab Schwester Ruth ziemlich kühl zurück, »ob Jakey uns wirklich eine große Hilfe ist.«
»Durch ihn fühlen wir uns wieder jung«, erklärte Mutter Magda bestimmt. »Und er versteht, was Ehrfurcht bedeutet.«
Jetzt geht Janna unter den Apfelbäumen hindurch und überquert den Hof. Die hübschen Zwerghühner mit ihrem Gefieder voll weicher Grau- und warmer Goldtöne stieben vor ihr auseinander und rennen davon. Das Kutschenhaus ist leer; keine Gäste diese Woche. Janna ist froh darüber. Es ist schön, unter sich zu sein. Sie hat es gern, wenn alles in der Familie bleibt, der Familie, nach der sie sich immer gesehnt hat: Mutter Magda, Vater Pascal, die Schwestern Emily, Ruth und Nicola und Clem, Jakey und Dossie. Wie eigenartig, dass sie sie gerade hier gefunden hat, unerwartet, in diesem winzigen, hochgelegenen Tal, das steil zum Meer hin abfällt! Durch die Hintertür tritt sie ein und geht in die Küche.
In der Kapelle sind die Nonnen beim Morgengebet. Schwester Nicola sitzt da und sieht starr auf das Doppelbogen-Fenster und die kahlen, reifbedeckten Zweige des Fliederbusches dahinter. Ihre Gedanken sind nicht immer klar, und sie stellt sich vor, dass sie, wenn sie einatmet, den berauschenden Duft des blühenden Flieders riechen kann, der durch das offene Fenster hineinweht, und das Zwitschern der Amsel hört, die in seinem Blattwerk sitzt. Doch heute Morgen ist das Fenster geschlossen, um die Winterkälte abzuhalten, und bis zum Frühling dauert es noch einige Zeit. Neben ihr steht Schwester Ruth auf, um an das Pult zu treten. Schwester Nicola sieht der hochgewachsenen, schmalen Gestalt nach und versucht, sich an ihren Namen zu erinnern. Sie schaut sich in der Kapelle um, sieht die Gesichter lange Verstorbener und ruhige, aufmerksame Gestalten, die in den leeren Bänken sitzen, und sie beobachtet Mutter Magdas schmales, fein gezeichnetes Gesicht und ihre gelassenen blauen Augen und Schwester Emilys intelligenten, direkten Blick und ihren verhalten lächelnden Mund. Die beiden sehen Schwester Ruth an – ja, das ist ihr Name, und Schwester Nicola nickt erfreut, als er ihr einfällt –, die jetzt die Bibel aufschlägt und zu lesen beginnt.
»›Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir!‹«
Jesaja. Epiphanias. Die Vertrautheit des Kirchenjahrs, das sich in seinem endlosen Reigen dreht, tröstet Schwester Nicola. Es bleibt, während ihr so vieles andere entgleitet. Ihr Kopf sinkt ein wenig nach vorn, aber sie schläft nicht.
Clem trifft vor Janna in der Küche ein und kippt Gemüse aus einem Korb auf eine Zeitung, die auf dem großen, sauber gescheuerten Tisch ausgebreitet ist. Auf dem Herd köchelt Brühe in einem Topf, doch von Penny, die aus dem Dorf heraufkommt, um zu kochen, ist keine Spur zu sehen. Janna und Clem lächeln einander zu. Während der paar Monate, die Janna jetzt im Kloster lebt, hat sie gelernt, sich behutsam zu bewegen und sehr leise zu sprechen. Die Nonnen legen großen Wert auf Stille, obwohl es hier, in der Küche, gestattet ist, sich leise zu unterhalten. Clem ist von Natur aus schweigsam. Janna und Penny dagegen müssen während der Zubereitung des Essens oft verärgerte Ausrufe oder Gelächter dämpfen, wenn sie sich gegenseitig im Weg stehen, die Kartoffeln anbrennen oder einen Teller fallen lassen. Wenn Schwester Emily leise hinter ihnen eintritt, lächelt sie oft; aber Schwester Ruth steht solchen Ausbrüchen weniger verständnisvoll gegenüber. Der gleichmütige Blick aus ihren hellen Augen ruft die beiden Frauen sehr schnell wieder zur Ordnung, und Emilys dunkle Augen ziehen sich dann mitfühlend zusammen.
An ihrem freien Nachmittag kommt Schwester Emily oft auf eine Tasse Tee in den Wohnwagen im Obstgarten. Die Schwester liebt das Leben mit einer für ihre zweiundachtzig Jahre erstaunlichen Leidenschaft. Angesichts eines besonderen Kuchens oder der Vielfalt von Jannas Früchtetees blitzen ihre Augen.
»Echinacea und Himbeere«, murmelt sie. »Kamille, Zitrone und Minze. Wie köstlich! Wofür soll ich mich nur entscheiden?«
Zum ersten Mal seit Jahren lebt Janna unter Frauen, die sogar noch weniger ihr Eigen nennen als sie selbst. Hier braucht sie ihren Mangel an Besitz nicht zu rechtfertigen; er erscheint sogar als Tugend. Sie hat Schwester Emily ihre kleine Sammlung von Schätzen gezeigt: die Peter-Hase-Tasse, das Buch Little Miss Sunshine von Roger Hargreaves und den fadenscheinigen indischen Seidenschal.
»Meine Mum hat mir die Sachen geschenkt, als ich klein war«, sagte sie, als müsste sie sich rechtfertigen. »Sie hat mich geliebt, verstehen Sie, obwohl sie sich von mir trennen musste. Sie hat mir Sachen gekauft und mich ›ihre kleine Miss Sunshine‹ genannt. Sie wollte mich nicht verlassen, aber sie war wirklich krank.«
Die Ältere nickte verständnisvoll und betrachtete die Schätze mit nachdenklichem Blick. Dann lächelte sie Janna zu. »Wenn Sie sie nicht mehr brauchen, werden Sie frei sein«, sagte sie. Sie klang ermunternd, beinahe frohlockend, als wäre es selbstverständlich, dass Janna auf dieses aufregende und lohnende Ziel hinarbeite.
Ihre Worte verblüfften Janna. Sie war daran gewöhnt, dass andere Menschen sie freundlich zu trösten versuchten, ihr erklärten, sie könnten nachvollziehen, wie wichtig ihr diese Symbole seien.
Aber Schwester Emily scheint da ganz anders gestrickt zu sein. Janna denkt häufig darüber nach. Die Reaktionen der Schwester sind oft unerwartet.
Clem lenkt ihre Aufmerksamkeit auf ein kleines Stück Papier, das auf dem Brotschneidebrett liegt. Eine Nachricht. Unwillkürlich lächelt Janna: Die Schwester teilen einander so vieles über Zettel mit. Sie horten kleine Stücke Papier, von einem Brief abgerissen; die Rückseiten gebrauchter Briefumschläge, Quittungen. Nichts wird verschwendet. Zusammengefaltete Nachrichten werden unter Türen hindurchgeschoben, auf Betten oder die Bänke in der Kapelle gelegt. Clem sieht Janna über die Schulter, und sie lesen die Nachricht zusammen.
Penny fühlt sich nicht wohl, steht da in Mutter Magdas krakeliger Handschrift. Die Suppe habe ich schon aufgesetzt. Kommen Sie auch zurecht, liebe Janna?
Es muss schwierig für die Nonnen sein, überlegt Janna, so abhängig zu sein, nachdem sie früher so autark waren.
»Gemüsesuppe?«, flüstert Clem ihr ins Ohr und deutet mit einer Kopfbewegung auf seine Mitbringsel: Möhren, Zwiebeln, Kartoffeln und ein paar Porreestangen.
Sie nickt und dankt ihm mit einem Lächeln, und er geht wieder an seine Arbeit, während sie das Gemüse zum Spülbecken trägt und beginnt, es unter dem Wasserhahn zu waschen.
Eine Woche später türmen sich über dem Meer im Westen graue Wolken auf. Hoch aufragend und überquellend rasen sie, angetrieben von heftigen Winden, die auf die Halbinsel eindringen, auf die Küste zu. Eis schmilzt, verwandelt sich in Wasser und beginnt zu tropfen. Die Sonne wird blass und ist nur noch eine zitronenfarbene Scheibe hinter den vorrückenden dünnen Wolkenschleiern, und schließlich verlischt sie ganz. Tiefe, betonharte Fahrrinnen erweichen rasch und verwandeln sich in dichten, schweren Schlamm; Flüsse und Wasserläufe steigen und ergießen sich donnernd durch ihre steinigen Betten.
Die Fenster des Pförtnerhäuschens rappeln im Sturm, und die Bäume knarren und schütteln sich und beugen sich mit winterkahlen Ästen über die Kaminaufsätze. Jakey, der am Küchentisch seinen Nachmittagsimbiss isst, sieht in den dunklen, nassen Garten hinaus. Die Vorhänge sind noch nicht zugezogen, und der helle Innenraum spiegelt sich in dem schwarzen Fensterglas, über das der Regen läuft. Hier in der Küche fühlt er sich sicher und warm. Daddy sitzt am anderen Ende des Tisches vor seinem aufgeklappten Laptop.
Jakey nimmt vorsichtig noch ein paar gebackene Bohnen auf die Gabel und steckt sie in den Mund. Neben seinem Teller hält der Streifenhase Wache. Ab und zu hebt Daddy den Kopf und fragt: »Alles okay, Jakes?«, und er nickt. Er mag es gern, wenn Daddy bei ihm ist, sich aber mit etwas anderem beschäftigt, und er den Streifenhasen zum Greifen nahe hat. Dann fühlt er sich sicher und gleichzeitig frei; frei, über alles Mögliche nachzudenken und auf die Geräusche zu hören. Im Moment nimmt er jede Menge Laute wahr: den Regen, der wie mit langen Fingern an das Fenster trommelt; das leise Summen des Laptops; das Brummen des Kühlschranks und das Gurgeln in der Heizung.
Gleich wird Daddy aufstehen und die Teller in die Spülmaschine stellen. Er wird die große schwere Tür öffnen, und der Geschirrspüler wird seinen schlechten Atem in die Küche entlassen. Dossie findet, dass Daddy die Teller zuerst abspülen soll, besonders, wenn sie Fisch gegessen haben, und Daddy sagt, wenn er das täte, wäre es ja vollkommen zwecklos, einen Geschirrspüler zu haben. Dann verdreht Dossie die Augen und stößt einen tiefen Seufzer aus, und Daddy räumt einfach weiter das Geschirr in die Spülmaschine und hat dabei einen komischen Gesichtsausdruck. Jakey nimmt ein Stück Toast, wischt damit die dicke Tomatensoße von seinem Teller auf und denkt über diese Miene nach. Genauso schaut Daddy manchmal drein, wenn er, Jakey, unartig ist. »Treib es nicht auf die Spitze, Jakes«, sagt Daddy, und dann hört er am besten mit dem Unsinn auf. Zufrieden kaut Jakey seinen Toast und überlegt, ob er wohl Nachtisch bekommt, wenn er alles aufisst, was er auf dem Teller hat.
Clem klappt seinen Laptop zu.
»Alles aufgegessen?«, fragt er. »Gut gemacht.« Er nimmt Jakeys Teller und stellt ihn in die Spülmaschine. »Wie wäre es jetzt mit einem Fruchtzwerg? Möchtest du einen? Oder ein paar Trauben?«
»Fruchtssswerg und Trauben«, erklärt Jakey bestimmt. »Und einen Keksss.«
»Über den Keks denken wir noch einmal nach«, erklärt Clem. Dossie und das Kindermädchen, das sich in London um Jakey gekümmert hat, haben ihn bezüglich der Ernährung seines kleinen Sohnes gut instruiert, obwohl er sich manchmal erlaubt, die Regeln ein wenig zu beugen. Er greift über das Spülbecken hinweg, um die Vorhänge zuzuziehen. Janna hat mehrere Töpfe Alpenveilchen mitgebracht, die auf dem weiß gestrichenen Fensterbrett stehen. Ganz unaufdringlich bringt sie hübsche, skurrile und weichere Aspekte in ihre Männerwelt ein, und Clem ist dankbar dafür. Zwischen ihnen hat sich rasch eine lockere Beziehung entwickelt, die keine großen Ansprüche stellt. Jannas Natürlichkeit wärmt ihm das Herz und mildert seine asketische Art. Sie bringt ihn zum Lachen, und Jakey liebt sie.
»Wir sind die beiden ›J‹«, sagt sie zu ihm. »Wir sind ein Team: Gib mir fünf, Partner«, und Jakey stellt sich auf die Zehenspitzen und reckt den Arm in die Höhe, um gegen Jannas Hand zu schlagen.
Gerade, als Clem an sie denkt, klopft es schnell und leise an der Tür, und sie kommt herein und versprüht Regentropfen. Ihr Gesicht ist von Wind und Regen gerötet.
»Pfui, Spinne!«, ruft sie aus. »Was für ein Abend! Hier drinnen ist es aber schön warm. Da sind Ihre Einkäufe!« Sie hievt zwei große Taschen auf den Tisch, und Jakey schiebt sich auf seinem Stuhl hoch, um hineinzuspähen.
»Danke, Janna.« Clem nimmt einen Fruchtzwerg aus dem Kühlschrank und gibt ihn seinem Sohn. »Ehrlich, ich bin Ihnen wirklich dankbar.«
»Ich wäre sowieso gegangen. Ich hoffe nur, dass ich an alles gedacht habe.«
Clem beginnt, Packungen herauszunehmen: Fischstäbchen, Würstchen, Joghurt.
»Gut, dass Ihre Mum Profiköchin ist und Ihren Tiefkühlschrank mit richtigem Essen auffüllt«, bemerkt Janna.
»Ich kann kochen«, gibt Clem unbeeindruckt zurück. »Zufällig mögen Jakey und ich Würstchen und Fischstäbchen.«
»Ich liebe Würssstchen«, verkündet Jakey. »Würssstchen sind mein Lieblingsssesssen.« Er hüpft auf seinem Stuhl herum, strahlt Janna an, wedelt mit dem Löffel und macht sich wichtig.
Clem stellt ein Schälchen Trauben vor ihn hin. »Iss anständig, sonst kriegst du Bauchschmerzen. Tee, Janna?«
»Sehr gern.« Sie setzt sich neben Jakey. Clem schaltet den Wasserkocher ein und beginnt, Büchsen und Päckchen in den Schrank zu stapeln. Janna sieht Jakey an und blinzelt ihm kurz zu.
»Und, was hast du zu Abend gegessen, Liebchen?«, fragt sie. »Nein, sag’s mir nicht. Bohnen auf Toast mit Würstchen.«
»Er mag Bohnen auf Toast mit Würstchen.« Clem schließt die Schranktür. »Sehr nahrhaft. Das Essen in der Vorschule ist gut, und Dossie ist oft hier und sorgt dafür, dass er ausgewogen ernährt wird.«
Jakey weiß, dass Janna Daddy aufzieht und Daddy nichts dagegen hat; er lächelt, während Clem einen Teebeutel in die Tasse hängt. Jakey isst ein paar Trauben. Er zieht die Nase kraus, rutscht hin und her und versucht, sich darüber schlüssig zu werden, ob er Jannas Aufmerksamkeit einfordern und sie bitten soll, mit ihm zu spielen oder ihm eine Geschichte vorzulesen. Aber ein Teil von ihm weiß, dass dies eine gute Gelegenheit ist, um zu fragen, ob er fernsehen darf. Normalerweise darf er ein wenig länger als sonst schauen, wenn Besuch da ist und die Erwachsenen reden. Er isst seine Trauben auf und nimmt den Streifenhasen.
»Kann ich runtergehen, Daddy? Kann ich fernsehen?«
»›Darf ich runtergehen?‹ Okay, ja. Aber nicht so lange. Warte mal! Lass mich dein Gesicht abwischen!« Das Wasser kocht. Clem gießt Jannas Tee auf, stellt den Becher neben sie hin und geht mit Jakey ins Wohnzimmer. Sie hört sie darüber diskutieren, wer welche Knöpfe drücken soll und was Jakey ansehen darf und wie lange. Kurz darauf kommt Clem zurück und setzt sich an den Tisch. Er schiebt den Laptop beiseite und nimmt seine halb geleerte, fast kalte Kaffeetasse.
»Das Anstrengendste ist, ihm immer einen Schritt voraus zu sein«, sagt er. »Ich hatte ja keine Ahnung, wie gewieft ein Vierjähriger sein kann. Er kann stundenlang diskutieren, und das Beängstigendste ist, dass seine Argumente sehr logisch sind. Ich komme manchmal an einen Punkt, an dem ich schreien möchte: › … weil ich es so will!‹ Aber dann hätte ich das Gefühl, dass er mich ausgetrickst hat. Es ist, als lebte man mit Henry Kissinger zusammen. Dossie kann ihn besser zur Raison bringen als ich.«
»Sie hat schließlich viele Jahre an Ihnen geübt. Außerdem ist sie eine Frau und damit weit gewiefter, als Jakey es jemals werden kann.«
Sie sitzen entspannt zusammen und sprechen über ihren Tag. Janna trinkt einen zweiten Becher Tee. »Vorhin war da so ein Mann«, sagt sie. »Komischer Kerl. Ist einfach so herumgelaufen. Haben Sie ihn gesehen?«
Clem schüttelt den Kopf. »Ich habe das kleine Zimmer im Westflügel renoviert. In den letzten paar Tagen war es unmöglich, draußen zu arbeiten, und Gäste haben wir im Moment nicht. Was genau meinen Sie mit ›komisch‹?«
Janna runzelt die Stirn. »Er schien sich ein wenig unbehaglich zu fühlen, als er mich gesehen hat. Ich bin hintenherum ins Dorf hinuntergegangen, und er muss diesen Weg heraufgekommen sein, weil er um die Rückseite der Remise ging und sich umsah. Also habe ich ihn gefragt, ob er etwas wolle, und er sagte Nein und er habe nicht gewusst, dass die Straße direkt auf das Gelände führe. ›Dann ist das hier das Kloster?‹, fragte er, ganz munter und interessiert. Und er meinte etwas darüber, dass es prima sei, seine eigene Privatstraße ins Dorf zu haben. Und dann sagte er: ›Aber andererseits war das Dorf früher auch im Besitz des Klosters, oder?‹ Nachdem ihm das herausgerutscht war, wirkte er verlegen, und ich wusste nicht, wovon er redete, deswegen habe ich ihn einfach stehen lassen. Verstehen Sie, ich wollte nicht mit ihm zusammen hinuntergehen. Ich habe mich in seiner Gegenwart unwohl gefühlt. Nachher habe ich mich gefragt, ob es richtig war, ihn sich selbst zu überlassen, aber er sah nicht ungepflegt aus oder so etwas. Er war ziemlich schick angezogen. Was hat er damit gemeint, dass das Dorf früher dem Kloster gehört hätte?«
»Bevor es Kloster wurde, waren Chi-Meur und Peneglos, die Kirche und das ganze Ackerland in dieser Gegend Eigentum der Familie Bosanko. Als Elizabeth Bosanko Chi-Meur einer kleinen Gemeinschaft von Nonnen hinterließ, wurden das Dorf und die meisten Bauernhöfe verkauft. Offensichtlich hat dieser Bursche die Lokalgeschichte studiert. Aber trotzdem sollte man meinen, er hätte das Schild am Hintereingang gesehen, auf dem Privatgelände steht.«
»Das dachte ich auch, doch ich wollte nicht unhöflich sein. Sie wissen schon – er hätte ein Besucher sein können, den die Schwestern erwarten. Schließlich tauchen bei uns auch andere merkwürdige Menschen auf.«
Clem zuckt die Schultern. »Nun ja, er kannte sich eindeutig mit der hiesigen Geschichte aus. Vielleicht war er nur ein neugieriger Besucher, der unten im Dorf abgestiegen ist.«
Janna trinkt ihren Tee aus und wirft einen Blick auf die Uhr. »Ich sollte sehen, dass ich weiterkomme. In zehn Minuten ist der Vespergottesdienst zu Ende, und Schwester Ruth wird Hilfe beim Abendessen brauchen. Ich habe Ihnen das Wechselgeld auf den Tisch gelegt. Danke für den Tee.«
»Ich danke Ihnen fürs Einkaufen«, antwortet Clem. Er steckt das Kleingeld in die Tasche, knüllt den Kassenzettel zusammen und wirft ihn in den Mülleimer. Ein Teil von ihm wünscht, er hätte Janna eingeladen, später zurückzukommen und mit ihm zu essen; aber er weiß, dass er froh sein wird, einfach mit einem Sandwich vor dem Fernseher zusammensinken zu können, nachdem er Jakey wie immer gebadet und ins Bett gebracht hat. Die Instandhaltung des Grundstücks und des Hauses bedeutet schwere körperliche Arbeit, und außerdem muss er dafür sorgen, dass Jakey bekommt, was er braucht. Dossie und Janna sind eine großartige Hilfe, doch die schmerzhafte Leere besteht weiter: Madeleine fehlt ihm, und der Frieden, den er einst gekannt hat – dieser tiefe Frieden, der daraus erwächst, seine Berufung erkannt zu haben und sie zu leben.
Die Hände in den Taschen vergraben, steht er neben dem Tisch und lässt den Kopf hängen. Als Madeleine starb, hat ihn der Schock aus der Bahn geworfen. Er war vollkommen orientierungslos. Ein paar Eckpunkte waren allerdings klar: Sie hätte gewollt, dass er selbst für ihr gemeinsames Kind sorgt, und das hätte er in Oxford unmöglich tun können. Ihre Eltern lebten und arbeiteten in Frankreich und konnten ihm daher keine große Hilfe sein. Dossie hatte ihm zwar angeboten, ja, ihn angefleht, sie nach Oxford ziehen und ihm den Haushalt führen zu lassen, aber er konnte unmöglich die Verantwortung für diesen Umzug auf sich nehmen, der ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt hätte. Schließlich hat sie das alles schon einmal durchgemacht: den Verlust ihres geliebten Mannes durch einen Autounfall und die Aussicht, ihr Kind allein großzuziehen. Damals studierte sie im letzten Jahr Gastronomie. Sofort nutzte sie ihr neu erworbenes Wissen und machte sich selbstständig, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen und sich gleichzeitig um ihr kleines Kind kümmern zu können. Wie in aller Welt hätte er, Clem, da von ihr verlangen sollen, ihre Kunden, ihre Kontakte und all ihre anderen Verpflichtungen aufzugeben? Unmöglich. Clem schüttelt den Kopf. Auch die Alternative – Dossie hätte Jakey mit nach Cornwall nehmen können, während er selbst die nächsten drei Jahre in Oxford studierte – stand außer Frage. Jakey hatte schon seine Mutter verloren; er brauchte seinen Vater. In London konnte Clem gutes Geld verdienen und sich ein Kindermädchen in Vollzeit leisten; und er hatte das Netzwerk seiner Freunde, die ihn unterstützten. Eine trübe Aussicht im Gegensatz zu allem, auf das er sich gefreut hatte; aber andererseits, wie konnte er sicher sein, dass sein Gefühl, berufen zu sein, ihn nicht trog? Falls er wirklich zum Geistlichen berufen war, warum war diese Tragödie ausgerechnet während der ersten Monate seiner Ausbildung geschehen? Lange haderte er mit Gott, zornig, verzweifelt und voller Schmerz.
Im Rückblick erkennt er, dass all seine Entscheidungen von Schuldgefühlen und Trauer bestimmt waren – und doch hat sein Weg ihn drei Jahre später nach Chi-Meur geführt. Und hier findet er bei der Arbeit an diesem magischen Ort, der so nahe am Meer liegt, Heilung und ein gewisses Maß an Frieden. So ist es auch, wenn er mittags zur Eucharistie in die Kapelle schlüpft oder der Terz, der Vesper oder dem Abendgebet zuhört. Und wenn er in diesem winzigen Haus im Dorf mit Vater Pascal redet.
Langsam und zuerst zögerlich hat Clem mit dem alten Priester über seine Verwirrung und seinen Zorn gesprochen. Er glaubt, durch die Stelle auf Chi-Meur, das Wohlwollen der Schwestern und Jannas Freundschaft Heilung für seine Seele gefunden zu haben. Doch mit welchem Ziel? Wie soll die Zukunft aussehen?
»Vielleicht sind das ja alles Wegweiser?«, hat Vater Pascal bei einer dieser Gelegenheiten gemeint. »Die Großzügigkeit von Fremden, die Liebe von Freunden. Finden Sie nicht, das könnten Wegezeichen auf der Straße zu Gott sein? Die Verheißungen Gottes, der vor Ihnen auf dieser Straße wandelt. Er wird dort auf Sie warten.«
»Aber wo?«, fragte Clem müde. »Ich dachte, ich hätte diesen Weg schon eingeschlagen, und dann hat er sich vor meinen Augen in Luft aufgelöst.«
»Sie haben doch Chi-Meur gefunden. Sie befinden sich wieder auf der Straße, und vielleicht sind Sie sogar ein Stück weitergekommen. Aber die Initiative liegt bei Gott.«
Jetzt nimmt Clem die Hände aus den Taschen: Es ist beinahe Zeit für Jakeys Bad. Er sieht jetzt schon viel länger fern, als er normalerweise darf, und wird nicht aufhören wollen. Clem atmet tief durch und wappnet sich für den Kampf.
Ein Stück weiter die Küste hinunter beugt sich der Fremde, den Janna gesehen hat, über sein Handy.
»Alles ist ziemlich gut in Schuss«, sagt er. »Nettes Haus. So ein Kerl im Pförtnerhäuschen kümmert sich um das Grundstück. Hat alle Hände voll zu tun. Und eine junge Frau in einem Wohnwagen. Mädchen für alles, würde ich sagen. Ziemlicher Hingucker … Nein, nein. Reg dich nicht auf. Nichts dergleichen. Aber ich habe mich im Dorf informiert. Vier Nonnen. ›Schwestern‹ nennen die Leute sie. Schon älter, eine von ihnen ist ein bisschen gaga. Kann mir nicht vorstellen, wie sie so weitermachen sollen, obwohl sie bei den Dorfbewohnern sehr beliebt sind … Nein, ich wohne nicht im Dorf. Ich bin in einer Frühstückspension ein Stück die Küste hinauf. Ein Bauernhof. Nett und ruhig. Sehr einfach, ländlich-sittlich, aber in Ordnung. Ich habe den Leuten erzählt, dass ich ein Buch über die Küste von Nordcornwall und seine Geschichte schreibe, und sie sind fasziniert.
Wir machen also unser Angebot und warten? Und wenn sie annehmen, kann man beweisen, dass das Haus nicht mehr als Kloster geführt werden wird, und dann kannst du auftauchen, dein Papier schwenken und erklären, dass du nach den Bedingungen des Alten Testaments als letzter Nachfahre dieses Zweigs der Bosankos ein Anrecht auf das Erbe hast … Ja, ich weiß, das habe ich jetzt ein bisschen einfach ausgedrückt, aber da stehen wir, oder? … Nein, niemand hört mich. Sei nicht so nervös. Ich habe dir doch gesagt, dass ich behaupte, für ein Buch zu recherchieren. Vielleicht wird es ja fürs Fernsehen adaptiert. Ich habe ein paar bekannte Namen fallen lassen, und die Einheimischen können es nicht abwarten, dafür gefilmt zu werden. Jeder will mitreden. Phil Brewster hält sich bereit und wird in Aktion treten, sobald du ihm den Startschuss gibst … Okay, ich sehe mich noch mal um. Morgen um die gleiche Zeit? Okay.«
Er drückt das Gespräch weg, sieht sich in dem ordentlichen, gemütlichen Zimmer um und schaut dann hinaus in die nasse, kalte Nacht. Keine Geräusche, keine Straßenbeleuchtung. Er erschauert, zieht eine Grimasse und fragt sich, wie Leute es aushalten, in dieser Stille zu leben. Dann schließt er die Vorhänge, bleibt einen Moment stehen und denkt nach. Der Plan erscheint verrückt, aber Tommy hat schon ein paar Geschäfte mit ihm durchgezogen, die hart am Limit waren, ein wenig zweifelhaft, doch lukrativ. Kluger Junge, dieser Tommy; ein alter Bekannter aus dem Internat mit einer Menge Kontakten zu gehobenen Kreisen. Aber er hält einen auf Trab, sitzt einem im Nacken. Bei ihrem letzten Treffen war er völlig aus dem Häuschen.
»Hör gut zu«, hat er aufgeregt gesagt. »Ein Freund von mir unten in Truro, ein Anwalt, hat etwas Interessantes über ein altes Familienerbe von mir ausgegraben. Ich möchte, dass du hinfährst und dich umsiehst. Der Besitz ist seit fast zweihundert Jahren ein Kloster, doch wenn wir Beweise dafür beibringen können, dass es als solches nicht mehr lebensfähig ist, fällt es diesem Dokument zufolge an die Nachfahren dieses speziellen Zweigs der Familie. Und der letzte noch lebende Nachfahre bin ich. Wir haben das überprüft. Anscheinend leben dort nur noch ein paar Nonnen, und sie überlegen schon, sich größeren Gemeinschaften anzuschließen. Wir wollen sie aber nicht aufschrecken, verstehst du? Wir verlassen uns darauf, dass niemand das Kleingedruckte gelesen hat. Fahr einfach hin und überprüf es.«
»Verstehe ich nicht. Wenn es sowieso rechtmäßig dir gehört …«
»Sieh mal, Alter.« Tommy ließ durchblicken, dass er Geduld mit ihm aufbrachte. »Du stellst fest, ob die guten alten Damen wegziehen wollen. Wenn ja, gibst du Phil Brewster das Okay. Er zieht seine Hotelier-Nummer ab und macht ein sehr schönes Angebot, und die Nonnen denken, sie könnten es in die Geldschatulle ihrer Religionsgemeinschaft stecken, um ihre Zukunft zu sichern. ›Oh, ja‹, sagen sie. ›Vielen Dank auch.‹ Er besorgt sich eine eindeutige Aussage von ihnen, dass sie das Angebot annehmen, gibt es an dich weiter, und dann – peng – tauche ich mit einem Exemplar des Alten Testaments auf. Der Verkauf kommt nicht zustande, der Laden gehört mir. Ich kenne jemanden, der für einen Besitz genau dort jede Menge Kohle hinblättern würde.«
»Und was haben die Nonnen davon?«
An diesem Punkt lachte Tommy, er schüttete sich regelrecht vor Lachen aus. »Du kapierst es nicht, was? Sie haben gar nichts davon. Ich kriege den alten Familienbesitz zurück und verscherbele ihn an den Meistbietenden, und sie haben immer noch ihren Schatz im Himmel, dem Motten und Rost nichts anhaben können. Jetzt mach dich an die Arbeit und beschaff den Beweis, und dann trete ich auf! Die übliche Bezahlung plus Spesen.«
Jim Caine hebt den Kopf. Der Wind frischt auf, und Regen klatscht gegen das Fenster. Die Familie hat ihn zum Abendessen eingeladen, und er hat dankbar angenommen. Er wird sich eine Geschichte über das Buch ausdenken, von einer Fernsehserie sprechen und ein paar berühmte Namen aus dem Filmgeschäft erwähnen.
Er hört etwas. Die Bauersfrau kommt die Treppe herauf, und er geht ihr rasch entgegen und schließt die Tür hinter sich, damit ihre scharfen schwarzen Augen in seinem Zimmer nichts erkennen können.
Neugierige Gans, denkt er, aber er lächelt sie an und knipst seinen Charme an.
»Ist das Essen schon fertig, Mrs. Trembath? Herrje, habe ich einen Hunger, nachdem ich den ganzen Tag draußen war!«
»Wartet nur auf Sie, Mr. Caine«, sagt sie, und er folgt ihr die Treppe hinunter.
Dossie legt das Telefon weg und macht sich auf dem Laptop ein paar Notizen. Heute Morgen arbeitet sie in der Küche, denn dort ist es viel wärmer als in ihrem winzigen Büro oben, das nach Norden hinausgeht; doch wenigstens hat sie heutzutage ein eigenes Arbeitszimmer. Vieles hat sich verändert, seit sie vor vielen Jahren als blutjunge Witwe nach Hause zurückgezogen ist, um ihr Kind zu bekommen und zu versuchen, sich ein Geschäft aufzubauen. Ihre Eltern haben zusätzlich zu ihrer ziemlich skurrilen Frühstückspension, die sie führten, Clem gehütet, während sie Mittag- und Abendessen organisierte und zu besonderen Gelegenheiten in anderer Leute Küchen Festessen zubereitete.
»Natürlich kommen wir zurecht, Liebling«, hatte ihre Mutter gesagt. »Und wir kennen jede Menge Leute, die ganz wild darauf sein werden, dass du ihre Partys belieferst.«