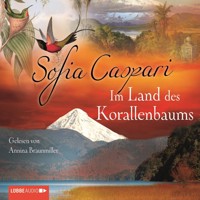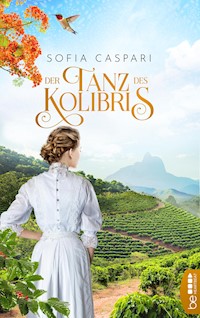9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Deutschland, Gegenwart: Nach der schmerzlichen Trennung von ihrem Freund reist Pia Sommer einer Eingebung folgend nach Kroatien. In das Land, in dem ihr Großvater einst vor Jahrzehnten so glückliche Zeiten verbracht hat. Auf der Insel Cres lernt Pia den charmanten Winzer Goran kennen. Doch als er sie auf sein Weingut einlädt, bringt seine Familie der jungen Deutschen überraschend große Ablehnung entgegen, denn Gorans Onkel verschwand vor über fünf Jahrzehnten spurlos in Deutschland ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungKroatien, Insel Cres – SechzigerjahreErstes KapitelZweites KapitelDrittes KapitelKroatien, Insel Cres – SechzigerjahreViertes KapitelFünftes KapitelKroatien, Insel Cres – SechzigerjahreSechstes KapitelSiebtes KapitelAchtes KapitelKroatien, Insel Cres – SechzigerjahreNeuntes KapitelZehntes KapitelKönigreich Jugoslawien – VierzigerjahreElftes KapitelZwölftes KapitelDreizehntes KapitelVierzehntes KapitelFünfzehntes KapitelSechzehntes KapitelDeutschland – SechzigerjahreSiebzehntes KapitelUnabhängiger Staat Kroatien, Insel Cres – VierzigerjahreAchtzehntes KapitelNeunzehntes KapitelZwanzigstes KapitelEinundzwanzigstes KapitelKroatien, Insel Cres – SechzigerjahreZweiundzwanzigstes KapitelDreiundzwanzigstes KapitelKroatien, Insel Cres – SechzigerjahreVierundzwanzigstes KapitelDeutschland – SechzigerjahreFünfundzwanzigstes KapitelUnabhängiger Staat Kroatien, Insel Cres – VierzigerjahreSechsundzwanzigstes KapitelKroatien, Insel Cres – SechzigerjahreSiebenundzwanzigstes KapitelAchtundzwanzigstes KapitelNeunundzwanzigstes KapitelUnabhängiger Staat Kroatien, Insel Cres – VierzigerjahreDreißigstes KapitelEinunddreißigstes KapitelZweiunddreißigstes KapitelDreiunddreißigstes KapitelDeutschland – SechzigerjahreVierunddreißigstes KapitelFünfunddreißigstes KapitelSechsunddreißigstes KapitelSiebenunddreißigstes KapitelDeutschland – SechzigerjahreAchtunddreißigstes KapitelNeununddreißigstes KapitelKroatien, Insel Cres – SechzigerjahreVierzigstes KapitelUnabhängiger Staat Kroatien, Insel Cres – VierzigerjahreEinundvierzigstes KapitelZweiundvierzigstes KapitelKroatien, Insel Cres – SechzigerjahreDreiundvierzigstes KapitelVierundvierzigstes KapitelFünfundvierzigstes KapitelSechsundvierzigstes KapitelSiebenundvierzigstes KapitelAchtundvierzigstes KapitelNeunundvierzigstes KapitelDeutschland – SechzigerjahreFünfzigstes KapitelEinundfünfzigstes KapitelDeutschland – SechzigerjahreZweiundfünfzigstes KapitelDreiundfünfzigstesKapitelVierundfünfzigstes KapitelFünfundfünfzigstes KapitelSechsundfünfzigstes KapitelRijeka – einige Jahre zuvorSiebenundfünfzigstes KapitelAchtundfünfzigstes KapitelDanksagungÜber dieses Buch
Deutschland, Gegenwart: Nach der schmerzlichen Trennung von ihrem Freund reist Pia Sommer einer Eingebung folgend nach Kroatien. In das Land, in dem ihr Großvater einst vor Jahrzehnten so glückliche Zeiten verbracht hat. Auf der Insel Cres lernt Pia den charmanten Winzer Goran kennen. Doch als er sie auf sein Weingut einlädt, bringt seine Familie der jungen Deutschen überraschend große Ablehnung entgegen, denn Gorans Onkel verschwand vor über fünf Jahrzehnten spurlos in Deutschland …
Über die Autorin
Sofia Caspari, geboren 1972, hat schon mehrere Reisen nach Mittel- und Südamerika unternommen. Dort lebt auch ein Teil ihrer Verwandtschaft. Längere Zeit verbrachte sie in Argentinien, einem Land, dessen Menschen, Landschaften und Geschichte sie tief beeindruckt haben. Heute lebt sie – nach Stationen in Irland und Frankreich – mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Söhnen in einem Dorf im Nahetal.
SOFIA CASPARI
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieses Werk wurde vermittelt durch dieLiterarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30131 Hannover
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: © Rafal Kubiak/shutterstock; adelhoidar/shutterstock; tinta/shutterstock
Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5653-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für M. und A. Unvergessen.
Sechzigerjahre
Ein gutes Stück des Weges war Zlata vollkommen allein gewesen. Es war noch sehr früh am Morgen, nur das Gezwitscher der Vögel und die eigenen schnellen Schritte auf dem steinigen Untergrund, die sie von ihrem Elternhaus in Richtung Hafen führten, zerrissen die Stille. Die Luft war frisch, vom Meer her wehte eine leichte Brise. Ein Hahn stakste ein Stück am Wegrand neben ihr her, plusterte sich auf und entließ ein Krähen in den sich langsam aufhellenden, von rosa- und lilafarbenen Wolkenfetzen überzogenen Morgenhimmel. Nach und nach standen die Häuser dichter, ab und zu fiel nun ein Lichtschein auf den Weg. Eine Frau kam ihr entgegen, sie grüßten einander, und Zlata wusste, dass diese Begegnung spätestens zum Frühstück Gesprächsthema sein würde. Aber darüber wollte sie jetzt nicht nachdenken.
Sie zog die hellgraue Strickjacke enger um die Schultern, beschleunigte ihre Schritte, um so rasch wie möglich Abstand zwischen sich und ihr Elternhaus zu bringen, doch sie gab acht, dass sie nicht in der Morgendämmerung stolperte und sich womöglich den Fuß verstauchte. Dann wäre alles umsonst gewesen.
Als sie das Bett verlassen hatte, um zur Tür hinauszuschleichen – kaum fünf Minuten schien das her zu sein –, da hatte sie befürchtet, ihre Mutter würde von ihrem laut hämmernden Herzen geweckt werden. Aber nichts war geschehen. Aleksija hatte gleichmäßig atmend in ihrem Bett auf der gegenüberliegenden Seite des Schlafraumes gelegen und sich nicht gerührt, auch nicht, als Zlata ihre Kleider zusammengerafft hatte und in den Flur hinausgeschlichen war. Während sie sich so lautlos wie möglich angekleidet hatte, hatte sie immer wieder innegehalten, um zu horchen, doch bis auf ihre eigenen kaum hörbaren Geräusche war alles ruhig geblieben.
Als sie endlich vorsichtig die Tür geöffnet hatte, nur so weit, dass sie nicht quietschen konnte, hatte sie aus der Ferne das erste Hahnenkrähen gehört. Wieder hatte sie verharrt, hatte sich versichern wollen, ob die Mutter nicht geweckt worden war, doch nichts … Behutsam war Zlata die Stufen hinuntergestiegen. Ihre Schritte hatten auf dem Kiesweg geknirscht, als sie vom Haus weg auf das Tor zugegangen war. Alles war ihr unglaublich laut erschienen, doch niemand war hinter ihr hergekommen, niemand hatte grob ihren Arm gepackt, um sie an ihrem Tun zu hindern.
Vor dem Tor hatte sie erneut gezögert und war dann doch entschlossen auf die Straße getreten. Und jetzt hatte sie den Hafen fast erreicht. Da waren so viele Gedanken, die ihr durch den Kopf jagten. Was sollte sie den Menschen sagen, die ihr jetzt begegneten? Sollte sie überhaupt etwas sagen? Sie hoffte, dass niemand Notiz von ihr nahm, sie war nur eine junge Frau, die beabsichtigte, frischen Fisch zu kaufen, eine gute Tochter, die der Mutter Arbeit abnahm. Sie wollte nicht, dass geredet wurde. Gerede würde ihr die Mutter sehr übel nehmen.
Weiter ging es, Schritt um Schritt. Zlata hob den Blick, als sie die Gasse verließ. Das Meer breitete sich vor ihr aus, irgendwo da vorne wartete das Schiff, das ihn von ihr wegbringen würde.
Ihr Herz klopfte schneller. Bald würde sie sie sehen – den einen mit dem struppigen dunkelbraunen Haar, den sie liebte, und den anderen mit dem glatten, halblangen blonden Haar, der sie liebte. Das hatte er ihr vor einigen Tagen gestanden. Seitdem war alles anders.
Würde sie sich auf ihn verlassen können?
Das Ende des Sommers, den Herbst … Sie würde viele Monate ohne ihren Branko verbringen.
Ich werde auf dich warten, eigentlich habe ich jetzt schon damit begonnen.
Zlata wandte sich zum Festland um. Über den Bergen wurde der noch fahle Schein der Sonne stärker. Er berührte die Bergspitzen und übergoss sie mit goldenem Licht. Bald würde er die Insel aus dem Meer emporheben. Die Schatten veränderten sich bereits.
Zlata wandte den Blick ab und schaute zu den Fischerbooten – zu denen, die schon an ihren Plätzen vertäut waren, und danach zu denen, die den Hafen ansteuerten. Sie hörte, wie die Wellen gegen die Kaimauer schwappten.
Die Stimmen wurden lauter. Die Fischer verkauften den Fang der Nacht, große und kleine Fische, silbrige und bunte, dicke und dünne. Erste helle Sonnenflecken tanzten auf dem Wasser, stets für einen Augenblick nur, dann waren sie wieder verschwunden.
Im nächsten Augenblick sah Zlata die beiden. Branko rauchte. Klaus hatte die Arme verschränkt, als würde er frieren, und schaute auf das Schiff, das sie von hier fortbringen sollte.
Wieder einmal ließ ihr die Angst die Kehle eng werden. Sie hatten so oft darüber gesprochen. Es war eine Chance. Branko hatte ihr erzählt, dass es das Beste sei. Er würde richtiges Geld verdienen, und wenn er zu ihr zurückkam, würden sie ein Haus bauen und einen Stall voller Kinder bekommen und niemals mehr Sorgen haben. Sie würden die großzügigsten Gastgeber sein. Keiner musste hungrig oder durstig von ihrem Tisch aufstehen.
Zlata sah, wie Branko sein verknautschtes Päckchen Tabak aus der Hose zog. Er betrachtete es, schien abzuwägen. Es war Klaus, der sie zuerst entdeckte und zögernd die Hand hob. Zlata nickte ihm zu.
Er hat mir versprochen, auf ihn aufzupassen. Er weiß, wie das Leben in Deutschland ist. Ich kenne ihn. Man kann sich auf die Deutschen verlassen.
Vier Jahre war es jetzt her, dass sie sich zum ersten Mal gesehen hatten. Neunzehn war sie damals gewesen, und sie hatten sich noch wie Kinder gefühlt. Erwachsen zu sein hatte in weiter Ferne gelegen. Sie hatten herumgealbert und »Fang die Kuh« gespielt, auch Klaus, der schon studierte und sich ganz allein auf Reisen befand. Er wollte Lehrer werden.
»Zlata!«
Klaus kam auf sie zu. Er sah sie anders an, seit diesem, vielleicht auch schon seit dem vergangenen Sommer. Er hatte sich in sie verliebt, aber natürlich wusste er, dass sie Branko gehörte, und er respektierte das. Er war ein anständiger Mann.
»Klaus …«
Sie lächelte. Für einen Moment standen sie sich unsicher gegenüber. Branko kam herbeigeschlendert, steckte den Tabak wieder ein, täuschte vor, keine Angst zu haben. Aber sie kannte ihn. Sie sah ihm an, wie verunsichert er war. Er hatte die Insel noch niemals verlassen. Sie war mit ihrer Mutter zumindest einmal in Rijeka gewesen, denn dort kam die Mutter her. Ein Stadtmensch war sie, niemals wirklich auf Cres angekommen.
»Du bist da.«
Branko sagte es leise. Zu viele Augen gab es hier. Sie dachte daran, dass sie sich am Abend zuvor hätten verabschieden sollen und dass es jetzt zu spät war. Ihn nicht berühren zu können fühlte sich wie körperlicher Schmerz an.
»Mama hat mir aufgetragen«, sagte sie zu laut und zu steif, »frischen Fisch zu holen.« Sie schaute an Brankos Schulter vorbei auf das Schiff.
»Es wird uns nach Rijeka bringen«, sagte er, als hätte er sie nicht gehört.
Zlata nickte. Ihr Blick fiel auf Klaus’ Leinenrucksack, den er immer bei sich trug. Im letzten Jahr hatte er zu nah am Feuer gelegen und war seitdem an der Seite schwarz von den Flammen. Daneben stand ein abgenutzter Koffer. Brankos neues Leben steckte in diesem Koffer. Ihr neues Leben steckte in diesem Koffer.
Im Winter würde er sie besuchen. Zu Weihnachten. Wenn er sich eingelebt hatte, würde sie ihn sicherlich auch einmal besuchen. Sie freute sich darauf und fürchtete sich zugleich. Am liebsten hätte sie sich in seine Arme gestürzt, doch es war unmöglich. Ihre Mutter würde es zu hören bekommen. Einer der Fischer sah bereits seit einiger Zeit zu ihnen herüber. Sie fühlte sich unwohl. Klaus streckte ihr die Hand hin.
»Auf nächstes Jahr!«, sagte er langsam auf Kroatisch. Er hatte ganz gut gelernt in ihren gemeinsamen Sommern.
»Pass auf ihn auf«, flüsterte sie.
»Das tue ich.« Sie trat einen Schritt zurück.
Branko kam ein wenig näher. »Vergiss mich nicht, Zlata«, sagte er mit belegter Stimme.
»Niemals.«
Sie überlegte, ob sie ihn doch umarmen konnte, ganz kurz, dann entschied sie sich, auch ihm nur die Hand zu reichen. Enttäuschung und Verständnis zeichneten sich auf seinem Gesicht ab. Er ging auf das Schiff zu und balancierte über ein schmales Brett hinüber auf das Deck. Klaus folgte ihm.
Zlatas Augen brannten. Es würde nicht mehr lange dauern, und sie würde ihre Umgebung nur noch verschwommen sehen. Keine Tränen, dachte sie, nicht hier, nicht jetzt, nicht in der Öffentlichkeit.
Klaus und Branko standen nebeneinander an der Reling. Zwei Freunde.
»Bring ihn mir zurück«, sagte sie lautlos.
»Du Hure!«
Ihre Mutter hatte gewartet, bis Zlata die Tür leise hinter sich zugezogen hatte, um sich dann mit geballten Fäusten auf ihre Tochter zu stürzen. Das Paket mit dem frischen Fisch entglitt Zlatas Händen, als sie die Arme hochriss, um sich zu schützen.
Nur um sich zu schützen, niemals würde sie die Hand gegen die Mutter erheben. Sie hatten nur einander. Ihre Mutter war eine Außenseiterin, und sie war ebenso eine, denn die Kinder von Außenseitern konnten nichts anderes sein.
Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn ihr Vater noch leben würde. Nach dessen Tod hatte ihre Mutter sie allein aufgezogen – seine Familie hatte nichts von Aleksija und ihrem Kind wissen wollen. Oft war es hart gewesen, das Geld für sie beide zu verdienen, aber die stolze junge Frau hatte sich nie geschont.
Ein neuer Schlag. Aus dem Halbdunkel kroch das weiße Gesicht ihrer Mutter gespenstisch auf sie zu.
»Wo warst du? Warum schleichst du dich morgens aus dem Haus wie ein billiges Flittchen?«
»Im Hafen. Ich wollte Fisch …«
Dieses Mal traf die flache Hand ihrer Mutter ihre linke Wange. Sie brannte wie Feuer.
»Lüg nicht.«
»Ich lüge nicht. Der Fisch liegt da. Ich habe Branko und den Deutschen zufällig am Hafen gesehen.«
Aleksija hatte schon wieder ausgeholt und hielt dann inne. »Er geht also wirklich? Sicher bist du ihm zu alt, eine alte Jungfer bist du! Wusstest du es? Dass er dich allein zurücklassen würde? Ja, so sind die Männer. Sie sind feige.« Sie verzog das Gesicht zu einem höhnischen Grinsen. »Er wäre ohnehin nichts für dich gewesen.« Unvermittelt packte sie Zlata am Arm und zerrte sie in die Küche, wo bereits ein Feuer im Ofen loderte. Während sie einen Kessel Wasser aufsetzte, warf sie ihrer Tochter einen kurzen Blick über die Schulter zu. »Geh Holz hacken«, befahl sie. »Ich kann den Herbst schon riechen. Und übrigens … Er wird dich vergessen. Ach, wie schnell wird er dich vergessen.«
Zlata konnte sich nicht mehr beherrschen. »Er wird mich nicht vergessen.«
»Hat er dir das versprochen?« Aleksija lachte verbittert auf und wandte sich Zlata erneut zu. »Sie versprechen so viel, wenn sie etwas von einem wollen. Aber wenn du sie brauchst, dann sind sie nicht da.« Sie musterte ihre Tochter mit zusammengekniffenen Augen. »Hast du ihm etwas dafür gegeben? Sag schon, du kleines Miststück, hast du? Ich erfahre es ja ohnehin. Man wird es mir erzählen, das weißt du.«
»Ich habe nichts getan.«
»Oh, ich habe nichts getan«, äffte ihre Mutter sie nach. »Das hoffe ich für dich, das hoffe ich sehr.« Sie hielt kurz inne. »Sind das Tränen? Ach je, Kindchen, Tränen nutzen dir nichts. Tränen haben noch keinem was genutzt …«
Zlata nahm sich vor, darauf zu achten, dass ihre Mutter es nicht mitbekommen würde, wenn einer von Brankos Briefen eintraf. Sie wollte nicht verletzt werden. Ihre scharfzüngige Mutter wurde nicht müde zu betonen, dass sie umsonst wartete, dass alle Männer eines Tages fortgingen und nicht wiederkamen. Dass man als Frau letztlich immer allein dastand. »Er wird dich verlassen, wie dein Vater mich verlassen hat«, sagte sie immer und immer wieder.
Zlata dachte daran, dass ihr Vater im Krieg gefallen war und dass er gewiss nicht beabsichtigt hatte, nie wiederzukommen. Er hatte doch nicht sterben wollen. Sie kannte ihn von Fotos. Er war ein guter Mann gewesen. Er wäre auch ein guter Vater gewesen. Sie fand es erschreckend, wie sehr das Leben ihre Mutter verhärtet hatte, und hoffte, dass es ihr selbst niemals so ergehen würde.
Niemals wollte sie so verbittert, so hartherzig und so gleichgültig werden wie Aleksija.
Erstes Kapitel
Deutschland, Gegenwart
Es wurde Pia unbequem, auf dem geschlossenen Klodeckel zu sitzen. Ihr Rücken schmerzte, ihre Beine begannen schon unangenehm zu kribbeln. Sie sah zum Waschbecken hinüber, auf dessen Rand sie den Schwangerschaftstest abgelegt hatte. Von ihrem Platz aus konnte sie das Ergebnis nicht sehen.
Soll ich?
Sofort spürte sie einen Druck im Magen, eine Enge, die sich über die Brust bis in den Hals hinaus ausweitete.
Alles oder nichts. Gleich würde sie es wissen.
Es klopfte zum wiederholten Mal an der Tür, unerbittlich jetzt, nicht mehr so sanft wie eben noch.
»Komm schon, Pia, lass uns wie erwachsene Menschen miteinander reden. Mach endlich die Tür auf.«
Sebastians Stimme klang genervt. Sie hatte recht gehabt. Man hatte seinem Klopfen anhören können, dass er langsam die Geduld verlor. Pia fragte sich, worüber er jetzt noch reden wollte. Eine halbe Stunde zuvor hatte er ihre Beziehung beendet, einfach so, nach sieben Jahren, mit ein paar knappen Worten.
Was genau hatte er gesagt? Sie konnte sich schon nicht mehr erinnern.
Sie starrte immer noch in Richtung Schwangerschaftstest, einem Frühtest, der im Internet als besonders sicher angepriesen wurde.
Wann hatten sie das letzte Mal miteinander geschlafen? Sie konnte sich einfach nicht konzentrieren.
Hatte es irgendwelche Anzeichen für eine bevorstehende Trennung gegeben? Nein, das hatte es nicht. Sie waren doch glücklich gewesen. Unzweifelhaft glücklich. Nicht wenige hatten sie bewundert für ihre Harmonie, eine Partnerschaft, die Sicherheit ausstrahlte. Erst in der vergangenen Woche waren sie spontan nach Hamburg gefahren. Im Hotelzimmer hatte ein Blumenstrauß auf sie gewartet, den Sebastian dort zur Begrüßung hatte hinstellen lassen. Er war ein sehr überlegter Mensch mit klaren Vorstellungen, jemand, für den solche Gesten selbstverständlich waren.
Am Tag ihrer Ankunft hatten sie sich ausgeruht. Sie hatten im Hotel gegessen und viel Zeit im Bett verbracht. Am nächsten Tag hatten sie eine Hafenrundfahrt gemacht, waren über die Reeperbahn spaziert und hatten sich schließlich noch die Elbphilharmonie angeschaut. »Eines Tages«, hatte Sebastian gesagt, »besuchen wir dort ein Konzert.«
Es war ein perfektes Wochenende gewesen, das ihr einmal mehr gezeigt hatte, dass sie zusammengehörten. Und jetzt sollte einfach so alles vorbei sein? Nein, sie konnte sich gar nicht vorstellen, wie es sein sollte, ohne Sebastian zu leben. Sie hatten ihr Leben doch teilen wollen, Kinder bekommen, ein Haus kaufen.
Zusammen alt werden …
Auch wenn sie noch jung waren, erst Ende zwanzig, so hatte sie dieser Gedanke doch immer begleitet – Sebastian war der Mann, mit dem sie ihr Leben verbringen wollte.
Und jetzt war alles aus. Wie stellte er sich das vor?
Es klopfte erneut, wieder etwas sanfter dieses Mal, aber immer noch unmissverständlich. Auch Sebastians Stimme hatte so geklungen, als er es ihr gesagt hatte, ganz sanft, jedoch umso entschlossener. Er hatte sich offenbar schon länger auf diesen Augenblick vorbereitet, vielleicht sogar mehrere mögliche Szenarien durchdacht.
Das sähe ihm ähnlich.
Während er ununterbrochen geredet hatte, hatte sie ihm nur zuhören können. Ihr Kopf war leer gewesen, da war nur das Gefühl, das ihr den Magen zusammenzog, das ihr Herz zum Klopfen brachte und ihren Körper zittern ließ.
Schließlich hatte sie sich ins Bad zurückgezogen, hatte wie in Trance den Schwangerschaftstest aus dem Spiegelschränkchen genommen, die Verpackung aufgerissen … Die Anleitung musste sie längst nicht mehr lesen. Sie hatte schon so viele dieser Tests gemacht. Es hatte sogar Tage gegeben, da waren es mehrere gewesen, weil sie den Eindruck gehabt hatte, eine winzige Spur auf dem Display erkannt zu haben. Später hatte sie dann regelrecht zwanghaft wieder und wieder überprüft, ob sie recht gehabt hatte mit ihrer Annahme oder ob sich ihre Hoffnung ein weiteres Mal zerschlug.
Und wenn sie jetzt schwanger war? Würde das etwas ändern? Würde er dann bei ihr bleiben? Dann musste er doch bleiben. Dann würde sich ihr Traum erfüllen, und sie würden Eltern werden.
Vielleicht …
Pias Blick fiel auf den Katalog mit Babyausstattung, den sie letztens schweren Herzens unter den Zeitungsstapel neben der Toilette geschoben hatte. Kürzlich hatte Sebastian eine Bemerkung über den »Babykram« fallen lassen, der überall herumlag, und sie hatte sich dafür entschieden, achtsamer zu sein. Sie wollte ihn schließlich nicht bedrängen. Männer tickten anders, was diese Dinge betraf.
»Pia, Mensch, jetzt komm raus. Sei nicht albern. Lass uns miteinander reden. Wir sind doch erwachsen.«
Erwachsen …
Wieder dieses Wort. Er verlor die Geduld, sie hörte es deutlich.
Sie stand auf und zog ab. Dann nahm sie den Schwangerschaftstest vom Waschbeckenrand.
Negativ.
Sie hatte es erwartet, und es schmerzte trotzdem. Sie ließ den Test in den Mülleimer fallen, biss sich auf die Faust und kämpfte gegen die Tränen an. Wie oft hatte sie das schon erlebt: negativ, negativ, negativ … Es las sich, als wollte man sie verhöhnen. Sie wusch sich die Hände, trocknete sie ab. Dann klopfte es erneut.
»Himmel, Pia, jetzt mach endlich die Tür auf! Lass uns reden, verdammt.«
Über was?, dachte sie, über was sollen wir jetzt noch reden? Es gab nichts mehr zu reden. Er würde sie verlassen. Sie würde allein zurückbleiben.
Ohne Kind. Ohne Beziehung. Einsam.
Pia ging ans Fenster und starrte nach draußen. Er sollte sie nicht weinen hören. Das war das Letzte, was sie wollte. Er sollte einfach gehen.
Vor der Tür rumpelte es. Dann waren Schritte zu hören, die sich entfernten. Sebastian fluchte unterdrückt. Pia hörte die Bügel an der Garderobe gegeneinanderklappern, einer krachte zu Boden. Sie kannte das Geräusch.
Erneutes Fluchen.
Das alte gefederte Sofa im Flur quietschte. Sebastian hatte sich hingesetzt, um sich die Schuhe anzuziehen. Fast konnte sie ihn vor sich sehen. Die Art, wie er sich nach vorne beugte, den Fuß in den Schuh gleiten ließ, dann der Griff an die Ferse … Erneutes Quietschen, als er aufstand, sich die Jacke anzog, kurz vor dem Spiegel im Flur stehen blieb, um hineinzusehen. Sie wusste, dass er das tat, weil er von seinen Gewohnheiten kaum ablassen konnte. Einmal den Kopf nach rechts drehen, einmal nach links …
Draußen schien eine strahlend helle Morgensonne. Es musste etwa halb zehn sein. Eine Mutter hastete mit ihrem Kind vorbei, sie waren sicher auf dem Weg zur benachbarten Kita. Mit dem Handrücken wischte Pia sich die Tränen weg, die nun doch über ihre Wangen rannen.
Sie waren nur nicht umgezogen, weil die Wohnung ihrem Vater gehörte und er sie ihnen zu einem günstigen Mietpreis überlassen hatte. Es gab Tage, an denen war es eine einzige Qual, die Kinder zu hören. Sie wollte sie nicht mehr hören, nicht mehr sehen. Sie wollte nicht mehr beobachten müssen, wie sich Eltern zu ihren Kindern hinunterbeugten, wie die Kleinen ihnen vertrauensvoll die Arme entgegenstreckten. Sie wollte kein Kindergeschrei und kein Kinderlachen mehr in ihrer Nähe.
Alles vorbei, alles sinnlos.
Draußen näherten sich Schritte, sicher ein letztes, ein allerletztes Mal. Wenn sie jetzt nichts sagte, würde er wirklich gehen.
»Pia …«
Sie wischte sich mit dem Handrücken über das Gesicht. »Ich komme.«
Es überraschte sie, wie ruhig ihre Stimme klang. Sie ging zum Waschbecken, ließ das Wasser erneut laufen, wartete, bis es eiskalt war. Dann wusch sie sich das Gesicht, trocknete es ab, cremte sich sorgfältig ein und musterte sich im Spiegel. Die Tränen hatten Spuren hinterlassen, doch sie musste sich nicht für ihre Gefühle schämen, auch wenn sie erwachsen war – ein wenig älter als Sebastian, was ihr nie als Problem erschienen war.
Aber vielleicht war es das ja doch.
Sie ging zur Tür und nahm sich fest vor, nicht mehr zu weinen.
Als sie öffnete, stand Sebastian der Tür gegenüber an die Wand gelehnt, den Kopf leicht zur Seite geneigt. So hatte er auch dagestanden, als sie sich kennengelernt hatten, damals auf dieser Party. Und so hatte er oft dagestanden, wenn er sie zum Mittagessen aus ihrem Büro abgeholt hatte in dem Unternehmen, in dem sie beide seit ihrem Abschluss arbeiteten.
Gearbeitet hatten.
Auch das war Vergangenheit.
»Du hast geweint«, stellte er fest.
Sie zuckte mit den Schultern. Was sollte sie sagen? Sollte sie sich für ihre Gefühle entschuldigen, dafür, dass ihr die Trennung etwas ausmachte? Wortlos ging sie in die Küche. Sebastian folgte ihr mit einem Seufzer. Irgendetwas passte ihm nicht.
Pia füllte den Wasserkocher und schaltete ihn an. Da stand noch ihre Tasse mit dem Teebeutel. Sie hatte den Raum so fluchtartig verlassen, als er davon geredet hatte, sich von ihr trennen zu wollen, dass sie alles hatte stehen und liegen lassen – und wenn sie jetzt daran dachte, hatte sie wieder das Bedürfnis davonzulaufen.
Sie wollte ihn nicht ansehen, also starrte sie den Wasserkocher an. Sie hörte das Wasser sieden, das Klacken, mit dem er sich abschaltete. Sie goss heißes Wasser in ihre Teetasse, beschwerte den Teebeutel mit einem Löffel, sah dem hellbraunen, dunkler werdenden Farbwirbel zu, der vom Teebeutel aufstieg und sich im Teewasser verteilte.
Sebastian räusperte sich. »Pia, ich weiß, dass es schwer ist, aber du wirst bald erkennen, dass es besser so ist. Es geht nicht mehr. Wir müssen uns trennen.«
Wir …
Warum sagte er das so, wenn er es doch war, der entschieden hatte?
Sie biss sich auf die Lippen und sah ihn nur an, konnte nicht sprechen. Wenn sie jetzt ein Wort sagte, dann würde sie wieder weinen.
Wir müssen uns trennen …
Wir?
Für ihn gab es kein »Wir« mehr. Wie lange wohl schon?
»Pia, ich …« Seine vertraute Stimme, und doch klang sie plötzlich so kalt. »Es ist einfach so … Du hast dich verändert, Pia, du bist nicht mehr die, die ich kennengelernt habe. Wirklich, es gibt da so vieles … vor allem die Sache mit dem …« Er räusperte sich erneut. »Ich kann einfach nicht damit leben, dass es für dich nichts anderes mehr gibt. Ich hab darüber nachgedacht, und weißt du, vielleicht will ich das einfach noch nicht. Vielleicht ist das alles viel zu früh mit einem …«
… mit einem Kind, dachte sie. Er konnte es noch nicht einmal aussprechen. Zum ersten Mal empfand sie Wut.
Halt sie zurück. Du willst nicht weinen. Nicht jetzt. Nicht vor ihm.
»Willst du nichts sagen? Lass uns doch reden.«
Sie schüttelte den Kopf. »Was gibt es da noch zu reden?«
Sie musste sich die Lippen blutig beißen, um die Tränen hinunterzuschlucken. Sie hatte nicht verbittert klingen wollen, vielmehr souverän, aber das war ihr gründlich misslungen. Sie drehte sich zu ihrer Teetasse um, bewegte den Löffel ein wenig. Es klirrte. Ein Knarren sagte ihr, dass Sebastian sich auf einen Stuhl gesetzt hatte. Auf ihren Stuhl … Sie hatte die Stühle in diese Wohnung mitgebracht. Wahrscheinlich hat er sie nie gemocht, fuhr es ihr durch den Kopf. Wer weiß … Aber sie sagte nichts. Der Gedanke war albern. Sie wollte nichts Albernes sagen.
»Ich werde heute nur ein paar Sachen mitnehmen, den Rest hol ich am Wochenende, wenn dir das recht ist.« Pia zuckte erneut mit den Schultern. Der Tee war fertig. Sie entfernte den Beutel und ließ ihn in die Spüle fallen, etwas, das Sebastian nicht ausstehen konnte. Darum musste sie sich jetzt ja nicht mehr kümmern. Sie musste sich nicht darum kümmern, was ihn störte und was nicht. Und es war ihre Wohnung, sie stand nicht auf der Straße. Wo würde er wohl unterkommen? Interessierte sie das? Er musste sich Gedanken darum gemacht haben, denn er machte keine Anstalten zu fragen, ob er bleiben konnte. Er wollte schon am Wochenende all seine Sachen holen. »Vielleicht können wir dann auch reden«, fügte Sebastian hinzu.
Wenn du dich beruhigt hast, fügte sie stumm hinzu.
Pia hielt die Tasse mit beiden Händen umklammert, als sie sich jetzt zu ihm umdrehte. Er zögerte noch einen Moment, dann stand er unvermittelt auf.
»Pia, ich will nicht, dass es so endet.«
»Dann trenn dich nicht von mir.«
»Wir haben uns auseinandergelebt, schon vor einer ganzen Weile. So ist es doch. Das musst du auch bemerkt haben.« Er schaute sie fragend an.
Sie konnte nicht fassen, was er da sagte. Auseinandergelebt? War es so? Sie dachte an Hamburg … Nein, bis eben noch war sie davon überzeugt gewesen, dass sie den Rest ihres Lebens gemeinsam verbringen würden. Sie hatte keine Ahnung gehabt von dem Mann, mit dem sie zusammenlebte, hatte nicht gemerkt, was in ihm vorging. Hatte er sich unwohl gefühlt, hatte sie ihn bedrängt? Musste sie ihm nur sagen, dass sie lernen konnte, dass sie sich ändern würde?
Ich kann mich ändern, Sebastian, nur für dich.
Doch reden konnte sie jetzt nicht. Nicht nur, weil sie dann wieder weinen müsste, sondern weil es keine Worte gab, die ausdrücken konnten, was sie sagen wollte.
»Pia«, setzte er erneut an.
Sie wandte sich abrupt ab. Vom Fenster aus konnte sie einen Teil der Kita sehen, in der schon die Kleinsten betreut wurden. Alles änderte sich, alles war ein immerwährender Fluss. Eine Tür ging zu, eine andere öffnete sich.
Nein, für sie gab es keine Tür, die sich öffnete.
Sie nahm noch einmal Sebastians Stimme wahr, aber sie hörte nicht mehr, was er sagte. Auch wenn es wehtat, blieb sie reglos stehen, bis die Wohnungstür hinter ihm ins Schloss fiel. Dann brachte sie die immer noch unberührte Tasse mit dem Tee zur Spüle, ging in ihr Zimmer, legte sich aufs Bett und schloss für einen Moment die Augen. Ihre Gedanken wanderten zurück zu dem Tag ein Dreivierteljahr zuvor …
»Frau Sommer, kommen Sie doch bitte einmal rasch. Oder sind Sie zu beschäftigt?«
»Pia«, zischte es vom Schreibtisch gegenüber. »Pia, hörst du nicht?«
Pia schaute auf. Sie konnte nicht sagen, ob ihr Vorgesetzter mehr als einmal gerufen hatte – sie war in Gedanken gewesen, wieder einmal. Doch dem Gesichtsausdruck ihrer Kollegin nach zu urteilen, hatte er das getan. Ein Gefühl des Unwohlseins schwappte in ihr hoch. Jetzt hieß es aufzustehen, sich zu sammeln, den Kloß im Magen zu bekämpfen und die weichen Knie. Sie schob den Stuhl zurück, atmete ein und wieder aus, ein und wieder aus, im Bemühen, ruhiger zu werden. Das hatte die Therapeutin ihr geraten, die sie nun seit einem Jahr aufsuchte. »Wenn die Angst kommt, dann atmen Sie«, hatte sie gesagt. »Das ist das Einzige, was Sie tun können. Sie atmen, und Sie spüren, wie Sie ruhiger werden. Atmen Sie ein und wieder aus und ein und wieder aus.«
Atmen nach Anleitung.
Noch einmal ließ Pia den Blick über den Schreibtisch wandern. Alles war geordnet. Das, was sie an diesem Tag erledigen wollte, war minutiös aufgelistet, aber sie hatte noch nicht damit angefangen, ihre Liste abzuarbeiten, und jetzt ging es schon wieder auf Mittag zu.
Aller Anfang barg die Möglichkeit des Scheiterns in sich. So war es doch, oder? Sie wurde ja auch seit Jahren nicht schwanger.
Als ob mit ihr etwas nicht stimmte.
Aber es stimmte alles, und vielleicht war das das Schlimmste. Sebastian und sie hatten sich beide untersuchen lassen mit dem Ergebnis, dass nichts dagegensprach, dass sie eines Tages Eltern werden würden. Die Ärzte konnten nichts finden, auch in der Kinderwunschklinik hatte man ihr keine Hoffnung machen können, denn es gab einfach keinen erkennbaren Grund, warum sie nicht schwanger wurde.
Eines Tages. Irgendwann. Nie.
»Gehen Sie die Sache lockerer an, Frau Sommer«, hatte ihr Gynäkologe gesagt.
Und wenn das nicht reichte?
Ihre Kollegen hielten sie für organisiert. Pia allein wusste, dass das nicht stimmte. In Wirklichkeit war sie eine Versagerin, die nichts auf die Reihe bekam. Ihre Arbeit nicht, ja, noch nicht einmal die einfachste Sache der Welt – schwanger zu werden … Manche schafften das nach einem One-Night-Stand.
Wie immer steigerte sich Pias Unbehagen mit jedem Schritt weiter auf das Büro ihres Chefs zu, bis es sie kurz vor seiner Tür fest im Würgegriff hatte. Von Anfang an war da etwas zwischen ihnen gewesen, seit dem Tag, an dem Konstantin Müller die Leitung des Unternehmens übernommen hatte. Es war nichts Dramatisches vorgefallen, sie hatten einfach nur nicht harmoniert.
Pia öffnete die Augen. War das der Anfang vom Ende gewesen und letztendlich das Ende von allem, auch das ihrer Beziehung mit Sebastian?
Es war jedenfalls dieser Tag ein Dreivierteljahr zuvor gewesen, an dem sie die Entscheidung mit dem verdammten Sabbatjahr getroffen hatte.
Und Sebastian hat mich darin bestärkt. Hat er damals auch schon über die Trennung nachgedacht?
Er war kein Mann schneller Entschlüsse, wahrscheinlicher war, dass er alles von langer Hand geplant hatte.
Oder doch nicht?
Pia erinnerte sich, Sebastian an diesem Tag – sie hatten sich zum Mittagessen getroffen – von ihren Plänen erzählt zu haben. Er hatte sie aufmunternd angelächelt. Sie hatten sogar über die Möglichkeit gesprochen, einen Teil der Auszeit gemeinsam zu verbringen.
»Auch ich könnte ein paar Monate Zeit gebrauchen, weißt du«, hatte er gesagt. »Wir könnten doch etwas Verrücktes gemeinsam machen. Was meinst du?« Er hatte gelacht.
»Was denn?«
»Ein Haus kaufen und es renovieren zum Beispiel.«
Klang das verrückt? Ja, vielleicht tat es das, jedenfalls für zwei Büromenschen, die handwerklich nicht besonders geschickt waren und vom Hauskauf keine Ahnung hatten.
Pia erinnerte sich, in ihren Rigatoni herumgestochert zu haben. Obgleich sich der Gedanke, gleich wieder ins Büro zu gehen, schlecht angefühlt hatte, war sie an diesem Tag auch erleichtert gewesen, erleichtert, eine Entscheidung getroffen zu haben, erleichtert, sich nicht länger quälen zu müssen und ihr Leben neu zu ordnen. Abstand zu gewinnen. Ruhiger zu werden. Wieder allein atmen zu können.
»Wie willst du Müller das verkaufen?«, hatte sie gefragt.
»Ach, wir haben uns angefreundet. Lass das mal meine Sorge sein.« Er hatte ihr eine Haarsträhne hinters Ohr gestrichen, sich dann zu ihr herübergebeugt, um sie zu küssen. »Ja, ich finde, das sollten wir tun, Pia. Etwas Tolles zusammen machen. Zuerst einmal musst du aber zur Ruhe kommen. Du machst dich noch ganz kaputt. Ich sehe das. Entspann dich ein bisschen, dann klappt auch alles andere.«
Das Kind zum Beispiel, hatte sie gedacht, endlich schwanger werden. Doch sie hatte nichts gesagt. Auch damals schon hatte sie manchmal für einen kurzen Augenblick das Gefühl gehabt, dass er sich von ihr bedrängt fühlte, und das durfte nicht sein. Er musste es wollen, das Kind, das war das Wichtigste.
Auf dem Weg zurück ins Büro hatte sie sich an ihn geschmiegt. Später hatten sie noch einmal alle Optionen durchgesprochen. Am Ende der Woche hatte sie allen Mut zusammengenommen und um ein Gespräch gebeten. Es war leichter gewesen, als sie es sich ausgemalt hatte, denn Konstantin Müller war nicht abgeneigt gewesen. »Machen Sie das. Und wenn Sie das Jahr hinter sich haben und voller neuer Ideen sind«, hatte er ihr zugesprochen, »dann denken wir neu nach. Sie sind immer eine gute Mitarbeiterin gewesen. Trauen Sie sich etwas zu, seien Sie wieder mutig!«
Wie auf Wolken war Pia zurück zu ihrem Schreibtisch gegangen. Sie hatte ein altes Projekt aufgerufen und zu arbeiten begonnen, aber sie war nicht wirklich dabei gewesen. Sie hatte an alte Häuser gedacht, die renoviert werden mussten. Sie hatte sich gefragt, wann und wie sich alles geändert hatte, wo die Angst hergekommen war und dieses Gefühl des Versagens. Wann nur war ihr das Vertrauen in ihre Fähigkeiten abhandengekommen? Wann war die Angst zu ihrem ständigen Begleiter geworden, dieses nicht enden wollende Gefühl der Überforderung?
Und vor zwei Monaten war es schließlich so weit gewesen. Sie hatte ihren Schreibtischplatz für eine Volontärin geräumt.
Pia stand wieder auf, ließ den Computer hochfahren und rief im Internet das Forum »WUNSCHKINDER« auf. Der vertraute Schriftzug erschien. Sie überflog die Liste der Namen derer, die online waren. Filinchen, die sich, wie Pia plötzlich ganz unsinnigerweise einfiel, nach ihrem Lieblingsknusperbrot benannt hatte und die im wahren Leben Jessica hieß, stand ganz oben. Pia loggte sich ebenfalls ein. Zusammen auf dem Weg zum Wunschkind war der erste Eintrag überschrieben. Jetzt konnte sie die Tränen nicht mehr zurückhalten.
Zweites Kapitel
Pia fröstelte. Sie stellte die Teetasse auf dem Nachttisch ab und zog die Decke etwas höher. Es war früh am Morgen, der Himmel war noch grau. Sie hörte, wie unten die Haustür geöffnet wurde. Die Krankenschwester aus dem Stockwerk über ihr, die sie eben noch eilig die Treppe hatte hinunterlaufen hören.
Die Tür fiel zu. Von ihrem Bett aus sah Pia das Blinken ihres Computers, den sie in der Nacht nicht mehr heruntergefahren hatte, und dachte an die dicken Tränen, die während des Chats mit Filinchen auf die Tastatur getropft waren.
Filinchen wusste es jetzt auch. Filinchen, die sie im Forum kennengelernt hatte und mit der sie die Last des Scheiterns teilte.
Sebastian und ich sind kein Paar mehr.
Die erste Nacht allein hatte sie irgendwie hinter sich gebracht. Sie hatte im Internet gesurft, mit ihrem Smartphone gespielt, ein Glas Wein getrunken. Gegen neun hatte sie ein heißes Bad genommen in der Hoffnung, dass sie das schläfrig machte. Geholfen hatte es nicht. Es war zu hell gewesen und zu laut, die Leute blieben länger draußen und vergnügten sich. Durch das gekippte Fenster waren bis tief in die erste warme Frühsommernacht Geräusche zu ihr hereingedrungen: das Schlagen der Kirchturmglocken, Jugendliche, die nach Hause gingen, fröhlich lachende junge Leute, die eine der Kneipen um die Ecke ansteuerten. Stimmen. Begrüßungen und Verabschiedungen. Küsse. Ja, auch die hatte sie deutlich zu hören gemeint – Liebesbeweise, Nähe. Pärchen, die von der Zukunft träumten. Männer und Frauen, die über Kinder nachdachten.
Sie hatte bewusst tief ein- und wieder ausgeatmet, um nicht vor Schmerz zu schreien.
Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen …
Wieso hatte sie nichts bemerkt? Zum Schmerz gesellte sich die Unsicherheit. Sie hatte nicht erkannt, was den Menschen, der ihr am nächsten stand, umtrieb.
Pia sprang aus dem Bett. Mit einem Mal ließen sie der stickige Geruch im Zimmer und das Gefühl der durchgeschwitzten Bettwäsche auf ihrer Haut würgen. Sie sprang unter die Dusche, griff nach dem erstbesten Kleidungsstück, das sie finden konnte, und zog sich an. Tag eins nach der Trennung. Eine neue Zeitrechnung hatte begonnen.
In den nächsten Tagen verließ Pia das Haus nur, um einzukaufen, aber selbst das hätte sie sich sparen können. Alles, was sie zu sich nahm, war Schokolade. Schokolade, hatte sie gelesen, bewirkte, dass im Gehirn bestimmte Substanzen ausgeschüttet wurden, unter anderem Endorphine, die Glücksgefühle erzeugten. Pia war sich da nicht so sicher, dennoch fühlte sie sich etwas getröstet. Stundenlang saß sie am Fenster und beobachtete die Welt – Leute, die zum Einkaufen gingen, Mütter, die mit ihren Kindern unterwegs zur Kita waren, die alte Dame mit dem grauen Hut, Herrchen und Frauchen, die ihre Hunde Gassi führten.
Ich bin allein.
Pia schluckte. Sie war allein, ihr Tag hatte keine Struktur. Ja, in diesem Moment erschien ihr alles besser, als zu Hause zu sitzen – sogar der Gedanke, arbeiten zu gehen.
Es war schrecklich. Die ganze verdammte Wohnung war voller schmerzhafter Erinnerungen, voller Dinge, die Sebastian am Wochenende abholen wollte: Da hing seine alte Jeansjacke an der Garderobe, im Bad fiel ihr Blick unweigerlich auf seine Zahnbürste und eine angebrochene Dose Rasierschaum. In seiner Schrankhälfte hingen noch etliche Anzüge, und im Wohnzimmer lagen Zeitschriften, Bücher, CDs und DVDs. Im Flur stand das Beistelltischchen, das er vom Trödel mitgebracht hatte.
Verdiene ich es, allein zu sein?
Pia stellte sich vor, wie sie in vielen Jahren, alt, faltig und verbittert, immer noch am Fenster saß, wie sie beobachtete, dass andere ein Leben führten, während sie selbst keines hatte. Ihre Kehle wurde eng. Das Wasserglas in ihrer Hand zitterte, sodass sie es abstellen musste. Sie atmete ein und aus und ein und aus. In ihrem Mund vermischte sich die süße Schokolade mit dem Geschmack salziger Tränen.
Am dritten Tag wünschte ihr der Postbote gute Besserung. Im Badezimmerspiegel begutachtete sie die tiefen Ringe unter ihren Augen, die blasse Haut und die ungewaschenen Haare.
Am sechsten Tag – in der Nacht hatte es heftig gewittert, jetzt war der Himmel wieder blau – duschte sie ausgiebig und öffnete zum ersten Mal wieder ihren Kleiderschrank. Es war wichtig, aktiv zu bleiben.
Tu etwas!
Sie hielt sich eine Bluse an, hängte sie zurück. Eine Strickjacke rutschte herunter, und sie bückte sich danach, hängte sie halbherzig wieder auf. Es brachte nichts, sich gehen zu lassen. Das Chaos um sie her würde das Chaos in ihrem Inneren nur umso schlimmer machen.
Sie schlüpfte in ein Kleid und stellte bei einem Blick in den Spiegel fest, dass sie Sebastians Lieblingskleid gewählt hatte. Während ihr erneut die Tränen in die Augen schossen, zog sie es rasch wieder aus, nein, riss es sich vom Körper und stopfte es dann ganz nach hinten in den Schrank. Sie brauchte weitere zehn Minuten, um sich schließlich für eine Jeans und ein Breton-Hemd zu entscheiden sowie weiße Sneakers.
Entschlossen nahm sie sich ein Blatt Papier, um aufzulisten, was an diesem Tag erledigt werden musste, und setzte sich an den Küchentisch. Sie musste einkaufen, die Wohnung aufräumen und putzen.
Einkaufen.
Aufräumen.
Putzen.
Pia starrte den Zettel an, aber mehr war da nicht.
Weitere zehn Minuten später hatte sie sich die Zähne geputzt, die dunkelblonden Haare zu einem Zopf gebunden und sogar ein leichtes Make-up aufgelegt, das ihre blauen Augen betonte. Von der Ablage an der Garderobe nahm sie sich ihre große Sonnenbrille, die sie an diesem Tag auch im Supermarkt nicht ausziehen würde, obwohl sie das bei anderen immer albern fand.
Unten begegnete ihr eine Mutter mit einem kleinen Mädchen, das rote Gummistiefel trug. Es blieb fasziniert vor einer großen Pfütze stehen. Die Mutter wartete ungeduldig. Im nächsten Moment hüpfte die Kleine mitten in die Pfütze hinein und juchzte vergnügt auf. Die Mutter sah aus, als ob sie schimpfen wollte, dann lachte sie jedoch mit der Kleinen.
Hätte ich ein Kind, würde ich auch lachen, dachte Pia. Erst als die beiden um die Ecke bogen, bemerkte sie, dass ihr schon wieder Tränen über die Wangen liefen.
Mechanisch tätigte sie ihre Einkäufe. Zu Hause ging sie gleich in ihr Schlafarbeitszimmer und fuhr den Computer hoch. Filinchen war online. Sie schrieb von einer neuen Therapie, die sie und ihr Mann auf Anraten der Kinderwunschklinik im nächsten Monat beginnen wollten und in die sie so große Hoffnungen setzten.
Und ich, dachte Pia, habe noch nicht einmal einen Mann an meiner Seite. Sie wollte diesen Neid nicht spüren, aber sie spürte ihn. Natürlich ging das Leben weiter, natürlich würde Filinchen ihren Traum nicht einfach aufgeben. Sie und ihr Mann, beide rundlich und blond, fast wie Geschwister, versuchten schon seit über fünf Jahren, ein Kind zu bekommen.
Kaum zwei Minuten später hatte Pia eine persönliche Nachricht.
Melde dich, wenn es dir schlecht geht. Du liest dich immer noch so traurig.
Es ist schwer loszulassen, tippte Pia nach kurzem Zögern in die Tastatur, was gäbe ich darum, wenn du in meiner Nähe wärst.
Ich auch, schrieb Filinchen zurück, wir würden uns gut verstehen.
Zweifellos.
Vielleicht kommst du mal nach München?
Kann sein.
Aber im Moment konnte Pia sich nicht vorstellen, irgendwohin zu fahren. Im Moment wollte sie sich nur auf dem Boden zusammenrollen und nichts tun.
Wie geht es bei dir so?, tippte sie.
Filinchen zögerte wohl, denn es dauerte eine Weile, bis die nächste Nachricht kam.
Ich bin sehr gespannt auf die Behandlung.
Schön. Pia wollte nicht kurz angebunden klingen oder harsch. Telefonieren wir?, fügte sie hinzu.
Gern. Kann ich dich gegen Abend anrufen?
Klar, stimmte Pia zu.
Pia holte ihr Fahrrad aus dem Unterstand im Vorgarten und radelte los. Die Bewegung tat gut. Wenn sie in Bewegung war, konnte sie die düsteren Gedanken für eine Weile verbannen.
Am Abend telefonierte sie dann zwei Stunden lang mit Filinchen. Das tat ebenfalls gut, doch als sie aufgelegt hatte, kam der Neid zurück, auf den die Wut folgte. Pia öffnete die Türen ihres Kleiderschranks, klaubte das Kleid hervor, das Sebastian so sehr an ihr gemocht hatte, und stopfte es in den Müll. Die nächste Phase hatte begonnen: Trauer.
Am kommenden Tag tat Pia etwas, das sie seit Monaten nicht getan hatte. Sie rief Arbeitskollegen an und schlug vor, sich am Abend auf einen Absacker zu treffen, wie sie das früher manchmal getan hatten. Die anderen schienen sich zu freuen, von ihr zu hören – Pia hörte ihre unternehmungslustigen Stimmen im Hintergrund. Dann hieß es jedoch, Sebastian werde bei dem Treffen dabei sein, und sie machte einen Rückzieher. So war das, wenn man einen gemeinsamen Freundeskreis hatte. Es war kaum möglich, einander zu meiden.
Schnell steckte sie sich ein Stück Schokolade in den Mund, überlegte im nächsten Moment, ob sie Sebastians Sachen in Kisten packen und sie vor die Tür stellen sollte. Er hatte schließlich gesagt, dass er sie am Wochenende holen wollte. Und er war noch nicht gekommen.
Kein Sebastian mehr. Kein Baby. Ich werde niemals Mutter sein …
Das Klingeln des Telefons riss sie aus ihren trübseligen Gedanken. Ich will mit niemandem reden, dachte Pia. Lasst mich doch alle in Ruhe.
Nach einer Weile sprang der Anrufbeantworter an.
»Hallo, Pia«, hörte sie die fröhliche Stimme ihres Großvaters. »Zu dumm, dass du nicht zu Hause bist. Ich wollte dich nämlich etwas fragen. Du weißt doch, dass wir umziehen, und Oma …«
Pia sprang auf und nahm den Hörer aus der Ladestation. »Opa? Ich bin’s. War nur grad im Bad …«
Drittes Kapitel
Opa Klaus nahm sie einfach in den Arm und drückte sie an sich. Der vertraute Geruch nach seinem Rasierwasser und den Pfefferminzbonbons, die er so gern aß, stieg ihr in die Nase. Pia hatte das Gefühl, dass er etwas schmaler geworden war, doch sein Bauch war immer noch weich und rund – ein Waschbärbauch, wie er einmal scherzhaft gesagt hatte. Oma Jutta wartete geduldig, bevor auch sie ihre Enkelin überschwänglich an sich drückte. Schon im Flur konnte Pia riechen, dass es ihr Lieblingsessen gab: Arabisches Reiterfleisch.
»Die Arbeit kann noch etwas warten«, sagte ihre Großmutter fröhlich, während sie wenig später in der Küche Kartoffelspalten auf Pias Teller häufte, so perfekt geschnitten, wie nur sie es konnte.
Pia war froh, dass sie nicht gefragt wurde, wie es ihr ging und was denn geschehen war mit Sebastian, oder was es mit dem Sabbatjahr auf sich hatte. Am Tag zuvor hatte sie ein langes Gespräch mit ihrer Mutter gehabt. Susanne hatte versucht, sie im Büro zu erreichen, und dort erfahren, dass ihr Sabbatjahr schon begonnen hatte. Peinlich, dass die Kollegen jetzt wussten, dass sie nicht mal ihrer Mutter davon erzählt hatte. Kurz entschlossen war sie abends bei ihr vorbeigefahren, und sie hatte ihr alles erzählt: von der Trennung, ihrer Auszeit, den Plänen, die sie ursprünglich mit Sebastian geschmiedet hatte. Zum ersten Mal hatten sie so zusammengesessen, als Pia sechzehn gewesen war und ihr erster Freund sich von ihr getrennt hatte. Damals hatte sie dieses Urvertrauen gehabt, das Vertrauen darin, dass alles wieder gut werden würde, dass der Schmerz irgendwann nachließ, dass sie eines Tages jemand anderen kennenlernen würde. Genau so war es gekommen, und doch hatte sie dieses Vertrauen jetzt nicht mehr.
Ganz sicher hatte ihre Mutter den Großeltern berichtet, aber die konnten schweigen, und Pia wusste ohnehin nicht, was sie sagen sollte. Zuerst einmal musste sie sich selbst über die Veränderungen in ihrem Leben klar werden.
Für einen Moment verlor sie sich darin, dem Besteck beim Klappern zuzuhören. Ihr Großvater war wie immer der Schnellste und schob den Teller schon wieder auffordernd in Richtung Schüssel, damit ihre Großmutter ihm noch einen Nachschlag geben konnte.
»Ein bisschen«, sagte sie. »Denk dran, was der Arzt gesagt hat.«
»Ach, der Arzt, der Arzt …«
»Was hat er denn gesagt?«, mischte sich Pia ein, um sich von ihren eigenen Gedanken abzubringen.
»Nichts«, knurrte Opa Klaus. »Ich soll bloß mehr Gemüse essen.«
Pia nahm auch noch etwas nach, obgleich sie nicht wirklich hungrig war, aber sie wollte Oma Jutta nicht enttäuschen. Gemüse … Wieder schweiften ihre Gedanken ab. Sebastian mochte auch nicht besonders gern Gemüse. Sie hatte ihn nicht mehr gesehen, seit er die Wohnung verlassen hatte. Seit Beginn ihrer Beziehung waren sie nie so lange getrennt gewesen – tatsächlich war es meist kaum mehr als ein Arbeitstag gewesen, allenfalls ein Wochenende, wenn einer von ihnen eine Fortbildung besucht hatte. Schon wieder wurde ihr die Kehle eng. Ihre Stimme klang schwach, als sie sich an ihre Großeltern wandte.
»Geht schon runter in die neue Wohnung, wenn ihr fertig seid.« Sie warf einen Blick auf die leeren Teller. »Ich krieg das hier allein hin.«
Ihre Großeltern hatten eine Wohnung im Parterre gesucht, und zufällig war im selben Haus eine frei geworden. Pia sollte helfen, die vielen Bücher in Kisten zu packen und hinunterzutragen.
Pia spürte, wie ihre Oma sie kurz prüfend ansah. Sie war eine sehr einfühlsame Frau, und was ihre Enkelin anging, entging ihr selten etwas. Vorsichtig streichelte sie über Pias Arm.
»Du bist dünn geworden … Geht es dir wirklich gut? Wollen wir nicht erst noch gemeinsam eine schöne Tasse Tee trinken?«
»Nein, nein …« Pia schüttelte den Kopf. »Ich freu mich auf die körperliche Arbeit. Ich denke viel zu viel nach in letzter Zeit, weißt du, ich …«
»Ich verstehe das«, sagte Oma Jutta sanft. »Du musst nicht reden, aber du kannst immer zu mir kommen, wenn du reden willst.« Sie stand auf, als wollte sie damit zeigen, dass sie ihre Enkelin zu nichts drängte.
»Danke, Oma.«
Auch Pia erhob sich erleichtert. Als Jugendliche hatte sie sich manchmal an ihre Oma gewandt, wenn sie zu Hause Krach hatte. Auch in der Trennungsphase ihrer Eltern – sie hatten sich sehr früh kennengelernt und waren seit fünfzehn Jahren geschieden – hatte Oma Jutta ihr zur Seite gestanden. Sie gingen gemeinsam in den Flur.
»Fang am besten in Opas Arbeitszimmer an. Da ist noch am meisten zu tun. Du weißt ja, Klaus ist ein wahrer Jäger und Sammler.« Oma Jutta zwinkerte ihrem Mann zu. Pia lachte. Sie hatte gesehen, dass die Oma ihre geliebte Porzellansammlung bereits zusammengepackt hatte. Die Vitrine, die am Eingang zum Wohnzimmer stand, war jedenfalls leer. Sie half den beiden, die vier ersten Kisten in die Parterrewohnung zu bringen, und kehrte dann allein zurück.
Stille. Für einen Moment stand sie nur da.
Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen …
Pia spürte, wie sie sich entspannte. Sie war immer gern bei Opa Klaus und Oma Jutta gewesen, und der Zauber ihrer Anwesenheit verfehlte auch jetzt seine Wirkung nicht. Vielleicht war ja dies der Moment, an dem der Prozess der Heilung beginnen konnte? Pia trank noch ein Glas Wasser, dann ging sie durch den engen, mit Kartons vollgestellten Flur zum Arbeitszimmer ihres Großvaters.
Opa Klaus war Grundschullehrer gewesen, einer der wenigen, die Pia kannte, und sie hatte sich immer gewünscht, er möge auch sie unterrichten. Lustig war er gewesen, nie streng, in der Lage, jeden zu begeistern, und er hatte eine Engelsgeduld mit allen gehabt, denen das Lernen nicht so leicht gefallen war. Susanne hatte sich zwar manchmal beschwert, dass nicht auch das eigene Kind von der Geduld des Vaters hatte profitieren können, aber das hatte Pia sich kaum vorstellen können. Genau wie es schwer war, sich vorzustellen, dass er einmal jung gewesen war. So jung wie sie.
Pia drehte sich zu den Fotos um, die an der Wand über seinem Schreibtisch hingen, und betrachtete das Bild, das ihre Großeltern beim letzten Urlaub auf Mallorca zeigte. Sie trugen Wanderschuhe, kurze Hosen und Sonnenhüte. Im Hintergrund sah man die Insel Sa Dragonera, die Dracheninsel. Pia mochte den Namen. »Du kennst ihn nicht wirklich«, glaubte sie die Stimme ihrer Mutter zu hören. »Er kann auch ganz anders sein.«
Pia runzelte die Stirn. Ihre Mutter hatte ab und zu angedeutet, dass ihr Vater sehr streng hatte sein können, ein Vater alter Schule eben. Pia hatte ihn nie so erlebt. Für sie war er immer da gewesen, immer einfühlsam, immer geduldig.
Der Traum von einem Opa, dem sie zudem so ähnlich sah, wie alle sagten.
Ihre Mutter mochte ihren Vater, aber da war auch eine spürbare Distanz. Zudem hatte sie es ihm nicht verziehen, dass er sich während des Trennungsstreits ihrer Eltern neutral verhalten hatte. »Nicht einmal da ist er für mich eingestanden«, hatte Susanne ihr eines Tages enttäuscht anvertraut, doch Pia wollte darüber jetzt nicht nachdenken.
Pia sah sich um. Hier im Arbeitszimmer war noch nichts verpackt oder aussortiert worden. Sogar der Papierkorb unter dem Tisch quoll über. Pia lächelte. Opa Klaus war immer unordentlich gewesen. Und es fiel ihm schwer, Dinge wegzuwerfen.
Sie ging zu den gerahmten Zeitungsausschnitten an der anderen Wand, Artikel, die er verfasst hatte. Solange sie denken konnte, war er immer beschäftigt gewesen. Stets hatte er Pläne verfolgt, immer hatte es irgendein Projekt gegeben. Als junger Mann hatte er gegen den Vietnamkrieg demonstriert, er und seine Freunde hatten sich nächtelang die Köpfe heißdiskutiert. Er hatte die DDR und die Sowjetunion bewundert, sich dann distanziert, aber immer von einer besseren Welt geträumt und nie aufgehört, dafür zu kämpfen. Als Jugendliche hatte sie gut mit ihm diskutieren können, besser als mit Susanne, die eben bei allem auch ihre Mutter blieb.
Opa Klaus hat mich immer ernst genommen.
Pia gab sich einen Ruck. Sie hörte die Wohnungstür. Ihre Oma rief ihr zu, dass sie noch rasch das Geschirr in die Spülmaschine räumen wollte. Pia rief etwas Zustimmendes zurück. Jetzt musste sie aber endlich mal loslegen, bevor sie sich hier noch ganz in Erinnerungen verlor. Zwei Wochen hatten sie Zeit, die Wohnung leer zu räumen, von Grund auf zu reinigen und zu streichen. Sie würde den Großeltern auch helfen, sich unten im Parterre neu einzurichten. Ein schönes Stückchen Arbeit, wenn sie sich hier umschaute, aber wenigstens musste sie dann nicht nachdenken.
Pia baute die ersten Kartons im Flur auf, denn im Arbeitszimmer war zu wenig Platz. Zuerst widmete sie sich dem Schreibtisch. Sie entsorgte alte Kulis und – so schien es ihr – kiloweise Bleistiftstummel. Sie füllte und leerte im Laufe des Tages immer wieder den Papierkorb. Opa Klaus ließ ihr freie Bahn. Sie sollte ihn auch nicht fragen. »Du machst das schon«, hatte er sie bestärkt, als er nach zwei Stunden noch einmal hochgekommen war, um die Spülmaschine auszuräumen und das Geschirr nach unten zu bringen. Pia sah, dass es ihm schwerfiel, sich umzuschauen, zugleich war er fest entschlossen, ihr die Verantwortung zu überlassen. Dafür war sie ihm sehr dankbar.
Zum ersten Mal seit Tagen verlor sie sich nicht in Gedanken an die eigene Hilflosigkeit. Und sie kam voran. Inzwischen war der Schreibtisch leer, Papier- und Schreibvorräte verpackt, ebenso die alte Ikea-Schreibtischlampe in Signalrot, die, seit sie denken konnte, am Schreibtisch ihres Opas festgeschraubt war.
Wieder brachte Pia eine Kiste in den Flur, dann kehrte sie in den Raum zurück und wandte sich mit einem Seufzer dem nächsten Regal zu. In die letzten Kisten hatte sie die Ordner mit den Zeitungsartikeln gepackt. Jetzt waren die Bücher an der Reihe. Sie musste darauf achten, die Kisten nicht zu voll zu packen, sonst würde es unmöglich sein, sie zu tragen. Sie hatte diesen Fehler bei ihrem letzten Umzug gemacht.
Dem Umzug mit Sebastian.
Wie lange das jetzt her war, und von wie viel Hoffnung er getragen gewesen war … Der Kloß im Hals war wieder da. Pia setzte sich einen Moment, aber langes Grübeln wollte sie sich an diesem Tag nicht erlauben.
Um acht Uhr schickte ihre Oma sie nach Hause.
»Du musst dich ausruhen. Für heute hast du genug getan. Sei nett zu dir, du hast es dir verdient.«
Pia hätte am liebsten gesagt, dass sie weiterarbeiten wollte, doch das würden ihre Großeltern nicht akzeptieren. Sie waren auch erschöpft. Tatsächlich verabschiedete sie sich, während Opa Klaus bereits in seinem Lehnstuhl vor dem Fernseher leise schnarchte.
Vor der Tür überlegte sie sich, ob sie den Bus nehmen sollte, entschied sich dann aber nach Hause zu laufen, um den Kopf klar zu bekommen.
Die Bewegung hielt sie von düsteren Gedanken ab. Damit war es allerdings schlagartig vorbei, als sich die Wohnungstür hinter ihr schloss. Plötzlich prasselte Sebastians Stimme von allen Seiten auf sie ein, das Gedankenkarussell nahm erneut Fahrt auf.
Pia ging in die Küche, doch im Kühlschrank war nichts, was sie essen mochte. Sie entschied, einkaufen zu gehen, der Supermarkt um die Ecke hatte bis zweiundzwanzig Uhr geöffnet. Sie war zwar nicht hungrig, aber sie musste etwas tun – irgendetwas nur, um nicht durchzudrehen.
Vielleicht sollte ich jemanden anrufen? Aber wen?
Als sie Sebastian kennengelernt hatte, war der Kontakt zu eigenen Freunden abgebrochen, das war ihr in den letzten Tagen nur zu klar geworden.
Pia sah auf die Uhr, sie hatte noch Zeit. Sie schlüpfte rasch aus den Arbeitsklamotten, duschte und zog Jeans und T-Shirt an. Ihre Finger schwebten für einen Moment über der goldenen Kette, die Sebastian ihr zum letzten Valentinstag geschenkt hatte. Doch sie legte sie nicht an.
Sie suchte ihr Portemonnaie, steckte es in die Einkaufstasche, nahm den Schlüssel vom Brett. Im Supermarkt waren nur wenige Leute. Man sah den meisten an, dass sie einen harten Arbeitstag hinter sich hatten, und es fühlte sich gut an, eine davon zu sein. Pia kaufte Obst, Gemüse, Milch, Joghurt. Keine Schokolade. Es ging besser als erwartet.
Ihre Stimmung sank schlagartig wieder, als sie den Supermarkt verließ. Sebastian stand bei den Einkaufswagen. War er das wirklich? Hatte er etwa eine Wohnung in der Nähe gefunden? Er sah sie nicht. Sollte sie ihn auch nicht sehen?
Ihre Finger verkrampften sich um den Griff ihres Einkaufswagens. Sie holte tief Luft und wollte ihr Versteck gerade verlassen, als sie die Frau bemerkte, die sich Sebastian vom Parkplatz her zielstrebig näherte. Einen Moment zweifelte sie noch, wollte nicht wahrhaben, was sie da sah – da hatte die Fremde Sebastian auch schon von hinten umarmt.
Wie in einer Seifenoper drehte er sich zu ihr um. Sie küssten sich.
Drama.
Musik.
Abblenden.
Pia ließ den Einkaufswagen los, stand noch kurz wie erstarrt da, stolperte ein paar Schritte rückwärts, und dann drehte sie sich um und rannte, als wäre jemand hinter ihr her.
Hoffentlich haben die beiden mich nicht gesehen …
Sie wirkten so unglaublich vertraut miteinander. Hatte Sebastian sie etwa betrogen?
Er hatte sie betrogen!
Wenigstens kamen die Tränen erst, als die Haustür hinter ihr ins Schloss fiel. Wie konnte er ihr das nur antun? Wie konnte er das, was sie gehabt hatten, so mit Füßen treten?
Die Übelkeit kam völlig unerwartet. In ihrer Wohnung angekommen kickte Pia die Sneakers von den Füßen, stürzte ins Bad und übergab sich. Eine gefühlte Ewigkeit hockte sie würgend vor der Toilette. Als das Übelkeitsgefühl nachließ und die Welt aufhörte zu schwanken, stand sie auf, spülte sich den Mund aus und knipste das Licht über dem Spiegel an. Ihr bleiches Gesicht starrte ihr entgegen.
Schwanger, flüsterte eine Stimme in ihrem Kopf, was, wenn du doch schwanger bist?
Sie dachte an den Postboten, der ihr eine gute Besserung gewünscht hatte. Hektisch öffnete sie die Tür des Medizinschränkchens. Da lagen sie, die Schwangerschaftstests. Sie riss einen auf und ging auf die Toilette. Dieses Mal wartete sie nicht eine Ewigkeit, um das Ergebnis zu erfahren. Und sie war nicht enttäuscht, als es negativ war.
Sie war maßlos erleichtert.
Sechzigerjahre
Als die ersten Sonnenstrahlen das Meer berührten, sprang Branko auf und reckte die Arme weit in den Himmel. Er nahm seinen Körper wahr, seine Muskeln, die Erleichterung, die es einem verschaffte, wenn man sich strecken konnte und die eigene Kraft spürte. Es würde ein schöner Tag werden, das wusste er. Jeder Tag hier war schön. Die Sonne schien und brachte das Meer zum Funkeln. Sie färbte die Steine golden. Da war ein Boot etwas weiter draußen, es hüpfte auf den glitzernden Wellen und verschwand manchmal ganz im hellen Licht. Hier am Strand hatten sie einen Ort gefunden, an dem sie ungestört waren, ungestört von den Erwachsenen und ihrem Geschwätz und ihren ständigen Forderungen, einen Ort, an dem sie miteinander reden, an dem sie Pläne schmieden und sich austauschen konnten.
Jetzt stand auch Zlata auf und zog die Strickjacke enger um den schmalen Körper. Das eigentlich unförmige Kleidungsstück zeichnete ihre Figur nach, und ihm wurde unwillkürlich heiß und kalt: die schmale Taille, über der ihr dicker blonder Zopf schaukelte, die runden Hüften und die schlanken Beine, die unter dem Rock hervorschauten. Der Anblick nahm Branko schlicht den Atem.
Zlata musste sich beeilen, um nach Hause zu kommen, bevor ihre Mutter aufwachte. Wenn die mitbekam, dass ihre Tochter die Nacht anderswo verbracht hatte, würde sie Zlata windelweich prügeln.
Aber nicht mehr lange. Er hatte Pläne. Pläne für sie beide. Bald würden sie ihre eigenen Wege gehen.
Viertes Kapitel
Deutschland, Gegenwart
»Pia!«, rief Sebastian ungläubig.
Pia brachte keinen Ton hervor. Tatsächlich wurde ihr erst in diesem Moment klar, dass es wohl immer noch eine Möglichkeit gab, tiefer zu sinken.
Wie bin ich nur hierhergekommen?
Sie erinnerte sich, eine Flasche Wein aus dem Regal in der Küche genommen zu haben, nachdem sie den Schwangerschaftstest gemacht hatte. Sie hatte sie geöffnet und direkt daraus getrunken.
Nein, sie war keine Trinkerin, bei Gott nicht. Das war das erste Mal gewesen, dass sie sich so verhalten hatte, und die ersten Schlucke hatte sie sogar herunterzwingen müssen. Irgendwann war die Flasche halb leer gewesen, genug für das wolkige Gefühl in ihrem Kopf.
Oh, wie furchtbar …
Natürlich war es der Alkohol, der sie hergebracht hatte. Sie trank sonst nie so viel und schon gar nicht auf leerem Magen. Außerdem war sie bestimmt müde vom Renovieren gewesen, vom Räumen, Kistenschleppen, Saubermachen. Erschöpft eben, da wurde man noch schneller betrunken.
Es ist also wirklich vorbei, vorbei, vorbei …
Sie war eingeschlafen, wieder aufgewacht und hatte reden wollen. Mit ihm. Also hatte sie den Computer hochgefahren und irgendwie herausgefunden, wo er wohnte, trotz ihres dicken Kopfes. Facebook sei Dank. Ihr Glück, dass Sebastian nie besonders darauf achtete, seine Privatsphäre auf den Internetplattformen zu schützen.
Sie war stolz darauf, dass sie nur die Adresse notiert und den Account gleich danach wieder geschlossen hatte. Sie hatte gewiss nicht die Absicht, ihm nachzuspionieren. Obwohl die Wohnung doch etwas entfernt lag, hatte sie sich zu Fuß auf den Weg gemacht.