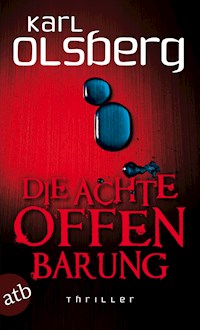8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Böse ist stärker als der Verstand... Während Marie Escher das Zukunftspotential einer Biotech-Firma analysiert, kommt es zu einem blutigen Zwischenfall. Um die Hintergründe zu klären, reist sie mit ihrem Kollegen Rafael nach Uganda. Hier in der Wildnis Afrikas gelten jedoch andere Regeln, denn gegen manche Sinneseindrücke ist der Verstand völlig machtlos. Die beiden müssen um ihr Leben kämpfen und wissen: Sie allein können die Welt vor dem Chaos bewahren ... Nach dem großen Erfolg von "Das System" ein neuer, atemberaubender Thriller von Karl Olsberg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Karl Olsberg
Der Duft
Thriller
Impressum
ISBN E-Pub 978-3-8412-0116-4ISBN PDF 978-3-8412-2116-2ISBN Printausgabe 978-3-7466-2465-5
Aufbau Digital,veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2010© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2009Aufbau Taschenbuch ist eine Markeder Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Mediabureau Di Stefano, Berlinunter Verwendung eines Fotos von© Ryann Cooley/The Image Bank/getty images
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
Prolog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Epilog
Danksagung
Gewidmet den letzten Berggorillas, dem Andenken ihrer mutigen Beschützerin Dian Fossey und den Menschen, die in ihrem Namen weiterkämpfen.
www.gorillafund.org
Der Mensch ist
dem Menschen ein Wolf
Thomas Hobbes
Prolog
Joan Ridley schreckte aus dem Schlaf. Ihr Herz pochte heftig. War da ein Schrei gewesen? Sie setzte sich auf. Durch die dünnen Vorhänge fiel das schwache, bläuliche Licht der Dämmerung. Draußen war nur das tägliche Morgenkonzert des Waldes zu hören: der Gesang der Vögel, hin und wieder unterbrochen vom klagenden Ruf eines Adlers, dem Kreischen der Meerkatzen oder dem Trompeten eines Elefanten.
Sie lauschte eine Weile, während sich ihr Puls allmählich beruhigte. Sie musste geträumt haben. Sie streckte sich auf der dünnen, von der allgegenwärtigen Feuchtigkeit klammen Matratze aus und versuchte wieder einzuschlafen. Sie hatte heute einen langen Weg vor sich: Sie wollte Gruppe8 suchen, die sie schon eine ganze Weile nicht mehr zu Gesicht bekommen hatte. Zuletzt war die zwölfköpfige Berggorillasippe an den Hängen des Sabinyo-Vulkans gesehen worden, der das Dreiländereck zwischen dem Kongo, Ruanda und Uganda markierte.
Sie schwang sich aus dem Bett, zog sich die braungrün gefleckte Tarnkleidung über, zögerte kurz, griff dann nach dem Halfter mit Revolver am Haken neben der Tür und legte ihn an. Sie hatte schon länger keine Leopardenspuren mehr in der Nähe gefunden, und es war höchst unwahrscheinlich, dass eines der scheuen Tiere sie angriff, aber es schadete nicht, vorsichtig zu sein.
Die Karisoke-Forschungsstation lag still im Morgennebel. Die meisten der schlichten Hütten standen leer. Die Gründerin der Station, die legendäre Gorillaforscherin und Naturschützerin Dian Fossey, hatte bis zu ihrer Ermordung dort gelebt, wo jetzt Joans Hütte stand. Während des Bürgerkriegs in Ruanda war die ursprüngliche Station zerstört worden, doch Joan hatte gemeinsam mit einer Gorillaschutz-Organisation für den Wiederaufbau gesorgt. Dennoch hatte hier nie wieder die frühere Betriebsamkeit geherrscht, denn seit Dian Fosseys Tod war das wissenschaftliche Interesse an den Berggorillas erlahmt. Ihr Verhalten galt als hinlänglich erforscht, ihr genetischer Code war gespeichert. Sie waren nur noch eine von vielen bedrohten Tierarten, die zumindest in den Archiven der Wissenschaft überleben würde. Nur zwei Studenten, die mehr aus Abenteuerlust denn aus wissenschaftlicher Notwendigkeit an einer Langzeitstudie der Gorilla-Bewegungen im Gebiet des Virunga-Massivs teilnahmen, schliefen noch in einer der aus Wellblech und Holz zusammengezimmerten Behausungen.
Joan ließ die beiden schlafen, ging zum Hühnerpferch und holte sich zwei Eier, die sie in der kleinen Kochhütte zu einem Omelett briet. Dann packte sie ihre Ausrüstung zusammen: Feldstecher, digitale Videokamera, Diktiergerät, eine Feldflasche mit Wasser und zwei Riegel Kraftnahrung für den Notfall. Währenddessen zogen Bilder eines wirren Traums durch ihren Kopf: Ein Gorilla, groß wie King Kong, hatte sie über die Vulkanhänge verfolgt und war dann von Hunderten von Menschen mit Macheten zerstückelt worden.
Sie schüttelte den Kopf, um das Bild zu verdrängen, und nahm einen Schluck von ihrem starken Kaffee. Die Einsamkeit hier oben hatte manchmal unangenehme Begleiterscheinungen. Trotzdem würde sie ihren Arbeitsplatz mit keinem anderen auf der Welt tauschen wollen. »Sanfte Riesen« hatte ihr Vorbild Dian Fossey sie genannt, und Joan liebte die Tiere fast wie ihre eigene Familie. Ihrer Meinung nach waren sie die freundlichsten und sympathischsten Lebewesen auf dem Planeten. Ihre Forschungsarbeit über den Humor der Berggorillas war in Fachkreisen oft belächelt oder gar verhöhnt worden. Doch sie hatte inzwischen genügend Videobeweise gesammelt, um zu zeigen, dass Gorillas sehr wohl Schabernack miteinander trieben und eine Gefühlsäußerung zeigten, die man durchaus als Lachen interpretieren konnte.
Nicht zum ersten Mal überlegte sie, was aus der Erde geworden wäre, wenn nicht Homo sapiens, sondern die Gorillas die Weltherrschaft errungen hätten. Sie war überzeugt, dass die Welt eine bessere gewesen wäre. Wenn es einen Gott gab, dann hatte er bei der Auswahl der dominanten Spezies einen gravierenden Fehler gemacht.
Sie trank den Kaffee aus, spülte das Geschirr ab und trat aus der Kochhütte. Der Karisimbi, mit gut 4500 Metern der höchste Gipfel des Virunga-Massivs, lag im Nebel verborgen. An seinen Hängen hatte Joan gestern am Spätnachmittag noch einmal kurz Kontakt mit Gruppe 5 gehabt, einer der an Menschen gewöhnten Gruppen, die in der Saison mehrmals pro Woche Besuch von Touristen bekamen.
Sie sah die Touristen mit gemischten Gefühlen. Fast täglich durchquerten sie in kleinen Gruppen die Station, fotografierten sich gegenseitig neben Dian Fosseys Grab und starrten Joan manchmal an, als hielten sie sie ebenfalls für eines der letzten Exemplare einer aussterbenden Spezies. Trotz aller Ermahnungen waren sie oft viel zu laut, ließen ihren Unrat im Lager herumliegen und trampelten durch den Urwald wie eine Horde Elefanten. Andererseits war der Gorilla-Tourismus eine der wichtigsten Devisenquellen Ruandas und hatte der Gegend um den »Parc National des Volcans« relativen Reichtum beschert. Dadurch war das Problem der Wilderei, gegen das Dian Fossey so unermüdlich gekämpft hatte, stark zurückgegangen, und der Gorillabestand hatte sich in den letzten zwei Jahrzehnten wieder leicht erholt. Es war Monate her, dass Joan eine Fangschlinge hatte entfernen müssen. Es schien, als hätten seltene Lebewesen nur dann noch eine Überlebenschance, wenn sie den Menschen als Urlaubsattraktion dienten.
Der Schrei, den sie vorhin zu hören geglaubt hatte, drängte sich in ihre Gedanken und verursachte ein ungutes Gefühl in ihrem Magen. Albern eigentlich – sicher war es nur ein Rest des wirren Traums gewesen. Doch sie würde keine Ruhe finden, bis sie sich davon überzeugte, dass der Silberrücken Cato und seine Gruppe wohlauf waren. Sie beschloss, einen kurzen Abstecher zu den Hängen des Karisimbi zu machen und nach dem Rechten zu sehen, bevor sie sich auf die Suche nach Gruppe 8 machte.
Sie ging zügig, aber nicht hastig. Auch wenn sie dem schmalen Pfad zum Karisimbi schon hundert Mal gefolgt war, wusste sie, wie gefährlich Eile sein konnte. Einerseits gab es mehrere steil abfallende Stellen, und schon ein einziger Fehltritt auf dem von der Feuchtigkeit schlüpfrigen Grund konnte einen Absturz mit Knochenbrüchen zur Folge haben. Andererseits bestand immer die Gefahr, unversehens mit einem der Büffel zusammenzustoßen, die morgens oft reglos im Unterholz standen. Jahr für Jahr kamen mehr Menschen durch Zusammenstöße mit den leicht reizbaren und enorm starken Tieren um, als durch Angriffe von Löwen oder anderen Großkatzen. Hier im Hochwald, wo es sonst nur scheue Bergleoparden gab, waren sie die mit Abstand gefährlichsten Lebewesen. Joans Pistole würde sie vor einem wütenden Büffel kaum schützen können.
Die Sonne erhob sich rasch über die Baumkronen. Ihre Strahlen flirrten durch das lichte Laub des Hochwaldes und vertrieben den Morgennebel. Doch Joan hielt sich nicht mit der Betrachtung der herrlichen Natur auf. Eine unerklärliche innere Unruhe, die mit jedem Schritt zuzunehmen schien, trieb sie voran.
Nach einer halben Stunde erreichte sie den Berghang, an dem sie Gruppe 5 zuletzt beobachtet hatte. Die Wiese war leer, der Dung abgekühlt. Die Gruppe hatte für die Nacht sicher den Schutz des Dickichts weiter oben aufgesucht.
Joan hielt einen Moment inne, um ihren Puls zu verlangsamen und Atem zu schöpfen. Sie durfte ihre wissenschaftliche Professionalität nicht verlieren. Offenbar machte sie die lange Einsamkeit nervöser, als sie sich eingestand. Vielleicht war es Zeit, mal wieder ein paar Wochen zu ihren Eltern nach Atlanta zu fahren, um etwas Abstand zu gewinnen. Sie atmete tief durch, doch das beklemmende Gefühl in ihrer Brust wollte nicht weichen.
Sie sah sich einen Moment um. Für jemanden, der sich schon so lange mit Gorillas beschäftigte wie Joan, war es ziemlich leicht zu erkennen, was die Familie aus dreizehn Tieren hier getrieben hatte. Sie waren etwa zwei bis drei Stunden an dieser Stelle geblieben, hatten gefressen und geruht, bevor sie in der Abenddämmerung aufgebrochen waren, um einen besser geschützten Schlafplatz zu suchen. Einer der Büsche war ziemlich übel zugerichtet: Abgebrochene Zweige und Blätter lagen herum, Spuren des Imponiergehabes eines der jungen Schwarzrücken. Abgeknickte Äste an einem niedrigwüchsigen Baum zeigten, dass hier die beiden Jungtiere der Gruppe herumgeklettert waren. Schließlich entdeckte Joan die Stelle, an der die Gruppe die Wiese verlassen hatte, und folgte ihrer Spur weiter den Hang hinauf.
Das erste, was sie wahrnahm, war der Geruch. Der ekelhafte, metallische Geruch von Blut, gemischt mit dem Gestank in höchster Not ausgeschiedener Exkremente. Dann hörte sie das Summen der Fliegen.
Ihre Kehle schnürte sich zusammen, als ihr klar wurde, dass sich ihre schlimmsten Ahnungen bestätigten. Sie zwang sich, die Zweige eines dichten Gebüschs beiseitezuschieben.
Es war eines der Weibchen. Joan hatte sie Lucy getauft, weil sie immer ein bisschen dominant und frech gewirkt hatte – so wie die Figur in den Peanuts-Comics. Lucy lag unter hoch aufragenden Farnen auf dem Rücken. Ihre leeren Augen starrten hinauf in das lichtdurchflutete Blätterdach. Der intelligente, beinahe verschmitzte Ausdruck, der in diesen Augen gelegen hatte, war für immer verschwunden.
Joan verscheuchte die Fliegen, die sich auf Lucys schrecklich zugerichtetem Körper niedergelassen hatten. Das schwarze, seidige Haar war blutverklebt. Hals und Brust wiesen mehrere tiefe Fleischwunden auf. Ein ganzes Stück ihrer Schulter sowie ein Teil des linken Unterarms fehlten.
Das Entsetzen raubte ihr den Atem. Sie hatte Fotos von Gorillakadavern gesehen, die von den Macheten der Wilderer brutal verstümmelt worden waren, aber keiner der Körper war so zerfetzt gewesen. Die Wunden waren nicht glatt, sondern unregelmäßig und ausgefranst. Es sah aus, als habe jemand mit einem nicht mehr scharfen Dolch oder einem spitzen Dorn brutal auf den Gorilla eingestochen.
Es dauerte eine ganze Weile, bis sie einen klaren Gedanken fassen konnte. Was war hier geschehen? Wo war der Rest von Gruppe 5? Wieso hörte sie keine aufgeregten Rufe, kein erregtes Brusttrommeln? Sie wischte sich die Tränen aus den Augen und zwang sich, der Spur weiter zu folgen.
Wenige Minuten später hatte sie die schreckliche Gewissheit: Kando, Lisa, Jenny und Mira, die vier übrigen Weibchen, die beiden Jungtiere Benni und Bob, sogar der mächtige Silberrücken Cato – sie alle lagen verstreut über eine Fläche von mehreren hundert Quadratmetern, auf die gleiche bestialische Weise zugerichtet. Die Leichen von zwei der jungen Schwarzrücken, die sie als Jojo und Alfred erkannte, fand sie auf merkwürdige Weise ineinander verschlungen, als hätten sie noch im Tod die Nähe zueinander gesucht und sich zum Trost umarmt. Tom und Jerry, ebenfalls junge Männchen, lagen nicht weit davon entfernt auf dem Bauch. Eine Blutspur führte durch das Blattwerk, es sah so aus, als hätten sie sich noch schwer verletzt vom Ort des Grauens fortschleppen wollen.
Joan ging mit steifen, beinahe roboterhaften Schritten zwischen den Kadavern umher. Ihre Augen nahmen die Bilder auf, aber ihr Gehirn weigerte sich, sie zu verarbeiten. Sie war wie betäubt. Das, was hier geschehen war, passte nicht in ihren Kopf.
Es war undenkbar, dass die Katastrophe einen natürlichen Ursprung hatte. Kein Lebewesen des Waldes wäre in der Lage gewesen, einer gesunden Gorillagruppe etwas Derartiges anzutun. Es gab nur eine Lebensform, die zu solcher Grausamkeit fähig war.
Joan spürte kaum die Tränen auf ihren Wangen. Sie betrachtete den entsicherten Revolver in der Hand, aber es gab kein Ziel, an dem sie ihre ohnmächtige Wut hätte auslassen können. Sie war fast froh, dass die Verantwortlichen für dieses Verbrechen offenbar nicht mehr in der Nähe waren, denn sie hätte sich des Mordes schuldig gemacht, wäre sie einem der Wilderer begegnet.
Gorillas waren schon früher auf grausame Weise von Menschen getötet worden. Sie hatten sich in den Schlingen der Wilderer verfangen und sich üble Verstümmelungen zugezogen, an deren Folgen einige verendet waren. Erwachsene Tiere hatte man erschossen, um ihre Jungen in Zoos zu verschleppen. In einigen seltenen Fällen waren Gorillas mit Wilderern oder mit Hirten aneinandergeraten, die ihre Rinder verbotenerweise in die Randbezirke des Nationalparks getrieben hatten. Joan hatte einmal Fotos eines Silberrückens gesehen, der während des ruandischen Bürgerkriegs von den Splittern einer Armeegranate getötet worden war. Aber nichts von alldem reichte an die sinnlose Gewalt heran, die hier gewütet hatte.
Es war einfach unfassbar. Eine ganze Familie ausgelöscht. Dreizehn Tiere. Für den Fortbestand der Berggorillas war das eine Katastrophe.
Als sie die Fundorte der Leichen auf der Suche nach Spuren der Mörder noch einmal abging, fiel ihr auf, dass es nur zwölf Tiere waren. Onkel Sam, der älteste der Schwarzrücken, fehlte. Offenbar war er dem Massaker entkommen. Vielleicht war er rechtzeitig geflohen, oder er hatte sich schwer verletzt davonschleppen können und lag nun irgendwo in einem Gebüsch und verendete qualvoll. Sie musste ihn finden!
Joan zwang sich, das Grauen zu verdrängen und sich auf diese Aufgabe zu konzentrieren. Ihr war übel. Ihre Hände zitterten, und ihre Knie fühlten sich an, als seien sie aus Gummi, aber sie schaffte es irgendwie, aufrecht stehen zu bleiben. Schließlich fand sie Blutspuren an den niedrigen Büschen und Farnen. Vorsichtig folgte sie der Spur den Berg hinauf.
Sie erinnerte sich an ihre erste Begegnung mit Gruppe 5. Sie war damals erst ein paar Wochen in Karisoke gewesen und hatte sich ziemlich ungeschickt angestellt. Statt durch lautes Zweigeknacken auf sich aufmerksam zu machen, hatte sie sich an die Gruppe angeschlichen, um sie ungestört zu beobachten. Sie hatte damals geglaubt, das Verhalten der Gorillas auf diese Weise besser studieren zu können. Doch sie war der Gruppe zu nahe gekommen, und Sam hatte sie sehr schnell hinter einem Busch entdeckt. Das daraufhin losbrechende Spektakel hatte sie bis ins Mark erschüttert. Die ganze Gruppe hatte sich hinter dem Silberrücken versammelt, der mit lautem Gebrüll auf sie losgegangen war. Joan hatte sich, ihr Ende vor Augen, auf dem Boden zusammengekauert. Doch Cato, der Menschen offenbar nicht für eine ernste Bedrohung hielt, hatte ganz dicht vor ihr innegehalten, verächtlich geschnaubt und sich dann abgewandt. Er hatte ihr ein für alle Mal gezeigt, dass Gorillas ein Anschleichen nicht tolerierten. Joan hatte diesen Fehler nicht noch einmal gemacht.
Die Blutspur führte in ein Dickicht aus Farnen und Bambus. Etwas wie ein heiseres Röcheln drang daraus hervor. Joan verharrte. Was sollte sie tun? Sich einem verletzten Gorilla zu nähern, war extrem gefährlich. Aber sie konnte Sam nicht einfach in dem Gebüsch verenden lassen!
Vorsichtig bog sie einige große Farnwedel beiseite. Dahinter erstreckte sich eine breite Spur niedergedrückter Pflanzen und abgebrochener Bambusstauden bis zu einem großen Busch, dessen Blattwerk eine natürliche Höhle formte. Darin hockte Onkel Sam, nur etwa ein Dutzend Meter entfernt. Seine Augen waren geweitet. Um die schwarzen Pupillen waren rötlich-weiße Ränder zu erkennen. In seiner Hand hielt er etwas, das wie ein welkes Bananenblatt aussah. Nein, es war ein Stück Stoff – vielleicht ein Kleidungsfetzen von einem der Mörder. Der Gorilla bleckte die Zähne und ließ ein kehliges Knurren ertönen, verhielt sich ansonsten aber ganz ruhig.
Langsam näherte Joan sich dem Tier bis auf etwa acht Meter, wobei sie leise, beruhigende Worte murmelte. Auch Sams Fell war blutverklebt, aber sie konnte nicht erkennen, wie schwer seine Verletzungen waren. Offene Fleischwunden waren nicht zu sehen.
Plötzlich sprang er auf, stieß ein durchdringendes Brüllen aus und rannte auf Joan zu.
Einen Moment war sie zu erschrocken, um zu reagieren. Das Tier konnte nicht sehr schwer verletzt sein, denn es bewegte sich behände und ohne erkennbare Beeinträchtigung. Ihr wurde klar, dass es völlig verstört sein musste. Gorillas waren eigentlich sehr friedliche Lebewesen, aber das Vertrauen, das Joan mit der Gruppe über viele Monate aufgebaut hatte, war sicher durch die Wilderer zerstört worden. Der Gorilla musste sie für einen grausamen Feind halten.
Sie wusste, sie würde gegen das Tier, das mehr als doppelt so schwer war wie sie und über messerscharfe Reißzähne verfügte, keine Chance haben. Onkel Sam würde sie töten.
Ein Schuss fiel.
Sam hielt mitten in seinem Angriff inne und starrte sie verwundert an. Joan wurde erst nach einer Sekunde klar, dass sie selbst vor Schreck in die Luft geschossen hatte.
Sie wartete nicht, bis der Gorilla sich von seinem Schock erholt hatte, sondern drehte sich um und rannte den Abhang hinab. Hinter sich hörte sie das Brechen von Zweigen und das Keuchen und Knurren des wütenden Tieres. Erneut schoss sie in die Luft, aber diesmal ließ sich der Gorilla nicht aufhalten. Er stieß nur einen langgezogenen Wutschrei aus. Er war jetzt so nah, dass Joan glaubte, seinen Atem im Nacken zu spüren.
Sie stolperte, schlug hin, rappelte sich auf. Sie hatte keine Chance, Onkel Sam zu entkommen, der sich in seiner vertrauten Umgebung viel schneller und sicherer bewegen konnte. Aber sie würde lieber sterben, als ihren Revolver gegen den letzten Überlebenden der Gruppe 5 zu richten und selbst zur Mörderin an einem dieser großartigen Geschöpfe zu werden.
Plötzlich gab der Boden unter ihr nach. Hinter einer Wand aus hohen Farnen fiel der Hang steil ab. Sie stürzte, überschlug sich ein paar Mal. Der Revolver glitt ihr aus der Hand. Sie rollte seitwärts den Abhang hinunter und schlug schließlich mit dem Kopf hart gegen einen großen Brocken aus verwittertem Basalt, der aus den Farnen aufragte. Sie hörte einen triumphierenden Schrei hoch über sich. Dann wurde es dunkel um sie.
1.
Das neue Projekt begann mit einem Chaos. Als Marie Escher pünktlich um halb sieben am Flughafen Berlin-Tegel eintraf, wurde ihr sorgfältig geplanter Tagesablauf über den Haufen geworfen. Ein Systemabsturz in Frankfurt hatte dafür gesorgt, dass die Anzeigetafeln in leuchtendem Gelb massenhaft Verspätungen und Flugausfälle verkündeten. Der Flughafen war überfüllt mit Geschäftsleuten in dunklen Anzügen, die mit ihren Reisetrolleys im Schlepp ratlos durch die Gänge irrten oder in langen Schlangen vor den Informationsschaltern ausharrten.
Na schön. Marie hätte nicht kurz davor gestanden, als erste Frau zum Partner der Unternehmensberatung Copeland & Company gewählt zu werden, wenn sie nicht in der Lage gewesen wäre, mit solchen Schwierigkeiten umzugehen. Der Termin mit ihrem neuen Klienten Daniel Borlandt, dem Vorstandschef der Oppenheim Pharma AG in Frankfurt, war erst um 14.00 Uhr.
Sie ging in die überfüllte »Senator Lounge« für besonders gute Lufthansa-Kunden, um sich dort über die Situation zu informieren. Die Frau am Empfang hatte dieselben schulterlangen, pechschwarzen Haare wie Marie, jedoch nicht ihren sehr hellen Teint, der ihr als Kind den Spitznamen »Schneewittchen« eingetragen hatte. Mit einem professionellen Lächeln verkündete sie, die Maschine habe etwa eine Stunde Verspätung.
Marie wog ihre Alternativen ab. Wie sie die Lufthansa kannte, konnten aus der einen Stunde Verspätung leicht zwei oder drei werden, oder die Maschine wurde ganz gestrichen. Besser, sie setzte auf Sicherheit und nahm den ICE.
Auch der Zug hatte fast eine Stunde Verspätung, und so kam sie erst knapp vor dem Treffen in Frankfurt an. Ihr Teamkollege Konstantin Stavras empfing sie am Haupteingang der Firmenzentrale. Er war hochgewachsen und sehr schlank, mit buschigen Augenbrauen und stark abstehenden Ohren. Er hatte ein warmes, freundliches Lächeln aufgesetzt.
Auch Marie freute sich, ihn zu sehen. Sie hatte bisher noch kein gemeinsames Projekt mit ihm gehabt, aber Konstantin galt als brillanter Analytiker und sehr gewissenhafter Berater. Er war mit dem Auto aus Düsseldorf gekommen und hatte nicht mehr als den einkalkulierten einstündigen Stau auf der A3 bei Köln erlebt, sodass er als einziges Teammitglied pünktlich um 10.00 Uhr eingetroffen war.
»Will kann nicht kommen«, sagte Konstantin. »Alle Flüge von London nach Frankfurt sind gestrichen worden.«
Will Bittner war der für den Kunden Oppenheim AG verantwortliche Partner bei Copeland und auf diesem Projekt Maries Vorgesetzter. Normalerweise hätte er also das Gespräch mit Borlandt geführt. Nun musste Marie diesen Part übernehmen, aber sie hatte bereits mit dieser Möglichkeit gerechnet und sich auf der Zugfahrt darauf vorbereitet.
»Was ist mit Rico Kemper?«, fragte sie.
»Der ist vor einer Viertelstunde gelandet und sitzt im Taxi. Müsste gleich da sein.«
Konstantin führte sie in einen Konferenzraum auf der Vorstandsetage im vierten Stock des schmucklosen Verwaltungsbaus, den man ihnen für den Tag zur Verfügung gestellt hatte. Aus dem Fenster sah man mehrere zweistöckige Gebäude mit Labors und Büros sowie zwei langgezogene Hallen, in denen vermutlich Produktionsanlagen und Lagerräume untergebracht waren. Trotz einiger Bäume und Grünstreifen wirkte die ganze Anlage grau und unansehnlich. Ein undefinierbarer, leicht unangenehmer Geruch wehte von draußen herein. Marie war sich nicht sicher, ob er vom Werk der Oppenheim AG oder den benachbarten Industrieanlagen herrührte.
»Ich hab uns schon mal Kaffee organisiert«, sagte Konstantin und schenkte ihr auf ihr Nicken hin eine Tasse ein.
In diesem Moment betrat Rico den Teamraum. Er hatte ein fein geschnittenes, sonnengebräuntes Gesicht und sorgfältig manikürte Hände. Marie kannte ihn von einem gemeinsamen Training und war von seiner leicht arroganten Ausstrahlung irritiert gewesen. Aber er hatte einen guten Ruf in der Firma, da er bereits zwei Folgeprojekte akquiriert hatte, und stand kurz vor der Beförderung zum Projektleiter.
Er knallte seinen Aktenkoffer auf einen der Arbeitstische. »Sorry, Leute. So ein Chaos habe ich noch nie erlebt!«
»Ja, ich weiß«, sagte Marie. »Ich bin auch erst seit einer Viertelstunde hier.«
»Worum geht’s hier eigentlich?«, fragte Rico. »Ich hatte noch nicht die Zeit, in die Unterlagen zu schauen.«
Marie fragte sich, was er wohl während der Wartezeit am Flughafen gemacht hatte. Wahrscheinlich hatte er sich die ganze Zeit mit irgendwelchen überforderten Mitarbeiterinnen der Lufthansa herumgestritten.
»Die Oppenheim AG steckt in ziemlichen Schwierigkeiten«, erklärte sie. »Die Patentfristen der beiden wichtigsten Produkte laufen demnächst aus, und die Firma hat in der Vergangenheit viel zu wenig Forschung betrieben. Die haben sich anscheinend auf den Erfolgen der Vergangenheit ausgeruht und stehen jetzt kurz vor einem Umsatzeinbruch. Die Börse weiß das natürlich, und der Kurs ist entsprechend gefallen. Oppenheim gilt als Übernahmekandidat.«
»Na toll. Ein echter Saustall!«, kommentierte Rico. »Da haben wir ja alle Hände voll zu tun!«
»Stimmt es, dass Borlandt früher Projektleiter bei Copeland war?«, fragte Konstantin.
Marie nickte. »Ich glaube, Will und er haben damals gleichzeitig angefangen. Er hat dann irgendwann ein Projekt bei Merck gehabt, ist dort als Vertriebsdirektor abgeworben worden und später Vertriebsvorstand geworden. Oppenheim hat ihn vor ein paar Monaten als Vorstandschef geholt, damit er die Firma wieder in die Profitabilität führt. Aber das wird nicht einfach.« Sie sah auf die Uhr. »Wir müssen los!«
Zu dritt legten sie den kurzen Weg bis zu Daniel Borlandts Büro zurück.
Borlandt begrüßte sie mit einem breiten Lächeln und einem festen Händedruck. Er hatte sehr kurzes Haar und eine leicht schiefe Nase, was ihm ein verwegenes, aber nicht unsympathisches Äußeres verlieh. Seine hellgrünen Augen blickten aufmerksam in die Runde.
»Will Bittner lässt sich entschuldigen«, sagte Marie. »Leider wurden sämtliche Flüge von London nach Frankfurt gestrichen.«
»Ja, ich hab von dem Chaos am Flughafen gehört«, sagte Borlandt, während sie sich an den Besprechungstisch in seinem großzügigen, holzgetäfelten Büro setzten. »Wir hatten heute Morgen auch einen Computerausfall. Wahrscheinlich irgendein Virus, der mal wieder das halbe Internet lahmlegt.«
Sie begannen das Meeting mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Borlandt erzählte, wie er Will kennengelernt hatte. Marie hätte fast gegrinst, als sie erfuhr, dass er sich auf seinem ersten Projekt einen peinlichen Rechenfehler geleistet hatte, der erst in der Vorstandspräsentation aufgefallen war. Mit seinem Charme und seiner Redegewandtheit hatte sich Will damals aus der Affäre gezogen.
»Ich hätte nie geglaubt, dass der mal Partner wird«, sagte Borlandt mit einem verschmitzten Lächeln. »Nun ja, das ist lange her. Heute sitzen wir auf verschiedenen Seiten des Tisches, und ich muss zugeben, ich kann die Unterstützung von Copeland gut gebrauchen. Ich nehme an, Sie haben sich die Unterlagen angesehen, die ich Will geschickt hatte?«
Marie nickte. Sie erläuterte kurz ihre Eindrücke.
»Sie haben sehr schnell verstanden, worum es hier geht«, sagte Borlandt. »Die Oppenheim AG steht mit dem Rücken zur Wand. Sollte es uns nicht gelingen, den Aktienkurs in den nächsten Monaten mindestens zu stabilisieren, sind wir reif wie Fallobst für eine feindliche Übernahme. Das Problem ist: Unsere Kosten sind viel zu hoch. Andererseits haben wir einen ziemlich mächtigen Betriebsrat. Es wird nicht einfach, einen Personalabbau durchzusetzen.«
»Sollen wir eine OOP machen?«, fragte Marie. Die Abkürzung stand für »Optimierung der operativen Prozesse« – eine schöne Umschreibung für ein Kostensenkungsprogramm.
Borlandt schüttelte den Kopf. »Nein. Wir wissen auch so, dass wir einen viel zu großen Verwaltungsapparat haben. Wir brauchen einen kurzfristigen Befreiungsschlag, der frisches Geld in die Kasse bringt, damit unsere mittelfristigen Maßnahmen greifen können. Wir haben da eine Tochtergesellschaft, die nicht wirklich zu unserem Kerngeschäft passt. Ich möchte, dass Sie sich diese Firma genau anschauen und mir sagen, welches Zukunftspotenzial sie hat und ob es Sinn macht, sich jetzt von ihr zu trennen.«
»Um welche Tochtergesellschaft geht es?«, fragte Marie. »Croptec? Biokinetics? Olfana?«
»Croptec bewegt sich in einem hart umkämpften Markt, aber die haben wenigstens ein paar brauchbare Produkte und machen Gewinn. Biokinetics ist unser einziger echter Hoffnungsträger – wenn wir den verkaufen, glaubt niemand mehr an die Zukunft der Oppenheim AG. Der naheliegendste Verkaufskandidat ist aus meiner Sicht Olfana.«
»Was genau machen die denn?«, fragte Rico.
»Natürliche Schädlingsbekämpfung. Angesichts der ganzen Umweltdiskussion ist das wahrscheinlich ein Wachstumsmarkt. Problematisch ist, dass die Firma bisher kaum marktreife Produkte hat und eine Menge Geld in die Forschung investiert, sodass sie hohe Verluste einfährt. Ich möchte, dass Sie herausfinden, wie groß ihr Zukunftspotenzial ist und was ein realistischer Verkaufspreis wäre. Ich habe den Geschäftsführer Dr. Scorpa schon über Ihren Besuch in Kenntnis gesetzt. Er ist nicht unbedingt begeistert, dass ihm jemand auf die Finger schauen wird, also gehen Sie bitte behutsam mit ihm um!«
»Das werden wir«, sagte Marie.
»Wir werden Ihnen in etwa zwei Wochen einen Zwischenbericht vorlegen«, sagte Rico.
Marie warf ihm einen finsteren Blick zu. Es war ihre Aufgabe als Projektleiterin, das Vorgehen abzustimmen, nicht seine.
Borlandt nickte. »Eine gute Idee. Meine Assistentin wird Ihnen einen Termin nennen. Ich wünsche viel Erfolg!«
Das Firmengebäude von Olfana in Dreieich, etwa zwanzig Minuten vom Sitz der Oppenheim AG entfernt, war ein zweistöckiger grauer Zweckbau auf dem Gelände eines stillgelegten Werkes. Außerdem waren hier eine Spedition, ein Reifenhandel, ein Baumarkt und mehrere Handwerksunternehmen untergebracht. Das Firmenschild neben dem Hauseingang war so klein, dass sie es fast übersehen hätten.
Dr. José Scorpa, ein elegant gekleideter, dunkelhäutiger Mann Mitte fünfzig, begrüßte sie knapp mit leicht südländischem Akzent und einem charmanten Lächeln, das besonders Marie galt. Sein Aftershave war etwas zu großzügig aufgetragen.
Scorpas Büro wirkte in dem tristen Bau überraschend modern und elegant. An den Wänden hingen abstrakte Ölgemälde, auf dem exquisiten Schreibtisch stand ein teurer Designcomputer. Eine hübsche Sekretärin fragte nach ihren Getränkewünschen. Marie bestellte ein Mineralwasser, Rico einen Latte macchiato und Konstantin eine Cola.
»Herr Borlandt hat gesagt, Sie seien hier, um unser Zukunftspotenzial zu bewerten«, sagte Scorpa, während sie sich an den großzügigen Konferenztisch setzten. Seine dunklen Augen musterten sie aufmerksam. »Was genau kann ich denn für Sie tun?«
»Vielleicht erklären Sie uns zuerst, was Olfana eigentlich macht«, sagte Rico, bevor Marie dazu kam, die Frage zu beantworten. Er hatte sich in seinem Stuhl zurückgelehnt und die Arme vor der Brust verschränkt.
»Olfana entwickelt Methoden zur biologischen Schädlingsbekämpfung.«
»Aha. Und was genau sind das für Methoden?«
»Wir verwenden Geruchsstoffe. Es ist seit Langem bekannt, dass sich Tiere mit bestimmten Gerüchen fernhalten lassen. Denken Sie an Anti-Mücken-Kerzen. Mäuse und Ratten beispielsweise verabscheuen den Geruch von Katzenurin. Menschen leider auch. Deshalb arbeiten wir hier zum Beispiel daran, die Moleküle zu isolieren, die von Nagetieren wahrgenommen werden, von Menschen jedoch nicht. So könnte man auf den Einsatz von Rattengift weitgehend verzichten.«
»Und das funktioniert?«, fragte Rico mit unverhohlener Skepsis.
»Die meisten Menschen haben leider vergessen, wie wichtig der olfaktorische Sinn für unser Leben ist«, sagte Scorpa in herablassendem, beinahe mitleidigem Tonfall. »Vielleicht kennen Sie das: Ein bestimmter Duft steigt Ihnen in die Nase, und plötzlich haben Sie eine Szene klar vor Augen, die Jahre oder Jahrzehnte zurückliegt. Gerüche prägen sich in unserem Gedächtnis viel tiefer und länger ein als irgendeine andere Sinneswahrnehmung. Und sie beeinflussen uns auch stärker, als wir wahrhaben wollen. Nicht umsonst sagt man: ›Den kann ich nicht riechen.‹«
»Was ist denn der Vorteil Ihrer Methode?«, fragte Marie.
»Es gibt viele Vorteile. Geruchsstoffe sind zum Beispiel vollkommen umweltverträglich und schädigen keine Lebewesen.«
»Aber ist das nicht auch recht aufwendig und teuer?«, fragte Rico.
Scorpa schüttelte den Kopf. »Nicht unbedingt. Gerüche bestehen aus einer Mischung ganz bestimmter Moleküle. Wenn man einmal weiß, wie sie chemisch aufgebaut sind, ist es meist relativ leicht, sie zu synthetisieren. Ein Nachteil von Duftstoffen gegenüber Gift ist, dass sie flüchtig sind und ihre Abschreckungswirkung allmählich verlieren. Aber wir arbeiten hier an speziellen Trägermaterialien, mit denen wir das Problem lösen.«
»Warum macht Ihre Firma dann Verluste?«
Marie seufzte innerlich. Wenn Rico Diplomat geworden wäre, hätte es vermutlich längst einen dritten Weltkrieg gegeben.
Scorpa versteifte sich. »Ich habe mir gleich gedacht, dass Sie nicht gekommen sind, um etwas über Olfana zu lernen«, sagte er. »Sie wollen lediglich Ihre Vorurteile bestätigt bekommen. Sie glauben, wir versenken hier Geld in sinnloser Forschung an Nischenprodukten, für die es nie einen großen Markt geben wird. Wahrscheinlich hat unser neuer Vorstandsvorsitzender längst vor, Olfana zu schließen, und braucht nur noch jemanden, der ihm diese Entscheidung mit Zahlen untermauert.« Er beugte sich vor und senkte die Stimme. »Aber eins sage ich Ihnen: Ich werde um diese Firma kämpfen. Sollten Sie Ihre Absicht, Olfana zu schließen, weiterverfolgen, werde ich Ihnen und Ihrem Auftraggeber die Hölle heiß machen!«
»Dr. Scorpa, es ist nicht unsere Absicht …«, begann Marie, doch Rico fiel ihr wieder mal ins Wort.
»Wir lassen uns nicht einschüchtern«, sagte er, lauter als nötig. »Copeland & Partner hat den Auftrag bekommen, diese Firma auf ihr Potenzial hin zu untersuchen, und das werden wir auch tun!«
Scorpa verschränkte die Arme vor der Brust. »Glauben Sie, der Name Copeland & Partner beeindruckt mich? Ich weiß sehr wohl, dass Berater wie Sie über Leichen gehen, dass Ihnen das Schicksal der Mitarbeiter, die sie wegrationalisieren, völlig egal ist. Deshalb hat mein alter Freund Franz Wullenweber von der Gewerkschaft auch ein ziemlich finsteres Gesicht gemacht, als er erfuhr, dass Sie hier im Haus sind. Wir lassen uns nicht so einfach auf dem Altar der Börse opfern!«
Marie erschrak. Wullenweber war der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats. Wenn Scorpa ihn gegen das Projekt aufhetzte, würde es verdammt ungemütlich werden. »Dr. Scorpa, bitte verzeihen Sie, wenn hier der Eindruck entstanden ist, wir hätten bereits ein Urteil über Olfana gefällt«, sagte sie und bedachte Rico mit einem eisigen Blick. »Das ist selbstverständlich nicht der Fall. Unser Auftrag ist es, das Zukunftspotenzial Ihrer Firma objektiv zu bewerten.«
»Gut, dann tun Sie das«, sagte Scorpa. Er holte einen Ordner aus einem Aktenschrank und knallte ihn auf den Konferenztisch. »Hier, das sind die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten fünf Jahre. Und jetzt lassen Sie mich bitte meine Arbeit machen.« Er öffnete die Tür und rief nach seiner Assistentin. »Judith, würden Sie den Herrschaften bitte ihren Raum zeigen.«
Marie fühlte, wie der Zorn ihr die Röte ins Gesicht trieb. Sie bedankte sich bei Scorpa und folgte ihren beiden Teammitgliedern aus dem Raum.
2.
Judith Meerbusch, Scorpas Sekretärin, führte sie zu einem Büro am Ende des Flurs. Es bot ihnen drei Schreibtische und einen kleinen Besprechungstisch, auf dem ein Tablett mit einer Kaffeekanne und einer Glaskaraffe Mineralwasser sowie Tassen und Gläsern bereitstand. »Wie gewünscht haben wir Ihnen auch einen Internetzugang eingerichtet«, sagte sie. »Ich hoffe, es ist alles zu Ihrer Zufriedenheit?«
»Ja, vielen Dank, Frau Meerbusch!« Marie war froh, endlich die Tür hinter der Sekretärin zu schließen. Sie musste unbedingt ein ernstes Wort mit Rico sprechen. Doch sie war noch viel zu zornig, um die Ruhe und Professionalität auszustrahlen, die sie als Projektleiterin brauchte.
»Sag mal, was war denn gerade mit dir los?«, fragte stattdessen Konstantin. »Was du da eben abgezogen hast, war hochgradig unprofessionell! Voll auf Konfrontationskurs zu gehen! Wir können froh sein, wenn es uns gelingt, wieder eine Arbeitsbeziehung zu Scorpa aufzubauen.«
Marie verspürte eine grimmige Genugtuung darüber, dass er aussprach, was sie dachte. Doch sie bereute das Gefühl augenblicklich. Sie durfte sich nicht von ihren Emotionen kontrollieren lassen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!