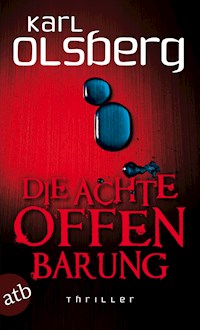
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kann eine Botschaft aus der Vergangenheit unsere Zukunft verändern?
Dem Historiker Paulus Brenner fällt ein uraltes verschlüsseltes Manuskript aus dem Besitz seiner Familie in die Hände. Doch je mehr er von dem Text dekodiert, desto rätselhafter wird der Inhalt. Denn das Buch sagt mit erstaunlicher Präzision Ereignisse voraus, die zum Zeitpunkt seiner vermuteten Entstehung noch nicht geschehen sind. Während aus einem US-Labor hoch gefährliches Genmaterial verschwindet, will irgendjemand um jeden Preis verhindern, dass Paulus auch die letzte, die achte Offenbarung entziffert ...
Ein packender Thriller um eine erschreckend realistische Apokalypse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Leseprobe
Karl Olsberg
D I E A C H T E O F F E N B A R U N G
Thriller
Impressum
Hinweis des Autors:
Dieses Buch ist ein Werk der Fiktion. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen oder Personen ist zufällig und unbeabsichtigt.
ISBN 978-3-8412-0575-9
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, März 2013
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die Originalausgabe erschien 2013 bei Aufbau Taschenbuch, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z. B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Mediabureau Di Stefano, Berlin
unter Verwendung eines Motivs von plainpicture/C&P
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
Prolog. Militärbasis Fort Fredrick, Maryland, Donnerstag 16:05 Uhr
1. Hamburg, Donnerstag 17:45 Uhr
2. Hamburg, Freitag 19:27 Uhr
3. Hamburg, Freitag 22:15 Uhr
4. Washington D. C., Maryland, Freitag 15:53 Uhr
5. Hamburg, Samstag 09:50 Uhr
6. Hamburg, Samstag 14:17 Uhr
7. Hamburg, Samstag 17:45 Uhr
8. Köln, Sonntag 10:53 Uhr
9. Köln, Sonntag 15:10 Uhr
10. Fort Meade, Maryland, Sonntag 14:03 Uhr
11. Köln, Sonntag 22:17 Uhr
12. Köln, Montag 04:47 Uhr
13. Köln, Montag 07:32
14. Köln, Montag 15:11 Uhr
15. Köln, Montag 16:35 Uhr
16. Köln, Montag 19:40 Uhr
17. Köln, Dienstag 09:11
18. Heidelberg, Dienstag 14:12 Uhr
19. Heidelberg, Dienstag 16:05 Uhr
20. Clover Hill, Maryland, Dienstag 20:50 Uhr
21. Heidelberg, Mittwoch 01:27 Uhr
22. Heidelberg, Mittwoch 04:40 Uhr
23. Heidelberg, Mittwoch 09:06 Uhr
24. Hagen, Mittwoch 15:49 Uhr
25. Olsberg-Bruchhausen, Mittwoch 17:38 Uhr
26. Olsberg-Bruchhausen, Mittwoch 17:53 Uhr
27. Hanover, Massachusetts, Mittwoch 20:55 Uhr
28. Remscheid, Donnerstag 09:34 Uhr
29. Washington D. C., Maryland, Donnerstag 11:07 Uhr
30. Speyer, Donnerstag 18:38 Uhr
31. Worms, Freitag 00:11 Uhr
32. Hagen, Freitag 09:15 Uhr
33. Düsseldorf, Freitag 11:57 Uhr
34. Düsseldorf, Freitag 15:51 Uhr
35. Lourdes, Samstag 00:15 Uhr
36. Düsseldorf, Samstag 04:27 Uhr
37. Autobahn 44 nahe Unna, Samstag 10:06 Uhr
38. Autobahn 44 nahe Soest, Samstag 10:15 Uhr
39. Berlin, Samstag 15:44 Uhr
40. Berlin, Sonntag 11:27 Uhr
41. Washington D. C., Maryland, Montag 11:37 Uhr
42. Hamburg, Montag 17:19 Uhr
43. Hamburg-Harburg, Montag 18:41 Uhr
44. Davis-Monthan Air Force Base, Tucson, Arizona, Dienstag 10:12 Uhr
45. Berlin, Dienstag 14:31 Uhr
46. Washington D. C., Maryland, Dienstag 18:41 Uhr
47. Luftraum über dem Indischen Ozean, Mittwoch 08:51 Uhr
Epilog. Hamburg, Sonntag 10:20 Uhr
Für Carolin,das größte Rätsel von allen
Ausgestattet mit einem einzigen Reagenzglas einer biologischen Substanz … könnten kleine Gruppen von Fanatikern oder scheiternde Staaten die Macht erlangen, um große Nationen und den Weltfrieden zu bedrohen. Amerika und die gesamte zivilisierte Welt sehen sich dieser Bedrohung in den kommenden Dekaden ausgesetzt. Wir müssen der Gefahr mit offenen Augen und unbeugsamem Willen begegnen.
Präsident George W. Bush, 11. Februar 2004
Es ist ja das große Glück,
den Wurm dann zu spüren,
wenn er noch vernichtet werden kann.
Bernhard von Clairvaux, 1142
PrologMilitärbasis Fort Fredrick, Maryland, Donnerstag 16:05 Uhr
Es riecht nicht gut. Das war der erste Gedanke, den Eddie Wheeler hatte, als er das zweistöckige Gebäude auf dem Militärgelände von Fort Fredrick betrat, etwa achtzig Kilometer nordwestlich von Washington. Der zweite: wie damals, als Oma starb.
Es war genau dieselbe Mischung des stechenden Geruchs von Desinfektionsmittel und der abgestandenen Atmosphäre von Räumen, die nie auf natürliche Weise belüftet wurden. Er konnte beinahe seine Großmutter vor sich liegen sehen, die Haut eingefallen, das bleiche Gesicht halb unter einer durchsichtigen Plastikmaske verborgen, wie sie ihn ansah. Er hatte an ihren Augen gesehen, dass sie versuchte zu lächeln, doch ihr Mund hatte nicht mehr die Kraft gehabt.
Er hatte geweint.
Erstaunlich, wie einen Gerüche plötzlich Szenen wieder erleben lassen, die Jahrzehnte zurückliegen, war sein dritter Gedanke. Er war damals erst zehn Jahre alt gewesen.
»Hier entlang bitte, Sir!« Der uniformierte Corporal, der ihn am Eingang des Militärgeländes in Empfang genommen hatte, führte ihn über einen neonbeleuchteten Gang bis zu einem Büro am Ende. Eine farbige Sekretärin blickte mit mürrischem Ausdruck von ihrem Computerbildschirm auf. Neben ihr führte eine Tür in das Büro des Laborleiters, Dr. Steve Crowe.
Crowe war Ende vierzig, ungefähr im selben Alter wie Eddie. Da hörten die Ähnlichkeiten allerdings schon auf: Während Crowe hochgewachsen und schlaksig war, hatte Eddie einen gedrungenen Körperbau, der ihn immer etwas korpulent wirken ließ, obwohl er regelmäßig in einem Fitnessstudio trainierte. Crowes volles, schon fast weißes Haar bildete einen Kontrast zu den dünnen Fransen, die von Eddies einst üppiger dunkelblonder Lockenpracht noch übrig waren.
Crowe war einer der wenigen Zivilisten, die auf dem Militärcampus arbeiteten. Seine grauen Augen wirkten müde, sein weißer Kittel war zerknittert, sein Händedruck schlaff, als er Eddie begrüßte. Sah er immer so aus, oder war der Eindruck das Ergebnis schlafloser Nächte in letzter Zeit?
»Bitte nehmen Sie Platz«, sagte Crowe. »Möchten Sie Kaffee?«
»Nein danke.« Eddie hätte nie im Leben in diesem Gebäude etwas zu sich genommen. Er war nicht unbedingt ein Hypochonder, aber er hasste Krankenhäuser und Arztpraxen. Und dieser Ort war in gewisser Hinsicht noch schlimmer. Hier heilten sie keine Krankheiten, hier brüteten sie welche aus. Zumindest vermutete er das, obwohl es natürlich offiziell verboten war, mit biologischen Kampfstoffen zu experimentieren.
Er setzte sich, wobei er sich instinktiv bemühte, seine Hände so wenig wie möglich mit den Möbeln in Berührung zu bringen, holte einen Collegeblock und einen Bleistift aus seiner Aktentasche und legte sie vor sich hin. Seiner Erfahrung nach konzentrierten sich Zeugen besser auf die Beantwortung von Fragen und schweiften weniger ab, wenn er sich während des Gesprächs Notizen machte.
»Dr. Crowe, was genau tun Sie in diesem Forschungsinstitut?«
»Dies ist kein Forschungsinstitut, Mr. Wheeler«, korrigierte Crowe. »Das National Biological Threat Defense Center ist dazu da, mögliche Gefahren, die aus infektiösen Substanzen resultieren können, zu erkennen, zu bewerten und Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Wir betreiben hier keine wissenschaftliche Forschung.«
»Und trotzdem haben Sie ein Hochsicherheitslabor.«
»Selbstverständlich. Wir müssen natürlich dazu in der Lage sein, potenziell hochletale biologische Substanzen zu analysieren.«
»Und dazu bewahren Sie solche Substanzen hier im Gebäude auf.«
»In unserem Hochsicherheitstrakt, ja.« Crowe blieb gelassen. Wenn es ihm unangenehm war, dass ihm jemand vom Office of Intelligence and Analysis – der Aufklärungsabteilung des Heimatschutzministeriums – auf den Zahn fühlte, überspielte er das geschickt.
»Wann genau haben Sie festgestellt, dass die fraglichen Substanzen verschwunden sind?«
Crowe sah ihn leicht verärgert an. »Wir haben nicht festgestellt, dass irgendwelche Substanzen verschwunden sind. Wir haben lediglich eine Inventurdifferenz bemerkt.«
»Und das heißt?«
»Das heißt, dass von einer Substanz weniger Bestand vorhanden ist, als laut unseren Bestandsdaten vorhanden sein müsste. Das kann zwei mögliche Ursachen haben: Entweder ist tatsächlich etwas von dieser Substanz verloren gegangen, oder die Daten stimmen nicht. Ich denke, Letzteres ist der Fall.«
»Was macht Sie so sicher?«
»Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wie wir hier arbeiten. Dann werden Sie sehen, dass bei uns nichts verschwinden kann.«
»Einverstanden.«
Eddie folgte Crowe zu einem Fahrstuhl, der ungewöhnlich lange brauchte, bis er die Ebene –1 erreichte. Sie mussten sich mindestens ein Dutzend Meter unter der Erde befinden. Sie gingen einen gefliesten Gang entlang bis zu einer Stahltür, die mit einem Zahlenschloss und einem Irisscanner gesichert war. Crowe drückte einen Knopf und blickte in die Kamera neben der Tür.
»Dr. Steve Crowe. Bitte um Zugang in Begleitung eines Gastes.«
Mit einem leichten Summen schwang die Tür auf. Dahinter lag ein Raum, der ein wenig wie das Kontrollzentrum einer Weltraummission wirkte. Dutzende von Monitoren an den Wänden zeigten Laborräume, in denen sich Menschen in einer Art gelben Raumanzügen bewegten. Ein großes Sichtfenster in der Mitte des Raums gab den Blick auf einen Teil des Labors frei, in dem mehrere gelb vermummte Gestalten mit Reagenzgläsern und Pipetten hantierten oder auf Computertastaturen tippten.
Zwei Soldaten erhoben sich und salutierten, als sie eintraten. »Guten Tag, Dr. Crowe«, sagte einer der beiden, der die Rangabzeichen eines Captains trug. Der andere, ein Corporal, hielt sich stumm abseits. Beide trugen schusssichere Westen und hatten Pistolenhalfter umgeschnallt.
»Das hier ist Mr. Eddie Wheeler, ein Mitarbeiter des OIA im DHS. Er ist hier, um unsere Sicherheitsvorrichtungen zu inspizieren.«
»Jawohl, Sir. Beabsichtigen Sie, zusammen mit Mr. Wheeler den BSL-4-Bereich zu betreten?«
Crowe warf einen kurzen Blick zu Eddie, dann nickte er, ohne eine Reaktion abzuwarten.
Eddie bemühte sich, nicht zusammenzuzucken. Es hätte ihm ausgereicht, hier vor Ort über die Sicherheitsabläufe informiert zu werden. Die Vorstellung, in den Raum auf der anderen Seite der Glasscheibe zu gehen, in eine Umgebung, die wahrscheinlich genauso lebensfeindlich war wie der Weltraum, gefiel ihm gar nicht. Aber er würde sich von Crowe nicht einschüchtern lassen.
»Wie Sie wünschen. Mr. Wheeler, darf ich bitte Ihren Dienstausweis sehen?«
Während der Captain den Ausweis entgegennahm und die persönlichen Daten überprüfte, betrachtete Eddie das Labor genauer. Das Glas der Sichtscheibe war mindestens zwei Zentimeter dick und garantiert schusssicher. Das Labor dahinter war mit Edelstahl ausgekleidet. Alle Ecken und Kanten waren abgerundet. Trotzdem bewegten sich die Gestalten in den gelben Schutzanzügen langsam, als hätten sie Angst, durch eine unbedachte Bewegung eine Katastrophe auszulösen.
Eddie spürte, wie Schweiß auf seine Stirn trat.
»Sir?«
Der Captain hatte ihm offenbar eine Frage gestellt. Er hielt ein Klemmbrett mit einer Checkliste in der Hand.
»Wie bitte?«
»Leiden Sie unter Klaustrophobie, Sir?«
»Nein.«
Der Captain hakte die erste Frage ab. »Haben Sie jemals Psychopharmaka verschrieben bekommen?«
Eddie beantwortete die Fragen und unterschrieb ein Formular, das das US-Militär von jeder Haftung freisprach, falls er bei dem Besuch in irgendeiner Weise zu Schaden kam.
»Soll ich Dr. Jarkov bitten, die Einweisung vorzunehmen?«, fragte der Captain.
»Nein, das wird nicht nötig sein«, sagte Crowe. »Ich werde Mr. Wheeler selbst unterweisen.«
»Selbstverständlich, Dr. Crowe.« Der Captain drückte einen Knopf und informierte die Mitarbeiter im Labor darüber, dass sie Besuch von ihrem Laborleiter und einem Zivilisten bekamen. Die Leute in den Schutzanzügen hoben die Köpfe und sahen sich an. Dann arbeiteten sie weiter.
Crowe gab dem Captain ein Zeichen, der daraufhin einen Knopf drückte und damit die Blockierung einer schweren Stahltür löste. Sie war mit einem gelben Dreieck gekennzeichnet, auf dem vier ineinander verschlungene schwarze Kreise zu sehen waren, drei davon an den äußeren Seiten durchbrochen – das internationale Symbol für biologische Gefahr.
Eddie schluckte, als er durch die Tür trat.
Dahinter lag ein Umkleideraum mit mehreren Spinden. Crowe wies ihm einen zu. »Legen Sie alle Kleidung und persönlichen Gegenstände ab und verstauen Sie sie da drin. Dann gehen Sie dort in die Kabine und duschen. Im Raum auf der anderen Seite liegt sterile Kleidung bereit. Ziehen Sie sie an und warten Sie dann auf mich.«
Eddie folgte den Anweisungen. Als er nackt durch die Tür auf der anderen Seite des Umkleideraums treten wollte, ertönte ein Warnsignal. »Ihre Kette, Sir«, erklang die Stimme des Captains durch einen Lautsprecher.
Eddie griff nach der Kette mit dem goldenen Kreuz, die er um den Hals trug. Er hatte sie seit Jahren nicht mehr abgelegt. Seine Großmutter hatte sie ihm geschenkt, kurz vor ihrem Tod. Mit einem mulmigen Gefühl nahm er die Kette ab und legte sie zu den anderen Sachen in seinem Spind. Er fühlte sich schutzlos, als er schließlich in die Duschkabine trat.
Er wusch sich gründlich mit der bereitgestellten antiseptischen Seife, trocknete sich mit einem sterilen Handtuch ab, das er anschließend in einen dafür vorgesehenen Schlitz warf, und trat auf der anderen Seite aus der Nasszelle in einen weiteren Umkleideraum. Wie Crowe gesagt hatte, lagen auf einer Bank zwei Stapel mit blauer Kleidung: Unterhose, dünnes, langärmliges Shirt und Leggings, dazu blaue Gummischuhe und Gummihandschuhe.
Als Eddie die Laborkleidung angelegt hatte, trat Crowe aus der Dusche. Mit geübten Bewegungen zog er die blaue Kleidung über. Dann wies er auf mehrere gelbe Anzüge, die an speziellen Haltevorrichtungen bereithingen. »Ziehen Sie einen davon über. Achten Sie darauf, dass nichts in die Verschlussnaht vorne gerät. Ziehen sie den Verschlussstreifen nach oben, bis er einrastet. Dann stecken Sie den blauen Schlauch dort auf das Ventil an der Seite. Es erfolgt eine automatische Dichteprüfung. Wenn alles okay ist, leuchtet neben Ihrem Visier eine grüne LED. Sollte jemals ein rotes Lämpchen aufleuchten, ist Ihr Anzug undicht. Dann müssen Sie sofort das Labor verlassen. Haben Sie das alles verstanden?«
Eddie nickte.
»Wenn wir beide in den Anzügen sind, entfernen Sie den blauen Schlauch und treten zusammen mit mir in die Schleuse. Auf der anderen Seite liegt das Labor. Sobald Sie hindurchgetreten sind, nehmen Sie einen der blauen Schläuche neben der Tür und stecken ihn auf das Ventil. Der Schlauch versorgt Sie mit Atemluft und erzeugt in Ihrem Anzug einen Überdruck, so dass selbst dann, wenn irgendwo eine winzige undichte Stelle sein sollte, keine Mikroorganismen eindringen können. Achten Sie darauf, wo Sie hingehen – man kann sich mit dem Schlauch leicht irgendwo verheddern. Wenn Sie ein Problem haben oder sich unwohl fühlen, sagen Sie es einfach oder drücken Sie auf den Notfallknopf an Ihrem rechten Arm. Alles klar?«
Eddie nickte noch einmal.
»Mr. Wheeler, wenn Sie in dem Schutzanzug nicken, sieht es niemand. Gewöhnen Sie sich bitte an, meine Fragen laut zu beantworten, so dass es jeder hört.«
»Ja, alles klar.«
»Gut. Dann los.«
Eddie legte den Schutzanzug an, wie ihn Crowe angewiesen hatte. Das war nicht so einfach wie gedacht, da der Helm fest mit dem Anzug verbunden war und man leicht in die Hocke gehen musste, um ihn überstreifen zu können.
Sobald er den Kopf in die Hülle gesteckt hatte, hörte er gedämpfte Stimmen. Er begriff, dass alle Labormitarbeiter und die Wachen in permanentem Sprechfunkkontakt miteinander standen. Er zog den Verschlussclip hoch, bis er einrastete. Er wartete darauf, dass die Leuchtdiode aufleuchtete, aber nichts geschah. Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn. Er fühlte sich wie in einem der Plastik-Leichensäcke, die sie damals beim FBI benutzt hatten.
»Mr. Wheeler, der Schlauch!«, hörte er Crowes Stimme.
Eddie griff sich einen der blauen Schläuche und steckte das Ende auf einen Zapfen, der aus dem Anzug herausragte. Ein Zischen ertönte, und er spürte einen leichten Druck auf seinen Ohren. Die grüne LED leuchtete auf.
»Sehr gut. Jetzt in die Schleuse bitte. Vorher den Schlauch entfernen. Keine Sorge, in Ihrem Anzug ist genug Atemluft für mindestens zehn Minuten.«
Eddie entfernte den Schlauch und trat durch eine weitere Stahltür. Er wartete, bis Crowe zu ihm trat und die Tür schloss. Feiner Nebel sprühte aus Düsen an den Seiten und nahm ihm die Sicht. Dann ertönte ein scharfes Zischen, und er spürte einen warmen Luftstrom von außen gegen den Anzug blasen. Sein Sichtfenster wurde wieder klar.
»Sobald die Lampe dort grün wird, treten Sie durch diese Tür«, wies Crowe ihn an. »Und vergessen Sie nicht, sich auf der anderen Seite wieder an das Sauerstoffsystem anzuschließen.«
Eddie kämpfte eine aufsteigende Panik nieder.
»Was ist los? Ist Ihnen nicht gut?«, fragte Crowe.
Eddie schluckte. »Nein, alles klar.« Er trat durch die Tür in die »Hexenküche«, wie das Labor innerhalb der Heimatschutzbehörde genannt wurde.
Insgesamt vier Wissenschaftler saßen an Tischen, hantierten mit irgendwelchen Glasgefäßen und starrten auf Computerbildschirme, auf denen Mikroskopaufnahmen oder statistische Diagramme zu sehen waren. Wie auf Kommando drehten sich alle vier gleichzeitig um. »Willkommen im BSL-4-Labor der NBTDC«, erklang eine weibliche Stimme in seinem Helm. »Ich bin Nancy Whitechapel. Das dort sind meine Kollegen Dr. Spencer, Dr. Jarkov und Dr. Hamilton.« Die Genannten hoben nacheinander die Hand, doch da man die Gesichter hinter den Sichtfenstern nur undeutlich erkennen konnte, versuchte Eddie erst gar nicht, sich die Namen zu merken.
»Der Schlauch, Mr. Wheeler«, ermahnte ihn Crowe, der nach ihm aus der Schleuse getreten war.
Eddie griff sich einen der blauen Schläuche und steckte ihn auf das Ventil. Sofort blähte sich sein Anzug auf. Trotz des beruhigenden Zischens fühlte sich Eddie immer noch unwohl in seiner Haut. Er wäre froh, wenn er diesen schrecklichen Ort möglichst schnell wieder verlassen könnte. Doch er hatte hier eine Aufgabe zu erfüllen. »Wo werden die Substanzen aufbewahrt, mit denen Sie hier experimentieren?«, fragte er.
Crowe führte ihn zu einer Klappe, die in die Edelstahlwand eingelassen war. Daneben befanden sich ein Tastenfeld und ein Monitor. »Die Proben werden in einem hermetisch verschlossenen, computergesteuerten Kühlsystem aufbewahrt«, erklärte der Laborleiter. »Man gibt hier den Code für die entsprechende Probe ein und autorisiert sich. Der Computer liefert dann die gewünschte Charge automatisch hier in die Klappe. Jeder Zugriff auf das System wird registriert und protokolliert.«
»Geben Sie bitte den Code für die fragliche Charge ein.«
»Wie Sie wünschen.« Crowe tippte ein paar Zahlen in die Tastatur. Ein Warnton erklang, und auf dem Bildschirm war eine rot unterlegte Meldung zu lesen: »Sicherheitsstufe 5 – Autorisierung erforderlich«. Crowe tippte einen weiteren Zahlencode ein. Die Meldung verschwand.
»Das dauert jetzt einen Moment«, sagte Crowe.
Nach etwa zwei Minuten ertönte ein weiteres Tonsignal. Neben der Klappe leuchtete ein blaues Licht auf.
»Ich muss jetzt noch einmal meinen Sicherheitscode eingeben«, erklärte Crowe, während er die Zahlen in die Tastatur tippte. »Erst dann habe ich Zugriff auf die Probe.«
Die Klappe schwang auf. Dahinter kam ein unscheinbares durchsichtiges Kästchen zum Vorschein. Auf einem Aufkleber waren Angaben zum Inhalt aufgedruckt. Eddie konnte erkennen, dass sich im Inneren sechs kleine Fläschchen befanden. Die Substanz darin schien gefroren zu sein.
»Das ist die Charge?«, fragte er.
»Ja. Wie Sie sehen, sind sechs Proben vorhanden. Nach den Aufzeichnungen im Computer sollten es acht sein. Das ist das ganze Problem.« Er schloss die Klappe wieder und tippte etwas auf der Tastatur.
»Wann wurde die Differenz bemerkt?«
»Vor fünf Tagen. Der Computer weist uns regelmäßig an, Routineüberprüfungen der Proben vorzunehmen. Dabei ist aufgefallen, dass die im Computer hinterlegte Anzahl der Proben nicht mit dem tatsächlichen Bestand übereinstimmt.«
»Wann ist diesen Aufzeichnungen gemäß zuletzt auf die Charge zugegriffen worden?«
»Vor etwa drei Jahren. Damals wurden die Proben eingelagert. Vermutlich wurde dabei die Anzahl falsch erfasst. Mehr ist es nicht. Trotzdem sind wir verpflichtet, jede Differenz zu melden. Wie Ihnen sicher nicht entgangen ist, nehmen wir es hier mit der Sicherheit sehr genau, Mr. Wheeler.«
»Ja, das sehe ich. Dennoch bin ich ebenfalls verpflichtet, der Sache nachzugehen. Können Sie ausschließen, dass ein Unbefugter in der Zwischenzeit Zugriff auf die Proben hatte?«
»Mr. Wheeler«, sagte Crowe sichtlich genervt, »Sie haben doch gerade selbst erlebt, welche Schritte man durchlaufen muss, um hier hereinzukommen. Es ist absolut ausgeschlossen, dass ein Unbefugter Zugriff auf eine der Substanzen erhält, die hier gelagert sind.«
»Könnte einer Ihrer Mitarbeiter die Proben entwendet haben?«
Vier Köpfe drehten sich zu ihm um. Eddie begriff, dass alle Anwesenden den Dialog mitverfolgten. »Ich meine, rein theoretisch natürlich«, schob er schnell nach.
»Wie ich schon sagte, jeder Zugriff wird aufgezeichnet. Man kann genau nachvollziehen, wann wer was aus dem Schrank entnommen oder eingelagert hat.«
»Und bei der Routineüberprüfung? Ist es denkbar, dass derjenige, der die Fläschchen gezählt hat, zwei davon entnommen hat und danach eine Differenz gemeldet hat?«
»Mr. Wheeler, was genau wollen Sie uns eigentlich unterstellen?«
»Ich unterstelle gar nichts. Ich prüfe nur alle Möglichkeiten systematisch ab. Das ist mein Job. Also, wäre es denkbar?«
»Theoretisch vielleicht, aber in diesem konkreten Fall nicht. Zum fraglichen Zeitpunkt waren mehrere Mitarbeiter im Labor anwesend. Außerdem gibt es keine Möglichkeit, Proben einfach so mit nach draußen zu nehmen. Wie Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist, haben die Schutzanzüge keine Taschen. Die Desinfektionskammer wird peinlich genau überwacht. Hier kommt keine einzige Bakterie unbemerkt raus.«
»Trotzdem würde ich gern mit demjenigen sprechen, der die Überprüfung vorgenommen und die Differenz bemerkt hat.«
»Das tun Sie bereits«, bemerkte Crowe. »Derjenige war ich.«
»Ich verstehe. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Dr. Crowe. Ich habe zum Abschluss nur noch eine Frage: Was genau ist das eigentlich für eine Substanz in der fraglichen Charge?«
Crowe zögerte einen Moment, bevor er antwortete. »Es handelt sich um isoliertes DNA-Material, mit dessen Hilfe man Keime identifizieren kann. Vergleichsmuster sozusagen.«
»Was für DNA-Material?«
»Eine synthetische Mutation.«
»Was genau heißt das?«
»Das heißt, dass die fragliche DNA so in der Natur nicht vorkommt.«
»Sie meinen, ein genmanipuliertes Virus?« Eddie wurde vage bewusst, dass die übrigen Labormitarbeiter mit ihrer Arbeit aufgehört hatten und gebannt dem Dialog lauschten.
»Wir reden hier von der DNA eines Virus, nicht von dem Virus selbst«, sagte Crowe. »Sie entstand im Rahmen eines Experiments.«
»Was für ein Experiment?«
»Wir haben damals überprüft, wie einfach es ist, bestimmte Viren-DNA miteinander zu kombinieren. Natürlich nicht, weil wir selbst biologische Kampfstoffe herstellen wollten. Wir wollten nur wissen, wie leicht Dritte dazu in der Lage wären. Das Ergebnis können Sie in einer Studie nachlesen, die ich damals verfasst habe. Sie liegt dem OIA vor.«
»Würden Sie mir bitte eine kurze Zusammenfassung geben?«
»Wir haben festgestellt, dass es prinzipiell – entsprechende technische Einrichtungen vorausgesetzt – möglich ist, gewisse Virenstämme miteinander zu kombinieren, um ein hoch pathogenes Virus herzustellen, das bestimmte für einen potenziellen Angreifer attraktive Charakteristika aufweist.«
»Im Klartext: Jemand, der über ein Labor wie Ihres verfügt, könnte aus den Bestandteilen, die Sie damals benutzt haben, ein extrem gefährliches Virus erzeugen?«
»So ungefähr.«
»Welche Bestandteile waren das?«
»Wir haben das Marburg-Virus mit einer häufigen Variante der Influenza Typ A gekreuzt.«
»Was ist das Marburg-Virus?«
»Ein Erreger, der hämorrhagisches Fieber auslöst. Er wurde 1967 bei einer Epidemie in der deutschen Stadt Marburg entdeckt, daher der Name. Er wurde von Versuchstieren eingeschleppt, Meerkatzen aus Afrika. Das Marburg-Virus gehört wie Ebola zur Familie der Filoviridae.«
Eddie lief ein Schauer über den Rücken. Er wusste nicht viel über Krankheiten, aber Ebola war ihm ein Begriff. Er erinnerte sich an Bilder eines Dorfs in Afrika, das voller Leichen gewesen war. Dazwischen waren zwei Ärzte der Weltgesundheitsorganisation in gelben Schutzanzügen herumgelaufen, ganz ähnlich dem, den er selbst gerade trug. »Soll das heißen, in den verschwundenen Proben war ein tödliches Virus?«
»Mr. Wheeler«, entgegnete Crowe mit mühsam unterdrücktem Ärger, »ich habe Ihnen bereits erklärt, dass hier nichts verschwinden kann. Die Charge ist beim Einlagern offensichtlich falsch erfasst worden. Und außerdem enthielt sie ohnehin nur die rekombinierte DNA. Sie allein ist völlig ungefährlich. Man bräuchte schon ein Hochsicherheitslabor wie dieses und eine Menge Knowhow, um die DNA in eine Virushülle einzuschleusen und daraus tatsächlich eine ansteckende Krankheit zu machen.«
»Aber es wäre möglich.«
»Prinzipiell schon, ja.«
»Nur mal angenommen, Dr. Crowe, jemand würde das tun und das Virus in einer Großstadt freisetzen. Was würde dann passieren?«
»Das habe ich bereits vor drei Jahren in meinem Bericht beschrieben. Sie sollten ihn wirklich lesen.«
»Das werde ich, Dr. Crowe. Bitte beantworten Sie trotzdem meine Frage.«
»Wenn das passieren würde, müssten wir mit vielen Millionen Toten rechnen. Wenn es nicht gelänge, die Ausbreitung rechtzeitig einzudämmen, könnte es zu einer globalen Pandemie kommen. Wir haben abgeschätzt, dass die Letalität des Virus zwischen 70 und 95 Prozent liegen würde.«
»Das heißt, ein Terrorist könnte mit einem solchen Virus unter Umständen fast die gesamte Menschheit ausrotten!«
»Theoretisch. Und sehen Sie, Mr. Wheeler, genau deshalb treiben wir den ganzen Aufwand hier – damit so etwas niemals passiert!«
1.Hamburg, Donnerstag 17:45 Uhr
Der kleine Hörsaal im sogenannten Philosophenturm, einem der Hauptgebäude der Hamburger Universität, war nur spärlich besetzt: drei oder vier Studenten aus dem Seminar zu mittelalterlicher Kryptologie und kaum ein Dutzend Besucher meist gehobenen Alters, die vermutlich wegen des reißerischen Vortragstitels »Das Rätsel des Voynich-Manuskripts« gekommen waren.
Paulus Brenner war von Anfang an nicht begeistert von der Idee gewesen, einen Vortrag vor Laien zu halten. Er stand nicht gern im Rampenlicht und diskutierte seine Erkenntnisse lieber im kleinen Kreis mit Fachleuten. Doch Professor Julius Degenhart, der neue Leiter des Instituts für mittelalterliche Geschichte, hatte ihm keine Wahl gelassen. Er hatte eine Vortragsreihe mit dem Titel »Geheimnisse des Mittelalters« organisiert, um die Öffentlichkeit stärker für die Arbeit seines Instituts zu interessieren. Tatsächlich war die Idee auf große Resonanz gestoßen. Paulus hatte gehört, dass das Audimax, in dem sein Kollege Marten Schmitt vorgestern einen Vortrag über »Störtebekers Schatz« gehalten hatte, brechend voll gewesen war.
Paulus drückte eine Taste, und die letzte PowerPoint-Folie erschien auf dem Beamer. Sie zeigte eine der schönsten Illustrationen aus dem Manuskript, das Gegenstand seines Vortrags war: eine doppelte Ausklappseite mit drei fein gezeichneten, radförmigen Grafiken, die anscheinend Sternkonstellationen darstellten, jedoch viel zu symmetrisch für reale Himmelsdarstellungen waren. Darüber stand der Text »Vielen Dank« in einer mittelalterlichen Schrifttype.
»Somit muss ich meinen Vortrag mit der Feststellung beenden, dass das Rätsel des Voynich-Manuskripts wohl niemals vollständig gelöst werden wird«, sagte Paulus. »Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.«
Zaghafter Applaus erklang und verebbte schnell wieder.
Paulus war froh, dass die Sache nun ausgestanden war. Er wollte gerade den Beamer ausschalten, als ihm einfiel, dass er etwas vergessen hatte. »Äh, haben Sie noch Fragen?«
Ein Mann mittleren Alters mit fettigem Haar und einem offenbar selbstgestrickten Pullover reckte seine Hand nach oben.
»Ja?«
»Was steht denn nun drin in dem Manuskript?«, fragte der Mann mit einer hellen, fast weiblichen Stimme.
Paulus seufzte. Hatte er sich denn so unklar ausgedrückt? »Wie ich versucht habe darzulegen, handelt es sich meiner Ansicht nach beim Voynich-Manuskript um ein Werk der Fantasie. Eine Art Lexikon einer fantastischen Welt, vergleichbar vielleicht mit einem Buch über die Figuren im ›Herrn der Ringe‹. Es wurde meines Erachtens in einer selbst ausgedachten Sprache verfasst, so ähnlich wie Tolkien in seinen Büchern oft die Kunstsprache Elbisch verwendete. Deshalb ist es nicht möglich, das Manuskript zu entschlüsseln – weil es gar nicht verschlüsselt wurde. Um den Inhalt zu verstehen, müssten wir die Kunstsprache des Autors kennen. Doch leider haben wir keine weiteren Dokumente, die in dieser Sprache verfasst sind, so dass wir nur spekulieren können, was der Text bedeuten soll. Ich vermute, dass es sich um die Beschreibung einer Welt handelt, die sich der Autor zum eigenen Vergnügen ausgedacht hat. Dafür sprechen zum Beispiel die vielen Abbildungen von nicht existierenden Pflanzen oder auch die rätselhaften Darstellungen von nackten Frauen in Badewannen. Vielleicht ist das so eine Art mittelalterliche Version von, äh, Pornografie.«
Eine junge Frau mit runder Brille meldete sich. Paulus hatte sie schon ein paar Mal auf dem Campus gesehen, aber sie ging nicht in sein Seminar. »Ich habe gelesen, dass eine der Zeichnungen verblüffende Ähnlichkeit mit einer Sonnenblume aufweist. Sonnenblumen waren jedoch im Mittelalter in Europa nicht bekannt. Wie erklären Sie sich das?«
»Diese Ähnlichkeit ist höchstwahrscheinlich Zufall«, erwiderte Paulus. »Das Manuskript enthält Dutzende solcher Zeichnungen. Wenn ich Sie bitten würde, dreißig oder vierzig verschiedene Fantasiepflanzen zu zeichnen, dann würde eine davon ziemlich sicher einer realen Pflanze ähneln, selbst wenn Sie diese noch nie zuvor gesehen haben.«
Der Typ mit dem selbstgestrickten Pullover reckte noch einmal seine Hand empor, wartete jedoch nicht, bis Paulus ihn aufforderte, seine Frage zu stellen. »Sie haben selbst gesagt, dass die im Manuskript skizzierten Pflanzen auf der Erde nicht existieren. Könnte es nicht sein, dass es sich um außerirdische Pflanzen handelt?«
Paulus unterdrückte ein Stöhnen. »Wie ich schon sagte, handelt es sich um ein Werk der Fantasie. Nicht alles, was in der Kunst dargestellt wird, ist real. Denken Sie etwa an die surrealistischen Gemälde eines Hieronymus Bosch.«
Die nächste Frage kam von einer älteren Dame in einer pinkfarbenen Strickjacke: »Könnte es nicht sein, dass die Freimaurer das Dokument verfasst und darin das geheime Wissen der Alten verschlüsselt haben?«
»Sie sollten nicht zu viele Verschwörungsthriller lesen«, sagte Paulus mit einem Lächeln. »Auch wenn die Freimaurer eine gewisse Geheimniskrämerei betreiben, bedeutet das noch lange nicht, dass alles, was rätselhaft ist, von Freimaurern stammt. Im Übrigen wurde die erste Freimaurerloge 1717 gegründet, ungefähr dreihundert Jahre, nachdem das Voynich-Manuskript geschrieben wurde.«
Diesmal meldete sich einer der Studenten, die Paulus’ Seminar für mittelalterliche Kryptologie belegt hatten. »Herr Brenner, Sie sagen, dass das Manuskript ein Werk der Fantasie ist. Aber es enthält, soviel ich weiß, über hundert aufwändig gestaltete Seiten. Pergament war im Mittelalter sehr teuer, und es muss Jahre gedauert haben, eine eigene Sprache und Schrift zu entwickeln. Glauben Sie wirklich, jemand hat all diesen Aufwand nur zum Spaß getrieben? Ist es nicht so, dass im Mittelalter Bücher, insbesondere illuminierte Codices, praktisch immer nur als Auftragsarbeiten angefertigt wurden?«
Endlich mal eine vernünftige Frage. »Das ist ein guter Einwand. Wie ich schon andeutete, kann ich das nicht abschließend beantworten. Aber ich vermute, dass der Schöpfer des Manuskripts eine große Leidenschaft dafür hegte. Man kann es vielleicht schon Besessenheit nennen. Ich stelle mir einen reichen Kaufmann oder Adligen aus Venedig, Florenz oder Pisa vor. Vielleicht litt er unter Schizophrenie und hatte Visionen der Dinge, die er aufgezeichnet hat. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass er es einfach zum Spaß getan hat – so wie heute viele Menschen in ihrer Freizeit malen, Bücher schreiben oder Modelleisenbahnen basteln. Es gab damals zwar nicht viele Leute, die sich solche Freizeitbeschäftigungen leisten konnten, aber es gibt ja auch nichts dem Voynich-Manuskript Vergleichbares.« Paulus sah auf die Uhr. Die Vortragszeit war fast abgelaufen. »Wir haben noch Zeit für eine weitere Frage.«
Mehrere Hände schossen nach oben, darunter auch der Spinner mit dem selbstgestrickten Pullover. Paulus wies auf einen Mann mit Glatze in der vorderen Reihe, der bisher stumm geblieben war. »Ja?«
Der Mann räusperte sich. »Mein Name ist Eckard Grün vom Hamburger Morgenblatt«, sagte er. »Sie haben uns einen Vortrag darüber gehalten, dass Sie praktisch nichts über dieses Wotan-Manuskript herausgefunden haben, außer dass es pornografische Zeichnungen enthält.« Ein paar Zuhörer kicherten. »Unsere Leser würde interessieren, wie viele Steuergelder an Ihrem Institut für solche sogenannte Forschung ausgegeben werden.«
Paulus wurde blass. Er verfluchte sich selbst dafür, dass er die nackten Frauen überhaupt erwähnt hatte. »Das … das ist natürlich nur ein Nebenzweig unserer Arbeit. Das Hauptarbeitsgebiet des Instituts liegt in der Erforschung alter Dokumente, die die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen der europäischen Städte im Mittelalter wiedergeben. Da einige dieser Dokumente verschlüsselt sind, beschäftigen wir uns quasi gezwungenermaßen mit mittelalterlicher Kryptologie und dabei eben auch mit dem Voynich-Manuskript.«
Der Journalist schrieb etwas in ein spiralgebundenes Notizbuch. »Haben Sie nicht gerade gesagt, dass das Voynich-Manuskript gar nicht verschlüsselt ist?«
»Das ist meine Theorie, ja.«
»Aha«, sagte der Mann nur und machte sich eine weitere Notiz.
Die Zuhörer standen auf und verließen den Raum, während Paulus niedergeschlagen seinen Laptop herunterfuhr. Der neue Institutsleiter war geradezu fanatisch, was sein Image in der Öffentlichkeit betraf. Er schien sich mehr für Marketing zu interessieren als für Geschichte. Wenn ein kritischer Bericht über Paulus’ Vortrag in der Presse erschien, konnte er die Verlängerung seines Vertrags als Dozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter vergessen.
»Entschuldigen Sie bitte.«
Paulus drehte sich um. Ein Mann mit wallendem schlohweißen Haar und tief herabgezogenen Koteletten stand vor ihm, mindestens siebzig Jahre alt. Er trug ein abgewetztes hellbraunes Jackett und eine graue Hose.
»Haben Sie noch eine Frage? Ich muss nämlich in den nächsten Termin«, log Paulus, der keine Lust mehr hatte, über irgendwelche albernen Verschwörungstheorien zu diskutieren.
Der Mann reichte Paulus die Hand. »Mein Name ist Aaron Lieberman«, sagte er mit starkem amerikanischen Akzent. »Ich würde gern Sie einladen zu Essen, morgen Abend in Hotel Atlantic.«
Paulus sah den Mann verwirrt an. Er sah nicht danach aus, als verkehre er regelmäßig in Luxushotels. »Ich verstehe nicht …«
»Ihre Großmutter ist Klara Brenner, right?«
Paulus’ Verwirrung nahm zu. »Meine Großmutter ist schon lange tot. Sie starb im Zweiten Weltkrieg.«
Lieberman nickte. »Ja, ich weiß. Sie hat geholfen meine Vater. Er ist gestorben letzte Monat, und ich habe etwas gefunden in seine Sachen. Etwas, das hat gehört Ihrer Grandma. Wenn Sie möchten, ich zeige es Ihnen, morgen Abend. Kommen Sie bitte in Hotel Atlantic um halb nach sieben. Ist das okay?«
»Ja, das ist okay«, sagte Paulus, der immer noch verblüfft war.
»Dann wir sehen uns«, sagte Lieberman und verließ den Hörsaal.
Paulus packte seinen Laptop ein und ging zu Fuß vom Campus der Universität bis zu seiner kleinen Wohnung am Grindelberg, direkt gegenüber den monumental hässlichen Grindelhochhäusern. Während es rund um den Campus noch alte Villen und historische Gebäude gab, war weiter nordöstlich kaum ein Gebäude älter als sechzig Jahre. Hier hatten die Bombenangriffe im Rahmen der Operation Gomorrha im Sommer 1943 nur noch ein Trümmerfeld hinterlassen.
Auf dem Weg dachte er darüber nach, was er über seine Großmutter väterlicherseits wusste. Viel war es nicht. Sie war unter ungeklärten Umständen während des Krieges in einem Arbeitslager gestorben. Sie hatte im Standesamt Hamburg-Wandsbek gearbeitet, bevor sie 1941 als Verräterin verhaftet worden war. Kurz darauf hatte sich ihr Mann, Paulus’ Großvater, das Leben genommen.
Paulus’ Vater war damals zehn Jahre alt gewesen und von den Nazis in ein Erziehungsheim gesperrt worden. Er hatte sich jedoch nach eigener Aussage allen Indoktrinierungsversuchen der Lehrer widersetzt. Nach dem Krieg war aus dem Heim ein Internat unter englischer Leitung geworden, wo er Abitur gemacht hatte. 1956 war er in die frisch gegründete Bundeswehr eingetreten und hatte es bis zum Oberst gebracht. Paulus’ Mutter, die fünfzehn Jahre jünger war, hatte er erst im Alter von fast fünfzig geheiratet.
Paulus’ Vater hatte nicht oft über seine Eltern gesprochen, aber wenn, dann voller Ehrfurcht. Für ihn waren sie Helden gewesen, die sich dem Terror des Dritten Reichs widersetzt hatten, auch wenn er nicht genau wusste, was sie getan hatten, um den Zorn der Gestapo auf sich zu ziehen. Er hatte nach Kriegsende versucht, mehr über die Hintergründe zu erfahren, doch die entsprechenden Akten waren von den Nazis vernichtet worden.
Paulus war gespannt darauf, was der Amerikaner über dieses dunkle Kapitel seiner Familiengeschichte wusste. Leider war sein Vater vor einigen Jahren an Lungenkrebs gestorben, so dass er es nicht mehr erfahren würde.
Als er den Flur des schmucklosen Mehrfamilienhauses betrat, traf er dort die alte Frau Zacharias aus dem dritten Stock. Sie trug ein helles Kostüm und einen Hut, hatte sich grell geschminkt und hielt einen kleinen Koffer in der Hand.
»Frau Zacharias! Was … was machen Sie denn hier?«
»Mein Verlobter, der Franz, kommt gleich und holt mich ab«, sagte sie mit strahlendem Lächeln. »Wir fahren ans Meer!«
Paulus seufzte. »Frau Zacharias, Ihr Mann Franz ist seit vielen Jahren tot«, sagte er sanft.
Die alte Dame blinzelte. »Ach ja, stimmt«, sagte sie. »Das hatte ich ganz vergessen.« Sie sah sich in dem engen Hausflur um, als wisse sie nicht genau, wie sie hierhergekommen war.
Er fasste sie am Arm. »Kommen Sie, ich bringe Sie in Ihre Wohnung. Ihre Tochter kommt sicher bald nach Hause.« Er führte sie die Treppe hinauf und half ihr, die Wohnungstür aufzuschließen.
Ein Luftzug wehte ihm entgegen – die Balkontür stand sperrangelweit auf. Er schloss sie rasch. Es erschien ihm unverantwortlich, die verwirrte alte Dame so lange allein zu lassen. Was, wenn sie auf die Idee kam, sich etwas zu essen zu machen, und dann vergaß, den Herd auszuschalten? Wahrscheinlich gehörte sie längst in ein Pflegeheim. Andererseits würde ihr Alzheimer ohne die vertraute Umgebung wahrscheinlich noch rascher voranschreiten.
Paulus schauderte. Was für eine schreckliche Vorstellung, dass sich ein ganzes Leben voller Erinnerungen allmählich in Vergessen auflöste!
Frau Zacharias hatte inzwischen ihren Koffer abgestellt und ein altes Fotoalbum aus dem Wohnzimmerschrank geholt. Sie winkte Paulus zu sich. »Sehen Sie mal, junger Mann, das ist er, mein Franz. Ist er nicht ein schmucker Bursche?«
Paulus nickte. Er setzte sich zu ihr, während sie ihm erzählte, wie sie ihren Franz auf einem Schützenfest im Sauerland kennengelernt hatte.
Zwei Stunden später saß er immer noch dort. Er hatte es nicht fertiggebracht, die alte Dame in ihren Erinnerungen zu unterbrechen. Während sie jetzt von ihren beiden Töchtern erzählte, das Fotoalbum auf ihren dünnen Knien, wirkte sie vollkommen klar.
Paulus blickte verstohlen auf die Uhr. Halb neun. Seit einer halben Stunde hätte er beim Treffen der Aktionsgemeinschaft »Historiker für den Frieden« sein sollen.
Er war wie viele seiner Fachkollegen überzeugt, dass sich vor allem Politiker mehr mit Geschichte befassen sollten. Dann würden sie sehr schnell begreifen, dass ihre Machtspielchen gefährlich waren und nur allzu leicht in die Katastrophe führen konnten. Wie viele Kriege waren schon ausgebrochen, weil jede Seite ihre eigene Stärke überschätzt und die Entschlossenheit des Gegners unterschätzt hatte! Wie sinnlos waren diese Gemetzel gewesen, hatte doch kaum je ein Krieg einer der beiden Seiten unter dem Strich tatsächlich einen Vorteil gebracht.
Die Aktionsgemeinschaft hatte es sich zum Ziel gesetzt, Aufklärungsarbeit zu betreiben. Statt historisches Wissen in Museen und Gedenkstätten verstauben zu lassen, wollte sie es in spektakulären Aktionen zu den Menschen bringen – und in die Medien. Auf dem letzten Treffen war die Idee entstanden, vor dem Hamburger Rathaus einen Pranger aufzustellen, in dem eines der Gruppenmitglieder symbolisch für die Sünden der Politik bestraft werden sollte. Man war sich nur nicht einig geworden, wer den Sünder spielen sollte.
Bisher war die Aktionsgemeinschaft nicht über Stammtischdiskussionen hinausgekommen, und Paulus vermutete, dass das auch auf absehbare Zeit so bleiben würde. Die meisten Gruppenmitglieder zeigten, wenn es darauf ankam, nicht allzu viel Mumm und hatten stets eine Ausrede parat, warum sie an der nächsten geplanten Aktion leider nicht teilnehmen konnten.
Dass Paulus trotzdem immer noch zu den Treffen ging, lag in erster Linie an Judith. Sie arbeitete am Archäologischen Institut der Universität und beschäftigte sich mit Frühgeschichte, von der Steinzeit bis zu den Feldzügen der Römer. Im Unterschied zu Paulus verbrachte sie ihre Zeit nicht über alten Dokumenten, sondern wühlte im Sand verschiedener Ausgrabungsstätten, was ihr einen braunen Teint einbrachte, der ihre blauen Augen umso heller strahlen ließ. Sie war hübsch, intelligent und hatte Humor, doch leider hatte sie bisher nicht auf Paulus’ dezente Annäherungsversuche reagiert. Aber vielleicht waren die ja auch ein wenig zu dezent gewesen.
Wie auch immer, das Treffen musste warten. Er konnte Frau Zacharias nicht allein lassen und riskieren, dass sie wieder in ihren geistigen Dämmerzustand fiel.
Um Viertel vor zehn öffnete sich die Tür. Frau Zacharias’ Tochter, selbst schon an die fünfzig Jahre alt mit einer rundlichen Figur und kurzen braunen Haaren, kam ins Wohnzimmer. »Oh«, sagte sie, als sie Paulus erblickte. »Entschuldigen Sie, ich …« Sie stockte.
»Ich habe dem freundlichen jungen Mann von Franz erzählt und von dir, als du noch klein warst«, erklärte ihre Mutter.
Paulus erhob sich. Als er an der Tochter vorbeiging, roch er Alkohol. Zorn wallte in ihm auf. Doch dann wurde ihm bewusst, was für ein Leben eine Tochter führen musste, die sich tagaus, tagein um ihre Mutter kümmerte.
»Keine Ursache«, sagte er mit einem Lächeln. »Es hat mir Spaß gemacht, mit Ihrer Mutter zu plaudern. Wenn Sie wieder einmal jemanden brauchen, der für ein, zwei Stunden bei ihr bleibt, sagen Sie mir bitte Bescheid!«
Die Tochter lächelte zurück. »Vielen Dank!«
In dem kleinen Flur seiner Wohnung fiel sein Blick auf den Garderobenspiegel. Seine bereits graumelierten Schläfen unter dem dichten Schopf kurzen schwarzen Haars ließen ihn deutlich älter wirken als seine 29 Jahre und verliehen ihm eine Aura der Seriosität und Erfahrung. Andere sahen in ihm eher einen Professor als einen Assistenten des Instituts. Doch spätestens mit 35 würde sein Haar vollständig ergraut sein, und er würde mindestens zehn Jahre zu alt wirken.
Er betrat das Schlafzimmer. Zwei gerahmte Bilder hingen über dem breiten, mit grauem Baumwollstoff abgedeckten Bett: Seiten aus dem Voynich-Manuskript, die Paulus aus dem Internet heruntergeladen, vergrößert und ausgedruckt hatte.
Eine zeigte eine besonders bizarre Darstellung aus der sogenannten balneologischen Sektion: insgesamt fünfzehn Frauen, die in zwei durch ein dünnes Rinnsal miteinander verbundenen grünlichen Teichen badeten. Aus dem oberen der beiden Teiche wuchs ein seltsames Röhrensystem heraus, das halb künstlich, halb pflanzlich wirkte. Die eher amateurhaft wirkenden Zeichnungen waren von der seltsamen, auf den ersten Blick so natürlich wirkenden Handschrift umrahmt, an der sich schon Generationen von Kryptologen, darunter ein ehemaliger Chef der National Security Agency der USA, die Zähne ausgebissen hatten.
Die zweite Zeichnung stellte eine besonders exotisch wirkende Pflanze mit einer großen, einem Auge ähnelnden Blüte und Blättern mit fingerartigen Auswüchsen an den Rändern dar. Es war dieses Blatt, das Paulus davon überzeugt hatte, dass es sich bei dem Voynich-Manuskript um ein Werk der Fantasie handeln musste, denn ganz offensichtlich gab es auf der Erde kein Gewächs, das dem dargestellten auch nur entfernt ähnelte.
Er wandte seinen Blick von den Drucken ab, die ihn allzu schmerzhaft an den bissigen Kommentar des Journalisten erinnerten. In einer Schublade des Wohnzimmerschranks kramte er herum, bis er einen Umschlag mit alten Fotos fand, die ihm sein Vater hinterlassen hatte. Eines zeigte einen bärtigen Mann im dunklen Anzug Arm in Arm mit einer jungen, recht hübschen Frau in einem hellen Kostüm. Sie standen vor einem Laden, über dem ein Werbeschild mit der Aufschrift »Kohlen von Brenner brennen länger« hing. In dem Umschlag fand er außerdem ein ovales Klappmedaillon aus Silber. Im Inneren waren der junge Mann und die Frau in Porträts abgebildet. Dies waren die einzigen Fotos, die er von seinen Großeltern besaß. Sein Vater musste sie vor den Nazi-Erziehern versteckt haben.
Er legte die Erinnerungsstücke zurück in die Schublade und ging zu Bett.
2.Hamburg, Freitag 19:27 Uhr
Paulus stieg die Marmorstufen zum Eingangsbereich des Hotels Atlantic empor. Der Portier, der ihm die Tür öffnete, wirkte mit seinem schwarzen Zylinder und der roten Goldknopflivree wie ein Relikt vom Beginn des letzten Jahrhunderts.
Paulus trug saubere Jeans, einen schwarzen Rollkragenpullover und das dunkelgraue Jackett, das er gestern während seines Vortrags angehabt hatte – das teuerste und edelste Kleidungsstück in seiner überschaubaren Garderobe. Trotzdem kam er sich unpassend gekleidet vor.
Er durchquerte die opulente Empfangshalle und betrat das Restaurant. Mit seinen holzvertäfelten Fensternischen und den aufwändig ornamentierten Glastrennscheiben zwischen den Tischen strahlte es eine steife Würde aus.
Etwa die Hälfte der Tische war besetzt, überwiegend mit Geschäftsleuten in dunklen Anzügen, die gedämpft in verschiedenen Sprachen miteinander redeten. Irgendwie schien sich in diesem Raum kaum etwas geändert zu haben, seit hier Männer mit schwarzen Westenanzügen, steifen Kragen, Monokeln und goldenen Taschenuhren über die Kautschukpreise und die Schwierigkeiten in den deutschen Afrikakolonien debattiert hatten.
Er entdeckte Lieberman an einem Tisch am Fenster. Der Amerikaner trug dasselbe abgewetzte Jackett wie gestern. Nun war Paulus beinahe froh, dass er keine elegantere Garderobe besaß.
Lieberman winkte Paulus zu sich und bedeutete ihm, Platz zu nehmen. Sie gaben sich über den Tisch die Hand. Der Amerikaner bedachte ihn mit einem breiten Lächeln. »Schön, dass Sie kommen konnten, Mr. Brenner.« Er reichte ihm die Speisekarte. »Wollen wir etwas zu essen bestellen zuerst? Die Küche hier ist gut, aber etwas langsam manchmal.«
Paulus nahm zögernd die Speisekarte in Empfang. Er war sich nicht sicher, ob die Verabredung eine Einladung durch Lieberman beinhaltete oder ob nicht eher er es war, der den alten Amerikaner einladen musste. Aber die Aussicht, mehr über das Schicksal seiner Großmutter zu erfahren, erschien ihm eine Investition wert. Trotzdem musste er schlucken, als er die Preise sah.
Lieberman bestellte ein Steak – well done – und einen Salat, dazu einen trockenen Sherry und einen offenen Rotwein, das Glas zu einem Preis, für den man bei Paulus’ Lieblingsitaliener eine ganze Flasche bekommen hätte. Paulus wählte Lachsravioli und begnügte sich mit Mineralwasser.
»Sie sagten, Sie hätten etwas, das meiner Großmutter gehörte«, begann Paulus das Gespräch. »Ich muss gestehen, ich weiß fast nichts über sie.«
Lieberman zeigte sein breites amerikanisches Lächeln. »Ihre Großmutter war eine, wie sagt man, extraordinary – eine nicht gewöhnliche Frau. Das ich vermute jedenfalls, von was meine Vater hat erzählt.« Er nahm einen Schluck von seinem Sherry. »Mein Vater, Sie müssen wissen, war Jude, wie ich. Er hat gelebt in Nazideutschland und ist emigriert vor dem Krieg, in 1939. Er hatte ein kleines Modegeschäft hier in Hamburg, an Große Bleichen. Was ich weiß, er wollte nicht gehen, ist lange geblieben unentdeckt von die Nazis, weil er hatte falsche Papiere. Sie wissen, was ein Ahnenpass war in diese Zeit?«
Paulus nickte. Jeder, der ein öffentliches Amt bekleiden wollte, hatte nach den Nürnberger Rassegesetzen eine lückenlose arische Herkunft vorweisen müssen. Dazu hatte der Ahnenpass gedient, der entweder bei Vorlage der entsprechenden Geburts- und Todesurkunden der Eltern und Großeltern ausgestellt wurde oder von einem örtlichen Standesamt beglaubigt werden konnte.
»Mein Vater hatte eine solche Pass. Ihre Mutter hat ihn gemacht, ein Fake, eine Fälschung, für ihn, und für eine Menge andere Juden, ich glaube. Er hat gedacht, er kann bleiben unbehelligt, so tun, als sei er ein, wie nennt man das, Aryan. Aber dann er ist doch ausgereist, als Gefahr wurde zu groß, entdeckt zu werden. Über die Schweiz er ist gekommen nach USA.«
»Haben Sie diesen Ahnenpass noch?«, fragte Paulus. Die Vorstellung, darin die Handschrift, vielleicht sogar die Unterschrift seiner Großmutter zu finden, elektrisierte ihn. Er konnte ihr vielleicht nach all den Jahren endlich die Anerkennung zuteilwerden lassen, von der sein Vater immer gewusst hatte, dass sie ihr gebührte.
Lieberman schüttelte den Kopf. »Nein, sorry. Mein Vater hat ihn vernichtet vor Einreise in US. Wäre nicht gut gewesen, Pass zu haben, worin steht, er ist ein Aryan.« Er lachte trocken. »Außerdem, andere Juden waren nicht gut zu sprechen auf solche, die haben getan, als wenn sie wären Nichtjuden. Daher mein Vater hat kaum je darüber gesprochen. Deshalb niemand hat jemals sich bedankt bei Ihre Großmutters Familie. Sie alle, denen sie geholfen hat, haben sich – wie sagt man – geschämt. Mein Vater hat mir das erst erzählt kurz vor seine Tod.«
»Meine Großmutter wurde 1941 von der Gestapo verhaftet und in ein Arbeitslager gebracht. Dort ist sie dann ein Jahr später gestorben. Wissen Sie etwas über die Umstände Ihres Todes?«
Lieberman schüttelte den Kopf. »Nein. Ich nur kann vermuten, dass sie ist geworden entdeckt, verhaftet, und dann schlecht behandelt in Lager. Vielleicht sie ist geworden krank. War eine schlimme Zeit.«
»Mein Großvater hat sich kurz nach ihrer Verhaftung das Leben genommen. Er war Kohlenhändler, Mitglied der NSDAP, soweit ich weiß. Er muss sie all die Jahre gedeckt haben. Wahrscheinlich ist er nur seiner eigenen Internierung oder Hinrichtung zuvorgekommen. Mein Vater hat nie erfahren, was sie getan hat. Leider ist er vor ein paar Jahren gestorben.«
»I’m sorry.«
»Sie sprachen von etwas, das Sie mir zeigen wollten«, sagte Paulus, der seine Neugierde kaum zügeln konnte.
Lieberman nickte. Er griff in eine Ledertasche, die er auf die Bank neben sich gestellt hatte, holte ein Kästchen und ein vergilbtes, gefaltetes Blatt Papier hervor und legte beides auf den Tisch. »Hier, bitte.«
Paulus nahm den Zettel und öffnete ihn vorsichtig. Es war ein Brief, geschrieben mit Tinte in einer sorgfältigen Handschrift.
Lieber J.,
die Zeit ist gekommen, vor der ich immer Angst gehabt habe. Wir müssen nun Abschied nehmen, vielleicht für immer.
Ich weiß nicht, welches Schicksal mir hier bevorsteht, aber ich beneide Dich darum, daß Du New York sehen wirst. Ich wünschte, wir könnten Euch begleiten. Doch man würde uns nicht gehen lassen, und allein den Wunsch zu äußern könnte uns und die Kinder in Gefahr bringen. Krieg liegt in der Luft, und überall herrschen jetzt Angst und Mißtrauen. Ich weiß nicht, wie lange meine Taten noch unentdeckt bleiben.
Eine Bitte habe ich noch. Das Buch, das sich in dem Kästchen befindet, hat meinem Vater gehört. Ich weiß nicht, was darin steht, ich habe von solchen Dingen nie etwas verstanden. Als er es mir gab, kurz vor seinem Tod, sagte er, es sei schon lange im Besitz unserer Familie, und daß es ein großes Geheimnis enthält, das nicht in falsche Hände gelangen darf. Er sagte, eines Tages würde jemand den Inhalt verstehen, und so lange müsse ich gut darauf aufpassen.
Ich weiß nicht, für wen dieses Buch bestimmt ist, er wußte es wohl selbst auch nicht. Aber ich weiß, daß es nicht in die Hände der Kriegstreiber und Schlächter fallen darf. Deshalb bitte ich Dich: Nimm das Buch an Dich, bringe es an einen sicheren Ort, verberge es gut. Eines Tages wird vielleicht jemand wissen, was damit zu tun ist. Bis dahin musst Du es sicher aufbewahren. Ich weiß, daß ich mich auf Dich verlassen kann.
Ich wünsche Dir und Gerda viel Glück auf Eurem Weg. Möge der Gott der Juden und der Christen über Euch wachen und Euch beschützen. Auch wenn wir uns vielleicht nie wiedersehen, werdet Ihr immer einen Platz in meinem Herzen haben.
In immerwährender Freundschaft
K.
Paulus starrte den Brief lange an, während Lieberman geduldig wartete. Schließlich schluckte er und fragte: »Woher … woher wissen Sie, dass es meine Großmutter war, die diesen Brief geschrieben hat?«
»Ich bin nicht sicher es zu wissen. Aber als mein Dad mir von seine Flucht aus Nazideutschland erzählte, er hat erwähnt ihren Namen – Klara Brenner. Er hat gesagt, sie war eine gute Freundin. Sein Name war Jakob, J., und sie war Klara, K., also ich habe gedacht das muss sein von ihr, auch weil sie schreibt von ihre Taten, die bald können entdeckt werden. Aber mein Vater hat den Brief nicht erwähnt. Er vielleicht hat vergessen – er war mehr als neunzig Jahre alt, als er ist gestorben. Ich habe es erst gefunden vor zwei Wochen, als ich aufgeräumt habe seine Sachen, auf Dachboden. Und das hier.« Er zeigte auf das Kästchen.
Paulus nahm es in die Hand und betrachtete es genauer. Es handelte sich um eine einfache, schmucklose Schatulle. Das dunkle Holz wirkte abgegriffen und war an einigen Stellen angeschlagen.
Er öffnete den Messingverschluss und klappte den Deckel auf. Das Kästchen war innen mit dunkelblauem Samt ausgeschlagen, der fadenscheinig und brüchig wirkte. Darauf lag ein in Leder gebundenes Buch. Der Einband wies keine Aufschrift auf.
Vorsichtig nahm er das Buch aus dem Kasten, öffnete es und betrachtete die erste Seite. Sie war leer, bestand aber eindeutig aus Pergament.
Allem Anschein nach war dies eine mittelalterliche Handschrift. Er traute sich kaum, die Seiten zu berühren. Vorsichtig blätterte er um und blickte ungläubig auf ein Pergamentblatt, das mit sorgfältig gezeichneten Glyphen bedeckt war. Sie bestanden aus halbmondförmigen Bögen, Linien und Punkten und ähnelten nichts, was Paulus jemals gesehen hatte.
Er blickte erstaunt auf.
Lieberman sah ihn erwartungsvoll an. »Haben Sie ein Idee, was das soll bedeuten? Ich kann nicht sagen, dass ich es verstehe.«
Paulus fuhr mit dem Finger über die unregelmäßigen Schnittkanten der Pergamentblätter. »Es sieht auf den ersten Blick aus wie eine mittelalterliche Handschrift. Aber solche Glyphen habe ich noch nie gesehen.«
»In dem Brief steht etwas von eine Geheimnis. Und davon, dass eines Tages jemand kommt, der versteht, was das Buch sagt. Als ich hatte gefunden das Buch und den Brief, ich habe erst gedacht es zu geben an eine University, zu entschlüsseln. Aber dann ich habe gedacht, das Buch gehörte diese mutige Frau, die geholfen hat meine Vater, und eigentlich das dann gehört ihre Kinder oder Enkelkinder. So ich habe recherchiert eine Weile, und ich dann herausgefunden habe Ihre Name und dass Sie sich kennen aus mit medieval cryptology. Und da habe ich gewusst, dass ich muss kommen her, um Ihnen zu geben das Buch.«
»Sie sind extra nach Deutschland gekommen, um mir das zu zeigen?«, fragte Paulus ungläubig.
Lieberman lächelte. »Nicht nur wegen Sie. Ich wollte immer schon sehen alte Heimat von meine Vater. Er hat gewohnt in Haus in Barmbek, doch das wurde gebombt in Krieg. Ich bin hier auf eine Art Suche von Spuren. Aber ich glaube auch, das Buch gehört in Ihre Hände. Sie verstehen, es ist eine geheime Code, und Sie sind Experte für Geheimschrift und Grandson von der Frau, die es meinem Vater gegeben hat, und Great-Grandson von dem Mann, der es ihr gegeben hat. Das kann nicht sein Zufall.«
Nun war es an Paulus zu lächeln. Dass seine Großmutter mit demjenigen, für den das Buch bestimmt war, ihn gemeint haben könnte, war eine hübsche, romantische Vorstellung – mehr aber auch nicht. Trotzdem gab es kaum etwas, das ihn mehr hätte reizen können als die Aufgabe, ein solches mittelalterliches Dokument zu entziffern, noch dazu eines, das sich lange im Besitz seiner Familie befunden hatte.
»Wäre es möglich, dass ich die Seiten kopiere, damit ich versuchen kann, sie zu entschlüsseln?«, fragte er.
»Kopieren? Sie wollen es kopieren?« Lieberman wirkte brüskiert. Seine buschigen weißen Augenbrauen waren tief herabgezogen, was seinem Gesicht einen finsteren Ausdruck verlieh. »Wissen Sie, was meine Vater hat riskiert, das Buch zu schmuggeln aus Nazideutschland? Er hat es all die Jahre beschützt, und ich komme hier her, um es Ihnen zu geben, und Sie wollen es kopieren? Haben Sie nicht gelesen, was dort steht in die Brief, dass es ist ein Geheimnis, das nicht kommen darf in falsche Hand? Sie dürfen dieses Buch nicht kopieren! Niemand darf es sehen!«
»Entschuldigung, aber … ich dachte, ich könnte vielleicht versuchen …«
Liebermans Gesicht hellte sich auf. »Ah, ich glaube, Sie haben mich verstanden falsch. Ich möchte, dass Sie das Buch behalten. Und den Brief. Es ist Ihr Erbe, von Ihrer Großmutter.«
»Aber … wenn dieses Buch aus dem Mittelalter stammt, dann ist es vielleicht sehr wertvoll …«
Lieberman setzte wieder sein breites Grinsen auf. »Wertvoll? Ich bin ein Händler von Gold und Edelsteine. Ich weiß, was ist wertvoll. Ich habe Geld genug, mehr als ein alter Mann haben soll. Ich brauche kein altes Buch, das ich nicht verstehe. Das Schicksal hat mir dieses Buch gegeben, damit ich es Ihnen gebe. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Nun müssen Sie tun, was Sie können, um das Geheimnis zu entdecken.«
Paulus strich sanft über den Ledereinband. Sein Herz schlug heftig. Dennoch gebot ihm sein Anstand zu widersprechen. »Ich weiß nicht, ob ich das annehmen kann, Mr. Lieberman …«
Liebermans Gesicht wurde wieder ernst. Diesmal sprach er ruhig, aber dafür umso eindringlicher. »Mr. Brenner, das ist kein Geschenk. Das ist eine Aufgabe. Ihre Großmutter hat viel getan für meine Familie. Sie hat ihre Last getragen. Ich weiß nicht, ob dieses Buch ist Fluch oder Segen, aber ich weiß, Sie müssen es nehmen und herausfinden, was es bedeutet.«
Paulus erwiderte Liebermans intensiven Blick. Was auch immer diese Handschrift tatsächlich für eine Bedeutung hatte, diesem alten Mann war es äußerst wichtig, dass er es als seine Aufgabe annahm, sie zu entschlüsseln. Lieberman war dafür eigens nach Deutschland gereist. Es wäre ein Affront gewesen, das Buch zurückzuweisen.
»Danke, Mr. Lieberman. Ich verspreche, ich werde alles tun, um das Geheimnis dieses Buches zu lüften.«
Diesmal lächelte Lieberman nicht. »Ja, das ich habe gewusst. Schließlich Sie sind Grandson von eine sehr mutige Frau.«
3.Hamburg, Freitag 22:15 Uhr
Paulus betrachtete das Manuskript auf seinem Schreibtisch voller Vorfreude. Er konnte es kaum erwarten, das Geheimnis der seltsamen Glyphen zu lüften.
Den Rest des Abendessens über hatte er sich mit Lieberman über belanglose Dinge unterhalten. Der Amerikaner war ein charmanter Gesprächspartner, der einen trockenen Humor hatte und sich selbst nicht allzu ernst nahm. Er hatte Paulus erzählt, wie er in den Sechzigerjahren das kleine Schmuckgeschäft seines Vaters übernommen und begonnen hatte, in größerem Stil mit Gold und Edelsteinen zu handeln, bis er es schließlich zu einem kleinen Vermögen gebracht hatte.
Paulus hatte kaum zugehört – seine Gedanken waren bei dem Manuskript gewesen.
Voller Dankbarkeit hatte er sich schließlich bei Lieberman verabschiedet, der am Ende auch noch die Rechnung übernommen hatte. Der Amerikaner hatte angekündigt, am nächsten Morgen in seine Heimatstadt Boston zurückzufliegen. Er hatte Paulus seine Handynummer gegeben und ihn gebeten, ihn zu informieren, wenn er etwas über das Manuskript herausgefunden hatte – »Sofern es etwas ist, das Sie glauben zu dürfen teilen mit mir«, wie er sich ausgedrückt hatte.
Paulus ging normalerweise relativ früh zu Bett, doch an Schlaf war jetzt nicht zu denken. Also machte er sich an die Arbeit.
Als Erstes zählte er die Seiten – es waren, den ledernen Einband nicht eingerechnet, 52, von denen 47 beschrieben waren. Sie schienen in vier Abschnitte oder Kapitel unterteilt zu sein, denn an drei Stellen endeten die Glyphen in der Mitte einer Seite und der Anfang der nächsten war mit einer Illumination verziert. Er vermaß das Buch und notierte eine Höhe von 17 und eine Breite von 11 Zentimetern in einer Datei auf seinem Laptop. Dann begann er mit der ersten kryptologischen Analyse.
Er erstellte auf kariertem Papier eine Liste der Glyphen, die er grob abzeichnete. Es waren 25, zuzüglich einem senkrechten Strich, der in zwei unterschiedlichen Längen, mal einzeln, mal doppelt vorkam und den Paulus intuitiv als Satzzeichen interpretierte. Somit war klar, dass es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine Substitutionschiffre handelte, bei der jeder Buchstabe des lateinischen Alphabets durch eine Glyphe ersetzt worden war.
Der nächste Schritt bestand darin, die Häufigkeit der Zeichen zu ermitteln. Er begnügte sich zunächst mit den ersten fünf Seiten und machte jedes Mal, wenn eine Glyphe im Text auftauchte, an der entsprechenden Stelle seiner Liste einen Strich. Auf diese Weise zählte er etwa 3000 Zeichen aus und übertrug sie in eine neue Tabelle, die ein klares Bild ergab:
Wie er gehofft hatte, zeigten die Glyphen deutliche Unterschiede in der Häufigkeit. Die beiden häufigsten tauchten in sehr vielen Wörtern auf und bildeten zusammen etwa ein Viertel aller Zeichen. Dies entsprach typischen Häufigkeitsverteilungen bei bekannten Sprachen. Es handelte sich tatsächlich um eine einfache Substitutionschiffre. Das Entschlüsseln würde ein Kinderspiel sein.
Die einzige noch offene Frage war, in welcher Sprache der Originaltext verfasst war. Wenn das Dokument aus dem Mittelalter stammte, dann war Latein am wahrscheinlichsten. Also öffnete Paulus eine Datei, die die Häufigkeit der Zeichen in lateinischen Texten wiedergab, und schrieb die Buchstaben neben die Glyphen. Da das traditionelle lateinische Alphabet nur 23 Buchstaben kannte, blieben zwei Glyphen übrig, die er nicht zuordnen konnte. Paulus ignorierte dieses Problem vorerst; es mochte sich bei den überzähligen Symbolen um die Zusammenfassung mehrerer Buchstaben oder um Symbole für Eigennamen handeln, das würde er später noch genauer untersuchen.
Jetzt hatte er eine Übersetzungstabelle für die Glyphen:
Er begann, für jede Glyphe den entsprechenden Buchstaben einzusetzen. Die häufig, jedoch nur am Ende eines Wortes auftretenden kurzen Striche interpretierte er als Kommata. Er merkte jedoch schon nach wenigen Wörtern, dass er auf dem Holzweg war, denn das Resultat sah nicht einmal ansatzweise wie Latein aus:
OE BETIA NIAE UCCQIDNSOL LMS UELITODNS, RIA QODN EH VUCRS AHFFS XH TODN, BEER TPE UOELIVMAE TMEI …
Als Nächstes versuchte er es aufs Geratewohl mit Deutsch. Dabei wählte er eine Häufigkeitstabelle des im ausgehenden Mittelalter verbreiteten Frühneuhochdeutschen, bei der U und V nicht unterschieden wurden, so dass sich genau 25 Zeichen ergaben. Die resultierende Übersetzungstabelle sah diesmal so aus:
Er ersetzte die Glyphen durch die entsprechenden Buchstaben. Das Ergebnis wirkte allerdings auch nicht viel überzeugender als bei seinem ersten Versuch:
HN ONREI DEIN SLLWEMDAHC CUA SNCERHMDA, TEI WHMD NO FSLTA IOKKA PO RHMD, ONNT RGN SHNCEFUIN RUNE XERO MDIHRA ONNT TER DEHLCEN CEHRAER ONNT TER DEHLCEN FEINSIT ONNT TEI CEWEHNRMDSKKA TEI DEHLCEN
Zwar tauchten deutsche Wörter wie »Dein« und »Rune« im Text auf, aber das war höchstwahrscheinlich Zufall – der Rest ergab überhaupt keinen Sinn.
Paulus wusste jedoch aus Erfahrung, dass das Knacken einer Substitutionschiffre etwas Geduld erforderte. Denn natürlich schwankten die Buchstabenhäufigkeiten von Schriftstück zu Schriftstück, und schon eine leichte Veränderung ihrer Häufigkeitsverteilung konnte einen Text gehörig durcheinanderbringen.
Er betrachtete den Text einen Moment. Das Erste, das ihm auffiel, war ein Wort, das in dem kurzen Text viermal unverändert auftauchte: ONNT. Konnte es sein, dass dieses Wort nicht nur zufällig so ähnlich klang wie »und«, eines der häufigsten Wörter im Deutschen? Zwar hatte es vier Buchstaben, nicht drei, doch in den frühen Formen des Neuhochdeutschen, die im ausgehenden Mittelalter geschrieben worden waren, kamen durchaus Schreibweisen mit doppeltem N vor. Er erinnerte sich an einen Vertragstext zwischen zwei Hanse-Kaufleuten, den er erst kürzlich analysiert hatte. Darin war »und« mit V und Doppel-N geschrieben worden.
Versuchsweise tauschte Paulus das O gegen das V und das D gegen das T aus.
HN VNREI TEIN SLLWEMTAHC COA SNCERHMTA, DEI WHMT NV FSLDA IVKKA PV RHMT, VNND RGN SHNCEFOIN RONE XERV MTIHRA VNND DER TEHLCEN CEHRAER VNND DER TEHLCEN FEINSID VNND DEI CEWEHNRMTSKKA DEI TEHLCEN
Viel besser war das noch nicht, aber Paulus spürte, dass er auf dem richtigen Weg war, denn jetzt tauchten plötzlich mehrere Wörter mit drei Buchstaben und einem D am Anfang auf – typische bestimmte Artikel im Deutschen. »Dei« war aber offensichtlich falsch, falls nicht das lateinische Wort für »Gottes« gemeint war, das wiederum in einem deutschen Text nicht so oft vorkommen sollte.
Er betrachtete das erste Wort des Textes. HN. Es enthielt keinen Vokal. Wenn aber das Wort VNND korrekt war, dann musste das N auch hier richtig sein. Vermutlich handelte es sich um das Wort »In« oder »An«. Da das I offensichtlich ohnehin an der falschen Stelle stand, versuchte es Paulus mit einem Dreieckstausch: Für H setzte er I ein, für I ein R, da so aus DEI das häufige Wort DER wurde, und das übrigbleibende H setzte er anstelle des Rs ein. Heraus kam:
IN VNHER TERN SLLWEMTAIC COA SNCEHIMTA, DER WIMT NV FSLDA RVKKA PV HIMT, VNND HGN SINCEFORN HONE XEHV MTRIHA VNND DEH TEILCEN CEIHAEH VNND DEH TEILCEN FERNSRD VNND DER CEWEINHMTSKKA DER TEILCEN





























