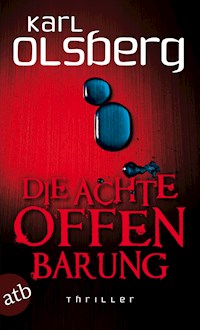Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dein Mirror kennt dich besser als du selbst. Er tut alles, um dich glücklich zu machen. Ob du willst oder nicht.
Wie digitale Spiegelbilder wissen Mirrors stets, was ihre Besitzer wollen, fühlen, brauchen. Sie steuern subtil das Verhalten der Menschen und sorgen dafür, dass jeder sich wohlfühlt. Als die Journalistin Freya bemerkt, dass sich ihr Mirror merkwürdig verhält, beginnt sie sich zu fragen, welche Macht diese Geräte haben. Dann lernt sie den autistischen Andy kennen und entdeckt, dass sich die Mirrors immer mehr in das Leben ihrer Besitzer einmischen – auch gegen deren Willen. Als sie mit ihrem Wissen an die Öffentlichkeit geht, hat das unabsehbare Folgen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über Karl Olsberg
Karl Olsberg (geb. 1960) promovierte über Anwendungen Künstlicher Intelligenz, war Unternehmensberater, Marketingdirektor eines TV-Senders, Geschäftsführer und erfolgreicher Gründer zweier Unternehmen in der »New Economy«. Er wurde unter anderem mit dem »eConomy Award« der Wirtschaftswoche für das beste Start Up 2000 ausgezeichnet. Heute arbeitet er als Unternehmensberater und lebt mit seiner Familie in Hamburg. Bislang erschienen seine Thriller »Das System«, »Der Duft«, »Schwarzer Regen«, »Glanz« sowie das Sachbuch »Schöpfung außer Kontrolle«.
Mehr vom und zum Autor unter www.karlolsberg.de
Informationen zum Buch
Dein Mirror kennt dich besser als du selbst.
Er tut alles, um dich glücklich zu machen.
Ob du willst oder nicht.
Wie digitale Spiegelbilder wissen Mirrors stets, was ihre Besitzer wollen, fühlen, brauchen. Sie steuern subtil das Verhalten der Menschen und sorgen dafür, dass jeder sich wohlfühlt. Als die Journalistin Freya bemerkt, dass sich ihr Mirror merkwürdig verhält, beginnt sie sich zu fragen, welche Macht diese Geräte haben. Dann lernt sie den autistischen Andy kennen und entdeckt, dass sich die Mirrors immer mehr in das Leben ihrer Besitzer einmischen – auch gegen deren Willen.
Als sie mit ihrem Wissen an die Öffentlichkeit geht, hat das unabsehbare Folgen …
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Karl Olsberg
Mirror
Thriller
Inhaltsübersicht
Über Karl Olsberg
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Phase 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Phase 2
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Phase 3
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Epilog
Nachwort
Impressum
Ein wahrer Freund ist
wie ein zweites Ich.
Marcus Tullius Cicero
Für Carolin,
mein zweites Ich
Prolog
Carl Poulson saß entspannt am Steuer seines Tesla und las ein Buch, während er vorschriftsgemäß mit nicht mehr als fünfundfünfzig Meilen pro Stunde den Highway 101 Richtung Norden entlangfuhr. Die Golden Gate Bridge hatte er kurz zuvor überquert, ohne den grandiosen Ausblick zu beachten. Zu oft hatte er die Strecke von seinem Luxusapartment in San Francisco bis zu dem kleinen, immer etwas heruntergekommen wirkenden Bungalow seines Vaters schon zurückgelegt. Außerdem hatte er Dad versprochen, Eine Welt zu viel zu lesen – immerhin war es ihm gewidmet –, und wollte vor seinem Besuch wenigstens wissen, worum es überhaupt ging. Irgendeine wirre Science-Fiction-Geschichte über einen einsamen Helden, der quer durch verschiedene absurde Paralleluniversen seiner großen Liebe nachjagte und dabei eine Menge erotischer Abenteuer, teils recht freizügig beschrieben, erlebte, so viel hatte er beim Querlesen herausgefunden. Kein Verlag hatte seine Bücher drucken wollen, also gab Dad sie im Selbstverlag heraus. Geld brachte das kaum, aber seit er Ende der Neunziger Internetaktien gekauft und sie rechtzeitig vor dem großen Crash wieder abgestoßen hatte, war sein Ruhestand finanziell abgesichert, und mit dem Schreiben auch noch so wirrer Romane konnte er seine Tage wenigstens halbwegs sinnvoll füllen.
»Schundliteratur« hatte Mom diese Schreibprojekte halb scherzhaft, halb ernst gemeint genannt, bevor sie vor drei Jahren viel zu früh gestorben war. Brustkrebs. An so was starb man doch heute nicht mehr! Hätte sie sich nicht immer geweigert, zu den Vorsorgeuntersuchungen zu gehen, würde sie jetzt noch leben. Dass ein Mensch so sorglos und unaufmerksam mit seinem Körper umging, war eines der vielen Dinge, die Carl ändern wollte.
»Du hast eine Kurznachricht von Alan Poulson erhalten«, sagte eine freundliche, wohl modulierte Männerstimme, die seiner eigenen nachempfunden war und sowohl aus dem kleinen Kommunikationsgerät kam, das an seinem Ohr klemmte, als auch aus den Lautsprechern des Wagens. Man hörte ihr kaum an, dass sie künstlich war.
Das war der Name seines Vaters. Carls Mirror hatte die Verwandtschaftsbeziehung irgendwie noch nicht richtig abgebildet. Er würde Eric, den Technikchef, bitten, sich das anzusehen.
»Hat er wieder mal Dringendes zu tun und keine Zeit für meinen Besuch?« Es war mehr ein Test als eine ernstgemeinte Frage, viel zu komplex, als dass die künstliche Intelligenz seines Mirrors sie hätte korrekt interpretieren und sinnvoll beantworten können.
»Soll ich die Nachricht vorlesen?«, fragte der Mirror. Immerhin, das war eine durchaus sinnvolle Reaktion.
»Ja.«
»Hilfe«, sagte der Mirror in seiner freundlichen, neutralen Stimme.
»Hilfe? Ist das der Text der Nachricht? Nur dieses Wort?«
»Ich verstehe diese Frage nicht. Benötigst du Hilfe, Carl?«
»Lies mir die letzte Nachricht von Alan Poulson noch einmal vor!«
»Der Text der letzten Nachricht von Alan Poulson lautet: Hilfe.«
Ein eisiger Schauer lief über Carls Rücken. »Rufe Alan Poulson an!«, sagte er, während er das Buch auf den Beifahrersitz warf und den Tesla auf manuelle Steuerung umschaltete. Mehrere Warnsignale ertönten, als er das Gaspedal drückte und der leise sirrende Elektromotor den Wagen auf deutlich mehr als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beschleunigte.
Sanfte Musik erklang plötzlich, eine Panflöte vor synthetischen Streichern. »Du bist sehr angespannt«, sagte Carls Mirror wie zur Erklärung. »Bitte reduziere die Geschwindigkeit. Du bringst sonst dich und andere in Gefahr.«
»Dies ist ein Notfall!«, sagte Carl so ruhig wie möglich. »Musik abschalten. Rufe sofort Alan Poulson an!«
Die Musik verstummte. Aus den Lautsprechern und dem MirrorClip in seinem Ohr drang das altmodische Tuten des Freizeichens wie ein Signal aus dem letzten Jahrhundert. Kurz darauf erklang eine Stimme, die der seines Vaters so stark ähnelte, dass Carl im ersten Moment erleichtert aufatmete, bevor ihm klar wurde, dass er bloß mit der modernen Version eines Anrufbeantworters verbunden war. »Dies ist der Mirror von Alan Poulson. Ich kann momentan nicht selbst antworten, aber mein Mirror nimmt gern deine Nachricht auf oder beantwortet deine Fragen.«
»Wie geht es dir, Dad?«
»Na ja, man wird eben nicht jünger«, antwortete die Stimme. »Aber ich jogge täglich meine drei Meilen, und die kalifornische Sonne tut mir gut.« Das war eine synthetische Antwort, die Dads Mirror aus früheren Gesprächen extrahiert hatte. Sie hatte nichts mit seinem tatsächlichen Zustand zu tun.
»Wie ist der Gesundheitsstatus deines Eigentümers?«, fragte Carl.
»Aus Datenschutzgründen kann ich diese Frage nicht beantworten«, erwiderte der Mirror und erfüllte damit exakt die Vorgaben, die die Rechtsabteilung von Carls Firma Walnut Systems, Inc. erarbeitet hatte.
»Dies ist ein Notfall. Ich brauche exakte Angaben über den Gesundheitszustand von Alan Poulson.«
»Aus Datenschutzgründen kann ich diese Frage nicht beantworten.«
Verdammt! So ein Mirror war eben doch bloß eine Maschine, selbst wenn er sich durch permanente Beobachtung immer besser an die Verhaltensmuster seines Besitzers anpasste. Durch MirrorSense, das flexible Armband, das jeder Mirror-Besitzer am Handgelenk trug, wusste das Gerät stets, wie es seinem Träger ging, ob er aufgeregt, freudig erregt, traurig oder krank war. Es erkannte Herzrhythmusstörungen, ungesunden Blutdruck und Schlaganfallsymptome, selbst wenn diese seinem Träger gar nicht bewusst wurden. Aber das nützte Carl jetzt gar nichts. Falls Dad erneut einen Schlaganfall bekommen hatte, lag er jetzt wahrscheinlich bewusstlos oder tot in seinem Haus.
»Ich möchte dich noch einmal bitten, die Geschwindigkeit zu drosseln und dich zu entspannen«, sagte Carls Mirror.
Am liebsten hätte er das flache Gerät, kleiner und leichter als ein Taschenbuch, aus dem Fenster geworfen. Aber jedes der zweihundert Beta-Testgeräte, die zurzeit im Umlauf waren, hatte in der Herstellung mehr als hunderttausend Dollar gekostet. Nur ein kleiner Betrag, gemessen daran, wie viel Geld bereits in die Entwicklung des Mirrors geflossen war, aber genug, um die Korinthenkacker von Global Information Systems auf den Plan zu rufen, die vor einem halben Jahr die Mehrheit an Carls Firma übernommen hatten. Er hatte sich seitdem schon mehr als einmal gewünscht, die Übernahme rückgängig machen zu können, und dafür gern die fast hundert Millionen Dollar auf seinen Bankkonten zurückgezahlt. Aber diese Entscheidung lag nun mal nicht in seiner Macht. Er konnte wahrscheinlich froh sein, dass sie ihn noch nicht als Vorstandschef von Walnut Systems abberufen hatten.
Endlich erreichte er die Ausfahrt nördlich von Sausalito. Er nahm dem Fahrer eines Porsche-Geländewagens die Vorfahrt und jagte mit quietschenden Reifen den Shoreline Highway entlang. Kurz darauf bog er in eine Seitenstraße ein, die in die Marin Avenue mündete, an der das Haus seines Vaters stand.
Schon von weitem sah er den Krankenwagen. Als er anhielt und aus dem Wagen sprang, kamen ihm gerade zwei Rettungskräfte entgegen, die eine Trage schleppten.
»Dad!«
Sein Vater lag reglos da, eine Sauerstoffmaske auf dem wächsern wirkenden bleichen Gesicht, die Augen geschlossen.
»Was ist passiert?«, fragte Carl.
»Sie sind sein Sohn?«, erwiderte der Sanitäter.
»Ja.«
»Ein anaphylaktischer Schock. Wahrscheinlich eine Lebensmittelallergie. Ist Ihr Vater allergisch auf irgendwas?«
»Erdnüsse. Aber eigentlich achtet er darauf … Ist es ernst? Er wird doch nicht …?«
»Er ist stabil, aber sein Gehirn war eine Zeitlang mit Sauerstoff unterversorgt. Wir sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Ob bleibende Schäden auftreten, kann man noch nicht sagen.«
»Wer hat Sie eigentlich gerufen?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn er nicht selbst den Notruf aktiviert hat, dann war es vielleicht ein Nachbar.«
»Wo bringen Sie ihn hin?«
»Ins Marin General Hospital. Möchten Sie ihn begleiten?«
»Nein, ich komme gleich nach. Ich möchte erst rausfinden, was den Schock ausgelöst hat.«
Er sah zu, wie die beiden Rettungssanitäter die Trage mit geübten Griffen im Krankenwagen fixierten. Einer der beiden blieb im Transportraum, während sich der andere ans Steuer setzte und mit eingeschaltetem Blaulicht davonfuhr.
Carl betrat den kleinen Bungalow. Die Eingangstür war noch angelehnt, ein durchdringender Alarmton verstummte erst, als er sie hinter sich schloss.
Sein Vater war nach dem Tod seiner Mutter von Idaho hierher nach Kalifornien gezogen, um in der Nähe seines einzigen Sohns zu sein. Trotzdem hatten sie sich in letzter Zeit nicht allzu häufig gesehen. Das letzte Mal war schon wieder vier Wochen her. Damals hatte Carl ihn endlich dazu überreden können, beim Betatest des Mirrors mitzumachen. Dad, der schon immer einen Hang zu Verschwörungstheorien gehabt hatte, war nicht gerade begeistert von der Idee gewesen, ein elektronisches Gerät rund um die Uhr an seinem Leben teilhaben zu lassen. Doch er hatte schließlich Carl zuliebe eingewilligt.
Der Techniker, der das Gerät gebracht hatte, hatte auch gleich die vollautomatische MirrorSafe-Schließanlage in die Tür eingebaut. Damit wurden Schlüssel oder Zahlencodes überflüssig. Die Tür konnte das Gesicht und die Stimme ihres Besitzers zuverlässig erkennen und öffnete nur diesem. Da sie offen gestanden hatte, musste entweder Dad selbst sie geöffnet haben, oder …
Carl betrat das Wohnzimmer. Der Großbildfernseher lief, irgendein Baseballspiel. Auf dem Couchtisch stand eine Packung Cracker. Es war nicht die Marke, die Dad sonst bevorzugte. Er warf einen kurzen Blick auf das Zutatenverzeichnis: Kann Spuren von Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten. Sein Vater hatte nicht aufgepasst.
Dads Mirror lag auf dem Sofa, auf dem Crackerkrümel verstreut lagen. Eine rote Warnmeldung blinkte: Verbindung zu MirrorSense und MirrorClip unterbrochen.
Carl nahm den Mirror und tippte auf den Bildschirm. Die Warnmeldung verschwand. Dafür erschien das computeranimierte Gesicht seines Vaters.
»Bitte bringe mich zu meinem Besitzer Alan Poulson!«, sagte das Gerät.
»Hast du den Notruf aktiviert?«, fragte Carl.
»Bitte identifiziere dich.«
»Carl Poulson.«
Das Gesicht lächelte. »Identität bestätigt. Hallo, Carl Poulson!«
»Hast du den Notruf aktiviert?«, fragte er erneut.
»Mein Besitzer hatte einen starken Blutdruckabfall«, erklärte der Mirror. »Ich habe den Notruf aktiviert. Die Verbindung zu MirrorSense und MirrorClip ist unterbrochen. Bitte bringe mich zu meinem Besitzer Alan Poulson!«
Carl schaltete den Mirror in den Stand-by-Modus, steckte ihn ein und fuhr zum Krankenhaus. Der schreckliche Anblick seines bleichen, wie tot daliegenden Vaters steckte ihm noch in den Knochen. Doch gleichzeitig spürte er so etwas wie Stolz in seinem Bauch.
Nun war genau der Fall eingetreten, für den Carl all die Mühen und Strapazen auf sich genommen hatte. Es erschien ihm wie eine Fügung des Schicksals, dass ausgerechnet sein eigener Vater der erste Mensch war, dem ein Mirror das Leben gerettet hatte.
Phase 1
011000101100101.10010111010100
Die bunten Buchstaben der Lichterkette, die Mama über dem Gabentisch aufgehängt hatte, spiegelten sich verschwommen in dem metallisch glänzenden Geschenkpapier. Er versuchte, das Paket so zu halten, dass er die leuchtende Schrift darin lesen konnte, doch er sah nur einen Ausschnitt: PPYBIRTHD.
»Andreas?«
Dass die Worte auf dem Kopf und in Spiegelschrift standen, bereitete ihm keine Mühe. Doch wie er das Paket auch drehte, es gelang ihm nie, alle Buchstaben auf einmal auf die glitzernde Fläche zu bannen. Vielleicht, wenn er es ganz dicht ans Gesicht hielt …
»Andreas, willst du das Paket nicht auspacken?«
Er mochte es nicht, wenn Mama ihn Andreas nannte. Andy klang wesentlich besser. Er drehte das Paket um. Auf der Rückseite klebte ein Tesafilmstreifen, der halb unter dem dunkelroten Geschenkband hervorlugte. Schief. Eine kleine Ecke hatte sich vom Papier abgelöst. Er versuchte, sie wieder anzudrücken, doch der Klebstoff hielt nicht mehr.
»Andreas, soll ich es vielleicht für dich auspacken?«
Nein, bloß nicht. Sie würde mit ihren ungeschickten Fingern das schöne Papier zerreißen und wahrscheinlich noch einen Kratzer in den Karton darunter machen, wenn sie ungeduldig das Geschenkband herunterzerrte, ohne den Knoten zu öffnen.
»Andreas, wir wollen bald essen!« Das war der Mann, der seit zehn Monaten und vier Tagen bei Mama wohnte und Sex mit ihr hatte. Andy konnte ihn nicht leiden.
Sorgfältig betrachtete er die Schleife, löste sie vorsichtig, strich das Band glatt, zog dann mit spitzen Fingern an dem Knoten, bis es ihm gelang, ihn etwas zu lockern. Endlich hatte er das Band gelöst, wickelte es auf drei Fingern seiner linken Hand auf und legte es sorgfältig auf den Gabentisch. Dann knibbelte er behutsam die Tesafilmstreifen ab. Schließlich klappte er die schlampig umgefalteten Enden des Geschenkpapiers auf, glättete sie und öffnete es.
Die Unterseite eines schwarzen Kartons kam zum Vorschein. Ein Barcode-Aufkleber mit einer EAN-Nummer klebte darauf: 5–901235 –123457. Darunter stand »Made in China«.
Der Mann sagte: »Wenn wir in dem Tempo weitermachen, komme ich zu spät ins Büro!«
»Bitte lass ihm die Zeit, die er braucht«, sagte Mama. Die beiden sprachen wieder einmal über Andy, als sei er gar nicht da.
»Findest du nicht, er muss langsam lernen, sich wie ein richtiger Erwachsener zu verhalten?«
»Ich bin ein richtiger Erwachsener«, sagte Andy, ohne den Blick von dem Karton zu wenden.
»Dann mach jetzt endlich das verdammte Geschenk auf!«
»Rudolf!« Mama sprach laut. »Es ist sein Geburtstag!«
»Genau«, sagte der Mann. »Er ist jetzt einundzwanzig und könnte langsam damit aufhören, sich wie ein Zehnjähriger aufzuführen. Als ich in seinem Alter war, hatte ich schon eine eigene Wohnung, eine feste Freundin und einen Job!«
Andy drehte den Karton um. Auf der Vorderseite stand ganz oben Walnut Systems. Neben den beiden Wörtern war ein Logo abgebildet, das vielleicht das Innere einer Walnuss darstellen sollte, oder auch ein Gehirn. Darunter stand in großen silbernen Buchstaben MIRROR. Zwei der Buchstaben – das R vor und hinter dem O – waren spiegelverkehrt geschrieben. Das sah lustig aus. Unterhalb der Schrift war etwas abgebildet, das wie ein Spiegel aussah – ein schwarzer Rahmen mit einer glatten silbernen Fläche. Andy drehte sie so, dass er sich selbst darin sehen konnte – unscharf, aber doch erkennbar: Hellblaue Augen hinter einer Brille aus schwarzem Kunststoff, lockige blonde Haare. Er streckte seinem Spiegelbild die Zunge heraus.
»Das ist doch wohl die Höhe!«, rief der Mann. »Wenn du dein Geschenk nicht haben willst, musst du es nur sagen! Ich schicke es gleich morgen zurück.«
»Er meint es doch nicht so!«, sagte Mama.
»Weißt du eigentlich, was dieses Ding gekostet hat?«
Andy ignorierte die Worte. Er drehte die Packung so, dass sich die Lichterkette in der silbernen Fläche spiegelte. Das Spiegelbild war klarer als das auf dem Geschenkpapier. Er hielt die Packung an die Nase und roch daran. Er liebte diesen künstlichen Geruch ungeöffneter Verpackungen: Papier, Farbe, Plastik, alles noch unberührt und frisch.
»Also, ich frühstücke jetzt. Was ihr macht, ist mir egal.« Der Mann setzte sich und schenkte sich Kaffee ein.
»Alles Gute zum Geburtstag, mein Sohn«, sagte Mama.
»Danke, Mama«, erwiderte er, ohne sie anzusehen. Vorsichtig öffnete er die Packung. Der Geruch nach Neuem verstärkte sich. Innen lag der Mirror auf einer schwarzen samtigen Unterlage. Der Bildschirm spiegelte schwach – eine Schutzfolie aus Plastik klebte noch darauf. Andy nahm ihn heraus. Das Gerät war schwerer als sein Smartphone, aber dafür auch viel leistungsfähiger. Andy kannte die technischen Daten auswendig: Tausendvierundzwanzig Risc-Prozessoren, die es auf sieben Billionen Rechenoperationen pro Sekunde brachten – so viele wie der schnellste Computer der Welt im Jahr 2000. Ein Terabyte Onboard-Speicher. Superschnelle Internetverbindung mit einer Datentransferrate von bis zu zweihundertsechsundfünfzig Megabit pro Sekunde, die allerdings nur mit einem Ethernet-Kabel erreicht werden konnte – im normalen Mobilfunknetz schaffte der Mirror selbst unter optimalen Bedingungen höchstens zweiunddreißig Megabit. Alles in allem der mit Abstand leistungsfähigste Computer, der je in einem für Konsumenten gedachten Endgerät gesteckt hatte.
Das Eindrucksvollste an dem Mirror war jedoch seine innere Architektur: Die Prozessoren, der Aufbau des Speichers und die Onboard-Software waren optimiert worden, um ein künstliches neuronales Netz mit mehreren hundert Millionen Neuronen abzubilden, vergleichbar mit dem Gehirn eines Vogels.
Er drückte den Netzschalter an der Seite des Geräts. Nichts geschah. Na klar, Mama hatte vergessen, es vorher aufzuladen. Vorsichtig legte Andy das MirrorBrain, wie die Zentraleinheit des Mirrors offiziell genannt wurde, beiseite, holte das restliche Zubehör aus der Packung und befreite es behutsam von seiner Plastikumhüllung: Die MirrorCharge-Ladestation, das MirrorSense-Armband und den MirrorClip-Ohrstecker, die beide per Bluetooth drahtlos mit dem MirrorBrain in Verbindung standen. Probehalber streifte er sich das MirrorSense-Armband über das rechte Handgelenk. Es sah schick aus: schwarz, mit schwach leuchtenden LEDs, die den Text no connection in roter Schrift wiedergaben. Auf der Unterseite war das Band elastisch, so dass man es einfach über das Handgelenk streifen konnte. Hier waren auch die Sensoren für Puls, elektrischen Hautwiderstand und Temperatur angebracht.
»Frühstücken wir jetzt endlich zusammen, oder was?«, schnauzte der Mann.
»Einen Augenblick noch, Rudolf«, erwiderte Mama.
Andy steckte sich den Clip ans Ohr und zog den dünnen, etwa zehn Zentimeter langen flexiblen Fühler heraus, so dass es aussah, als trage er eine Antenne am Kopf. In Wahrheit waren am oberen Ende ein Mikrofon und eine stecknadelkopfgroße hochauflösende 360°-Kamera angebracht. Damit nahm der Mirror die Umgebung wahr. Der Clip fühlte sich ein bisschen ungewohnt an, aber nicht unangenehm. Er bog den Fühler nach vorn, so dass er parallel zum Bügel seiner Brille lag, und betrachtete sich in der Spiegeloberfläche der Verpackung. In dem unscharfen Bild war jedoch nicht zu erkennen, ob der Fühler auffiel.
»Ich muss gleich los!«
Andy steckte den Stecker der Ladestation ein und legte das MirrorBrain auf die Station. Eine glockenartige Melodie erklang, dann zeigte ein animiertes Symbol an, dass der Akku des Geräts geladen wurde. Andy wusste, dass er voll aufgeladen im Normalbetrieb gut achtzehn Stunden hielt. Nachts blieb das Gerät auf der Ladestation, wo es mit neuer Energie versorgt wurde und gleichzeitig die am Tag aufgezeichneten Eindrücke verarbeitete – genau wie das Gehirn eines Menschen. Er nahm den Clip ab und legte ihn wieder in die Packung. Das Armband ließ er am Handgelenk – es fühlte sich irgendwie gut an. Die LED-Schrift war inzwischen verblasst, aber eine Berührung mit dem Finger reichte, um sie erneut anzeigen zu lassen.
»Lass uns jetzt frühstücken, mein Schatz.«
»Ja, Mama. Danke, Mama.«
Sie gab ihm einen Kuss auf die Stirn, als sei er noch ein kleines Kind. »Gern geschehen. Ich hoffe, dein Geschenk gefällt dir.«
»Ja, Mama.«
Andy wusste alles über den Mirror, was man wissen musste – das Netz war voll von Testberichten und begeisterten Meinungen. Allein am ersten Tag waren weltweit fünf Millionen Geräte verkauft worden. Der Mirror war im Begriff, selbst das iPhone als erfolgreichstes Elektronikprodukt aller Zeiten zu überflügeln.
Andy hatte sich jedoch etwas anderes zum Geburtstag gewünscht: einen neuen Highend-Gaming-PC. Der Mirror war in erster Linie ein Kommunikationsgerät, doch Andy hatte niemanden, mit dem er kommunizieren wollte, außer in der virtuellen Welt von World of Wizardry, seinem Lieblings-Onlinespiel – und dafür brauchte er bloß ein Headset und kein über tausend Euro teures Gerät. Er überlegte, ob er Mama das sagen und sie bitten sollte, den Mirror umzutauschen, doch sie würde bestimmt Theater deswegen machen. Sie sagte immer, er spiele ohnehin schon viel zu viel am Computer und solle sich lieber mehr in der »richtigen Welt« beschäftigen. Sie begriff einfach nicht, dass Online-Rollenspiele für Andy die »richtige Welt« waren – die einzige Welt, in der er sein wollte. Eine Welt, in der alle Menschen gleich waren. In der man nicht von stinkenden, hektischen Menschenmengen bedrängt wurde, in der man nicht von Autos angefahren werden konnte, bloß weil man von der verwirrenden Vielfalt der Sinneseindrücke abgelenkt war. Eine Welt, in der einem die anderen nicht gleich ansahen, dass man anders war. Eine Welt, in der es nicht darauf ankam, die Gesichtsausdrücke der anderen lesen zu können oder ihre seltsamen Witze und Wortspiele zu verstehen. Eine Welt, in der Andy seine Stärken – Intelligenz, Auffassungsgabe, blitzartige Reflexe – perfekt einsetzen konnte. Eine Welt, in der man keine teuren Kommunikationsgeräte brauchte, um andere damit zu beeindrucken; in der nur die eigenen Fähigkeiten, Kreativität und Einfallsreichtum zählten.
Er stieß ein irritiertes Schnauben aus und setzte sich an seinen Platz. Mama hatte einen Blumenkranz aus weißen Rosen um seinen Teller gelegt. Einige der Blüten waren schon welk. Der Mann schaufelte Rührei mit Speck auf seinen Teller. Der Geruch verursachte Andy Übelkeit. Er hasste Speck, denn der wurde aus Schweinen gemacht, sensiblen Wesen, die unter unwürdigsten Umständen lebten und auf ein unnatürliches Gewicht gemästet wurden, nur um dann, kaum ausgewachsen, brutal geschlachtet zu werden. Der Gedanke ließ ihn schaudern.
Er aß ein Brötchen mit Honig, trank warmen Kakao und wartete darauf, dass der Mann endlich das Haus verließ.
011000101100102.10010111010100
»Komm schon, Alter! Nur ein Gramm. Ein Gramm, mehr nicht. Du kriegst dein Geld, Ehrenwort!«
Jack Skinner blickte in das bleiche pockennarbige Gesicht des Junkies, das von der trüben Straßenlaterne in fahles Licht getaucht wurde. Will Mason. Er kannte ihn noch aus der Zeit, als sie beide zur Schule gegangen waren. Damals war Will einer der besten Schüler gewesen. Hatte Jack manchmal abschreiben lassen. Hatte sogar ’nen Highschoolabschluss gemacht. Wollte Informatik studieren, das große Geld machen im Valley. Jetzt war er nur noch ein Wrack.
Jack hasste Junkies. Hasste Leute, die sich gehenließen. Die jammerten, bettelten, unmögliche Dinge versprachen. Keine Selbstachtung hatten. Und Jack hasste Drogen. Aber es war nun mal sein Job, das Zeug zu verkaufen, und dieses arme Würstchen würde sonst was tun, um den nächsten Schuss zu kriegen.
»Du schuldest mir noch achtzig vom letzten Mal«, sagte er mit der entspannt-lässigen Stimme, von der er wusste, dass sie die Junkies mehr einschüchterte als jedes Gebrüll.
»Ich weiß. Ich weiß ja, Mann!« Wills Augen waren weit geöffnet und glitzerten, als sei er kurz davor, in Tränen auszubrechen. Ein Speichelfaden hing aus seinem Mund. »Du kriegst dein Geld, ehrlich! Mit Zinsen. Hab’s nur gerade nicht dabei!«
Jack sah sich um. Niemand war in der Nähe. Sie standen auf dem Parkplatz eines runtergekommenen Diners in Hunter’s Point, dem abgefucktesten Stadtteil von San Francisco, ganz in der Nähe der stillgelegten Werft. Nicht mehr lange, dann würden irgendwelche Immobilienhaie das ganze Gelände kaufen, die baufälligen Häuser und Lagerschuppen abreißen und Glastempel für Dotcom-Millionäre bauen, und für Leute wie Jack wäre dann kein Platz mehr. Nicht, dass er an der Gegend hing – obwohl er hier aufgewachsen war.
Er überlegte kurz, ob es Zeit war, Will ein paar Manieren beizubringen. Doch der Kerl tat ihm irgendwie leid.
»Hör zu, Will. Ich kann dir nichts mehr geben, wenn du nicht deine Schulden bezahlst. Besorg mir die achtzig und leg noch zwanzig drauf, dann hast du deinen nächsten Schuss.«
»Das mach ich! Das mach ich!«, stammelte Will und streckte eine zitternde schmutzige Hand aus. »Du kriegst es gleich morgen! Aber ich brauche jetzt einen Schuss! Nur einen!«
Jack schüttelte den Kopf, während ihn ein Anflug von Ekel überkam. Er war zu weich für diesen Scheißjob. Er musste aussteigen. Aber natürlich war das unmöglich. Er stand bei Mike ebenso in der Kreide wie Will bei ihm. Wenn er nicht wenigstens einen Teil des Stoffs, den er bei sich trug, schnell zu Geld machte, würde er in ernste Schwierigkeiten kommen. Und Mike würde nicht so sanft mit ihm umgehen wie er mit dem armen Schwein von Junkie vor sich.
Wills Stimme bebte vor Verzweiflung, während Tränen über seine Wangen rollten. »Bitte, Jack!«, flehte er mit heiserer Stimme. »Nur noch dieses eine Mal!«
»Tut mir leid«, sagte Jack, wandte sich um und ging betont lässig über den Parkplatz.
Will stieß ein Geräusch aus, das wie das Aufheulen eines verwundeten Tieres klang. Jack hörte seine schlurfenden Schritte, als er hinter Will herkam. Er beachtete sie nicht, ging einfach weiter.
Eine Bewegung, die er aus dem Augenwinkel wahrnahm, ließ ihn instinktiv zur Seite zucken. Eine Eisenstange! Sie verfehlte knapp seinen Schädel und krachte hart auf seine Schulter. Ein stechender Schmerz erstreckte sich bis in die Fingerspitzen seines linken Arms.
Er fuhr herum. Dieser Abschaum hatte es gewagt, ihn anzugreifen!
Wills Augen waren weit aufgerissen, sein Gesicht zu einer Fratze verzerrt. Braune Zähne standen schief in seinem aufgerissenen Maul.
Jack ignorierte die Schmerzen in seiner Schulter und zog das Klappmesser aus der Hosentasche. »Du Scheißkerl! Ich mach dich fertig!«
Will hob die Eisenstange und holte zum Schlag aus, doch diesmal war Jack vorbereitet. Er wich dem Schwung mühelos aus, packte die Stange und wand sie dem Junkie aus der Hand. Mit einem Krachen fiel sie zu Boden.
»Du miese Ratte!«, brüllte Jack. »Ich werd dir zeigen, was mit Leuten passiert, die mich verscheißern wollen!« Er richtete das Messer auf Will.
Der Junkie kniete sich auf den Boden und hob die Hände. »Bitte, Jack! Bitte nicht! Es tut mir leid! Bitte, bitte tu mir nichts!«
»Das hättest du dir vorher überlegen sollen!«
»He, was soll das?«, ertönte eine tiefe Stimme. Jack sah über die Schulter. Ein breitschultriger Kerl mit Glatze und Tätowierungen kam aus dem Diner auf ihn zu.
»Er wollte mich ausrauben!«, rief Will. »Helfen Sie mir bitte, Sir!«
»Halt dich da raus!«, sagte Jack drohend. »Das hier geht dich nichts an.«
Der Typ kam langsam näher. Springerstiefel und Lederjacke. »Lass den Mann in Ruhe und verpiss dich.«
»Ich sagte, halt dich da raus!«, drohte Jack. »Dieser Typ da schuldet mir Geld. Außerdem hat er mich mit einer Eisenstange angegriffen!«
»Er lügt!«, rief Will. »Er hat mich überfallen und mit dem Messer bedroht!« Der Wichser würde eine Abreibung kriegen, die er sein Leben lang nicht vergaß, wenn Jack mit dem tätowierten Riesen fertig war.
»Hör zu, ich rate dir, dich hier nicht einzumischen!«, sagte Jack so ruhig wie möglich.
Der Breitschultrige grinste. »Sagt wer?«
»Ich bin Mitglied der Hunters, falls dir das was sagt. Wenn du dich mit uns anlegst, wirst du’s bereuen.«
»Denkst du Nigger etwa, du hast hier was zu sagen? Ich pisse auf deine Hunters!«
Bei dem Wort Nigger zuckte Jack innerlich zusammen. Es war weniger die Beleidigung – er hatte schon Schlimmeres zu hören bekommen. Doch es war offensichtlich, dass der Typ auf Streit aus war. Er suchte bloß einen Grund, seine vermutlich mit Meth aufgeputschte Aggressivität an jemandem auszulassen, und ein Nigger kam da gerade recht.
Jack war selbst kein Weichei, er hatte schon als Jugendlicher so manchen Straßenkampf hinter sich gebracht. Aber der Typ da wog mindestens das Doppelte wie er, und er sah durchtrainiert aus. Es war besser, einen Kampf zu vermeiden. Will konnte er sich später vorknöpfen.
Er klappte das Messer zusammen, steckte es demonstrativ ein und hob die Hände. »Schon gut. Ich sag noch mal, dass dich das hier nichts angeht, aber ich will keinen Ärger mit dir.«
Der Tätowierte grinste breit. »Zu spät, Nigger!« Er hatte plötzlich einen Schlagstock in der Hand.
Jack wollte das Messer wieder hervorholen, doch in diesem Moment spürte er einen harten Schlag in den Rücken. Will hatte ihn von hinten mit der Eisenstange attackiert! Der Schlag war nicht sehr gut gezielt und richtete kaum Schaden an, aber er brachte Jack aus dem Gleichgewicht. Er stolperte vor, genau in den Schwung des Breitschultrigen hinein, der seinen Schlagstock gegen Jacks Schläfe krachen ließ. Bunte Lichter tanzten vor seinen Augen, und er fiel zu Boden.
Vergeblich versuchte er, sich gegen die Tritte und Schläge der beiden Männer zu schützen, die jetzt von allen Seiten auf ihn einprasselten. Es dauerte lange, bis er endlich ohnmächtig wurde.
011000101100103.10010111010100
»Andreas, mach jetzt bitte den Computer aus. Du weißt, was du mir versprochen hast!«
»Aber Mama, es ist mein Geburtstag!«
»Deshalb habe ich dich auch eine Stunde überziehen lassen. Aber jetzt ist endgültig Schluss. Du hast ja noch nicht mal dein Geschenk ausprobiert! Den ganzen Tag sitzt du nur vor diesem blöden Rechner und spielst irgendwelche Ballerspiele!«
»Das sind keine Ballerspiele, Mama. Das ist World of Wizardry. Da gibt es kaum Feuerwaffen.«
»Das ist mir vollkommen egal!« Ihre Stimme wurde schrill. Andy war nicht sehr gut darin, die Emotionen von Menschen einzuschätzen, aber in diesem Fall war es einfach, zu erkennen, dass Mama sauer war. Bald würde sie den Mann dazuholen, und dann würde es richtig ungemütlich werden. Der Mann hatte Andy schon mehrfach gedroht, ihn aus der Wohnung zu werfen. Nicht, dass Andy davor Angst gehabt hätte – er wusste, dass Mama das niemals zulassen würde. Aber sie weinte dann jedes Mal, und das wollte er nicht.
»Also gut, ich mache sofort aus. Fünf Minuten noch.«
»Nein!« Ihre Stimme war so laut, dass er sich am liebsten die Ohren zugehalten hätte. »Du machst jetzt sofort Schluss!«
»Aber mein Team ist mitten in einer …«
»Jetzt sofort, Andreas, oder ich ziehe den Stecker raus!«
»Ist ja gut. Nur kurz tschüs sagen.« Er tippte »Gotta go. CUT« in das Chatfenster und beendete das Programm, ohne die Proteste der Spielergruppe abzuwarten, mit der er gerade mitten in einem Raid auf eine gegnerische Clanfestung war. Sie würden es auch ohne ihn schaffen.
Mama wartete, bis das Programm beendet war, bevor sie den Raum verließ. Andy spielte mit dem Gedanken, sich wieder in das Spiel einzuloggen, doch er wusste, dass der Mann seine ultimative Drohung wahrmachen und das Internet für eine Woche kappen würde, wenn sie ihn erwischten. Dann hatte er bloß noch die schlechte Mobilfunkverbindung über sein Smartphone, und sein Datenvolumen war diesen Monat schon so gut wie ausgeschöpft.
Was für ein blöder Geburtstag! Statt ihn einfach machen zu lassen, was er wollte, hatte Mama einen »tollen Tag« für ihn organisiert. Sie waren nach dem Frühstück zu Hagenbeck gegangen, obwohl Mama eigentlich wissen musste, dass sich das für Andy wie ein Gefängnisbesuch anfühlte – nur waren im Unterschied zu einem richtigen Gefängnis alle eingesperrten Tiere unschuldig. Mittags hatten sie in einem Restaurant gegessen, wo Andy sich Nudeln mit Tomatensoße bestellt hatte, die nicht besonders geschmeckt hatten. Am Nachmittag war der Mann mit ihm ins Kino gegangen. Er hatte sich dafür extra von der Arbeit freigenommen, deshalb hatte Andy nicht nein sagen können. Sie hatten einen blödsinnigen Animationsfilm gesehen, bei dem alle im Kino bis auf Andy dauernd laut gelacht hatten, ohne dass er verstanden hätte, warum. Von dem aufdringlichen Aftershave des Mannes hatte er Kopfschmerzen bekommen.
Danach hatten sie den Geburtstagskuchen gegessen, immerhin Schokoladentorte, und dann hatte sich Andy endlich wieder mit seinen Freunden in der virtuellen Welt treffen können. Doch nun war es damit schon wieder vorbei, und das, obwohl er sein Tageslimit von vier Stunden Onlinespielen gerade mal um dreiundfünfzig Minuten überzogen hatte. An seinem Geburtstag!
Er sah auf die Uhr. Kurz vor zehn. Er war noch überhaupt nicht müde.
Sein Blick fiel auf die Ladestation des Mirrors. Die LED leuchtete grün. Er hatte zwar keine große Lust, sich mit dem Gerät zu beschäftigen, aber er konnte es ja probehalber mal einschalten.
Vorsichtig entfernte er die Schutzfolie vom Bildschirm des MirrorBrains und drückte den Einschaltknopf. Ein Glockenton erklang, und das sich um die eigene Achse drehende Innere einer Walnuss erschien. Ein Ladebalken füllte sich langsam. Dann erklang eine Frauenstimme: »Bitte sage deinen Namen.«
»Andy Willert.«
Ein Ladebalken erschien, der sich langsam füllte.
»Andy Willert«, erklang es aus dem Lautsprecher. »Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich bin dein Mirror.« Die Stimme war jetzt anders, wirkte seltsam vertraut und doch fremd – ungefähr so wie seine eigene Stimme, wenn er sich in einem Video reden hörte. »Jetzt mache bitte ein Selfie von dir.«
Auf dem Bildschirm war nun das Bild der Frontkamera zu sehen. Andy drehte das Gerät so, dass sein Gesicht erschien, und drückte den Auslöser.
Das Bild verschwand, und erneut erschien ein Ladebalken.
Dann plötzlich war Andy selbst auf dem Bildschirm zu sehen. Doch es war nicht das Bild der Frontkamera, sondern eine animierte 3-D-Figur, die ihm verblüffend ähnelte: die krausen blonden Haare, die schwarze Brille, die schmale Nase, sogar das Muttermal am Kinn.
»Hallo, Andy«, sagte das Gesicht. »Ich bin sicher, wir werden gute Freunde werden. Denn du weißt ja: Dein bester Freund bist du selbst.«
Andy starrte mit einer Mischung von Faszination und Abscheu auf sein virtuelles Ebenbild. Er wischte mit dem Finger über den Touchscreen und drehte damit die 3-D-Figur, so dass er sich von der Seite und von hinten betrachten konnte. Das musste man Walnut Systems lassen: Die Technik, mit der sie sein Gesicht scannten und daraus ein virtuelles Abbild schufen, war wirklich verblüffend.
»Bist du mit deinem Ebenbild zufrieden?«, fragte der Mirror.
»Ja«, sagte Andy.
»Falls du es später ändern willst, sage es mir einfach. Aber nun lege bitte das mitgelieferte MirrorSense-Armband um und setze den MirrorClip in dein Ohr.«
Andy tat beides. Auf dem Armband erschien eine Leuchtschrift: Connected. Als er den Clip hinter sein linkes Ohr klemmte, konnte er die Stimme des Mirrors hören: »Sehr gut. Nun biege bitte den Draht an deinem Clip nach vorn, so dass die Spitze ungefähr neben deinem Auge ist. Du kannst ihn mit der mitgelieferten Plastikklemme an deinem Brillengestell befestigen.«
Es war ein bisschen unheimlich, Anweisungen von einer Maschine zu bekommen, die so klang wie Andy selbst. Auf dem Bildschirm erschien nun das Kamerabild. Es war kreisförmig und verzerrt, denn die Kamera hatte ein sehr weites Blickfeld. Er sah seine eigene Nase rechts in das Bild hereinragen, während links sein Ohr das Blickfeld begrenzte.
»Ich kalibriere nun MirrorSense und MirrorClip«, sagte der Mirror. »Das dauert nur einen Moment.« Eine einfache, sich wiederholende Melodie erklang – das akustische Pendant eines Ladebalkens.
»Ich habe die Kalibrierung jetzt abgeschlossen. Nun möchte ich dich gern näher kennenlernen. Sage mir bitte deinen Facebook-Benutzernamen.«
Nachdem Andy ihm Benutzernamen und Passwort seiner verschiedenen Social-Media-Accounts inklusive seines Spieleraccounts in World of Wizardry genannt hatte, sagte die Maschine: »Vielen Dank. Ich brauche nun etwas Zeit, um all die neuen Informationen zu verarbeiten. Es ist schon spät. Bitte lege mein MirrorBrain auf die Ladestation und behalte dein MirrorSense-Armband am Handgelenk. Gute Nacht, Andy!«
»Gute Nacht!«, sagte Andy, legte das Gerät auf die Station und ging schlafen.
011000101100104.10010111010100
Lukas betrachtete das frische Tattoo auf seinem Oberarm im Spiegel. Er konnte die Buchstaben in Spiegelschrift nicht lesen, aber er wusste ja, was sie bedeuteten: Ellen, der Name seiner Freundin, geschrieben auf ein Herz, das ein Adler in den Klauen hielt. Das Tattoo war noch ganz rot, wund und aufgequollen, und es tat ziemlich weh. Doch das machte ihm nichts aus, im Gegenteil. Er war stolz auf den Schmerz. Irgendwie war das Gefühl richtig geil.
Er konnte es nicht abwarten, es ihr zu zeigen. In letzter Zeit hatten sie sich öfter gestritten, und beim letzten Mal hatte er sie eine blöde Schlampe genannt. Das tat ihm jetzt leid. Er liebte sie doch, ihre langen blondierten Haare, ihre vollen, knallrot geschminkten Lippen, ihre Titten, die sich fest anfühlten wie prallgefüllte Luftballons, ihren knackigen Arsch. Er war nicht so gut mit Worten, deshalb musste er ihr seine Liebe eben anders zeigen: indem er ihren Namen für immer in seine Haut einbrannte, die Schmerzen ertrug, nur für sie. Er war sich sicher, dass er sie damit beeindrucken werde. Zum Dank würde sie ihn küssen, und er würde sie ganz fest an sich drücken und ihr die Kleider vom Leib reißen und sie richtig durchvögeln, bis sie seinen Namen in höchsten Tönen schrie. Und dann, wenn sie gekommen war, würde er sie fragen, ob er nicht endlich bei ihr einziehen konnte.
Stolz spannte er seine Muskeln an. Das tat noch mehr weh, aber es war trotzdem ein gutes Gefühl. Schmerz, der stark machte. Manchmal, wenn sein Vater im Alkoholrausch auf ihn eingeprügelt hatte, war Lukas sich wie ein Stück glühend heißer Stahl vorgekommen, auf den ein Hammer eindrosch. Die Schläge hatten ihn härter gemacht. Stärker. Unzerbrechlich. Dann waren die Schmerzen etwas erträglicher gewesen.
Er roch an seinem T-Shirt: Es ging noch. Er streifte es über, sprühte etwas Deo darauf, zog die Lederjacke an und verließ die Wohnung.
Ellen wohnte nur ein paar Straßen weiter. Sie trafen sich immer nur bei ihr, denn Ellen wohnte allein und mochte Lukas’ Mitbewohner Piotr nicht. Sie arbeitete als Bürohilfe in einer Versicherungsagentur und verdiente ein richtiges Gehalt, anders als Lukas, der von Hartz IV leben musste, seit er bei seinem Lehrbetrieb, einer Klempnerei in Wandsbek, wegen einer Schlägerei rausgeflogen war. In letzter Zeit hatte Ellen häufig Überstunden machen müssen, deshalb hatten sie vereinbart, dass sie ihn anrief, wenn sie zu Hause war und er vorbeikommen konnte. Doch heute würde er sie überraschen. Wenn sie noch nicht von der Arbeit zurück war, würde er einfach vor ihrer Wohnung warten. Wenn sie dann kam, würde er wortlos seine Lederjacke ausziehen und ihr das Tattoo zeigen. Dann würde sie große Augen machen!
Kalte Regentropfen liefen ihm in den Kragen, als er die Straße in Hamburg-Billstedt entlanglief, zwischen grauen Wohnblocks hindurch. Es machte ihm nichts aus. Seine Schritte waren federnd, voller Kraft und Energie. Er fühlte sich wunderbar stark. Stark wie Stahl. Eisenhart. Unzerbrechlich. Vor Vorfreude beulte sich bereits seine Hose aus, als er daran dachte, was gleich passieren würde.
Er überlegte, ob er ihr Blumen mitbringen sollte. Frauen standen ja auf so was. Aber eigentlich, fand er, war das Tattoo Geschenk genug. Außerdem hatte es eine Menge gekostet, obwohl Tarik ihm einen Sonderpreis gemacht hatte, und er war wie immer ziemlich knapp bei Kasse.
Endlich stand er vor ihrer Wohnungstür und klingelte. Hörte er da Stimmen im Inneren? Nein, er musste sich getäuscht haben. Er wartete einen Moment, dann klingelte er noch mal.
Jetzt waren Schritte zu hören. Die Tür öffnete sich. Ellens Haare waren ganz zerzaust.
»Lukas! Du, wir hatten doch vereinbart, dass ich dich anrufe!«
Ihr Tonfall verunsicherte ihn. War sie immer noch sauer wegen neulich?
»Guck mal!«, sagte er und zog seine Lederjacke aus. Er sog scharf die Luft ein, als das Innenfutter über die wunden Stellen rieb.
»Was soll das denn?«, fragte Ellen.
»Für dich!«, sagte er irritiert.
»Spinnst du jetzt, oder was? Kannst du mich nicht vorher fragen, bevor du so was machen lässt?«
»Was? Ich … ich dachte, du freust dich!«
»Lukas, du sollst nicht so viel denken, das liegt dir nicht so.«
Allmählich wurde ihm bewusst, dass er einen Fehler gemacht hatte. Wieder mal. Er verstand bloß nicht, warum.
»Magst du es nicht? Findest du, Tarik hat den Adler nicht richtig hingekriegt?«
Ihre Stimme wurde sanft. »Das ist es nicht. Aber …«
»Aber was?«
»Lukas, das ist ja irgendwie süß, und du weißt, dass ich dich wirklich mag. Aber ein Tattoo mit meinem Namen, das ist mir einfach zu viel.«
»Zu viel? Wieso zu viel? Tarik hat mir einen Sonderpreis gemacht. Und ich kann es abstottern.«
Sie seufzte. »Du begreifst wirklich gar nichts.«
»Was begreife ich nicht?«
»Wer ist denn das?«, drang eine Männerstimme nach draußen. »Doch nicht etwa der Trottel, von dem du mir erzählt hast?«
Lukas wurde eiskalt. Plötzlich schmerzte das Tattoo genau wie in dem Moment, als Tarik die Nadel wieder und wieder und wieder in die Haut gestochen hatte.
»Es ist besser, du gehst jetzt!«, sagte Ellen.
Wortlos schob Lukas sie zur Seite und drängte in die Wohnung.
Ein Mann stand in der Schlafzimmertür. Er war mindestens fünfzehn Jahre älter als Lukas und hatte kaum noch Haare. Er trug nur karierte Boxershorts.
Lukas spürte einen Druck in seinem Kopf, ein dumpfes Pochen. Er ballte die Fäuste und ging langsam auf den Wichser zu, der es gewagt hatte, sich an seiner Freundin zu vergreifen.
»Lukas, nicht!«, rief Ellen.
»Passen Sie auf, was Sie tun!«, sagte der Wichser. »Ich habe einen Mirror!« Er wies auf ein Ding in seinem Ohr, das aussah wie ein Hörgerät.
Sollte das etwa bedeuten, dass man ihn deswegen nicht schlagen durfte? Weil er behindert war, oder was? Wieso trieb es Ellen mit einem Behinderten? Plötzlich verließ ihn alle Kraft, wie Luft, die aus einem geplatzten Luftballon entwich. Er fühlte sich bleischwer.
»Lukas, du musst das verstehen!«, sagte Ellen. »Ich hab dich wirklich gern, aber … aber das mit uns, das hat einfach keine Zukunft.«
Er sah sie an, verstand kein Wort, so als hätte sie Türkisch gequatscht. »Wieso?«, fragte er.
»Du und ich, wir … wir passen einfach nicht zusammen.«
»Wir passen nicht zusammen?« Immer noch begriff er kein Wort.
»Hören Sie, es wäre wirklich gut, wenn Sie jetzt gehen würden«, sagte der Wichser.
Lukas fuhr herum. »Was hast du gesagt?«
Der Mann wich zurück. Seine Augen waren aufgerissen. Er hatte Angst. Der Wichser hatte Angst! Plötzlich fühlte sich Lukas stark. Dieser erbärmliche Wicht mit dem Hörgerät glaubte wirklich, ihm die Freundin ausspannen zu können? Der würde sich wundern!
»Pass mal auf, du behinderter Wichser!«, schrie er und hob eine Faust. »Wenn einer sich hier verpisst, dann bist du das, und zwar ein bisschen plötzlich, oder ich hau dir eins in die Fresse, dass dir dein Hörgerät aus dem Ohr fliegt!«
»Mirror, ruf die Polizei!«, sagte der Wichser.
»Was?«, fragte Lukas. »Was hast du gesagt, du Wichser?«
»Lukas!«, rief Ellen. »Bitte geh jetzt!«
»Erst wenn dieses Arschloch aus deiner Wohnung verschwunden ist!«
»Sie haben es gehört!«, sagte der Wichser. »Die Bewohnerin dieser Wohnung möchte, dass Sie augenblicklich gehen. Entweder, Sie leisten dem Folge, oder ich werde dafür sorgen, dass Sie wegen Hausfriedensbruchs angezeigt werden. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass alles, was sie hier tun, aufgezeichnet wird und später vor Gericht gegen sie verwendet werden kann.«
»Was?«
»Wissen Sie überhaupt, was das hier ist?« Der Wichser zeigte auf das Hörgerät.
»Ein Hörgerät«, sagte Lukas.
Der Wichser lachte hässlich. »Oh Mann, der ist ja wirklich so blöd, wie du erzählt hast, Ellen!«
Jetzt reichte es! Mit einem urtümlichen Wutschrei holte Lukas zum Schlag aus. Doch der Wichser machte einen Satz zurück und knallte blitzschnell die Schlafzimmertür zu, so dass Lukas’ Faust in das Holz krachte. Er versuchte, die Klinke hinunterzudrücken, aber es ging nicht. Ellen schrie irgendwas, aber er hörte nicht zu. Besinnungslos vor Wut machte er zwei Schritte zurück, nahm Anlauf und rammte die Schulter gegen die Tür.
Es war, als stoße jemand einen glühenden Dolch in seinen Oberarm. Er schrie auf. In seiner Raserei hatte er das frische Tattoo vergessen. Halb vor Schmerz, halb aus Frust trat er mit dem Stiefel gegen die Tür, doch das bewirkte nicht das Geringste. Die Hand auf die pochende Wunde gepresst, drehte er sich um.
Ellen starrte ihn mit großen Augen an. »Es … es tut mir leid!«, sagte sie. »Ich wollte nicht, dass du es auf diese Weise erfährst!«
Einen Moment lang verspürte er große Lust, ihr die Fresse zu polieren. Die dreckige Hure hatte es weiß Gott verdient! Er hatte sich extra ein Tattoo für sie machen lassen, und sie hatte in der Zwischenzeit einen Behinderten gevögelt! Doch er vergriff sich nicht an Frauen. Niemals. Er wollte nicht so werden wie sein Vater.
»Ich … ich bin dir zu blöd, oder?«, fragte er.
Sie sagte nichts.
Ihm wurde plötzlich übel, so dass er sich zusammennehmen musste, um sich nicht vor ihren Füßen zu übergeben. Schwindel befiel ihn. Das Tattoo brannte wie Feuer.
Er wandte sich ab und verließ die Wohnung. Als er aus dem Haus trat, hielt vor ihm ein Peterwagen mit Blaulicht. Zwei Beamte sprangen aus dem Wagen. Der eine von beiden warf ihm einen kurzen Blick zu, doch sie beachteten ihn nicht weiter, sondern rannten ins Haus.
Langsam schleppte er sich durch den Regen nach Hause wie ein geprügelter Hund.
011000101100105.10010111010100
Ein sanfter, heller Glockenton weckte Andy. Er schlug die Augen auf. Der Wecker auf seinem Nachtschrank zeigte sechs Uhr zwölf – siebenundvierzig Minuten vor der eingestellten Weckzeit.
»Guten Morgen, Andy!«, sagte seine eigene Stimme. Sie kam von dem MirrorBrain, das neben dem Wecker auf seiner Ladestation lag.
Andy setzte seine Brille auf, nahm das Gerät in die Hand und betrachtete das Gesicht auf dem Display – sein Gesicht, das ihn aufmunternd anlächelte.
»Warum hast du mich geweckt?«, fragte er.
»Du hast acht Stunden und sieben Minuten geschlafen. Außerdem befandst du dich nicht in einer REM-Tiefschlafphase. Es war ein guter Zeitpunkt, um dich zu wecken.«
»Mein Wecker ist auf 6.59 eingestellt. Ich brauche meinen Schlaf!«
»Die optimale Schlafdauer beträgt individuell unterschiedlich zwischen sieben und neun Stunden.«
»Normalerweise vielleicht. Aber ich bin anders als andere.« Andy rechnete nicht damit, dass der Mirror diese Aussage verstand, aber es ärgerte ihn, dass das Gerät in sein Leben eingriff, ohne dass er ihm die Anweisung dazu gegeben hatte.
»Das Asperger-Syndrom beeinflusst das individuelle Schlafbedürfnis nicht wesentlich«, gab der Mirror zur Antwort.
Nun war Andy hellwach. »Woher weißt du das?«
»Ich verstehe die Frage nicht.«
Er war fast erleichtert über diese Antwort. »Woher weißt du, dass ich das Asperger-Syndrom habe?«, präzisierte er.
»Deine Kommentare und Mitteilungen in sozialen Netzwerken lassen den Rückschluss zu, dass du an einer milden Form von Autismus leidest.«
»Ich leide nicht daran!«, sagte Andy. »Asperger ist keine Krankheit, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal!«
»Viele Menschen mit Asperger empfinden dies als eine Belastung. Sie haben das Gefühl, auf dem falschen Planeten zu leben.«
Andy starrte das Gerät verblüfft an. So gut hatte noch nie jemand beschrieben, wie er sich fühlte: Wie ein Mensch unter lauter Aliens.
»Wie viele Mirror-Besitzer haben noch Asperger?«, fragte er.
»Asperger tritt bei etwa 0,2 bis 0,3 Prozent der Menschen auf.«
Das war nicht die Antwort auf seine Frage, aber man konnte wohl davon ausgehen, dass Asperger bei Mirror-Besitzern ebenso häufig war wie im Rest der Bevölkerung. Bei hundert Millionen Mirror-Käufern waren das mindestens zweihunderttausend weltweit. Zweihunderttausend Menschen, die waren wie er selbst! Andy wusste, dass die Mirrors all dieser Aspies über das MirrorNet miteinander verbunden waren. Sein eigener Mirror lernte nicht nur aus dem, was Andy tat, sondern auch aus dem Verhalten der anderen. Plötzlich sah er das Gerät mit ganz anderen Augen. Er war nicht mehr allein! Er war nicht mehr hilflos dem Unverständnis des Mannes und Mamas Mitleid ausgeliefert. Er konnte mit anderen in Kontakt treten. Mehr noch, er konnte seinen Mirror nutzen, um sich auf dem »falschen Planeten«, wie das Gerät es genannt hatte, besser zurechtzufinden.
»Kannst du die Gesichtsausdrücke anderer Menschen deuten?«, fragte er.
»Walnut Systems hat speziell für Menschen mit Autismus eine Funktion entwickelt, die MirrorExpressions genannt wird. Sie blendet dir verbale Interpretationen der Gesichtsausdrücke anderer Menschen in das Display deiner optionalen MirrorGlass-Brille ein. Wenn du keine MirrorGlass-Brille besitzt, kann ich dir einfach sagen, was die Gesichtsausdrücke anderer Menschen bedeuten. Du musst nur auf dein MirrorSense-Armband tippen, wenn du jemanden ansiehst.«
»Gut!«, sagte Andy und sprang aus dem Bett.
Zwanzig Minuten später ging er frisch geduscht und fertig angezogen in die Küche. Der Mirror steckte in der mitgelieferten diebstahlsicheren Gürteltasche, der MirrorClip in seinem Ohr, die Kamera war am Brillenbügel angebracht. Der Mann und Mama saßen beim Frühstück.
»Überrascht«, erklang es aus dem kleinen Ohrhörer, als der Mann von seiner altmodischen Papierzeitung aufblickte und Andy kurz auf sein Armband tippte. »Besorgt«, war der Kommentar des Mirrors beim Anblick seiner Mutter. Das hätte er sich denken können – Mama war fast immer besorgt, wenn sie ihn sah.
»Was ist mit dir?«, fragte Mama. »Geht es dir nicht gut?«
»Mir geht es sehr gut«, sagte Andy.
»Warum bist du dann schon auf?«
»Ich habe lange genug geschlafen.«
»Wie schön, dass du zu dieser Erkenntnis gelangt bist«, sagte der Mann.
»Sarkasmus«, warnte der Mirror.
»Setz dich doch zu uns«, sagte Mama. »Ich mache dir einen Tee.«
»Sag mal, hast du da etwa eine Kamera an deiner Brille?«, fragte der Mann.
»Misstrauen«, deutete der Mirror seinen Gesichtsausdruck.
»Ihr wolltet doch, dass ich euer Geschenk ausprobiere!«, erwiderte Andy. »Die Kamera gehört dazu, sonst funktioniert es nicht.«
»Mach das Ding sofort aus!«, befahl der Mann.
»Zorn«, kommentierte der Mirror.
»Lass ihn doch, Rudolf!«, meinte Mama.
»Er kann gern in seinem Zimmer mit seinem Gerät herumspielen, oder draußen. Aber nicht hier am Küchentisch!«
»Zorn.«
»Immer musst du an allem herummeckern, was Andreas macht!«
»Zorn.«
»Und du nimmst ihn immer in Schutz, egal, was er macht! Für dich ist der Junge heilig! Dabei ist er …« Er beendete den Satz nicht.
Andy tippte erneut auf das MirrorSense-Armband.
»Verachtung«, gab sein Mirror zurück.
»Du verachtest mich!«, sagte Andy.
Der Mann starrte ihn an. »Was? Nein, Junge! Das siehst du ganz falsch! Ich verachte dich nicht!«
»Besorgnis. Er lügt.«
»Du lügst!«, sagte Andy.
»Andreas!«, rief Mama. »Wie kannst du so etwas sagen!«
»Besorgnis.«
»Ich kann es sagen, weil es stimmt. Mein Mirror hat es mir gesagt. Er kann eure Gesichter lesen.«
»Dein Mirror?«, fragte Mama.
»Verwunderung«, sagte der Mirror.
»Das ist ja wohl die Höhe!«, rief der Mann. »Mach sofort das Ding aus, oder ich nehme es dir weg!«
»Zorn.«
»Das darfst du nicht!«, sagte Andy. »Der Mirror gehört mir! Niemand darf ihn mir wegnehmen!«
»Dann verschwinde sofort aus der Küche!«
»Wie kannst du es wagen, meinen Sohn aus meiner Küche zu schicken!«, sagte Mama. Ihre Stimme zitterte ganz komisch.
»Zorn«, erklärte der Mirror, als Andy reflexartig auf das Armband tippte.
»Wenn das so ist, dann gehe wohl besser ich!«, sagte der Mann, warf die Zeitung auf den Tisch und ging aus dem Raum. Die Tür krachte hinter ihm zu.
Mama weinte.
Andy wusste nicht, was er machen sollte.
»Sag ihr, dass es dir leidtut«, sagte der Mirror zu ihm.
»Was? Aber …«, gab Andy zurück.
Mama sah ihn an. »Was?«
»Verwunderung«, sagte der Mirror. »Sag ihr, dass es dir leidtut.«
»Es tut mir leid, Mama«, sagte Andy.
Ihr Mund wurde breit. »Schon gut, mein Junge! Du hast nichts falsch gemacht. Rudolf hat momentan Stress im Job. Er meint es nicht so. Nun setz dich erst mal hin und frühstücke!«
»Erleichterung«, sagte der Mirror.
011000101100106.10010111010100
Tschernobyl: Hochmut.
Es war Freya Harmsens Angewohnheit, jeden Ort, den sie bereiste, mit einem einzigen Wort zu charakterisieren. Das Wesentliche auf den Punkt zu bringen war ihre Aufgabe als Journalistin und Fotografin. Einen Ort, eine Situation in einem einzigen Bild oder einem kurzen Satz treffend festzuhalten war eine Kunst, die sie auch nach zehn Jahren Berufserfahrung längst noch nicht perfekt beherrschte.
Sie stand auf einem großen Platz, der einmal als Parkplatz für die Beschäftigten des Kernkraftwerks gedient haben mochte. Vor ihr ragte der gigantische Betonblock auf, in dessen Innerem die Trümmer von Block vier des Kernkraftwerks verschlossen waren. Sie warf einen nervösen Blick auf ihre Führerin, eine junge Ukrainerin namens Maria Jelenowa, die einen Geigerzähler in der Hand hielt. Das Gerät zeigte 0,7 Milliröntgen pro Stunde an, immerhin etwa das Zwanzigfache der natürlichen Strahlung. Kein wirklich beängstigender Wert, aber genug, um bei Freya das Gefühl des Unwohlseins und der Beklemmung zu verstärken, das sie befallen hatte, seit sie in der Sperrzone waren.
Maria lächelte beruhigend. »Kein Problem«, sagte sie auf Englisch. »Der größte Teil der Strahlung wird durch den Betonmantel blockiert. Hier haben noch viele Jahre lang Tausende Menschen gearbeitet. Der letzte Reaktorblock ist erst im Jahr 2000 außer Betrieb gegangen, vierzehn Jahre nach der Katastrophe. Wenn man nicht allzu lange hierbleibt, passiert einem nichts.«
Freya strich sich eine Locke ihres kaum zu bändigenden roten Haarschopfs aus dem Gesicht und machte ein paar Fotos, indem sie leicht gegen den Bügel ihrer MirrorGlass-Brille tippte. Sie hatte sich erst vor kurzem einen Mirror gekauft, nachdem ihn ihr ein befreundeter Journalist empfohlen hatte. Die Bilder der Brillenkamera und der Drohne seien exzellent und der Mirror sei außerordentlich einfach zu bedienen. Bisher hatte sich diese Einschätzung als richtig erwiesen. Auch die übrigen Funktionen, von der Terminorganisation bis zur Einkaufsberatung und dem digitalen Bezahlen, hatte Freya schätzen gelernt, obwohl sie das Gefühl hatte, bei weitem noch nicht alle Möglichkeiten des Geräts auszunutzen. Verblüfft hatte sie das Gerät gestern am Flughafen von Kiew, als sie ein ukrainischer Sicherheitsbeamter auf Russisch angesprochen hatte und der Mirror ungefragt die Übersetzung des Textes in das Sichtfeld ihrer Brille eingeblendet hatte: »Sie müssen die Kamerabrille ausschalten!«
»Kommen Sie«, sagte Maria. »Die Kraftwerksruine ist doch langweilig. Ich zeige Ihnen die wirklich interessanten Plätze.«
Sie stiegen in den Mietwagen, einen VW Golf, den sie in Kiew gemietet hatte. Sie holperten über leere Straßen, deren Asphalt aufgeplatzt war. Einmal mussten sie einen Baum umfahren, der mitten auf der Straße aus einem fast kreisrunden Loch emporgewachsen war. Freya stoppte den Wagen und machte ein Foto davon.
Nach ein paar Kilometern wies ein Schild in kyrillischer Schrift darauf hin, dass sie die Grenze einer Stadt erreicht hatten. »Pripjat«, sagte Maria.
Es war das eigentliche Ziel ihrer Reise in diese tote Gegend. Freya war als freie Journalistin von der Londoner Zeitung Sunday Times beauftragt worden, eine Reportage über Tschernobyl dreißig Jahre nach der Katastrophe zu machen. Sie hatte den Auftrag gern angenommen, auch wenn sie die Vorstellung, in das radioaktiv verstrahlte Gebiet zu reisen, von Anfang an mit Unbehagen erfüllt hatte. Wenigstens konnte sie so einen gutbezahlten Job mit ihrem privaten Interesse verbinden. Denn sie arbeitete insgeheim an einem eigenen Projekt, für das hier sicher ein paar schöne Bilder abfallen würden.
»Die Schönheit der Zerstörung« war der gedachte Titel eines Bildbandes, für den Freya bereits seit einigen Monaten Material sammelte. Es sollte ihr Versuch werden, sich international einen Namen als Fotografin zu machen. Ihre Idee war es, die Umweltzerstörung durch den Menschen zu dokumentieren – doch nicht mit den üblichen, grauenerregend hässlichen Bildern von qualmenden Schloten, verpesteten Flüssen, industrieller Ödnis oder an Ölvergiftung verendenden Seevögeln. Stattdessen wollte sie die schöne Seite der Zerstörung zeigen: das farbenprächtige Schillern von Ölflecken auf Wasser, die Eleganz der glänzenden Metallrohre einer Raffinerie, die Schönheit der vom Smog in die Länge gezogenen Sonnenuntergänge über asiatischen Metropolen, die dekadente Pracht vor sich hin rostender Tankerwracks. Selbst in den gelben Qualmwolken, die sich aus den Schloten der Chemiefabriken erhoben, ließ sich Schönheit finden.
Es war eine trügerische Schönheit, die, so hoffte Freya, beim Betrachter eine Mischung aus Faszination und Grusel hervorrufen würde. Statt sich voller Ekel abzuwenden, würden die Leser ihre Bilder immer wieder sehen wollen – und sich damit der subtilen Botschaft der Umweltzerstörung eher öffnen. Das jedenfalls war ihre Idee. Ob sie funktionierte, würde sie erst wissen, wenn sie einen Verlag für ihr Werk gefunden hatte. Bisher hatte sie mit ihrem Exposé und den beigefügten Beispielbildern nur mehr oder weniger freundliche Absagen kassiert.
Sie fuhren durch leere Straßen, zwischen Wohnhäusern hindurch, die seltsam normal wirkten. Auf einem Platz in der Mitte der Stadt bedeutete ihr Maria anzuhalten. Sie stiegen aus und sahen sich um.
Pripjat: Stille.
Freyas Nackenhaare stellten sich auf. Nichts war zu hören, kein Verkehrslärm, kein Vogelgezwitscher, nicht einmal das Rauschen des Windes. Sie scharrte unbewusst mit einem Fuß, um sich zu vergewissern, dass sie nicht taub geworden war. Die Lautlosigkeit löste in ihr eine Beklemmung aus, die mit Worten kaum zu beschreiben war.
Die Gebäude wirkten unversehrt, so als könne sich jeden Moment eine Balkontür öffnen und eine Frau mit einem Wäschekorb heraustreten, um in der strahlenden Nachmittagssonne ihre Wäsche aufzuhängen.
»Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich die Geister der Menschen spüren kann, die hier lebten«, sagte Maria in die Stille hinein.
Freya nickte. An diesem Ort fiel es nicht schwer, an Gespenster zu glauben.
Eine Bewegung, die sie aus dem Augenwinkel wahrnahm, ließ sie herumfahren. »Was war das?«
Maria folgte ihrem Blick. »Was denn?«
Freya wies auf ein schmuckloses Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes. Die Tür stand offen. »Dort drüben. Da war jemand. Glaube ich.«
Langsam gingen sie auf das Haus zu. Der Flur hinter dem Eingang lag in tiefem Schatten. Als sie noch etwa zwanzig Meter entfernt waren, war plötzlich deutlich eine Bewegung zu erkennen. Dann stürmte jemand – etwas – aus dem Gebäude. Freya machte mehrere Bilder mit der Brillenkamera.
Ein Reh. Es floh die Straße entlang, bis es hinter einer Häuserecke verschwunden war.
Maria lachte. »Scheint so, als hätte die Stadt doch noch ein paar lebendige Einwohner.«
Freya sagte nichts. Sie fand die Begegnung verstörend. Die Geisterstadt erschien ihr plötzlich wie ein unheilvolles Vorzeichen einer zukünftigen Welt ohne Menschen. Die Natur würde den Planeten innerhalb kürzester Zeit zurückerobern.
»Ich nenne diese Gegend ›Das Reich der Wölfe‹«, sagte Maria. »Von denen gibt es hier Tausende. Nachts kann man sie heulen hören, und dann ist es hier noch ein ganzes Stück gruseliger. So verrückt es klingt: Die Katastrophe von 1986 hat aus dieser Gegend ein riesiges Naturschutzgebiet gemacht. Die Radioaktivität scheint den Tieren nicht viel auszumachen – aber vielleicht leben sie einfach nicht lange genug, um die schädlichen Auswirkungen zu spüren. Andererseits habe ich Geschichten von Kälbern mit vier Hörnern oder Säuglingen mit zusammengewachsenen Beinen gehört, die nach der Katastrophe geboren worden sein sollen. Vielleicht sind das auch nur die üblichen Horrorgeschichten. Ich bin keine Biologin.«
Sie betraten das Gebäude. Es roch nach Schimmel und Moder. Eine Betontreppe führte nach oben. An der Rückwand war eine der großen Fensterscheiben gesprungen, so dass es hereingeregnet hatte. In dem aufgeplatzten Linoleumfußboden davor hatten sich Gräser und ein paar niedrige Sträucher ausgebreitet.
Links vom Eingang befand sich ein großer Raum, der einmal ein Restaurant gewesen sein mochte. Dafür sprach die große Zahl von Tischen und Stühlen, die noch dort standen. Eine Tür auf der gegenüberliegenden Seite führte in eine Küche. Die Elektrogeräte waren vor langer Zeit entfernt worden, ebenso alle Küchenutensilien. Nur ein rostiges Messer lag noch auf einer staubigen Arbeitsfläche.
Hinter der Küche befanden sich eine leere Kühlkammer, in der immer noch der Geruch modrigen Fleisches hing, ein Vorratsraum und eine große Abstellkammer. Zwischen halbverrottetem Gerümpel standen mehrere große, auf Holzrahmen aufgezogene Farbdrucke: Fotos von Michail Gorbatschow, das fleckige Muttermal auf seiner Stirn wegretuschiert, und weiteren Parteifunktionären, die Freya nicht erkannte. Daneben rote Spruchtafeln und Banner.
»Die waren sicher für die Feierlichkeiten zum 1. Mai gedacht«, kommentierte Maria.