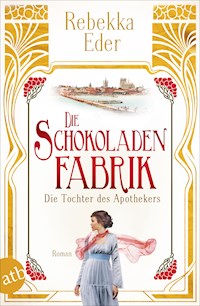9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Himmlisch duftender Zimt, ein altes Geheimnis und eine Prise Romantik HAMBURG, 1812: Die junge Josephine führt mit ihrem Onkel eine kleine Bäckerei. Doch die französische Besetzung der Stadt stellt die beiden vor die Herausforderung, genug Zutaten zu beschaffen. Als ihr Onkel aufgeben will, überredet Josephine ihn, Thielemanns Backhus allein weiterführen zu dürfen. Er hat nur eine Bedingung: Sie soll endlich heiraten – ausgerechnet den Postboten Christian Schulte, der überraschend wenig Mitgefühl für die Nöte der Hamburger Bevölkerung zeigt. Gleichzeitig wird ihr der Soldat Pépin Sabatier, der in der Backstube ein und aus geht und stets von den Köstlichkeiten Frankreichs schwärmt, immer sympathischer. Besonders der Duft von Zimt hat es ihm angetan – genau wie Josephine. Zusammen mit Pépin kommt sie nicht nur einem alten Familiengeheimnis auf die Spur, sondern erfindet auch ein Gebäck, das Thielemanns Backhus retten könnte … Ein zauberhafter Roman über das wohl beliebteste Hamburger Gebäck: das Franzbrötchen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 606
Ähnliche
Rebekka Eder
Der Duft von Zimt
Historischer Roman
Vita
REBEKKA EDER ist ein Pseudonym. Die Autorin wurde 1988 in Kassel geboren und hat Theaterwissenschaft und Germanistik in Erlangen, Bern und Berlin studiert. Schon während des Studiums begann sie, Romane zu schreiben. Nach Stationen als Journalistin und Werbetexterin machte sie ihre Leidenschaft zum Beruf. Heute schreibt und lebt sie auf dem nordhessischen Land. Sie ist fasziniert von geschichtsträchtigen Orten, alten Fotografien und Geheimnissen – und hat eine große Schwäche für Zucker und Zimt.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Karte © Peter Palm, Berlin
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Richard Jenkins; Ullstein Bild; iStock
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-01235-6
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Für Papa, der meine Bücher stets verschlingt, als wären sie ofenwarme Franzbrötchen.
Prolog
Beim Backen vergaß Fritz Thielemann die Zeit. Dann flutschten ihm die Minuten, die Stunden, die Jahre wie flüssiges Eiweiß durch die Finger. Er mochte diesen Zustand. Nicht umsonst arbeitete er seit vierzig Jahren voller Leidenschaft in Thielemanns Backhus mitten in der Hamburger Altstadt. Zwar war die Backstube so winzig klein, dass man sie in nur drei Schritten durchmessen konnte. Doch er liebte die dicht an dicht stehenden deckenhohen Holzregale an der langen Seite, die rotbraune Glasvitrine in der Ecke, den nussbraunen Tresen in der Mitte mit seinen zahlreichen Schubladen – liebte jeden Butterfleck und jeden Krümel! Und er war stolz darauf, dass seine Kunden ihn für die knusprigsten Rundstücke und die erlesensten Geduldzettel der Stadt rühmten.
Dafür stand er stets mitten in der Nacht auf, auch wenn ihn das zunehmend Überwindung kostete, seit er keine fünfzig mehr war. Doch mit jedem Moment, den er in seiner Backstube knetete, rührte und formte, während sich das Mehl in seinem weißen Haar und seinen unzähligen Lachfalten verfing, vergaß er eines seiner Jahre. Am frühen Morgen, sobald die ersten Kunden hereinspazierten, glaubte er, wieder zwanzig zu sein. Dann warf er sich das Haar verwegen aus der Stirn und lächelte die Damen schelmisch an. Dass er dabei zusätzlich zu seinen Geheimratsecken auch vier Zahnlücken entblößte, kümmerte ihn nicht besonders. Fritz nahm sich weder ernst noch allzu wichtig. Doch seine Geduldzettel, die waren beides. Das hatte ihm schon sein Vater beigebracht, der es einst von dessen Vater gelernt hatte. Es war eine uralte, über viele Generationen überlieferte Backkunst, diese Plätzchen herzustellen:
Wie seine Vorfahren pflegte Fritz in dem kleinen Garten hinter der Bäckerei einen Rosenstrauch. Im Sommer pflückte er die Blütenblätter und legte sie in Wasser ein, um Rosenwasser herzustellen. Das ganze Jahr hindurch verquirlte er am frühen Morgen ein paar Löffel davon mit vier Eiern, goss die Mischung durch ein Sieb, vermengte sie erst mit Zucker und dann mit Mehl, bis der Teig so dick wurde, dass er gerade noch tropfte. Fritz’ Geduldzettel waren handflächengroß und so strahlend hell wie seine eigene Haut.
Wenn die Geduldzettel gelangen, wurde der Tag gut. Auch diese Weisheit hatte sein Vater ihm beigebracht, der sich seinerzeit für die guten Tage Hamburgs verantwortlich fühlte. Mittlerweile vermittelte Fritz sie nicht nur an seine Schwägerin Caroline weiter, die seit einigen Jahren bei ihm aushalf, sondern auch an seine Nichte Josephine, das talentierte Mädchen mit den zimtfarbenen Haaren. Eines Tages, wenn Fritz sich zur Ruhe setzte, müsste sich ja weiterhin jemand um die guten Tage der Stadt kümmern. Und während sein Sohn Hans noch nie großes Interesse an der Bäckerei gezeigt hatte, ebenso wenig wie seine beiden älteren Nichten, erschien ihm Josephine für diese Aufgabe wie geschaffen.
«Oh, sie sind heute wieder wunderbar geworden», flüsterte sie ihrer Mutter etwa zu.
«Meine Dame, ich habe gute Neuigkeiten!», rief Caroline dann der nächsten Kundin entgegen. «Die Geduldzettel sind gelungen – heute wird ein herrlicher Tag!»
Nachdem die Kundin die noch warmen Plätzchen entgegengenommen hatte, verließ sie die Bäckerei guter Dinge.
Doch dann kam die Nacht, in der die Geduldzettel nicht fest werden wollten. Josephine und Caroline schliefen noch. Fritz hatte geglaubt, er brauche keine Hilfe, und allein mit dem Backen begonnen. Und dann das! So etwas hatte er noch nie zuvor erlebt. Dabei hatte er alles genauso gemacht wie immer: die Eier sorgsam verquirlt, Zucker und Mehl hinzugegeben, bis der Teig nur noch ein wenig tropfte. Und doch zerlief er nun im Ofen zu einer einzigen Fläche. Vor Schreck zog Fritz das Blech schnell wieder heraus, der Teig zitterte, und seine Form – oben halbrund geschwungen, rechts und links spitz zulaufend – erinnerte an einen Zweispitz mit hochgestellter Krempe. Das jedenfalls würde er in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten immer wieder erzählen. «Es war ein Zeichen», würde er sagen – denn noch während Fritz dastand und auf den missratenen Teig starrte, erschien bereits der erste französische Soldat in seiner Tür.
«Bonjour», sagte der Soldat. «Diese Stadt ist auf Befehl Kaiser Napoleons besetzt. Wir brauchen ein Zimmer für fünf Mann. Haben Sie Schlafstätten, Feuerholz und Kerzen?»
«Ich… aber…», stotterte Fritz Thielemann. Und seine brüchige Stimme war die eines alten, traurigen Mannes, der sich sicher war, dass er die Besetzung Hamburgs hätte verhindern können – mit ein bisschen mehr Mehl.
1
1. Kapitel
Noch nie zuvor hatte Josephine ein so merkwürdiges Gewürz gesehen. Andächtig drehte und wendete sie die kleine, in sich gedrehte braune Stange in ihren Händen. An ihren Fingern blieb eine leicht krümelige Spur zurück. «Zimt», flüsterte sie und ließ sich dieses Wort auf der Zunge zergehen.
Der würzige Duft erfüllte die ganze Backstube ihres Onkels. Die zwei großen Fenster zu ihrer Rechten waren wie immer weit geöffnet, trotz der Kälte und Nässe dieses Novembermorgens. Mit gesenkten Köpfen – die Zylinder und Schuten voran – liefen die Passanten vorbei. Sie blinzelten gegen den Regen an, die Herren verschränkten die Arme schützend vor ihren Mänteln, die Frauen wickelten ihre Schultertücher enger um die langen, locker fallenden Chemisenkleider. Keiner von ihnen warf einen Blick in die Bäckerei. Ob sie vielleicht kurz nach hinten in die Backstube gehen könnte?, überlegte Josephine gerade, doch in diesem Moment schob sich der blonde Schopf der kleinen Mathilde durch das Fenster.
«Guten Morgen, Josephine! Habt ihr offen?» Es fehlte nur noch, dass sie ungeduldig an den Fensterläden rüttelte. Sie konnte nicht älter als zehn sein, benahm sich dafür aber reichlich vorlaut.
Josephine seufzte. «Wonach sieht’s denn aus, mh?»
Schnell versteckte sie die Zimtstange in einer Schublade unter dem Tresen und sah dem Mädchen entgegen, das nun durch die Tür hereinkam und wie immer seinen älteren Bruder Hermann hinter sich herzog. Beide trugen völlig zerrissene Kleider, waren blass und dreckig. Hermann duckte sich unter dem Türrahmen und wich Josephines Blick aus, als sie ihn grüßte. In den letzten Monaten war er so schnell in die Höhe geschossen, dass sie stets ein wenig erschrak, wenn sie ihn sah. Auch er selbst schien sich mit seiner Größe nicht wohlzufühlen, jedenfalls lief er stark gebückt durch die Stadt.
«Ich habe mich schon gefragt, wo ihr zwei Rotzlöffel heute bleibt.» Josephine zwinkerte ihnen verschmitzt zu. Obwohl Mathilde furchtbar ungezogen war und Hermann zu schüchtern, um viel zu sprechen, und obwohl sie nur selten bezahlen konnten, hatte sie die beiden ins Herz geschlossen. «Wie geht es eurer Mutter? Kann sie mittlerweile wieder aufstehen?»
«Ach, wo denkst du hin?» Mathilde rieb sich über ihren auffällig breiten Mund. «Hast du Geduldzettel?»
Josephine schüttelte den Kopf. «Tut mir leid.»
«War ja klar», grummelte das Mädchen. «Hätte ich mir schon denken können, als mein liebes Brüderchen heute unsere letzten Teller zertrümmert hat. Das wird kein guter Tag, habe ich mir gesagt.»
Sie sprach gern über Hermann, als sei er gar nicht da. Josephine fragte sich, ob es in gewisser Weise nicht auch stimmte. Sie legte den Kopf schief. «Hast du mir nicht erzählt, dass du die anderen letzte Woche selbst zerschlagen hast, als du wieder einmal wütend warst?»
Mathilde schnaufte. «Was kümmert es mich, was ich letzte Woche getan hab?» Doch sie sah ein wenig betreten zu Boden. «Sind noch Rundstücke von gestern da? Oder irgendwelche anderen Reste?», fragte sie dann überraschend leise.
In diesen Zeiten, in denen selbst die grundlegendsten Zutaten knapp waren, blieb nie etwas vom Vortag übrig, das Josephine hätte verschenken können. Schließlich war sie kaum in der Lage, genug für ihre zahlenden Kunden zu backen. Und doch brachte sie es einfach nicht übers Herz, die beiden wegzuschicken. Die Vorstellung, dass sie hungrig durch die Stadt irren mussten, verursachte ein heftiges Ziehen in ihrem Magen. Also drehte sie sich um und griff nach zwei frischen Brötchen. Im gleichen Moment klingelte das Glöckchen über der Tür.
«Das gibt’s doch nicht!», polterte der Neuankömmling los. «Was treibt ihr zwei Lümmel euch hier wieder herum? Ich habe euch schon zehnmal gesagt, dass Bettler in dieser Bäckerei nichts verloren haben! Wegen Schmarotzern wie euch muss der gute Fritz bald schließen! Da werdet ihr euch dann umgucken, wenn ihr ihm das Geschäft kaputt gemacht habt! Wie oft soll ich es euch denn noch sa…?»
«Du brauchst gar nichts zu sagen, mein lieber Fiete», unterbrach Josephine ihn und stemmte die Hände in die Hüften. «Oder haben wir jetzt einen hauseigenen Pförtner, von dem ich noch gar nichts wusste?»
Sie konnte es schlecht ertragen, wenn jemand davon sprach, ihr Onkel könne die Bäckerei aufgeben müssen. Leider geschah das in letzter Zeit immer öfter. Sogar Fritz selbst beklagte, dass es in diesen Tagen kaum noch möglich wäre, ein Geschäft zu führen. Manchmal sprach er sogar davon, rüber nach Altona zu ziehen und neu anzufangen. Doch Josephine wollte davon nichts hören. Nicht von Fritz und schon gar nicht von Fiete. Nein, sie würden durchhalten, komme, was wolle!
Kleinlaut sah Fiete sie an. «Ich wollte doch nur …» Obwohl er die Stimme gesenkt hatte, dröhnte sie Josephine noch immer in den Ohren. «Ihr habt es schon so schwer, da dachte ich …»
«Ich weiß doch, Fiete.» Sie lächelte versöhnlich und strich sich ihre Haare aus dem Gesicht. Unter Fietes noch immer leicht missbilligendem Blick drückte sie Mathilde und Hermann die beiden Rundstücke in die Hände. «Bitte schön, ihr zwei. Lasst sie euch schmecken.»
Mathilde nickte ihr dankend zu und zog Hermann schnell aus dem Geschäft hinaus.
Fiete sah ihnen kopfschüttelnd hinterher. «Dass die beiden hier so oft aufkreuzen und euch eure knappen Waren abluchsen … In diesen Zeiten! Du meinst es ja nur gut, aber wegen dieser Bälger werdet ihr noch …»
«Lass mich raten», unterbrach Josephine ihn, bevor er schon wieder in Schwarzmalerei verfallen konnte. «Du klingst, als könntest du möglicherweise selbst ein Rundstück vertragen?» Sie zwinkerte.
Jetzt schmunzelte Fiete. «Das kann ich doch immer!» Er klopfte sich auf den mittlerweile kaum noch vorhandenen Bauch. Dann rief er gut gelaunt: «Vier Stück, bitte!»
Während Josephine ihm die letzten Brötchen einpackte, erklang eine weinerliche Stimme in ihrem Rücken.
«O nein, o nein, o nein.»
Josephine sah über ihre Schulter und erkannte die wässrigen, tieftraurigen Augen von Jette, die durch das offene Fenster hereinschaute. «O guter Gott, alle Rundstücke fort! Bin ich schon wieder zu spät? O Herr Jesus Christus, womit habe ich das verdient? Wenn das so weitergeht, müsst ihr bald schließen. Gott helfe euch durchzuhalten! Wenn es Thielemanns Backhus nicht mehr gibt, dann geht auch bald die ganze Stadt vor die Hunde, das sage ich euch!»
Josephine hatte die alte Frau noch nie mit trockenen Augen gesehen. Ihr Kinn zitterte, während sie nach Geduldzetteln fragte, und wenn es keine gab, zeterte und schluchzte sie laut über die Grausamkeit dieser Welt. Heute sah sie ganz besonders unglücklich aus. Stark gebeugt schlurfte sie herein.
«O, wie schrecklich müssen wir leiden. Und alles nur wegen der Franzosen, habe ich recht? Diese schrecklichen Franzosen!»
«Heute waren’s nicht die Franzosen, Jette, sondern Fiete», warf Josephine betont munter ein.
«Da hat sie recht, unsere Josephine», gab Fiete zu und verzog zerknirscht das Gesicht. Die beiden «Lümmel» hatte er offenbar bereits vergessen. «Ich habe die letzten Brötchen genommen … Ach, weißt du was? Wir teilen!»
Gerührt sah Josephine dabei zu, wie Fiete Jette zwei Rundstücke schenkte. Die begann sofort, vor Dankbarkeit noch lauter zu weinen, und Fiete winkte in so großen Gesten ab, dass er dabei glatt gegen ein Wandregal stieß und es ins Wanken brachte.
Josephine seufzte. «Fiete, es ist immer wieder eine Freude zu sehen, was für eine liebe Seele sich hinter deiner lauten Stimme versteckt.»
Überrascht sah er sie an, dann lachte er. «Das Kompliment kann ich nur zurückgeben, Josephine. Loses Mundwerk, aber gutes Herz!»
Als der laute Fiete und die weinende Jette gegangen waren, holte Josephine die Zimtstange wieder hervor und lehnte sich an den Tresen, der an der Vorderseite über zahlreiche kleine Schubladen verfügte. Zog man an den goldrot bemalten Rundgriffen, fand man darin normalerweise Pfeffernüsse, Konfekt und Geduldzettel. Doch es war schon viele Monate her, dass sie tatsächlich mit kleinen Köstlichkeiten gefüllt gewesen waren. Wer jetzt einen Blick hineinwarf, fand nur noch Krümel vergangener Zeiten. Gleiches galt für die schmale, hohe Glasvitrine mit geschwungenen Füßchen aus rotbraunem Holz, die gegenüber dem Tresen stand. In ihr hatte Fritz einst bunte Fruchtküchlein, prächtige Birnenmustorten oder saftige Pflaumenkuchen präsentiert. Woher sollten er und Josephine auch Sahne und Butter nehmen? Woher genügend Zucker, den sie so dringend für feineres Gebäck bräuchten? Sie waren froh, wenn sie genug Mehl und Hefe hatten, um Brot zu backen.
Nachdenklich betrachtete sie die Zimtstange in ihren Händen, die ihr die Nachbarin zugesteckt hatte. Über dieses unverhoffte Geschenk war Josephine so verdutzt gewesen, dass sie den Moment verpasste, um nach dessen Grund oder Herkunft zu fragen. Nun betrachtete Josephine die Stange von allen Seiten, hob sie an die Nase, schloss die Augen, atmete ein – und mit einem Mal verschwand die kleine Bäckerei mit den leeren Schubladen und Holzregalen aus ihren Gedanken. Sogar die kühle Novemberluft löste sich auf, und mit ihr der Regen, die Traurigkeit und das furchtbare Gerede vom Ende der Bäckerei. Anstelle von alldem nahm sie nur noch diesen ganz besonderen Geruch wahr: schwer, süßlich und verheißungsvoll, nach Ferne und Heimat zugleich, nach Abenteuer und Geborgenheit. Zwar mochte sie nie zuvor eine Zimtstange gesehen haben, doch auf einen Schlag wurde ihr bewusst, dass sie diesen unverwechselbaren Duft bereits kannte. Er kitzelte warm ihre Nase und entfaltete vor ihrem inneren Auge das Bild ihrer Mutter: ihre schwarzen, hoch aufgetürmten Locken, die vollen Wangen, das leicht vorgewölbte Kinn, das Josephine von ihr geerbt hatte. Sie lächelte Josephine an, warm und herzlich, streckte einen Arm nach ihr aus, und plötzlich wusste Josephine wieder, wie sich ihre Hände angefühlt hatten: weich, ruhig und sicher. Sie erinnerte sich an die kurzen Nägel, die schmalen Knöchel und den leicht gekrümmten Ringfinger.
«Na komm schon», hörte sie Carolines Stimme flüstern, wie früher. «Du brauchst keine Angst zu haben.»
Josephine wollte nach ihrer Hand greifen und sich mitziehen lassen. Doch da verblasste das Bild. Vielleicht müsste sie nur noch einmal tief einatmen, dachte sie – als sie das Glöckchen über der Ladentür erneut hörte. Sie zuckte zusammen und riss die Augen auf.
Schlagartig war der November zurück, der Regen, die kleine Backstube, die beinahe leeren Regalbretter. Eilig versteckte Josephine die Zimtstange wieder in der Schublade und schob sie mit dem Rücken zu. In der Tür war ein französischer Soldat aufgetaucht. Schnell setzte Josephine ein unverbindliches Lächeln auf, das sich falsch und hart anfühlte. Wenn sie die weißen Hosen und Gamaschen, die blauen Fracks mit den roten, umgeschlagenen Ärmeln und die Helme mit diesen albernen Pompons in der Mitte nur sah, wurde sie nervös. Und dieser Soldat hier konnte besonders unangenehm werden.
«Monsieur Gaspard», presste sie hervor. «Was kann ich heute für Sie tun?»
Vorsichtshalber lehnte sie sich gegen die Schublade. Keinesfalls durfte er bemerken, was sie darin versteckt hatte. Die Franzosen konfiszierten alles, was nicht niet- und nagelfest war.
«Bonjour Mademoiselle Thielemann», sagte er mit seiner nuschelnden Bassstimme. Sein markantes Gesicht war wettergegerbt und wurde von dichten Augenbrauen dominiert.
«Nun, die Frage kommt Ihnen vielleicht seltsam vor», grummelte er, «aber … haben Sie in letzter Zeit etwas Merkwürdiges gesehen?»
Überrascht sah sie ihn an. In der Regel kamen die Soldaten vorbei, um die Abgaben einzutreiben oder Brot zu kaufen. Manchmal fragten sie auch, ob Fritz wieder seine berühmten Geduldzettel gebacken hatte, für die sie offenbar ebenso eine Vorliebe entwickelt hatten wie die Stammkundschaft. Möglich war das nur, wenn dem Onkel auf dem ein oder anderen nicht ganz legalen Wege Zucker in die Hände gefallen war. Und Josephine verachtete die Franzosen dafür, dass sie zwar sämtliche Karren und Kutschen an den Toren der Stadt auf Zucker durchsuchten und jeden Schmuggler festnahmen, den sie erwischen konnten, dabei aber keinen Gedanken daran verschwendeten, warum Fritz’ Geduldzettel so schön süß waren, während sie sie gierig verschlangen. Oder wie Fritz und Josephine die Steuern bezahlen sollten, da sie angesichts des Mangels an Zutaten in der Stadt doch eigentlich kaum etwas backen und verkaufen konnten.
Bisher hatte Gaspard nichts anderes als «Zwei Laib Brot bitte!», «Haben Sie Geduldzettel?» oder «Ich höre, Sie haben noch nicht gezahlt?» zu ihr gesagt. Sein Wortschatz war offenbar doch umfangreicher, als sie gedacht hatte.
«Etwas Merkwürdiges?», wiederholte sie langsam in seiner Sprache. Wenn sie ins Französische wechselte, dann stets mit gemischten Gefühlen. Einerseits machte ihr die Sprache der Besatzer Angst. Wenn Gaspard oder die furchtbaren Zollbeamten an der Stadtmauer sich unterhielten, klangen sie höhnisch, unbarmherzig und arrogant. Andererseits erinnerte es sie auch an ihre Mutter. Lange bevor Napoleon Hamburg besetzte, hatte Caroline sie in der Backstube nebenbei in Französisch unterrichtet. Während ihre Mutter Teig knetete und Puderzucker mit Zitronensaft vermischte, erzählte sie Josephine von der wachsenden Anzahl der Franzosen in der Stadt, die die prächtigsten Bälle ausrichteten und die rauschendsten Feste feierten. Feine Menschen seien das, behauptete Caroline. Josephine solle sich nur einmal die Madame ansehen, die ins leer stehende Nachbarhaus eingezogen war. Sogar ein Dienstmädchen habe sie, und Josephine solle in der Lage sein, sich mit ihnen zu unterhalten. Josephines Wortschatz wuchs kaum merklich, aber stetig, so wie Carolines Hefeteig, und bald wurde er wie die Erdbeertorten mit kleinen Details garniert. Ihre Mutter war stolz auf Josephine, auch wenn Louise, das Dienstmädchen der Madame und ebenfalls eine Französin, bei ihren Besuchen in der Backstube über den deutschen Akzent der beiden Frauen schmunzeln musste.
Gaspard jedoch schmunzelte nicht. Er setzte gerade zu einer Antwort an, als ein lautes Lachen sie beide erschrocken zusammenfahren ließ. Josephine drehte den Kopf und sah, dass sich zwei weitere Soldaten durch die offenen Fenster in die Bäckerei schwangen. Auf den Fensterbänken blieben sie sitzen.
«Bonjour Madame!», rief der eine und grinste.
«Bonjour belle femme!», fügte der andere hinzu, während er die Hand zu einem beiläufigen Gruß hob.
Josephine verschränkte unwillkürlich die Arme. Sie kannte die beiden genauso gut wie Gaspard und hatte für sie beinahe noch weniger übrig als für den älteren Soldaten. Pépin und Marlo wirkten stets vergnügt, ganz als sei die Besetzung Hamburgs nichts als ein großes Abenteuer. Sie verstanden nicht im Geringsten, wie sehr die Hamburger litten, wie groß die Not in vielen Familien war und was das Wort Kontinentalsperre bedeutete, da war sich Josephine sicher.
«Soldaten!», knurrte Gaspard. «Benutzt gefälligst die Tür!»
«Vieux grincheux!» Die Jüngeren seufzten. Normalerweise hätte Josephine die Beschreibung alter Griesgram treffend gefunden. Doch ausnahmsweise einmal war sie Gaspards Meinung. Sobald Pépin und Marlo bei ihr im Fensterrahmen herumsaßen, mieden die Hamburger Kunden das Geschäft. Und die zahlten immer noch zuverlässiger als die Soldaten, die ihre Stellung gern ausnutzten und häufig anschreiben ließen.
«Zeigt gefälligst mehr Respekt!», zischte Gaspard und stemmte die Hände in die Hüften. Sogar seine breiten, vernarbten Unterarme wirkten grob, dachte Josephine.
«Ach Gaspard!» Marlo mit dem leichten Doppelkinn und dem schwarz gelockten Haar machte gleich mehrere wegwerfende Bewegungen mit beiden Händen. Josephine hatte noch nie erlebt, dass irgendetwas an ihm still verharrte. Ständig waren seine Arme, seine Beine, seine Mimik in Bewegung. Jetzt lachte er und entblößte dabei kurze Zähne und viel Zahnfleisch. «Du versuchst seit Wochen, uns zu erziehen. Wann gibst du endlich auf?»
«Ich weiß nicht, ich weiß nicht, Marlo!» Pépin stellte einen Fuß auf die Fensterbank, stützte sich mit dem Ellenbogen auf das angewinkelte Knie und zog eine Augenbraue hoch. «Gaspard ist ein zäher alter Hund. Knallhart und unnachgiebig. Guck ihn dir an. Eines Tages macht er aus uns noch richtig achtbare Soldaten. Ich glaube, wenn er mit uns fertig ist, dann sind unsere Stiefel und Helme perfekt poliert, unsere Haare gekämmt und unsere Herzen aus Stahl. Und –», er hob einen Zeigefinger, «– wir benutzen nur noch Türen, keine Fenster mehr.»
Er warf Gaspard einen herausfordernden Blick zu, und ohne dass sie es wollte, fielen Josephine sein hübscher Mund und sein elegantes Kinn auf. Wenn sie ganz ehrlich war, musste sie sich eingestehen: Pépin war ein attraktiver Kerl. Seine Leichtfüßigkeit, seine Ungezwungenheit wirkten anziehend. Hinzu kamen diese spöttisch herausfordernden Blicke und das geheimnisvolle Zucken seiner Augenbrauen. Junge Frauen wurden in seiner Gegenwart häufig rot und kicherten über seine Scherze – doch Josephine würde das mit Sicherheit nicht tun. Sie ließ sich nicht blenden vom äußeren Schein. Nein, Pépin war im Grunde ein Kindskopf im Körper eines französischen Soldaten. Und weder mit Kindsköpfen noch mit Soldaten wollte sie irgendetwas zu tun haben.
«Zurück zu meiner Frage», brummte Gaspard unbeeindruckt und wandte sich wieder Josephine zu. «Ist Ihnen in den letzten Stunden irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen?»
Josephine blinzelte ein paarmal. «Was könnte das denn beispielsweise gewesen sein?»
«Die schöne Mademoiselle will Beispiele …» Pépin verengte die Augen nachdenklich zu halbmondförmigen Schlitzen.
«Eine leuchtende Marienerscheinung?», schlug Marlo vor.
«Ein gut gelaunter Grünrock», hielt Pépin dagegen – und spielte damit auf die strengen, grün gekleideten Zollbeamten an den Stadttoren an.
«Eine freundliche Kellerratte!» Marlo meinte wohl die Abgabeneintreiber, die sogar in die düsteren Keller der Gängeviertel vordrangen, obwohl es dort nun wirklich nichts zu holen gab. Die zwei Soldaten witzelten über ihre eigenen Leute, begriff Josephine. Dennoch würde sie sicher nicht mit ihnen lachen.
«Wir sind auf der Suche nach einer Kuh», erklärte Gaspard endlich, wohl um den Albernheiten ein Ende zu machen.
Josephine klappte unwillkürlich der Mund auf. «Eine Kuh?»
«Na, sehen Sie, unsere Vorschläge waren gar nicht so daneben, wie Sie dachten.» Pépin sah sie an und verzog entschuldigend den Mund. Ihr Blick hatte ihm wohl mehr über ihre Gedanken verraten, als sie es beabsichtigt hatte. Sie sollte sich besser zusammenreißen, nahm sie sich vor.
«Warum suchen Sie denn eine Kuh?», fragte sie so sachlich wie möglich.
«Sämtliche Kühe eines Bauern vor der Stadt wurden requiriert. Doch uns ist zu Ohren gekommen, dass ihm eine davon kurz nach dem Erlass gestohlen wurde. Nun sind wir ihr auf der Spur.» Gaspards Kiefer malmte. War er wütend auf den Dieb? Oder eher über die Aufgabe, die ihm und seiner kleinen Truppe da aufs Auge gedrückt worden war?
«Nein», sagte Josephine und unterdrückte mit aller Macht ein Grinsen. «Mir ist in den letzten Stunden keine Kuh begegnet.»
Gaspard nickte. «Bien, je vous remercie, Madame.» Er wandte sich ab, blieb in der Tür aber noch einmal stehen. «Ah, fast hätte ich es vergessen: Haben Sie heute Geduldzettel?»
«Leider nein.»
Gaspard nickte kurz, fasste sich zum Gruß an den Helm, drehte sich um – und stieß beinahe mit einem vierten Soldaten zusammen.
«Oh, pardon, Gaspard», sagte der und senkte den Kopf. Dennoch konnte er noch auf den muskulösen und breitschultrigen Gaspard hinabsehen, so groß war er. Seine helle Haut lief rot an, und sein Französisch hatte einen noch stärkeren deutschen Akzent als das von Josephine.
«Pass doch auf, Konrad», knurrte Gaspard.
Konrad war ebenfalls Mitglied der französischen Armee, allerdings Deutscher. Er war so scheu und linkisch, dass Josephine beinahe Mitleid mit ihm hatte. Einmal hatte sie sich mit ihm unterhalten und erfahren, dass er in Kassel aufgewachsen und eingezogen worden war, kurz nachdem die Franzosen das Kurfürstentum besetzt haben. Im Gegensatz zu Marlo und Pépin war ihm jedes Verlachen der Situation in Hamburg fremd.
«Pardon», wiederholte er. «Aber ein Kind hat sie gesehen.»
«Die Kuh?», rutschte es Josephine heraus.
Konrad lief noch ein bisschen röter an und nickte.
Pépin griff nach dem oberen Rand des Fensterrahmens, sprang mit beiden Füßen gleichzeitig auf die Fensterbank und dann hinaus auf die Straße. Marlo folgte ihm etwas schwerfälliger.
Mit knirschenden Stiefeln liefen sie die Straße hinunter. Der gestohlenen Kuh dicht auf den Fersen, dachte Josephine und schmunzelte in sich hinein.
Als die Soldaten mitsamt ihren Späßen fort waren, überkam Josephine ein Anflug von Melancholie. Sie musste wieder an ihre Mutter denken. Lange hatte sie die schmerzhafte Erinnerung nicht zugelassen. Doch nun, in der stillen, leeren Bäckerei, den Duft nach Zimt noch in der Nase, konnte sie sich nicht mehr dagegen wehren.
Im letzten Jahrhundert, als Josephine noch ein kleines Kind gewesen war, hatte Caroline mit ihr manchmal in der Bäckerei getanzt. Sie hatte ihre Hände genommen und sie leise summend im Kreis bewegt. Dabei hatte Carolines Gesicht gestrahlt, und auf ihrem Kopf hatte ein prächtiger, hellblauer Hut gesessen, den sie mit einem blauen Band unter dem Kinn zusammengeschnürt hatte. Und aus dem Hut wuchs eine schneeweiße, gebogene Gänsefeder.
Josephine runzelte die Stirn. Sie hatte so lange nicht mehr daran gedacht, und als Kind hatte sie es nicht hinterfragt, doch jetzt wunderte sie sich. Woher hatte ihre Mutter diesen aufwendigen Hut gehabt? Die Familie hatte zwar ein gutes Auskommen gehabt, aber wohlhabend waren sie nie gewesen. Das lag schon allein daran, dass ihr lieber Vater, ein Schuhmacher, so früh an der Schwindsucht gestorben war. Sein bescheidenes Erbe hatten seine Ehefrau und seine drei Töchter schnell aufgebraucht. Es war Onkel Fritz, Vaters Bruder, gewesen, der sie von da an versorgt hatte. Caroline unterstützte ihn in der Bäckerei, und Josephines ältere Schwestern Henriette und Ida heirateten, sobald sie achtzehn und neunzehn Jahre alt waren, um dem Onkel nicht länger zur Last zu fallen. Nur Josephine war noch zu jung gewesen, um daran überhaupt zu denken. Stattdessen half sie täglich in der Bäckerei. Sie lernte, wie man Hefe füttern musste, und beobachtete andächtig, wie sie scheinbar zu leben begann, anwuchs und über den Rand der Schüssel quoll. Sie übte, Wasser so in Mehl einzurühren, dass es keine Klumpen gab. Onkel Fritz zeigte ihr, wie man Sahne schlug, Rosenwasser herstellte und Honig aufkochte. Ihr erstes eigenes Gebäck war aufgeblasenes Mandelkonfekt: Dafür trennte sie Eier, vermengte gemahlene Mandeln mit dem Eiweiß und goss so lange Zucker hinzu, bis die Masse steif wurde. Welche Mengen an Zucker sie damals gehabt hatten, dachte Josephine sehnsüchtig. Die kleinen Formen aus Blech – Kreise, Sterne und Quadrate –, mit denen sie das Konfekt ausgestochen hatte, besaßen sie immer noch. Sie lagen in einer der untersten Schubladen des Tresens, doch sie waren lange nicht benutzt worden.
Josephine seufzte. Langsam drehte sie sich im Kreis und stellte sich vor, die hohen Holzregale wären wieder voller Zuckerbrot, Anisplätzchen und Haselnussstangen, die Leckereien stapelten sich und lugten aus allen Schubladen hervor, es duftete wieder nach Kuchen und Keksen, und die Kunden streckten ihre Köpfe vom Geruch angelockt durch die Fenster. Ihre Mutter winkte ihnen zu. «Was darf’s denn sein?» Und sie träten, angelockt von ihrer fröhlichen Stimme, herein und kauften viel mehr, als sie brauchten. Mutter packte ihnen all die Köstlichkeiten sorgsam ein und gäbe ihnen außerdem gute Wünsche mit – für ihre Ehemänner, Eltern oder Kinder, Tanten oder Cousins. Der ganze Laden wäre angefüllt von den süßesten Düften und den herzlichsten Worten.
Noch immer ließen Fritz und Josephine die Fenster gern offen. Es duftete hier zwar nur noch nach Brot und hin und wieder nach einfacherem Gebäck – doch in diesen Zeiten der französischen Besatzung, in denen es sonst nicht mehr viel gab, war schon dieser warme, schwere Geruch eine Wohltat. Josephine erinnerte sich genau an den Tag vor sechs Jahren, an dem all das angefangen hatte: Zur Tür kam der erste Trupp französischer Soldaten herein. Eigentlich waren die meisten von ihnen Italiener, die weder Französisch noch Deutsch sprachen und sich mit Fritz und Josephine kaum verständigen konnten. Sie waren so müde und ausgelaugt, dass einer von ihnen auf dem Fußboden zusammenbrach. Und über ihren Köpfen, in der kleinen Kammer, wurde Mutter krank. So richtig wohl hatte sie sich seit Monaten nicht gefühlt, doch von diesem Tag an musste sie das Bett hüten. Und Josephine kam es vor, als seien es die Besatzer gewesen, die den Zustand ihrer Mutter verschlechtert hatten. Innerhalb weniger Wochen starb sie. Vielleicht hätte ihr Geist noch in ihrem ordentlich gemachten Bett, in der halb abgebrannten Kerze auf dem Nachttisch und in den selbst genähten, bunten Vorhängen weitergelebt, wären die Soldaten nicht gewesen. Doch sie bezogen Carolines Kammer schon kurz nach ihrem Tod, nächtigten abwechselnd in ihrem Bett, brannten ihre letzte Kerze nieder und nutzten ihre Vorhänge als Bettdecken. In der Ecke stand stets ein kleines Bierfass, und auf dem Boden lagen Stiefel und Helme verstreut.
Damals war Josephine voller Schrecken gewesen, voller Trauer um ihre Mutter und Wut auf sämtliche Franzosen, doch sie hatte geglaubt, dass sie sicher nicht lange in der Stadt bleiben würden. Sehnsüchtig wartete sie auf den Tag, an dem die Männer endlich nicht mehr mit ihren dreckigen Stiefeln durchs Haus trampelten, in die Bäckerei drängten und sich an den Rundstücken und Zuckerbroten gütlich taten. Doch sie hatte falschgelegen. Zwar waren die Italiener der ersten Monate längst in eine der vielen Schlachten Napoleons geführt worden, und dieses Häuschen, in dem es über der Bäckerei nur drei kleine, einfache Kammern gab, war den Neuankömmlingen glücklicherweise zu eng gewesen, um es als Herberge auszuwählen, doch nach wie vor war Hamburg Teil des französischen Kaiserreichs. Es waren immer neue Truppen gekommen. Ihr Onkel hatte ihr erklärt, dass Napoleon Hamburg vor allem deswegen eingenommen hatte, weil er England in die Knie zwingen wollte. Indem England vom Handel abgeschnitten würde, sollte es dazu gebracht werden, sich Frankreich zu unterwerfen. «Wir sind ein Kollateralschaden, nichts weiter», hatte Fritz leise seufzend festgestellt.
In Hamburg durfte fast kein Schiff mehr ablegen, sämtliche Waren aus England, sogar das kleinste Zuckerkorn, waren verboten. Wenn Josephine im Hafen unterwegs war und auf die mindestens sechzig Segler schaute, die abgetakelt an den Piers lagen, auf die vielen nackten und unnütz in den Himmel stechenden Masten, glaubte sie beinahe, vor einem toten Wald zu stehen. Gespenstisch still kam es ihr hier vor, an diesem Ort, der früher von einer so großen Geschäftigkeit geprägt gewesen war.
Die Stadt litt unter dem Mangel an englischen Gütern und der Armut, die die Kontinentalsperre gebracht hatte. Schließlich lebten hier so viele einst erfolgreiche Kaufleute, so viele Seemänner und Reeder, die die Waren der Kaufleute hin und her transportierten, so viele Tischler, Schreiner und Handwerker, die normalerweise für die Reedereien arbeiteten. Sie alle waren auf einen Schlag arbeitslos geworden. Hinzu kamen die immer höheren Steuerabgaben, die die Hamburger an die Besatzer zu zahlen hatten.
Josephine musste wieder an Fritz’ besorgtes Gesicht denken. Daran, wie er sagte: «Lange halten wir nicht mehr durch.» Oder: «Aus nichts kann man nun mal nichts backen.» Und er hatte recht: Mehl und Hefe bekamen sie noch, doch Milchprodukte und Eier waren rar. Onkel Fritz’ Versuche, heimlich Mandeln und Zucker zu ergattern, wurden immer riskanter. Auch heute war er bereits lange unterwegs. Zu lange.
Josephine schluckte.
Plötzlich riss ein Geräusch sie aus ihren trüben Gedanken, und als sie den Kopf umwandte, entdeckte sie den Postboten, der in der Tür stand und sie anlächelte.
«Christian, guten Tag!» Sie schob eine Haarsträhne unter ihre weiße Haube. «So spät habe ich gar nicht mehr mit dir gerechnet.»
«Guten Tag, Josephine», antwortete Christian Schulte mit seiner leisen Stimme. Er trug den einfachen Hut der Postleute, hohe, schwarze Stiefel und einen dunklen Mantel mit doppelter Knopfleiste.
Als er sich den Hut zurechtrücken wollte, klingelte er aus Versehen mit der kleinen Handschelle, mit der er morgens in den Straßen auf sich aufmerksam machte.
«Entschuldige.» Er biss sich auf die Unterlippe.
Josephine kannte Christian schon, seitdem sie beide Kinder gewesen waren. Gerade war er noch ein schlaksiger, eher kleiner Junge gewesen, unsicher und etwas fahrig. Mittlerweile musste sie zu ihm aufschauen.
«Ich habe es nicht früher zu dir geschafft, aber ich habe Post für dich.» Er streckte ihr die Briefe entgegen, ganz leicht zitterten sie in der Luft. War er etwa nervös?
«Danke, Christian.» Sie lächelte ihm zu und wartete, dass er noch etwas sagte.
«Bis bald», murmelte er jedoch nur und verschwand eine Spur zu schnell.
Einen Moment lang stand sie verwundert in der Bäckerei. So seltsam hatte sich Christian noch nie benommen. Nachdenklich griff sie nach den Briefen: die Rechnung für die letzte Holzlieferung und ein Schreiben ihrer Schwester Henriette, die mittlerweile als Frau eines Bauern im dänischen Altona lebte. Gerade wollte sie den Umschlag öffnen, da bemerkte sie, dass das Siegel bereits gebrochen war. Sie presste die Lippen fest aufeinander. Wieso öffneten diese schrecklichen Franzosen nun sogar die privaten Briefe ihrer Schwester? Sie wollte schon einen Fluch ausstoßen, da segelte etwas Kleines, Weißes zu Boden.
Sie bückte sich, hob es auf und betrachtete es mit gerunzelter Stirn: Es war eine Blüte, die Josephine noch nie gesehen hatte. Jemand hatte sie gepresst und getrocknet. Zerbrechlich, doch strahlend weiß lag sie mit fünf schmalen Blütenblättern in ihrer Hand.
2. Kapitel
Die dicken Vorhänge waren zugezogen, sodass nur wenig Licht in die kleine Stube drang, und in den schmalen Strahlen tanzte der Staub – das Einzige, was sich hier bewegte. Still stand das dunkelgrüne Kanapee an der Wand, dumpf lag der sandfarbene Teppich am Boden, nicht einmal der kleine Schaukelstuhl quietschte. Darauf saß starr und stumm Madame Laurent. Seit Jahren hatte die Madame nicht mehr geschaukelt.
Einen Moment stand Louise im Türrahmen und ließ dieses inzwischen bekannte Bild auf sich wirken. Stille war doch etwas Sonderbares, dachte sie. Manchmal, wenn Louise außerhalb der Stadttore einen Spaziergang machte, tat sie ihr gut. Doch wenn sie von einem atmenden Menschen ausging, konnte sie die Luft vergiften. Ob das Haus, in dem Louise nun seit fünfzehn Jahren mit Madame Laurent lebte, unter der Tapete und den Teppichböden bereits verfault war?
Louise schüttelte den Kopf. So ein Unsinn, schalt sie sich. Der armen Madame hatte es damals, nachdem man Marie-Antoinette den Kopf abgeschlagen hatte, die Sprache verschlagen. Und wer könnte es ihr verdenken? Kurz darauf musste die ganze, einst adelige Familie Laurent Frankreich verlassen. Die Madame hatte zuerst ihren Stadtpalast, ihre Stellung und ihren Reichtum verloren. Dann, nach nur wenigen Jahren in dieser Stadt, auch ihren Mann und zuletzt ihre Tochter. Geblieben war ihr nur Louise. Glücklicherweise war deren Stimme zumindest stark und laut genug für zwei.
Louise gab sich einen Ruck, überprüfte den Sitz ihres großen Hutes und trat mit einem breiten Lächeln in die Stube.
«Bonjour Madame, wie haben Sie geschlafen? Das wird ein wunderbarer Tag, das sage ich Ihnen! Ich habe von einem roten Hut mit großen Federn geträumt, das wird mein nächstes Kunstwerk. Karl müsste jeden Moment kommen, vielleicht kann er mir noch mehr Baumwolle bringen. Ich glaube, der Hut würde Ihnen ganz ausgezeichnet stehen, Madame. Sie sind wie immer mein Modell. Und dann finden wir eine hübsche Hamburgerin, die er schmücken kann!»
Während sie sprach, wirbelte Louise durch den Raum, riss die Vorhänge auf, ließ das Licht herein und bemühte sich, so viel Fröhlichkeit wie irgend möglich in ihre Stimme zu legen. Madame Laurent rührte sich nicht. Ihr trockenes weißblondes, zu einem langen Zopf zusammengebundenes Haar lag über ihrer Schulter, ihre gerade Nase mit den weiten Flügeln zeigte starr nach unten. Ihr einst so roter, elegant geschwungener Mund war blass geworden. Nur ihre Augen unter den schmalen Brauen folgten Louises Bewegungen. Obwohl die Madame in den letzten Jahren rasch gealtert war, ihr Hals immer faltiger wurde und die einst so edlen, hohen Wangenknochen in schlaffer Haut versanken, war noch immer auf den ersten Blick ersichtlich, welche Schönheit sie gewesen war. Sogar in ihrem stillen Altern war ein Leuchten zu erkennen. Wie die Glut eines erlöschenden Feuers, dachte Louise.
«Gestern habe ich gleich drei Hüte verkauft», fuhr sie fort. «Davon werden wir bestimmt die ganze Woche satt. Wie finden Sie übrigens dieses Modell?» Sie fasste sich an die breite, herabhängende Krempe und drehte sich nach rechts und links, um den hübsch gepunkteten Stoff und die kleinen ringsherum angebrachten Blüten vorzuführen. Doch natürlich sagte die Madame nichts. «Zut alors, fast hätte ich es vergessen. Karl hat gemeint, er hätte schon bald etwas Neues. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber er sagte, dem Winter könnten wir beruhigt entgegensehen. Ist das nicht formidable, Madame Laurent?»
Sie wusste, dass es sinnlos war, und doch sah sie die Madame erneut aufmunternd an. Früher, in Frankreich, hatten sie anregende Gespräche geführt. Niemand hatte Louise so gut verstanden und ernst genommen wie die Madame. Louise war damals noch ein junges Mädchen gewesen und hatte nichts von der Welt gewusst, während die Madame Bücher las, ins Theater ging und sich hin und wieder sogar mit den Männern der Familie über Politik unterhielt. Wie sehr hatte sie sich damals gewünscht, eines Tages ebenso schön und elegant zu sein wie die Madame!
Wie sich doch die Welt seitdem geändert hatte … Mittlerweile hatte sie beinahe alle Kleider der Madame zu bunten Hüten verarbeitet. Es war doch eine seltsame Vorstellung, dass so viele Hamburger Frauen Madame Laurents Gewänder auf den Köpfen trugen. Auch Louise hatte sich verändert. Sie war Mitte dreißig, in etwa so alt wie die Madame zu ihren Glanzzeiten, und bemühte sich stets, das Beste aus sich zu machen. Die Haare trug sie zu modernen Locken aufgedreht und locker hochgesteckt, ihre vorstehende Oberlippe war von Natur aus dunkelrot und ihre Augen tiefdunkel. Auch wenn sie nicht mehr die Jüngste war – in Hamburg zog sie mit ihrer großen Gestalt und ihren ausgefallenen Hüten die Blicke sämtlicher Männer auf sich: die der Hamburger Arbeiter, Kaufleute und Schmuggler, die der französischen Offiziere und Soldaten, ja sogar die der schrecklichen Grünröcke, die an den Toren der Stadt positioniert waren, um sämtliche Passanten auf verbotene Waren zu durchsuchen.
Dennoch – wie gern würde Louise die Zeit zurückdrehen. Sie wünschte, sie hätten sich niemals in Hamburg niedergelassen, wären niemals aus Frankreich geflohen, könnten wieder in den kleinen Stadtpalast zurückkehren. Dort hatte Louise zwar gearbeitet bis zum Umfallen, sie war nur ein kleines, unbedeutendes Dienstmädchen in grauen Kleidern gewesen, das von allen Herrschaften außer der Madame fürchterlich behandelt worden war, doch zumindest hatte sie immer gewusst, was sie zu tun hatte. Sie war für den Putz der Madame zuständig gewesen: ihre Kleidung, ihre Hüte, ihre Ausstattung. Und es gab immer genug zu essen.
Heute hing jede einzelne Mahlzeit von der Summe aller Entscheidungen ab, die Louise im Laufe des Tages traf, für sich und für die Madame. Sie war froh, dass die Madame sich zumindest noch selbstständig ankleiden und waschen konnte. Größere Unterstützung aber war von ihr nicht zu erwarten.
«Wollen wir heute vielleicht einen Spaziergang machen?» Louise versuchte, nicht gereizt zu klingen, doch ihre Stimme zitterte leicht. Einen Moment lang lauschte sie dem gewohnten Schweigen, das statt einer Antwort folgte. Dann seufzte sie und begann, wie so oft, zu singen, um die Stille zu füllen. J’aime l’oignon frit à l’huile, J’aime l’oignon car il est bon. Sie sang von Zwiebeln, angebraten in Öl, während ihr Magen knurrte, und dachte an Frankreich, an den alten Stadtpalast und an die Operette Le jeune Henri, die Madame Laurent damals besucht hatte. Als sie nachts nach Hause kam und Louise ihre komplizierte Flechtfrisur Strähne für Strähne löste, sang die Madame ihr leise, aber mit leuchtenden Augen und klarer Stimme ihre Lieblingslieder vor. Andächtig lauschte sie und prägte sich jeden Ton, jedes Wort ein. Heute gaben sie ihr in den stillsten Tagen Kraft. Ob die Madame auch an damals denken musste, während nun Louise sang? Ihrer Miene war nichts anzumerken.
«Un seul oignon frit à l’huile, Un seul oignon nous change en Lion …» – da hörte sie ein Klopfen.
Louise eilte zum Fenster und sah hinaus. Karl stand in der Rosenstraße, groß und gut aussehend wie immer, seine Kappe schief auf dem Kopf. In der Hand hielt er einen Strick, und dieser Strick führte zum Hals einer Kuh.
Louise keuchte vor Überraschung.
«Beeil dich», rief Karl mit durch das Fensterglas gedämpfter Stimme. «Du musst sie verstecken, bevor uns jemand sieht.»
«Mon Dieu», entfuhr es Louise. Rasch öffnete sie das Fenster. «Was soll das heißen, ich muss sie verstecken?»
«Diese Kuh wird dich und mich durch den Winter bringen.»
Louise sah zwischen der Kuh und Karl hin und her. Das Tier war nicht besonders dick, aber auch nicht ausgezehrt. Sein weißes Fell war von großen hellbraunen Flecken übersät.
«Wem hast du sie gestohlen, mh?», fragte sie, und ihre Stimme klang strenger als beabsichtigt.
«Den Franzosen natürlich. Sie haben sie requiriert – und du weißt selbst, dass die Soldaten in dieser Stadt wirklich nicht an Hunger leiden. Im Gegensatz zu uns …»
Louise biss sich auf die Unterlippe. «Das ist gefährlich, Karl. Wenn sie uns erwischen …» Bei dem Gedanken wurde ihr Mund ganz trocken. Bekämen die Soldaten auch nur einen Hinweis von einem Nachbarn, würden sie alles auf den Kopf stellen und nicht nur das Tier mitnehmen, sondern auch Louise. Sie käme sicherlich ins Zuchthaus. Und was sollte Madame Laurent ohne sie anfangen?
Karl sah ihr fest in die Augen. «Niemand wird uns erwischen, Louise. Dieser Winter wird noch härter als die vergangenen. Bald gibt es kaum noch Möglichkeiten, an etwas Essbares zu kommen. Glaub mir, die Kuh wird unsere Rettung sein.»
Nachdenklich betrachtete Louise das Tier, das ihren Blick aus großen Augen mit weißen langen Wimpern ruhig erwiderte. Seine Ohren standen freundlich ab, ganz leicht legte es den Kopf schief, dann blinzelte es zweimal.
Karl bemerkte es wohl ebenfalls, denn er ahmte die Kuh nach und schaute Louise nun mit einem ähnlich treuherzigen Augenaufschlag an.
Da konnte sie nicht anders und lachte leise. «Und sie gibt noch Milch?»
«Guck dir ihren Euter an!» Er war prall gefüllt.
Louises Hände wurden feucht vor Aufregung, sie musste sich entscheiden – so schnell wie möglich. Je länger Karl dort mit der Kuh stand, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Also nickte sie schließlich. «Bon. Ich komme.»
Sie lief durch die Stube in den schmalen Flur hinaus und öffnete die Haustür.
«Dann mal hereinspaziert», rief sie fröhlich gegen das laute Pochen ihres Herzens an, als hätte sie Karl und die Kuh schon erwartet. «Unser Gast darf im alten Stall wohnen.»
Sie ging voran, vorbei an der Küche und dem schmalen Aufstieg, und versuchte Schritt für Schritt, ihre Sorgen abzuschütteln. Es würde schon alles gut gehen, sagte sie sich. Es musste alles gut gehen.
Hinter der Treppe befand sich die Tür zum Hinterhof.
«Passt die Kuh da hindurch?», fragte Louise mit Blick über ihre Schulter.
«Die Kuh hat einen Namen, Louise», wies Karl sie zurecht. «Sie heißt Philibert, und natürlich passt sie da durch.»
«Philibert?»
«Ja. Nach Louis-Philibert Brun d’Aubignosc.»
«Und wer soll das sein?»
«Unser französischer Polizeidirektor. Ich fand das passend.»
Er zuckte mit einer seiner tiefschwarzen Brauen, und seine Augen funkelten angriffslustig. Wie ihm jetzt gleichzeitig eine Locke aus der Mütze rutschte und in seine hohe Stirn hing, sah er beinahe verwegen aus – stünde nicht eine treuherzig dreinschauende Kuh neben ihm.
«Woher weißt du denn das schon wieder?»
«Ich habe im Gegensatz zu dir meine Quellen», er zwinkerte. «Können wir Philibert nun einquartieren?»
«Aber natürlich. Monsieur Philibert – folg mir bitte.»
«Sie ist trotz ihres Namens immer noch eine Madame, vergiss das nicht.»
«Natürlich. Pardonnez-moi, Madame.»
Die Alberei entspannte Louise ein wenig. Sie stellte sich vor, die Kuh sei lediglich ein fantastischer Scherz und kein Risiko. Ach, wie schön wäre das!
Louise öffnete die Hintertür und schaute auf den Hof hinaus. Die Vorhänge an den niedrigen Fenstern gegenüber waren zugezogen, die schmalen Holzstufen, die steil an der Wand des Hinterhauses hinaufführten, leer, und auch im Garten zu ihrer Rechten, in dem der Bäcker von nebenan im Sommer regelmäßig seine Rosen pflegte, sah sie niemanden. Die Bettlaken, die jemand im ersten Stock gegenüber aus den Fenstern gehängt hatte, wehten im Wind und streiften hin und wieder die schwarz angelaufene Laterne, die aus der Fassade ragte.
«Hier entlang», sagte sie, wandte sich nach links und öffnete einen kleinen Holzverschlag, in dem Madame Laurent früher ein Schwein gehalten hatte. Für eine Kuh war er ziemlich klein. Außerdem gab es kein Stroh oder Wasser, aber das würde Louise schon noch ändern.
Karl führte die Kuh über den Hinterhof und schimpfte sie streng, als sie versuchte, auf dem dornigen Rosenstrauch herumzukauen. Louise lächelte bei diesem Anblick, doch Karls Gesicht mit der grüblerischen Stirn blieb ernst. Sie war sich sicher, dass auch er ihre Frotzeleien dringend brauchte, um in diesen Zeiten nicht zu verzweifeln, allerdings war sein Humor schwarz und staubtrocken – mit Fröhlichkeit hatten seine Witze nur wenig zu tun. Und doch hatte Louise ihn gern.
Sie kannte Karl aus einer Zeit, in der Franzosen in Hamburg noch willkommen gewesen waren – als wohlhabende Emigranten aus noblen Häusern, die vor der Französischen Revolution hatten fliehen müssen. Niemand hätte sich träumen lassen, dass es in Hamburg bald von Soldaten Napoleons nur so wimmeln würde. Damals war Karl Schutenschubser in der Speicherstadt gewesen: Er verlud meterhohe Ballen Baumwolle von den großen Handelsschiffen in die Stapelhäuser. Zu dieser Zeit, da noch Waren aus Übersee in Hamburg umgeschlagen wurden, war es üblich gewesen, dass Ewerführer wie er in den Kojen ihrer flachen, langen Boote lebten, damit sie ihre wertvolle Ware Tag und Nacht beschützen konnten.
Der große Mann mit der ernsten Miene war Louise schon mehrmals auf seinen Wegen durch die Fleete Hamburgs aufgefallen. Und auch sein Blick war immer wieder an ihr hängen geblieben. Eines Tages, als Louise von der Holzbrücke auf den Nikolaifleet hinuntersah, entdeckte sie ihn unter sich. Seine Schute war nicht zu übersehen – Karl war der wohl einzige Schutenschubser der Stadt, der seine Koje rosa gestrichen hatte. Der Eingang war mit dicken Kordeln verhangen, die im Rhythmus der Wellen hin und her schwankten. Ihre Fröhlichkeit wollte so gar nicht in die Szenerie passen: nicht zu dem schmutzigen Wasser, das zu beiden Seiten graubraun gegen die Steinwände der Häuser schwappte und eine schmierige Schicht dunkelgrüner Algen hinterließ. Nicht zu den anderen, kargen Schuten, die von schmutzigen und Pfeife rauchenden Männern gesteuert wurden. Und am wenigsten zu Karl selbst, der so finster wie alle anderen aufs Wasser starrte.
Kurz überlegte sie, dann winkte sie ihm.
«Mmh?», brummte Karl und hob das Kinn.
«Pardon! Bitte entschuldige die … dreiste Frage, aber», rief sie mit ihrem damals noch so starken französischen Akzent, «hast du vielleicht ein wenig Baumwolle … übrig?»
«Baumwolle übrig?» Er lachte trocken auf, dann fuhr seine Schute unter ihr hinweg.
Sie wirbelte herum und beobachtete, wie er auf dem Fleet immer kleiner wurde. Erst kurz bevor er hinter einer Biegung verschwand, sah er über seine Schulter und musterte sie nachdenklich.
Als sie ihn das nächste Mal sah, sagte er kein Wort, doch er beugte sich durch die Kordeln in seine Koje, holte ein kleines Paket hervor und warf es ihr zu.
«Ist das … Baumwolle?»
«Ausschussware. Gibt’s zum halben Preis.»
«Aber … ich habe das Geld noch nicht. Kann ich es nächste Woche bezahlen?»
«Anschreiben ist nicht.» Er winkte mit zwei Fingern, damit sie die Ware zurückwarf.
«Bitte, gib mir eine Woche!», rief Louise. «Ich werde genau hier stehen, und ich werde das Geld dabeihaben.»
Als sie eine Woche später an Ort und Stelle stand, wickelte sie ihm das Geld in eine Kappe, die sie eigens für ihn genäht hatte.
«Für dich», sagte sie und warf ihm das kleine Paket zu.
Danach trug Karl nicht nur ihre Mütze auf dem Kopf, sie hatten auch eine feste Verabredung an der Holzbrücke über dem Nikolaifleet. Bis zu dem Tag, an dem Napoleons Soldaten kamen, die leeren Schuten vertäut wurden und Karl in den Gängevierteln verschwand.
Erst einige Monate später am Dammtor begegneten sie sich wieder. Beide wurden gleichzeitig von Grünröcken auf verbotene Ware durchsucht. Ihre Blicke trafen sich, und Louise musste lachen. Auch Karls Mund verzog sich zu einem Schmunzeln, und als die Douaniers sie endlich durchließen, führte er sie am Ellenbogen ein paar Schritte weiter.
«Verkaufst du noch deine Hüte?», fragte er sie leise. «Ich habe da nämlich eine Idee.»
Anfangs hatte sie keine Ahnung gehabt, wie praktisch ihre Hüte sein würden, um Waren in die Stadt zu schmuggeln. In den großen Schachteln ließen sich neben ihren Kreationen auch wunderbar Kaffee, Zucker oder verbotene Gewürze verstecken. Schon bald brachte Karl sie auf die kreativsten Manöver. Und bis heute hielten sie an dem kleinen Arrangement fest.
Nun zerrte und zog Karl an Philiberts Strick, um sie von den Rosen weg und zum Stall zu führen. Endlich trottete die Kuh in den kleinen Stall hinein. Etwas ratlos schaute sie währenddessen über die Schulter in Louises Richtung, als wollte sie sie fragen, ob hier wirklich auch alles seine Richtigkeit hatte.
Sobald Philibert im Verschlag stand, schnaufte Louise durch. «Alors, willst du mir jetzt erklären, was das zu bedeuten hat?»
Doch Karl antwortete nicht, starrte nur erschrocken an Louise vorbei, und als sie sich umdrehte, stockte ihr ebenfalls der Atem. In dem kleinen Rosengarten nebenan stand Josephine. Ein paar Strähnen ihres zimtfarbenen Haars wehten im Wind, und mit ihren großen Augen sah sie Louise verwundert an.
3. Kapitel
«War das etwa eine …?», entfuhr es Josephine. «Die Soldaten haben vorhin nach einer gesucht, aber das kann doch nicht …» Sie unterbrach sich selbst. «Entschuldigt, das geht mich überhaupt nichts an.»
Sie wollte sich schnell wieder abwenden, da trat Louise zwei energische Schritte auf sie zu, ihr grünes Kleid flatterte. Sie schob sich ihren voluminösen Hut in den Nacken, sodass ihre honigblonden Haare hervorlugten, hob das Kinn und sah Josephine direkt in die Augen. «Ich kann dir vertrauen, habe ich recht?»
Josephine zögerte einen Moment. Onkel Fritz war aus irgendeinem Grund der Meinung, man solle sich vor der Nachbarin mit den bunten Hüten in Acht nehmen. Seit Carolines Tod hatte Josephine immer versucht, sich an seinen Rat zu halten. Schließlich hatte der Onkel eine gute Menschenkenntnis. Doch nun lag eine so aufrichtige Bitte in Louises Blick, dass Josephine nicht anders konnte, als zu murmeln: «Natürlich, Madame …»
Louise hob überrascht die Augenbrauen. «Madame? Wie schmeichelhaft» Sie lachte, und Josephines Gesicht wurde heiß. Sie wusste selbst nicht, warum ihr diese Anrede herausgerutscht war. Schließlich war die Nachbarin lediglich die Hausdame der alten Madame Laurent, die seit Jahren niemand mehr auf der Straße gesehen hatte. Es hatte eine Zeit gegeben, als die Madame durch die Straßen Hamburgs flaniert war und die elegantesten Bälle besucht hatte. Damals war Louise als ihr Dienstmädchen noch in graue Gewänder gehüllt gewesen und unscheinbar hinter ihr hergelaufen. Dann, als man Madame Laurent immer seltener auf der Straße sah, hatte sich Louise allmählich verändert. Jedes Mal, wenn Josephine ihr begegnet war, oft an ihrem eigenen Küchentisch, da sich Louise und Josephines Mutter zunehmend angefreundet hatten, war sie etwas bunter und auffälliger gekleidet. Und spätestens seitdem die Madame von der öffentlichen Bildfläche verschwunden war, war Louise aufgeblüht. Mittlerweile wirkte sie so selbstbewusst, trug derart ausgefallene Hüte und ein so strahlendes Lächeln im Gesicht, dass man sie einfach für eine Madame halten wollte.
«Louise», korrigierte sich Josephine selbst. Mit steifen Bewegungen versuchte sie, ihre vom Wind verwehten Haare einzufangen und hinter die Ohren zu schieben.
«Was sagtest du eben von den Soldaten?»
Bei diesen Worten hob der Mann, der gerade noch so konzentriert die Kuh geführt hatte, die Augenbrauen. Karl, wenn Josephine sich recht erinnerte. Er war schon ein- oder zweimal im Backhus gewesen.
«Soldaten?», knurrte er. «Wo sind sie hingelaufen?»
«In die andere Richtung, zum Pferdemarkt runter», antwortete Josephine.
Karl nickte zufrieden. «Anna sei Dank», murmelte er.
«Du solltest sie nicht bei solchen Dingen um Hilfe bitten», zischte Louise über ihre Schulter. «Das Mädchen ist erst elf!»
«Und wenn es will, steckt es uns alle in die Tasche», brummte er.
«Wie dem auch sei …» Louise sah wieder Josephine an und lächelte. «Du verrätst niemandem etwas, oder?»
«Nein, keine Sorge», antwortete sie nach einem kurzen Zögern. Selbst wenn Onkel Fritz mit seiner Meinung über Louise recht haben sollte – gegen die Franzosen hielt man zusammen.
«Auch nicht wegen des Zimts?»
Josephine schüttelte den Kopf. Kurz sah sie zu dem Mann hinüber.
«Keine Sorge, Karl weiß Bescheid.»
«Was glaubst du, von wem sie das Zeug hat?» Er zog einen Mundwinkel hoch, und zum ersten Mal seit dieser seltsamen Begegnung hatte Josephine das Gefühl, dass er gar nicht so rau und schroff war, wie er auf den ersten Blick wirkte.
«Josephine! Fritz! Ist jemand da?», rief eine Stimme aus der Bäckerei.
«Oh, ich habe die Tür noch nicht abgeschlossen!» Eilig verabschiedete sich Josephine und lief zurück, durch die längliche Backstube in den kleinen Verkaufsraum.
Vor dem Tresen stand Fräulein Weber, das Dienstmädchen ihrer Schwester Ida. «Guten Tag, Fräulein Thielemann. Herr und Frau Altmann sitzen draußen in der Kutsche und lassen fragen, ob Sie mit zum Grasbrook fahren möchten.»
Josephine sah sie verwundert an. Der Grasbrook war eine sumpfige Insellandschaft auf der Elbe, die als große Viehweide genutzt wurde – nicht unbedingt ein typisches Ausflugsziel des Ehepaars Altmann. «Wieso fahren sie denn zum Brook?»
«Es sollen wohl wieder Waren verbrannt werden. Der Herr ist sehr aufgebracht. Und Frau Altmann würde sich freuen, wenn Sie ebenfalls mitkämen. Aber wir haben nicht viel Zeit.»
So war das also. Sicherlich hatte Ida sich in dem großen Haus gelangweilt, ihren Mann überredet, sie mitzunehmen, und dann Josephine ins Spiel gebracht, um Gesellschaft zu haben. Von Philipp war der Vorschlag gewiss nicht gekommen. Aufgrund ihres unterschiedlichen gesellschaftlichen Standes fiel der Kontakt zwischen ihnen oft ungelenk und steif aus.
Josephine seufzte. «Natürlich. Ich komme», sagte sie dennoch, ihrer Schwester zuliebe.
Rasch griff sie nach ihrem Schultertuch, ihrer gelben Schute und dem kleinen Beutel, den sie mit einer Kordel an ihrem Kleid festbinden konnte und in dem sie ihren Schlüssel und etwas Geld aufbewahrte. Dann lief sie hinter dem Dienstmädchen nach draußen, wo die Kutsche der Altmanns schon wartete. Ihre Eleganz hatte in diesen dunklen Tagen etwas Unwirkliches. Auf zwei großen Rädern hinten und zwei kleinen vorn thronte ein gedeckter Wagen mit reich verzierten Holztüren und Glasfenstern. Dahinter sah sie das Gesicht ihrer Schwester.
Der Kutscher sprang von seinem Sitz herunter und öffnete ihr die Tür. Während sie einstieg, sah sie aus den Augenwinkeln, dass Fräulein Weber ihrerseits auf den Bock kletterte. Die Ärmste – und das bei dem nassen Wetter!
Sobald Josephine einstieg, setzte ein kräftiges Kläffen ein.
«Josephine, meine Liebe», sagte Ida, als würde sie den Hund gar nicht hören, und drückte ihr kurz die Hand. Ihre Finger waren ganz kalt, dennoch war es eine liebevolle, warme Geste. «Schön, dass du mitfährst. Komm, setz dich hier neben mich.»
«Guten Tag», grüßte Philipp Altmann, gerade so laut, dass man ihn durch das Hundegebell hören konnte, und nickte nur einmal kurz in ihre Richtung, bevor er wieder aus dem Fenster schaute. In gemächlichem Tempo verließen sie die Rosenstraße mit den kleinen Gastwirtschaften, Ladengeschäften und Thielemanns Backhus. Während sie die Apotheke im Eckhaus passierten und über den Pferdemarkt in Richtung Hafen fuhren, betrachtete Josephine ihre Schwester und ihren Schwager. Sie waren ein ungleiches Paar, was nicht allein an dem Altersunterschied von elf Jahren lag. Alles an Ida war klein: ihre Füße in den Lackschuhen, ihre Hände, die in fein bestickten Handschuhen steckten, ihr schmaler Körper in dem reich verzierten, wallenden Kleid, ihr Kopf, mit dem aufwendig frisierten Haar und einem eleganten Hut geschmückt, die Stupsnase und die eng beieinanderstehenden Augen. Ein wenig verkniffen schaute sie Josephine an, und ihr Gesicht sah dabei ganz ähnlich aus wie das der kleinen, weißen Malteserhündin, die sie auf den Knien balancierte und so lange streichelte, bis die endlich aufhörte zu kläffen. Das Tier machte Anstalten, von Idas Schoß auf Josephines zu wechseln, doch Ida hielt es fest. Josephine hätte nichts dagegen gehabt, ein wenig mit dem Tier zu kuscheln. Doch ihre Schwester wollte es meist ganz für sich allein.
«Marie-Antoinette!», tadelte sie die Hündin nun streng.
Anfangs hatte sich Josephine über den Namen gewundert, doch als sie ihre Schwester danach gefragt hatte, hatte diese nur geseufzt. «Du weißt wirklich nichts von der Welt, habe ich recht?» Daraufhin hatte Josephine nicht weiter nachgefragt.
Im Gegensatz zu Ida war Philipp ein großer, massiger Kerl. Er füllte mehr als zwei Drittel der Bank aus. Sein Rock spannte gefährlich, und seine Schultern drohten, die Fensterscheibe zu zerdrücken. Nur sein Kopf war ebenso klein und rund wie der Idas und wollte nicht so recht zu seinem Körper passen. Gemeinsam mit der großen Nase, die daraus hervorragte wie der Henkel aus einer Kaffeetasse, verlieh er seinem Äußeren eine unfreiwillige Komik. Er war wahrlich kein schöner Mann, doch wenn er gute Laune hatte und es darauf anlegte, konnte er die Menschen mit seinem Charme um den Finger wickeln. Sogar Josephine hatte schon Gespräche mit ihm geführt, in denen sie geglaubt hatte, noch niemand habe sie so ernst genommen wie er.
In diesem Moment aber schien er tief in Gedanken versunken zu sein.
«Ist alles in Ordnung?», fragte Josephine ihre Schwester leise.
«Natürlich, natürlich», sagte Ida mit ihrer hohen Stimme. «Wir machen nur einen kleinen Ausflug und … da dachte ich, du möchtest vielleicht mit.»
Sie setzte ein gezwungenes Lächeln auf, und Josephine wusste, dass sie die Wahrheit in diesem Moment nicht aus ihr herauslocken konnte. Nicht, während Philipp neben ihr saß. Kurz drohte sich Schweigen in der Kutsche auszubreiten. Dann fragte Ida: «Wie geht es Onkel Fritz?»
«Ich bin mir nicht sicher.» Josephine seufzte. «In letzter Zeit ist er sehr angespannt.»
«Ihr habt es nicht leicht mit der Bäckerei, habe ich recht?»
Marie-Antoinette reckte die Nase in die Luft, schnupperte und versuchte, sich aus Idas Händen zu winden. Josephine zwang sich dazu, sich dennoch auf das Gespräch zu konzentrieren, und schüttelte den Kopf.
«In letzter Zeit gehen uns sogar Butter und Eier aus. Zucker hatten wir schon lange nicht mehr. Die Leute kommen weiterhin zu uns, aber meistens haben wir nur Brot. Und auch davon nicht genug.»
«Es sind schwere Zeiten.»
Josephine senkte den Blick. Ida hatte recht, doch sie beide wussten, dass die Zeiten nicht für alle schwer waren. Ganz offensichtlich ging es den Altmanns weiterhin prächtig. Bevor sie geheiratet hatten, war Philipp noch ein einfacher Seidenhändler gewesen. Kurz nach der Hochzeit stieg er dann in rasantem Tempo zu einem der wohlhabenderen Kaufmänner der Stadt auf. Heute besaß er eine große Villa am Jungfernstieg mit Blick auf die Binnenalster. Josephine hatte sich schon häufig gefragt, womit er, der bis zur Besatzung Hamburgs mit Kolonialwaren, vor allem mit Rohrzucker und Kaffee, gehandelt hatte, mittlerweile eigentlich sein Geld verdiente. Der Lebensstil ihrer Schwester kam ihr noch immer prunkvoll und verschwenderisch vor. Und immer wieder stand das Ehepaar großzügig bereit, um Onkel Fritz’ Schulden zu begleichen oder seine allzu knappe Kasse aufzubessern.
Einmal hatte sie ihre Schwester danach gefragt, doch die hatte nur die Schultern hochgezogen. «Ach, ehrlich gesagt sind Philipps Geldgeschäfte viel zu kompliziert, als dass ich sie verstehen könnte.» Und dann hatte sie das mädchenhafte Kichern aufgesetzt, das sie sich angewöhnt hatte, kurz nachdem sie eine Dame der Gesellschaft geworden war.
Nun seufzte Josephine noch einmal. «Die Franzosen können die Stadt doch nicht für immer halten …»
«Mir bereiten gar nicht die Franzosen die meisten Sorgen», schaltete sich da Philipp mit seiner etwas nasalen Stimme ein, ohne zu den Frauen hinüberzusehen. «Viel mehr beunruhigt mich der Pöbel.» Mit dem Zeigefinger wies er durch das Fenster nach draußen. «Seht ihr das?»
Josephine beugte sich nach vorn, um an ihrer Schwester vorbei schauen zu können. Gerade passierte die Kutsche eine kleine Gruppe zerrissener Gestalten, die die Köpfe zusammensteckten. Einer von ihnen schien wild auf die anderen einzureden, ein Zweiter nickte mit geballten Fäusten. Ihre Haut war gerötet und von weißen Schuppen übersät, ihre Haare verfilzt und die halbnackten Füße schwarz vom Dreck.
«Zusammenkünfte wie diese sind verboten, oder nicht?», fragte Ida leise. Wie um sie zu bestätigen, kläffte Marie-Antoinette. Es stimmte, die Franzosen hatten ein Dekret erlassen, wonach sich die Hamburger nicht mehr in größeren Gruppen an öffentlichen Orten aufhalten durften. «Sie haben Angst vor einer Revolte», hatte Onkel Fritz Josephine erklärt.
Mit einem Ruck öffnete Philipp nun die Tür der fahrenden Kutsche und rief: «Schert euch hier weg, oder soll ich das melden?!»
Die Köpfe der Männer wirbelten herum, und schneller als eine Schar Möwen stoben sie auseinander und verteilten sich in sämtliche Richtungen.