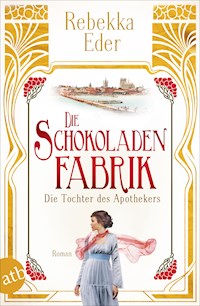9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Eine Liebesgeschichte zwischen duftenden Hyazinthenfeldern und den Wirren der Märzrevolution – ein perfekter Schmöker für den Frühling von der Autorin von «Der Duft von Zimt» Berlin, 1848: Wo später einmal der Boxhagener Platz sein wird, erstrecken sich duftende Hyazinthenfelder, so weit das Auge reicht – die Ländereien der fünf Sonntag-Schwestern. Früher waren sie unzertrennlich, doch seit dem Tod ihres Bruders Heinrich steht ein dunkles Geheimnis zwischen ihnen. Vor allem die mittlere Schwester Alba leidet sehr unter dem großen Streit. Zumal ihre Familie drauf und dran ist, die Felder zu verkaufen, die Alba über alles liebt. In der Sprache der Blumen, die ihre Mutter sie gelehrt hat, versucht sie, mit ihren Schwestern Frieden zu schließen und für den Erhalt von Boxhagen zu kämpfen. Bis eines Morgens ein Fremder in ihrem Blumenbeet liegt, der vorgibt, der neue Gärtner zu sein. Hals über Kopf verliebt sie sich in ihn, ohne zu ahnen, dass in seiner Brust das Herz eines Revolutionärs schlägt, der bereits den Aufstand plant. Ihre Liebe verändert Albas Blick auf die Welt, sodass sie nicht nur Mut fasst, für eine bessere Zukunft zu kämpfen, sondern auch, sich der düsteren Vergangenheit ihrer Familie zu stellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 532
Ähnliche
Rebekka Eder
Hyazinthenschwestern
Historischer Roman
Über dieses Buch
Die geheime Sprache der Blumen, eine verbotene Liebe, die im Verborgenen blüht, eine Revolution, die alles verändern könnte …
Berlin, 1848: Wo später einmal der Boxhagener Platz sein wird, erstrecken sich duftende Hyazinthenfelder – die Ländereien der fünf Sonntag-Schwestern. Waren sie früher unzertrennlich, steht nun, seit dem Tod ihres Bruders, ein dunkles Geheimnis zwischen ihnen. Vor allem Alba, die mittlere Schwester, leidet unter dem Streit. Zumal ihre Familie drauf und dran ist, ihre geliebten Blumenfelder zu verkaufen. Zunächst wagt Alba es nicht, ihren Schwestern die Stirn zu bieten.
Das ändert sich, als sie eines Morgens einen Fremden in ihrem Blumenfeld findet, der vorgibt, der neue Gärtner zu sein. Doch schnell stellt sich heraus, dass sein Herz nicht wirklich für Pflanzen schlägt, sondern für die sich anbahnende Revolution – und schon bald auch für Alba Sonntag…
Der perfekte Schmöker für den Frühling
Vita
Rebekka Eder ist ein Pseudonym. Die Autorin wurde 1988 in Kassel geboren und hat Theaterwissenschaft und Germanistik in Erlangen, Bern und Berlin studiert. Schon während des Studiums begann sie, Romane zu schreiben. Nachdem sie als Journalistin und Werbetexterin arbeitete, machte sie ihre Leidenschaft zum Beruf. Heute lebt und schreibt sie auf dem nordhessischen Land. Sie ist fasziniert von verblichenen Fotografien, gut gehüteten Familiengeheimnissen und der uralten Sprache der Blumen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Copyright © 2024 by Rebekka Eder
Karte © Sabrina Knoll
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Richard Jenkins; Johann Kräftner /brandstaetter images / akg-images; Shutterstock
ISBN 978-3-644-01697-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Einen Kranz von wilden Rosen
Wand das Schicksal mir in’s Haar,
Mir, der Fremden, Heimathlosen,
In den Stürmen der Gefahr.
Aus «Wilde Rosen» von Louise Aston
Prolog
Mit geübten Handgriffen streifte sich Ottilie das Brautkleid über. Ihre Fingerspitzen strichen über die cremefarbene Seide, spürten dem Blumenmuster nach, dem sie wohl niemals mehr entkommen würde. Sie fasste nach den Schnüren und zog sie fest, bis es wehtat. Lächelnd blickte sie in den angelaufenen Spiegel. Die blinden Flecke wirkten wie Wunden in ihrem Gesicht, die niemals verheilen sollten. War sie noch immer schön? War das überhaupt noch wichtig?
Sie wandte sich ab und verließ das Schlafzimmer, schritt durch den langen, dunklen Flur und die Treppe hinunter. Die Schleppe ihres Kleides flüsterte auf den hölzernen Stufen. Während sie die Haustür öffnete, dachte sie an die Klänge der Orgel damals. An die gerührten Blicke ihrer Gäste. Eine Hochzeit ging immer ans Herz. Schließlich veränderte sie das Leben zweier Menschen. Für immer.
Fast konnte sie das Hüsteln und Wispern hören, das sich in einer Kirche nirgends verstecken konnte, das an den hohen Wänden widerhallte wie eine Warnung. Dabei war es hier draußen beinahe still. Da war nur die Eule, die sie Nacht für Nacht grüßte. Nur der Wind in den knarrenden Ästen der Kirschbäume. Dunkelheit lag über Boxhagen.
In der Ferne sah Ottilie die Häuser ihrer Schwestern. Hinter den Fenstern brannte kein Licht, sie alle schliefen. Keine von ihnen sah, was Ottilie sah: den Schatten des Waldes, das Glänzen des Sees, die Eisenbahnschienen, die das Licht des Mondes reflektierten. Und dazwischen: Hyazinthen, so weit das Auge reichte. In den Nächten, in denen die Wolkendecke so dicht war, dass weder Mond noch Sterne hindurchdrangen, riefen sie sich nur durch ihren schweren Duft in Erinnerung. Doch in dieser Nacht ließ das Mondlicht all die weichen, zarten Blüten unheilvoll schimmern. Dunkelblau. Violett. Türkis. Blassgelb. Blutrot. Ein gewaltiger Teppich, ein wogendes Blumenmeer. Ottilie konnte sich nicht sattsehen an dem düsteren Farbenspiel. Ohne den Rock ihres Brautkleids anzuheben, setzte sie den ersten Schritt ins Feld. Ihre Schleppe war ohnehin längst verdreckt. Langsam zog Ottilie sie hinter sich her, spürte Kälte unter ihren Fußsohlen und feuchte Erde zwischen ihren Zehen. Sie lief durch die lautlos schaukelnden Hyazinthen und sog ihren Duft tief ein, obwohl er ihr Übelkeit bereitete. Weil er ihr Übelkeit bereitete.
Sie hatte es nicht anders verdient.
Ob ihm genauso übel gewesen war? Ob er unter derselben Schönheit hatte leiden müssen? Immer wieder kamen ihr diese Fragen, obwohl Ottilie sie kaum ertrug. Sie ging schneller, versuchte, ihnen davonzulaufen. Doch das Blut, das vor Jahren in die Erde Boxhagens gesickert war, hatte sich bereits über das Land verteilt, war unzählige Male umgegraben und von den Hyazinthenwurzeln aufgenommen worden. Nun wuchs es in all den Stängeln, all den Blüten in Richtung Himmel. Ottilie konnte nicht anders. Sie blieb stehen, legte den Kopf in den Nacken und schrie. Schrie, so laut sie konnte. Schrie, weil sie nicht ändern konnte, was geschehen war, und auch nicht, was noch geschehen würde. Schon bald würden all die Blumen geerntet werden. Und dann begann alles von vorn. Der Sommer trocknete das sandige Land aus, der Herbst überschwemmte es, der Winter ließ die Hyazinthenzwiebeln erkalten, damit sie im März erneut emporsprießen konnten. Da war Schönheit. Da war Tod. Nichts von beidem konnte sie ändern. Und für einen Moment verharrte Ottilie, nur um erneut Luft zu holen.
1
1. Kapitel
Boxhagen, Oktober 1847
Der schwere Duft feuchter Erde umgab mich, während ich in meinem frisch geharkten Blumenfeld kniete und kleine Löcher aushob. Vorsichtig setzte ich Zwiebel um Zwiebel ein und schob die Erde darüber, drückte sie mit beiden Händen fest, während ich das Leben darin spürte. Über jeden schimmernden Käfer und jeden Regenwurm, der mein Blumenfeld bevölkerte, musste ich lächeln.
«Ihre Mutter wäre glücklich, Sie so zu sehen. Wenn ich das sagen darf, Fräulein Sonntag», brummte Herr Range hinter mir.
Ich drehte mich halb zu ihm um. Der alte Gärtner aus der böhmischen Kolonie zwinkerte mir zu und grub dann emsig weiter Zwiebeln ein. In der Ferne packten weitere Kolonisten sowie mein Gehilfe Alfred fleißig mit an. Dieser milde Oktobertag war perfekt, um Hyazinthen zu pflanzen. Der Wind kühlte uns die Haut, und die Erde war weder zu nass noch zu trocken.
«Ich bin Ihnen wirklich dankbar für Ihre Hilfe …», sagte ich nicht zum ersten Mal.
«Das ist doch selbstverständlich, Fräulein Sonntag. So oft, wie Ihre Familie uns geholfen hat … Das kann ich gar nicht wiedergutmachen.»
«Sie brauchen es nicht wiedergutzumachen, Herr Range.»
Sobald er von der Wohltätigkeit meiner Familie sprach, bekam ich einen Knoten im Bauch. Ja, wir hatten ihnen Kredite gegeben, als die Kartoffelfäule die Ernten der böhmischen Gärtner von Boxhagen vernichtet hatte. Doch die Beträge waren gemessen am Umsatz des Vorwerks Boxhagen lächerlich gering gewesen. Schon als Kind hatte ich mich darüber gewundert, warum die einen über 260 Morgen Land besaßen und immer mehr Reichtum anhäufen konnten, während die anderen kleine Parzellen pachten und ums Überleben kämpfen mussten. Über diese Ungerechtigkeit hatte ich oft mit Heinrich gesprochen. Heinrich, mein großer Bruder, mein Vertrauter. Ich schloss die Augen, versuchte, den Schmerz, der in meiner Brust aufstieg, niederzukämpfen. Nicht jetzt.
«Ich finde es wunderbar, dass eine Dame wie Sie noch selbst Hyazinthen zieht und pflanzt. Ganz wie Ihre Mutter. Damit halten Sie ihr Andenken in Ehren.»
«Sie sind wahrscheinlich der Einzige, der das wunderbar findet, Herr Range.» Ich musste an meine Schwestern denken und daran, wie sie ihre Nasen rümpfen würden, wenn sie mich so sehen könnten. Wir waren die Besitzerinnen dieses Landes. Nicht seine Gärtnerinnen – das zumindest betonte vor allem Ludmila, die Älteste von uns, sehr gern.
«Mitnichten, Fräulein Sonntag! In der Kolonie sagen das alle.»
«Sie sprechen in der Kolonie über mich?» Besorgt blickte ich wieder über meine Schulter. Seine gerunzelte Haut wurde von einem rosaroten Schimmer überzogen.
«Nur … hin und wieder», gab er zu.
Die Kolonie lag am Rande des Vorwerks Boxhagen. Der König von Preußen hatte im vorigen Jahrhundert Gärtner aus Böhmen auf bis dato ungenutzten Sandschollen nördlich unserer Ländereien angesiedelt, damit sie den Boden fruchtbar machten. Auf ihren Parzellen hatten sie Obstbäume und Gemüsefelder angepflanzt. Ich mochte die böhmischen Familien gern. Als wir klein gewesen waren, hatten wir jüngeren Sonntag-Schwestern – Ottilie, Clara und ich – den ganzen Tag mit den Kindern der Kolonisten gespielt. Viele Stunden waren wir durch die Gärten getobt, auf die knorrigen Obstbäume geklettert und hatten uns auf alten Dachböden versteckt.
«Sie wissen doch, wie beliebt Sie bei uns sind.» Herr Range lächelte unter seinem dichten grauen Bart. «Sie sind sich nicht zu schade, selbst in der Erde zu wühlen, und lieben Ihre Blumen. Das kommt bei unsereins gut an.»
Ich ahnte, dass das nicht alles war. «Und was sagt man noch über mich?»
«Ach, nichts weiter …» Herr Range winkte ab und starrte konzentriert auf eine Zwiebel. Er drehte sie in der Hand und hielt sie in die Sonne. «Das wird doch kein Schimmel sein?», murmelte er.
Ich wischte die Hände an meiner Schürze ab und wandte mich gänzlich zu ihm um. Ich sollte nicht nachhaken. Was jetzt kam, würde wehtun, das wusste ich. Und vielleicht wollte ich es deswegen hören.
Als er meinen Blick und die Entschlossenheit darin sah, seufzte er und ließ die Zwiebel sinken. «Nun gut. Wir machen uns ein wenig Sorgen um Sie, Fräulein Sonntag. Sie haben Ihre lieben Eltern viel zu früh verloren. Das steckt niemand so einfach weg. Und dann auch noch Ihr Bruder … Es heißt, seit seinem Tod … sind Sie nicht mehr dieselbe.»
Ich sollte widersprechen, das Thema wechseln. Stattdessen verharrte ich und sah ihn fragend an.
«Es geht das Gerücht um, Sie würden seitdem kein Wort mehr sprechen. Hätten sich fürchterlich mit all Ihren Schwestern zerstritten. Und einige sagen …» Er zögerte. «Meine Frau und ich geben natürlich nichts auf dieses Geschwätz. Fräulein Sonntag, sagen wir immer, ist die Sanftheit in Person! Stets hilfsbereit, stets nachsichtig. Mit dem Tod ihres Bruders kann sie nicht das Geringste zu tun haben.» Mehrfach nickte er, als wollte er seinen eigenen Worten Nachdruck verleihen. Er stellte keine Frage, doch sein Blick unter den dichten Brauen huschte wiederholt zu mir herüber.
Ich mochte Herrn Range sehr. Bei seiner Familie waren wir besonders häufig zu Besuch gewesen. Mittlerweile arbeitete seine Tochter als Dienstmädchen in Berlin, aber mit ihm und seiner Frau verband mich noch immer eine familiäre Freundschaft. Ich konnte ihn nicht anlügen.
Mit dem Handrücken wischte ich mir über die Stirn. «Verstummt bin ich nicht, jedenfalls nicht ganz.» Ich rang mir ein gequältes Lächeln ab. «Clara und ich verstehen uns gut. Aber meine anderen Schwestern …» Ich senkte den Blick. Gedankenverloren bohrte ich die Finger tief in die kalte, feuchte Erde.
«Das wird wieder, Fräulein Sonntag», sagte Herr Range. Ein bisschen hilflos wirkte er, wie er da hockte und mich mit herabhängenden Mundwinkeln und großen Augen ansah. Angesichts seines Mitgefühls schossen mir die Tränen in die Augen. Ich hatte es nicht verdient. Alba, flüsterte, wie so oft, eine Stimme in mir. Alba, was hast du getan? Schnell schnappte ich mir eine Zwiebel und vergrub sie in der Erde.
Als ich das aufgeregte Gekläffe hörte, war ich erleichtert. Es gab mir einen Grund, aufzustehen und meiner Traurigkeit zu entfliehen.
«Echo!», rief ich. «Hierher!»
Doch der graue Mischling dachte nicht im Traum daran, auf mich zu hören. Bellend und knurrend raste er auf das sich nähernde Pferd mitsamt Reiterin zu.
«Echo! Komm auf der Stelle zurück!» Ich rannte los.
Mit nach vorn gerichteten Ohren blieb er stehen, drehte den Kopf in meine Richtung.
«Ruf diesen verfluchten Köter zurück!», rief die Reiterin mir entgegen. Hätte ich meine Schwester Amalie nicht längst erkannt, ihr Befehlston hätte sie endgültig verraten. Doch Echo entschied sich gegen mich und dafür, weiter auf Amalie zuzuhasten. Wütend sprang er an den Beinen ihres Pferdes hoch. Es scheute, tänzelte hin und her.
Erst als ich nur noch einen Schritt von ihnen entfernt war und erneut brüllte: «Nein, Echo!», stob er zur Seite davon, trottete im Halbkreis um mich herum und blieb hinter mir stehen.
«Entschuldige, Amalie», sagte ich, während Amalies Pferd neben mir zum Stehen kam.
Wie eine Königin saß sie auf ihrem erhabenen Tier. Amalie war die Schönste unter uns Schwestern. Und das lag nicht nur an ihrem schwarzen Haar, das mich stets an die Blüten der Tigerlilie erinnerte. In ihrem ovalen Gesicht leuchteten die schräg stehenden Augen mit den dichten Wimpern und die dunkelroten Lippen gefährlich. Schon als sie noch ein kleines Mädchen gewesen war, hatten sich völlig Fremde verblüfft nach ihr umgedreht. Das zumindest hatte uns Mutter gern erzählt. Ich war damals noch nicht geboren, doch vorstellen konnte ich es mir gut.
In letzter Zeit sah man Amalie selten ohne Pferd. Den Blick ernst und konzentriert in die Ferne gerichtet, galoppierte sie mit wehenden Röcken über die Felder. Normalerweise ritt sie die Kutschpferde der Sonntags. Das Tier, auf dem sie heute saß, hatte ich noch nie zuvor gesehen.
«Wer ist denn diese Schönheit?», fragte ich. «Woher …»
«Erzieh deinen Köter, verstanden?», unterbrach mich Amalie. «Es kann nicht sein, dass er jedes Pferd vom Land jagen möchte, das eine halbe Meile von ihm entfernt vorbeigaloppiert. Stell dir vor, er würde das bei einem Besucher machen!»
Mit einer winzigen Bewegung ihrer Schenkel lenkte sie das schwarz glänzende Tier zurück auf den Feldweg, und weg war sie.
Tief atmete ich durch. Gerade wollte ich zu meinen Hyazinthen zurückkehren, als Echo schon wieder bellte. Diesmal in den höchsten Tönen – eindeutig vergnügt.
Ich drehte mich um und sah Clara und Ludmila in meine Richtung spazieren. Begeistert rannte Echo zu Clara, die sich lachend zu ihm hinunterbeugte.
«Na, da ist ja mein Lieblingsräuber!», rief sie und erlaubte ihm, an ihren Fingern zu knabbern. Ludmila ließ er links liegen. Die Ignoranz beruhte auf Gegenseitigkeit. Ich wusste nicht, ob Ludmila ihn keines Blickes würdigte, weil sie noch nie viel mit Tieren hatte anfangen können oder weil Echo mein Hund war. Aufrecht und steif verharrte sie neben Clara und blickte in die Ferne. Ein Fremder würde niemals ahnen, dass die beiden Schwestern waren: Clara hatte so tiefe Lachgrübchen in ihren vollen Wangen, dass ich sie sogar aus der Ferne sehen konnte. Sie war die Jüngste von uns Schwestern, honigblond, rundlich und stets fröhlich.
Ludmila hingegen war die Älteste – brünett, hager und ernst. Bis heute versuchte sie, uns alle zu erziehen. Bei mir hatte sie mit Sicherheit das Gefühl, vollkommen versagt zu haben.
In einiger Entfernung blieb ich stehen und blinzelte gegen die Sonne an.
«Hallo, Alba!», rief Clara mir zu und winkte. Ich ging ein paar vorsichtige Schritte weiter. Erst jetzt entdeckte mich auch Ludmila, und ihre Augen weiteten sich.
«Jesus, Maria und Josef!» Sie blinzelte, dann kam sie mir mit entschlossen vorgerecktem Kinn entgegen. «Alba, was machst du denn da?» Ihr spitzes Gesicht war noch ein wenig blasser als sonst, und die Haut unter ihren hellgrünen Augen schimmerte rötlich.
«Ich bepflanze mein Hyazinthenfeld», sagte ich vorsichtig. Früher hätte mich Ludmilas herrischer Tonfall wütend gemacht. Doch die Dinge hatten sich geändert.
«Du siehst aus wie eine Bäuerin, ist dir das klar? Du kannst doch hier nicht in derart verdreckter Kleidung in der Erde wühlen.»
«Es ist Oktober. Die Hyazinthen müssen gepflanzt werden.» Wieso fühlte ich mich im Gespräch mit Ludmila immer wie ein Kind? Ich war zwar zehn Jahre jünger als sie, aber immerhin schon vierundzwanzig.
Ludmila schloss die Lider, wie um sich zu beherrschen. «Alba, du besitzt 52 Morgen Land. Ist dir das bewusst?» Jetzt schlug sie die Augen wieder auf. «Du kannst nicht dein komplettes Land selbst bestellen. Dafür gibt es Leute. Du bist immerhin eine Sonntag.»
Ich knetete meine Hände. «Die Kolonisten helfen mir.»
Ludmila verzog den Mund. «Du musst gelernte Gärtner einstellen, Alba. Du kannst die Arbeit auf den Feldern nicht selbst anleiten!»
«Mutter hat ihr Land auch gern selbst bepflanzt», sagte ich. «Wir haben ihr immer geholfen. Und wir haben es geliebt.» Beim letzten Wort brach meine Stimme.
«Du hast es geliebt, Alba. Ich habe es schon damals nicht ausstehen können. Aus gutem Grund – die Arbeit ist uns jedes Mal über den Kopf gewachsen. Bis Mutter endlich mehr Gärtner eingestellt hat. Für eine Arbeit wie diese braucht es nun mal geübte Hände. Unsereins ist dafür nicht gemacht.»
Kurz stockte ich. Früher hätte ich ihr widersprochen, ihr erklärt, dass ich nicht an diese Standesunterschiede glaubte. Doch ich wollte die Situation zwischen uns nicht noch weiter verschlimmern.
«Ich habe leider noch keinen Gärtner gefunden, der die Arbeit anleiten könnte …»
«Dann such bitte weiter. Was sollen die Leute von uns denken?»
Hilfe suchend sah ich zu Clara hinüber. Prompt warf sie mit ihrer glockenhellen Stimme ein: «Ach, die interessieren sich lang nicht so sehr für uns, wie wir immer meinen. Sei nicht so streng, Ludmila! Wenn es Alba doch Freude macht …»
Ludmila schnaubte. «Das ist mein letztes Wort, Alba. Wenn du keinen Gärtner findest, suche ich einen für dich aus.»
Zwar war sie nicht meine Mutter, und im Streit hatte sie mir vor gar nicht allzu langer Zeit an den Kopf geworfen, auch nicht mehr meine Schwester sein zu wollen. Doch ihr Wort hatte Gewicht, das wussten wir beide. Schließlich war meine Vormundschaft nach dem Tod unseres Vaters und unseres Bruders wie üblich auf den Mann meiner ältesten Schwester übergegangen: meinen Schwager Otto. Ich führte das freieste und selbstständigste Leben, das überhaupt möglich war – solange ich Otto keine Probleme bereitete. Und eine Ehefrau, die über das Benehmen der kleinen Schwester schimpfte, war sicher ein Problem.
Also nickte ich Ludmila zu.
Die drehte sich auf dem Absatz um, bot Clara ihren Arm und schritt mit ihr gemeinsam weiter.
«Ich komme bald bei dir vorbei, meine Liebe!», rief Clara mir zu. Und ihr breites Lächeln wollte kein bisschen zu unser aller Stimmung passen.
2. Kapitel
Boxhagen, Oktober 1847
Am liebsten wäre Amalie immer weitergeritten. Sie fühlte sich eins mit diesem mächtigen und zugleich zierlichen Tier. Sie liebte seine glänzende Mähne, das sanfte Auf und Ab seines Halses, die kräftigen Schultermuskeln zwischen ihren Knien. Hier oben, mit der Nase im Wind und den Waden am Pferdebauch, erschienen ihr all ihre Sorgen weit entfernt. Alba und die Wut, die schon allein ihr Anblick bei Amalie entfachte. Der ständige Schmerz, tief in ihrem Unterleib. Und Friedrich, ihr Mann.
Sie hatte gehofft, ein langer Ausritt rund um das Vorwerk Boxhagen würde ihr Gemüt abkühlen, doch nichts half. Eine Stunde war sie bereits unterwegs, und ihr Pferd brauchte eine Pause. Amalie musste sich der Situation stellen.
Albas Blumenfeld grenzte an ihre eigenen Ländereien. Amalie trabte über den Weg, der zwischen violetten Kohlköpfen hindurchführte, direkt auf ihr Haus zu. Schräg dahinter erstreckte sich der Pferdestall. Wie sie es befürchtet hatte, wartete ihr Mann vor der Stalltür. Er hatte sich einen kleinen Tisch in der Sonne eindecken lassen. Mit elegant überschlagenen Beinen saß er da und trank aus einer Porzellantasse.
Amalie wusste, dass sie den bestaussehenden Mann weit und breit geheiratet hatte. Friedrich war groß und athletisch, sein Bart perfekt gepflegt, seine Kleidung modisch. Schon vor ihrer Hochzeit hatten ihr alle versichert, sie würden wunderbar zueinanderpassen. Ihre Anmut spiegele sich in seiner. Sie seien so schön, dass man wegsehen wolle und den Blick doch nicht von ihnen lösen könne. So hatte es zumindest Alba ausgedrückt. Beim Gedanken an ihre kleine Schwester bildete sich ein bitterer Geschmack auf Amalies Zunge. Entschlossen schob sie das Bild von Albas Gesicht mit dem asymmetrischen Kinn und dem dunklen Blick beiseite.
Friedrich stellte seine Tasse ab und sprang behände auf. «Was für einen Anblick du bietest! Ich muss sagen, ich bin überwältigt.»
Sie wusste, dass er es ernst meinte. Sein Blick klebte an ihr, er beobachtete jede ihrer Bewegungen, jedes Zucken in ihrem Gesicht. Wie sehr hatte sie es früher geliebt, so von ihm angesehen zu werden. Sie hatte ihn auf einem der Bälle kennengelernt, die Mutter gern in Boxhagen gegeben hatte. Für ihn hatte sie sich eine Ringelblume ans Kleid gesteckt, die unumwunden erklärte: Ich wünsche, mit dir zu tanzen. Die Traubenhyazinthe an seinem Frack hatte ihr galant geantwortet: Ich ziehe dich allen anderen vor.
Amalie wusste, dass sie großes Glück hatte: Friedrich war nicht nur ein erfolgreicher Bankier aus Berlin, sondern auch ein ungewöhnlich netter Mensch. Er war freundlich, zuvorkommend und wollte jedem, den er traf, Gutes tun. Dass er sich genauso sehr in Amalie verliebte wie sie sich in ihn, konnte sie kaum fassen. Sie galt zwar als Schönheit, doch auch als ausgesprochen schwierige und kratzbürstige Person. Die Leute behaupteten aber auch in einem fort Dinge, die sie gar nicht wissen konnten, was Amalie rasend machte. Jede Konversation war randvoll mit Gemeinplätzen:
Die Zeit heilt alle Wunden.
Das wird schon wieder.
Nichts als verbale Masken! Sie wollte sie den Leuten von den Gesichtern reißen und sehen, was darunter war. Nur Friedrich ließ sich davon nicht verschrecken. Er lachte überrascht auf, wenn sie widersprach, und hörte sich ihre Argumente genau an. Er ließ sich über den Mund fahren und korrigieren, manchmal wechselte er nach einem Gespräch mit Amalie sogar tatsächlich den Kurs. Dafür hatte sie ihn geliebt.
Und nun stand er da, verliebt wie eh und je – stolz auf seine Frau. Doch sie wusste nicht mehr, was sie für ihn empfand. Liebte sie ihn noch? Der Zorn in ihr überlagerte alles andere.
«Wie war der erste Ritt auf Adonis?», fragte Friedrich.
«Gut», sagte Amalie.
Als sich Enttäuschung auf seinen ebenmäßigen Gesichtszügen abzeichnete, fügte sie hinzu: «Ich habe noch nie ein so großartiges Pferd geritten.»
Er strahlte. «Das freut mich außerordentlich. Ich habe mich lange beraten lassen. Adonis hat einen ausgezeichneten Stammbaum, und seine Gesundheit lässt nichts zu wünschen übrig. Der Züchter hat allerdings betont, dass er eine außergewöhnlich gute Reiterin braucht.» Friedrich kam mit ausgestreckten Armen auf sie zu und half ihr beim Absteigen.
«Das kann ich mir vorstellen. Er ist wirklich feinfühlig. Ich könnte ihn mit dem großen Zeh lenken, wenn ich wollte. Würde ich ihm derart im Maul reißen, wie ich es bei den Kutschpferden manchmal tun muss, wäre er schnell hinüber.»
«Ich konnte dich einfach nicht mehr auf diesen Gäulen sehen. Die schönste Frau des Landes gehört auch auf ein schönes Pferd.» Er zog sie an sich heran. Widerwillig gab sie ihm einen Kuss auf den Mund, und sein Bart kratzte unangenehm. «Also gefällt dir mein Geschenk?»
Amalie sah ihrem Mann ins Gesicht. Wie konnte er immer alles so verdammt richtig machen? Er war perfekt. Das Einzige, was nicht zu ihm passte, war dieses störrische Wesen, das er seine Ehefrau nannte.
«Es gefällt mir», gab sie zu und sah an Friedrich vorbei.
«Ist etwas vorgefallen?»
Alles in ihr schrie: Ja, natürlich, vor Jahren schon! Wie kannst du das nicht wissen? Doch diese Wahrheit war die einzige, die sie für sich behielt.
«Ich bin Alba begegnet», sagte sie stattdessen.
Friedrich verzog das Gesicht. «Komm, setz dich zu mir und erzähl mir davon.»
Schon eilte Tom, der Stallbursche, herbei. Der schlaksige große Junge tätschelte Adonis’ Hals. «Ein schönes Tier.» Er nickte Amalie zu und nahm seine Zügel.
«Danke, Tom», sagte sie. Zum ersten Mal an diesem Tag brachte sie ein kleines Lächeln zustande.
Tom führte das Pferd zu einem der Eisenringe an der Stallwand, um es dort festmachen und abreiben zu können. Derweil nahm Amalie auf dem Stuhl Platz, den Friedrich für sie zurückgezogen hatte.
Erwartungsvoll sah er sie an. «Wo hast du sie getroffen?»
«Auf ihrem Hyazinthenfeld. Sie war über und über mit Erde beschmiert. Wie Flora damals.» Amalie schüttelte den Kopf, um die Gedanken an ihre verstorbene Mutter zu vertreiben. «Ihr Hund hätte Adonis beinahe in die Beine gebissen.»
Friedrich lehnte sich im Stuhl zurück. «Das wundert mich nicht. Alba sollte ihn an eine Kette legen.»
Bei der Vorstellung wurde es eng in Amalies Brust. «Kein Lebewesen gehört an eine Kette.»
«Wie war es, mit Alba zu sprechen?», fragte Friedrich vorsichtig.
«Sie hat wieder einmal so getan, als wäre alles in Ordnung. Natürlich bin ich nicht darauf eingegangen. Sie weiß genau, dass ich ihr nicht vergeben kann. Keine von uns kann das.»
«Außer Clara», sagte Friedrich.
Amalie schüttelte den Kopf. «Clara kann Konflikte nicht ertragen, ständig will sie Harmonie verbreiten. Aber im Grunde ist sie genauso wütend wie wir. Wenigstens sind wir so ehrlich und sagen es Alba ins Gesicht.»
«Ich weiß nicht.» Friedrich wiegte den Kopf. «Ich denke, Clara hat Alba wirklich gern.»
Bei den Worten fuhr Amalie hoch. Wie konnte er es wagen, über Clara und Alba zu sprechen, als würde er sie kennen? Die Sonntag-Schwestern waren zu fünft. Und ihre Geschichten waren ineinander verschlungen wie die Wurzeln in einem Hyazinthenglas. Niemand konnte sie durchblicken. Am wenigsten ein Außenstehender wie Friedrich.
«Ich werde ein Bad nehmen», sagte sie.
«Möchtest du nicht noch etwas mit mir trinken?» Mit flehendem Blick stand Friedrich auf, bot ihr die Hand.
«Nein. Ich bin müde. Entschuldige mich.»
Sie ließ ihn stehen und lief mit großen Schritten hinüber in ihre Villa.
In der Eingangstür hielt sie noch einmal inne und sah zu Albas Anwesen in der Ferne hinüber. Der alte Glasbau, in dem ihre Mutter früher Blumen gezogen hatte, glitzerte in der Sonne. Alba hatte kurzerhand ein schmales Wohnhaus anbauen lassen, so brauchte sie ihr Land nicht mehr zu verlassen. Sie lebte in diesem verschrobenen Haus, konnte durch das Wohnzimmer ins Gewächshaus gehen, um ihre Zwiebeln zu ziehen, und hatte ihr Hyazinthenfeld direkt vor der Haustür. Dort war Alba Tag und Nacht allein. Abgesehen von der inkonsequenten Clara, die ihre Besuche nicht lassen konnte, der Familie Range, die Alba hin und wieder aus Mitleid zur Hand ging, dem Gartengehilfen Alfred und Echo, dem verrückten Hund.
Kurz ertappte sich Amalie dabei, wie sie eine solche Einsamkeit herbeisehnte. Sie hätte ebenfalls gern ein Haus für sich und ein Land, das nur ihr gehörte. Doch eine Freiheit wie Albas wurde aus Schmerz geboren. Und noch mehr Schmerz in ihrem Leben könnte Amalie nicht ertragen.
Sie drückte die Klinke hinunter und ging hinein, um die wenigen Augenblicke zu genießen, in denen sie das Haus für sich hatte. Mit einem heftigen Ruck zog sie die Tür hinter sich zu.
3. Kapitel
Boxhagen, Dezember 1847
«Sie werden sich eines Tages beruhigen», sagte Clara. «Niemand kann für immer wütend sein.»
Obwohl sie seit Tagen das Bett hütete, sah sie frisch und glücklich aus, wie sie da gemütlich zwischen unzähligen Kissen lag. Ihr Bauch war innerhalb der letzten zwei Monate kugelrund geworden, liebevoll strich sie darüber. «Vor allem Ludmila wird irgendwann zu dem Schluss kommen, dass sie dir vergeben muss, sonst kann es mit ihrer großen Frömmigkeit ja nicht weit her sein, oder?» Sie zwinkerte mir zu.
Ich musste leise lachen.
«Ist doch wahr! Immer von Gottesfurcht sprechen und selbst nicht vergeben können.»
Ich schüttelte den Kopf. «Ich kann sie ja verstehen …»
«Schluss jetzt mit den Selbstvorwürfen! Unterhalte mich lieber ein bisschen – ich liege den ganzen Tag in diesem Zimmer herum.» Sie seufzte, doch die glücklichen Grübchen ließen sich auch davon nicht aus ihrem Gesicht vertreiben. «Was passiert dort draußen?»
Ich schluckte. Dort draußen passierte gar nichts. Es war Winter. Nichts blühte, nichts bewegte sich, außer Echo, der seine immer gleichen Runden über meine kahlen Ländereien drehte.
Clara ergriff meine Hand. «Der Winter wird bald vorüber sein. Und spätestens wenn die Hyazinthen aufgehen, wird alles anders …»
«Wie geht es denn unseren Schwestern?», fragte ich.
«Ludmila ist froh, dass ihr Otto für ein paar Wochen zurück in Boxhagen ist. Jetzt kann sie sich wieder mit ihm gemeinsam in der Kirche zeigen.» Clara grinste.
Erneut musste ich lachen. «Aber Clara!»
«Ich meine es gar nicht böse.» Sie winkte ab. «Ludmila geht es besser, wenn sie in Boxhagen nicht mehr alles allein entscheiden muss. Du weißt ja, wie sie ist. Für immer die älteste Schwester – ständig trägt sie für alles die Verantwortung. Es tut ihr gut, dass sie nun ein wenig davon an Otto abgeben kann.»
«Und Amalie?»
Clara zuckte mit den Schultern. «Ganz ehrlich? Ich weiß es nicht. Sie ist verschlossener denn je. Ich sehe sie nur noch auf ihrem neuen Pferd Adonis.»
«Das passt. Den Namen hat sie doch sicher selbst ausgesucht, oder?»
Clara kicherte. «Friedrich traue ich es auch nicht zu.»
Einen Moment sahen wir uns schweigend an. Sicher dachte auch Clara an unsere fünfte Schwester, über die keine von uns sprechen wollte. Ottilie. Früher war Clara häufig eifersüchtig gewesen, weil Ottilie und ich einander so nahegestanden hatten. Doch diese Zeiten waren lange vorbei.
«Mein Philipp hat sich übrigens wieder einmal mit Otto und Friedrich überworfen», wechselte Clara schnell das Thema.
«Schon wieder?» Ich zog die Brauen hoch. Zwar arbeitete ich eng mit Claras Gatten zusammen – ihm hatte ich den Vertrieb meiner Blumen und Zwiebeln überantwortet, er kümmerte sich um sämtliche Geschäftsbeziehungen und nahm mir die Korrespondenz nach außen ab. Dennoch versuchte ich stets, mich aus seinen Streitigkeiten herauszuhalten. Ich hatte schließlich alle Hände voll mit meinen eigenen zu tun.
«Er ist felsenfest davon überzeugt, unser Feld wäre vor seiner Abreise größer gewesen als jetzt. Er wisse nicht, ob Otto oder Friedrich dahinterstecke und ob die Verkürzung von Norden oder Westen geschehen sei. Dennoch fordere er sie dazu auf, die gestohlene Fläche zurückzugeben. Du kannst dir denken, wie die beiden reagiert haben?» Sie verzog das Gesicht. «Otto hat nicht aufgehört, höhnische Witze zu reißen und sich vor Lachen auf den dicken Bauch zu klopfen, woraufhin Ludmila Schnappatmung bekam und sich immer wieder bekreuzigte.»
Ich konnte die stocksteife Ludmila vor mir sehen. Ruckartig und mit gen Himmel verdrehten Augen beschrieb ich ein Kreuz vor der Brust.
Clara lachte laut auf und klatschte in die Hände. «Genau so, Alba, genau so!» Sie schüttelte den Kopf. «Jedenfalls hat Friedrich sein schönstes Lächeln aufgesetzt, Philipp an seinen Schreibtisch geführt und ihm dann in aller Seelenruhe die Adresse eines Psychikers aufgeschrieben. Du glaubst gar nicht, wie wütend Amalie deswegen geworden ist …»
Clara stockte in ihrem Redefluss, als hätte sie erst jetzt bemerkt, wohin ihre Geschichte sie geführt hatte. Ich wagte es nicht, sie anzusehen. Schnell sprach sie weiter: «Du weißt ja, wie leidenschaftlich Amalie werden kann, wenn … Na ja. Jedenfalls muss ich ehrlich sagen», sie senkte die Stimme zu einem Flüstern und beugte sich vertrauensvoll zu mir vor, «dass ich mich in diesem Moment ein wenig für Philipp geschämt habe. Ich weiß, man soll seinem Mann nicht widersprechen. Aber – ganz ehrlich? Manchmal lässt er sich zu sehr von seinem Wettbewerbsgeist regieren. Ich hoffe, ihm fällt bald etwas Neues ein, über das er sich echauffieren kann.»
Vor allem, da die Geschäfte bereits seit Monaten immer schlechter laufen, fügte ich in Gedanken hinzu. Unsere Zwiebeln und Blumen verkauften sich schleppend, die Einnahmen gingen stetig zurück. Beschwert hatte ich mich bisher nicht, schließlich war ich Philipp dankbar dafür, dass er mir sämtliche Vertriebsaufgaben abnahm. Dennoch würden wir irgendwann in der großen Runde darüber sprechen müssen. Nun aber beließ ich es bei einem Nicken, um Clara nicht weiter in ihren Sorgen zu bestätigen.
Ein Klopfen ließ uns beide zusammenfahren.
«Ja?», sagte Clara.
Ihr Mann streckte den Kopf ins Zimmer. «Bitte entschuldigt die Störung.»
Wie immer wurde mein Blick zuerst von der steilen Falte zwischen seinen Augenbrauen angezogen. Der hochgewachsene, schlanke Philipp war durchaus ein attraktiver Mann, allerdings wirkte er stets etwas missmutig und unzufrieden.
«Hallo, Alba, wie geht es dir?», fragte er beiläufig.
«Danke, gut, und dir, Philipp?», erwiderte ich steif.
Statt einer Antwort nickte er mir höflich zu. An seine Frau gewandt, sagte er: «Clara, denkst du daran, was der Arzt gesagt hat?»
«Du hast vollkommen recht, mein Lieber. Ich sollte jetzt ein wenig schlafen.»
«Ich wollte ohnehin gerade gehen», log ich.
«Auf Wiedersehen, Alba.» Er schloss die Tür und ließ uns noch einen Moment allein.
«Bitte entschuldige.» Bedauernd sah Clara mich an. «Es ist sein erstes Kind. Er möchte alles richtig machen, verstehst du?»
«Aber natürlich.»
Dass es auch ihr erstes Kind war und sie nun wirklich nicht den Eindruck erweckte, als bräuchte sie Ruhe, verkniff ich mir. Stattdessen zwang ich mich dazu, zur Tür zu gehen, Clara zum Abschied noch einmal zuzulächeln und dann die Klinke zu drücken.
4. Kapitel
Berlin, Dezember 1847
Sekundenlang stand Kasimir vor der Tür. Es kostete ihn Überwindung zu klopfen. Jedes Mal. Endlich hob er die Faust.
«Da ist er, da ist er!», schrie im Inneren der Wohnung eine Kinderstimme, und die Tür wurde aufgerissen.
«Onkel Kasimir!» Die kleine Lina stand mit breitem Zahnlückengrinsen vor ihm. «Ich habe mich so sehr auf dich gefreut! Komm rein, komm rein, ich habe dir schon einen Teller hingestellt. Du isst mit uns, oder? Bitte sag, dass du mit uns isst!»
Sie griff nach seiner Hand und zog ihn hinein.
Kasimir lachte. «Natürlich esse ich mit euch!»
Zuerst war da der Geruch, der ihm entgegenschlug. Wie eine Ohrfeige. Fäulnis, Moder und Exkremente. Er brauchte einen Moment, damit sich seine Augen an das spärliche Licht gewöhnten, das durch das winzige Fenster fiel.
Henriette kam mit großen, dunklen Augenringen auf ihn zu. «Bruderherz …» Sie schloss ihn fest in die Arme. «Danke, dass du gekommen bist.» Trotz allem tat es gut, ihre Stimme zu hören. Schon ihr sanftes Lispeln weckte ein warmes Gefühl von Heimat in seinem Bauch.
«Ich freu mich doch immer, euch zu sehen.»
Sobald sie ihn losließ, legte er den großen Laib Brot, die Rüben und den Sack Äpfel auf den Tisch, die er für die Familie seiner Schwester besorgt hatte.
«Danke, Schwajer. Du bist der Beste», sagte Joseph und schlug ihm auf die Schulter. Kasimir erwiderte seine halbe Umarmung und roch seinen Branntweinatem. Abgekämpft und müde sah er aus. Joseph hatte nur noch drei Zähne im Mund und Ruß im Gesicht. In einem anderen Leben hätte er ein gut aussehender Kerl sein können – stämmig, tiefe Stimme, breitbeiniger Gang. Doch die Streichholzfabrik, in der er schuftete, und all der Branntwein hatten ihn ausgehöhlt. Bucklig und zerlumpt stand er da. Ähnlich wie ihm war es Henriette ergangen. Kasimirs Schwester war eine große, dünne Frau, die ihren Kopf schwer vor sich herschob und deren verschleierte Augen gelblich schimmerten. Fettige Strähnen hatten sich aus ihrem Haarknoten gelöst, eine hatte sich an der trockenen, aufgesprungenen Haut ihrer Lippen verfangen.
«Und wie geht es dir, kleiner Mann?» Kasimir wandte sich dem stillsten Familienmitglied zu. Sein Neffe Hanns saß am Tisch und sah aus seinen eng stehenden Augen zu ihm auf.
«Hallo, Onkel Kasimir», sagte er schüchtern.
Kasimir ging zu ihm hinüber und wuschelte ihm durch das blonde Haar. «Wie war es heute in der Schule?»
Sein Mund öffnete sich, doch kein weiteres Wort kam über seine Lippen.
«Gut war es, oder?» Henriette sah ihren Sohn streng an. Brav nickte er.
Kasimir drängte ihn nicht weiter. Hanns war schon immer ein in sich gekehrter Junge gewesen, das ganze Gegenteil seiner aufgeweckten Schwester.
«Warst du wieder in der Universität, Onkel Kasimir? Hast du mit Studenten gesprochen?» Linas Augen leuchteten. Kasimir glaubte, dass die altehrwürdige Universität für Lina wie ein Königspalast aussehen musste. Folglich hielt sie Studenten für so etwas wie Prinzen.
«Selbstverständlich habe ich das. Und ich habe wieder erstaunlich viele Holzköpfe unter den gebildeten Männern entdeckt.» Er zwinkerte ihr zu, und Lina kicherte.
Vorsichtig setzte er sich auf einen der klapprigen Stühle, bemüht darum, den Blick nicht schweifen zu lassen. Er kannte die Gerüche nur zu gut, wusste, wie sich Wäsche auf der Haut anfühlte, die starr war vor Dreck, kannte den fauligen Geschmack alten Wassers, den bohrenden Hunger im Bauch und das Rascheln der Ratten hinter den Möbeln. Er wusste, dass die Fäulnis in den Wänden wohnte und dass sie stank, egal wie häufig das Fenster geöffnet wurde. Schließlich war er gemeinsam mit Henriette in einem Loch wie diesem aufgewachsen.
Er wünschte sich nichts mehr, als sie und ihre Familie hier herauszuholen. Doch wie zur Hölle sollte er das schaffen?
Er selbst hatte unfassbares Glück gehabt. Bevor sein Vater, ein Bibliothekar, gestorben war, hatte Kasimir – im Gegensatz zu seiner Schwester – eine relativ ansehnliche Bildung genossen. Später konnte er zumindest eine Lehre zum Laternenfabrikanten machen. Währenddessen lebte er bei Henriettes Familie und unterstützte sie finanziell. Allerdings sehnte er sich so sehr nach den Büchern, die in seiner Kindheit nie weit entfernt gewesen waren, dass er sich immer wieder in die Universität schlich. Irgendwann fand er heraus, dass er auch als Nicht-Student an Vorlesungen teilnehmen durfte. Seitdem ging er in jeder freien Minute hin und versuchte, so viel wie möglich zu lernen.
Dabei fand er bereits nach kurzer Zeit gute Freunde: zwei Brüder, eingeschriebene Studenten der Theologie, Philologie und Philosophie. Die Eltern lebten in Danzig und versorgten ihre Söhne regelmäßig mit Geld, sodass sie sich eine hübsch möblierte Wohnung mit zwei Betten und zwei Kanapees im studentischen Medizinerviertel nahe der Charité leisten konnten. Als sie erfuhren, dass Kasimir gemeinsam mit der Familie seiner Schwester in einer feuchten Dachkammer in der Königstadt hauste, bestanden sie darauf, dass er bei ihnen einzog. Das schlechte Gewissen darüber, dass er selbst diesen Ort verlassen, Henriette, Joseph und die Kinder aber nicht mitnehmen konnte, plagte ihn seitdem jeden Tag.
«Erzähl, Schwajer. Was jibt et Neues in der Welt?», fragte Joseph. Mit seinen Pranken griff er nach dem Brot, riss ein großes Stück ab, tauchte es in ein Glas Wasser und steckte es sich in den Mund.
Auch Henriette setzte sich. Schweigend verteilte sie dünne Suppe in die Teller, während Kasimir sagte: «In der Schweiz hat es einen Bürgerkrieg gegeben.»
«Großer Gott», sagte Henriette müde.
«Die Bevölkerung hat es geschafft, innerhalb kürzester Zeit einen freiheitlichen Bundesstaat zu erkämpfen. Auch in Nord- und Mittelitalien erheben sich Liberale und Demokraten gegen die Herrschaft.»
Joseph kaute langsamer. «Tatsächlich? Dit is jut, oder?»
«Das ist sogar sehr gut. In Frankreich fordern Arbeiter, Studenten und Handwerker bereits freie Wahlen.»
«Pass nur auf, deine verrückten Träume von der Demokratie werden am Ende doch noch wahr.» Joseph grinste und zeigte dabei seine schwarzen Zähne.
«Sie können wahr werden, wenn wir darum kämpfen», sagte Kasimir.
«Ich kämpfe mit dir, Onkel Kasimir!», rief Lina. «Gegen wen?»
«Gegen den preußischen König natürlich.» Kasimir musste lächeln.
«Wenn ich ein Schwert bekomme, mache ich auch mit», sagte Hanns und sah Kasimir mit treuem Blick an.
Die drei Erwachsenen lachten. «Ihr wisst, dass wir nur Spaß machen?» Kasimir zwinkerte Hanns und Lina zu. «Nicht, dass ihr in der Schule davon sprecht! Das ist sehr gefährlich, versteht ihr?»
«Ach!» Lina winkte ab. «Die Schule ist doch eh vorbei.»
«Lina!», fuhr Henriette sie an.
Lina ließ ihren Löffel fallen und schlug sich die Hand vor die Stirn. «Das war ja ein Geheimnis», flüsterte sie.
Kasimir wischte sich mit dem Handrücken über den Mund und sah seine Schwester an. «Was meint sie damit?»
Mit einem Mal war es still in der düsteren Kammer.
«Henriette, warum gehen die Kinder nicht mehr zur Schule?»
Es war Joseph, der als Erster das Schweigen brach. «Schule is wat für Reiche. Is doch so, Joldstern? Sag’s ihm.»
«Es ist so. Was sollen wir machen?! Wir können es uns nicht leisten, die Kinder in die Schule zu schicken! Sie müssen arbeiten, wie wir auch. Alles wird teurer, wir können kaum die Miete bezahlen, an manchen Tagen haben wir nicht mal Brühe auf dem Tisch!»
Und Kasimir saß hier seelenruhig und aß ihre Suppe! Eine Portion, von der seine Nichte und sein Neffe vielleicht ein weiteres Mal satt geworden wären. Schlagartig wurde ihm übel. Er sprang auf, rieb sich über das Gesicht und versuchte fieberhaft nachzudenken.
«Und wie … verdienen sie Geld?»
«Natürlich in der Fabrik.»
«Es ist ziemlich hässlich dort», sagte Lina. «Wir dürfen nicht einmal …»
Henriette schnitt ihr das Wort ab: «Wirst du wohl still sein, Lina!»
Kasimir stöhnte auf. Wie hatte er das zulassen können? Die Fabrik war eine Sackgasse. In einer Fabrik wurden die Menschen verheizt. Man starb in einer Fabrik. Dort begann man kein Leben. Hanns und Lina würden enden wie ihre Eltern.
Entschlossen schüttelte Kasimir den Kopf. «Nein, ihr geht wieder zur Schule, verstanden?»
Henriette lachte bitter auf. «Und willst du Schlaumeier uns jetzt auch erzählen, woher wir das Geld nehmen sollen?»
«Das Geld bekommt ihr von mir.»
Für einen Moment wurde es wieder still.
«Auf keinen Fall», knurrte Joseph schließlich. «Wir wollen keene Almosen vom feinen Herrn Nebel. Dit kannst du verjessen.»
«Es sind keine Almosen.» Kasimir stützte sich mit beiden Händen auf die Stuhllehne und sah seinem Schwager fest in die Augen. «Es ist mein Geschenk an meine Nichte und meinen Neffen. Als Onkel darf ich ihnen etwas schenken.»
«Du darfst ihnen überhaupt nichts …»
«Natürlich darf er das, du Holzkopf!», unterbrach Henriette ihren Mann. Wütend funkelte sie ihn an. «Wenn mein Bruder die Schule der Kinder zahlen will, dann lass ihn. Es geht um Lina und Hanns. Denk doch mal eine Sekunde nach und schluck deinen Stolz runter!»
Zerknirscht sah Joseph auf seinen Teller, schlürfte ein wenig Suppe vom Löffel und lehnte sich dann zurück. «Meinetwejen, Joldstern.»
«Jaaa!», jubelte Lina, sprang auf und hüpfte durch den Raum. «Wir gehen zurück zur Schule, zurück zur Schule!»
Ihre Freude drohte Kasimir zu zerreißen. Wie gern würde er so viel mehr für sie tun! Er schaute hinüber zu seinem Neffen. Der blieb zwar still sitzen, doch auf seinen Lippen zeichnete sich ganz vorsichtig ein Lächeln ab.
Immer wieder musste Kasimir an die Gesichter der beiden Kinder denken, während er durch die Straßen Berlins lief. Sie wuchsen auf wie er selbst damals. Dabei hatte sich für ihn längst eine neue Welt eröffnet. Er musste mehr für sie tun, sich stärker bemühen. Was er bei seiner Schwester gesagt hatte, meinte er vollkommen ernst: Er würde kämpfen.
Immer wieder streifte sein Blick im Vorübergehen Gruppen zwielichtiger Gestalten, die ihn aus stinkenden, dunklen Ecken lauernd beobachteten. In letzter Zeit bevölkerten immer mehr dieser Männer mit tiefen Tränensäcken und steifen Gliedern die Stadt: Zuwanderer aus den Provinzen, die Armut und Hunger nach Berlin getrieben hatten. Einst waren sie vielleicht Bauern gewesen. Doch hier angekommen, blieb ihnen oft keine andere Wahl als das Verbrechen.
Schnell lief Kasimir weiter. Da tauchte aus der Dunkelheit ein Kind auf, das es offensichtlich noch viel schlechter erwischt hatte als Hanns und Lina. Mit ausgehöhlten Wangen sah es zu ihm hoch. «Zündholzer?», flüsterte es mit rauer Stimme. Es trug keine Schuhe, keine Jacke. Durch seine zerschlissene Hose konnte Kasimir einen dürren Oberschenkel erkennen und Gänsehaut auf dem Knie.
Schnell kramte er ein paar Münzen aus seiner Tasche und gab sie dem Kind.
«Behalt die Zündhölzer», sagte er.
Seit Monaten wurden die Berliner immer ärmer. Und die Angst, die die Kartoffelfäule in den Köpfen der Menschen zurückgelassen hatte, hing wie grünbrauner Schimmel in all den kalten Straßen.
Nach einer Weile wurden die Gassen endlich heller und breiter, die Fassaden gepflegter. Er atmete auf, als er den Gendarmenmarkt erreichte und das Stehley sah. Leichtfüßig sprang er die schmale Holztreppe hinauf, hörte schon die vielen streitenden Stimmen, das Rufen und Höhnen der Debatten. Er mochte diese Geräuschkulisse. Schlagartig wurde ihm leichter ums Herz. Oben angekommen, öffnete er die Tür. Zigarrenqualm hieß ihn willkommen. Größer könnte der Kontrast zum Zuhause seiner Schwester kaum sein: Glitzernde Leuchter hingen an der Decke, die Tapeten waren gemustert und am Rand des langen Lesekabinetts standen elegante Nussbaumtische, an denen dicht gedrängt Herren unterschiedlicher Altersgruppen saßen, Zeitung lasen, diskutierten und einander ins Wort fielen. Manche trugen Frack und Zylinder, andere betonten ihre politische Gesinnung durch ihre voluminösen Vollbärte. Demokraten ließen derzeit möglichst dichte Gesichtsbehaarungen wuchern – und Kasimir war ziemlich enttäuscht darüber, dass ihm einfach kein ansehnlicher Bart wachsen wollte. Die wenigen hellen Härchen, die auf seinen Wangen sprossen, rasierte er sich lieber ab.
Vorsichtig bahnte er sich seinen Weg und hielt Ausschau nach seinen Freunden.
«Die Zeit ist gekommen!», rief eine ihm wohlbekannte Stimme. Er folgte ihrem Klang bis zu einem kleinen Tischchen in der Ecke, wo er kurzes, krauses Haar, einen dunklen Anzug und eine gelbe Fliege ausmachen konnte. «Jetzt müssen auch wir tätig werden», sagte Louise Aston gerade und zog kräftig an ihrer Zigarre.
Nach allem, was Kasimir heute erfahren und erlebt hatte, konnte er ihr nur aus vollem Herzen zustimmen.
5. Kapitel
Boxhagen, Dezember 1847
Ich schloss die Haustür von Clara und Philipp hinter mir und zog den Mantel enger zusammen. Es war ein eiskalter Dezembermorgen. Der Frost lag weiß und scharfkantig auf sämtlichen Grashalmen, auf der hart gefrorenen Erde der Feldwege und den kahlen Ästen der Kirschbäume. Den Blick hinüber zu Ottilies unheimlichem Haus, das auf derselben Höhe wie das von Clara und Philipp stand, mied ich. Stattdessen betrachtete ich den Gutshof schräg hinter Ottilies Anwesen: unser Elternhaus. Das alte Gemäuer war mit Efeu bewachsen, die Fensterläden grün gestrichen, und vor der zweiflügeligen Eingangstür erstreckte sich eine breite Treppe. Ich war sie lang nicht mehr hinaufgestiegen. Mittlerweile lebte Ludmila gemeinsam mit Otto in den Zimmern, in denen wir Schwestern aufgewachsen waren. Schnell lief ich weiter, vorbei an dem großen Kirschgarten, der sich rückwärtig an den Gutshof schmiegte, dem alten Schuppen und dem Pferdestall, die auf einer von Ludmilas weiten Wiesen standen. Ich passierte das Land von Amalie und Friedrich, ihre elegante kleine Villa inmitten ihrer Felder und überlegte, nach Hause zu gehen, entschied mich dann aber dagegen. Ich konnte der traurigen Schönheit dieser Winterlandschaft nicht widerstehen.
Tag für Tag lief ich auf meinen ausgetretenen Wegen und sehnte den Frühling herbei. Auch heute wollte ich eine kleine Runde drehen.
Unsichtbar ruhten die Hyazinthenzwiebeln unter dem Frost. Sie brauchten diese Kälte, um irgendwann blühen zu können. Und ich wollte so sehr daran glauben, dass ich ihnen ähnlich war. Dass aus dieser Winterstarre eines Tages doch noch etwas Gutes erwachsen würde.
Auf dem kleinen Hügel ganz am Rande der Boxhagener Ländereien blieb ich stehen und drehte mich um. Immer wieder kehrte ich an diese Stelle zurück. Einst hatte Mutter uns hierher mitgenommen. Damals, als wir noch Kinder waren und keine Waisen, als die Familie noch vollständig war und kein Streit in der Luft lag. Hier hatte Mutter uns zum ersten Mal von der Sprache der Blumen erzählt: «Eine Blume ist nie nur eine Blume. Sie ist ein Kunstwerk. Und wie ein Kunstwerk ist auch die Blume all das, was wir in ihr sehen.»
Hier hatte sie uns die Ländereien der Familie gezeigt. Unser Vater war immer der Überzeugung gewesen, wir sollten vor allem auf ein Leben als Ehefrauen vorbereitet werden, das wäre genug, um für unsere Sicherheit zu sorgen. Doch Mutter sah das anders. Wir dürften uns nicht darauf verlassen, dass Männer für uns sorgten, betonte sie. Stattdessen sollten wir unbedingt zusammenhalten.
«Im Grunde seid auch ihr wie Blumen», hatte Mutter gesagt. «Ihr steht genauso aufrecht, seid ebenso grundverschieden.»
Wie recht sie damit hatte, spürte ich seit unserer Auseinandersetzung mehr denn je. Nachdenklich ließ ich den Blick über die Landschaft wandern, stellte mir vor, wie sich die brachliegenden Felder in ein paar Monaten in ein Blütenmeer verwandeln würden.
Ich konnte es kaum erwarten.
«Wir können uns sehr glücklich schätzen, in unserem wunderschönen Boxhagen», hatte Mutter uns damals erklärt. Wir waren ihrem Blick gefolgt, hatten gen Südosten die herrliche Fernsicht Boxhagens genossen. Ich erinnerte mich gern an diesen friedlichen Moment mit meinen Schwestern zurück, versuchte, die Umgebung mit den Augen meiner Mutter zu sehen.
«Erkennt ihr ganz weit hinten, am Horizont, die kleinen Häuser?», fragte sie in meiner Erinnerung.
Amalie schnaufte. «Ich seh nur Punkte. Winziger noch als Ameisen.»
«Das ist die Kolonie. Es ist wichtig, dass ihr den Kolonisten gegenüber immer freundlich seid, hört ihr?»
«Oh Mama!» Amalie verdrehte die Augen und strich sich wie eine Erwachsene über ihren Rock. «Das sagst du uns jedes Mal. Dabei haben wir mit ihnen sowieso nie zu tun!»
«Ich mag unsere Nachbarn!» Clara, gerade sechs Jahre alt, strahlte. «Heute Morgen haben mich zwei Mädchen zum Spielen in ihren Garten eingeladen, und ich durfte Kirschen essen! Die waren köstlich.»
«Ich hoffe, du hast dir nicht den Magen verdorben», tadelte Ludmila sie sanft. «Dein Rock hat in jedem Fall einiges abbekommen.»
Wie Clara würdigte auch Mutter die roten Flecken keines Blickes, sondern schaute weiter in die Ferne. «Seht ihr ganz dahinten das Wasser?» Sie zeigte auf einen Punkt rechts von der Kolonie.
«Das ist …», setzte ich an.
«… der Rummelsburger See!», ergänzte Clara.
«So dunkelgrün und herrlich kühl», sagte Ottilie. Die ganze Zeit lang hatte die Mittlere von uns schweigend dagestanden. Ich hatte mich schon gefragt, ob sie überhaupt dem Gespräch lauschte oder mit ihren Gedanken mal wieder ganz woanders war. Doch nun sah sie mich mit ihren übergroßen, leicht vorstehenden Augen an.
Clara blickte ebenfalls zu uns hinüber, und wir blinzelten uns verschwörerisch zu. Schließlich waren wir erst vor ein paar Tagen am Rummelsburger See gewesen – mit Mutter. Sie brachte uns drei jüngeren Schwestern dort das Schwimmen bei. Doch das sollte besser unser Geheimnis bleiben, fand Mama. Ludmila würde es am Ende noch Vater sagen, und der machte sich immer zu viele Sorgen um seine Mädchen.
Ich liebte Geheimnisse. Sie fühlten sich an, als würden sie tief in mir Wurzeln schlagen, um eines Tages zu erblühen.
«Seht ihr dahinten die Gleise?» Mutter schwenkte den ausgestreckten Arm langsam nach rechts.
«Das ist die Frankfurter Eisenbahn, richtig?», fragte Clara. Amalie seufzte resigniert. «Was habt ihr nur für Augen? Ich sehe rein gar nichts.»
Nun schaute Ottilie Amalie direkt ins Gesicht. «Ich habe in einem Buch von einem Zauber gelesen, der deine Sehkraft verbessern könnte, Amalie …»
Amalie stemmte die Hände in die Hüften. «Du weißt genau, dass ich an den Unsinn nicht glaube.»
Ludmila bekreuzigte sich.
Ottilie zuckte mit den Schultern. Doch ihr Lächeln verrutschte keinen Millimeter, während sie den Kopf wieder drehte, um weiter in die Ferne zu schauen. Mir kroch ein wohliger Schauer über den Rücken. Ottilies unerschütterlicher Glaube an die Magie erfüllte mich stets mit einer Mischung aus Aufregung und Furcht. Konnte es wahr sein, dass Ottilie besondere Fähigkeiten hatte? Wenn Ottilie zaubern konnte, wäre auch für mich alles möglich.
«Und jetzt schaut auf die Felder dazwischen», fuhr Mutter fort. «Dahinten die Streuobstwiese, dort vorn das Weizenfeld, der Acker, der noch bearbeitet werden muss. Und all die weiten, bunten Blumenfelder. Seht ihr das?»
«Oh ja», sagte ich.
«Das sehe sogar ich.» Amalie warf ihr Tigerlilienhaar zurück.
«Dieses Land gehört eurem Vater. Unserer Familie», erklärte Mutter stolz.
«Möge der Herr es schützen», sagte Ludmila.
«Amen!», rief Clara laut und klatschte fröhlich in die Hände.
«Guckt mal», rief Amalie, die sich offenbar nicht für Mutters Ausführungen interessierte. «Dort hinten liegt Berlin.» Mit ausgestrecktem Arm zeigte sie nach Nordwesten.
Mutter verzog das Gesicht. «Berlin ist eine Steinwüste. Dort gibt es nichts als verwahrloste Häuser, dazwischen Rinnen voller Unrat, durch die sich die Ratten fressen, und einen erbärmlichen Gestank.»
«Iiiih!» Clara kicherte.
«Nur ein einziges Tor ist prächtig: das Brandenburger Tor im Westen. Der König hat den Platz davor für Besucher elegant herrichten lassen – und dabei die alten Häuser hinter blendenden Fassaden versteckt. Deswegen solltet ihr immer erst die Türen öffnen, bevor ihr ein Gebäude bewundert.»
Ich runzelte die Stirn und versuchte, mir die Worte meiner Mutter genau einzuprägen. Verstehen würde ich sie erst Jahre später.
Ich brauchte all meine Kraft, um die Augen zu öffnen und wieder in der Gegenwart anzukommen. Im Winter 1848, in dem das Boxhagener Land weiß gefroren und in fünf Abschnitte geteilt war. So vieles hatte sich verändert seit den glücklichen Stunden, die wir mit unserer Mutter auf diesem Hügel verbracht hatten.
Vier Jahre waren meine Schwestern und ich nun schon Erbpächterinnen von 260 Morgen Land. Alles, was ich von meinem kleinen Aussichtspunkt sehen konnte, gehörte nun uns.
Als kleine Mädchen hätten wir niemals damit gerechnet, all das könnte einmal uns gehören. Es hieß, wir würden heiraten und die Felder verlassen. Vielleicht haben meine Schwestern ihr Herz deswegen niemals an die Blumen verschenkt. Unsere Älteste, Ludmila, hatte ihre Gefühle sowieso meist gut im Griff. Täglich schloss sie die langen Hände zum Gebet, wie die Wetterdistel bei Nacht ihre Blütenblätter, und schöpfte Kraft in Gott.
Amalie, die Schönste, sah die Blumen immer nur als Waren. Sie wusste genau, wie viel eine Hyazinthenzwiebel gerade wert war und wann man neue Modefarben hineinkreuzen sollte, um mehr Gewinn zu machen. Manchmal schüttelte sie über die Bereitschaft der Menschen, so viel Geld für etwas derart Vergängliches wie Schnittblumen auszugeben, missbilligend den Kopf, sodass ihre Tigerlilienhaare wogten.
Ich glaube, Clara, unser Nesthäkchen, hing noch am meisten an unseren Feldern. Sie war zwei Jahre jünger als ich und so voll von Leidenschaft, dass auch jede einzelne Blume ihren Teil erhielt. Allerdings liebte sie nicht nur die Blumen, sondern die ganze Welt. Und je nachdem, in welcher Richtung das Licht gerade heller leuchtete, drehte sie, wie die Ringelblume, ihren Kopf.
Und dann war da noch Ottilie, unsere Mohnblüte. Betörend und fragil, liebreizend und gefährlich zugleich. Ich konnte ihren Namen nicht einmal denken, ohne einen lautlosen Schrei in meiner Kehle zu spüren. Hatte sie die Blumen je geliebt? Am liebsten pflückte sie die Pflanzen nachts, um sie heimlich zwischen den Fingern zu zerreiben …
Wir alle hatten nicht gewusst, wie uns geschah, als wir das Vorwerk Boxhagen erbten. Auch ich nicht, dabei hatte ich mir in meinem Leben nichts sehnlicher gewünscht, als hierbleiben zu dürfen. Von Kindesbeinen an konnte ich mich an den Feldern nicht sattsehen. Vater ließ damals gelbe Tulpen anbauen, dunkelrote Rosen, hellblaue Vergissmeinnicht, riesige, weiß gesprenkelte Jasmin-Büsche, Nelken und Heliotrope in den unterschiedlichsten Violett-Tönen und hohe, schlanke, tiefgrüne Reseden. Freilich zog er all die Schönheiten nicht selbst heran. Er war gelernter Koch und beschäftigte sich lieber mit der Ernte seiner Gemüsefelder. Für die Arbeit mit der Erde hatte er Gärtner eingestellt.
Dennoch war es Mutter, die die schönsten Blumen züchten konnte. Alles, was sie über Pflanzen wusste, hatte sie als Kind von ihrem Vater gelernt. Und dann gab sie es an mich weiter, an die einzige Tochter, die es wirklich interessierte. Wann immer unsere Gouvernante mir die Gelegenheit ließ, lief ich zu Mutter. Ich bettelte darum, mit ihr ins Gewächshaus gehen zu dürfen, wo sie mir das Kreuzen verschiedener Farben zeigte, oder zu unseren Beeten, in denen nur die prächtigsten Pflanzen stehen bleiben durften. Sie erklärte mir, wann man Blumenzwiebeln in die Erde setzte, damit sie es im Winter dunkel und kalt hatten. Und weil ich nicht bis zum Frühling warten wollte, brachte sie mir bei, wie ich Hyazinthen auch in meinem Zimmer ziehen konnte: Gemeinsam setzten wir eine Zwiebel in ein mit abgekochtem Wasser gefülltes Hyazinthenglas. Anfangs musste es tief hinten in meinem Regal stehen – es durfte kein Licht abbekommen. Tag für Tag holte ich es heimlich hervor und musterte es. Tatsächlich brachen schon bald winzige, dann immer größere Wurzeln aus der unteren Zwiebelhaut hervor. Sie waren so weiß wie der Rand meiner Fingernägel und so fein wie meine Haare. Immer dicker wurden sie, immer länger, kräuselten und verknoteten sich. Als der runde Bauch des Glases voller Wurzeln war, durfte ich es auf die Fensterbank stellen und der Zwiebel, die noch immer nicht viel Licht vertrug, ein Papierhütchen aufsetzen. So verkleidet sah es aus wie ein Kobold mit tausend dünnen Wurzelbeinen. Jeden Morgen sprang ich aus dem Bett und lugte neugierig unter das Hütchen. Als das erste Grün darunter zum Vorschein kam, konnte ich meinen Freudenschrei nicht unterdrücken. Mit aufgerissenen Augen starrte ich auf diese winzige grüne Spitze, die aus der Zwiebel ragte. Ein kleines Wunder, hier, in meinem Zimmer! Was vorher nur eine dunkelbraune Knolle gewesen war, begann zu leben.
Von da an fieberte ich den Blüten regelrecht entgegen. Langsam wurde die grüne Spitze immer länger. Sie schob, Millimeter für Millimeter, ihr Hütchen hinauf – und eines Tages lag es neben dem Glas. In der Mitte war das Grün aufgesprungen und hatte sich in vier dicke Blätter verwandelt. Von nun an ging alles so schnell, dass es mir den Atem raubte. Wann immer ich hinsah, hatte sich die Pflanze verändert. Aus den grünen Blättern wurden dicke, lange Stängel, die immer höher wuchsen, und dann erschienen unzählige, kleine Knospen, die sich daran emporrankten. Bald sprangen die ersten auf. Kleine, oval geformte Blütenbüsche strahlten mir entgegen. Wie sie leuchteten, wie filigran sie sich gen Licht streckten und wie herrlich intensiv sie dufteten! Draußen fiel der erste Schnee des Jahres, doch hier drin, in meinem Zimmer, war Frühling.
An dem Tag, an dem die Hyazinthe auf meinem Fensterbrett zum ersten Mal blühte, beschloss ich, Gärtnerin zu werden.
Mittlerweile waren meine Glieder steif vor Kälte, meine Fingerspitzen spürte ich kaum noch. Mein Wunsch von damals war in Erfüllung gegangen. Doch heute fragte ich mich immer wieder: zu welchem Preis?
Ich riss mich vollends aus meinen Erinnerungen und lief schnellen Schrittes zum Haus hinüber. Im September hatte ich Efeu gepflanzt, damit sich seine Wände bald hinter Grün verstecken konnten – und ich mich zwischen ihnen. Doch noch waren die Backsteine um die hohen Fenster und die dunkelrote Tür gut zu erkennen. Das Schönste an meinem Haus aber war seine Rückseite: Ich hatte es direkt an unser altes Gewächshaus anbauen lassen. Früher war der Glasbau der ganze Stolz meiner Mutter gewesen: Es war eines der ersten Gewächshäuser der ganzen Umgegend und verfügte über eine gläserne Kuppel sowie modernste Stahlträger.
Ich stürmte in meine Stube, und sofort hüllte mich der Duft von Hyazinthen ein. Aus den unterschiedlichsten Gläsern – schlank oder bauchig, gemustert oder gefärbt – leuchteten sie mir von sämtlichen Fensterbrettern entgegen. Mutter würde diese bunte Pracht in hellem Blau, kräftigem Rot und leuchtendem Gelb lieben. Doch sie war nicht hier. Niemand war hier. Das Mädchen, das mit vier Schwestern und einem Bruder aufgewachsen war, das nirgends im Elternhaus auch nur ein kleines bisschen Ruhe finden konnte, war einsam geworden.
Ich hatte sie alle verloren, vertrieben.
Still war das Haus.
Und nur die Blumen dufteten wie früher.
6. Kapitel
Berlin, Februar 1848
Kasimir konnte kaum glauben, was er da las. Atemlos entzifferte er die Zeile wieder und wieder.
«Gib her!»
«Lies vor!»
«Nun mach schon!»
Die Umstehenden versuchten, ihm die Zeitung aus der Hand zu reißen. Er hielt sie so hoch, wie er konnte, und erklomm schließlich den Stuhl, den Louise ihm mit dem Fuß entgegenschob. In den vergangenen zwei Monaten war er beinahe täglich hier gewesen. Seine Schwester und ihre Familie hatte er in dieser Zeit kaum besucht. Zu aufregend war die Stimmung im Stehley gewesen, zu groß die Hoffnung auf eine Nachricht wie diese. Und nun war sie endlich da.
«Am 24. Februar 1848», las Kasimir laut und deutlich vor, «wurde in Paris König Louis Philippe gestürzt. Der Monarch ist geflohen. In Frankreich wurde die Republik ausgerufen!»
Einen Moment lang war es vollkommen still im Stehley am Gendarmenmarkt. Dann brach der allgemeine Jubel los. Glücklich lachte und johlte die Menge, noch mehr Arme streckten sich Kasimir entgegen, und irgendjemand schaffte es schließlich doch, ihm die Zeitung wegzunehmen. Mit einem ungläubigen Lachen sprang Kasimir von seinem Stuhl.
«Es ist passiert, es ist wirklich passiert…»
Tagelang war der Postweg zwischen Berlin und Paris unterbrochen gewesen. Niemand hatte gewusst, was in Frankreich geschehen war, nur von Barrikaden hatten sie gehört, von Straßenkämpfen. Immer wieder hatten Kasimir und seine Mitstreiter die preußischen Blätter durchforstet, hatten zwischen den Zeilen gelesen, auf jedes noch so kleine Wort geachtet. Doch kein einziger Hinweis hatte es durch die strenge Zensur geschafft. Erst heute, am 28. Februar, waren endlich die französischen Zeitungen im Kabinett eingetroffen.
«Jetzt gilt es!», sagte Louise. Sie hüllte sich in dichten Zigarrenqualm und ließ sich seelenruhig auf einem Stuhl in der Mitte des Raums nieder.
«Und wie stellst du dir das vor, meine Liebe?», fragte Adalbert mit einem hintergründigen Schmunzeln. Er wedelte den Rauch beiseite, sodass Kasimir sein rundes Gesicht mit dem wilden, ungezähmten Vollbart der Demokraten sehen konnte. «Du bist schon einmal aus dieser Stadt verbannt worden.»
Louise zeigte mit ihrer Zigarre auf ihn: «Das wird diesmal nicht passieren. Weil wir allesamt nonkonformistisches Verhalten an den Tag legen werden. Sie können uns nicht zu Tausenden verbannen.»