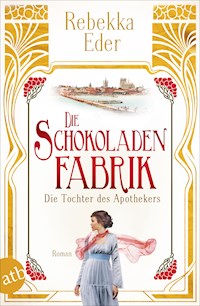
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Stollwerck-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Bonbons, Liebe und Revolution.
Köln, 1838: Anna Sophia liebt es, ihrem Vater in der Apotheke zu helfen. Stolz ist sie auch auf ihre eigene Kreation: köstliche Hustenbonbons. Als der Apothekergeselle August um ihre Hand anhält, blickt sie einer sicheren Zukunft entgegen. Doch plötzlich wird ihr Vater krank. Die Ärzte scheinen ihm nicht helfen zu können, und ausgerechnet August gerät unter Verdacht, ihrem Vater schaden zu wollen, um die Apotheke an sich zu reißen. Währenddessen kehrt Franz Stollwerck, der Sohn des Krämers, nach Jahren der Wanderschaft in die Stadt zurück. Er ist schon seit Kindertagen in Anna Sophia verliebt, und auch sie hat nie aufgehört an ihn zu denken. Als er ihr einen Heiratsantrag macht, steht Anna Sophia vor einer schwierigen Entscheidung ...
Inspiriert von einer wahren Geschichte: Der große Auftakt einer farbenprächtigen Saga über die Kölner Familie Stollwerck und den Aufstieg ihres berühmten Schokoladenimperiums.
„Ein wundervolles Buch voller Sprachpoesie und Spannung.“ Miriam Georg, Autorin von "Elbleuchten".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 838
Ähnliche
Über das Buch
Köln, 1838: Seite an Seite mit ihrem Vater arbeitet Anna Sophia jeden Tag in der Apotheke am Neumarkt. Ihre Hustenbonbons schmecken nicht nur köstlich, sondern helfen auch bei so manchen Beschwerden. Als der Apothekergeselle August um ihre Hand anhält, scheint ihre Zukunft gesichert, doch dann wird ihr Vater schwer krank. Anna Sophia beobachtet August dabei, wie er Medikamente vertauscht, und ihr kommt ein ungeheuerlicher Verdacht: Steckt er etwa hinter der plötzlichen Krankheit ihres Vaters? Während die Apothekertochter verzweifelt versucht, Licht ins Dunkel zu bringen, kehrt der Zuckerbäcker Franz Stollwerck, der schon als kleiner Junge in sie verliebt war, nach Köln zurück. Als er sie bittet, seine Frau zu werden, stimmt sie zu, ohne zu ahnen, vor welche Schwierigkeiten sie diese Entscheidung stellen wird. Franz eröffnet eine Bäckerei, und Anna Sophia hat eine Idee: Sie werden süße Hustenbonbons anbieten! Doch die Apotheker der Stadt stellen sich ihnen in den Weg, schließlich dürfen bisher nur sie Heilmittel verkaufen.
Über Rebekka Eder
Rebekka Eder, 1988 in Kassel geboren, hat Theaterwissenschaft und Germanistik in Berlin, Erlangen und Bern studiert und gleichzeitig ihre ersten Romane veröffentlicht. Nachdem sie als Werbetexterin und Journalistin gearbeitet hat, konzentrierte sie sich schließlich ganz auf ihre Leidenschaft. Sie lebt und schreibt in Nordhessen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Rebekka Eder
Die Schokoladenfabrik - Die Tochter des Apothekers
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
Teil 1 — 1838
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Teil 2 — 1839-1845
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Teil 3 — 1845-1848
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
Teil 4 — 1848-1849
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
Personenregister
Nachwort
Danksagung
Erläuterungen
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Mutter, löse die Spangen mir!
Mich hat ein Fieber befallen,
Denn das Fenster ließest du auf,
Das immer sorglich verhängte.
Verliebt, Annette von Droste-Hülshoff
Man nehme:
Gänseblümchen, Eibischwurzel, Süßholz, Mohnblüten, Huflattich, irländisches und isländisches Moos,
mahle sie mit einem Mörser,
gebe Souchong-Tee und destilliertes Wasser hinzu,
versiede Zucker und mische ihn unter den Brei aus Heilkräutern.
Teil 1
1838
1. Kapitel
Anna Sophia konnte es kaum erwarten. Während sie die Arzneifläschchen ordnete, schaute sie immer wieder zu ihrem Vater hinüber. Würde er es ihr heute erlauben? Am Rücken, den er ihr zuwandte, konnte sie keine Hinweise auf seine Stimmung ablesen. Wie ein knorriger Baum stand Gottlieb am Tresen seiner Apotheke. Er stützte sich auf die Fingerspitzen, während er in sein Kassenbuch starrte. Anna Sophia verglich ihn gern mit dem Lindenbaum, der direkt vor der Ladentür seine Äste und Blätter in den Himmel reckte. Er war genauso stark, unverrückbar, in dieser Stadt verwurzelt wie er. In letzter Zeit aber auch etwas ausgedünnt, seine Äste schienen trocken. Der Baum hatte schon bessere Tage gesehen, und doch wirkte er noch immer herrschaftlich. Auch an diesem schon fortgeschrittenen Abend. Durch das Schaufenster und die Äste der Linde konnte Anna Sophia den Neumarkt Kölns sehen, auf dem nur noch vereinzelt Mägde mit ihren weißen Hauben und an Armen baumelnden Körben über die Straße eilten. Wenn sie Glück hätte, würde ihr Vater den Laden in Kürze für heute schließen.
»Anna Sophia? Hörst du nicht?«, fragte ihr Vater, ohne den Kopf zu heben. Sie zuckte zusammen. Hatte sie mal wieder geträumt? Verflixt nochmal, dachte sie. Wieso musste ihr das ständig passieren?
»Entschuldige, Papa, was hast du gesagt?«
»Ob deine Schwestern versorgt sind, habe ich gefragt.«
»Natürlich. Betty ist bei ihnen.«
Die Haushälterin der Familie war immer bei ihren Schwestern. Während der Hausarbeit betreute sie die Kleinen, Julie und Elise, und gleichzeitig hatte sie noch ein offenes Ohr für die sechzehnjährige Wilhelmine.
»Ich nehme an, die Regale sind sauber?«
»Blitzblank«, bestätigte Anna Sophia. Ihren stolzen Blick konnte er nicht sehen, denn er drehte sich noch immer nicht um. Doch es stimmte: Sie hatte sämtliche Regale abgestaubt, die sich an den Seiten der Apotheke fast bis unter die Decke drängten und in den oberen Reihen mit Schachteln, Dosen und Karaffen gefüllt waren. Auch die Türchen der Schubladen in den unteren Reihen hatte sie abgewischt, und die bronzefarbenen Verzierungen, die den Abschluss der Regale bildeten, glänzten in der Abendsonne. Sogar den Apothekertisch, auf den sich Gottlieb gerade stützte, hatte sie ausgeräumt und seine kleinen Schubladen gesäubert. Neben dem dicken Kassenbuch leuchtete die große Waage mit den bronzenen Schalen – auch die hatte sie poliert. Sie liebte es, wenn die Apotheke so glänzte wie jetzt.
»Nun gut«, sagte er. Gleich würde er es ihr erlauben, doch in diesem Moment läutete das Glöckchen über der Ladentür. Anna Sophia bemühte sich, nicht die Augen zu verdrehen. Wieso musste kurz vor Ladenschluss immer noch jemand hereinkommen? Diesmal war es ein Bediensteter, doch als Anna Sophia ihn erkannte, wich sie erschrocken zurück. Sie stieß gegen den Apothekerschrank und die Fläschchen zitterten. Der Mann hatte Schatten um die Augen, lichtes Haar und bis auf den Leberfleck, der auf seiner Stirn prangte, sah er aus wie ein gewöhnlicher Dienstbote. Dennoch wusste sie genau, wer er war und für welche Familie er arbeitete. Ob er sich wohl auch an sie erinnerte? Damals war Anna Sophia ein Kind gewesen, trotzdem wusste sie noch genau, wie sie zum ersten Mal an die fremde Tür geklopft hatte, mit zahlreichen Medikamenten im Gepäck. Und welcher Mann sie hereingebeten und die Tür hinter ihr geschlossen hatte. Sie kniff Lippen und Augen zusammen. Daran wollte sie sich nicht erinnern, nie wieder. Mit aller Kraft schob sie die Bilder beiseite, doch sie machte dadurch nur Platz für eine weitere Erinnerung: Es war ein sonniger Tag im September, an dem sie eigentlich Brot und Äpfel hatte kaufen wollen. Sie stand in einer schmalen Gasse, die von der Bäckerei in Richtung Dom führte. Fast fühlte Anna Sophia wieder den kalten Stein der Fassade in ihrem Rücken, sie sah wieder, wie jemand auf sie zukam: eine große Gestalt, ein breites Grinsen. Anna Sophia schloss die Augen, atmete tief ein und aus, bevor sie sie erneut öffnete und sich zwang, wieder in der Gegenwart der Apotheke anzukommen.
Mittlerweile war der Bedienstete näher an ihren Vater herangetreten. »Ich komme mit einem … komplizierten Anliegen. Herr Mertens fühlt sich nicht wohl. Er hat einen fürchterlichen Husten.«
Gottlieb nickte. »Was sagt der Arzt?«
»Er zieht … nun, ja … eine Schwindsucht in Betracht. Aber ein vornehmer Mann wie Herr Mertens … Woher soll er denn die Schwindsucht haben?«
Gottlieb wendete sich zu seiner Tochter um. Die Enden seines weißen, gezwirbelten Schnurrbarts hingen bereits ein wenig hinab – wie immer, wenn sich der Tag gen Abend neigte. »Anna, rufst du bitte nach August?«
Anna Sophia nickte, drehte sich um und öffnete die Hintertür neben dem Apothekerschrank. Während sie den Gang entlanglief, spürte sie, wie ihr Herz schneller schlug. Heute hatte sie gar nicht mehr damit gerechnet, ihn noch einmal zu treffen. Für gewöhnlich experimentierte der Gehilfe ihres Vaters im Hinterzimmer bis spät in die Nacht mit Medikamenten. Wenn er das Haus verließ, war sie schon längst oben auf ihrem Zimmer. Nun atmete sie tief ein, um ihre Nervosität zu bekämpfen, und klopfte.
»August?«
Sie hörte ein Räuspern, Schritte, dann ging die Tür auf.
»Anna Sophia! Ist alles in Ordnung?«
»Ja, ähm, nein, also …«, stammelte sie. August lächelte munter, seine Augen funkelten, und sein lockiges Haar zeigte rechts und links seiner Ohren fröhlich in die Luft. Er legte wie ein galanter Diener eine Hand auf den Rücken. »Oh. Was ist geschehen?«
Wenig später stand Anna Sophia wieder mit verschränkten Fingern vor dem Apothekerschrank und beobachtete das Gespräch zwischen den drei Männern am Tresen.
»Könnten Sie Herr Mertens’ Zustand ein wenig genauer beschreiben?«, bat Gottlieb den Dienstboten.
»Der Herr ist seit drei Tagen sehr erschöpft.«
»Leidet er unter Nachtschweiß?«, fragte August, während er sein Monokel zwischen Augenbraue und Wange klemmte. Gottlieb belohnte ihn für diese Frage mit einem kaum merklichen Nicken.
»Ich fürchte, ja.«
»Appetitlosigkeit?«
»Er isst seit Tagen nicht mehr.«
»Bekommt er Fieberschübe?«
»Tagsüber sinkt das Fieber, aber nachts ist es schlimm.«
August zog eine Braue hoch und ließ dabei das Monokel von seinem Auge springen, so dass es an der silbernen Kette von seinem Hals baumelte. »Mmh.« Er sah den Apotheker an.
»Wir empfehlen Herrn Mertens dringend, auf den Rat seines Arztes zu hören«, übernahm Anna Sophias Vater. »Er braucht viel frische Luft und Bettruhe. Am besten wäre der Besuch eines Sanatoriums. Wir hätten außerdem eine exzellente Gesundheitsschokolade im Sortiment. Sie erfrischt und vermehrt die Lebensgeister, hilft gegen Husten und erweicht kalten und zähen Schleim.«
Der Diener kratzte sich an der Stirn oberhalb seines Leberflecks. »Nun ja, was soll ich sagen? Er bittet lediglich um Ihre Hustenbonbons, Herr Müller.«
Gottlieb seufzte und sah über die Schulter zu seiner Tochter. »Haben wir noch welche?«
Anna Sophia konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Wenige, Vater«, sagte sie und hob ein großes Glas vom Regal. Mit einer Kelle fischte sie die letzten verbliebenen Kräuterbonbons heraus und wickelte sie in Papier.
Der Mann zahlte und nahm die Bonbons an sich. Dann griff er nach der Türklinke – und hielt inne. Mit einem Mal schüttelte ihn ein heftiger Hustenanfall. Er krümmte sich, und während er nach Luft rang, röchelte und japste, fiel ihm das Bonbonpäckchen aus der Hand. Noch in der Luft öffnete sich das Papier, die Bonbons fielen herunter und kullerten einzeln über den Fußboden.
Als der Mann gegangen war, kniff August die Lippen zusammen. Gottlieb zwirbelte sich mit den Fingern beider Hände den Schnurrbart zurecht. Und Anna Sophia trat von einem Fuß auf den anderen.
»Schwindsucht bei einem Mann wie Herrn Mertens …? Wirklich sehr unwahrscheinlich«, brummte Gottlieb.
August nickte. »Unwahrscheinlich ist es. Aber nicht unmöglich.«
»Anna, du kannst schon hochgehen, ich schließe das Geschäft für heute.«
Anna Sophia nickte ihrem Vater zu, allerdings machte sie noch keine Anstalten, zu gehen.
»Ist noch was?«
Er würde es doch nicht vergessen haben? Sie legte den Kopf schief, doch noch bevor sie etwas erwidern konnte, rief er schon aus: »Ach, die Zuckerlieferung! Natürlich! Was stehst du hier noch herum? Na, geh schon!«
In der Mitte der Küche blieb Anna Sophia stehen. Endlich! Dieser Teil des Tages gehörte allein ihr. Durch das kleine Fenster fiel das letzte Sonnenlicht des Abends, und in seinen Strahlen funkelte der Staub in der Luft. An der steinernen Wand stand der große Feuerherd, der seit Kurzem sogar mit einem Wasserschiff ausgestattet war. Darüber hing das kupferne Kochgeschirr an großen Haken an der Wand. Und auf dem Küchentisch lag der Beutel Zuckerhüte, den der Vater hatte ergattern können. Auch der Mörser, der normalerweise im Hinterzimmer der Apotheke seinen Platz hatte, stand bereit. Wanne und Stab waren aus glänzendem Kupfer, seine Füße aus fein geschnitztem Holz. August hatte ihn für Anna Sophia hochgetragen. Als er hinter ihr in die Küche getreten war, hatte ihr Herz schon wieder wie verrückt gepocht. Seit wann machte dieser Mann sie eigentlich so nervös? Sie konnte sich noch gut an seinen ersten Tag als Geselle erinnern. Er war ein Jahr jünger als sie und damals gerade fünfzehn Jahre alt gewesen. Viel kleiner als heute und mit etwas zu langen Locken hatte er hinter dem mit Fläschchen und Schüsseln beladenen Tresen gestanden. Er hatte sich schüchtern umgeschaut und leise und vorsichtig gesprochen, so dass sie über ihn hatte schmunzeln müssen. Wann hatte sich diese Situation dermaßen verändert? Mittlerweile war er achtzehn Jahre alt und hatte eine so vornehme, bescheidene Selbstsicherheit angenommen, dass ihr manchmal ganz schwindelig wurde.
Sie schüttelte den Kopf, um die Gedanken loszuwerden, und öffnete den Küchenschrank. Im obersten Regal standen die Gläser, in denen sie ihre Lieblingskräuter aufbewahrte: darunter Huflattich, Mohnblüten, Eibisch und Süßholz. Daneben standen kleine Behälter mit getrockneten Gänseblümchen, isländischem und irländischem Moos. Ihr Vater durfte niemals erfahren, warum sie ausgerechnet diese Kräuter für ihre Sammlung ausgewählt hatte. Zum Glück hatte er keine Ahnung, wie Anna Sophia auf ihr Rezept gekommen war. Wüsste er es, würden seine morgens so fröhlich gezwirbelten Bartspitzen vor Enttäuschung wahrscheinlich ganz plötzlich schlaff herabhängen. Und schon bei dieser Vorstellung bekam sie ein schlechtes Gewissen. Sie wollte ihren Vater keinesfalls enttäuschen. Für die ganze Familie wäre es besser, wenn er niemals hinter ihr Geheimnis käme.
Zunächst holte sie das Glas mit den Gänseblümchen heraus; ihr süßlicher Duft ließ Anna Sophia an einen milden Frühling denken, an einen Sommertag und eine bunte Blumenwiese. Großzügig streute sie die Blätter in die Kupferschale des Mörsers. Anschließend fügte sie den geruchlosen Huflattich hinzu, der Hustenreiz linderte und gleichzeitig das Abhusten erleichterte, und mischte einige krautig beruhigend riechende Mohnblätter hinzu – ein hervorragendes Mittel gegen Schmerzen. Als sie den Deckel des Eibisch-Glases öffnete, vermied sie es, durch die Nase zu atmen. So blumig Eibisch auch duftete, wenn er als Staude wuchs, so eigenartig dunkel und stechend rochen seine Wurzeln in getrocknetem Zustand. Schnell schüttete sie davon einen kleineren Teil in die Wanne. Mit kreisenden Bewegungen zerstieß sie die Kräuter, bis sie zu einem feinen Pulver gemahlen waren und ihr Geruch in der Küche hing. Zuletzt fügte sie die Moossorten und das Süßholz hinzu und atmete tief ein. Wie sehr sie jeden Schritt dieser Prozedur liebte. Seit Monaten verfeinerte sie dieses Rezept nun immer weiter, und jedes Mal dachte sie wieder daran, wie es angefangen hatte: Vor einem Jahr war Julie, ihre kleinste Schwester mit den größten Ohren, so erkältet gewesen, dass sie kaum hatte sprechen können. Die Heiserkeit war eines Morgens plötzlich da gewesen und tagelang geblieben. Anna Sophia wusste zwar, welche Kräuter bei Heiserkeit halfen, doch die Kleine hatte sich beim Gurgeln so heftig verschluckt, dass sie nur noch geweint und den Kopf geschüttelt hatte, sobald sie ihr Tee gereicht hatte. Ratlos hatte Anna Sophia in der Küche gestanden und darüber nachgedacht. Was könnte sie Julie geben, damit sie die Kräuter lang genug im Mund behielt? Dass ausgerechnet die Haushälterin Betty sie auf die rettende Idee bringen würde!
Anna Sophia machte Feuer im Herd und goss Wasser in einen Topf. Nun war es so weit: Sie gab die Blätter des Souchongs hinzu und ließ den Tee aus dem chinesischen Wuyi-Gebirge aufkochen. Schnell legte sich sein rauchig würziger Duft über den der Kräuter. Gemeinsam mit dem Wasser, das sie schon am Vormittag destilliert hatte, mischte sie ihn unter die Kräuter und begann dann mit dem Versieden des Zuckers. Wie so oft erinnerte sie sich an Bettys Worte: »Du musst genau aufpassen, Mädchen. Der Zucker muss heftig kochen – und lange, damit er flüssig wird. Aber nicht zu lange, sonst verbrennt er. Wichtig ist der genau richtige Moment.«
Während der französischen Besatzung Kölns, als Betty noch ein junges Mädchen gewesen war, hatte die Haushälterin bei einer wohlhabenden Pariser Familie gearbeitet, die sie das Karamellisieren gelehrt hatte. Die Familie lebte mittlerweile wieder in Paris, aber einen Teil ihrer Kenntnisse hatte sie in der Stadt am Rhein zurückgelassen. Wie ein Geschenk, dachte Anna Sophia. Betty hatte es damals lediglich genutzt, um an Feiertagen kleine Köstlichkeiten wie Zuckerstangen für die Kinder herzustellen. Doch Anna Sophia hatte angesichts Julies Heiserkeit mithilfe ihrer Kräuter aus harten Zuckerwürfeln ein Heilmittel erschaffen. Aufmerksam schaute sie nun in den Kessel. Ein paar Sekunden noch. Drei, zwei, eins …
»Wie fürchterlich gemein du bist!«, rief ein helles Stimmchen hinter ihr.
»Du hast uns kein Wort gesagt!«
»Ich habe nur zufällig das Feuer gehört, sonst hätten wir es alle verpasst!«
Anna Sophia drehte sich um. Nacheinander drängten sich ihre Schwestern in die Küche. Vorneweg Julie. Normalerweise war die Sechsjährige ein stilles Kind, doch in diesem Moment, als sie Anna Sophia vor dem brodelnden Kessel stehen sah, strahlte sie übers ganze Gesichtchen. Sie wurde angeschoben von Elise, die zwei Jahre ältere und um einiges rosigere Schwester mit den dunkelsten Haaren und den schwärzesten Augen der Familie. Als Letzte folgte Wilhelmine. Ihr Rock war wie immer zerknittert, ihre dunkelblonden Haare leicht zerzaust und ihr ebenmäßiges Gesicht mit den markanten, dunklen Augenbrauen glänzte.
»Dass ihr immer im falschen Moment hier auftaucht!« Anna Sophia pustete sich eine Haarsträhne aus der Stirn. Hastig zog sie sich die Lederhandschuhe über, die neben dem Kochgeschirr an der Wand hingen, und hob den Kessel vom Herd.
»Vorsicht, heiß!«
Sofort stoben die Mädchen auseinander – aber nur, um aus sicherer Entfernung zu beobachten, wie Anna Sophia die kochende Zuckermasse auf die Steinplatte goss, die sie neben dem Herd bereitgelegt hatte.
»Die Kräuter fehlen noch, oder?«, rief Elise.
»Sehr gut.« Anna Sophia lächelte sie über die Schulter hinweg an. Mit beiden Händen griff sie nach der Mörserschale und hob sie hinüber zur Steinplatte. Dann goss sie die Masse in den Zucker.
»Wie das duftet«, piepste Julie. In der Küche hatte sich ein süßlicher Geruch ausgebreitet, der nun von den heiß werdenden Kräutern verfeinert wurde. Mit einem Kupferlöffel schob Anna Sophia die Masse hin und her. Sie musste abkühlen, durfte aber nicht zu fest werden. Hinter sich hörte sie, wie die Stuhlbeine über den Steinboden kratzten – ihre Schwestern setzten sich an den großen Küchentisch.
»Darf ich das allererste Bonbon essen?«, rief Elise aufgeregt.
»Sei still«, sagte Wilhelmine. »Du willst doch nicht, dass Vater uns hört.«
»Jetzt ist der Zucker doch noch viel zu heiß«, wandte Julie ein und wieder mal fiel Anna Sophia auf, dass die Kleinste für ihr Alter schon viel zu klug war.
»Ich meine doch auch, wenn er nicht mehr heiß ist.« Anna Sophia konnte beinahe hören, wie Elise bei diesen Worten die schwarzen Augen verdrehte.
Nun war es endlich so weit. Die zuckrige Kräutermasse war genauso zäh, wie Anna Sophia sie haben wollte. Also begann sie, sie zu kneten und zu rollen. Durch die Lederhandschuhe hindurch fühlte sie die Hitze, beobachtete, wie sich das Grün der Kräuter im Zucker verteilte und wie er dabei geschmeidiger und fester wurde. Zuletzt rollte sie ihn zu langen Stangen. Jetzt musste es schnell gehen. Stange um Stange zog sie aus der Masse und legte sie auf dem Tisch ab.
»Darf ich eine?«, rief Elise und Wilhelmine schlug ihr sachte auf die Finger.
»Natürlich nicht«, antwortete sie mit einem Lachen in der Stimme. »Immer das Gleiche mit dir!«
Zuletzt legte Anna Sophia die hart gewordenen Stangen über eine große Schüssel und schlug mit einem Messer mundgerechte Stücke ab. Mit einem Klackern purzelten die Bonbons in die Schale.
»Wieso kannst du das so gut?«, fragte Elise.
»Weil ich das schon so oft gemacht habe«, sagte Anna Sophia.
»Naja, so oft nun auch nicht, oder?« Wilhelmine musste einfach immer widersprechen. »Ich glaube, du hast einfach Talent. Schon deine allerersten Bonbons für Julie waren köstlich.«
»Das stimmt!«, piepste Julie. »Und ich konnte noch am gleichen Abend wieder sprechen! Deswegen verkauft Papa sie ja auch in der Apotheke. Manchmal glaube ich, deine Bonbons können zaubern!«
»So?« Anna Sophia sah die Kleine einen Moment lang mit möglichst geheimnisvollem Blick an. »Wieso glaubst du das nur manchmal?« Sie zwinkerte.
Als ihre Schwester damals ihre allerersten eigenen Bonbons gelutscht hatte, da war sie selbst kaum aus dem Staunen herausgekommen. Seit Tagen hatte Julie kein Wort herausgebracht – und schon nach einem Bonbon konnte sie wieder sprechen! Wo zuvor kein Laut gewesen war, war nun zumindest ein Krächzen. Anna Sophia hatte es zuvor schon geahnt, doch in diesem Augenblick war ihr klar geworden, welche Macht die Natur besaß. Und wie viel Anna Sophia den Menschen um sich herum helfen könnte, wenn sie diese Macht nur richtig einsetzte. Damals hatte sie beschlossen, dass sie genau das ihr Leben lang tun wollte: die Natur verstehen lernen, um anderen zu helfen. Wie gut, dass sie in eine Apotheke hineingeboren worden war. Sie konnte sich keinen Ort vorstellen, der mehr mit Magie zu tun hatte.
»Darf ich jetzt endlich eins?«, rief Elise.
»Na gut.« Anna Sophia nickte. »Jede von euch darf sich ein Bonbon nehmen. Aber nur eins! Und wie immer: Bloß kein Wort zu Vater! Ihr wisst, was dann los ist.«
Und während drei Hände gleichzeitig in die Schüssel griffen, flog die Küchentür auf.
»Anna Sophia, bist du hier?« Bettys Kopf schaute zur Küche herein. Normalerweise konnte die hagere Haushälterin mit den starken Armen und den kurzen Beinen nichts aus der Ruhe bringen. Ihr Dutt saß weit oben auf dem Kopf und ihre eisblauen Augen schauten in die Welt, als hätten sie schon alles gesehen. Doch in diesem Moment war es anders. Anna Sophia wusste sofort, dass etwas nicht stimmte. Betty war hochrot im Gesicht. »Es geht um deinen Vater – komm schnell.«
2. Kapitel
Victor Mertens leckte sich über die Lippen. Er kratzte sich die Halbglatze. Dann rümpfte er die Nase.
»Es wird Zeit, findest du nicht?«, fragte er.
»Ha«, machte Ferdinand abfällig und warf sich eine blonde Strähne aus der Stirn.
Warum nur hatte sein Bruder so volles Haar und eine so hohe Denkerstirn – Victor aber nicht? Er und Ferdinand saßen in ihrer Kutsche und warteten vor der Weinhandlung ihres Onkels, der wohl größten und beliebtesten der ganzen Stadt. In der Wohnung darüber hatten sie einen Großteil ihrer Kindheit verbracht, allerdings hatten sie diese Räume seit Jahren nicht von innen gesehen. Und das würde sich auch am heutigen Tag nicht ändern. Darum konnte ihre Mutter sie noch so eindringlich bitten. Es zeigte genug guten Willen, dass sie ihre Kutsche zumindest hatten hierher lenken lassen. Ihre Mutter konnte sie vom Schlafzimmerfenster aus sehen – das musste genügen.
Obwohl die Sitze samtrot gepolstert waren, tat Victor so langsam der Hintern weh. Er rutschte hin und her, beugte sich nach vorn und betrachtete die geschwungenen Lettern auf der Steinfassade: Mertens Weine und Spirituosen. Darunter konnte er durch zwei Fenster einen Blick auf die hölzernen Fässer erhaschen. Ohne es zu wollen, betrachtete Victor auch sein eigenes, schemenhaftes Spiegelbild in der Scheibe. Wann war er eigentlich so alt geworden? Ach, der Eindruck täuscht, versuchte er sich einzureden. Sicherlich lag es nur an den schlechten Lichtverhältnissen an diesem Abend.
»Ah, da kommt er endlich!« Ferdinand zeigte in die enge Gasse mit den krummen Giebeldächern, die vom Dom aus in Richtung Weinhandlung führte. Dort trat gerade der Diener der Familie Mertens aus dem Schatten. In den Armen hielt er ein riesiges Käserad.
»Was soll das denn? Bonbons solltest du holen«, rief Ferdinand ihm entgegen, während er sich aus der Kutsche beugte. »Wenn der alte Herr mittlerweile tot ist, weil du noch Käse kaufen warst, bist du schuld, hast du verstanden?«
Bei ihnen angekommen, entschuldigte sich der Diener keuchend. »Ihre Mutter … Sie hatte mich gebeten, auf dem Weg auch Käse … aber die Bonbons habe ich natürlich auch …«
»Spar dir deine Ausreden!«, herrschte Ferdinand ihn an.
»Und … nun, ja … sind Sie sich sicher, dass er keine weiteren Medikamente will?«
Victor konnte kaum glauben, was er da hörte. Wagte es dieser Mann tatsächlich, die Worte seines Bruders in Zweifel zu ziehen? Ruckartig richtete er sich auf, stieß mit dem Kopf gegen die Kutschendecke und fluchte.
»Was erlaubst du dir?« Victor bemerkte, wie seine eigene Stimme bei jedem seiner Worte schriller wurde. »Wenn ich noch einen Ton des Widerspruchs vernehme, dann …«
Ein Keuchen unterbrach ihn. Auf der Straße krümmte sich der Diener plötzlich zusammen, hustete wie wild auf den Käse und rang nach Luft. Die beiden Mertens-Brüder wichen zurück und sahen einander mit entsetzten Mienen an. Victor war sich nicht ganz sicher – schmunzelte sein Bruder in diesem Moment etwa ein wenig?
»Schon gut«, sagte Ferdinand dann mit sanfter Stimme zum Diener. »Geh hoch und bring unserem Onkel die Bonbons.«
So schnell der Mann es mit dem Käse in der Hand schaffte, hastete er an der Kutsche vorbei und durch die Tür neben dem Laden ins Wohnhaus.
Es dauert nicht lange, bis sich die Tür wieder öffnete. Diesmal war es ein junges Mädchen, das schüchtern herausschaute. Victor beugte sich weit durch die Kutschentür nach draußen und rief: »Oh, na, guten Tag!«
Sie trug Haube und Kleid eines Dienstmädchens. Victor sprangen sofort ihr helles Dekolleté und die glatte Haut ins Auge. Er legte den Kopf schief, um ihren Blick aufzufangen, doch sie sah schüchtern zu Boden. Er widerstand dem Drang, aus der Kutsche zu springen und ihr Kinn zu fassen, um ihre Blickrichtung selbst bestimmen zu können.
»Ihre Mutter schickt mich«, murmelte sie statt einer Begrüßung. Was war nur los mit dem Personal? Hatte die Schwindsucht in diesem Haus nun auch den Respekt ihm gegenüber dahingerafft? »Sie lässt nach einem Arzt für Herrn Mertens schicken. Sie sagt, es sei dringend.«
»Wie dringend?« Ferdinand warf sich eine Strähne aus der Stirn.
»Sie sagt, er stirbt, es dauert nicht mehr lang. Er braucht einen Arzt, aber von uns will sie niemanden schicken. Wir sollen bei ihr bleiben, sagt sie.«
»Nun gut.« Ferdinand drehte seinen Stock in den Händen. »Sag ihr, ein Arzt ist unterwegs.«
Sie nickte und verschwand wieder.
Victor runzelte die Stirn. »Nach wem möchtest du schicken lassen?«
»Nach niemandem. Ich habe eine viel bessere Idee. Wie lange hast du keinen Alkohol mehr getrunken, lieber Bruder?«
Victor kratzte sich die Halbglatze. »Viele Jahre?«
Tatsächlich hatte er lange keinen einzigen Tropfen mehr zu sich genommen. Keinen Wein, kein Bier, keine Spirituosen. Nichts, seit jenem Tag. Und dieser Tag lag so weit zurück, dass er nur noch eine verschwommene Erinnerung war. Victor tat gut daran, nie wieder darüber nachzudenken.
»Mir geht es genau so. Aber heute, lieber Bruder, heute ist der Tag.«
Victor klappte der Mund auf. Sobald er es bemerkte, schloss er ihn wieder. War das wirklich eine gute Idee?
»Glaub mir. Wir genehmigen uns einen schönen Wein und stoßen auf den alten Herrn an. Es ist das Beste, was wir nun tun können. Nach allem, was geschehen ist.«
Victor horchte den Worten hinterher, dann nickte er langsam und bedächtig.
»Er ist tot!« Es war ein Satz, den man häufig aussprechen musste, damit er sich irgendwann wahr anfühlte.
»Der alte Herr ist tot!« Victor Mertens sagte es immer wieder. Zuerst rief er es dem Kutscher entgegen, obwohl der es natürlich längst wusste. Victor sprang aus der Kutsche, stolperte und taumelte. Sobald er sich wieder einigermaßen gefangen hatte, rief er es noch einmal in Richtung des zu dieser Stunde nur noch schemenhaft zu erkennenden Mannes auf dem Kutschbock: »Er ist mausetot!«
Alles drehte sich um Victor herum: die schwarze Kutsche mit den großen, filigranen Rädern; die Auffahrt zu Schaaffhausens Stadtpalast, in dem Victor Mertens seit ein paar Monaten wohnte; die akkurat geschnittenen Hecken und Büsche, die das Anwesen vor den Blicken Neugieriger abschirmten und deren sonst so bunt leuchtenden Blumen im bleichen Licht des gerade aufgetauchten Mondes grau waren. Sogar die dunkeln Wolken und die ersten Sterne der Nacht schienen über seinem Kopf zu tanzen. Victor Mertens war zum ersten Mal in seinem Leben betrunken. Er lachte auf. Niemals hatte er damit gerechnet, sich einmal so zu fühlen. Ihm war der Kopf ganz leicht und die Zunge schwer. Dennoch wollte er unbedingt reden. Er musste die Neuigkeit verbreiten, sie schrie geradezu danach!
Er schwankte die Auffahrt entlang bis zur breiten Treppe, stolperte die Stufen hinauf und wurde von einem potthässlichen Hausmädchen empfangen, auf dessen Namen er einfach nicht kam. War ja auch egal, bei den klapperdürren Hüften. »Er ist tot!«, herrschte er sie an, so dass sie zusammenzuckte. Sie starrte ihn mit dümmlich fragendem Gesicht an. Dass diese Schaaffhausens so fürchterliches Personal haben mussten!
»Steh nicht so dumm da! Wo ist meine Frau?«, lallte er.
In diesem Moment öffnete sich die Tür zum Salon, und eine wahre Lichtgestalt trat ins Foyer. Er seufzte. Diese hellblonden Haare, zu tausend Zöpfen geflochten, dieses üppige Dekolleté im engen Kleid, die weichen, weißen Oberarme und der spitze, tiefrote Mund!
»Mein lieber Victor«, rief Emma Mertens und musterte ihn bestürzt von oben bis unten. »Bist du etwa betrunken?«
Er antwortete nicht, stattdessen versank er in ihrem Anblick. Wie schön sie war! Und Tag für Tag schien die Sechzehnjährige sogar noch schöner zu werden. Wieso konnte seine Frau nicht genauso aussehen? Hätte sie solche Lippen, solche Hüften, diese Jugend, dann wäre die Sache mit dem Nachwuchs sicherlich kein Problem. Er würde sie einfach packen und sie wäre schneller schwanger, als sein so griesgrämiger wie reicher Schwiegervater »Erbschaft« sagen konnte.
»Ich war bei unserer lieben Tante in Bonn, als ich einen Brief von Mutter bekommen habe. Sie schrieb, Vater gehe es schlecht. Ich wollte sofort zu ihm, doch Mutter hat mir verboten, das Haus zu betreten, stattdessen sollte ich zunächst zu euch fahren«, erklärte sie aufgeregt.
»Sicher, ja. Das ist tatsächlich … also … gut. Ja.« Er hörte selbst, dass er nuschelte.
»Victor, was ist mit dir?«
Er verkniff sich ein Grinsen. »Er ist tot.«
»Wer ist tot, Victor?«
»Mausetot. Es ging ganz schnell.«
»Wer, Victor, wer? Sag, du sprichst doch nicht etwa … von Vater?«
Ihr hübsches Gesichtchen wurde ganz weiß, und ihr weicher Mund stand offen. Er wusste schon, wie er sie trösten könnte. Wenn das blöde Hausmädchen nicht dümmlich danebenstehen würde, wäre er der kleinen Emma noch an Ort und Stelle zu Diensten, so dass sie das Monster, das sie Vater nannte, ganz schnell vergessen hätte.
»Es war die Schwindsucht, meine liebe, süße Emma. Sie hat das ganze Haus erwischt. Wir konnten nichts mehr für ihn tun. Vor einer Stunde ist er von uns gegangen.«
Emma schrie auf. »Nein!« Sie stürmte zur Tür.
»Du kannst dort nicht hin«, rief er und hielt sie an den Schultern zurück. Wie warm sie sich anfühlten. Sanft drückte er sie an sich, so dass er ihre Schulterblätter an der Brust fühlen konnte.
»Lass mich los«, kreischte sie, doch Victor dachte natürlich nicht daran. Während sie versuchte, den Türgriff zu fassen, streichelte er ihr Schlüsselbein. Was für eine Gelegenheit, überlegte er, grinste und ließ seine Hand so unauffällig wie möglich tiefer gleiten.
»Das ganze Haus hat die Schwindsucht. Du hast es doch selbst gesagt – Mutter will nicht, dass du das mitansiehst!« Trotz seiner Worte zappelte Emma weiter. Auch dann noch, als seine Hand schon in ihrem Ausschnitt steckte.
»Victor!«, rief laut und streng eine tiefe Stimme. »Lass sofort deine Halbschwester los!«
Schnell zog er seine Hand wieder hervor und umfasste nur noch Emmas Schultern.
»Sie will zu ihrem Vater, aber das geht nicht«, erklärte er, ohne sich umzudrehen. Er wollte die Nähe zu diesem hübschen Mädchen noch einen Moment länger genießen.
»Lass Emma sofort los!«, herrschte die Stimme ihn noch einmal an. »Emma, du bleibst hier. Victor hat recht – deine Anwesenheit hilft dort heute niemandem«, fügte sie an das Mädchen gewandt hinzu. Als er fühlte, dass Emma aufhörte, sich unter seinen Händen zu winden, ließ er widerwillig von ihr ab und wandte sich zu seiner Frau um. Groß, schmal und streng stand Sibylle Mertens-Schaaffhausen da, die Hände vor der Taille gefaltet. Sie trug ein blau kariertes Kleid mit aufgebauschten Ärmeln, das ihre Schultern frei ließ. Warum nur musste sie so eine unendlich lange, spitze Nase haben? Ohne diese Nase hätte er ihr Gesicht vielleicht sogar erträglich finden können, zumindest in diesem Dämmerlicht.
»Er ist tot«, sagte er zu Sibylle. »Onkel ist tot.« Hinter ihm heulte Emma bei diesen Worten auf und stützte sich an der Wand ab. Doch Sibylle reagierte nicht. Emotionsloses Weibsstück! Begriff sie nicht, was geschehen war? Emmas Vater, sein Onkel und zugleich seit knapp zwanzig Jahren der Mann der gemeinsamen Mutter war endlich gestorben. Unglaublich, dass es eine Krankheit nun wirklich geschafft hatte, diesen zähen, alten Mistkerl dahinzuraffen.
»Minna, kümmere dich bitte um Emma und bring sie ins Gästezimmer. Sie hatte einen langen Weg, bevor sie heute hier angekommen ist. Victor, du kommst mit mir«, sagte Sibylle zuerst zum Dienstmädchen, dann zu ihm. Sie drehte sich um und ging vor. Er wusste, wo sie hin wollte, und folgte ihr. Der Gang mit den hohen Gemälden und der blauen Tapete schien sich hin und wieder ein wenig zu neigen. Sogar die Treppe, die er hinauf schritt, bebte unter seinen Füßen. Ihm war noch immer schwindelig – was für ein wunderbares Gefühl! Er genoss die Taubheit in seinem Kopf, während er seiner Frau ins Schlafzimmer folgte. Gut, dachte er. Nach dem kleinen Gerangel mit Emma war er durchaus in Stimmung. Sibylle drehte sich zu ihm um und möglichst sanft lächelte er sie an.
»Ich habe mich danach gesehnt, wieder mit dir allein zu sein«, verkündete er. Langsam ging er auf sie zu und musterte sie, während er es vermied, ihre Nase zu genau anzuschauen. »Ein hübsches Kleid ist das.« Mit diesen Worten umfasste er seine Frau an der Taille. Sie zuckte zusammen.
»Was erlaubst du dir?« Fest stieß Sibylle ihn zurück.
»Was ich mir erlaube?« Er taumelte etwas, hielt sich an der Wand fest. Wie sprach sie denn mit ihm? Mit ihm, dem erfolgreichen Bankier Victor Mertens? Sie war seine Frau. Und seine Frau hatte gefälligst zu tun, wonach ihm die Lust stand.
»Ich möchte, dass du mir gehorchst«, befahl er. Doch alles, was sie tat, war trocken aufzulachen.
»Nie im Leben.«
Fast blieb ihm die Luft weg. Wie konnte sie es wagen? Nun gut, dachte er. Dann würde sie es eben auf die harte Tour lernen müssen. Er fasste ihre Handgelenke und drängte sie zurück in Richtung Bett. Dann griff er nach ihrem Rock, um ihn hochzuschieben.
»Nimm deine Finger weg!«, presste sie hervor, doch er lachte nur und drehte sie um. Fast hatte er ihre Beine freigelegt. Gleich war es soweit, dachte er, doch plötzlich wirbelte Sibylle herum – und sie hatte etwas in der Hand. Was war das? Etwa ihre Bettpfanne? Er hatte gar nicht bemerkt, wie sie danach gegriffen hatte. Er versuchte zu reagieren, seine Arme waren jedoch zu langsam. Sie gehorchten ihm einfach nicht. Mit einem leisen Sausen schoss die Bettpfanne in der Dunkelheit auf ihn zu.
3. Kapitel
»Du hast gelogen, habe ich recht?« Es war schon das dritte Mal, dass Margaretha genau das sagte. Diesmal blieb sie stehen, stemmte die Hände in die Hüften und lachte Kaspar ins Gesicht.
»Hier ist gar nichts, oder?« Sie drehte sich einmal im Kreis, ihr langer Rock verfing sich im Unterholz, so dass der Saum aufriss. »Wir sind völlig allein mitten im Wald.«
Freute sie sich etwa darüber? Sie warf sich das glatte Haar hinter die Schultern und trat einen Schritt auf ihn zu.
»Ich habe nicht gelogen«, widersprach Kaspar und zog sich seinen großen Schlapphut tiefer ins Gesicht. »Sie muss hier irgendwo sein. Es war westlich von Höhenforst, eine Meile hinter dem Scharfenfels. Wir müssen ganz nah dran sein.«
Margaretha lachte wieder, doch Kaspar ließ sich nicht beirren. Auch nicht, als sie sich bei ihm einhakte. Arm in Arm stiefelten sie weiter durch das Unterholz, und Kaspar versuchte, nicht nervös zu werden. Es war das allererste Mal, dass er ihre Wärme fühlen konnte. So oft hatte er sich genau danach gesehnt. Und bisher hatte sie, die schönste Tochter des bösartigen Bauern Wilhelm, ihn immer ignoriert. Jetzt, da sie ihn zum allerersten Mal berührte, wusste er nicht, was er tun sollte. Natürlich gefiel es ihm. Doch er wurde einen Gedanken einfach nicht los: Sie musste annehmen, er habe die Geschichte erfunden, um sie herzulocken. Dabei würde Kaspar so etwas niemals tun! Er konnte noch so verliebt sein, er würde nicht lügen.
»Weißt du was, Kaspar?«, fragte sie jetzt.
»Mmh?«
»Du musst das nicht machen.«
»Was?«
»Du musst nicht so tun, als würden wir die geheimnisvolle Frau suchen. Ich wäre auch so mit dir in den Wald gegangen.«
Sie blieb stehen und hielt seine Hand fest. Er biss sich auf die Lippen. Wie rau und fest sich ihre Finger anfühlten, die normalerweise Hühnern die Federn ausrissen, Brotteig kneteten und Ställe ausmisteten. Margarethas glatte Wangen waren braun gebrannt und ihre Lippen von der Sonne spröde.
Sie sah ihm zuerst in die Augen, dann auf den Mund. Kaspar träumte davon, Margaretha zu küssen, seitdem er denken konnte. Sie wohnte nebenan, und obwohl ihr Vater Wilhelm ihn mehr als einmal vom Hof gejagt hatte – mit in die Luft gereckter Faust und blau aufgequollener Nase von all dem Bier, das er Tag für Tag in der Kneipe seines Bruders trank –, hatte Kaspar immer wieder vor dem großen Bauernhaus herumgelungert und darauf gehofft, dass sie aus dem Fenster sehen und ihm winken würde. Eines Tages hatte sie Wasser aus dem Brunnen geholt und gehört, wie er ein paar Dorfjungen von der geheimnisvollen Frau erzählt hatte.
»Ich schwöre euch, ich habe sie gesehen!«
»Ach«, sie hatten abgewinkt. »Das denkst du dir aus.«
»Ich habe sie ganz eindeutig am Waldrand gesehen. Sie hat in den Büschen nach irgendetwas gesucht. Dann hat sie sich umgedreht und in Richtung Dorf geblickt. Es gibt sie, so viel ist sicher.«
»Wie soll sie denn mitten im Wald überleben, so ganz allein? Es ist schon zehn Jahre her, dass Wilhelm sie aus dem Dorf gejagt hat. Zehn Jahre in diesen Wäldern! Wie soll das gehen?«
»Die geheimnisvolle Frau lebt«, hatte er beteuert.
»Nein, Kaspar«, hatte Margaretha plötzlich laut gerufen und die Jungen hatten sich überrascht nach ihr umgesehen.
Jetzt griff sie auch nach Kaspars zweiter Hand.
»Du brauchst mich nicht anzulügen«, sagte sie mit leiser Stimme.
»Ich habe ihre Hütte wirklich gefunden«, widersprach Kaspar. »Vorgestern erst.«
»Ich mag deine Geschichten, Kaspar Rockstroh«, flüsterte sie. Ihr Gesicht kam seinem immer näher. »Ich mag dich.«
Er konnte ihren warmen Atem auf seiner Haut spüren. Gleich ist es so weit, dachte er, gleich berühren ihre Lippen meine. Doch Kaspar konnte nicht anders. Zuerst musste er beteuern: »Sie wohnt in einer krummen und schiefen Waldhütte. Drum herum wachsen Kräuter und Beeren. Sie hat sogar Hühner und eine große, hölzerne Schaukel. Auf Kniehöhe des Baumes hat sie eine Schnur gespannt, an der Glöckchen hängen. Wenn man zu nah kommt, klingelt es.«
Bei diesen Worten wich Margaretha zurück. Ihre Augen weiteten sich, dann verschränkte sie die Arme.
»Was ist?«, fragte er.
»Woher weißt du das?«
Er runzelte die Stirn. »Ich sagte doch: Ich war dort.«
»Hast du mit ihr gesprochen?«
Er schüttelte den Kopf. »Als die Glöckchen geklingelt haben, bin ich fortgelaufen.«
»So ein Mist!« Margaretha seufzte. Dann sagte sie: »Na gut, komm mit.«
Sie griff nach seiner Hand und zog ihn durch den Wald. Plötzlich schien sie genau zu wissen, wo es langging. Hin und wieder legte sie den Kopf in den Nacken, betrachtete den Stand der Sonne, dann lief sie weiter. An Büschen und Bäumen vorbei, über sanfte Hügel und durch kleine Senken hindurch. Kaspar lief hinterher. Mittlerweile schmerzte sein schlimmes Knie, doch er biss die Zähne zusammen und humpelte weiter.
»Wo willst du hin?«
»Sei still«, fuhr sie ihn an. Ihre Stimme klang viel ernster und schroffer als noch vor wenigen Minuten. Was war nur in sie gefahren? Er konnte sich nicht mehr im Geringsten vorstellen, dass die beiden sich gerade noch so nah gekommen waren. Hätte er doch seine Klappe gehalten! Dann würden sie in diesem Moment noch dort stehen, und wer weiß, was dann geschehen wäre!
Unvermittelt hielt Margaretha inne. Hinter einer dichten Wand aus Büschen öffnete sich eine kleine Waldlichtung, und sofort wusste Kaspar, dass sie da waren. Er hörte das Rascheln und Picken von Hühnern, er sah die Kräuter- und Beerenbüsche, und dahinter konnte er zwischen dichtem Blätterwerk eine große Schaukel und die Bretter einer Holzhütte sehen. Einen Schritt weiter, und sie hätten die Schnur berührt, die die geheimnisvolle Frau gespannt hatte.
»Du wusstest es«, sagte Kaspar leise. »Du hast es die ganze Zeit gewusst. Du warst schon mal hier.«
Kurz sah Margaretha ihn an, dann gellte ihre Stimme durch den Wald. »Gesche! Ich bin’s, Margaretha! Ich muss mit dir sprechen! Gesche, bist du hier?«
Es dauerte nicht lange, bis Kaspar ein lautes Knarren hörte, ganz so, als würde sich eine alte Tür öffnen. Dann raschelte es hinter einem Brombeerstrauch. Und plötzlich stand eine kleine Frau vor ihnen. Sie trug ein aus Stofffetzen zusammengeflicktes Kleid, ihre Haare standen wild von ihrem Kopf ab, und ihre Augen hatten unterschiedliche Farben. Das Blaue schien Margaretha anzuschauen, das Braune Kaspar.
»Margaretha, meine Liebe … Was ist geschehen? Und warum kommst du nicht allein?« Ihre Stimme war ein heiseres Kratzen. Und doch hatte es etwas Liebevolles.
»Er war schon mal hier. Er weiß, wo du dich versteckst. Ich musste ihn herbringen«, sagte Margaretha mit einem abfälligen Handzeichen in Kaspars Richtung. Und in diesem Moment glaubte er zu verstehen, dass sie ihn gar nicht wirklich hatte küssen wollen. Ihr Kuss wäre ein Ablenkungsmanöver gewesen. Nur ein Mittel zum Zweck. Sie war nicht mit ihm in den Wald gekommen, weil er ihr gefiel. Nein, ihr war es nie um ihn gegangen, sondern einzig und allein um die geheimnisvolle Frau. Wie hatte er so dumm sein können? Margaretha hatte nur sichergehen wollen, dass er keine Lügengeschichten erfand.
»Hast du irgendjemandem von diesem Ort erzählt?«, fragte Gesche ihn und zog langsam eine Augenbraue hoch.
»Ich hatte keine bösen Absichten«, beteuerte Kaspar.
»Sag, wer weiß davon?«
»Ich … habe den anderen gesagt, dass ich eine Frau am Waldrand gesehen habe. Aber ich habe kein Wort über diesen Ort verloren … nur Margaretha habe ich von der Hütte erzählt.«
Nun sah Gesche Margaretha an. »Vertraust du ihm?«
Mit einem strengen Seitenblick bedachte Margaretha Kaspar. »Er ist manchmal ganz schön naiv«, verkündete sie, und es schmerzte ihn, wie recht sie hatte. »Aber ein Lügner ist er nicht.«
Gesche trat einen Schritt auf Kaspar zu. Sanft umfasste sie sein Kinn, um seinen Kopf zu heben. Ihr blaues und ihr braunes Auge sahen ihn an, als würden sie etwas in ihm suchen. Dann sagte sie: »Ein hübscher Kerl bist du. Pass mir bitte auf, dass du den Frauen im Dorf nicht bald den Kopf verdrehst, verstanden? Nun, komm mal mit.«
Sie wandte sich um und lief in Richtung der Hütte. Kurz sah Kaspar zu Margaretha hinüber. Doch als hätte sie Gesches Worte kaum bemerkt, spielte sie an ihren Haaren. Erst jetzt fiel Kaspar auf, dass es bereits dämmerte. Unschlüssig blieb er stehen. Ging von dieser fremden Frau mit den wirren Haaren und dem wackeligen Schritt eine Gefahr aus? Sie war zwar sehr klein, so dass er sie im Ernstfall gewiss leicht überwältigen könnte. Trotzdem hatte er das dumpfe Gefühl, man sollte diese Frau nicht unterschätzen.
»Nun geh schon«, sagte Margaretha und stieß ihn leicht vorwärts. »Ein Dummkopf und ein Angsthase bist du.«
»Ich bin nichts davon«, widersprach Kaspar und stiefelte hinter Gesche her. Sie öffnete die knarzende Holztür und bedeutete ihm, einzutreten. Unschlüssig sah er hinein. Innen war es düster und kühl. Von der Decke hingen Kräuter zum Trocknen, an den Wänden stapelten sich Schalen und Schüsseln, und auf einer Obstkiste, die wohl als Tischchen diente, stand eine kleine Teekanne.
»Worauf wartest du noch?«, fragte Gesche. Kaspar schluckte – und trat ein. Er hörte, dass Margaretha ihm folgte. Mitten im Raum drehte er sich um.
»Es tut mir leid, Junge«, sagte Gesche, während sie die Tür hinter sich schloss. Das schwächer werdende Sonnenlicht, das durch die Ritzen der Holzbretter schimmerte, legte sich wie ein Heiligenschein um ihre wilden Haare und erhellte den Raum kaum noch. »Dieser Ort ist wichtig. Wir müssen absolut sichergehen, dass er unter allen Umständen unser Geheimnis bleibt«, fuhr sie leise fort. Die Körper der beiden Frauen waren für ihn nichts mehr als dunkle Schemen. Und zwischen den herabhängenden Kräutern kamen sie nun langsam auf ihn zu.
»Vater!«, rief Anna Sophia, während sie die Tür zum elterlichen Schlafzimmer aufstieß. Es war ein Raum, den sie nur selten betrat. Zu sehr erinnerte er sie an ihre verstorbene Mutter: die Kleider, die noch immer im Schrank hingen; die Bettseite, für die Betty das Kissen jeden Morgen frisch aufschüttelte, obwohl sich niemand mehr hineinsinken lassen würde. Auf dem Nachttischchen lag sogar noch der Roman, den ihre Mutter während ihrer immer komplizierter verlaufenden Schwangerschaft mit Julie häufig gelesen hatte – anfangs chronologisch, später kreuz und quer: Stolz und Vorurtheil in der Übersetzung von Louise Marezoll. Jedes Mal versetzte es Anna Sophia einen Stich, das Buch zu sehen. So oft hatte sie ihre Mutter darin blättern sehen. Ihr Gesicht war dabei immer blasser und ängstlicher geworden, und manchmal hatte sie die Seiten wild und verzweifelt aufgeschlagen, als würde sie nach etwas ganz Bestimmtem suchen. Damals hatte Anna Sophia noch fest daran geglaubt, dass alles gut gehen würde. Dass ihre Mutter bald wieder die ungewöhnliche und unbeugsame Frau werden würde, die sie noch bis vor Kurzem gewesen war.
Nun lag auf der anderen Seite des Bettes der Vater. Sein sonst so akkurat gezwirbelter Bart hing strähnig an den eingefallenen Wangen hinunter. Und – wie damals auch – saß der Arzt Dr. Hugo Baader auf einem Stuhl neben dem Bett, heute aber auf Vaters Seite.
»Papa, was ist geschehen?«, rief sie und stürzte neben den Doktor ans Bett.
»Er hat einen kleinen … ja, nun ja …«, sagte Dr. Baader und wirkte dabei wie immer etwas verwirrt. Seine blonden Haare standen ihm am Oberkopf leicht zu Berge und hingen links und rechts seines Kopfes hinab. Auch seine Mundwinkel zeigten nach unten. Er schmatzte zwei Mal und wollte fortfahren, da wurde er von einer freundlichen Stimme unterbrochen. »Er hat einen kleinen Schwächeanfall.« Anna Sophia fuhr herum. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass August in der hinteren Schlafzimmerecke stand.
»Du hast ihn hergebracht?«
»August war natürlich sofort zur Stelle«, brummte Gottlieb; die Anerkennung in seiner Stimme war nicht zu überhören. Anna Sophia wusste, wie sehr ihr Vater den Gesellen ins Herz geschlossen hatte. Schon oft hatte sie sich gefragt, ob Gottlieb wohl darunter litt, keinen Sohn zu haben. Und ob sich August für ihn nicht ein klein wenig wie dieser fehlende Sohn anfühlte. Schließlich war er anfangs ja beinahe noch ein Kind gewesen. Neugierig hatte er jedes Wort aufgesogen, das Gottlieb an ihn gerichtet hatte. Und bald hatte der junge Geselle bewiesen, dass er jede Anweisung klug und geschickt befolgte. Schon nach den ersten Monaten hatte Anna Sophia beobachten können, wie Gottlieb ihm liebevoll die Schulter getätschelt oder ihm ein paar extra Pfennige zugesteckt hatte. Und seitdem August alt genug war, saßen sie manchmal nach Feierabend in der Kneipe schräg gegenüber, um den Arbeitstag zu begießen, oder sie besuchten gemeinsam eines der zahlreichen Karnevalsfeste in der Stadt. Die beiden Männer sprachen über die Apotheke, wie es Gottlieb mit seinen Töchtern niemals möglich wäre, das wusste Anna Sophia. Im Gegenzug war August ständig an Gottliebs Seite, um ihn zu unterstützen und zu beraten.
»Das ist doch selbstverständlich, Herr Müller«, beteuerte August nun. »Betty ist sofort losgelaufen, um Dr. Baader zu holen.« Er deutete auf die Haushälterin, die in der geöffneten Tür wartete. »Ich wollte mich gerade von ihm verabschieden, als er plötzlich über Schwindel klagte und zusammenbrach.«
Anna Sophia legte ihrem Vater eine Hand auf die Stirn. Sie war feucht und kalt.
»Wie fühlst du dich jetzt, Papa?«
»Gut, gut«, murmelte ihr Vater. »Es geht schon wieder.«
»Da bin ich mir nicht so sicher.« Sie warf Dr. Baader einen fragenden Blick zu.
»Er ist, nun ja, sein Zustand ist mittlerweile schon etwas …«
»Es war ein langer und schwüler Tag. Sicher ist es nichts weiter«, unterbrach ihn August. Er lächelte Anna Sophia aufmunternd an und sah ihr dabei fest in die Augen. Hielt er ihren Blick etwa einen Moment zu lang fest? Schnell drehte sie sich wieder um. Sie spürte ihren schneller werdenden Herzschlag und schalt sich innerlich dafür. Wie konnte sie nur über Augusts Blick nachdenken, während ihr Vater so leiden musste? Seitdem ihre Mama gestorben war, war es ihre Aufgabe, auf ihn aufzupassen. Sie war die älteste Tochter und sollte Verantwortung übernehmen, anstatt über ihre eigenen Sehnsüchte nachzudenken.
»Betty, bringst du Vater bitte ein Glas Wasser? Und ein feuchtes Tuch?«
»Es steht beides schon bereit.« August trat hinter sie und zeigte auf das Nachttischchen direkt neben dem Bett. Verflixt, wie unangenehm, dachte Anna Sophia. Sie war mal wieder unaufmerksam gewesen.
»Danke, August.« Sie versuchte, sich nicht zu sehr über sich selbst zu ärgern, griff zum Glas, flößte ihrem Vater einen Schluck ein und griff dann nach dem Lappen, um ihm die Stirn abzutupfen.
»Lass doch, Anna Sophia«, widersprach Gottlieb mit schwacher Stimme, doch sie ließ sich nicht beirren.
»Natürlich kümmere ich mich um dich, Papa. Dr. Baader, was könnte ihm jetzt helfen?«
»Ich brauche nichts«, sagte Gottlieb.
»Viel Ruhe könnte, also … Wissen Sie, meine Regina, Gott hab sie selig, sie brauchte damals auch so viel Ruhe …«, sagte Dr. Baader.
»Ruhe ist ja schön und gut«, wandte August ein, und obwohl sein Tonfall wie immer freundlich war, fragte sich Anna Sophia, ob nicht ein wenig Ungeduld mitschwang, »aber eine zusätzliche medikamentöse Behandlung wäre sicherlich besser.«
»Da haben Sie recht«, sagte Anna Sophia. »Würden die Herren mich hinunter in die Apotheke begleiten? Dort finden wir alles, was wir brauchen.«
»Ach, Papperlapapp«, machte Gottlieb, allerdings blieb er liegen und hielt die Augen geschlossen. Es musste ihm wirklich schlecht gehen.
»Betty, bleibst du bitte bei ihm?«
Kurz drückte Anna Sophia noch die Hand ihres Vaters, bevor sie sich aufrichtete und auf den Flur hinaustrat. Hinter ihr ächzte der Doktor, während er ihr mit schweren Schritten folgte. Und obwohl sie August auf seinen wie gewohnt leisen Sohlen nicht hören konnte, wusste sie, dass auch er direkt hinter ihr war. Mittlerweile war es ein wenig dämmrig geworden, so dass Betty schon die Lichter in den Wandleuchten entzündet hatte. Sie tauchten den Gang mit seinen nackten Steinwänden in ein flackerndes, gespenstisches Licht. Rechts und links gingen das Schlafzimmer von Wilhelmine und ihr sowie das Zimmer der kleineren Schwestern ab, dahinter konnte Anna Sophia die Tür zur Treppe öffnen. Auch hier tanzten die Schatten kleiner Flammen an den Wänden, während Anna Sophia die schmalen, hölzernen Stufen hinuntereilte, vorbei am Hinterzimmer, in dem Gottlieb und August tagtäglich mit Medikamenten experimentierten. So oft sie konnte, lauschte Anna Sophia an der Tür den Gesprächen der Männer über ihre Fortschritte, ihre Theorien und Experimente. Gleichzeitig fühlte sie sich schrecklich deswegen. Natürlich gehörte sich so ein Verhalten ganz und gar nicht. Ihr Vater wäre sehr enttäuscht, wenn er sie erwischen würde. Immer wieder nahm sie sich vor, die Heimlichkeiten sein zu lassen. Sobald sie aber im Vorbeigehen einen spannenden Begriff aufschnappte, konnte sie doch nicht anders, als erneut stehen zu bleiben …
Nun lief sie bis zur Apotheke und schloss auf. August folgte ihr eilig, während der Doktor hinter ihr in den Raum schlurfte, in den durch die Schaufenster noch ein wenig Tageslicht fiel. Dennoch entzündete Anna Sophia die beiden Petroleumlampen an den Wänden. Nun warfen die Gläser und Fläschchen in den Wandregalen und auf dem Apothekerschrank tiefe Schatten.
»Was, glauben Sie, könnte meinem Vater Erleichterung verschaffen?«, fragte Anna Sophia in die Runde.
»Ich denke, möglicherweise wäre … Also, meiner Tochter – Gott hab sie selig – hat ja vor allem der Weißdorn ungemein geholfen.« Dr. Baader nickte nachdenklich und schaute an Anna Sophia vorbei in Richtung des dunklen Schaufensters.
»Das ist eine ausgezeichnete Idee, Doktor. Weißdorn hilft bei Herzschwäche und kann die Lebensgeister wecken.«
Es tat ihr zwar unendlich leid, doch sie versuchte, Baaders Erwähnung seiner Tochter zu ignorieren. Dazu war sie schon vor Monaten übergegangen – es ging einfach nicht anders. Der liebenswerte, aber etwas eigensinnige Familienarzt hatte schon immer gern von seiner Erstgeborenen gesprochen. Doch seitdem Regina an einer schleichenden Krankheit und unter großen Schmerzen verstorben war, konnte er kaum einen Satz aussprechen, ohne von ihr zu reden. Jedes Mal versetzte es Anna Sophia einen Stich. Sie hatte Regina sehr gemocht. Ein leises Mädchen war sie gewesen, doch wenn man genau hinhörte, hatte man einen seltenen Witz in ihrer Stimme gehört. Mit aller Kraft schob Anna Sophia die Erinnerung beiseite – sie musste jetzt für ihren Vater da sein.
Schon wollte sie zum Apothekerschrank laufen – in der Schublade oben links müssten noch einige Fläschchen der Weißdorntinktur zu finden sein. Doch ein vorsichtiges Räuspern von August ließ sie innehalten und ihren Kopf stattdessen in seine Richtung drehen. »Ein sehr spannender Gedanke, Doktor. Aber dürfte ich Ihnen vielleicht vorschlagen, ein noch wirksameres Medikament zu nutzen?« Während er das sagte, reckte er einen Zeigefinger in die Luft.
Doktor Baader öffnete den Mund, als wollte er etwas sagen. Gleichzeitig riss Anna Sophia die Augen auf. »Glaubst du, es ist so schlimm um meinen Vater bestellt?«
August trat einen Schritt auf sie zu. »Sorge dich nicht, deinem Vater wird es schon bald besser gehen.«
Langsam hob er eine Hand und legte sie auf ihren Oberarm. »Herr Müller und ich haben es erst vor wenigen Wochen geschafft, einen wertvollen Wirkstoff zu isolieren, der auf das Nervensystem stabilisierend und belebend wirkt. Wir haben ihn sogar bereits in der neuen Pulverisiertrommel gemahlen. Doktor Baader möchte ihn für seine Behandlungen einsetzen, nicht wahr, Doktor?«
Der nickte. »Meine ersten … nun ja, Versuche, haben eine beeindruckende Wirkung gezeigt.«
»Wunderbar«, sagte Anna Sophia. August berührte sie noch immer. Er sah ihr ins Gesicht, und sie hielt den Atem an. Sie sollten einander nicht so lange in die Augen schauen, dachte sie. Was der gute Doktor Baader wohl dachte!
»Was halten sie davon, wenn wir den neuen Wirkstoff bereits heute einsetzen, Doktor?« August ließ die Hand sinken.
»Es dürfte, also …«, der Arzt schien zu überlegen, dann nickte er mit Nachdruck. »Ich denke, es spricht nichts dagegen.«
»Wunderbar. Ich schlage vor, Sie beide gehen schon mal hoch und bringen Herrn Müller ein wenig Weißdorn. Das war wirklich eine ausgezeichnete Idee. Ich mache ihm derweil die erste Dosis unseres neuen Medikaments fertig und komme nach.«
Entschlossen lief Anna Sophia zum Apothekerschrank und holte eines der Fläschchen hervor. Sie hatte ihrem Vater vor Wochen dabei zusehen dürfen, wie er im Hinterzimmer gestanden und die weißen, kleinen Blüten sowie die langen, gezackten Blätter der Heilpflanze im Mörser zerstoßen hatte. Anschließend hatte er sie in die Fläschchen gefüllt und mit Korn übergossen. Die Tinktur müsse einige Wochen ziehen, danach wirke sie Herzschwäche entgegen, hatte er ihr erklärt. Aber auch Kreislaufbeschwerden, Schwindel und niedriger Blutdruck könnten damit gut behandelt werden. Sie hatte jedes seiner Worte aufgesogen. Wie sehr sie es genoss, Zeit mit ihrem Vater zu verbringen und von ihm unterwiesen zu werden! Auf keinen Fall durfte er merken, dass sie all das längst wusste. Und noch viel weniger sollte ans Licht kommen, was sie vor vielen Jahren außerdem über Weißdorn gelernt hatte – oder von wem. Nicht auszudenken, wie ihr Vater reagieren würde.
Dennoch musste Anna Sophia nun auch an die Worte ihrer Mutter denken: »Dem Weißdorn sagt man magische Kräfte nach. Er kann böse Geister vertreiben. Deswegen gibt es auf dem Land viele Höfe, die von Weißdornhecken beschützt werden. Und hier und dort weist man noch Kranke an, durch geflochtene Weißdorn-Tore zu schreiten, um ihr Leiden abzuschütteln.«
Das musste zu jener Zeit gewesen sein, in der sie noch hin und wieder in das Heimatdorf ihrer Mutter gefahren waren, um Großmutter zu besuchen. Oder war es bereits danach? Nachdem Vater es ein für alle Mal verboten hatte, obwohl Mutter getobt hatte vor Wut?
»Hat Oma dir davon erzählt?«, hatte Anna Sophia sie gefragt. Das sehnsuchtsvolle Lächeln, das diese Frage auf dem Gesicht der Mutter ausgelöst hatte, würde Anna Sophia nie vergessen. Seitdem hatte sie kein Lächeln mehr gesehen, das so traurig ausgesehen hatte.
Anna Sophia schüttelte leicht den Kopf, um ihre Gedanken zu vertreiben. Natürlich glaubte sie nicht an Magie. So ein mittelalterlicher Unsinn!, würde ihr Vater sagen. Doch wenn sie ehrlich zu sich selbst war, glaubte sie durchaus an alte Weisheiten, die Natur und an ihre fast grenzenlosen Möglichkeiten. Kurz sah sie durch das Schaufenster auf die Linde vor der Apotheke, von der sie manchmal dachte, sie wäre auf wundersame Weise mit ihrem Vater verbunden. Ließ der Baum seine Blätter im Dämmerlicht etwa noch tiefer hängen als sonst? Hoffnungsvoll schloss Anna Sophia ihre Hand um das Fläschchen, während sie, gefolgt von Doktor Baader, zurück in Vaters Schlafzimmer eilte.
Die alte Frau hatte einen länglichen Gegenstand in der Hand, während sie auf Kaspar zuging. In der Hütte mitten im Wald war es trotz des Feuers, das in einem Holzofen in der Ecke brannte, düster. War es ein dicker Ast? Auch Margaretha, die Kaspar doch vorhin noch hatte küssen wollen, kam bedrohlich immer näher.
»Was habt ihr vor?«, fragte er. Hatte er tatsächlich vor zwei Frauen Angst? Die eine war winzig, und auch die andere hatte nichts Kräftiges an sich. Dennoch spürte er, dass ihm der Schweiß ausbrach. Das konnte allerdings auch an der Wärme in der Hütte liegen.
»Sag, hübscher Junge, kannst du ein Geheimnis für dich behalten?«, fragte die Alte.
»Natürlich!« Kaspar nickte. Fast hätte er wie zum Beweis vom Geheimnis des Nachbarjungen erzählt, der gegen den Willen seiner Eltern die Tochter des Müllers heiraten wollte, doch er hielt sich gerade noch rechtzeitig zurück. Das jetzt auszuplaudern wäre wahrscheinlich nicht sehr hilfreich.
»Ich kann schweigen wie ein Grab«, sagte er stattdessen. Trotzdem kamen die Frauen weiter auf ihn zu. Er wich zurück.
»Was soll das?«, fragte er.
Sie waren nun so nah, dass er in Gesches Hand den hölzernen Stab eines Mörsers erkennen konnte. Kaspar hob beide Hände, um sich vor einem Schlag zu schützen, doch in der Mitte des Raumes angekommen, wendete sich die alte Frau einfach von ihm ab, beugte sich zu der Obstkiste hinunter und stellte den Stab in eine Holzschale. Zunächst zündete sie die große Kerze auf dem Tisch an, so dass ihr Licht auf den Mörser fiel. Dann begann sie in langsamen, kreisenden Bewegungen etwas darin zu zermalmen. Das Kerzenlicht beleuchtete ihr weiches, faltiges Gesicht.
»Was steht ihr noch so herum? Setzt euch und trinkt ein Tässchen Tee mit mir. Wir müssen reden.«
Verwirrt sah er zu Margaretha hinüber, die einen klapprigen Stuhl zurückzog und sich daraufsinken ließ. Langsam und vorsichtig tat Kaspar es ihr gleich, darauf bedacht, sein seit Tagen schmerzendes Knie nicht zu belasten.
»Weißt du, wer ich bin, hübscher Junge?«, fragte die Alte ihn.
»Ich denke, Sie heißen Gesche.«
Die Frau nickte. »Richtig. Ich heiße Gesche. Und früher habe ich wie ihr in Höhenforst gelebt.«
»Wilhelm hat Sie fortgejagt, nicht wahr?«, fragte Kaspar und war gleichzeitig ein wenig stolz auf seine eigene Kühnheit.
»Los, Kinder. Nun schenkt euch Tee ein!«
Mit zittrigen Händen griff Kaspar nach der Kanne und goss den noch dampfenden Tee in drei Tassen. War es Zufall, dass sie schon in der richtigen Anzahl für sie bereitstanden?
»Ja, er war sehr wütend. Es ist lange her …« Gesche sprach leise, ohne von ihrem Mörser aufzusehen. Kaspar und Margaretha nippten an ihren Tassen. Der Tee schmeckte blumig und gleichzeitig ein wenig bitter. Für eine kurze Zeit hörte man nur das Reiben des Mörsers in der Schale. »Seitdem lebe ich hier. Und es ist wichtig, dass niemand davon erfährt. Weißt du, was ich tue?«
Kaspar schüttelte den Kopf und trank noch einen Schluck. Die Wärme tat seiner Kehle gut.
»Ich bin eine Heilerin. Ich weiß zum Beispiel, wie man Frauen hilft, ihre Kinder zu gebären. Und ich weiß, was zu tun ist, wenn sie keine bekommen möchten.«
Vielsagend sah Gesche ihn an. Kaspar schaute von ihrem blauen zu ihrem braunen Auge und war sich nicht sicher, ob er sie wirklich richtig verstanden hatte. Gesche fuhr fort: »Dieser Ort war schon Zuflucht für viele verzweifelte Frauen. Wenn du ihn verrätst, verrätst du auch sie alle. Und gleichzeitig jene, die noch Hilfe brauchen könnten.«
»Ich möchte niemanden verraten«, sagte er schnell und drehte den Kopf in Margarethas Richtung. Ihre dunkelblonden Haare begrenzten ihr Gesicht wie schwere Vorhänge, während sie ihn dunkel anstarrte.
»Das will ich dir auch geraten haben. Wenn du es doch tust, bekommst du es mit mir zu tun«, presste sie zwischen ihren Zähnen hervor. »Gesche ist meine Familie, hast du verstanden?«
Kaspar nickte stumm, obwohl er keine Ahnung hatte, was sie damit meinte. Eigentlich waren der grobschlächtige Bauer Wilhelm, seine zwei Brüder und ihre Schwester Amalie ihre Familie.





























