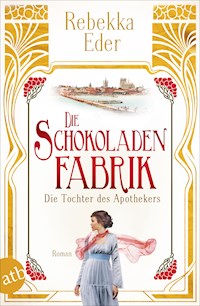9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Stollwerck-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Schokolade, Liebe und der Traum von Freiheit.
Köln, 1862. Apollonia Krusius gilt als Wunderkind. Eines Tages will sie studieren und Erfinderin werden, genau wie ihr Vater. Doch als er stirbt, scheint dieser Traum in weite Ferne zu rücken: Ihr Onkel will sie mit einem Stollwerck verheiraten, da deren junge, aber erfolgreiche Schokoladenfabrik eine sichere Zukunft verspricht. Zuerst ist Apollonia entsetzt. Wider Erwarten verliebt sie sich jedoch in den klugen Maschinenbauer Heinrich Stollwerck. Allerdings ist sie bereits seinem älteren Bruder Nikolaus versprochen. Und als der Deutsch-Französische Krieg ausbricht, steht Apollonia plötzlich vor ganz neuen Herausforderungen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 862
Ähnliche
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Rebekka Eder
Die Schokoladenfabrik – Das Geheimnis der Erfinderin
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Vorwort
Motto
Prolog — 1860
Teil 1 — 1862
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Teil 2 — 1867–1868
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Teil 3 — 1869–1871
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Teil 4 — 1871–1876
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
Epilog
Nachwort
Personenregister
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Vorwort
Liebe Leser*innen,
zur Schokolade gehört der Genuss, die Leidenschaft, der große Glücksmoment. Natürlich. Doch sie ist auch untrennbar verbunden mit Kolonialismus, Sklaverei und Ausbeutung. Wer eine Geschichte über diese sagenumwobene Köstlichkeit erzählen will, muss meiner Meinung nach beide Seiten zeigen: die schöne und die hässliche.
Bevor ich Sie ins Köln des 19. Jahrhunderts entführe, möchte ich Sie gern ein wenig vorbereiten: Sie werden von der Liebe lesen, von Sehnsucht, großen Zielen und magischen Momenten. Doch ich werde Sie auch mitnehmen auf eine Kakaoplantage, in der Menschen als Sklaven missbraucht und ausgebeutet werden, in eine Zeit, in der Naturwissenschaftler Menschen in unterschiedliche Rassen einteilen und dabei die menschenverachtende Ideologie festigen, die wir heute Rassismus nennen.
Meiner Meinung nach ist ein historischer Roman stets ein Balanceakt: Er soll eine vergangene Zeit erlebbar machen und helfen, unsere Geschichte und damit auch unsere Gegenwart besser zu verstehen. Doch er darf nicht unnötig verletzend sein, er sollte nicht unkommentiert rassistische Strukturen bedienen oder gar die Leser*innen unbewusst in eine koloniale Ordnung zwingen.
Als Autorin habe ich daher mehrere Entscheidungen getroffen, in die ich Sie gern einweihen möchte: Auf das besonders verletzende N‑Wort habe ich ganz bewusst verzichtet, allerdings tauchen durchaus rassistische und sexistische Wörter auf. Ich weiß, dass diese Bezeichnungen wehtun. Doch es war mir wichtig, dass »Das Geheimnis der Erfinderin« Diskriminierung, Ausbeutung und Missbrauch nicht ausblendet, sondern thematisiert.
Manche Szenen erzählen davon, andere deuten sie an. Mit Sicherheit hätte ich grausamere Szenen beschreiben können, um vielleicht noch näher an der Wahrheit zu bleiben, ich hätte expliziter werden und eine gewalttätigere Sprache verwenden können. Doch ich denke, dass kein Schreckens-Voyeurismus nötig ist, um ein Gefühl für diese Zeit zu bekommen.
Wir beginnen im Jahr 1860: Preußen beherrscht das dichter werdende Köln, die Stadtmauer fühlt sich bald an wie ein zu fest sitzender Gürtel, und in ihrer Mitte wächst der Dom langsam, aber stetig in die Höhe.
Franz Stollwerck, der in »Band 1 – Die Tochter des Apothekers« gemeinsam mit seiner Frau Anna Sophia viele Höhen und Tiefen seines Unternehmens gemeistert hat, ist mittlerweile nicht nur Bonbonfabrikant. Er hat auch eine Schokoladenfabrik errichtet und betreibt ein beliebtes Ausflugslokal, die Königshalle. Außerdem halten ihn seine neun Kinder auf Trab. Die drei ältesten Söhne drängen darauf, in seine Fußstapfen zu treten. Und dann ist da noch Apollonia Krusius. Er weiß es noch nicht, doch die junge, ausnehmend kluge Frau wird für das Unternehmen Stollwerck eines Tages von großer Bedeutung sein.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!
Ihre Rebekka Eder
Noch niemals hat eine Frau sich eine große, wissenschaftliche Aufgabe gestellt; niemals ist ihr die Lösung einer selbst leichten Aufgabe in origineller Weise geglückt.
Prof. Dr. med. Wilhelm Alex Freund, Direktor der Universität-Frauenklinik in Straßburg i.E., 1897
Ich halte die Frauen zum akademischen Studium und zur Ausübung der durch dieses Studium bedingten Berufszweige für in körperlicher wie geistiger Beziehung völlig ungeeignet.
Prof. Dr. med. Ernst von Bergmann, Direktor des Klinischen Instituts für Chirurgie an der kgl. Charité in Berlin, 1897
Wollen die »Intellectuellen« ihre Geschlechter erhalten und in ihren Nachkommen fortleben, so müssen sie vor allem streng darauf achten, dass ihre Frauen gesunde Weiber und nicht Gehirndamen sind.
Dr. Paul Julius Möbius, 1903
Daher kommt es, dass über weite Zeitläufe hinweg von den Spuren der Frauen nicht mehr erscheint als von den Spuren eines Schiffes im Meer.
Nach Anna Maria van Schürmann,
einer der ersten Studentinnen Europas, 1638
Prolog
1860
Niemand durfte Theresia bemerken. Es war ihr streng verboten, ihren großen Brüdern zu folgen. Doch sie musste die Schokoladenfabrik einfach mit eigenen Augen sehen. Sicherlich war sie wunderschön und phantastisch, bestimmt duftete es herrlich, und überall könnte sie naschen! Mama verbot ihr viel zu oft, Schokolade zu essen. Doch jetzt war Mama nicht hier – also drückte sich Theresia auf Zehenspitzen an der Wand entlang.
»Sag schon, wie macht sich die Maschine?«, rief Nikolaus, der Älteste und Größte der Geschwister, gerade. Wenn er ihr den Rücken zukehrte, wusste Theresia oft nicht, wen sie da vor sich hatte – ihren Bruder oder ihren Papa –, so ähnlich waren sich die beiden Männer. Das breite Kreuz, die großen, in die Hüften gestemmten Fäuste. Sogar die Stimmen glichen einander.
»Ich weiß nicht, Nikolaus.« Ihr Vater schüttelte den Kopf. »Das alte Handwerk erscheint mir sicherer.«
»Ach, Papa!« Peter, der Zweitälteste, seufzte. Er fuhr sich durch die gewellten Haare, dann schob er die Hände in die Hosentaschen. »Wenn wir jetzt nicht an die Zukunft denken, werden wir ganz schnell abgehängt!«
»Ich bin sehr gespannt, wie die Maschine läuft«, brummte Heinrich, der Jüngste der drei, mit leicht verträumtem Blick. »Bewegt sich der Kolben wirklich ganz von allein?«
Er hatte den anderen wieder mal nicht zugehört. Theresia unterdrückte ein Kichern. Ihr liebster Lieblingsbruder war wie immer in seiner eigenen Welt. Sie verstand seine Worte zwar nicht so richtig, aber bestimmt waren sie klug. Heinrich war der klügste Mensch, den sie kannte – obwohl er noch gar kein Mann war. Das sagte Papa zumindest. Mit seinen 17 Jahren sei er noch ein Kind und solle Ratschläge besser ernst nehmen. Wenn Heinrich das hörte, runzelte er furchtbar erwachsen die Stirn und zwinkerte Theresia dann heimlich zu. Nur jetzt nicht – er hatte schließlich keine Ahnung, dass sie sich im Schatten vor ihnen versteckte. Was für ein Spaß es werden würde, wenn sie ihm später davon erzählte! Er wäre bestimmt beeindruckt von ihrem Mut und würde mit heruntergezogenen Mundwinkeln nicken. Und dann könnten sie gemeinsam über die phantastische, geheimnisvolle, duftende Schokoladenfabrik sprechen!
»Na, dann kommt mal mit.« Ihr Vater stieß die Tür auf, die Theresia niemals öffnen durfte. »Wie ihr seht, halte ich noch am Handwerk fest. Hier vorn stehen die manuell betriebenen Maschinen. Ehrliche, harte Arbeit – schaut euch die Männer an!«, rief ihr Vater, während er in großen Schritten in die Fabrik lief. Ihre Brüder folgten ihm, und kurz bevor die schwere Tür hinter ihnen zufiel, schlüpfte auch Theresia hindurch.
Schnell versteckte sie sich im Schatten von etwas, das so ähnlich aussah wie die Kupferkessel in der Küche, nur viel größer. Sie schaute sich um und runzelte irritiert die Stirn. Sollte ein Ort, an dem etwas so Wunderbares wie Schokolade entstand, nicht der schönste Platz der Welt sein? Wie düster es hier stattdessen war! Ruß hing schwarz und schwer an den Wänden, er verdunkelte die kleinen Fenster unter der Decke und kitzelte ihr in der Nase. Besser, sie atmete durch den Mund. Nicht auszudenken, wenn sie jetzt niesen würde! Ob Papa sie wohl sehr schlimm schimpfen würde, wenn er sie entdeckte? Ein achtjähriges Mädchen an so einem Ort … Es roch nach Feuer, heißer Asche und Schweiß. Wie laut es war! Überall standen diese Kessel, und darunter knisterten Flammen. Die Luft war so stickig, dass Theresia der Schweiß auf die Stirn trat. Wie hielten die Arbeiter das den ganzen Tag aus? Direkt vor ihr stand ein kleiner, aber umso breiterer Mann auf einem Hocker. Seine nackten Oberarme glänzten feucht, während sie mit kreisenden Bewegungen einen gigantischen Mörser wieder und wieder in einen der Kessel stießen. Sein Gesicht wirkte starr, und immer wieder tropfte es von seiner Nase in den Kessel.
So leise sie konnte schlich Theresia um ihn herum. Als sie auf seiner Höhe ankam, hielt sie die Luft an und rannte dann zum Schatten eines zweiten Kessels. Atemlos sah sie sich um – und unterdrückte ein Seufzen. Der Kopf des Arbeiters hatte sich nicht gerührt.
»Hier werden die Kakaobohnen geröstet, richtig?«, fragte Heinrich gerade.
»So lang, bis die Schalen knacken. Hörst du das?«, fragte ihr Papa.
Theresia nickte stumm, obwohl sie natürlich gar nicht gefragt worden war.
»Dort werden sie von den Schalen gereinigt und dann in die Schokoladenmaschinen gegeben. Hier drüben, siehst du?«
Wohin ihr Vater wohl zeigte? Sie musste näher ran!
»Die Männer zerreiben die Bohnen so lange, bis sie zu einem flüssigen Öl werden, das sie mit Zucker vermischen können.«
Theresia spähte vorsichtig hinter ihrem Versteck hervor und sah, wie sich ihre Brüder und ihr Vater über den Kesselrand beugten.
»Und wie lang dauert das?«, fragte Nikolaus. »Die Männer stehen hier wahrscheinlich noch die halbe Nacht, oder?«
»Es dauert nun mal so lange, wie es dauert«, brummte ihr Papa.
»Und wie viel Schweiß, wie viele Haare und wie viel Kohlenstaub landen währenddessen in der Schokolade? Ich will gar nicht darüber nachdenken, was wir da verkaufen!«
Theresia verzog das Gesicht. Wie eklig!
»Und wie oft verbrennt die Masse, weil die Männer vor lauter Müdigkeit den richtigen Moment verpassen? Wie viele Rohstoffe haben wir schon verloren?« Nikolaus war so mutig! Obwohl man Papa schon ansehen konnte, dass er wütend wurde, sprach ihr Bruder weiter. »Papa, du musst zugeben, dass die neue Maschine, die ich vorgeschlagen habe, viele Vorteile hat! Zeigst du sie uns nun endlich?«
Kurz sahen sich Nikolaus und ihr Papa an, und ein bisschen wirkte es, als würde einer von ihnen vor einem Spiegel stehen. Nur, dass Papa etwas dicker war und seine Haare ein bisschen grauer, überlegte Theresia. Am liebsten würde sie zwischen sie laufen und irgendetwas Lustiges sagen, damit sie nicht anfingen, zu streiten.
Dann sagte Papa: »Na, kommt schon mit.«
Sie bogen rechts ab, und Theresia hüpfte zwischen den Kesseln hindurch, ihren Brüdern hinterher.
»Das Ding steht hier hinten«, hörte sie ihren Papa sagen.
»Das ›Ding‹ ist eine hochmoderne Dampfmaschine, Papa! Sie ermöglicht es uns, dass alle Arbeitsschritte, die sonst mühsam per Hand ausgeführt werden müssen, ganz automatisch ablaufen.« Theresia hörte förmlich, wie Peter die Augen verdrehte. »Wir sollten noch viel mehr von diesen ›Dingern‹ kaufen. Ich sage dir, in ein paar Jahren brauchen wir gar keinen Handwerksbetrieb mehr!«
»Schokolade, die per Hand hergestellt wird, hat einen ganz besonderen Geschmack. Es ist wie mit unseren Bonbons! Du weißt doch, dass sie besser schmecken, wenn eure Mutter sie kocht, als wenn diese neumodischen Maschinen das erledigen.«
Theresia huschte hinüber zur Wand und schlich langsam und vorsichtig daran entlang.
»Das will ich ja gar nicht abstreiten! Aber Mama kann nun mal nicht so viele Bonbons kochen, wie wir verkaufen!«
Heinrich schien den anderen kaum zuzuhören. Er betrachtete etwas abseits ein breites Band, das quer durch den Raum zu einem schwarzen Rad führte. Theresia klappte der Mund auf. Es war gigantisch! Und es thronte auf einem riesigen, liegenden Rohr, auf dem zwei Arbeiter an Hebeln hantierten. Es zischte und brodelte. War da vielleicht die Schokolade drin? Sie hielt die Nase in die Luft und schnupperte. Riechen konnte sie eigentlich nichts. Sie lief ein Stückchen weiter – und hörte, wie es schepperte. Sie war auf eine Schippe getreten!
Theresia zuckte zusammen, sah sich um – und fing Heinrichs Blick auf. Er stand nur wenige Schritte von ihr entfernt! Mit wild klopfendem Herzen hob sie ihren Finger an die Lippen. Psst, wollte sie sagen. Seine Augen weiteten sich, er öffnete den Mund, schloss ihn wieder. O bitte, flehte sie stumm.
»Ich hab sie gefunden«, brummte Heinrich dann.
Theresia blieb die Luft weg. Wie konnte er nur? Er war doch ihr allerbester Freund! Was sollte sie nun tun? Könnte sie schnell genug aus der Fabrik rennen, um der Strafe zu entgehen?
Doch da hob er den Finger an die Lippen, als wollte auch er »Psst« sagen, und blinzelte ihr verschwörerisch zu.
»Da drüben ist die Dampfmaschine!« Er zeigte auf den Kessel mit dem riesigen Rad und ging darauf zu. Fast hätte Theresia vor Erleichterung aufgelacht. Tief atmete sie durch und zog sich in den Schatten der Wand zurück.
»Ah, ja! Ist sie nicht prächtig?«, rief Nikolaus.
»Beeindruckend«, pflichtete Heinrich ihm bei.
Keiner der Männer bemerkte Theresia. Sie hatte ein solches Glück gehabt! Allerdings hatte sie noch immer keine Schokolade gefunden … Irgendwo mussten die kleinen Tafeln, die so süß und krümelig auf der Zunge lagen, doch gemacht werden! Vielleicht brauchte sie nur noch ein wenig näher heranzugehen, um sie zu finden – und ein bisschen zu naschen. Also nahm sie all ihren Mut zusammen und ging weiter auf den brodelnden und dampfenden Kessel zu. Nur noch ein Stückchen. Roch sie ein wenig Kakao? Etwas heißen Zucker?
Plötzlich zerriss ein Zischen den Augenblick. Die Arbeiter schrien auf, schwangen sich über das niedrige Geländer und sprangen fast gleichzeitig vom Kessel.
»Weg da!«, brüllte einer.
»Schnell!«, schrie ein anderer und stieß die Stollwercks zurück. Sie stolperten, rannten.
Theresia wollte hinterherrennen. Doch da hörte sie einen Knall. Er war lauter als Papas stampfende Füße, als Mamas Rufe in der Nacht, wenn sie Alpträume hatte, und als Heinrichs Lachen über Theresias lustige Grimassen zusammen. Unendlich viel lauter. Es war, als hätten sich alle Geräusche, die sich in Theresias kurzem Leben angesammelt hatten, miteinander vereint – zu einem einzigen, letzten Tosen. Eine schwarze Wolke erfasste Theresia, und sie fühlte sich an wie eine Welle, so als könnte sich Luft an einem kleinen Mädchen brechen. Und dann war da nur noch Hitze und Feuer – und ganz weit entfernt, kaum zu riechen, der unwiderstehliche Duft nach Schokolade.
Teil 1
1862
1. Kapitel
Apollonia Krusius, das Wunderkind, rührte im Marmeladentopf und weinte. Kurz bevor eine Träne in den Topf fallen konnte, wischte sie sie weg. Diese blödsinnige Weinerei, dachte sie und schniefte. Wenn sie jemand beobachten würde! Sie schüttelte den Kopf und sah, wie ein Tropfen durch die Luft segelte und mitten im roten Brei landete. So ein Mist! Schnell rührte sie um. Ob ihr Onkel, ihre Tante und ihre Schwester etwas merken würden, wenn sie die Marmelade später aßen? Ob sie wohl ihre Traurigkeit schmecken könnten?
Schon wieder so ein dummer Gedanke, dachte Apollonia. Warum konnte sie sich nicht zusammenreißen? Das Ganze war schon zwei Jahre her, und sie war ein großes Mädchen, schon 15 Jahre alt! Energisch rührte sie weiter. Sie sollte nicht mehr so oft daran denken, hatte ihre Schwester gesagt, sondern nach vorn schauen. Sie seufzte und sah aus dem kleinen Fenster. Wenn sie sich nach links beugte und seitlich hinausschaute, konnte sie die Kirchturmuhr sehen. Es war gerade kurz nach neun. Früher hatte ihr Vater sie sonntags um diese Tageszeit das Rechnen gelehrt. In einer halben Stunde wäre Naturkunde dran gewesen. Am allerliebsten mochte sie aber die frühe Mittagszeit, in der er von den Maschinen erzählte, die er gebaut hatte. Von Schiebern und Schwungrädern. Ihr Papa war nämlich nicht nur der beste Lehrer der Welt, sondern auch Maschinenbauer. Er hatte ihr Zeichnungen gezeigt und erklärt, wie Wasserdampf einen Kolben in Bewegung versetzen konnte.
»Ist das auch wirklich nicht zu kompliziert für dich?«, hatte er einmal gefragt, und sie hatte wild den Kopf geschüttelt.
»Der Druck entsteht, weil sich das gasförmige Wasser ausdehnt. Durch diese Leitungen gelangt der Wasserdampf in den Zylinder, habe ich recht?«, hatte sie mit ihrer damals noch so piepsigen Stimme gesagt und sich gefreut, da sich ein Lächeln auf seinem ernsten Gesicht ausbreitete.
»Du bist ein Wunderkind, weißt du das?« Sie erinnerte sich so gut an diese Worte. Wie sehr seine Augen hinter seinen Brillengläsern geleuchtet hatten! Damals war sie sechs Jahre alt gewesen und hatte die Stirn gerunzelt.
»Was ist ein Wunderkind?«, hatte sie gefragt.
»Ein Wunderkind ist anders als die allermeisten anderen Kinder. Es ist sehr klug. Schau, du bist ein kleines Mädchen und verstehst diese Maschine trotzdem. Das ist äußerst ungewöhnlich. Du bist etwas ganz Besonderes. Und deswegen werde ich dich unterrichten, obwohl das unüblich ist. Vielleicht wirst du eines Tages sogar studieren! Du wärst die einzige Frau in Köln! Wenn du immer schön brav und fleißig bist, wirst du einmal Großes erreichen, Apollonia, vergiss das nicht!«
Apollonia hatte es nicht vergessen, das würde sie nie. Doch jetzt, wo sie in der Küche vor dem neuen Sparherd stand und darauf wartete, dass die mohnblütenrote Marmelade eindickte, bemerkte sie zum ersten Mal, dass sie den Glauben an diese Worte verloren hatte. Hatte ihr Vater sie angelogen? Er hatte ihr selbst oft erzählt, dass ein guter Freund von ihm, Herr König, sich in der Fabrik über seine Begeisterung für Apollonias Fähigkeiten lustig machte. »Eigentlich halte ich vom kleinen König sehr viel. Aber dass er einfach nicht glauben möchte, dass ein Mädchen kann, was du kannst – das spricht nicht für seine Intelligenz! Du wirst es dem kleinen König und all den anderen Zweiflern schon zeigen, denk an meine Worte!«, hatte er mehr als einmal ausgerufen.
Sie wollte es nicht, und doch sah sie ihren Papa nun wieder vor ihrem inneren Auge. Seine glänzende Weste, seine Steckbügelbrille mit den ovalen Gläsern und dem langen Bogen über der Nase, die ihrer eigenen Lesebrille so sehr glich, sein abstehender Bart. Er hatte sich kurz gebückt und »Sieh an!« gerufen. Und dann hatte er ihr eine lange hellrote Mohnblume überreicht, die er gerade von der Wiese gepflückt hatte. Sie biss sich auf die Lippen und schüttelte die Erinnerung ab. Verflixt, wieso wurde diese Marmelade eigentlich nicht langsam dick? Da hatte die Familie schon diesen neuen modernen Herd gekauft, und trotzdem musste das Personal noch rühren und rühren. Ihre Hände und Arme taten schon weh. Wie hielten die Küchengehilfen das den ganzen Tag aus? Könnte man nicht einfach eine Maschine erfinden, die diese schweißtreibende, stundenlange Arbeit erledigte? Einen selbstrührenden Topf zum Beispiel. Apollonia legte den Kopf schief. Den Löffel könnte man doch bestimmt am Topfrand befestigen. Dann bräuchte es noch eine Vorrichtung, die ihn in Bewegung versetzte … Könnte man dafür nicht die Hitze nutzen, die der Herd sowieso produzierte? Müssten die Ingenieure täglich selbst in der Küche schuften, dann hätten sie so etwas bestimmt schon längst erfunden, ging es ihr durch den Kopf.
»Aber, Fräulein Krusius, was machen Sie denn da?«
Apollonia fuhr herum. In der Küchentür stand Hanni, die Köchin, und starrte Apollonia an. Ihr Gesicht war von Natur aus rötlich, doch nun war es vor Erstaunen sogar noch dunkler angelaufen.
Apollonia lächelte. »Guten Tag, Hanni! Wissen Sie, ich wollte doch so gern sehen, wie der neue Sparherd funktioniert. Deswegen habe ich Lise und Carla gefragt, ob ich …«
»Das ist ja ungeheuerlich! Da verlasse ich mich einmal auf die Küchenhilfen, und dann machen sie sich einen faulen Lenz! Wo sind die zwei jetzt?«
»Ich habe sie schon mal auf den Markt geschickt, damit …«
»Fräulein Krusius, Sie brauchen doch für die faulen Trinen nicht zu lügen!«
»Aber ich lüge nicht! Alles gut, liebe Hanni!« Das u von gut zog sie wie immer ganz lang, um Hanni zu beruhigen. »Ich bin wirklich froh, dass ich Lise und Carla kurz ablösen kann. Schauen Sie sich dieses Wunderwerk von einem Herd doch einmal an: Er hat eine installierte Wasserwanne, so dass immer warmes Wasser da ist, zwei Platten, auf denen gleichzeitig unterschiedliche Gerichte gekocht werden können, und diese Klappe, wodurch weniger Wärme verloren geht. Wie rußverschmiert die Küche früher mit dem offenen Feuerherd oft war! Und jetzt? Es ist alles blitzeblank!«
Hanni legte den Kopf schief und schmunzelte.
»Das ist wahr, Fräulein Krusius. Aber es steigt ja gar kein Dampf aus dem Topf. Ist der Herd denn überhaupt an?«
Apollonia runzelte die Stirn. Dann wurde sie rot. Tatsächlich. Während sie in Gedanken versunken gewesen war, hatte sie gar nicht bemerkt, dass die Marmelade abgekühlt war. Wahrscheinlich hätte sie längst Holz nachlegen müssen.
»Lassen Sie mich mal übernehmen, Fräulein Krusius. Kommt heute nicht die neue Klavierlehrerin?« Sie nahm ihr mit entschiedener Bewegung den Löffel aus der Hand.
Apollonia seufzte. »Stimmt. Der Klavierunterricht …«, murmelte sie voller Abscheu.
Kurze Zeit später saß sie gemeinsam mit ihrer Schwester Maria im Klavierzimmer, sah ihr beim Stricken zu und wartete.
»Ich bin schon ganz gespannt auf die Klavierlehrerin, du nicht auch?«, fragte Maria und schaute sie von der Seite an. Mit hochgezogenen Augenbrauen musterte sie Apollonias Rock, auf dem ein roter Marmeladenspritzer gelandet war, doch sie sagte nichts. Das brauchte sie auch nicht, ihr Blick genügte voll und ganz. Manchmal fühlte sich Apollonia, als wäre Maria die große Schwester, nicht sie.
»Ja, natürlich«, sagte Apollonia geistesabwesend.
»Das Fräulein unterrichtet auch bei Stollwercks. Das ist doch aufregend! Glaubst du nicht auch, dass das irgendetwas zu bedeuten haben könnte?« Sie lächelte versonnen in sich hinein. Apollonia wusste, dass Maria schon seit Jahren davon träumte, einmal einen der Stollwercks zu heiraten. Die Familie war eng mit ihrem Onkel Joseph und ihrer Tante Barbara befreundet und hatte auf Josephs Grundstück nebenan ihre große, herrschaftliche Königshalle gebaut. Ihre Zukunft erschien vielversprechend, hatte Tante Barbara einmal gesagt.
Maria hatte vor allem ein Auge auf Nikolaus Stollwerck geworfen, das wusste Apollonia. Seit Kindertagen, als er noch nicht auf dem Internat gewesen war und sie ihn bei Feierlichkeiten hin und wieder hatte beobachten können, schwärmte sie von dem stattlichen Jungen mit dem selbstbewussten Gang und der lauten Stimme. Natürlich würde sie das niemals zugeben, aber Apollonia kannte ihre Schwester gut.
»Was soll es schon bedeuten?«, fragte Apollonia.
Maria wiegte den Kopf hin und her. »Onkel und Tante legen anscheinend Wert darauf, dass unsere Erziehung mit der von Stollwercks Töchtern vergleichbar ist.«
»Mmh«, machte Apollonia und betrachtete Maria. Für die Klavierlehrerin der Stollwercks hatte sie sich herausgeputzt: Ihr Korsett war wie immer waghalsig eng geschnürt, das Kleid rosa und strahlend, und die blonden Haare waren perfekt geflochten.
Während Maria immer wieder gespannt zur Tür sah, betrachtete Apollonia das Klavier. Wie es wohl funktionierte? Langsam stand sie auf und ging zu dem schwarzen Instrument mit seinen vielen Tasten und Pedalen hinüber.
»Was machst du da?«, fragte Maria.
»Ich schaue nur …« Apollonia schlug eine Taste an, lauschte dem Ton und strich über den Klavierdeckel. »Ist diese Maschine nicht beeindruckend?«
Maria seufzte. »Das ist keine Maschine. Es ist ein Instrument.«
Apollonia zuckte mit den Schultern. »Wo sind da die Grenzen?«
Mit einem leichten Ruck öffnete sie den Klavierdeckel. Vor ihr erstreckten sich eng aneinandergereiht Metalldrähte und kleine Holzklötze.
»Mach das wieder zu! Wenn Barbara dich erwischt«, rief Maria.
»Nur einen Moment«, murmelte Apollonia. Rechts und links am Rahmen hatte sie Scharniere entdeckt. Sie versuchte sie zu öffnen. Beim ersten Mal lösten sie sich nicht, doch als sie mit der anderen Hand von außen gegen den Rahmen drückte, sprangen sie auf. Nun konnte Apollonia ihn vorsichtig in ihre Richtung kippen und herausheben.
»Apollonia! Was soll das?« Marias Stimme klang schrill.
»Schau dir das an …«, flüsterte Apollonia. Sie nahm nun den Tastaturdeckel heraus und stellte ihn neben sich auf den Boden. »Diese Mechanik! Schau, wie die Tasten …«
»Apollonia Krusius!« Die Stimme von Tante Barbara überschlug sich fast, und Apollonia zuckte so heftig zusammen, dass sie mit dem Fuß gegen den Tastaturdeckel stieß. Scheppernd fiel er um.
Mit aufgerissenen Augen, offenem Mund und in die breiten Hüften gestemmten Händen starrte Tante Barbara sie an.
»Was in Herrgotts Namen machst du da?«, rief sie.
»Ich … also … nun …« Schnell griff Apollonia nach dem Deckel, setzte ihn wieder ein und versuchte dann vorsichtig, den Rahmen ebenfalls an seinen Platz zurückzustellen.
»Ich wollte nur … ich dachte, bevor wir gleich lernen, wie man darauf spielt, sollten wir vielleicht nachschauen, wie es funktioniert.«
»Wir? Ich hab damit nichts zu tun!«, warf Maria schrill ein und hob eine Stricknadel in die Höhe, als würde sie sich melden. Gleichzeitig verknotete sich die Wolle.
»Keiner hat dich gefragt, Maria!«, rief Tante Barbara streng. »Apollonia, wenn du das Klavier kaputt gemacht hast, dann kannst du was erleben!«
Schnell klappte Apollonia den Klavierdeckel zu, strich nochmal darüber und lächelte. Sie schlug einen Ton an, der selbstbewusst und klar durch den Raum vibrierte. »Alles in Ordnung!«
Tante Barbara atmete durch die Nase aus, und Apollonia wunderte sich darüber, dass sie vor Wut nicht wie eine Lokomotive dampfte. Eigentlich mochte sie Tante Barbara gern. Sie war eine resolute, rundliche Dame, die hinter ihrer strengen Miene ein großes Herz verbarg. Für Apollonia und ihre Schwester Maria hatte sie immer ein offenes Ohr und meist sogar Verständnis für ihre Tränen, ihre Unkonzentriertheit und ihre Launen. Doch heute hatte Apollonia den Bogen wohl etwas überspannt.
»Es tut mir leid, Tante Barbara«, flüsterte sie und sah auf ihre Füße.
»Nun gut.« Barbara drehte sich um. Erst jetzt bemerkte Apollonia, dass die Klavierlehrerin bereits eingetreten war. Sie hatte wohl in der offenstehenden Tür gewartet, während Tante Barbara wutschnaubend hereingestürmt war. Ihre Lider waren geschlossen, als würde sie angespannt über etwas nachdenken, und ihre Hände hinter dem Rücken gefaltet.
»Kommen Sie, Fräulein Weber«, sagte Tante Barbara und hielt ihr den Arm hin.
Stirnrunzelnd sah Apollonia, dass die Lehrerin mit einer Hand vorsichtig tastend nach dem Arm der Tante griff und sich von ihr in den Raum führen ließ.
»Guten Tag, die Damen, mein Name ist Christina Weber«, sagte sie dann mit überraschend lauter Stimme und einem breiten Lächeln im rundlichen Gesicht. Sie hob die Lider – und Apollonia erkannte, dass die Augen, die in unterschiedliche Richtungen zu schauen schienen, in der Mitte milchig weiß waren.
Als Apollonia mit Tante Barbara, Onkel Joseph und Maria wenige Stunden später zum Tee beisammensaß, war die Marmelade dick und köstlich.
»Na, wie war die erste Klavierstunde, Mädchen?«, fragte Tante Barbara, bevor sie herzhaft in ein fürstlich bestrichenes Brot biss.
»Sehr anregend«, antwortete Maria. »Ich finde es ja wirklich erstaunlich, dass dieses blinde Fräulein so gut Klavier spielen kann.«
Apollonia nickte. »Das war beeindruckend. Sie hat sich hingesetzt, uns etwas vorgespielt, und ich wusste gar nicht, wie mir geschah! Sie hat so flinke Finger und so viel Gefühl! Ich hätte ihr ewig lauschen können!«
»Eines Tages will ich auch so wunderschön Klavier spielen können wie sie.« Maria seufzte. »Ob wohl alle blinden Frauen so gut Klavierspielen? Ich habe ja vorher noch nie eine Blinde gesehen. Aber, ihre Augen … wenn ich solche Augen hätte, würde ich sie vielleicht verstecken …«
»So wie deine Nase?«, rutschte es Apollonia heraus. Sofort wurde Maria rot – und Apollonia tat es leid, dass sie ihre Schwester geärgert hatte. Einen Moment lang herrschte eine peinliche Stille am Tisch. Dann fasste sich Tante Barbara ein Herz: »Woher kennen die Stollwercks das Fräulein Weber überhaupt, Joseph?«
»Sie kommt wohl aus Berlin. Der älteste Sohn muss sie bei einem Salon auf seinen Reisen getroffen und für seine Schwestern engagiert haben.«
»Und da kommt sie von Berlin eigens bis nach Köln?«
»Anscheinend haben die Stollwercks sie mit Konzerten in der Königshalle gelockt. Außerdem schien sie wohl ganz wild darauf zu sein, in unser schönes Köln zu kommen.«
»Tatsächlich? Das ist ja ungewöhnlich …«, murmelte Apollonia.
»Da werdet ihr jetzt also beide versierte Klavierspielerinnen«, stellte Joseph mit vergnügter Stimme fest.
»Nun, ehrlich gesagt … Klavierspielen ist vielleicht nicht so ganz das Richtige für mich«, sagte Apollonia.
Maria lachte spitz auf. »Apollonia denkt, sie wäre anders als andere Mädchen.«
»Anders?« Joseph runzelte die Stirn.
Langsam drehte Apollonia den Kopf. »Was willst du denn damit sagen?« Warnend sah sie ihre Schwester an. Sicher war das jetzt die Retourkutsche für ihren Witz über Marias Nase.
»Das hat sie von Vater. Er hat immer gesagt, sie sei kein Mädchen, sondern ein Wunderkind.«
»Ein was?« Barbara runzelte die Stirn, und Apollonia spürte, wie ihr die Hitze in den Kopf stieg. Wie konnte Maria so über sie und ihren Papa sprechen?
»Ach, das wisst ihr doch längst! Er hat sie unterrichtet, als wäre sie ein Junge, erinnert ihr euch? Und sie hat geglaubt, sie könnte eines Tages studieren. Es ist doch so, oder, Apollonia?«
Apollonia warf ihr den bösesten Blick zu, den sie zustande brachte, doch Maria sprach einfach weiter: »Sonntags war der Unterricht, richtig? Und die ganze Woche lang hat sie gelesen und gelernt. Es passt ihr nicht, dass sie jetzt wie alle anderen Mädchen leben soll.«
Onkel Joseph sah von Maria zu Apollonia und zurück. Offensichtlich wusste er nicht, was er sagen sollte. Stattdessen biss er in sein Brot, und Apollonia sah, dass an ein paar Barthärchen Marmelade kleben blieb. Er kaute, schluckte und antwortete dann: »Ein Wunderkind? Nun, das wäre ja doch sehr ungewöhnlich. Aber natürlich ist unsere Apollonia ein ganz schlaues Mädchen, da bin ich mir sicher. Ist doch so, nicht wahr, Barbara?«
Barbara räusperte sich. »Natürlich, Joseph. Natürlich.«
Kurz fing Apollonia den Blick ihrer Tante auf. Ihre Stirn lag in Falten – und in ihren Augen glaubte Apollonia für einen ganz kleinen Moment einen Zweifel an Marias Worten aufblitzen zu sehen. Ob sie wohl daran dachte, dass Apollonia das Klavier auseinanderbaute, statt darauf zu spielen? Dass sie jüngst ihr Bett selbst repariert und die Brunnenspirale auf dem Platz um die Ecke allein instandgesetzt hatte? Vielleicht fragte sie sich, wie normal ihr Verhalten für eine 15‑Jährige wohl war. Apollonia biss sich auf die Zungenspitze. Jetzt oder nie, dachte sie, dann sagte sie: »Ich würde tatsächlich sehr gern in die Schule gehen.«
Barbaras Augen weiteten sich, sie sah Joseph an.
»In die Schule?«
»Ich würde gern mehr über die Welt lernen. Ich weiß doch schrecklich wenig! Zum Beispiel, wieso ein Klavier klingt und welcher Stoff die Marmelade dick macht. Oder wie die Maschinen funktionieren, die Papa gebaut hat.«
Es war, als hätte Apollonia mit diesem Satz ein verbotenes Fenster geöffnet. Plötzlich wurde es kühl im Raum. Alle sahen auf ihre Teller.
»Papa war der beste Maschinenbauer der Welt. Er hat die phantastischsten Dampfmaschinen hergestellt«, fuhr sie fort, obwohl sie bereits eine Gänsehaut hatte. Ihretwegen wurde es am Tisch ungemütlich, und normalerweise versuchte sie alles, um eine solche Stimmung zu vermeiden. Doch heute konnte sie sich nicht bremsen.
»Du weißt, was mit Papas Maschine passiert ist«, flüsterte Maria.
»Nein, nicht wirklich.« Jetzt legte Apollonia ihr Brot auf den Teller zurück. »Und du auch nicht. Keiner weiß, warum sein Kessel explodiert ist und dieses Unglück bei Stollwercks geschah.«
»Apollonia, du sollst darüber doch nicht sprechen«, warnte sie Joseph.
Dennoch fuhr Apollonia fort: »Keiner von uns weiß, wie das geschehen konnte! Also möchte ich es herausfinden! Ich kann das schaffen! Eines Tages weiß ich, wo der Fehler lag, und dann werde ich …«
»Halt endlich den Mund!«, unterbrach sie Maria. »Auch du bist nicht so schlau, dass du Papa wieder lebendig machen kannst! Oder Mama. Sie sind beide tot!« Ihre Stimme klang schrill und atemlos. »Onkel Joseph, darf ich aufstehen?«
Hilfe suchend sah Joseph seine Frau an.
»Lass sie hochgehen, die Mädchen müssen sich erst mal beruhigen«, flüsterte Barbara. »Du weißt, wie viel sie durchgemacht haben.«
»Du hast recht, meine Liebe. Geh, Maria.«
Sofort sprang Maria auf und rannte hinaus.
»Darf ich auch …?«
Joseph sah Apollonia stirnrunzelnd an. »Warte noch einen Augenblick.«
Er biss wieder in sein Brot, und Apollonia wartete stumm, bis er es aufgegessen hatte. Nach einer gefühlten Ewigkeit wischte er sich langsam mit seiner Serviette über Mund und Backenbart, in dem mittlerweile einige Tropfen der Marmelade gelandet waren, kratzte den großen Bauch und seufzte. Endlich fuhr er fort: »Ich möchte etwas mit dir besprechen, Mädchen.«
»Ja, Onkel.«
Barbara winkte Carla heran, die das Geschirr wegräumte. Dann verließ auch sie selbst den Raum.
»Ich weiß, dass du klug bist«, setzte Joseph an. »Dein Vater hat es mir immer wieder erzählt. Und für ein kluges Mädchen muss all das sehr schwer sein. Du verstehst schließlich genau, wie viel sich für dich durch den Tod deiner Eltern geändert hat.«
»Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr uns so liebevoll aufgenommen habt«, sagte Apollonia beinahe mechanisch – das hatte sie schon so oft gesagt.
Joseph winkte ab. »Ich weiß, ich weiß. Es muss schrecklich sein, erst den Vater bei einem so schlimmen Unfall zu verlieren, dann auch noch die Mutter an eine Krankheit – und beides innerhalb kurzer Zeit. Wir sind froh, dass wir euch ein wenig Sicherheit geben können.« Auch das klang nicht mehr ganz neu – ihr Onkel hatte es schon häufig betont. »Ich muss dir aber auch ganz deutlich sagen, dass ich ein anderer Mensch bin als mein Bruder. Ich glaube nicht an Wunderkinder und Universitäten. Ich bin Kaufmann. Ich glaube an Wohlstand durch Handel, an ehrliche Arbeit und daran, dass eine Frau nun mal ihren Platz einnehmen muss. Eine dumme genauso wie eine kluge Frau. Verstehst du, was ich dir sagen will?«
»Natürlich, Onkel«, erwiderte Apollonia schnell, obwohl sie sich da gar nicht so sicher war.
»Ich will euch beschützen und irgendwann in ein sicheres Leben entlassen. Und dafür habe ich auch schon meine Pläne. Du kennst doch Franz Stollwerck.«
Apollonia nickte. »Ich dachte, ich darf nicht über ihn …«
»Was vor zwei Jahren in Stollwercks Schokoladenfabrik passiert ist, muss streng vertraulich behandelt werden. Es wäre schließlich ein Skandal, wenn das herauskäme! Nicht nur für Franz, auch für uns … Du weißt, wie eng meine Geschäftsbeziehungen zu Franz sind. Er ist wirklich ein feiner Kerl. Manchmal ein wenig ungehalten und aufbrausend, aber im Grunde gut.«
»So ähnlich wie Maria?«
»Nein, ganz anders als deine Schwester … Jedenfalls hat Franz fünf Söhne.«
Apollonia nickte langsam. »Ich weiß, Onkel Joseph. Einer von ihnen heißt Heinrich, richtig? Dann ist da Peter mit den unterschiedlich farbigen Augen. Und dieser ständig schlecht gelaunte Nikolaus. Ich glaube, Maria hat ein Auge auf ihn geworfen.«
Um Josephs Augen bildeten sich vergnügte Lachfalten. »So?«
»Aber die anderen beiden kenne ich nicht.«
»Ludwig und Carl, sie sind erst zwei und fünf Jahre alt. Wie dem auch sei. Ich möchte dich und deine Schwester mit Stollwercks verheiraten.«
Apollonia starrte ihren Onkel an. Wie Maria frohlocken wird, wenn sie das hört, dachte sie. Ganz im Gegensatz zu ihr selbst. Sie schluckte. Dann stammelte sie: »Aber … ich bin 15.«
Joseph lachte auf. »Das weiß ich doch. Natürlich verheirate ich euch noch nicht jetzt. Aber ich habe bereits mit Franz darüber gesprochen, er ist einverstanden. Wichtig ist ihm natürlich, dass ihr gut vorbereitet in diese Ehe geht. Das heißt: Du bekommst deinen Unterricht.«
Apollonia spürte, wie ihr der Mund aufklappte. »Tatsächlich?«
»Tatsächlich. Wir werden dich und deine Schwester ein Jahr lang auf die höhere Töchterschule schicken.«
Apollonia schlug die Hand vor den Mund. Ein Jahr erschien ihr unendlich lang. Was man in dieser Zeit alles lernen konnte! Zwar würde sie irgendwann einen Mann heiraten müssen, obwohl ihr Vater ihr immer gesagt hatte, dass sie anders sei als die anderen Frauen und dass sie, wenn sie es nicht wolle, auch nicht heiraten müsse, sondern studieren könne. Aber bis Onkel Josephs Hochzeitspläne für sie relevant würden, dauerte es noch viele Jahre. Viel früher durfte sie in die Schule gehen. Sie klatschte in die Hände. »Aber das ist ja ganz wundervoll! Und dort werde ich rechnen lernen? Und Naturkunde? Wie bei Papa?«
Joseph wiegte mit dem Kopf. »Das nicht. Es ist eine Schule für Mädchen. Dort werdet ihr auf das Leben in der Ehe vorbereitet. Speziell auf das Leben an der Seite eines Unternehmers. Du wirst lernen, wie man einen Haushalt führt, Handarbeiten verrichtet, Französisch und Englisch spricht, solche Dinge.«
Apollonia ließ die Hände wieder sinken.
»Solche Dinge«, wiederholte sie leise. Aber immerhin, fügte sie tapfer im Stillen zu sich selbst hinzu.
»Das wollte ich dir sagen. Jetzt kannst du hochgehen.«
Langsam stand Apollonia auf und wandte sich zum Gehen. An der Tür angekommen, drehte sie sich noch einmal um. Leise fragte sie: »Und was, wenn ich die Stollwerck-Söhne alle nicht leiden kann?«
Joseph schmunzelte wieder und rieb sich den Backenbart.
»Ach … Mach dir darüber keine Gedanken. Erst mal ist es doch die Hauptsache, einer von ihnen mag dich, oder nicht?«
»Natürlich, Onkel«, sagte sie und trat hinaus.
2. Kapitel
Nikolaus hatte keine Zeit zu schreien. Es knallte, er hielt sich die Ohren zu und hechtete hinter einen Kessel, dann spürte er die heiße Druckwelle und sah den Feuerschein. Für einen kurzen Augenblick war die ganze Fabrik in loderndes Licht getaucht. Dann drang der Rauch in seine Nase, er hustete und hielt sich den Ärmel vor den Mund.
»Wir müssen hier raus!«, rief er.
»Schnell!« Peter zerrte an ihm.
»Los!« Franz keuchte.
»Nein!«, hörte er Heinrich schreien. »THERESIA!«
Nikolaus fuhr hoch und riss die Augen auf. Sein Atem ging schnell, auf seiner Stirn stand der Schweiß. Er wischte sich über das Gesicht und versuchte, sich zu beruhigen. Bitte, lieber Gott, vergib uns, dachte er wie so oft.
Er brauchte einige Minuten, um wieder ruhig zu atmen. Dann zwang er sich aus dem Bett. Kurz sah er aus dem Fenster und stützte die Hände auf das Fensterbrett. Auf der Bayenstraße in der südlichen Altstadt waren schon einige Dienstleute unterwegs, Kutschen fuhren vorbei, und zwei Geschäftsmänner mit hohen Hüten, glänzenden Fracks und filigranen Stöcken stolzierten gestikulierend ihrer Wege. Würde er die Fenster öffnen, könnte er sicher das bunte Treiben am Rhein hören: die Schiffsmänner, die ihre Waren an Land schafften, die Hafenarbeiter, die sie sich zuwarfen. Schließlich war der Hafen nur eine Häuserreihe von der Bayenstraße entfernt.
Die Stadt war bereits erwacht, Nikolaus sollte sich beeilen. Schnell stieg er in seine glänzende Stoffhose, knöpfte sein weißes Hemd sowie den hohen Kragen zu, legte sein Halstuch darüber und zog die graue Weste an. Prüfend sah er in den Spiegel. In den letzten Jahren hatte er sich zu einem großen, kräftigen Mann entwickelt. Er setzte sich noch seinen Zwicker auf, um sein Gesicht mit der markanten Nase und dem dunklen Schnauzbart besser zu erkennen. Dann trat er auf den Flur hinaus. Im Haus war bereits laute Geschäftigkeit ausgebrochen. Zwei Dienstmädchen eilten mit Bergen an Bettwäsche an ihm vorbei, und aus der Küche unten hörte er es klappern und klirren. Zwei Kinder brüllten, ein Kindermädchen sang, draußen fuhr eine Kutsche vor, überall eilte und stürmte jemand durch die Gänge. Nikolaus liebte seine Familie. Für seine Eltern und seine sieben Geschwister würde er einen Mord begehen. Für jeden und jede Einzelne von ihnen. Gleichzeitig machten sie ihn manchmal wahnsinnig. Es waren einfach so furchtbar viele! Seine Eltern sollten wirklich aufhören, weitere Kinder zu bekommen. Er würde es niemals sagen, doch mit den Kleinen – Ludwig, Carl und Therese – war nun wirklich eine Grenze in diesem Haus erreicht. Kein Wunder, dass seine Mutter, die früher so sehr im Vertrieb ihrer Bonbons aufgegangen war, mittlerweile überhaupt keine Zeit mehr für die Firma hatte. Wenn sogar ihr diese Horde an Nachkommen über den Kopf zu wachsen drohte – wie sollte Nikolaus sie alle gleichzeitig ertragen? Den kindlichen Peter, der ständig seine albernen Scherze machte. Den nachdenklichen Heinrich, der nichts als seine Maschinen im Kopf hatte. Cartharina, die ihn stets mit ihren großen, tapferen und doch so traurigen Augen ansah. Mutter, die immer für alle da sein wollte, an diesem Anspruch aber scheitern musste, und versuchte, dies mit Kräutersträußchen auszugleichen. Und der so sprunghafte wie sture Vater.
Nikolaus seufzte. Ob seine Brüder schon unten waren? Er klopfte erst an Heinrichs, dann an Peters Tür.
»Oh, Mist!«, rief es aus dem einen Raum.
»O nein!«, aus dem anderen.
Nikolaus verdrehte die Augen, vergrub die Hände in den Taschen und seufzte. »Beeilt euch, in Herrgotts Namen«, brummte er.
Heinrich war erst vor kurzem aus dem Internat nach Hause gekommen, und Peter hatte die letzten Monate in Paris verbracht. Es machte sicherlich keinen guten Eindruck auf Vater, wenn sie schon in den ersten Tagen ständig verschliefen. Besser, er wartete hier auf sie. Dann konnte er sie ein wenig zur Eile anhalten.
»Nun macht schon!«, rief er streng. »Es ist schon spät!«
Beinahe zehn Minuten dauerte es, bis Peter atemlos aus seinem Zimmer stürmte. »Einen Applaus für Nikolaus!«, rief er. »Danke dir, großer Bruder! Ohne dich hätte ich noch bis Mittag geschlafen!« Sein neumodisches französisches Sakko hatte er in der Eile falsch zugeknöpft, und seine gewellten Haare waren noch ganz unordentlich. Doch Peter konnte sich so einiges erlauben – schließlich sahen die meisten nur ganz gebannt in seine unterschiedlich farbigen Augen. Das eine war blau und das andere braun.
Endlich stürmte auch Heinrich auf den Flur hinaus.
»Danke, Nikolaus«, brummte er und knöpfte sich noch den Frack über der breiten Brust zu. In den letzten Jahren hatte auch er beachtliche Schultern und zudem noch ein markantes Kinn bekommen. Bald stand er Nikolaus in Stattlichkeit in nichts mehr nach. Nur, dass Heinrich kleiner war als er selbst. Außerdem waren seine Haare heller, er hatte diese steile Denkerfalte zwischen seinen Augenbrauen und einen dichten Bart an Oberlippe und Kinn. Kaum glaubte Nikolaus, dass er erst nächste Woche 19 Jahre alt werden würde, so erwachsen sah Heinrich bereits aus.
»Auch verschlafen, kleiner Bruder?« Peter lächelte Heinrich spitzbübisch zu und versuchte gleichzeitig, seine eigenen Haare mit der Hand notdürftig zu ordnen.
»Ich habe wohl letzte Nacht zu lang in meinen Abhandlungen gelesen«, erklärte Heinrich zerknirscht.
»Nun macht schon«, rief Nikolaus und ging voran. »Wir haben heute viel vor!«
Er hörte, dass seine Brüder ihm folgten und sich dabei tuschelnd miteinander unterhielten. Das würde sich wohl nie ändern, dachte Nikolaus: Der lustige Peter und der grüblerische Heinrich waren eine Einheit. Schon als Kinder hatten sie zu zweit ständig Streiche ausgeheckt. Obwohl Nikolaus nur zwei Jahre älter war als Peter und drei Jahre älter als Heinrich, kam er sich neben den beiden noch heute wie der einzig Erwachsene vor.
»Es ist aber auch verführerisch, am frühen Morgen nicht zum miesepetrigen Backe zu müssen«, flüsterte Heinrich Peter zu.
»Oh, seine wehleidigen Ausschweifungen über die internationale Politik habe ich im Ausland wirklich nicht vermisst.«
»Nein? Und was ist mit seinem Mundgeruch, wenn er sich weit zu dir vorbeugt und dich fragt, welche außenpolitischen Erfolge und Rückschläge Napoleon III. in den letzten Jahren zu verzeichnen hatte?«
Nun lispelte Peter mit hoher, abgehackter Stimme: »Herr Stollwerck, wo hat der Franzose gesiegt? Wo hat der Franzose verloren? Was soll Preußen tun?«
Nikolaus konnte die Reaktion zwar nicht sehen, doch er ahnte, dass Heinrich grinste.
»Ihr sollt euch beeilen und nicht tratschen!«, tadelte Nikolaus seine Brüder und unterdrückte ein Grinsen. So kindisch sie manchmal auch waren – er hatte sie vermisst. Nun stieg er die breite Treppe hinunter, lief quer durch das Foyer mit den hohen Wänden, den gewaltigen Zierpflanzen und der rot-gelb gemusterten Tapete.
»Guten Morgen, Betty«, grüßte er das Kindermädchen, das er schon immer sehr gemocht hatte und das nun tadelnd mit dem Kopf schüttelte. Sicher war Betty nicht entgangen, dass die drei Brüder zu spät dran waren. Alt war Betty geworden, dachte er unwillkürlich, als er im Vorbeigehen ihren faltigen Hals sah. Doch er wollte nicht darüber nachdenken, was das bedeutete.
»Elise, die Fiese, guten Morgen!«, rief Peter und winkte der kleinen Schwester Elisabeth überschwänglich zu, die gerade aus der schon geöffneten Haustür hinaustreten wollte. Sie drehte sich noch einmal zu den Brüdern um und seufzte. Sie war erst dreizehn Jahre alt, führte sich in letzter Zeit aber auf wie eine Erwachsene.
»Seid ihr endlich wach geworden?«, rief sie und stemmte die Hände in die Hüften. Da tauchte auch die zwei Jahre ältere Schwester Cartharina mit dem blassen, zarten Gesicht und den blonden, hochgedrehten Haaren in der Tür auf.
»Elisabeth, du weißt doch, unsere Herren Brüder sind unverbesserlich.« Ein Lächeln konnte sie offensichtlich aber nicht unterdrücken. »Komm schon, unsere Kutsche steht bereit!«
Waren ihre Augen heute noch stärker von diesem sanften Hellrot umrandet als sonst? Nikolaus versuchte, sich nicht schon wieder um ihre Gesundheit zu sorgen.
»Und was lernt ihr heute in der höheren Töchterschule? Knicksen? Nicken? Lächeln?«, neckte Peter sie. Die drei Brüder wussten genau, wie sehr Elisabeth diese Schule liebte und welche Abneigungen Cartharina gleichzeitig gegen den Unterricht hegte.
»Heute steht Stricken auf dem Plan, es wird sicher wundervoll«, sagte Elisabeth betont würdevoll, während Cartharina mit den Augen rollte.
»Vielleicht verunglückt ja unsere Kutsche«, flüsterte sie.
»Was sagst du, Cartharina?«, flötete die kleine Elisabeth.
»Nichts, nichts. Wir müssen wirklich los, Elisabeth. Einen schönen Tag euch!«
Schon waren sie verschwunden, und die Tür wurde hinter ihnen zugeschlagen.
»Kommt ihr jetzt endlich?«, brummte Nikolaus und führte seine Brüder den Gang hinunter bis zur Küche. Einen wichtigen Tag wie den heutigen sollte man unbedingt mit einem guten Frühstück beginnen.
Er schob die Tür auf und wollte die Köchin Minna bitten, ihnen schnell etwas zuzubereiten, doch noch bevor er den Mund öffnen konnte, stockte er. In der großen Küche mit dem gewaltigen Feuerherd voller Klappen und Schubladen, den vielen Schüsseln und Löffeln, die aufgereiht an der Wand hingen, den Regalen, in denen sich das Porzellangeschirr stapelte, und dem langen Tisch für das Dienstpersonal stand nicht nur wie erwartet die Köchin Minna – die vielleicht größte Frau der Welt –, sondern auch ihre Mutter Anna Sophia. Langsam drehte sie sich um. Auf ihrem Arm hielt sie die fast einjährige Tochter Therese. Immer wenn Nikolaus das kleine Mädchen mit den winzigen blonden Löckchen sah, versetzte es ihm einen Stich. Wie hatten seine Eltern sie nur auf diesen Namen taufen lassen können?
»Meine lieben Söhne, seid ihr nicht ein wenig spät dran?«
Einen Moment sah Anna Sophia die drei streng an und blinzelte noch langsamer als sonst. »Sogar Nikolaus! Von dir bin ich das gar nicht gewohnt …«
Ihre Haare waren nachlässig hochgesteckt, der Morgen hatte sie bereits zerzaust, doch ihre weichen Wangen glänzten, und ihre Lippen waren hellrot. Die kleine Therese schaute ihnen einen Moment interessiert entgegen, streckte ein Ärmchen nach ihnen aus und schmiegte ihr Gesicht dann doch an den Hals ihrer Mutter, an dem ein kleines Amulett baumelte. Ihre Beinchen strampelten und brachten die Kräuterschere zum Schwingen, die wie so oft an Anna Sophias Rock hing.
»Es ist unsere Schuld, Nikolaus hat auf uns gewartet«, brummte Heinrich und schob die Hände in die Hosentaschen.
»Es tut uns leid, wir geloben Besserung, wirklich!«, beteuerte Peter. »Wir waren nur schon wieder so schrecklich müde.«
Endlich huschte ein mildes Lächeln über ihr Gesicht. Ihrem Liebling Peter konnte sie nie widerstehen, dachte Nikolaus und ärgerte sich über den Neid, den er dabei empfand.
Seine Mutter trat zur Seite und zeigte auf drei Teller. Darauf lagen herrlich duftendes Kaiserweck, Mettwurst und Butter, daneben standen drei Tassen Kaffee. Er dampfte noch. Woher wusste ihre Mutter nur immer, wann sie auftauchen würden? Schon war der Neid wie weggeblasen.
»Du bist eine Wucht«, entfuhr es Nikolaus.
»Sagenhaft«, brummte auch Heinrich.
»Hach, Mama!«, pflichtete ihnen Peter bei.
Sie beugten sich über den Tisch und wollten das Essen im Stehen hinunterstürzen.
»Immer mit der Ruhe!« Anna Sophia lachte. »Setzt euch bitte. Minna, lässt du uns einen Moment allein? Und könntest du Therese zu Betty und den Kindern bringen? Sie ist heute mit Ludwig und Carl im Garten.«
Die hochgewachsene Köchin nickte, nahm das Kind auf den Arm, das sofort anfing zu weinen, und verließ den Raum. Nikolaus, Heinrich und Peter sahen ihre Mutter überrascht an.
»Nun, eigentlich sollte ich darüber nicht mit euch sprechen, ich denke aber, Offenheit ist für alle in diesem Zusammenhang das Beste. Peter, du warst ein halbes Jahr in Paris. Und Heinrich, das Gleiche steht für dich an, um deine Ausbildung abzuschließen.«
»Und danach steigen wir gemeinsam mit Nikolaus in Papas Firma ein.« Peter kaute auf einem Stück Kaiserweck, und Nikolaus wunderte sich darüber, wie selbstverständlich diese Worte aus seinem Mund klangen. Manchmal hatte Nikolaus nämlich das Gefühl, der Bruder würde den Eintritt in die Firma eigentlich ganz gern noch ein wenig hinausschieben und bis dahin das unstete Leben genießen. Er war im Herzen ein Lebemann, eine Firma wie Stollwerck bedurfte hingegen viel Disziplin. Nikolaus wusste das und war im Gegensatz zu Peter schon heute bereit, alle nötigen Opfer zu bringen.
»Es wäre sicher das Beste, ja«, antwortete Anna Sophia. »Für euch, für die Firma und für euren Vater. Aber euer Verhalten in den letzten Tagen war dem nicht gerade zuträglich.«
Nikolaus öffnete schon den Mund, um zu protestieren, doch beschwichtigend tätschelte Anna Sophia ihm die Hand. »Damit meine ich natürlich nicht dich, Nikolaus.«
»Unser Verhalten?«, fragte Peter in gekränktem Tonfall.
»Muss ich euch das wirklich erklären?« Anna Sophia verzog bedauernd das Gesicht. Kurz sahen sich die jüngeren Brüder an und schluckten sichtlich.
»Ihr habt fast jeden Tag verschlafen, tollt hier durch die Gänge wie kleine Jungen, ärgert eure Schwestern, wo ihr nur könnt, und zieht hinter Franz’ Rücken Grimassen. Nur Nikolaus kann euch hin und wieder zur Vernunft bringen! Euer Vater und ich sind doch ein wenig … irritiert. Wir haben euch aufs Internat geschickt, damit ihr zu verantwortungsbewussten jungen Männern heranwachst, unser Familienunternehmen tatkräftig unterstützen und eines Tages mit Nikolaus übernehmen könnt. Ich bin mir sicher, dass ihr alle Fähigkeiten dafür mitbringt und viel gelernt habt. Doch ihr müsst euch nun auch selbst dazu entscheiden, diesen Weg einzuschlagen.«
Heinrich ließ das Brot in seiner Hand sinken und sah seine Mutter nachdenklich an. »Das werden wir, Mama.«, brummte er.
»Ach, Mama.« Peter kaute geräuschvoll. »Wir freuen uns einfach so, wieder zu Hause zu sein. Ihr wisst doch, dass wir verantwortungsvoll sind, wenn es darauf ankommt! Nicht wahr, Nikolaus?«
Nikolaus schnaubte, doch ein Schmunzeln konnte er dabei nicht unterdrücken.
»Seid ihr das wirklich?« Anna Sophia zog mahnend die Augenbrauen hoch.
Peter wischte sich über den Mund und sagte etwas leiser: »Es stimmt schon, wir waren in letzter Zeit etwas … undiszipliniert. Aber du weißt doch auch: Wenn wir versuchen, Papa in der Firma zu helfen, bremst er uns. Wir sind ihm entweder zu neunmalklug oder noch viel zu unsicher. Ich glaube, er ist noch nicht soweit, uns mit einzubeziehen.«
»Unsinn, Peter! Ich weiß, dass Franz streng sein kann. Aber er hält große Stücke auf euch!«
Auch Heinrich fuhr sich mit einer Serviette über den Mund, lehnte sich zurück und spähte mit leicht zusammengekniffenen Augen zu Peter hinüber. »Mama hat recht, Peter …«
»Naja, aber seit der Sache in der Schokoladenfabrik …«
»Sprich nicht weiter«, unterbrach ihn Anna Sophia mit plötzlich scharfer Stimme.
»Wir können doch alle nichts dafür, und er tut manchmal so, als wäre es unsere Schuld!«
»Peter!«, rief Nikolaus.
Wie konnte Peter dieses Tabuthema nur ansprechen? Nikolaus musste wieder an seinen Traum denken und sah vor seinem inneren Auge Theresias kleines Gesicht zwischen den Kesseln auftauchen. Sie hätte nicht dort sein dürfen! Wieso hatte sie niemand bemerkt? Wie hatte sie sich heimlich hineinschleichen können? Sie würde noch leben, wenn die Brüder besser Acht gegeben hätten …
Auch Heinrich war auf einen Schlag blass geworden.
»Ist alles gut?«, fragte seine Mutter ihn in jetzt wieder sanfterem Ton.
Heinrich rieb sich den Schnauzbart. »Ja Mama, es ist nichts«, brummte er.
»Euer Vater und ich glauben ganz fest an euch, aber ihr müsst euch dennoch ein wenig anstrengen, habt ihr verstanden?«
»Du hast recht, Mama.« Heinrich nickte.
»So«, brummte Nikolaus und stand mit einem Ruck vom Tisch auf. »Ich bereite schon mal alles vor, ihr kommt in spätestens zehn Minuten nach!«
Er schnappte sich noch ein Brötchen und lief hinaus.
An den Wänden standen Regale voller Bücher, und der Sekretär in der Mitte bog sich unter einem Papierchaos. Franz saß dahinter und stützte die Ellenbogen auf die Knie, die Fingerspitzen hatte er auf Höhe seines Mundes aufeinander gelegt. Seine Haare und sein Backenbart waren in den letzten Jahren ergraut, und sein Bauch war gemütlich rund geworden. Nikolaus stand neben ihm und fing gerade seinen ungeduldigen Blick auf, als es endlich an der Tür klopfte und Heinrich und Peter hereinkamen.
»Einen angenehmen Morgen wünsche ich«, sagte Franz mit einem Gesichtsausdruck, der Belustigung und Tadel zugleich andeutete.
»Guten Morgen, Papa«, antwortete Heinrich.
Auch Peter murmelte eine Begrüßung und kratzte sich verlegen am Kopf.
»Sie waren verhindert und entschuldigen sich. Ist doch so, oder?«, fragte Nikolaus und sah die beiden beschwörend an.
»Ja, bitte verzeih.«
»Verstehe.« Franz nickte und sah erst Peter, dann Heinrich in die Augen. »Eure Mutter hat euch sicher schon die Leviten gelesen, habe ich recht? Na dann. Fangen wir an.«
»Ich habe etwas vorbereitet.« Nikolaus zeigte auf die kleine Sitzgruppe hinter Franz. Auf den runden Tisch hatte er kleine Teller, Gläser und eine Karaffe mit Milch gestellt.
»Papa, du bist ja der Meinung, dass wir bei der handwerklich gefertigten Schokolade bleiben sollten«, begann Nikolaus, während er seinen Zwicker zurechtrückte. »Ich kann deine Beweggründe verstehen, vor allem bezüglich der … Sicherheit der Dampfmaschinen.«
Nikolaus bemerkte, dass Heinrich neben ihm die Hände zu Fäusten ballte. Ihm war, als würde ihn dieses Thema sogar noch mehr mitnehmen als Nikolaus. Der Bruder blieb zwar gern schweigsam und distanziert, legte vor Geschäftspartnern stets eine brummige Sachlichkeit an den Tag und ließ sich nur hin und wieder, wenn es um Maschinen und Technik ging, von seiner Leidenschaft mitreißen. Doch Nikolaus wusste, dass er recht sensibel war.
»Ich denke aber, wir müssen auch weitere Kriterien berücksichtigen, wie Kosten und Stückzahl.«
»Ich weiß.« Franz rieb sich das Kinn. »Dazu habe ich einige Unterlagen von dir bekommen.«
»Genau. Zum anderen geht es um den Geschmack. Ihr wisst ja, dass bei der handwerklichen Fertigung häufig Rohstoffe anbrennen oder Schweiß und Haare die Masse verschmutzen, was wiederum durch stärkeres Würzen ausgeglichen wird. Das ist nicht nur teuer, sondern auch geschmacklich von Nachteil.«
»Was zu beweisen wäre«, warf Franz ein.
»Ganz genau. Deswegen habe ich zwei verschiedene Tafeln unserer Schokolade sowie eine Tafel Dampfschokolade besorgt.«
Sichtlich neugierig betrachteten Nikolaus’ Brüder die Süßigkeiten, die vor ihnen auf den Tellern lagen. Einen großen Unterschied konnte man zwischen den verschiedenen Portionen nicht feststellen. Vielleicht war die eine etwas dunkler, die andere etwas matter, vielleicht war es auch nur das Licht.
»Ich verrate nicht, welche Schokolade von welchem Hersteller ist. Probier sie – ich denke, du wirst überrascht sein, wie gut die Dampfschokolade schmeckt, Papa.«
»Ich will doch meinen, dass ich unsere Schokolade unter Tausenden erkennen würde …«, sagte ihr Vater.
»Also, wir fangen mit diesem Teller hier an.«
Nikolaus wartete, bis die anderen sich bedient hatten, dann nahm auch er sich ein Stück. Er legte es auf seine Zunge und erkannte den vertrauten Kakaogeschmack, die krümelige, fast sandige Konsistenz, den kräftig süßen Zucker. Das Stück zerfiel sofort in viele kleine, während er kaute – jeder musste merken, dass das eindeutig Vaters Schokolade war. Wohlschmeckend, keine Frage. Aber seitdem er sie kannte, fragte er sich, ob man es nicht besser machen könnte. Er mochte es nicht, wenn die Körner zwischen seinen Zähnen knirschten und die Luftblasen in der Schokolade sie so bröselig machten. Außerdem war da, wenn man geschluckt hatte, dieser seltsame Nachgeschmack. Ölig vielleicht, nein, rußig? Und ein wenig nach Zimt.
»Mmh«, brummte ihr Vater, rieb sich das Kinn und nickte.
Nikolaus reichte die nächste herum. Sie ähnelte der ersten, nur war der Nachgeschmack anders. Diesmal erinnerte er an dunkle Erde und Salz.
»Schließlich noch diese hier.« Nikolaus verteilte Stücke vom letzten Teller.
Sicher war allen sofort klar, dass dies eine andere Schokolade war. Die Konsistenz war zwar ebenso sandig wie die Stollwercksche Schokolade, doch zerbröselte sie nicht ganz so leicht. Und, was noch viel ausschlaggebender war: Sie hatte keinen Nachgeschmack. Nicht den geringsten! Da waren nur Kakao und Zucker, die eine wunderbare Vereinigung eingingen. Herb und süß zugleich, würzig und lieblich. So schmeckte die Zukunft, dachte er mit größer werdender Selbstsicherheit. Er beobachtete die anderen und sah, dass Peter genüsslich die Augen schloss. »Wundervoll«, sagte er. »Hast du davon noch mehr?«
Franz Stollwerck lachte leise. »Ich muss ja zugeben, dass ich stolz bin, so gewitzte Söhne zu haben. Ihr habt euch abgesprochen! Glaubt nicht, dass ich das nicht merke.« Er zwinkerte. »Ihr seid schlau, alle drei. Aber ich bin es auch! Ich habe natürlich keinen großen Unterschied geschmeckt. Seitdem eure Mutter damals die Idee hatte, Schokolade zu fertigen und gemeinsam mit unseren Bonbons zu verkaufen, werden unsere Waren ehrlich produziert, von Hand gerieben und gerührt. Bei mir explodiert kein Dampfkessel mehr, das wisst ihr doch.« Er seufzte. »So, und jetzt raus mit euch. Ich habe ein Unternehmen zu führen!«
Er stand auf, scheuchte sie nach draußen und wirkte dabei wie ein alter Mann, der teils amüsiert, teils angestrengt eine Horde Schuljungen bändigt.
Nikolaus biss die Zähne zusammen und kämpfte um seine Beherrschung. Da begegnete ihm Peters Blick, der ganz leicht mit dem Kopf schüttelte. Sie wussten alle, dass es besser wäre, nun erst mal locker zu lassen. Dann würde ihr Vater vielleicht noch einmal allein darüber nachdenken.
»Nun gut. Belassen wir es dabei …«, brummte Nikolaus und kratzte sich die Nase. »Wir machen einen kleinen Spaziergang zum Dom, die Bauarbeiten kann man sich dieser Tage gar nicht oft genug ansehen. Aber denk darüber nach, Papa. Glaub mir, wir haben uns nicht abgesprochen.«
Und als Nikolaus sich im Türrahmen noch einmal umdrehte, sah er, wie sein Vater innehielt und nachdenklich auf den dritten, leeren Teller schaute. Dann fiel die Tür zwischen ihnen ins Schloss.
»Sieh dir das an!«, rief Apollonia und fasste Maria am Unterarm. Mit der freien Hand hielt sie ihre Schute fest. Sie legte den Kopf in den Nacken und sah an der mit Ornamenten, Figuren, Mustern und Türmchen geschmückten Fassade des Kölner Doms hinauf.
»Ist das nicht unglaublich? Schau, wie hoch die Männer dort oben hämmern! Siehst du sie? Wie Köln von dort wohl aussieht? Stell dir vor, was passiert, wenn sie den Halt verlieren!«
»Entsetzlich!«, rief Maria schrill. »Komm weiter, es ist noch ein ganzes Stück.«
Die Mädchen waren auf dem Weg zum Neumarkt, wo sie für Tante Barbara Arznei holen sollten. Außerdem durften sie sich für die neue Schule im Schreibwarenladen Papier und Federn kaufen. Sie hatten nicht viel Zeit, bevor es Abendessen geben sollte, doch wie so oft konnte Apollonia ihren Blick nicht lösen. Sie liebte diesen Ort. Wann immer sie konnte, kam sie zur Westfassade, um die Bauarbeiten zu beobachten. Oder sie ging um den halbfertigen Dom herum und betrachtete den Centralbahnhof, der hier 1859 eröffnet worden war. Mitten in die Stadt fuhren seitdem dampfend und krachend Eisenbahnen und spuckten Fahrgäste aus fremden Städten aus. Sie liebte die Geräusche an diesem Ort: das Zischen und Rattern der Züge, das Gemurmel und Getrappel der Menschen, das Hämmern und Sägen der Domarbeiter, die Geschäftigkeit, die Veränderung, das Wachsen und Gedeihen dieser Stadt. Wenn sie könnte, wäre sie ständig mittendrin und würde ihre eigenen Gedanken kommen und gehen sehen. Manchmal, an ihren mutigsten Tagen, träumte sie davon, selbst in einem der Seile zu hängen, die Füße an der Fassade, ausgestattet mit Hammer und Meißel. Diesen Dom, ja, die Stadt mitzugestalten. Und dann musste sie über ihre eigene Dummheit lachen. Was hatte sie nur manchmal für absurde Gedanken? Sie blieb doch leider ein Mädchen.
Ganz oben über ihrem Kopf thronte der mittelalterliche Domkran, darunter hingen unzählige Arbeiter in Seilen, standen auf Gerüsten und schlugen auf die Fassade ein. In den letzten Jahren war der Dom so schnell in die Höhe geschossen, dass die Kölner immer wieder mit großen Augen davorstanden und es kaum fassen konnten. Auch jetzt waren Apollonia und Maria nicht die einzigen Schaulustigen an der Westfassade.
»Nun komm schon!«, rief Maria noch einmal, doch Apollonia rührte sich nicht.
»Gleich, nur einen Augenblick noch.«
»Erstaunlich, nicht wahr?«, fragte neben ihr eine tiefe Männerstimme.
»Allerdings«, antwortete Apollonia.
»Oh, Apollonia!«, wisperte Maria. »Du warst doch gar nicht gemeint.« Und in eine andere Richtung viel freundlicher: »Guten Tag, die Herren.« Maria zog an ihrem Arm. »Jetzt komm schon, Apollonia.« Und Apollonia zwang sich, endlich den Blick zu lösen. Erst schaute sie Maria, dann die drei Männer an, die neben ihnen standen. Einer von ihnen sah sie amüsiert an: Er war breit gebaut, hatte eine große, gebogene Nase, auf der ein Zwicker saß, und einen schwarzen Schnauzbart. Irgendwie kam er ihr bekannt vor.
»Ein beeindruckendes Schauspiel, nicht wahr?«, fragte er.
»Und wie! Ich könnte den Männern stundenlang zusehen.«
»Apollonia!«, zischte Maria und versuchte erneut, die Schwester mit sich zu ziehen.
»Sehr verständlich, Fräulein …?«