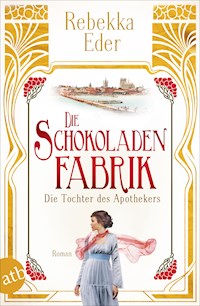9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Stollwerck-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ein Gedicht aus Schokolade
Köln, 1881: Therese Stollwerck ist stolz auf die prosperierende Schokoladenfabrik ihrer Familie, zu deren Erfolg auch sie einen Beitrag leisten will. Doch von ihrer Idee, Werbesprüche für das Unternehmen zu dichten, wollen die Gebrüder nichts wissen – und ihre Schwester lieber an einen Geschäftspartner verheiraten. Therese jedoch gibt ihren Traum, die Hauspoetin der Schokoladenfabrik zu werden, nicht auf und verweigert sich einer Heirat. Schließlich ist es einzig der feinsinnige Künstler Emil Doepler, der ihr Herz höherschlagen lässt und der sie ermutigt, ihre Texte unter Pseudonym einzureichen …
Das große Finale der Erfolgssaga über die Schokoladenfabrik der Kölner Familie Stollwerck
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 774
Ähnliche
Über das Buch
Die jüngste Schwester der Gebrüder Stollwerck hat immer ein Buch zur Hand: Therese liebt es, in fremde Welten einzutauchen und sich in phantastischen Geschichten zu verlieren. Kein Wunder, dass Emil Doepler, der für die Schokoladenfabrik der Stollwercks einzigartige Bilder schafft, eine magische Anziehungskraft auf sie ausübt. Während sie ihm heimlich Briefe schreibt und sich Hals über Kopf in den feinsinnigen Künstler verliebt, entdeckt sie ihr besonderes Gespür für Worte. Von nun an träumt sie davon, Werbesprüche zu Emils Bildern zu dichten. Ihre Brüder nehmen diese Pläne allerdings nicht ernst. Stattdessen planen sie Thereses Hochzeit mit dem Seifenhersteller William Lever aus England. Eine Verbindung beider Familien würde dem stetig wachsenden Familienunternehmen aus Köln zu großem Vorteil gereichen. Was allerdings keiner ihrer Brüder ahnt: Therese ist wild entschlossen, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie wird für ihren Traum kämpfen. Sogar, wenn sie dafür mit ihrer Familie brechen muss …
Über Rebekka Eder
Rebekka Eder, 1988 in Kassel geboren, hat Theaterwissenschaft und Germanistik in Berlin, Erlangen und Bern studiert und gleichzeitig ihre ersten Romane veröffentlicht. Nachdem sie als Werbetexterin und Journalistin gearbeitet hat, konzentrierte sie sich schließlich ganz auf ihre Leidenschaft. Sie lebt und schreibt in Nordhessen.
Im Aufbau Taschenbuch sind bereits ihre Romane »Die Schokoladenfabrik – Die Tochter des Apothekers« und »Die Schokoladenfabrik – Das Geheimnis der Erfinderin« erschienen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Rebekka Eder
Die Schokoladenfabrik – Der Traum der Poetin
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Vorwort
Motto
Prolog — 1880
Teil 1 — 1881-1883
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Teil 2 — 1885-1886
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Teil 3 — 1886-1896
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
Epilog — 1900
Nachwort
Danksagung
Personenregister
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für Mama,
deren Begeisterung mich durch diese Geschichte fliegen ließ.
Vorwort
Liebe Leser*innen,
Auf den folgenden Seiten möchte ich Sie in die Jahre 1880–1900 entführen – in eine Zeit der gewaltigen Umbrüche, des technologischen Fortschritts und der sozialen Kämpfe. Bei meinen Recherchen habe ich überraschende Parallelen zur Gegenwart entdeckt. Gleichzeitig stieß ich unweigerlich auf einen erschreckenden Rassismus und tief verwurzelte Misogynie. Historische Romane haben meiner Meinung nach die Aufgabe, eine vergangene Zeit erlebbar zu machen, damit wir mehr über Geschichte und Gegenwart lernen können. Bei Themen wie Rassismus und Sexismus sieht man sich da als Autorin allerdings vor einer Herausforderung: Soll man das verletzende Vokabular der Vergangenheit nutzen, um möglichst ungefiltert zu zeigen, wie es »wirklich war«? Oder tragen wir unserer Gegenwart und ihren Erkenntnissen Rechnung? Vor allem aber: Wie sehr können und müssen wir uns vor alter, hasserfüllter Sprache schützen?
Keine dieser Fragen kann ich in diesem Vorwort umfänglich beantworten. Aber ich möchte Sie in meine Überlegungen einweihen, die ich während des Schreibens angestellt habe:
Ich persönlich denke, dass ein historischer Roman nicht ausschließlich die Zeit widerspiegeln kann, in der er spielt. Zudem wäre ein originaltreuer Stil des 19. Jahrhunderts für viele Leser*innen mit Sicherheit ziemlich zäh. Wer diese Sprache ungefiltert lesen möchte, sollte sich unbedingt in historische Dokumente vertiefen – in Romane, Briefe oder Berichte des 19. Jahrhunderts. (Ich kann es empfehlen – hochspannend!) Ein historischer Roman, verfasst in den 2020er-Jahren, ordnet hingegen aus heutiger Sicht ein. Daher habe ich mich in Band 3 dieser Reihe – wie auch schon in den beiden Vorgängern – um eine Balance bemüht. Einerseits nähere ich mich der Zeit an, indem ich hin und wieder Worte wähle, vor denen wir heute aus gutem Grund zurückschrecken. Andererseits war es mir wichtig, auf besonders kränkende Begriffe zu verzichten. Ich hätte eine gewalttätigere Sprache nutzen können, um der damaligen Zeit näher zu kommen, bin aber der Überzeugung, dass dies nicht nötig ist, um ein Gefühl für die Probleme dieser Jahrzehnte zu bekommen.
Unsere Zeitreise beginnt im Jahr 1880: Gerade wurde in Köln endlich der Dom vollendet. Noch steht die Stadtmauer – doch schon bald wird die wachsende Bevölkerung sie sprengen. Mit Köln breitet sich auch ein prosperierendes Unternehmen aus: Die Gebrüder Stollwerck bauen immer größere Fabriken in der ganzen Welt. Doch in ihrem Ehrgeiz übersehen sie das ungenutzte Potenzial in ihrer Familie: Ihre junge Schwester Therese hat einen großen Traum, ein besonderes Talent – und zugleich ein gefährliches Temperament …
Viel Spaß mit dem großen Finale der Reihe »Die Schokoladenfabrik«!
Ihre Rebekka Eder
PS: Für die bessere Orientierung in dieser Großfamilie finden Sie am Ende des Romans ein Personenregister.
Ich achte dennoch eure Tugend nicht,
Verwerfe kühn eu’r heiliges Gericht!
Seid des Gesetzes Hort, der Sitte Rächer,
Des frommen Glaubens treuer Genius!
Es lebt ein heil’ger Geist auch im Verbrecher.
Der Freie sündigt, weil er sünd’gen muss.
Louise Aston, 1846
Prolog
1880
Wenn der Dom fertig ist, geht die Welt unter – so lautete ein altes Kölner Sprichwort. Kaspar hatte nicht daran geglaubt, er würde die Vollendung dieses Bauwerks eines Tages erleben. Oder das Ende der Welt. Doch nun wimmelte und brummte die ganze Stadt so laut, als würde es im Gebälk der Welt schon bedenklich ächzen.
An diesem 15. Oktober 1880 waren sämtliche Kölner auf den Straßen und legten die Köpfe in die Nacken. Es war der vielleicht letzte Spätsommertag des Jahres. Durch die Straßen wirbelte blutrotes Laub, der Himmel war tiefblau und die Luft mild. Sogar die Fabrikarbeiter, die sonst kaum Tageslicht sahen, blinzelten gegen die Sonne an und betrachteten die Türme des Doms, die zwar noch von Baugerüsten umgeben waren, aber doch vollendet und unfassbar hoch in den Himmel aufragten. Auch Kaspar verengte die Augen und betrachtete die kölnischen Flaggen, die am Gerüst im Wind wehten. Ob er der einzige Mann weit und breit war, der an diesem Tag nach etwas ganz anderem Ausschau hielt als nach der Spitze des Nationaldenkmals?
»Köln feiert drei Tage lang die Vollendung des Doms, sogar der Kaiser kommt! Und jeder Arbeiter bei Stollwerck soll zumindest an einem Tag mitfeiern können«, hatte Peter Stollwerck seinen Fabrikarbeitern einige Tage zuvor mit großzügigem Lächeln verkündet. Und auch Kaspar wollte diesen seltenen freien Tag, diese vielleicht einzigartige Gelegenheit, die ihnen der Unternehmer eröffnet hatte, auf keinen Fall ungenutzt lassen.
Im Gedrängel der Massen stießen Kaspar und Nuno immer wieder aneinander. In der Ferne erkannte Kaspar verkleidete Menschen auf Wagen und Pferden, die stolz durch die Straßen zogen. Er musterte einen nach dem anderen – doch die Gesichter waren ihm fremd.
»Was diese Verkleidungen wohl zu bedeuten haben?«, brummte er und sah zu Nuno hoch, der ihn mittlerweile überragte.
»Julie sagte, man würde die Geschichte des Doms in einem historischen Festzug nachspielen.«
»Ah«, machte Kaspar und kaute auf seinem Grashalm.
»Trugen die Menschen früher Kettenhemden, als sie den Dom bauten?«
»Ich glaube nicht.« Kaspar rückte sich den Schlapphut zurecht. »Vielleicht wollen sie Ritter aus dem Mittelalter darstellen.«
»Also haben Ritter den Dom errichtet?«
Kaspar zuckte mit den Schultern. Woher sollte er das wissen?
Sich immer wieder umblickend, stand Kaspar mit Nuno am Rande des Neumarkts und schob seinen Grashalm von einem Mundwinkel in den anderen. Während um ihn herum Menschen in ihren besten Sonntagskleidern ihre gewaschenen Hälse reckten und dem Festzug mit behandschuhten Händen zuwinkten, beobachtete er konzentriert die Scharen von verkleideten Bürgern, die in einem gemächlichen Zug in Richtung Hohe Straße schritten. Er griff in seine Hosentasche, befühlte den Stein, den er seit so vielen Jahren mit sich herumtrug, und zog dann die kleine Tafel Schokolade hervor, die jeder Arbeiter zur Feier des Tages bekommen hatte.
»Essen wir die jetzt?« Nuno nahm seine ebenfalls in die Hand.
»Warum nicht?«, brummte Kaspar. »Bevor sie noch schmilzt.«
Dann öffnete er das Papier und betrachtete die dunkel glänzende Süßigkeit, die darin eingeschlagen war. Bisher hatte er nur selten Schokolade gegessen. Leisten konnte er sie sich kaum, aber zu wichtigen Anlässen schenkte man den Arbeitern eine Kostprobe. Er erinnerte sich daran, dass sie Nervosität lindern konnte – und wenn er ehrlich zu sich selbst war, dann hatte er genau das in diesem Moment bitter nötig. Er wollte es vor Nuno nicht zeigen, doch seine Knie fühlten sich weich und sein Nacken feucht an. Also nahm er seinen Grashalm aus dem Mund, brach ein Stück Schokolade ab und legte es sich auf die Zunge. Wie süß sie war! Wie schwer und erdig. Er kaute und musste unwillkürlich lächeln. Wie war es möglich, dass dieser Geschmack einen Mann so glücklich machte?
Vielleicht war heute der Tag, dachte er. Nach all den Jahren. Diesmal würde er sich nicht von Feigheit aufhalten lassen. Diesmal würde er der Mann sein, der er immer hatte werden wollen.
Während die Schokolade auf seiner Zunge zerschmolz, an diesem allerletzten, ewigen Spätsommertag, sah Kaspar zu Nuno hinüber, der ebenfalls selig lächelte.
»Dass man das aus Kakao macht …« Der Junge schüttelte nachdenklich den Kopf. »Schokolade hat nichts mit dem Fleisch zu tun, das wir früher auf der Kakaoplantage von São Tomé aus der Frucht gepult haben. Dabei habe ich das auch gemocht. Manchmal, wenn keiner hingesehen hat, habe ich ein wenig genascht. Es war das Himmlischste, das ich kannte …«
Kaspar brach ein weiteres Stück ab und kaute, während er wachsam all die Menschen um sich herum musterte. Manche von ihnen hatten altertümliche Gewänder und Hosen an, andere ritten in eleganten Kleidern auf Pferden, und wieder andere thronten auf reich geschmückten Wagen. Auf einem davon wurde eine Nachbildung des alten Domkrans spazieren gefahren, auf einem anderen das Modell des fertiggestellten Doms.
Da streifte sein Blick endlich das eine Gesicht, das er mit jeder Faser seines Körpers hatte finden wollen. Oder war es eine Täuschung? Früher war er häufig in den Straßen zusammengezuckt, weil er glaubte, er würde sie erkennen. Diese blonden Löckchen, diesen roten Mund, diese vollen Wangen oder das überlegene Lächeln. Doch heute war es etwas anderes. Schließlich wusste er diesmal, dass sie kommen würde.
Es bestand kein Zweifel, denn auf einem ausnehmend großen Schimmel thronte eine Königin. Sie saß in einem Damensattel, die Hände hielten die mit Goldfäden geschmückten Zügel und über ihren Schultern lag ein glänzendes Gewand. Ihre ergrauten Haare waren mit einem wehenden weißen Tuch umwickelt und auf ihrem Kopf trug sie eine Krone.
Rechts und links von ihr ritten Frauen, die er ebenfalls kannte. Die eine konnte zwar nicht sehen, hielt sich aber beeindruckend gut auf ihrem Pferd. Die andere war trotz ihres hohen Alters beinahe unmenschlich schön mit ihren hohen Wangenknochen und den weißen Augenbrauen.
»He, Kasper, wo willst du hin?«, rief Nuno.
Kaum hatte Kaspar wahrgenommen, wie er sich den Rest Schokolade in den Mund geworfen hatte und vorwärtsgehastet war, um der Königin mit rasendem Herzen und schwindelndem Kopf zu folgen.
»Ich bin noch verabredet«, brachte er mit vollem Mund hervor. »Warte nicht auf mich!«
Dann kämpfte er sich durch die Menschenmenge. Immer wieder reckte er den Hals, um sie nicht zu verlieren. Wie sollte er Schritt mit ihrem Pferd halten? Er hastete, stolperte, wurde geschubst und beschimpft, doch er gab nicht auf. So lange er ihre weißen Locken, das Hufgeklapper ihres Pferdes und ihr wehendes Haarband sehen konnte, hatte er eine Chance. Er lief, kaute, schluckte und keuchte, streckte sich und schob sich weiter. »Emma!«
Zahlreiche Köpfe drehten sich zu ihm um – doch ihrer nicht. Noch einmal brüllte er aus Leibeskräften: »Emma!«
»Gehen Sie aus dem Weg«, polterte eine dunkle Stimme hinter ihm. Er drehte sich um und sah sich zwei schnaubenden Pferden gegenüber. In seiner Aufregung hatte er gar nicht bemerkt, dass eine Kutsche versuchte, sich einen Weg quer über die Hohe Straße zu bahnen. Der Kutscher funkelte Kaspar mit wütenden Augen an.
»Die Straße ist gesperrt!«, rief eine alte Frau neben ihm in Richtung des Wagens. »Fahren Sie zurück, wir feiern heute den Dom!«
»Mein Herr muss hier durch, egal, was heute gefeiert wird.« Der Kutscher knallte mit seiner Peitsche auf die Straße, so dass die Menschen um ihn herum zurückwichen. Auch Kaspar sprang zur Seite. Gerade schritt ein Heer mit gestreiften Mützen, roten Strumpfhosen und Speeren an ihm vorbei. Emma musste bereits hinter der nächsten Kurve verschwunden sein.
»Sie können hier nicht durch«, polterte ein beleibter Mann. »Sehen Sie denn nicht, was hier los ist?«
Flüchtig beobachtete Kaspar, wie die Kutschentür aufging und ein junger Herr herausschaute. »Bitte entschuldigen Sie, aber ich muss leider dringend nach Düsseldorf«, erklärte er höflich.
»Oh, Herr Ludwig Stollwerck«, sagte da der Mann, der gerade noch lautstark protestiert hatte. »Bitte entschuldigen Sie.« Er wandte sich um und schob die Menschen beiseite. »Machen Sie bitte einmal Platz! Der Herr Stollwerck muss hier durch! Entschuldigung, darf ich?«
Er stoppte sogar den Festzug mit ausgebreiteten Armen, so dass die Kutsche passieren konnte und in der nächsten Gasse verschwand. Erstaunt sah Kaspar dem Wagen hinterher – und wollte dann endlich die Beine in die Hand nehmen, um dem kostümierten Heer zu folgen. Doch da legte sich ihm eine kleine, warme Hand auf die Schulter. Und noch bevor er sich umdrehte, wusste er, wem sie gehörte.
Er schluckte schwer und atmete tief durch – erst dann wandte er den Kopf, um seiner Emma wieder in die Augen zu schauen.
Dreißig Jahre war es her, dass er sie zuletzt gesehen hatte. Ozeane hatten sie getrennt, ein ganzes Leben auf hoher See, ein falscher Ehemann, all die Zeit …
Und jetzt stand sie vor ihm, mitten im Menschenmeer Kölns, während er noch den verheißungsvollen Geschmack von Schokolade auf der Zunge trug. Zwar war ihre Haut blasser geworden und ihr Lachen hatte elegante Spuren darin hinterlassen, doch ihre dunklen Augen waren die gleichen geblieben, und auch ihr spitzbübisches Lächeln stahl sich zurück auf ihre Lippen.
»Was schreist du denn so?«, fragte Emma mit ihrer unverwechselbar hohen Stimme. »Wilhelmine sagt, sie wäre fast vom Pferd gefallen.«
Kaspar wusste nicht, was er sagen oder tun sollte. Er öffnete den Mund, doch alles, was herauskam, war: »Ich habe einen … Stein für dich.«
»Einen Stein?« Emmas Schmunzeln wurde deutlicher. »Andere Frauen wünschen sich Blumen oder Liebesbriefe … Sie liegen ja so falsch!«
Sie kicherte und es klang wie früher, obwohl sie nun über fünfzig sein musste. In ihren Augen funkelte der alte Schalk so mädchenhaft, dass er vergaß, seinen Stein hervorzuholen.
»Ich weiß, es gehört sich nicht«, flüsterte sie, und mit jedem Wort wurde ihre Stimme tiefer. »Aber – darf ich?« Und ohne seine Antwort abzuwarten, küsste sie ihn.
Teil 1
1881-1883
1. Kapitel
Therese hielt ihr Buch fest in beiden Händen. Für einen Moment genoss sie die warme Junisonne auf ihrem Gesicht. Dann fuhr die Pferdebahn um die nächste Kurve, Therese schwankte auf ihrem Sitz, und der Gereonswall schob sich zwischen den Wagen und das Licht. Angespannt musterte sie die schweren, dunklen Steine der Stadtmauer, die Köln seit dem Mittelalter zusammenschnürte und an denen das Hufgeklapper der Pferde widerhallte. Geräusche wie diese verklangen niemals gänzlich, die Mauer hielt sie in der Stadt. In Köln blieb alles, wie es einmal gewesen war, dachte Therese. Innerhalb der Mauern waren Vergangenheit und Gegenwart eins. Selbst was starb, blieb. Die Stadt war voller Geister, sie drohte zu zerplatzen unter dem Druck der Vergangenheit. Therese atmete flach. Die Stadtmauer war ihr Korsett, dachte sie. Und dies war ihr Tag.
Therese liebte die Pferdebahn – für 15 Pfennig konnte man nach Nippes oder Ehrenfeld hinausfahren, mit 20 kam man sogar bis nach Bayenthal. Doch nicht alle mochten dieses Transportmittel, das vor vier Jahren in der Stadt eingeführt worden war. Es hieß, die Gleise würden die Equipagen der Kutschen beschädigen, außerdem würde die Bahn ein große Unruhe in die Stadt bringen. Noch bevor sie nun gänzlich zum Stehen gekommen war, stand Therese von ihrem Sitz auf, ergriff eine der Haltestangen und sprang auf die noch nasse Straße. Erst vor Kurzem war ein sanfter Landregen niedergegangen, nun roch es herrlich nach feuchter Erde. Das Buch hielt sie fest in der Hand. Es war ihr wie eine Freundin. Therese war nie allein, sie hatte immer eine gute Geschichte dabei, in die sie fliehen konnte. Heute war es »Die zweite Frau« von Eugenie Marlitt. Therese fühlte sich ebenso fehl am Platz wie die Heldin des Buchs, die starke Juliane von Trachenberg mit ihrem roten Haar. Therese war ebenfalls ungewollt in dieser Stadt. Könnte sie doch genauso kühl sein! Doch in Therese flammte und brannte es unentwegt.
Nervös sah sie sich um. Am Gereonstor hatten sich zahlreiche Schaulustige versammelt. Therese presste ihr Buch an ihren Bauch und sprang über die Pfützen auf die Menschenmenge zu. Sie musterte die Gesichter und war erleichtert, kein bekanntes unter ihnen zu finden. Ihre Brüder hatten heute ohnehin keine Zeit, um zur Stadtmauer zu kommen: Nikolaus und Peter leiteten eine Zusammenkunft des Branchenverbands der deutschen Schokoladenindustrie. Seit Jahren kämpfte vor allem Nikolaus darum, Rezeptstandards und einen Mindestpreis für Schokolade auszuhandeln. Seine Frau Maria hütete währenddessen das Bett – wie schon seit vielen Monaten. Sobald Therese an ihren verbeulten Körper dachte, der mehr und mehr zwischen den Laken verschwand, wurde ihr ganz anders. Sie sollte ihre Schwägerin unbedingt bald wieder besuchen – doch die Stunden bei dieser bitter gewordenen Frau hingen ihr oft noch tagelang nach, so dass sie sich wieder und wieder davor drückte. Thereses Mutter hingegen besuchte in diesem Moment Tante Julie in der Apotheke, ihre Schwester Elisabeth lebte in Hamburg. Und Ludwig, Heinrich und seine Frau Apollonia bereiteten seit Wochen emsig die Frankfurter Gewerbeausstellung vor, um weitere Auszeichnungen für die Firma zu erlangen.
Trotzdem wäre es möglich, dass ein Geschäftspartner der Firma, ein Freund oder ein Verwandter hier auftauchte. Für diesen Fall hatte sich Therese bereits einige Worte zurechtgelegt: Natürlich wäre sie nicht allein hier, würde sie sagen, das würde sich für eine junge Frau von gerade mal 20 Jahren nicht gehören. Sie machte einen Ausflug mit ihrem zwei Jahre älteren Bruder Carl. Der sei hier irgendwo im Gewimmel – sicher käme er gleich zurück.
Dass Carl nicht hier war, sondern sich heimlich mit einem Mädchen traf, wusste nur Therese. Dieses Geheimnis hatte Carl noch nicht einmal Ludwig anvertraut, obwohl die beiden sich seit Kindertagen so nahstanden wie Zwillinge.
Therese schob sich vorsichtig durch die Reihen, um besser sehen zu können. Bald entdeckte sie die Männer, die auf einem der Wachtürme standen und feierlich auf die Menge schauten. Einer von ihnen war, mit seinem zerfransten, blassroten Schnurrbart, der Oberbürgermeister, den alle den »roten Becker« nannten. Er stützte sich auf das Geländer und rief zu ihnen hinunter: »Um des alten Kölns willen wollen wir einem neuen Köln Raum schaffen!«
Die Menge applaudierte und Therese bekam eine Gänsehaut. Gab es in einem neuen Köln auch ein neues Leben?
Es zischte, Therese drehte den Kopf und sah, dass in einem abgesperrten Bereich vor der Mauer ein schwarz gekleideter Arbeiter ein Feuer entfachte.
»Was unsere Altvorderen bauen mussten, damit Köln groß würde, das müssen wir sprengen, damit Köln nicht klein werde«, rief der rote Becker vor hellblauem Himmel. Therese konnte den Blick nicht von der brennenden Lunte lösen, die der Arbeiter entzündet hatte. Die Funken fraßen sich quer über den Weg bis zum uralten Mauergestein. Alle Anwesenden schienen den Atem anzuhalten. Es war, als wehrte sich diese Stadt, die Stadt der Geister, gegen die Zeit, gegen den Fortschritt, die Moderne. Hier war die Mauer zerstört und intakt zugleich, dachte Therese, und egal, was die Kölner versuchten – das Gestern hatte sie alle fest in der Hand.
Therese wollte es nicht, doch kurz schielte sie zu der Pfütze zu ihren Füßen hinunter. Wie so oft blinzelte ihr dort das Spiegelbild ihrer älteren Schwester entgegen. Theresia mit dem Kleinmädchen-Gesicht, den dunklen Haaren und den Sommersprossen. Das ewige Kind, für immer jünger als sie selbst, obwohl sie neun Jahre vor ihr geboren war. Für immer fröhlich und unbeschwert. Sie war all das, wonach sich ihre Familie sehnte. Kurz nach ihrem Tod war ihnen stattdessen jedoch Therese geboren worden, Therese mit E. Viel zu ernst und aufbrausend, viel zu gefährlich lodernd.
Entschlossen stapfte Therese in das fröhlich kichernde Kindergesicht, so dass ihr das Wasser den Rock hinaufspritzte – und endlich knallte es so laut in dieser Stadt, dass Therese auflachte. Sie starrte auf die schwarze Rauchwolke, die für einen flüchtigen Moment diesen Sommertag verdunkelte, das glühende Leuchten hinter den Schwaden und die Gesteinsbrocken, die flogen, fielen und zerbarsten. Die Menschen jubelten, nur Therese rührte sich nicht. Sie versuchte, sich diesen Anblick für immer einzuprägen. Nach Jahrhunderten war nun die erste Bresche in die Stadtmauer gesprengt worden. Dahinter sah sie Bäume, Wiesen und Felder. Die ganze weite Welt, die Zukunft. Wie hypnotisiert lief sie darauf zu, als sie eine Hand an ihrem Unterarm spürte.
»Komm mit.«
Beinahe hatte sie vergessen, weswegen sie eigentlich hier war. Ihr Herz stolperte, während sie sich mitziehen ließ, durch die Menschenmenge zu einer Kutsche. Sie verschwand darin, hoffentlich, ohne von irgendjemandem beobachtet worden zu sein. Schwankend setzte sich der dämmrig schwüle Wagen in Bewegung, und der Mann ihr gegenüber schaute sie aus derart ernsten Augen an, dass Therese ganz schwindelig wurde. Sie sollte nicht hier sein. Wenn irgendjemand davon erfuhr … Vor ihrem inneren Auge tauchten die dicken Wände eines Klosters auf. Und dessen Gestein würde niemals gesprengt werden.
»Du hast es geschafft«, flüsterte er mit seiner sanften Stimme. Kurz fuhr er sich durch das wilde Haar und legte es verwegen auf eine Seite. Dann nahm er seinen großen, modernen Zwicker ab und steckte ihn in seine Brusttasche, während er sie musterte. Von der Stirn bis zum Kinn. Sie konnte ihr eigenes Herz hören, das Blut in ihren Ohren, sie konnte die Hitze auf ihren Wangen spüren. Sie sollte nicht hier sein, dachte sie wieder.
»Hast du das gesehen?«, fragte sie schnell. »Ich wusste nicht, wie wunderschön Zerstörung sein kann. Das wird alles verändern, oder? Die ganze Stadt, das ganze Leben. Du solltest das malen, Emil. Ich wünsche mir ein Bild von dieser Explosion.«
Ohne eine Miene zu verziehen, streckte er einen Arm aus. »Und ich wünsche mir, dass du herkommst, Therese.«
In ihrem Magen flatterte es. Sie sollte nicht, echote es ein ums andere Mal in ihrem Kopf. Dennoch beugte sie sich vor und ließ sich auf seinen Schoß ziehen. Endlich, dachte sie. Nach all den Monaten, den Briefen, dem Warten. Wie oft hatte sie sich diesen Moment vorgestellt? Jetzt begann ihre Geschichte, jetzt wurde sie Wirklichkeit.
Emil fuhr ihr durch die blonden Locken, und sämtliche Härchen an ihrem Körper richteten sich auf. Es war ungeheuerlich, was sie hier tat, ein Fräulein der feinen Gesellschaft … Und doch konnte sie ihn nicht abweisen. Er umfasste ihren Nacken mit festen, warmen Fingern und dann küsste er sie.
Während sich die Kutsche schlingernd aus der alten Stadt ins Grüne hinauswand, die ersten Steine der Stadtmauern abgetragen wurden und Köln eine neue Freiheit feierte, öffnete Therese mit bebenden Händen Emils Jacke, fand Emil in Thereses Röcken ihre Beine, versprachen sie einander ihre Liebe.
Später hielt die Kutsche im Schatten einer großen Eiche. Emil stieg als Erstes aus.
»Die Luft ist rein«, erklärte er und half Therese hinaus.
Sie schaute nicht zum Kutscher hinüber, und er nicht zu ihr. Obwohl sie bei dem Gedanken daran, was dieser Mann mit dem stolzen Zylinder wohl über sie dachte, hochrot im Gesicht wurde, erwog sie keine Sekunde lang zu gehen.
Seit Monaten kreisten ihre Gedanken um Emil und seine Bilder, Emil und seine Briefe. Zwar war er mit seinen tiefsinnig traurigen Augen und der melodischen, beinahe hohen Stimme eigentlich nicht so, wie sie sich den Mann ihrer Träume vorstellte. Doch sobald er mit ihr sprach, öffnete sich vor ihrem inneren Auge eine neue Welt, die so weit, bunt und voller Möglichkeiten war, dass es keinen aufregenderen Ort für sie geben konnte als in seinen Armen, auf seinem Schoß.
»Was liest du da? Immer noch die Marlitt?« Er deutete auf das Buch in ihren Händen.
»Wieder. Ich liebe einfach diese pulsierende Ader, die ihre Geschichten durchzieht.«
Emil nickte nachdenklich. »Ich habe auf deine Empfehlung hin ›Blaubart‹ gelesen. Und ich muss wirklich sagen: Du hattest recht. Auch wenn es keine hohe Literatur ist – diese Schriftstellerin hat ein ganz eigenartiges Gepräge. Ich war zutiefst beeindruckt von Figuren und Spannung.«
Therese strahlte. »Nicht wahr? Ich könnte tagelang in ihrem Thüringer Wald versinken.«
»Oh, das wäre aber zu schade.« Er schmunzelte und zog sie nah an sich heran. »Von jetzt an musst du dich schon hin und wieder mit deinem Emil abgeben. Zumindest, wenn er in Köln ist.«
»Mein Emil kann ja mitkommen!« Lachend zog sie ihn hinter die Kutsche, legte die Arme um seinen Hals und küsste ihn erneut.
Erst, als es in der Ferne wieder knallte und explodierte, traten sie beide hinter dem Wagen hervor.
»Lass uns zusehen!« Ohne Umschweife ließ sich Therese auf eine Wurzel der Eiche sinken und breitete ihren Rock sorgsam aus. Das Gras unter ihren Fingern war sonnengewärmt und über den Himmel zogen nur wenige Schleierwolken.
Emil setzte sich hinter sie auf die gleiche Wurzel, umschlang Therese mit seinen Armen. Während sie zur Kölner Stadtmauer hinübersah, in der eine Sprengladung nach der anderen gezündet wurde, spürte sie Emils Wärme in ihrem Rücken. Immer wieder knallte und leuchtete es in der Ferne, und Emil erzählte ihr flüsternd von seinen ersten Wochen als Lehrer an der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums Berlin. Er unterrichtete dort dekorative Malerei, Figuren- und Musterzeichnen.
»Wir haben sogar ein paar Schülerinnen, und ich muss ehrlich sagen, dass sie ihren männlichen Kollegen in nichts nachstehen«, berichtete er. »Ich lege natürlich großen Wert auf solides Handwerk, aber ich bin davon überzeugt: Sobald sie das gelernt haben, können einige von ihnen mit ihren Ideen das Kunstgewerbe erneuern.«
Therese konnte den Blick nicht von den Explosionen am Rande der Stadt lösen, doch ein Wort hallte in ihr nach. »Schülerinnen hast du gesagt? Auch Frauen dürfen bei euch zeichnen?«
Sie spürte Emils Nicken in ihrem Haar. »Manche sind wirklich ausgesprochen gut!«
»Meinst du, ich könnte auch eine Künstlerin sein?« Sie biss sich auf die Zunge. Hatte sie das gerade wirklich laut gesagt? Sie traute sich nicht, ihn anzusehen, hoffte, er würde ihre Frage einfach übergehen. Sie war aber auch zu blödsinnig. Nichts an Therese und ihrem Leben war künstlerisch: Sie lebte mit ihrer Mutter, ihren Brüdern Carl, Ludwig und Peter, mit dessen Frau Agnes und deren vier Kindern in der Hohen Straße über dem Warenlager und dem Büro der Firma Stollwerck. Unzählige Tafeln Schokolade, Tüten Bonbons, Packungen Marzipan und Kakao stapelten sich zu ihren Füßen, nicht weit entfernt wurden all die Köstlichkeiten in Zahlen, Daten und Fakten festgehalten und in Aktenordner geheftet. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Die Männer berechneten Gegenwart und Zukunft des Unternehmens, während die Frauen immer teurere Kleider und kompliziertere Frisuren trugen, gewählter sprachen und spürten, dass die Welt von einer Stollwerck heutzutage Eleganz und Anmut erwartete. Keine Kreativität. Keine Kunst. Therese war kein Freigeist. Sie war der Spiegel eines prosperierenden Unternehmens.
Und genau das war der Grund, warum Emil sie so faszinierte.
Bei Ludwigs Verlobungsfeier hatte sie diesen zerzausten Herrn mit dem entrückten Blick zum ersten Mal gesehen. Ihr Bruder hatte ihn als neuen Illustrator der Stollwerck-Verpackungen vorgestellt, den er bei Tante Wilhelmine in Bonn kennengelernt hatte. Bei ihr gingen schließlich viele Künstler ein und aus. Therese wollte nur höflich nicken, ein wenig plaudern und dann weiterziehen. Sie war an diesem Tag viel neugieriger auf Anna gewesen. Schließlich hatte sie Ludwigs Verlobte zuvor erst einmal gesehen. Anna war wie aus dem Nichts im Leben der Stollwercks aufgetaucht, und niemand wusste so recht, woher Ludwig sie eigentlich kannte. Doch sobald Emil Therese ansah, änderte sich etwas in seinem Blick. Ein kaum merkliches Lächeln lag in seinen Augen, er kratzte sich zerstreut an der Schläfe und sagte dann mit leiser Stimme: »Bitte entschuldigen Sie die dreiste Frage, aber … haben Sie sich schon einmal porträtieren lassen?«
Therese umfasste den Gedichtband, den sie an diesem Tag mit sich herumtrug, fester mit beiden Händen. Was erlaubte sich dieser Fremde?
»Ich habe selten ein so interessantes Gesicht gesehen …« Aufmerksam musterte er ihre Züge.
Therese sollte höflich ausweichend reagieren, das war ihr klar. Ihre ältere Schwester Elisabeth hätte sich rot werdend bedankt und ihn gebeten, sie nicht in Verlegenheit zu bringen. Doch nichts lag Therese ferner. In ihr stieg wie so oft eine plötzlich lodernde Wut auf. Ihre Wangen wurden heiß, zornig funkelte sie den Fremden an. Sie würde ihm unter keinen Umständen erlauben, ihr Gesicht zu beurteilen.
Eine Spur zu laut erklärte sie: »Und ich bin noch keinem so respektlosen Herrn begegnet!«
Erschrocken sah er ihr in die Augen, doch sie würde ihren Blick sicherlich nicht senken. Nach einer gefühlten Ewigkeit tat er es. »Sie haben recht. Ich bitte aufrichtig um Entschuldigung. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist.«
Zerknirscht schielte er zu ihr hoch – und Therese erkannte, wie sehr er um Höflichkeit bemüht war. Und doch hatte sie nie zuvor so offen begehrliche Blicke erlebt. Sie schnaubte und verschränkte die Arme vor der Brust, obwohl sich das für eine Dame natürlich nicht gehörte. Ihr Herz raste vor Zorn, doch allmählich bemerkte sie noch ein ganz anderes Gefühl in ihrem Körper, das sie keinesfalls spüren durfte: Erregung. Auf unerhörte Weise mochte sie seine unhöflichen Blicke. Sie sollte gehen, dachte sie. Doch sie wollte bleiben.
»Frägst du mich im Rätselspiele …«
Sie runzelte die Stirn. »Was haben Sie gesagt?«
Er lächelte unsicher und fuhr leise fort: »Wer die zarte lichte Fei / Die sich drei Kleinoden gleiche / Und ein Strahl doch selber sei?«
Therese ließ die Arme langsam sinken, und erst, als er auf den Gedichtband in ihrer Hand zeigte, begriff sie.
»Droste-Hülshoff«, murmelte er. »Ich verehre diese Dichterin.«
Sie konnte sich ein überraschtes Glucksen nicht verkneifen. So plötzlich, wie die Wut sie erfasst hatte, verflog sie schon wieder. »Ob ich’s rate? Ob ich fehle?«
»Liebchen, pfiffig war ich nie«, zitierte er.
Und sie: »Doch in meiner tiefsten Seele / Hallt es: Das ist Poesie!«
Einen Moment lang sahen sie sich an, schmunzelnd, fragend, suchend. Dann war es Therese, die ihre Lider senkte. Sie sollte nicht hier stehen, nicht im Bann dieses Mannes.
»Ich wünsche einen vergnüglichen Abend.« Schnell drehte sie sich um und bemühte sich, so selbstverständlich wie möglich zu ihrer Schwägerin in spe hinüberzulaufen.
Anna mit den schweren, dunklen Haaren und den amüsiert gekräuselten Lippen erschien ihr liebevoll, warm und vergnügt. Auf ihre Frage, woher sie Ludwig eigentlich kannte, bat sie Therese in geheimnisvollem Tonfall, das solle sie ihren Bruder am besten selbst fragen. Das amüsierte Funkeln in ihren Augen machte sie dabei nur noch sympathischer. Sie tranken heißen Kakao, der ihnen in kleinen Tässchen serviert wurde, und die kräftige Süße schoss Therese wie pures Glück durch den Körper. Während sie das Gespräch genoss, schielte sie immer wieder mit heftig klopfendem Herzen zu Emil hinüber. Doch erst am Ende des Abends wechselten sie noch einmal ein paar Worte miteinander.
»Es war mir eine Freude«, sagte er nicht nur zu ihr, sondern auch zu Anna und Ludwig. Dennoch entging Therese nicht, wie er sie dabei einen Moment länger ansah als die anderen. »Darf ich Sie zu einer kleinen Ausstellung einladen?« Er drückte ihnen kleine, eng beschriebene Zettel in die Hände. »In der kommenden Woche werden im Gürzenich Malereien und Glasgemälde von einigen Künstlern gezeigt. Ich habe das Glück, ebenfalls ein paar Werke beisteuern zu dürfen.«
»Oh, eine Kunstausstellung!«, rief Anna mit leuchtenden Augen. »Wie aufregend. Ich habe noch nie eine besucht.« Fragend sah sie zu ihrem Verlobten.
»Es tut mir sehr leid, meine Liebe, aber ich werde wohl kaum die Zeit haben.« In Ludwigs Stimme schwang ehrliches Bedauern mit. »Vielleicht begleitet dich Therese?«
Noch ehe Therese etwas erwidern konnte, kam ihr ältester Bruder Nikolaus in den Saal, eilte auf Ludwig zu und nahm ihn beiseite. Kurz darauf musste Ludwig seine eigene Verlobungsfeier verlassen. »Das Geschäft ruft, ich bin untröstlich«, sagte er, drückte Anna beide Hände und verschwand.
Anna senkte den Blick, und Therese fragte sich, ob die junge Frau wohl wusste, worauf sie sich mit dieser Heirat einließ.
Leise räusperte sich Emil. »Ich würde mich sehr freuen, Sie wiederzusehen.« Er nickte den beiden Damen mit einem zerstreuten Lächeln zu, bevor auch er die Feierlichkeiten verließ. Und Therese wusste schon in diesem Augenblick, dass sie die ganze Nacht kein Auge zumachen, sondern unentwegt an diesen Mann und seine Blicke denken würde.
Tatsächlich hatten Anna und sie in der Woche darauf die Ausstellung besuchen dürfen. Beinahe hätte sich Therese dabei in den Malereien verloren. In den weichen Farben, den klaren und doch schwungvollen Linien, den starken Körpern, dem dichten, kräftigen Haar und den traurigen Augen dieser Figuren, die sie allesamt an Emil selbst erinnerten. Vor einem Bild blieb sie besonders lang stehen. Isiden las sie darüber. Und darunter: Emil Doepler. Zwei Frauen zerrten an einem gefesselten jungen Mann mit edlen, jugendlichen Gesichtszügen. Verzweifelt schien er Therese anzuschauen, während in seinem Rücken alles feierte und jubelte.
»Ich fühle mich sehr geehrt«, hatte sie da Emils melodische Stimme in ihrem Rücken vernommen und eine Gänsehaut kroch ihren Arm hinab. »Sie sind tatsächlich gekommen.«
Glücklicherweise war Anna ebenso fasziniert von den Malereien wie Therese. Und so schlenderte sie bald allein von einem Bild zum nächsten – während sich Therese und Emil leise miteinander unterhielten. Sie sprachen über die germanische Mythologie, über die Macht der Kunst und über Annette von Droste-Hülshoff.
»Wussten Sie, dass meine Tante mütterlicherseits sie persönlich gekannt hat?«, fragte Therese. »Tante Wilhelmine hat sie mehrfach im Salon erlebt.«
»Die Glückliche! Sagen Sie, Therese, welches ist Ihr Lieblingsgedicht von Droste-Hülshoff?«
»Oh, es gibt so viele!« Einem Impuls folgend, schlug sie ihr Buch auf und las ein paar Zeilen des Gedichts vor, das ihr zuletzt einen Schauer über den Rücken gejagt hatte: »Frommer Eltern heftiges Kind / Nur Minne nehmend und minnend / Kannte sie nie ein anderes Band / Als des Blutes, die schüchterne Hinde; / Und nun einer, der nicht verwandt – / Ist das nicht eine schwere Sünde? / Mutlos seufzet sie niederwärts, / In argem Schämen und Grämen, / Will zuletzt ihr verstocktes Herz / Recht ernstlich in Frage nehmen. / Abenteuer sinnet sie aus: / Wenn das Haus nun stände in Flammen, / Und um Hülfe riefen heraus / Der Karl und die Mutter zusammen?«
Lächelnd sah sie auf – und erschrak. Emil lächelte nicht. Er schaute sie ernst an, und erst jetzt begriff Therese, wie er diese Verse aufnehmen konnte. Sie hatte von Sünde gesprochen, von einer verbotenen Liebe, vom brennenden Haus der eigenen Familie.
Sie schluckte, sah zu Boden und klappte mit zittrigen Fingern das Buch wieder zu.
»Therese, ich werde nicht mehr lang in Köln sein können. Aber ich würde Ihnen gern schreiben«, sagte er leise, den Blick weiterhin fest auf sich geheftet. »Darf ich Ihnen schreiben?«
»Sie müssen«, flüsterte Therese und konnte selbst kaum glauben, was sie da sagte. »Unterschreiben Sie bitte mit dem Namen Paula Heimerdinger. Ich unterhalte mit der Schwester meiner Schwägerin eine lockere Brieffreundschaft.«
Seit diesem Tag verging keiner mehr, an dem Therese nicht auf Post von ihm wartete. Nur das Schreiben ihrer eigenen Briefe an ihn liebte sie sogar noch mehr als das Lesen der seinen. Stundenlang verlor sie sich in ihren Sätzen, ließ sich von einem Wort zum nächsten tragen, und nicht selten überraschte sie die Wendung ihrer eigenen Gedanken. Mit jedem Brief, den sie verfasste, verstand sie sich selbst besser.
Sie hatte immer schon gern geschrieben. Heimlich hatte sie sich an Geschichten und Gedichten versucht, sich aber schrecklich geschämt, da sie keinesfalls mit den großen Dichtern mithalten konnten, die sie so verehrte. Wenn sie Tagebuch schrieb, führte manchmal die Wut ihren Federhalter: Groß, fest und kämpferisch erschienen die Worte auf dem Papier. Manchmal war es aber auch die Sehnsucht nach einem anderen Leben, die ihre Sätze lenkte. Dann erschienen die Buchstaben weich und flehend.
Die Briefe an Emil waren anders. Sie veränderten ihren Stil. Nun war da jemand, der ihre Zeilen tatsächlich las. Ein echtes Gegenüber, das sie mit ihren Worten berühren wollte.
Natürlich war Emil nicht der erste Mensch, dem sie schrieb. Neben Paula Heimerdinger hatte sie mehrere Brieffreundinnen. Doch keine von ihnen hatte ein Gespür für Kunst und Literatur. Emil hingegen ließ eine ganz neue Therese zum Vorschein kommen.
Manchmal stelle ich mir vor, ich wäre eine Figur der Marlitt. Ob das Leben dann leichter wäre?, schrieb sie. Oder: Mir kommt die Literatur in diesen Tagen echter vor als das Leben. Diese steifen Kleider. Diese seltsamen Hüte. Und unter uns die Schokoladenfabrik. Stell dir riesige, dampfende, rumpelnde Maschinen vor, die winzige Tafeln feinster Schokolade ausspucken. All das kann doch nur ein Traum sein.
So seltsam ihre Gedanken auch waren – Emil verstand jeden einzelnen. Er würdigte sie alle, spann sie weiter und beteuerte ein ums andere Mal, dass er lang und intensiv über ihre Worte nachdachte.
Ich genieße diese Brieffreundschaft wie keine andere, schrieb er einmal. Sie lenkt meine Gedanken auf neue Wege.
Monatelang träumten sie von ihrem Wiedersehen. Emil erklärte, dass er sich im Sommer erst mit ihrer Tante Wilhelmine in Bonn, dann mit Ludwig in Köln treffen würde, doch Therese war es, die den 11. Juni vorschlug. Den Tag, an dem der erste Teil der Kölner Stadtmauer gesprengt werden sollte.
»Es wäre der poetischste Moment, findest du nicht?«, hatte sie ihn gefragt.
Und hier saßen sie nun. Endlich war ihr der Mann, an den sie seit Monaten denken musste, so nah.
»Aber Therese«, antwortete er nun. Sie hielt den Atem an. Noch immer schämte sie sich für ihre dumme Frage. Doch er fuhr fort: »Natürlich denke ich, dass du eine Künstlerin sein könntest. Nein, mehr noch. Du bist längst eine. Ich kenne niemanden, der so mit Worten umgehen kann wie du.«
Therese spürte in ihrem Inneren ein neues Glühen. Ein noch nie dagewesenes Wollen. Es war ungeheuerlich, doch sie ahnte, dass es sie von diesem Tag an gegen jede Vernunft lenken würde.
2. Kapitel
Sophie schaute an der Schokolade hinauf. Sie hielt die Hand ihrer Mutter fest umschlossen, so überwältigt war sie.
»Mama, wie hoch ist er?«
»Acht Meter hoch und sieben Meter breit. Beachtlich, nicht wahr? Fünf Tonnen Schokolade haben wir verwendet.«
Sophie konnte den Stolz ihrer Mutter deutlich in ihrer Stimme hören. »War er deine Idee?«
»Dein Onkel Ludwig hat ihn sich eigens für diese Gewerbeausstellung ausgedacht. Ich habe lediglich das technische Konzept erstellt.«
Sophie hätte es wissen können. Schließlich dachte ihre Mutter am liebsten in Metall und Eisen. Sie betrachtete die kunstvollen Ornamente an den süßen Säulen, die lieblichen Treppenstufen, den öligen Glanz der Mauern, das prächtige Dach mit den köstlichen Schnörkeln und Verzierungen. Beim Anblick des in Schokolade gegossenen Torbogens klappten allen Menschen – sämtlichen Frauen in ihren eleganten Röcken, Knaben mit schicken kleinen Zylindern und befrackten Geschäftsmännern – die Münder auf. Gut so, dachte Sophie bei sich. Keinem von ihnen sollte entgehen, dass Stollwerck die Zukunft war.
»Meine liebe Apollonia!«, hörte sie in diesem Moment die Stimme ihres Vaters. »Hier seid ihr!«
Mit großen Schritten lief er durch die Halle auf sie zu. Es war ein gewaltiger Saal, in dem die Ausstellung stattfand: Die Decken waren so hoch, dass Sophie den Kopf in den Nacken legen musste, um ganz hinaufschauen zu können. An den Wänden gab es so viele hohe Fenster, wie sie noch nie zuvor gesehen hatte, und alles war voller lachender, murmelnder und gestikulierender Menschen.
Stollwerck präsentierte sich natürlich in der Süßwarenabteilung. Hier gab es an jedem Stand bunte Bonbons, köstliche Schokolade und unzählige Pastillen. Die größte Attraktion aber war Stollwercks Triumphbogen.
»Er sieht in dieser Halle sogar noch besser aus, als ich ihn mir vorgestellt habe«, rief Apollonia ihrem Mann zu.
Heinrich hatte in den letzten Jahren einen beachtlichen Vollbart bekommen. Sein Gesicht war ein bisschen runder geworden, doch seine Augen wirkten so nachdenklich und besonnen wie eh und je.
»Nicht wahr?«, brummte er mit seiner tiefdunklen Stimme.
Heinrich legte Sophie den Arm um die Schultern und tätschelte ihren Kopf, obwohl sie mit ihren elf Jahren dafür schon fast zu alt war.
»Ihr hättet den Kaiser hören sollen. Einen Triumphbogen deutscher Schokoladenindustrie hat er ihn genannt. Er hat regelrecht geschwärmt …«
Sophie nickte zufrieden. »Hoffentlich hat ein Reporter mitgeschrieben.«
Kurz flackerte der Blick ihrer Mutter zu ihr herüber. Sie kannte diesen Ausdruck in ihren Augen: Jeder wusste, dass Sophie das klügste und ungewöhnlichste Kind der Stollwercks war, darauf war Apollonia sichtlich stolz. Doch zugleich schwang eine gewisse Sorge in ihrem Blick mit. Einmal hatte sie sie sogar laut ausgesprochen: »Liebes, kannst du nicht noch ein wenig länger Kind sein?«
»Kinder habt ihr genug«, hatte Sophie geantwortet. »Aber ihr habt nur eine Sophie.«
Apollonia hatte vor Schreck aufgelacht. Dann hatte sie geflüstert: »Das ist wahr. Vergiss das niemals, hörst du? Aber sag es auch nicht zu laut.« Dann hatte sie ihrer zweitältesten Tochter zugezwinkert.
Sophie würde es nicht vergessen. Doch sie würde es wieder aussprechen, da war sie sich sicher. Vielleicht sogar laut.
»Natürlich«, sagte ihr Vater nun mit einem anerkennenden Schmunzeln. »Die Worte des Kaisers werden stets notiert.«
»Oh, dort ist ein Photograph!« Sophie deutete auf einen Mann, der sich ein Stativ aufgestellt hatte, auf dem eine Kamera thronte. Wie eine Ziehharmonika sah sie aus, nur dass vorn keine Tasten, sondern ein kleines, rundes Fenster angebracht war, das Sophie an das abgeschnittene Ende eines Fernrohrs erinnerte.
»Seht, ein Collodium-Apparat. Und der Mann hat sogar seine Dunkelkammer dabei!«, rief Sophie aus.
Gerade montierte er auf ein zweites Stativ einen großen Holzkasten, an dem ein weites, schwarzes Tuch angebracht war. »Später wird er darunter verschwinden, um das Photo zu machen.«
Vater legte beide Hände auf ihre Schultern: »Mein liebes Töchterchen, verrätst du mir, woher du das alles weißt?« Er wollte sicher streng klingen, doch Sophie wusste, dass er es nicht wirklich war. Weder der steife Frack noch der verwegene Blick, mit dem er in die Welt hinaussah, konnten sie in die Irre führen. Zwar war er als Ingenieur der Familie stets für Technik, Zahlen und Fakten zuständig, doch gleichzeitig war Heinrich ein herzensguter Mensch, der sich nichts mehr wünschte, als seine Familie glücklich zu sehen. Außer natürlich, mit seinen Erfindungen Weltruhm für die Firma Gebrüder Stollwerck zu erlangen. Wobei selbstverständlich das eine mit dem anderen zusammenhing.
Am liebsten hätte Sophie ihm erzählt, dass sie von der Apparatur sowohl in der Kölnischen Zeitung als auch in der Gartenlaube gelesen hatte. Doch sie ahnte, dass diese Information einen Keil zwischen ihre Eltern treiben könnte. Also sagte sie nur: »Ich weiß nun mal, was ich weiß, Papa. Schaut, er schießt gleich eine Photographie!«
Sophie beobachtete, wie der Mann hinter dem Ziehharmonika-Kasten einen runden Rücken machte und angestrengt durch die kleinen gläsernen Platten starrte. Sie folgte seinem Blick auf den Triumphbogen. Gerade schien die Sonne durch die großen Fenster herein und ließ ihn funkeln und glänzen. Gleichzeitig stieg Sophie der Duft warmer Schokolade in die Nase, so dass sie unwillkürlich lächelte.
Sie hörte nicht, wie das Photo gemacht wurde, sie sah nur, wie der Mann sich fürchterlich beeilte, um mit einer Glasplatte in der Dunkelheit seiner tragbaren Kammer zu verschwinden. Und als sie wieder zum Triumphbogen zurückschaute, erschrak sie. Denn am Fuße des Gebildes hatten sich große, dunkelbraune Pfützen gebildet.
»Oh nein!«, rief sie aus. »Die Schokolade schmilzt!«
Ihre Eltern machten sogleich hastig ein paar Schritte auf den Triumphbogen zu. Doch natürlich konnten sie nichts tun. Schmelzende Schokolade kann niemand aufhalten. Immer mehr Zeigefinger wurden ausgestreckt und in Richtung der Schokolade geschwenkt. Bald schaute die ganze Halle auf den Triumphbogen, beobachtete, wie er immer dünner wurde, wie die Ornamente sich verflüssigten und an den Wänden hinabliefen, wie das Dach einsank, die Säulen schmaler wurden und ein Schokoladensee entstand. Noch nie hatte Sophie etwas so Trauriges und so Schönes zugleich gesehen. Sie schaute zu dem Photographen hinüber, der nichts von alledem mitbekam. Er steckte noch immer in seiner Dunkelkammer fest, in der Vergangenheit. Auf seiner Glasplatte war der Schokoladenbogen für immer intakt, dachte sie. Ein einziger Moment, festgehalten für die Ewigkeit.
»Das ist ein Desaster«, flüsterte ihr Vater so leise, dass nur Apollonia und Sophie es hören konnten. »Niemand darf glauben, dass Stollwerck vergänglich wäre!«
So hatte Sophie es noch gar nicht gesehen, doch sicherlich hatte ihr Vater recht. Erwartungsvoll sah sie zu ihrer Mutter hinauf. Bestimmt hatte sie einen rettenden Einfall, den hatte sie immer. Doch diesmal war sie eigentümlich blass.
»Mama, ist alles gut?«, wisperte Sophie.
»Aber natürlich«, antwortete Apollonia eine Spur zu laut. Dann sah sie Sophie an. »Liebes, lauf und hol beim Bäcker nebenan einen großen Schwung Plätzchen, ja?« Sie drückte ihr Geld in die Hand. »Beeil dich!«
Sophie rannte so schnell sie konnte, obwohl es draußen in der Sonne sogar noch heißer war als in der Halle. Und als sie wenige Minuten später erhitzt und mit voll beladenen Armen zurückkehrte, war der Triumphbogen bereits auf zwei Drittel seiner Größe zusammengeschrumpft. Ihre Mutter hatte sich derweil auf einem Stuhl niedergelassen. Ihr Gesicht war beinahe grün. Angespannt sah sie Sophie entgegen. Es war ihr Vater, der ihr die Plätzchen abnahm. Er räusperte sich und rief laut in die Halle hinaus: »Wer die Stollwerck’sche Schokolade einmal probieren möchte, hat heute die Gelegenheit. Nehmen sie sich ein Plätzchen und kosten Sie!«
Ein aufgeregtes Raunen ging durch die Halle. Zuerst trauten sich die Kinder, nahmen ein Plätzchen von Heinrich entgegen und tauchten es andächtig in die Schokolade.
»Oh wie herrlich sie schmeckt!«, piepste ein kleiner Junge.
Und dann gab es für die Menschen kein Halten mehr. Wer ein Plätzchen ergattern konnte, türmte darauf Schokolade, andere tauchten Picknicklöffel oder einfach ihre Zeigefinger hinein, um sie anschließend abzuschlecken. Die ganze Halle war mittlerweile von dem betörend herbsüßen Geruch von Schokolade erfüllt.
Nachdenklich beobachtete Sophie die Menschen, die sich über die Stollwerck-Schokolade hermachten, diesen Triumphbogen deutscher Schokoladenindustrie, der gerade mal einer Belichtungszeit standgehalten hatte. Wie vergänglich war wohl der Erfolg? Wie schnell könnte ihre Familie alles verlieren, was die Gebrüder Stollwerck so mühevoll aufgebaut hatten? Sophie konnte den Blick nicht von der dunklen Masse abwenden, die zu einem immer größeren See wurde. Wer könnte dieses Sterben wohl aufhalten?
»Apollonia, Liebes, was hast du?«, keuchte hinter ihr plötzlich ihr Vater. Sophie wirbelte herum. Apollonia war auf dem Stuhl zur Seite gekippt, nur Heinrichs Arme hielten sie davon ab, auf den Boden zu rutschen.
»Mama!«, rief Sophie erschrocken.
»Lauf und such nach einem Arzt«, sagte ihr Vater, und Sophie entging die Angst in seiner Stimme nicht. Ohne nachzudenken, drehte sie sich um und rannte los.
3. Kapitel
Therese erkannte ihre Schwägerin Apollonia kaum wieder. Normalerweise war sie voller Energie, sprach schnell und hatte eine Idee nach der anderen – Therese liebte die Gespräche mit dieser ausnehmend klugen Frau. Doch nun lag sie matt und stumm in ihrem Bett. Nur kurz sah sie Therese an, dann schaute sie wieder an die Decke, von der Anna Sophias obligatorischen Kräutersträuße herabhingen, die einen wohltuenden Duft verströmten.
»Wie schön, dass du die Zeit gefunden hast, herzukommen.« Diese Worte kamen nicht aus Apollonias Mund, sondern aus dem ihrer ältesten Tochter: Bertha war ein Musterbeispiel an Verantwortung und Eleganz und arbeitete in diesem Moment neben dem Krankenbett an einem Stickmuster. In letzter Zeit umgab sie ein schwacher Anschein von Autorität, der nicht so recht zu einer Zwölfjährigen passen wollte. Neben ihr saß Sophie, hielt eine Ausgabe der Gartenlaube in den Händen und musterte Therese darüber hinweg eindringlich aus ihren großen Augen. Wie immer fühlte sich Therese unter dem forschenden Blick der Elfjährigen ertappt, sie wusste nur nicht, bei was. Sie wich ihm aus und sah stattdessen Apollonia an. »Wie geht es dir, liebe Schwägerin?«
Apollonia lächelte angestrengt. »Es wird schon wieder.«
»Der Doktor sagt, Mama bräuchte viel Ruhe«, schaltete sich Bertha erneut ein. »Und natürlich Gebete. Wollen wir für Mama beten?« Mit großer Entschiedenheit sah Bertha erst Therese und dann Sophie an, und in ihren Augen lag keine Spur selbstgefälliger Frömmigkeit, wie Therese sie so oft in der Kirche beobachtete. Berthas klassisch schönes Gesicht mit den strengen, fast senkrecht verlaufenden Wangen wirkte ehrlich besorgt.
Bertha faltete die Hände, doch ihre jüngere Schwester verdrehte abfällig die Augen. Das tat sie oft. Und meist verdrehte sie sie nicht nur einmal, wie andere Menschen, sondern zweimal. Damit hatte sie schon als kleines Kind angefangen, und jede Bemühung ihrer Eltern, ihr es abzugewöhnen, war fehlgeschlagen.
»Du kannst gern beten, Schwesterchen.« Sophie sprach leise und scharf zugleich. Sie war all das, was Bertha nicht war, dachte Therese. Ihr Gesicht rund, ihre Lippen nach unten gebogen, ihre schattigen Augen erschreckend klug. »Aber solange der Storch Mama immer wieder beißt, wird sie nicht richtig gesund.«
Therese hielt unwillkürlich den Atem an.
»Aber was redest du denn da?«, fragte die nur ein Jahr ältere Bertha. »Der Storch?«
Sophie zuckte mit den Schultern. »Ich habe den Doktor vom zweiten Sternenkind reden hören und eins und eins zusammengezählt. Ich denke, der Storch sollte nicht noch einmal kommen. Wir könnten vielleicht Gitter an den Fenstern anbringen lassen. Was denkst du, Mama?«
Traurig sah Therese auf ihre Hände. Wenn es doch mit Gittern getan wäre …
»Meine süße Sophie«, flüsterte Apollonia. »Beizeiten werde ich dir alles erklären. Aber du bist noch so jung …«
Sophie schnaubte abfällig und hob die Gartenlaube vor ihr Gesicht. Auch Therese bezweifelte, dass Sophie süß war. Oder ihr Herz jung. Nein, Sophie war ein alter, weiser Mensch in einem Kinderkörper. Und Therese glaubte, dieses Gefühl auf eigentümliche Weise zu kennen: Alle dachten, Therese wäre 20 Jahre alt. Doch es gab Tage, an denen war Therese schon beinahe 30. Dann hatte sie das Gefühl, die Erinnerungen der verstorbenen Theresia wären ihre eigenen, nur einen Traum weit entfernt. Als hätte sie schon einmal gelebt, geträumt, als wäre sie schon einmal gestorben. Sie kannte den Tod. Sie bräuchte nur eine ruhige Minute, um sich wirklich daran zu erinnern …
»Tante Therese?« Bertha richtete sich auf.
»Entschuldige. Was hast du gesagt?«
»Wir wollten uns gerade von dir verabschieden. Wir haben jetzt Klavierunterricht.«
»Du hast Klavierunterricht«, korrigierte Sophie sie. »Ich höre nur zu.«
Bertha verzog den Mund. »Es würde dir nicht schaden, ebenfalls ein wenig zu üben.« Therese hätte bei diesem liebevoll strengen Tonfall wahrscheinlich auf sie gehört. Im Gegensatz zu Sophie.
»Mama mag das Klavierspielen auch nicht.«
»Sie muss nicht, wenn sie nicht will«, flüsterte Apollonia lächelnd. »Ich kann das gut verstehen.«
»Auf Wiedersehen, Tante Therese!« Bertha nickte ihr freundlich zu, als sie aufstand, und Sophie winkte und wirkte dabei zum ersten Mal an diesem Tag fast wie ein Kind, dann verschwanden sie nach draußen.
Sobald die Tür hinter ihren Töchtern ins Schloss gefallen war, füllten sich Apollonias Augen mit Tränen.
Schnell ergriff Therese ihre Hand. »Stimmt es, was Sophie sagt? Hast du wieder ein Kind verloren?«
Apollonias Lippen zitterten, sie sagte nichts.
»O meine liebe Schwägerin. Es tut mir so unendlich leid. Niemand sollte ein solches Leid ertragen müssen. Und nun schon zum zweiten Mal …«
Thereses Stimme brach. In den letzten Jahren war ihr Apollonia sehr ans Herz gewachsen. Schon vor der Niederkunft der kleinen Hubertine war ihre Schwägerin auffällig schwach gewesen. Als sie dann Franz II. erwartete, der in der Familie nur liebevoll Der Zweite genannt wurde, hatte sie heftig zu kämpfen gehabt. Die dritte Schwangerschaft in Folge war dann zu viel für ihren Körper gewesen. Da Apollonia wochenlang das Bett hatte hüten müssen, hatte Therese sie immer häufiger besucht. Ihre Gespräche wurden länger und offener, bald redeten sie stundenlang miteinander. Einerseits über Apollonias Warenautomaten, die sie nach den Skizzen der verstorbenen Cartharina fertigen wollte, mit denen sie aber aufgrund ihrer Schwangerschaften noch nicht hatte beginnen können. Andererseits über Thereses Lieblingsbücher, aus denen sie Apollonia gern vorlas. Als das Ungeborene trotz aller Vorsicht starb, schien Apollonia todunglücklich zu sein, aber auch erleichtert. Ein paar Wochen später trat wieder Farbe in ihr Gesicht, sie sprach wieder schnell und aufgeregt und ihre Augen leuchteten wie früher. Therese würde es niemandem verraten, doch sie verstand es gut. Mit einem Neugeborenen im Arm konnte man nun mal keine Automaten bauen. Und mit Bertha, Sophie, Hubertine und ihren Brüdern Albert und Franz hatte sie ja bereits fünf gesunde Kinder, um die sie sich sorgte.
Apollonia hatte sich damals wieder Bleistifte in ihre Flechtfrisur gesteckt, sich in die Arbeit gestürzt, den Triumphbogen für die Ausstellung in Frankfurt entworfen – und Therese hatte keine Ahnung gehabt, dass Apollonia mittlerweile erneut in anderen Umständen gewesen war. Doch hier lag sie nun, blass, dünn und aufgelöst. Sie war erst 34 Jahre alt, doch an diesem Tag sah sie viel älter aus. Ihre dunklen Haare waren von weißen Strähnen durchzogen, ihre Wangen eingefallen und ihre Augen wirkten in dem ausgezehrten Gesicht größer als früher.
»Wie fühlst du dich?«, fragte Therese leise.
Sie fürchtete schon, die Frage wäre völlig unpassend, doch ihre Schwägerin schluchzte auf und antwortete sogleich: »Ich habe fürchterliche Angst, Therese.«
»Angst? Aber wovor denn?«
»Ich sage es nur dir, da ich weiß, dass du mich verstehst. Jeder andere könnte es falsch auffassen und mich für ein egoistisches, gefühlskaltes Wesen halten, also bitte sag es niemandem, ja?«
»Du weißt doch, dass unsere Gespräche vertraulich bleiben.« Therese klang eine Spur empörter, als sie es beabsichtigt hatte.
»Ich weiß, entschuldige.« Apollonia schloss kurz die Augen, und Therese rückte ein wenig näher an sie heran.
»Also, wovor hast du Angst?«
»Ich fürchte mich vor dem Tod.« Abwehrend hob sie eine Hand. »Ich weiß, was du sagen willst. Dass ich nicht sterbe, jedenfalls nicht jetzt, dass alles gut wird und so weiter. Wahrscheinlich hast du recht. Ich hoffe es! Doch stell dir vor, du irrst dich.«
Therese wusste nicht, was sie sagen sollte. Sollte sie von Jesus und dem ewigen Leben sprechen? Davon, dass sie im Paradies sicherlich auch ihre beiden Sternenkinder wiedersehen würde? Instinktiv wusste sie, dass Gott an dieser Stelle nicht die richtige Antwort war. Sie holte Luft, doch Apollonia kam ihr zuvor: »Ich fürchte mich nicht vor dem, was auf der anderen Seite sein könnte. Nein, ich bin mir sogar sicher, dass es meinen beiden kleinen Engeln jetzt gut geht. Aber ich fürchte mich davor, auf dieser Seite alles zurückzulassen. Seit Jahren versuche ich, Cartharinas Warenautomaten zu bauen. Ich habe unserem Onkel in New York geschrieben, aber er konnte keinen solchen Apparat finden. Er vermutet, Cartharina habe damals einen Prototyp gesehen, der nicht zufriedenstellend war und deswegen wieder verschwunden ist. Ich habe sogar mit Julius Mertens gesprochen.«
»Wann warst du denn in Bonn?«, fragte Therese erstaunt. Es überraschte sie immer wieder, wie viel Apollonia in kürzester Zeit schaffte. Sie schien immer überall gleichzeitig zu sein, arbeitete bis tief in die Nacht. Sie war eine Suchende, eine Getriebene, die keine Ruhe fand, außer auf dem Krankenbett.
»Ich habe Tante Wilhelmine vor ein paar Wochen besucht, habe ich das nicht erzählt?« Sie ließ den Kopf in das Kissen sinken. »Sie ist immer noch in Trauer um Sibylle. Aber es ist schön zu sehen, dass sie in Sibylles Villa dennoch weiterhin ihre Heimat hat. Und dass Sybilles Schwägerin Emma Witt ihr so eine gute Freundin geworden ist. Das Haus gehört ja jetzt Sybilles ältestem Sohn, aber Julius überlässt es den Frauen. Er hat sich so verändert – seit Amerika. Mittlerweile kann ich Cartharina wirklich verstehen … Gott hab sie selig. Sie haben sich wahrhaftig geliebt.«
Therese nickte langsam, wollte aber nicht an ihre geliebte, verstorbene Schwester Cartharina denken. Also wechselte sie schnell das Thema. »Lebt diese schreckliche Charlotte auch noch dort?«
Als sie den Namen der ehemaligen Lehrerin aussprach, wurde Thereses Stimme hart. Sie konnte es nicht verhindern. Aus welchen Gründen die junge Frau auch gehandelt hatte – sie hatte die Familie Stollwerck hintergangen, und das würde Therese ihr nie verzeihen. Ganz egal, ob sie es mittlerweile bereute.
Apollonia nickte. »Als ich da war, ist sie kein einziges Mal aus ihrem Zimmer gekommen. Aber ja, sie lebt weiterhin dort. Sibylle wollte es so, und das respektiert Tante Wilhelmine. Charlotte ist immerhin Sibylles Tochter.«
Therese stieß ein Geräusch aus, das nach einem Seufzen und einem Schnauben zugleich klang. Sie mochte ihre Tante Wilhelmine gern, doch es war schon etwas befremdlich, dass sie in einem Haus mit zwei Frauen der Familie Mertens lebte, die den Stollwercks so viel Leid bereitet hatte.
»Und Julius Mertens konnte dir nicht mehr über den Automaten berichten?« Auch gegen ihn hegte Therese noch immer einen Groll. Auch wenn sie rational wusste, dass Cartharina die Familie aus Liebe verlassen hatte – und aus dem Gefühl heraus, keine andere Wahl zu haben, als mit Julius ein neues Leben zu beginnen.
»Julius hat ihn ebenfalls gesehen, konnte mir aber auch nichts weiter dazu sagen. Keinen Hersteller, nichts. Und ich komme einfach nicht weiter. Wenn ich jetzt …« Ihre Stimme brach ab, sie rieb sich die Augen. »Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass Cartharinas letztes Geschenk an mich ungenutzt bleibt. Verstehst du das?«
Therese nickte langsam. »Ich verstehe es sehr gut.«
»Wenn ich sterbe, ohne irgendetwas geschaffen zu haben … wirklich geschaffen, was bleibt dann von mir?«
»Aber Apollonia, du hast so viel geschaffen! Den Walzenstuhl, zahlreiche Maschinen, den Triumphbogen …«
»Keiner wird sich daran erinnern, Therese. Keiner.«
Therese wusste nicht, was sie dazu sagen sollte.
»Und dann ist da noch meine Schwester. Maria ist völlig allein, ich bin die Einzige, die sie noch besucht …«
»Aber das stimmt doch nicht«, protestierte Therese – zugegebenermaßen etwas halbherzig. Schließlich wusste sie, dass Apollonia recht hatte.
»Ich verstehe es gut, Therese. Maria war noch nie ein … sonderlich zugänglicher Mensch. Und die Krankheit macht es ihr unmöglich, ihre liebevolle Seite zu zeigen. Ich weiß, es ist kaum zu ertragen, sie so zu sehen …«
»… und sich beschimpfen zu lassen«, ergänzte Therese zerknirscht. »Als ich das letzte Mal bei ihr war, hat sie mich unstet und aufbrausend genannt.« Therese verschränkte die Arme. »Ich musste mir fest auf die Zunge beißen, um nicht an die Decke zu gehen!« Dabei lag ihre Schwägerin Maria mit ihren harten Urteilen häufig gar nicht so falsch. Therese war tatsächlich schrecklich launenhaft. Sie wünschte, sie könnte es ändern, doch manchmal reichte nun mal der kleinste Funken, um etwas in ihr heiß auflodern zu lassen. Und Marias abwertende Art machte sie besonders wütend.
Apollonia schmunzelte. »Das Schimpfen ist ein gutes Zeichen! Ich freue mich immer, wenn Maria die Kraft aufbringt, meine rußverschmutzten Kleider zu kritisieren.«
Therese kicherte leise, und für einen Moment sah es aus, als würde sich auch Apollonias Stimmung heben. Doch schon verfinsterte sich ihre Miene wieder. »Als letztes Jahr ihr kleiner Sohn an Keuchhusten gestorben ist, ist etwas in ihr zerbrochen, weißt du? Unwiederbringlich. Sie braucht mich. Wir konnten uns zwar nie richtig leiden, auch als Kinder nicht. Aber wir haben uns immer geliebt. Wenn ich nicht mehr bin, dann muss Maria ganz allein sterben.«
»Sie hat doch Nikolaus«, widersprach Therese. Doch der bittere Blick von Apollonia ließ sie verstummen. Nikolaus, ihr ältester Bruder, war Maria nie ein guter Ehemann gewesen, das wusste Therese.
Nun sah sie, wie entschlossen Apollonia gegen die Tränen ankämpfte. Brüsk fuhr sie sich über das Gesicht. »Und was ist mit meiner kleinen Sophie?«
Erschrocken richtete sich Therese auf. »Aber Sophie ist doch kerngesund, oder nicht?«
»Natürlich. Aber sie ist fürchterlich … ungewöhnlich. Viel ungewöhnlicher noch als ich. Wie soll sie ohne mich …« Kurz presste Apollonia die Lippen aufeinander. »Wie soll sie dieses Leben ertragen? Sie wird eine Enttäuschung nach der anderen erleben. Wenn ich sterbe, kann sie keiner davor beschützen. Und niemand kann sie auffangen, wenn sie fällt.«
»Du stirbst nicht, meine liebe Apollonia! Du bist so stark. Du wirst deine Automaten bauen, Marias Hand halten und an Sophies Seite sein, hörst du?«