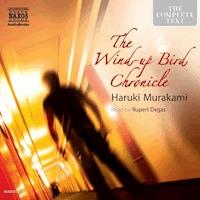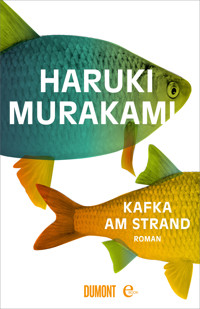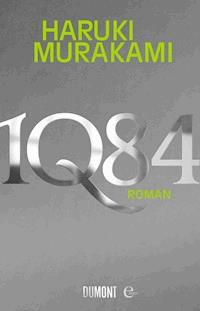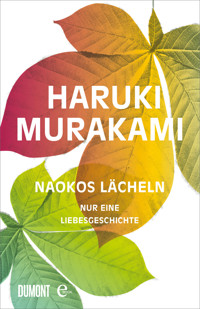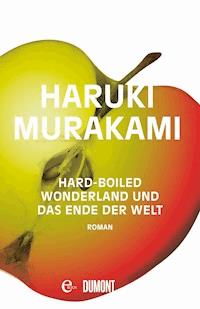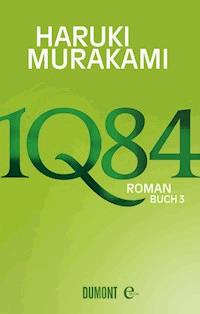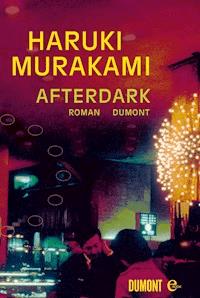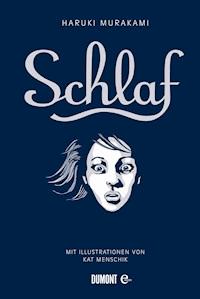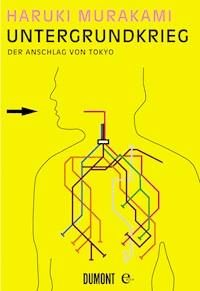8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Stories, die Haruki Murakamis Ruhm im Westen begründet haben. Das Gitter ist geschlossen, doch der Elefant ist verschwunden, zur Bestürzung der ganzen Stadt. Nur einer ahnt, was passiert ist. Ein junger, einsamer Mann, der in der Werbeabteilung eines Küchenherstellers arbeitet und einer Journalistin seine Wahrnehmungen mitteilt. – Ein nächtlicher Anfall von Heißhunger und ein übermütig geplantes Verbrechen enden ganz anders als vorgesehen: so anders, dass sie Jahre später eine unvermutete Auferstehung erleben. – Eine Frau in den besten, ödesten Verhältnissen erkennt in der eigenen Schlaflosigkeit ein berauschendes Geschenk. Immer wieder tut sich für Murakamis melancholische Gestalten im Gewebe des Alltags eine Leerstelle auf, in die ein tiefer, lebensverändernder Sinn einzusickern scheint. Erzählungen von unerhörten Ereignissen und betörenden Zufällen, wie von unsichtbarer Hand gesandt. »Wir haben alle Bücher von Murakami gelesen, wir haben das Telefon klingeln lassen und sind lesend gegen Laternenpfähle gelaufen.« SPIEGEL ONLINE Dieser Band enthält die folgenden Erzählungen: ›Der Aufziehvogel und die Dienstagsfrauen‹ ›Der Bäckereiüberfall‹ ›Der zweite Bäckereiüberfall‹ ›Schlaf‹ ›Der Untergang des Römischen Reiches, der Indianeraufstand von 1881, Hitlers Einfall in Polen und die Sturmwelt‹ ›Scheunenabbrennen‹ ›Frachtschiff nach China‹ ›Der Elefant verschwindet‹ Die Erzählung »Scheunenabbrennen« (Original »Barn Burning«) wurde 2018 von Lee Chang-dong verfilmt unter dem Titel »Burning« (Besetzung: Ah-in Yoo, Steven Yeun, Jong-seo Jeon, Joong-ok Lee) und war für den Oscar als bester ausländischer Film 2019 nominiert. Die Erzählung ›Der Bäckereiüberfall‹ wurde 1982 von Naoto Yamakawa verfilmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
HARUKI MURAKAMI
DER ELEFANT VERSCHWINDET
ERZÄHLUNGEN
AUS DEM JAPANISCHEN
›DER BÄCKEREIÜBERFALL‹ UND ›DER ZWEITE BÄCKEREIÜBERFALL‹ WURDEN VON JÜRGEN STALPH, ›DER UNTERGANG DES RÖMISCHEN REICHES, DER INDIANERAUFSTAND VON 1881, HITLERS EINFALL IN POLEN UND DIE STURMWELT‹ WURDE VON JÜRGEN STALPH, INGE FLEISCHER, MARTINA GUNSKE, MICHAEL INOUE, JOHANNES KIMMESKAMP UND SLAWOMIR MIRECKI AUS DEM JAPANISCHEN ÜBERSETZT. © 1993 Haruki Murakami E-BOOK 2011 © 2007 FÜR DIE DEUTSCHE AUSGABE: DUMONT BUCHVERLAG, KÖLN ALLE RECHTE VORBEHALTEN
DER ELEFANT
Der Aufziehvogel und die Dienstagsfrauen
Als diese Frau anrief, stand ich gerade in der Küche und kochte Spaghetti. Die Spaghetti waren so gut wie fertig, und ich pfiff zusammen mit dem Radio die Ouvertüre aus Rossinis »Die diebische Elster«. Die perfekte Musik zum Spaghettikochen.
Ich wollte das Klingeln des Telefons eigentlich ignorieren und weiter meine Spaghetti kochen. Sie waren fast gar, und Claudio Abbado war gerade dabei, das Londoner Symphonieorchester zu seinem musikalischen Höhepunkt zu führen, aber dann stellte ich doch das Gas kleiner, rannte mit den Kochstäbchen in der rechten Hand ins Wohnzimmer und nahm den Hörer ab. Mir fiel ein, dass es ein Freund sein könnte, der wegen eines neuen Jobs anrief.
»Hätten Sie zehn Minuten für mich Zeit?«, sagte eine Frauenstimme völlig unvermittelt.
»Wie bitte?«, fragte ich überrascht. »Was haben Sie gesagt?«
»Ich fragte, ob Sie nur zehn Minuten für mich Zeit hätten«, wiederholte die Frau.
Ich konnte mich nicht erinnern, diese Frauenstimme schon mal gehört zu haben. Und da ich mir, was das Erinnern von Stimmen angeht, fast hundertprozentig sicher bin, täuschte ich mich bestimmt nicht. Es war die Stimme einer mir unbekannten Frau. Eine tiefe sanfte Stimme, doch ohne jede Besonderheit.
»Entschuldigen Sie bitte, aber welche Nummer haben Sie gewählt?«, fragte ich immer noch höflich.
»Das spielt doch keine Rolle. Das Einzige, was ich möchte, sind zehn Minuten. Dann werden wir uns bestimmt besser verstehen.« Die Frau redete schnell auf mich ein.
»Uns verstehen?«
»Unsere Gefühle«, antwortete sie kurz.
Ich reckte meinen Hals und lugte in die Küche. Aus dem Spaghettitopf stieg gemütlich der weiße Dampf, und Abbado dirigierte weiter die »Diebische Elster«.
»Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber ich koche gerade Spaghetti. Sie sind gleich fertig, doch wenn ich mit Ihnen zehn Minuten spreche, sind sie verkocht. Ich lege jetzt auf, ja?«
»Spaghetti?«, fragte die Frau verblüfft. »Es ist erst halb elf. Wieso kochen Sie morgens um halb elf Spaghetti? Finden Sie das nicht ein bisschen komisch?«
»Ob komisch oder nicht, das geht Sie nichts an«, sagte ich. »Ich habe kaum gefrühstückt, und jetzt habe ich eben Hunger. Und schließlich bin ich es, der sie kocht und isst. Um wie viel Uhr ich was esse, ist doch wohl meine Sache, oder?«
»Ja, natürlich. Na gut, dann lege ich auf«, sagte sie mit aalglatter Stimme. Eine seltsame Stimme. Eine winzige Gefühlsschwankung, und schon änderte sich ihr Tonfall, als ob man eine andere Frequenz eingeschaltet hätte. »Ich rufe später wieder an.«
»Einen Moment«, rief ich hastig. »Wenn Sie irgendetwas verkaufen wollen, rufen Sie umsonst an. Ich bin nämlich momentan arbeitslos und kann mir gar nichts leisten.«
»Keine Angst, das weiß ich bereits«, sagte die Frau.
»Wissen? Was wissen Sie?«
»Dass Sie arbeitslos sind, natürlich. Das weiß ich. Also kochen Sie schnell Ihre Spaghetti, ja?«
»Was wollen Sie …«, begann ich, als plötzlich das Gespräch unterbrochen wurde. Es war eine ziemlich abrupte Art einzuhängen. Sie hatte nicht den Hörer aufgelegt, sondern einfach auf die Taste gedrückt.
Verwirrt starrte ich einen Moment geistesabwesend auf den Telefonhörer in meiner Hand, als mir die Spaghetti wieder einfielen. Ich legte den Hörer auf und ging in die Küche. Ich stellte das Gas ab, schüttete die Spaghetti in ein Sieb, tat sie auf einen Teller, goss die Tomatensauce, die ich in einem kleinen Topf warm gemacht hatte, darüber und begann zu essen. Dank des unsinnigen Telefongesprächs waren die Spaghetti etwas weich. Keine Katastrophe, außerdem war ich zu hungrig, um mich an den Feinheiten des Spaghettikochens aufzuhalten. Ich hörte der Musik im Radio zu und verleibte mir genüsslich die zweihundertfünfzig Gramm bis auf die letzte Nudel ein.
Ich wusch meinen Teller und den Topf ab, setzte einen Kessel Wasser auf und machte mir mit einem Teebeutel Tee. Und während ich den Tee trank, dachte ich über den Anruf nach.
Uns verstehen?
Warum um Himmels willen rief diese Frau mich an? Wer war sie überhaupt?
Mir war das alles ein Rätsel. Ich hatte keine Idee, warum ich von einer mir unbekannten Frau einen anonymen Anruf erhalten könnte, und mir war auch vollkommen unklar, was sie eigentlich sagen wollte.
Wie dem auch sei, dachte ich mir, ich habe keine Lust, die Gefühle irgendeiner fremden Frau zu verstehen. Das führt doch zu nichts. Was ich zunächst einmal brauche, ist eine neue Arbeit. Und ich muss meinen neuen Lebensrhythmus finden.
Doch als ich aufs Wohnzimmersofa zurückkehrte und in dem Roman von Len Deighton las, den ich mir aus der Bücherei ausgeliehen hatte, geriet ich beim bloßen Anblick des Telefons ins Grübeln: Was das wohl war, wovon diese Frau behauptete, dass »man es in zehn Minuten versteht«? Was kann man denn in zehn Minuten verstehen?
Wenn ich es mir recht überlegte, hatte die Frau gleich zu Anfang die Zeit auf genau zehn Minuten festgelegt. Sie schien sich mit der Bestimmung dieser begrenzten Zeit sehr sicher zu sein. Neun Minuten wären vielleicht zu kurz und elf Minuten schon wieder zu lang. Genauso wie Spaghetti al dente …
Bei diesen Gedanken kam mir die Geschichte des Romans abhanden, weshalb ich mich dazu entschloss, etwas Gymnastik zu machen und dann meine Hemden zu bügeln. Immer wenn ich etwas verwirrt bin, bügele ich Hemden. Es ist eine alte Gewohnheit von mir.
Den Bügelvorgang eines Hemdes unterteile ich in insgesamt zwölf Schritte. Ich beginne mit (1) dem Kragen (Vorderseite) und ende mit (12) den Manschetten des linken Ärmels. Von diesem System weiche ich niemals ab. Ich bügele immer in der gleichen Reihenfolge, wobei ich jeden einzelnen Schritt mitzähle. Wenn ich das nicht tue, klappt das Bügeln nicht richtig.
Ich bügelte also drei Hemden, erfreute mich an dem Zischen meines Dampfbügeleisens und an dem besonderen Geruch heiß gewordener Baumwolle, und nachdem ich mich vergewissert hatte, dass auch alles glatt war, hängte ich die Hemden auf einem Bügel in den Schrank. Als ich das Bügeleisen ausgeschaltet und zusammen mit dem Bügelbrett verstaut hatte, fühlte sich mein Kopf schon ein bisschen klarer an.
Ich war etwas durstig und wollte gerade in die Küche gehen, als von neuem das Telefon klingelte. Oh je, dachte ich. Ich schwankte, ob ich einfach in die Küche oder zurück ins Wohnzimmer gehen sollte, ging dann aber ins Wohnzimmer und nahm den Hörer ab. Wenn es wieder die Frau sein sollte, könnte ich sagen, dass ich gerade beim Bügeln sei, und einfach auflegen.
Aber es war meine Frau. Die Uhr auf dem Fernseher zeigte halb zwölf.
»Wie geht’s?«, fragte meine Frau.
»Gut«, sagte ich erleichtert.
»Was hast du gemacht?«
»Gebügelt.«
»War irgendwas?«, fragte sie. In ihrer Stimme klang eine leichte Spannung mit. Meine Frau weiß genau, dass ich nur bügele, wenn ich durcheinander bin.
»Nein, nichts. Ich wollte bloß meine Hemden bügeln. Es ist nichts Besonderes«, sagte ich, setzte mich auf den Stuhl und nahm den Telefonhörer aus der linken in die rechte Hand. »Und du, rufst du wegen was Bestimmtem an?«
»Ja, wegen einer Arbeit. Vielleicht gäbe es da einen kleinen Job für dich.«
»Aha«, sagte ich.
»Kannst du Gedichte schreiben?«
»Gedichte?«, fragte ich überrascht zurück. Gedichte? Was denn für Gedichte?
»Ein Zeitschriftenverlag, bei dem eine Bekannte von mir arbeitet, gibt ein Lyrikmagazin für junge Mädchen heraus, und sie suchen jemanden, der die eingesandten Beiträge auswählt und korrigiert. Außerdem möchten sie jeden Monat ein Gedicht für die erste Seite. Die Arbeit ist einfach und dafür nicht schlecht bezahlt. Natürlich ist es nur ein Job, aber wenn es gut läuft, kannst du vielleicht auch in der Redaktion mitarbeiten …«
»Einfach?«, fragte ich. »Moment mal. Ich suche Arbeit in einem Rechtsanwaltsbüro. Wie kommst du auf so was wie Gedichte korrigieren?«
»Aber du hast doch erzählt, dass du im Gymnasium irgendwas geschrieben hast.«
»Das war in einer Zeitung. In der Schulzeitung unseres Gymnasiums. Ich habe alberne Artikel geschrieben, darüber, welche Klasse beim Fußballspiel gewonnen hat, oder dass der Physiklehrer die Treppe runtergefallen ist und ins Krankenhaus musste. Keine Gedichte. Ich kann keine Gedichte schreiben.«
»Mit Gedichte meine ich Gedichte, wie sie Oberschülerinnen lesen. Es braucht nichts Besonderes zu sein. Du musst nicht gleich wie Allen Ginsberg schreiben. Es reicht, wenn du so schreibst, wie es gerade kommt.«
»Ich kann absolut keine Gedichte schreiben, weder so, wie es gerade kommt, noch sonstwie«, sagte ich entschieden. Vollkommen undenkbar.
»Na gut«, sagte meine Frau etwas enttäuscht. »Aber im juristischen Bereich tut sich doch anscheinend nichts.«
»Es sind gerade mehrere Sachen im Gespräch, diese Woche müsste ich eine Antwort bekommen. Wenn das nicht klappen sollte, kann ich ja noch mal darüber nachdenken.«
»Wirklich? Na, mach, wie du denkst. Was ist heute übrigens für ein Tag?«
»Dienstag«, sagte ich nach kurzer Überlegung.
»Könntest du zur Bank gehen und die Gas- und Telefonrechnung bezahlen?«
»Kein Problem. Ich wollte sowieso gleich los und fürs Abendessen einkaufen, ich gehe dann anschließend bei der Bank vorbei.«
»Was gibt es heute zu Abend?«
»Weiß ich noch nicht«, sagte ich, »habe ich noch nicht entschieden. Ich überlege es mir beim Einkaufen.«
»Übrigens«, sagte meine Frau in einem veränderten Tonfall. »Weißt du, ich denke gerade, du musst ja vielleicht nicht unbedingt eine Arbeit suchen.«
»Wieso das denn?«, fragte ich aufs Neue überrascht. Es scheint, als riefen alle Frauen der Welt allein aus dem Grund an, mich zu überraschen. »Warum sollte ich denn nicht nach einer Arbeit suchen? Noch drei Monate und meine Arbeitslosenversicherung ist zu Ende. Ich kann doch nicht die Beine baumeln lassen.«
»Ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen, mein Nebenjob läuft gut, und außerdem haben wir ja noch was gespart. Wenn wir nicht prassen, können wir doch gut davon leben, oder?«
»Und ich soll dann also die Hausarbeit machen?«
»Magst du das nicht?«
»Ich weiß nicht«, sagte ich ganz ehrlich. Ich weiß es wirklich nicht. »Ich werde darüber nachdenken.«
»Ja, denk drüber nach«, sagte sie. »Was ich dich noch fragen wollte, ist die Katze eigentlich zurück?«
»Die Katze?«, fragte ich. Auf einmal merkte ich, dass ich die Katze seit heute früh vollkommen vergessen hatte. »Nein, sie ist noch nicht wieder nach Hause gekommen.«
»Kannst du nicht ein bisschen in der Nachbarschaft nach ihr suchen? Sie ist schon seit vier Tagen weg.«
Ich gab eine vage Antwort und nahm den Hörer wieder in die linke Hand.
»Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht im Garten des leerstehenden Hauses hinten in dem Gässchen ist. Der Garten mit dem steinernen Vogel, weißt du? Ich habe sie dort schon ein paar Mal gesehen. Weißt du, wo ich meine?«
»Nein«, sagte ich. »Aber seit wann treibst du dich denn allein in dem ›Gässchen‹ rum? Du hast mir noch nie davon …«
»Du, tut mir leid, aber ich muss jetzt aufhören. Ich muss langsam wieder an die Arbeit. Bitte kümmere dich um die Katze.«
Dann legte sie auf.
Ich betrachtete wieder einen Moment lang den Telefonhörer, bevor ich ihn auf die Gabel zurücklegte. Warum kannte sich meine Frau so gut in dem »Gässchen« aus, fragte ich mich. Um dorthin zu gelangen, musste man von unserem Garten aus über eine ziemlich hohe Ziegelmauer steigen, und ich verstand nicht, warum man ohne Grund diese Anstrengung auf sich nehmen sollte.
Ich ging in die Küche, trank etwas Wasser, schaltete das Radio ein und schnitt mir die Fingernägel. Im Radio lief eine Sondersendung zu der neuen LP von Robert Plant, aber nach zwei Stücken taten mir bereits die Ohren weh, und ich schaltete wieder aus. Ich ging auf die Veranda und untersuchte den Katzenteller, aber die getrockneten Sardinen lagen unberührt da, so wie ich sie am Vorabend hingelegt hatte, nicht eine fehlte. Die Katze war also nicht zurückgekommen.
Ich stand auf der Veranda und blickte in unseren kleinen Garten, in den hell die Frühsommersonne schien. Es ist kein Garten, der seinen Betrachter ruhig stimmt. Die Sonne gelangt nur für einen kurzen Moment am Tag herein, deshalb ist der Boden dunkel und feucht. In einer Ecke stehen zwei, drei unscheinbare Hortensien. Aber Hortensien gehören ehrlich gesagt nicht zu meinen Lieblingsblumen.
Von einer nahen Baumgruppe her ertönte das regelmäßige Quietschen eines Vogels, es klang, als würde er eine Feder aufziehen. Wir hatten den Vogel »Aufziehvogel« getauft. Meine Frau hatte ihm diesen Namen gegeben. Seinen richtigen Namen kannte ich nicht, und ich hatte auch keine Ahnung, wie er ausssah. Nichtsdestoweniger saß dieser Aufziehvogel jeden Tag in der benachbarten Baumgruppe und zog die Federn unserer ruhigen Welt auf.
Warum muss ich eigentlich nach dieser verdammten Katze suchen, fragte ich mich, das Quietschen des Aufziehvogels im Ohr. Und selbst wenn ich die Katze fände, was sollte ich dann mit ihr machen? Sollte ich sie dazu überreden, nach Hause zu kommen? Sollte ich sie etwa bitten: Hör mal, alle machen sich solche Sorgen um dich, kannst du nicht bitte wieder nach Hause kommen?
Großartig, dachte ich. Einfach großartig. Warum soll denn eine Katze nicht hingehen, wohin sie will, und leben, wie sie will? Und was mache ich hier eigentlich mit meinen dreißig Jahren? Wäsche waschen, mir das Menü fürs Abendessen ausdenken und Katzen suchen.
Früher, dachte ich, war ich ein ganz normaler Mensch mit leidenschaftlichen Wünschen. Ich hatte im Gymnasium die Biografie von Clarence Darrow gelesen und wollte unbedingt Anwalt werden. Auch meine Noten waren nicht schlecht. Im letzten Jahr des Gymnasiums kam ich bei der Wahl des »Erfolgversprechendsten« an die zweite Stelle meiner Klasse. Ich hatte sogar die Aufnahmeprüfung für die juristische Fakultät einer ziemlich renommierten Universität bestanden. Aber irgendwie hatte es dann einen Bruch gegeben.
Ich stützte meine Ellbogen auf den Küchentisch, legte mein Kinn darauf und dachte nach. Seit wann hatte die Kompassnadel meines Lebens begonnen, in die falsche Richtung zu zeigen? Ich wusste es nicht. Mir fiel nichts ein, an dem ich es hätte festmachen können. Ich war in keiner politischen Bewegung gescheitert und nicht von der Universität enttäuscht worden, und ich hatte mich auch nicht übermäßig mit Mädchen eingelassen. Aus meiner Sicht lebte ich ein ganz normales Leben. Doch als ich bald darauf mein Studium abschloss, wurde mir klar, dass ich nicht mehr der Alte war.
Wahrscheinlich war diese Kluft anfangs minimal und kaum wahrzunehmen gewesen. Aber im Lauf der Zeit war sie immer größer geworden und hatte mich schließlich an einen Punkt geführt, an dem ich mein eigentliches Ich nicht mehr erkannte. Wenn man unser Sonnensystem als Beispiel nimmt, befände ich mich jetzt ungefähr zwischen Saturn und Uranus. Noch ein kleines Stück, und ich müsste Pluto entdecken können. Und danach, dachte ich, was kommt eigentlich danach?
Anfang Februar hatte ich in dem Rechtsanwaltsbüro, in dem ich die ganze Zeit angestellt gewesen war, gekündigt. Es hatte keinen besonderen Grund dafür gegeben, es war nicht so, dass mir die Arbeit nicht gefallen hätte. Auch wenn es zweifellos keine Arbeit war, die einem das Herz höher schlagen ließ, war doch mein Einkommen nicht schlecht und die Atmosphäre im Büro freundschaftlich.
Meine Rolle war, um es kurz zu sagen, die eines ausgebildeten Laufburschen.
Ich persönlich glaube, dass ich gute Arbeit leistete. Wenn ich das über mich selbst sage, mag das seltsam klingen, aber was die Durchführung meiner sogenannten praktischen Pflichten angeht, besitze ich durchaus Fähigkeiten. Ich habe eine schnelle Auffassungsgabe, bin flink, beschwere mich nicht und denke realistisch. Als ich erklärte, dass ich aufhören wollte, bot mir der Seniorpartner – also der Vater dieser von Vater und Sohn geführten Anwaltskanzlei – sogar eine Gehaltserhöhung an, damit ich bliebe.
Aber schließlich kündigte ich. Warum ich dort aufgehört habe, weiß ich selbst nicht genau. Ich hatte weder einen bestimmten Wunsch noch eine Vorstellung davon, was ich danach machen wollte. Noch einmal zu Hause eingesperrt für das nächste Juraexamen zu büffeln schien mir zu mühselig, und außerdem wollte ich gar nicht unbedingt Anwalt werden.
Als ich meiner Frau beim Abendessen eröffnete, dass ich mir überlegte, bei meiner Arbeit zu kündigen, antwortete sie bloß: »Hm.« Mir war nicht ganz klar, welche Bedeutung dieses »Hm« hatte, aber sie sagte nichts weiter und schwieg eine Weile.
Als auch ich schwieg, meinte sie: »Wenn du aufhören möchtest, solltest du es tun. Es ist dein Leben, und du solltest es so leben, wie du möchtest.« Nach dieser kurzen Bemerkung nahm sie ihren Fisch in Angriff und verteilte die Gräten mit den Stäbchen auf dem Tellerrand.
Meine Frau arbeitete als Bürokraft in einer Designschule, ihr Gehalt war nicht schlecht, und außerdem bekam sie noch ab und zu von befreundeten Redakteuren kleinere Aufträge für Illustrationen, die auch ganz passabel bezahlt waren.
Ich könnte ein halbes Jahr Arbeitslosenversicherung beziehen. Wenn ich zu Hause bliebe und jeden Tag ordentlich die Hausarbeit erledigte, würden wir Extraausgaben für Restaurants oder Reinigung sparen, und unser Lebensniveau würde sich wahrscheinlich kaum ändern.
Also kündigte ich.
Um halb eins ging ich, wie jeden Tag, mit einer großen Segeltuchtasche über der Schulter einkaufen. Zuerst ging ich zur Bank und bezahlte die Gas- und Telefonrechnung, dann kaufte ich im Supermarkt für das Abendessen ein und aß zum Schluss bei McDonald’s einen Cheeseburger und trank einen Kaffee.
Als ich, zu Hause angekommen, die Lebensmittel in den Eisschrank stopfte, klingelte das Telefon. Es war ein sehr nervöses Klingeln, fand ich. Ich ließ die halb geöffnete Plastikpackung mit Tofu auf dem Küchentisch liegen, ging ins Wohnzimmer und nahm den Hörer ab.
»Und, sind Sie fertig mit Ihren Spaghetti?« Es war wieder die Frau.
»Ja«, erwiderte ich. »Aber jetzt muss ich die Katze suchen gehen.«
»Das kann zehn Minuten warten, oder? Die Suche nach der Katze.«
»Also gut, zehn Minuten.«
Warum mache ich das bloß, fragte ich mich. Warum muss ich mich zehn Minuten mit irgendeiner wildfremden Frau unterhalten?
»Nun, wir werden uns verstehen, nicht?«, sagte die Frau leise. Ich konnte spüren, wie sie – wer sie ist, weiß ich nicht – es sich am anderen Ende der Leitung in einem Stuhl bequem machte und die Beine übereinanderschlug.
»Na, ich weiß nicht«, sagte ich. »Manchmal ist man zehn Jahre zusammen und versteht sich noch nicht.«
»Wollen Sie es versuchen?«, fragte sie.
Ich nahm meine Armbanduhr ab, stellte die Stoppuhrfunktion ein und drückte auf den Knopf. Die digitalen Ziffern tickten von eins bis zehn. Schon zehn Sekunden.
»Warum gerade ich?«, fragte ich. »Warum haben Sie nicht jemand anderen angerufen?«
»Das hat seine Gründe.« Sie sprach die Worte sorgfältig aus, als kaue sie langsam auf etwas Essbarem herum. »Ich kenne Sie nämlich.«
»Wann, wo?«, fragte ich.
»Irgendwann, irgendwo«, sagte sie. »Das spielt keine Rolle. Was zählt, ist jetzt. Nicht wahr? Außerdem verlieren wir nur Zeit, wenn wir darüber sprechen. Ich habe auch nicht ewig Zeit.«
»Beweisen Sie es. Geben Sie mir einen Beweis, dass Sie mich kennen.«
»Zum Beispiel?«
»Wie alt bin ich?«
»Dreißig«, antwortete die Frau prompt. »Dreißig und zwei Monate. Reicht das?«
Ich war perplex. Diese Frau kennt mich also wirklich. Aber sosehr ich auch überlegte, ich konnte ihre Stimme nicht einordnen. Es ist unmöglich, dass ich eine Stimme vergesse oder verwechsele. Bei Gesichtern und Namen passiert mir das manchmal, aber an Stimmen erinnere ich mich immer ganz genau.
»Und versuchen Sie sich jetzt einmal vorzustellen, wer ich bin«, sagte sie verführerisch. »Was suggeriert Ihnen meine Stimme? Was für eine Frau bin ich? Gelingt es Ihnen? Das ist doch Ihre Stärke, oder?«
»Keine Ahnung«, sagte ich.
»Versuchen Sie es mal«, sagte sie.
Ich sah auf die Uhr. Erst eine Minute und fünf Sekunden. Ich seufzte resigniert. Ich hatte eingewilligt. Und einmal angefangen, musste ich bis zum Ende durchhalten. Ich richtete meine ganze Aufmerksamkeit auf die Stimme, so wie ich es früher oft getan hatte – sicherlich war das, wie sie gesagt hatte, meine Stärke.
»Zwischen fünfundzwanzig und dreißig, Universitätsabschluss, geboren in Tōkyō, Kindheit im oberen Mittelklassemilieu«, sagte ich.
»Unglaublich«, sagte die Frau. Sie zündete sich neben dem Hörer mit einem Feuerzeug eine Zigarette an. Klang nach einem Cartier. »Machen Sie weiter.«
»Ziemlich hübsch. Zumindest finden Sie das selbst. Aber Sie haben einen Komplex. Sie wären gerne größer, oder Ihre Brüste sind zu klein, so was in der Richtung.«
»Ziemlich nah dran«, sagte sie kichernd.
»Sie sind verheiratet. Aber es läuft nicht so gut. Es gibt Probleme. Eine Frau ohne Probleme ruft keine Männer an, ohne ihren Namen zu nennen. Aber ich kenne Sie nicht. Jedenfalls habe ich nie mit Ihnen gesprochen. Und trotz dieser Vorstellungen kann ich mir noch kein Bild von Ihnen machen.«
»Meinen Sie?«, fragte sie leise, als würde sie einen weichen Keil in meinen Kopf treiben. »Sind Sie sich Ihrer Fähigkeiten so sicher? Meinen Sie nicht, dass sich irgendwo in Ihrem Kopf ein fataler blinder Fleck befinden könnte? Sonst hätten Sie es doch bis jetzt zu etwas mehr bringen können, finden Sie nicht? Ein Mann mit so einem guten Kopf und solchen Begabungen wie Sie!«
»Sie überschätzen mich«, sagte ich. »Ich weiß nicht, wer Sie sind. Ich bin jedenfalls nicht dieser großartige Mensch, für den Sie mich halten. Mir fehlt das Vermögen, etwas bis zu Ende durchzuführen. Deswegen gerate ich ja immer mehr auf Abwege.«
»Ich habe mich aber in Sie verliebt. Das ist allerdings lange her.«
»Also ist es eine alte Geschichte«, sagte ich.
Zwei Minuten und dreiundfünfzig Sekunden.
»So alt nun auch wieder nicht. Wir reden nicht von Vergangenheit.«
»Doch, wir reden von Vergangenheit«, sagte ich.
Blinder Fleck, dachte ich. Vielleicht ist es wirklich so, wie sie sagt. Vielleicht gibt es irgendwo in meinem Kopf, in meinem Körper, in meiner Existenz eine Art verloren gegangene unterirdische Welt, die mein Leben ein wenig verschiebt.
Nein, nicht nur ein wenig. Derart beträchtlich, dass es sich nicht wiedergutmachen ließ.
»Ich liege jetzt im Bett«, sagte sie. »Ich habe gerade geduscht und habe nichts an.«
Ach du meine Güte, dachte ich. Nichts an. Hört sich an wie ein Porno.
»Oder soll ich lieber ein Höschen anziehen? Oder vielleicht Strümpfe? Macht Sie das an?«
»Das ist mir egal. Machen Sie, was Sie wollen«, sagte ich. »Tut mir leid, aber solche Telefongespräche sind nicht mein Ding.«
»Es sind nur zehn Minuten. Kleine zehn Minuten. Zehn Minuten sind kein so schrecklicher Verlust, oder? Mehr verlange ich ja nicht. Es gibt doch auch so was wie Freundschaft. Aber beantworten Sie bitte meine Frage. Ist es besser nackt? Oder soll ich mir lieber was anziehen? Ich habe alles Mögliche, Strapse oder …«
Strapse? Ich glaubte zu spinnen. Welche Frau trägt denn heutzutage noch Strapse? Höchstens Penthouse-Fotomodelle vielleicht.
»Bleiben Sie nackt. Und Sie brauchen sich auch nicht zu bewegen«, sagte ich.
Vier Minuten.
»Mein Schamhaar ist noch feucht«, sagte sie. »Ich habe es nicht richtig abgetrocknet. Deswegen ist es ganz feucht. Warm und feucht. Und meine Schamhaare sind ganz weich. Schwarz und weich. Fühlen Sie mal.«
»Hören Sie, es tut mir leid, aber …«
»Darunter ist es noch viel wärmer. Wie warme Buttercreme. Ganz warm. Wirklich. Und in welcher Position, glauben Sie, liege ich gerade? Mein rechtes Bein ist aufgestellt, und mein linkes Bein habe ich zur linken Seite weggestreckt. Wenn ich eine Uhr wäre, wäre es jetzt etwa fünf nach zehn.«
Am Tonfall ihrer Stimme merkte ich, dass sie dies nicht erfand. Sie hat ihre Beine wirklich in einem Winkel von fünf nach zehn geöffnet, und ihre Vagina ist warm und feucht.
»Streicheln Sie meine Lippen. Ganz langsam. Öffnen Sie sie. Langsam. Streicheln Sie sie ganz zart mit den Seiten Ihrer Finger. Ja, ganz langsam. Und mit Ihrer anderen Hand berühren Sie meine linke Brust. Streicheln Sie sie ganz sanft, erst unten, dann oben, kneifen Sie in meine Brustwarzen, behutsam. Machen Sie es immer wieder. Bis ich komme.«
Ohne etwas zu sagen, hängte ich auf. Ich legte mich aufs Sofa, starrte an die Decke und rauchte eine Zigarette. Die Uhr hatte fünf Minuten und dreiundzwanzig Sekunden gestoppt. Als ich meine Augen schloss, überfiel mich eine Dunkelheit, als wären Farben in verschiedenen Schattierungen ohne System einfach übereinander gemalt.
Warum bloß, dachte ich. Warum lassen sie mich nicht einfach in Ruhe?
Ungefähr zehn Minuten später klingelte wieder das Telefon, aber diesmal nahm ich nicht ab. Es klingelte fünfzehnmal, dann hörte es auf. Nachdem das Klingeln verstummt war, füllte ein tiefes Schweigen den Raum, als habe die Schwerkraft ihr Gleichgewicht verloren. Ein tiefes kühles Schweigen wie von Steinen, die seit fünfzigtausend Jahren in einem Gletscher eingeschlossen sind. Fünfzehnmal Telefonklingeln hatte die Atmosphäre um mich herum vollkommen verändert.
Um kurz vor zwei stieg ich über die Ziegelmauer von unserem Garten in das »Gässchen«.
Obwohl wir es »Gässchen« nennen, ist es eigentlich kein »Gässchen«. Ehrlich gesagt ist es nichts, was man irgendwie bezeichnen könnte. Genau genommen ist es noch nicht einmal ein Weg. Bei einem Weg gibt es einen Eingang und einen Ausgang, er bezeichnet eine Strecke, die an einen bestimmten Ort führt.
Dieses »Gässchen« aber hatte weder einen Eingang noch einen Ausgang, und an seinen Enden stieß man auf eine Ziegelmauer und auf einen Stacheldrahtzaun. Es war auch keine Sackgasse. Denn bei einer Sackgasse gibt es zumindest einen Eingang. Die Leute aus der Umgebung nennen diesen Pfad bloß der Einfachheit halber »Gässchen«.
Das »Gässchen« windet sich ungefähr zweihundert Meter zwischen den Hintergärten der Häuser entlang. Es ist etwas über einen Meter breit, aber da überall Zäune hineinragen und Gerümpel auf dem Weg liegt, kann man sich an mehreren Stellen nur seitlich durchzwängen.
Erzählungen zufolge – mir hatte das mein netter Onkel berichtet, der uns unser Haus zu einem Spottpreis vermietet – hatte das »Gässchen« früher einmal einen Eingang und einen Ausgang besessen und als eine Art Abkürzung zwischen zwei Straßen gedient. Doch seit der Zeit des enormen wirtschaftlichen Aufschwungs, als auf jedem ehemals unbebauten Grundstück ein neues Haus nach dem anderen entstand, war auch dieser Weg bis auf einen schmalen Streifen eingeengt worden. Und da die Anwohner es nicht schätzten, wenn Leute unter den Vordächern ihrer Häuser entlang oder durch ihre Hintergärten liefen, wurden die Durchgänge zum Pfad in aller Stille geschlossen. Zuerst versperrte man sie nur mit einem einfachen Zaun, als aber einer der Anwohner seinen Garten erweiterte und den einen Eingang mit einer Ziegelmauer vollständig abriegelte, versah man dementsprechend auch den anderen mit einem festen Stacheldrahtzaun, um die Hunde fernzuhalten. Die Anwohner hatten den Weg sowieso nur selten als Durchgang benutzt, sodass sich niemand über die Schließung der beiden Eingänge beschwerte, und außerdem war es zur Verbrechensverhütung von Vorteil. Und so war dieser Weg inzwischen, einem aufgegebenen Kanal gleich, verlassen und unbenutzt – lediglich eine Art Pufferzone zwischen den einzelnen Grundstücken. Auf dem Boden wucherte Unkraut und überall woben Spinnen ihre klebrigen Netze und warteten auf Insekten.
Ich begriff nicht, warum meine Frau an einem solchen Ort ein- und ausging. Ich selbst hatte das »Gässchen« bisher erst ein einziges Mal betreten. Und sie ekelte sich noch dazu vor Spinnen.
Als ich darüber nachdenken wollte, füllte sich mein Kopf mit einer gasartigen Substanz, bis er fast zu platzen schien. Ich spürte einen dumpfen Schmerz in meinen Schläfen. Ich hatte die letzte Nacht nicht gut geschlafen, und auch das für Anfang Mai viel zu heiße Wetter und diese seltsamen Telefonanrufe waren schuld daran.
Egal, dachte ich. Ich mache mich jetzt auf die Suche nach der Katze. Über alles Weitere kann ich auch später nachdenken. Und es ist immer noch wesentlich besser, draußen herumzulaufen, als zu Hause zu hocken und auf das Klingeln des Telefons zu warten. Wenigstens habe ich dann ein Ziel.
Die ungewöhnlich klaren Strahlen der Frühsommersonne drangen durch die Spitzen der überhängenden Äste und streuten Schattentupfen auf den Boden des Weges. Da kein Wind wehte, sahen die Schatten wie am Boden haftende, verhängnisvolle Flecken aus. Vielleicht würde die Erde noch Zehntausende von Jahren, besetzt mit diesen winzigen Flecken, unaufhörlich um die Sonne kreisen.
Als ich unter den Ästen entlanglief, huschten die Schatten behände über mein graues T-Shirt und kehrten wieder auf den Boden zurück.
Rundherum war es still, und ich glaubte sogar die Blätter im Sonnenlicht atmen zu hören. Am Himmel schwebten ein paar kleine Wolken, scharf umrissen wie Wolken auf mittelalterlichen Kupferstichen. Alles vor meinen Augen erschien in einer so überwältigenden Klarheit, dass mir mein eigener Körper vage und verschwommen vorkam. Und es war furchtbar heiß.
Ich trug ein T-Shirt, eine dünne Baumwollhose und Tennisschuhe, und mit jedem Schritt, den ich in der Sonne tat, spürte ich, wie mir der Schweiß unter den Achselhöhlen und auf meiner Brust herunterrann. Beides, T-Shirt und Hose, hatte ich erst heute früh aus der Kiste mit den Sommersachen geholt, sodass mir bei jedem tieferen Atemzug der stechende Geruch des Mottenpulvers wie winzige Insekten in die Nase stieg.
Sorgfältig nach links und rechts Ausschau haltend, lief ich mit gleichmäßigen Schritten langsam den Weg entlang. Manchmal hielt ich an und rief leise den Namen der Katze.
Unter den Häusern auf beiden Seiten des Gässchens gab es zwei Kategorien, deutlich voneinander getrennt, als hätte man zwei Flüssigkeiten mit unterschiedlichem spezifischem Gewicht gemischt. Zum einen Häuser, die schon lange dort standen, mit großen ruhigen Gärten, zum anderen vergleichsweise neue, kleinere Häuser. Die neuen Häuser besaßen meist keinen richtigen Garten, und manche von ihnen hatten noch nicht einmal ein kleines Stück. Bei diesen Häusern war zwischen Vordach und Gässchen gerade so viel Platz, dass man zwei Stangen zum Wäschetrocknen anbringen konnte. Zuweilen ragten diese Stangen bis in das Gässchen hinein, und ich musste mich an tropfenden Handtüchern, Hemden und Bettlaken vorbeischlängeln. Unter den Vordächern ließen sich deutlich die Geräusche von Fernsehern und Klospülungen vernehmen, und der Geruch von kochendem Curry hing in der Luft.
Im Gegensatz dazu war bei den alten Häusern kaum ein Lebenszeichen zu bemerken. An den Zäunen waren verschiedenste Sorten von Sträuchern und Zypressen so angepflanzt, dass sie die Sicht ins Innere versperrten, doch ab und zu erhaschte ich durch die Zwischenräume hindurch einen Blick auf wohlgepflegte und weitläufige Gärten. Die Hauptgebäude wiesen ganz unterschiedliche Architekturstile auf:traditionell japanische Häuser mit langen Korridoren, Häuser im westlichen Stil mit alten Kupferdächern und auch moderne Umbauten, die erst vor kurzem ausgeführt zu sein schienen. Allen aber war gemeinsam, dass keiner ihrer Bewohner sichtbar war. Kein Laut und kein Geruch drang nach außen. Auch Wäsche entdeckte ich nur selten.