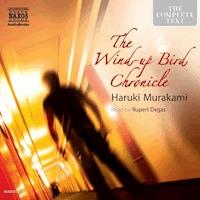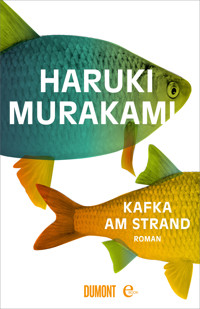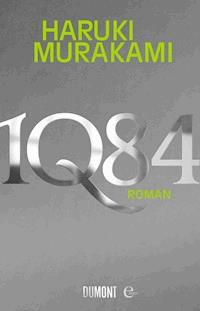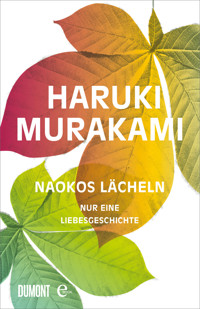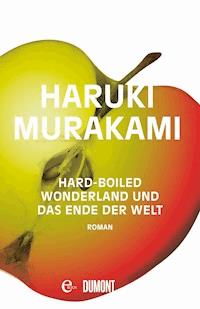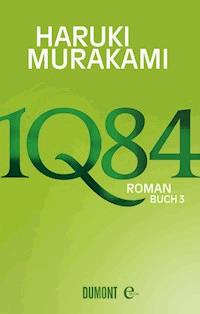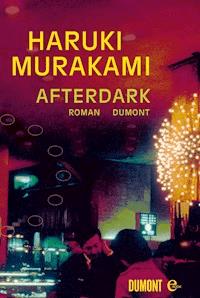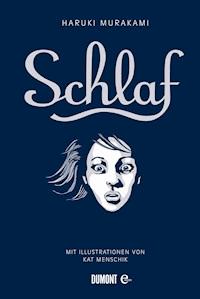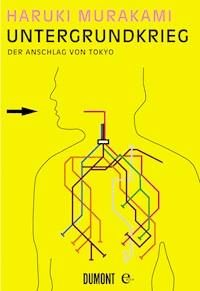8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein moderner Klassiker des japanischen Kultautors Haruki Murakami! Wie eine Halluzination taucht die Kindheitsgeliebte des Barbesitzers Hajima nach Jahrzehnten wieder auf, unfassbar und geheimnisumwoben. Immer an regnerischen Abenden erscheint Shimamoto wie eine verführerische Andeutung aus einer fremden Welt und hebt das Leben des tüchtigen Geschäftmannes und Familienvaters aus den Angeln. ›Südlich der Grenze, westlich der Sonne‹ erzählt mit großer Magie vom Einbruch dämonischer Kräfte in ein Leben – und scheut dabei keine Tabus. Als ›Gefährliche Geliebte‹ in der Übersetzung aus dem Englischen erschien, führte der Streit über die Sprache des Romans und seine Darstellung von Sexualität zur Auflösung des »Literarischen Quartetts«. Jahre später wurde er endlich direkt aus dem japanischen Original ins Deutsche übersetzt: Ursula Gräfe, die längst zur deutschen Stimme Murakamis geworden ist, legt dabei verborgene Schichten frei und enthüllt einen Roman, den wir alle zu kennen glaubten, auf aufregende Weise neu. Der ideale Zeitpunkt für neue Leser, diesen modernen Klassiker zu entdecken – und für alle, die seinem Zauber schon zuvor verfallen waren, sich neu zu verlieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Haruki Murakami
SÜDLICH DER GRENZE,WESTLICH DER SONNE
Roman
Aus dem Japanischenvon Ursula Gräfe
Die Originalausgabe erschien 1992 unter dem Titel
›Kokkyo no minami, taiyo no nishi‹
bei Kodansha Ltd., Tokio
© 1992 Haruki Murakami
eBook 2013
© 2013 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Ursprünglich erschienen als ›Gefährliche Geliebte‹
Übersetzung: Ursula Gräfe
Umschlag: Hafen Werbeagentur, Hamburg
Umschlagabbildung: © Erin Cone
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook: 978-3-8321-8710-1
SÜDLICH DER GRENZE,WESTLICH DER SONNE
1
Mein Geburtstag fiel auf den 4.Januar 1951, also in die erste Woche des ersten Monats zu Beginn der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts. Aufgrund dieses denkwürdigen Datums erhielt ich den Namen Hajime, was »Anfang« bedeutet. Ansonsten war an meiner Herkunft nichts Bemerkenswertes. Mein Vater arbeitete in einem großen Wertpapierhaus, und meine Mutter war Hausfrau. Vater war als Student nach Singapur an die Front geschickt geworden, und als der Krieg vorbei war, hatte er noch einige Zeit in Gefangenschaft verbracht. Die Familie meiner Mutter war im letzten Kriegsjahr während der B-29-Angriffe ausgebombt worden. Meine Eltern gehörten der Generation an, die durch den Krieg am meisten gelitten hatte.
Als ich auf die Welt kam, wies freilich kaum noch etwas auf diesen Krieg hin. In dem friedlichen Vorort, in dem wir wohnten, gab es weder Ruinen noch Besatzungstruppen. Unser Haus, das der Firma meines Vaters gehörte, war noch vor dem Krieg gebaut worden und etwas altmodisch, dafür aber großzügig angelegt. Im Garten standen große Kiefern, und es gab sogar einen kleinen Teich mit einer Steinlaterne.
In unserer Gegend lebten ausschließlich Angehörige der Mittelschicht, ja, sie war geradezu ein Musterbeispiel für solche Vororte. Alle in meiner Klasse, mit denen ich mehr oder weniger befreundet war, wohnten in netten, eigenen Häusern. Sie mochten unterschiedlich groß sein, hatten aber alle einen Eingangsbereich und einen Garten mit Bäumen. Die Väter meiner Freunde waren Firmenangestellte oder selbstständig. Berufstätige Mütter waren eine Seltenheit. Die meisten Familien hielten entweder einen Hund oder eine Katze. Ich kannte niemanden, der in einer gewöhnlichen Mietwohnung oder einem Apartmenthaus wohnte. Später zogen wir in ein anderes Viertel in der Nähe, das ganz ähnlich strukturiert war. So kam es, dass ich, bis ich nach Tokio auf die Universität ging, in dem Glauben lebte, jeder normale Mensch müsse in Schlips und Anzug zur Arbeit gehen, in einem Haus mit Garten wohnen und einen Hund oder eine Katze halten. Einen anderen Lebensstil konnte ich mir praktisch nicht vorstellen.
In meiner Welt hatte eine Durchschnittsfamilie entweder zwei oder drei Kinder. Sämtliche Freunde meiner Kindheit hatten ausnahmslos noch ein oder zwei Geschwister. Waren sie nicht zu zweit, dann waren sie zu dritt, wenn nicht zu dritt, dann zu zweit. Familien mit sechs oder sieben Kindern waren selten, aber längst nicht so selten wie solche mit nur einem Kind.
Ich war der Einzige, der keine Geschwister hatte. Ich war ein Einzelkind und hatte deshalb einen Minderwertigkeitskomplex. Ich war die Ausnahme in einer Welt, in der andere ganz selbstverständlich etwas besaßen, was mir fehlte.
In meiner Kindheit verabscheute ich nichts so sehr wie das Wort »Einzelkind«. Stets aufs Neue ließ es mich meine Unterlegenheit spüren. Es zeigte mit dem nackten Finger auf mich. »Du da«, sagte es, »dir fehlt was.«
In meiner Welt herrschte unerschütterlich und allgemein anerkannt die Meinung, Einzelkinder seien von ihren Eltern verwöhnt, schwächlich und egoistisch. Dies galt als eine Art Naturgesetz, ähnlich dem Umstand, dass Kühe Milch geben oder dass der Luftdruck fällt, wenn man auf einen hohen Berg steigt. Deshalb hasste ich es, nach der Anzahl meiner Geschwister gefragt zu werden. Jemand brauchte nur zu erfahren, dass ich keine hatte, und schon stellte sich bei ihm unwillkürlich der Gedanke ein: Sieh da, ein Einzelkind, verwöhnt, schwächlich und egoistisch. Diese stereotype Reaktion hing mir zum Hals heraus und kränkte mich nicht wenig. Was mich jedoch besonders kränkte und ärgerte, war, dass diese Annahme völlig den Tatsachen entsprach. Ich war wirklich ein verwöhnter, schwächlicher und ziemlich egoistischer Knabe.
Ein Kind ohne Geschwister war also eine echte Rarität. In den ganzen sechs Jahren meiner Grundschulzeit begegnete ich nur einem anderen Einzelkind. Deshalb erinnere ich mich auch sehr gut an sie. (Ja, es war ein Mädchen.) Wir freundeten uns an, denn wir konnten über alles reden. Zwischen uns herrschte eine Art inneres Einverständnis. Man könnte sogar sagen, dass ich dieses Mädchen liebte.
Sie hieß Shimamoto. Kurz nach ihrer Geburt hatte sie Kinderlähmung bekommen und zog deshalb das linke Bein etwas nach. Außerdem war sie erst gegen Ende der fünften Klasse neu auf unsere Schule gekommen. Allein deshalb muss sie unter weitaus größerem psychischem Druck gestanden haben als ich. Allerdings war sie durch diese Belastung stärker und selbstbewusster geworden, als ich es jemals hätte sein können. Nie kam auch nur ein Wort der Klage über ihre Lippen. Nie sah man ihr ihren Kummer an, und was auch geschah, ihr Lächeln versagte nie. Fast kam es mir so vor, als vertiefe es sich, je unerträglicher eine Situation wurde. Es war ein wunderschönes Lächeln, das mich oft tröstete und ermutigte. »Mach dir nichts draus«, schien es zu sagen. »Hab nur etwas Geduld, dann wird auch das vorübergehen.« Später war es vor allem dieses Lächeln, das meine Erinnerung an Shimamoto beherrschte.
Shimamoto war sehr gut in der Schule und behandelte andere stets fair und freundlich. Sie wurde respektiert. Obwohl sie ebenfalls ein Einzelkind war, benahm sie sich in dieser Hinsicht ganz anders als ich. Fraglich war allerdings, ob unsere Klassenkameraden sie wirklich vorbehaltlos mochten. Keiner ärgerte oder hänselte sie, aber Freunde hatte sie außer mir keine.
Vielleicht wirkte sie zu unnahbar und selbstbewusst. Manche fanden sie vielleicht zu kühl und anmaßend. Ich dagegen spürte immer wieder, dass sich hinter ihren Worten und in ihrer Miene eine gewisse Wärme und Verletzlichkeit verbargen, etwas, das entdeckt werden wollte wie ein Kind, das Verstecken spielt.
Da Shimamotos Vater häufig versetzt wurde, hatte sie immer wieder die Schule gewechselt. Welchen Beruf er ausübte, weiß ich nicht mehr genau. Sie hatte mir einmal ausführlich davon erzählt, aber wie die meisten Kinder interessierte ich mich nicht für das Berufsleben fremder Väter. Ich glaube mich zu erinnern, dass er irgendetwas bei einer Bank oder einem Steuerberater war. Sie wohnten in einem für eine Firmenwohnung recht großen Haus westlichen Stils. Es war von einer soliden, hüfthohen Mauer mit einer immergrünen Hecke umgeben, durch die man hier und dort einen Blick auf den Rasen im Garten erhaschen konnte.
Shimamoto war fast so groß wie ich und hatte markante Züge. Jahre später sollte sie zu einer hinreißenden Schönheit heranwachsen. Doch als ich sie kennenlernte, hatte sie noch nicht die äußere Erscheinung erreicht, die ihrem Wesen entsprach. Sie hatte damals etwas Unausgewogenes an sich, und die meisten fanden sie nicht besonders anziehend. Vielleicht lag es daran, dass das Erwachsene und das Kindliche an ihr einander widersprachen und dieses Ungleichgewicht den Betrachter verunsicherte.
Während ihres ersten Monats in der Klasse saß sie neben mir, weil ich am nächsten wohnte (ihr Haus lag buchstäblich nur einen Katzensprung von unserem entfernt). Es gehörte zu den Regeln unserer Schule, dass ein neuer Schüler von einem in seiner direkten Nachbarschaft wohnenden Kind betreut wurde. Bei Shimamoto galt dies einmal mehr, da sie gehbehindert war. Unser Klassenlehrer hatte mich eigens zu sich gerufen und mir den Auftrag erteilt, mich um sie zu kümmern. Ich hatte sie in die notwendigen Einzelheiten unseres Schulalltags einzuweihen: welche Unterrichtsmaterialien sie für die jeweiligen Fächer brauchte, wann die wöchentlichen Tests stattfanden, wie weit wir in den Lehrbüchern waren, wann man Putz- oder Essensdienst hatte. Wie es zwischen elf- oder zwölfjährigen Jungen und Mädchen, die sich nicht kennen, die Regel ist, waren wir bei unseren ersten Gesprächen noch ziemlich verlegen. Doch als wir erst einmal erkannten, dass wir beide Einzelkinder waren, wurde daraus rasch ein lebhafter und inniger Austausch. Beide waren wir nie zuvor einem anderen Einzelkind begegnet, und wir ergingen uns in leidenschaftlichen Erörterungen über unser Los. Wir hatten einander so unendlich viel zu sagen. Nicht jeden Tag, aber sooft es sich ergab, gingen wir zusammen von der Schule nach Hause. Während unseres etwa einen Kilometer langen Heimwegs (wegen ihres Beins konnten wir nur langsam gehen) redeten wir ununterbrochen und entdeckten dabei viele Gemeinsamkeiten. Wir lasen beide gern. Wir hörten beide gern Musik. Wir mochten beide Katzen. Uns fiel es beiden schwer, anderen unsere Gefühle zu zeigen. Die Liste der Nahrungsmittel, die wir nicht mochten, war lang. Wir lernten ohne Schwierigkeiten, solange der Stoff uns Spaß machte, aber die ungeliebten Fächer verabscheuten wir wie den Tod. Einen Unterschied gab es jedoch zwischen uns: Shimamoto bemühte sich viel disziplinierter darum, sich zu schützen. Sie lernte auch in den Fächern, die sie nicht mochte, und hatte ziemlich gute Noten. Anders als ich. Wenn es zum Mittagessen in der Schule etwas gab, was sie nicht mochte, aß sie es trotzdem auf. Anders als ich. So war der Schutzwall, den sie um sich errichtete, ungleich höher und stärker als meiner. Doch was sich dahinter befand, war auffallend ähnlich.
Ich gewöhnte mich sofort daran, mit ihr allein zu sein. Das war eine völlig neue Erfahrung für mich. In ihrer Gegenwart verspürte ich nie die Nervosität und Befangenheit, die ich beim Umgang mit anderen Mädchen empfand. Ich ging gern mit ihr von der Schule nach Hause. Wegen ihres Beins mussten wir unterwegs immer auf einer Parkbank ausruhen. Was mich nicht im Geringsten störte, im Gegenteil, ich freute mich, weil wir dadurch länger brauchten.
Obwohl Shimamoto und ich viel Zeit zusammen verbrachten, kann ich mich nicht erinnern, dass die anderen Kinder über uns lästerten. Damals dachte ich mir nichts dabei, aber im Nachhinein wundert mich das ein bisschen, denn in jenem Alter sind Freundschaften zwischen Jungen und Mädchen normalerweise Gegenstand von Hänseleien. Ich vermute, dass diese Zurückhaltung mit Shimamotos Persönlichkeit zusammenhing. Andere fühlten sich in ihrer Nähe eingeschüchtert. »Vor der darf man keinen Blödsinn reden«, schien die einhellige Meinung zu sein. Selbst Lehrer wirkten ihr gegenüber manchmal befangen. Wahrscheinlich hatte dies auch mit ihrer Behinderung zu tun. Jedenfalls galt es offenbar als unpassend, sich über Shimamoto lustig zu machen, und ich war froh darüber.
Wegen ihres Beins war Shimamoto vom Sportunterricht und von Bergwanderungen befreit. Sie nahm auch nicht an der sommerlichen Schwimmfreizeit teil, und auf dem alljährlichen Sportfest an unserer Schule wirkte sie immer etwas fehl am Platz. Ansonsten führte sie jedoch das ganz normale Leben einer Grundschülerin. Über ihre Behinderung sprach sie, soweit ich mich erinnere, nie. Auf unserem gemeinsamen Heimweg von der Schule entschuldigte sie sich nie für ihre Langsamkeit, und auch sonst ließ sie sich nie etwas anmerken. Dennoch wusste ich, dass sie unter ihrer Behinderung litt und sie gerade deshalb nie erwähnte. Sie ging nicht zu anderen Kindern nach Hause, weil sie dann im Flur ihre Schuhe hätte ausziehen müssen. Der linke hatte eine höhere Sohle als der rechte. Es handelte sich offensichtlich um eine Spezialanfertigung, und es war ihr wohl unangenehm, die Schuhe den Blicken anderer auszusetzen. Mir war aufgefallen, dass sie sie, sobald sie nach Hause kam, im Schuhschrank verstaute.
Im Wohnzimmer der Familie Shimamoto stand eine hochwertige moderne Stereoanlage, auf der wir oft Schallplatten hörten. Allerdings konnte die Sammlung ihres Vaters sich nicht mit der Qualität seiner Anlage messen. Er besaß etwa fünfzehn Langspielplatten mit überwiegend leichter klassischer Musik, die wir unermüdlich immer wieder abspielten. Noch heute kann ich diese Stücke in- und auswendig.
Der Umgang mit den Schallplatten war Shimamotos Aufgabe. Sie nahm sie aus der Hülle und legte sie mit beiden Händen auf den Plattenteller, ohne die Rillen zu berühren. Nachdem sie mit einem kleinen Pinsel die Nadel vom Staub befreit hatte, setzte sie mit größter Behutsamkeit den Tonarm auf. Wenn die Platte zu Ende war, besprühte sie sie mit einem antistatischen Mittel und wischte sie mit einem weichen Tuch ab. Anschließend schob sie sie wieder in ihre Hülle und stellte sie ins Regal zurück. Diese Handgriffe führte sie mit ernster Miene genau so aus, wie ihr Vater es ihr beigebracht hatte. Oft kniff sie dabei die Augen zusammen und hielt sogar den Atem an. Ich saß währenddessen auf dem Sofa und beobachtete sie. Sooft sie eine Platte ins Regal zurückstellte, schenkte Shimamoto mir ein kleines Lächeln. Und jedes Mal fragte ich mich, ob das, was sie in ihren Händen hielt, womöglich nicht nur eine Schallplatte war, sondern eine empfindsame, in einer gläsernen Flasche eingeschlossene Seele.
Bei uns zu Hause gab es weder einen Plattenspieler noch Schallplatten. Meine Eltern machten sich nichts aus Musik. Deshalb saß ich meist in meinem Zimmer und presste mein Ohr an ein kleines UKW-Radio aus Plastik. Fast immer hörte ich Rock'n'Roll. Doch bald fand ich auch Geschmack an den klassischen Stücken, die ich bei Shimamoto hörte. Für mich waren sie Musik »aus einer anderen Welt«, und wahrscheinlich lag die besondere Anziehungskraft dieser »anderen Welt« darin, dass Shimamoto ihr angehörte. Ein- oder zweimal in der Woche verbrachten wir den Nachmittag auf dem Sofa im Wohnzimmer der Shimamotos und hörten Ouvertüren von Rossini, die Pastorale von Beethoven oder Peer Gynt. Dabei tranken wir den schwarzen Tee, den Shimamotos Mutter uns brachte. Die Mutter war ziemlich angetan von meinen Besuchen. Wahrscheinlich war sie froh, dass ihre Tochter nach dem Schulwechsel so rasch Anschluss gefunden hatte. Sicher hatte es auch damit zu tun, dass ich stets adrett und anständig gekleidet war. Allerdings muss ich zugeben, dass ich mich nie so recht mit ihr anfreunden konnte. Nicht dass mir etwas Konkretes an ihr missfallen hätte, sie war immer freundlich zu mir, aber hin und wieder spürte ich eine Gereiztheit in ihrer Stimme, die mich beunruhigte.
Von den Platten des Vaters gefielen mir die Klavierkonzerte von Liszt am besten, das erste auf der A-, das zweite auf der B-Seite. Dafür gab es zwei Gründe. Zum einen fand ich die Hülle wunderschön, und zum anderen gab es – Shimamoto ausgenommen – in meiner Umgebung keinen einzigen Menschen, der schon einmal ein Klavierkonzert von Liszt gehört hatte. Das war ein aufregender Gedanke für mich. Ich kannte eine Welt, die in meinem Umfeld niemand sonst kannte. Es war, als hätte man mir allein den Zutritt zu einem geheimen Garten gestattet. Ich fühlte mich erhaben, denn Liszts Klavierkonzerte ermöglichten es mir, eine höhere Daseinsstufe zu erklimmen.
Zudem war die Musik selbst von großer Schönheit. Anfangs klang sie für meine Ohren übertrieben, geziert und eher unzusammenhängend, doch durch mehrmaliges Hören verankerte sie sich nach und nach in meinem Bewusstsein, und es war, als würde ein verschwommenes Bild allmählich feste Gestalt annehmen. Wenn ich die Augen schloss und mich konzentrierte, erreichte mich die Musik als eine Abfolge verschiedener Wirbel. Aus einem Wirbel entstand ein weiterer, der sich mit dem ersten verband, und so fort. Diese Wirbel waren, wie mir natürlich erst heute klar ist, von ideeller, abstrakter Natur. Liebend gern hätte ich Shimamoto von ihnen erzählt. Aber sie gehörten nicht zu den Dingen, die man einem anderen Menschen in alltäglichen Worten erklären konnte. Um sie genau zu beschreiben, hätte es anderer Worte bedurft, die ich jedoch nicht kannte. Außerdem wusste ich gar nicht, ob das, was ich empfand, es überhaupt wert war, weitergegeben zu werden.
Leider habe ich den Namen des Pianisten vergessen, der die Liszt-Konzerte spielte. Doch an die farbenprächtige Hülle und das Gewicht der Schallplatte, die sich auf geheimnisvolle Weise schwer und massiv anfühlte, erinnere ich mich noch deutlich.
Zwischen den klassischen Platten, die Shimamotos Vater besaß, standen noch jeweils eine von Nat King Cole und eine von Bing Crosby im Regal, die wir sehr oft hörten. Die von Bing Crosby war eine Weihnachtsplatte, aber wir hörten sie zu jeder Jahreszeit. Noch heute frage ich mich, warum wir so gar nicht genug davon bekamen.
An einem Tag im Dezember, nicht lange vor Weihnachten, saßen Shimamoto und ich wie üblich auf dem Sofa und hörten Musik. Ihre Mutter machte Besorgungen, und außer uns war niemand im Haus. Es war ein trüber Winternachmittag. Das Licht, das mühsam durch die dichte, tief hängende Wolkenschicht drang, wirkte körnig, aufgeraut durch winzige Staubpartikel. Alles war düster und bewegungslos. Es war dunkel im Zimmer, als wäre es bereits Abend. Ich glaube, die Straßenbeleuchtung war noch nicht eingeschaltet. Nur der rötliche Schein des Gasofens beleuchtete schwach die Wände. Nat King Cole sang »Pretend«. Natürlich verstanden wir kein Wort von dem englischen Text. Für uns war er so etwas wie eine Zauberformel. Dennoch liebten wir den Song, und da wir ihn immer wieder gehört hatten, konnte ich die ersten Zeilen mitsingen.
Pretend you’re happy when you’re feeling blue
It isn’t very hard to do.
Heute weiß ich natürlich, was sie bedeuten. Sie klingen für mich wie ein Lied über Shimamotos anmutiges Lächeln. Der Text brachte eine bestimmte Lebenseinstellung zum Ausdruck, auch wenn diese Art zu denken mir bisweilen schwer fiel.
Shimamoto trug einen blauen Pullover mit rundem Ausschnitt. Sie besaß mehrere blaue Pullover. Vielleicht mochte sie blaue Pullover. Oder sie passten einfach gut zu der dunkelblauen Jacke, die sie immer zur Schule trug. Der Kragen ihrer weißen Bluse schaute aus dem Ausschnitt hervor. Außerdem trug sie einen karierten Rock und weiße Baumwollstrümpfe. Unter dem weichen, anliegenden Pullover zeichnete sich die leichte Wölbung ihrer Brust ab. Sie saß mit untergeschlagenen Beinen auf dem Sofa. Einen Ellbogen auf die Lehne gestützt, lauschte sie der Musik, den Blick in unbestimmte Ferne gerichtet.
»Meinst du, es stimmt, dass Ehepaare, die nur ein Kind haben, nicht gut miteinander auskommen?«, fragte sie.
Ich überlegte, aber der Zusammenhang wurde mir nicht recht klar. »Wo hast du das denn gehört?«
»Jemand hat vor längerer Zeit mal zu mir gesagt, Eltern, die sich nicht gut verstünden, bekämen nur ein Kind. Das hat mich sehr traurig gemacht.«
»Hm«, sagte ich.
»Verstehen deine Mutter und dein Vater sich gut?«
Darauf hatte ich keine Antwort, denn ich hatte noch nie darüber nachgedacht.
»Meine Mutter ist nicht sehr kräftig«, sagte ich. »Ich weiß nicht genau, aber vielleicht wäre die Belastung, noch ein Kind zu bekommen, zu groß für sie, und es liegt daran.«
»Hast du dir schon einmal vorgestellt, wie es wäre, Geschwister zu haben?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
Ich nahm die Plattenhülle vom Tisch und betrachtete sie. Aber es war zu dunkel im Zimmer, und ich konnte die Schrift nicht lesen. Ich legte die Hülle wieder auf den Tisch und rieb mir mit dem Handgelenk die Augen. Meine Mutter hatte mir irgendwann dieselbe Frage gestellt. Meine Antwort hatte sie weder gefreut noch betrübt. Sie schien nur verwundert. Doch meine Antwort war offen und ehrlich gewesen.
Und ziemlich weitschweifig. Ich hatte nämlich nicht richtig ausdrücken können, was ich meinte. Was ich hatte sagen wollen, war Folgendes gewesen: »Ich bin ohne Geschwister aufgewachsen und dabei so geworden, wie ich jetzt bin. Wenn ich Geschwister gehabt hätte, wäre ich vermutlich ein ganz anderer geworden. Also hat es für mich, der ich jetzt bin, wie ich bin, keinen Sinn, darüber nachzudenken, wie es wäre, Geschwister zu haben.« Mit anderen Worten, die Frage meiner Mutter schien mir sinnlos.
Die gleiche Antwort gab ich auch Shimamoto. Sie sah mich lange an. In ihrem Ausdruck war stets etwas, was anderen Menschen zu Herzen ging. Etwas Sinnliches, als würde sie ihrem Gegenüber liebevoll Schicht um Schicht die zarte Haut vom Herzen ziehen – dieser Gedanke kam mir natürlich erst viel später. Ich kann mich auch jetzt noch gut an ihre schmalen Lippen erinnern, die mit der Veränderung in ihrem Ausdruck ganz leicht die Form wechselten, und an das schwache Leuchten, das tief in ihren Augen glomm und mir wie das Flackern einer kleinen Kerze am Ende eines dunklen länglichen Zimmers erschien.
»Ich glaube, ich weiß, was du meinst«, sagte sie mit ruhiger Erwachsenenstimme.
»Wirklich?«
»Ja«, sagte sie. »Es gibt Dinge, die sich nicht mehr rückgängig machen lassen. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ist man einmal an einem gewissen Punkt angekommen, gibt es kein Zurück mehr. Das meinst du doch, oder?«
Ich nickte.
»Mit der Zeit erstarren die Dinge. Wie Zement in einem Eimer. Und dann gibt es kein Zurück mehr. Du willst sagen, dass dein Zement bereits hart geworden ist und du deshalb kein anderer mehr werden kannst, als der, der du bist, oder?«
»Ja, so ungefähr«, sagte ich unsicher.
Shimamoto sah kurz auf ihre Hände. »Weißt du, manchmal stelle ich mir vor, wie es sein wird, wenn ich erwachsen bin und verheiratet. In was für einem Haus ich leben und was ich tun werde. Auch wie viele Kinder ich haben werde.«
»Wirklich?«, sagte ich.
»Denkst du nie an so was?«
Ich schüttelte den Kopf. Zwölfjährige Jungen denken über so etwas nicht nach. »Und wie viele Kinder willst du?«
Sie nahm die Hand von der Sofalehne und legte sie auf ihr Knie. Unverwandt beobachtete ich, wie sie mit dem Finger langsam das Karomuster auf ihrem Rock nachzeichnete. Es lag etwas Geheimnisvolles darin. Von ihrer Fingerspitze schien ein unsichtbarer, feiner Faden auszugehen, aus dem sich eine neue Zeit entspann. Als ich die Augen schloss, tauchten die Wirbel in der Dunkelheit auf. Tauchten auf und verschwanden wieder, lautlos. Aus weiter Ferne hörte ich Nat King Cole »South of the Border« singen. Natürlich handelte das Lied von Mexiko, aber das wusste ich damals nicht. Für mich klangen die Worte »südlich der Grenze« lockend und unergründlich. Sooft ich das Lied hörte, fragte ich mich, was sich wohl südlich der Grenze befinden mochte. Shimamoto fuhr noch immer mit dem Finger über ihren Rock. Ich spürte einen leisen, süßen Schmerz in mir.
»Es ist seltsam«, sagte sie. »Ich kann mir nur vorstellen, dass ich ein Kind habe. Ich bin Mutter und habe ein Kind. Aber dass dieses Kind Geschwister hat, kann ich mir nicht vorstellen. Weder Brüder noch Schwestern. Es ist ein Einzelkind.«
Shimamoto war offenbar ein frühreifes Mädchen, das sich für mich als Mitglied des anderen Geschlechts interessierte. Auch ich fühlte mich auf diese Weise zu ihr hingezogen, wusste aber nicht, wie ich damit umgehen sollte. Shimamoto ging es vermutlich ebenso. Ein einziges Mal nur nahm sie meine Hand, um mich irgendwohin zu ziehen, so als wolle sie sagen »komm schnell, hier entlang«. Sie hielt sie nur etwa zehn Sekunden fest, die mir jedoch wie eine halbe Stunde vorkamen. Als sie wieder losließ, wünschte ich, sie hätte meine Hand länger gehalten. Die Geste hatte ganz natürlich gewirkt, doch ich wusste, dass Shimamoto mit Absicht gehandelt hatte.
Noch heute erinnere ich mich genau, wie ihre Hand sich angefühlt hatte. Ganz anders als jede Berührung, die ich damals kannte und später kennenlernte. Es war nur die kleine, warme Hand eines zwölfjährigen Mädchens. Dennoch schien in ihren fünf Fingern und ihrer Handfläche wie in einem Schaukasten alles enthalten zu sein, was ich wissen wollte und wissen musste. Indem Shimamoto meine Hand hielt, führte sie mich an einen Ort, an dem diese Dinge wirklich existierten. Während dieser zehn Sekunden hatte ich das Gefühl, ganz und gar ein kleiner Vogel zu sein. Ich konnte mich hoch in die Lüfte schwingen, den Wind spüren und von hoch oben die Landschaft weit unter mir sehen. Ich war zu hoch, um alles deutlich erkennen zu können. Aber ich spürte, dass dort etwas war und ich eines Tages dorthin gelangen würde. Diese Erkenntnis nahm mir den Atem und ließ mein Herz erzittern.
Wieder zu Hause, setzte ich mich an meinen Schreibtisch und betrachtete lange die Hand, die Shimamoto gehalten hatte. Ich war sehr glücklich, dass sie es getan hatte. Dies schöne Gefühl glühte noch mehrere Tage in mir nach. Zugleich war ich verwirrt und bedrückt. Was sollte ich mit dieser Wärme anfangen, wie konnte ich sie bewahren?
Nach der Grundschule kamen Shimamoto und ich auf verschiedene Schulen. Aus irgendwelchen Gründen zogen meine Eltern und ich in eine andere Stadt. Allerdings lag sie nur zwei Bahnstationen entfernt, und ich besuchte Shimamoto in den ersten drei Monaten nach dem Umzug noch ein paar Mal. Aber dann nicht mehr. Wir waren damals in einem komplizierten Alter. Durch die andere Schule und die Entfernung von zwei Bahnstationen hatte sich meine Welt völlig verändert. Ich hatte andere Freunde, eine andere Schuluniform und andere Lehrbücher. Mein Körper, meine Stimme und meine Empfindungen waren abrupten Veränderungen unterworfen, und die vertraute Atmosphäre, die zwischen Shimamoto und mir geherrscht hatte, verwandelte sich zunehmend in Befangenheit. Ihre physischen und psychischen Veränderungen erschienen mir noch gravierender als meine eigenen und riefen ein diffuses Unbehagen in mir hervor. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass ihre Mutter mich zunehmend misstrauischer beäugte. »Was will dieser Junge denn noch bei uns?«, schien sie sich zu fragen. »Er wohnt doch gar nicht mehr hier und geht auf eine andere Schule.« Vielleicht war ich auch zu empfindlich. Jedenfalls irritierten ihre Blicke mich sehr.
So entfernte ich mich allmählich von Shimamoto, bis ich schließlich gar nicht mehr zu ihr ging. Was wahrscheinlich ein Fehler war (ich kann hier nur das Wort »wahrscheinlich« verwenden, denn es ist nicht meine Aufgabe, den gewaltigen Speicher der Vergangenheit zu durchforsten und zu entscheiden, was darin richtig oder falsch ist). Jedenfalls hätte ich die Verbindung zu ihr aufrechterhalten sollen. Ich brauchte sie und sie mich vielleicht auch. Aber meine Selbstzweifel waren zu stark, und ich fürchtete mich zu sehr vor einer Kränkung. So sah ich sie erst lange danach wieder.
Auch nachdem ich Shimamoto aus den Augen verloren hatte, dachte ich stets voller Sehnsucht an sie. In meiner Pubertät, dieser von Verwirrung und Melancholie erfüllten Zeit, trösteten und ermutigten mich meine Erinnerungen an sie immer wieder. Viele Jahre lang räumte ich ihr einen besonderen Platz in meinem Herzen ein. Ich hielt ihn für sie frei, so wie man ein Schild mit der Aufschrift »reserviert« auf einen ruhigen Tisch in einer hinteren Ecke eines Restaurants stellt. Wenngleich ich nicht damit rechnete, sie jemals wiederzusehen.
Als ich Shimamoto kennenlernte, war ich erst zwölf und kannte noch kein sexuelles Verlangen im eigentlichen Sinn. Ich verspürte zwar ein vages Interesse an den Rundungen ihrer Brüste und an dem, was sich unter ihrem Rock befinden mochte, hatte jedoch keine Ahnung, was dies konkret bedeutete und wohin es führen würde. Mit gespitzten Ohren und geschlossenen Augen versuchte ich mir ein Bild von dem zu machen, was dort war. Meine Vorstellungen waren natürlich sehr undeutlich. Alles lag im Nebel, die Umrisse waren vage und verschwommen. Dennoch spürte ich, dass sich dort etwas für mich sehr Bedeutsames verbarg. Und ich wusste genau, dass Shimamoto etwas Ähnliches sah.
Wahrscheinlich fühlten wir beide, dass wir noch unfertige Geschöpfe waren, auf der Suche nach einem neuen, zu erreichenden Etwas, das uns erfüllen und vervollkommnen würde. Zehn Sekunden lang standen wir Hand in Hand vor dem Tor zu diesem Neuen. Nur wir beide. Im Schein eines trüben, flackernden Lichts.
2
In der Oberschule entwickelte ich mich zu einem normalen Teenager. Dies war die zweite Phase in meinem Leben und ein weiterer Schritt in meiner Entwicklung. Ich hörte auf, etwas Besonderes zu sein, und wurde ein ganz normaler Mensch. Ein aufmerksamer Beobachter hätte natürlich erkannt, dass ich Probleme hatte. Aber gibt es einen Sechzehnjährigen auf der Welt, der keine hat? Während ich mich der Welt annäherte, kam auch sie auf mich zu. Zumindest war ich mit sechzehn kein verwöhntes Einzelkind mehr. In der siebten Klasse trat ich spontan in einen Schwimmverein in der Nähe ein. Dort lernte ich zu kraulen und schwamm regelmäßig zweimal in der Woche Bahnen. Dadurch bekam ich breitere Schultern, mein Brustkorb wurde kräftiger, und meine Muskeln strafften sich. Ich war auch nicht mehr das kränkliche Kind, das bei jedem bisschen Fieber bekam und ins Bett musste. Oft stand ich lange vor dem Badezimmerspiegel und erkundete ausführlich meinen Körper. Ich konnte beinahe zuschauen, wie er sich veränderte. Diese radikalen Veränderungen gefielen mir, weniger jedoch, weil ich mich gefreut hätte, erwachsen zu werden, sondern eher weil sie mich zu einem anderen machten.
Ich las gern und hörte gern Musik. Obwohl ich Bücher und Musik schon immer gemocht hatte, hatte sich meine Hinwendung zu beidem durch die Freundschaft mit Shimamoto vertieft und verfeinert. Ich ging regelmäßig in die Bücherei und verschlang ein Buch nach dem anderen. Hatte ich einmal angefangen zu lesen, konnte ich nicht mehr aufhören. Es war wie eine Sucht. Ich las beim Essen, in der Bahn, bis spät abends im Bett, sogar heimlich während des Unterrichts. Irgendwann besorgte ich mir eine kleine Stereoanlage und verbrachte nun meine gesamte Freizeit in meinem Zimmer, um Jazz zu hören. Ich hatte nicht das Bedürfnis, mit jemandem über die Bücher, die ich las, und die Musik, die ich hörte, zu sprechen. Ich war völlig zufrieden, wenn ich für mich sein konnte. So gesehen war ich ein sehr einsamer und anmaßender junger Mann. Für Mannschaftssportarten hatte ich nicht das Geringste übrig. Ebenso verabscheute ich Wettkämpfe jeder Art. Lieber zog ich meine einsamen, stummen Bahnen im Schwimmbad.
Was nicht heißt, dass ich ein absoluter Einzelgänger war. In der Schule schloss ich einige enge Freundschaften, wenn auch nicht viele. Ehrlich gesagt gab es nicht einen einzigen Tag, an dem es mir in der Schule gefiel. Ich hatte ständig das Gefühl, erdrückt zu werden, und lebte deshalb in ständiger Abwehrhaltung. Ohne meine Freunde hätte ich gewiss tiefere Wunden aus dieser schwierigen Zeit des Heranwachsens davongetragen.
Nachdem ich angefangen hatte, Sport zu treiben, verkürzte sich die Liste der von mir verabscheuten Lebensmittel ganz erheblich. Auch errötete ich nur noch selten, wenn ich mit einem Mädchen sprach. Es schien sich auch niemand mehr daran zu stören, dass ich ein Einzelkind war. Offenbar hatte ich diesen Fluch, zumindest äußerlich, abgeschüttelt.
Und ich lernte meine erste Freundin kennen.
Sie war keine ausgesprochene Schönheit. Gar nicht der Typ, der Mütter beim Anschauen eines Klassenfotos aufseufzen lässt und zu der Frage treibt: »Wer ist denn das? So ein hübsches Mädchen.« Doch ich fand sie, schon als ich sie das erste Mal sah, sehr süß. Auf Fotos war das nicht zu erkennen, aber in Wirklichkeit strahlte sie eine Wärme und Aufrichtigkeit aus, durch die sich alle auf ganz natürliche Weise zu ihr hingezogen fühlten. Sie war keine Schönheit, mit der man angeben konnte. Andererseits war ich, wenn ich es mir recht überlegte, auch nicht gerade ein toller Fang.
Wir gingen gemeinsam in die elfte Klasse. Unsere erste Verabredung war ein Doppel-Date, aber beim nächsten Mal trafen wir uns allein. Wenn ich mit ihr zusammen war, fühlte ich mich ungewöhnlich entspannt. In ihrer Gegenwart konnte ich unbefangen reden, und sie hörte mir immer interessiert zu. Ich redete über nichts Besonderes, aber sie lauschte stets aufmerksam und mit einer Miene, als verkünde ich weltbewegende Erkenntnisse. Es war das erste Mal, seit ich mich nicht mehr mit Shimamoto traf, dass ein Mädchen mir so konzentriert zuhörte. Und auch ich wollte alles über sie wissen. Jede Kleinigkeit. Was sie aß. Wie ihr Zimmer aussah. Und welche Aussicht sie von ihrem Fenster aus hatte.
Meine Freundin hieß Izumi – »Quelle«. »Was für ein schöner Name«, sagte ich bei unserem ersten Treffen. »Wenn man eine Axt hineinwirft, kommt eine Fee heraus.« Sie musste lachen. Izumi hatte eine drei Jahre jüngere Schwester und einen fünf Jahre jüngeren Bruder. Ihr Vater war Zahnarzt, sie hatten ein eigenes Haus und einen deutschen Schäferhund. Er hieß – unglaublich, aber wahr – Karl: nach Karl Marx. Izumis Vater war Mitglied der Japanischen Kommunistischen Partei. Sicher gibt es auf der Welt den einen oder anderen Zahnarzt, der Kommunist ist. Doch vermutlich würden sie alle zusammengenommen in vier oder fünf Bussen Platz finden. Dass ausgerechnet der Vater meiner Freundin einer von ihnen war, verwunderte mich ein wenig. Izumis Eltern spielten begeistert Tennis und zogen jeden Sonntag mit ihren Schlägern bewaffnet zum Tennisplatz. Ich fand es etwas merkwürdig, dass ein Kommunist so wild auf Tennis war, aber Izumi schien nichts dabei zu finden. Sie hatte keinerlei Interesse an der Japanischen Kommunistischen Partei, hing aber sehr an ihren Eltern und ging oft zum Tennis mit ihnen. Sie ermunterte mich, ebenfalls damit anzufangen, doch leider konnte ich mich nie für diesen Sport erwärmen.
Izumi beneidete mich um meinen Status als Einzelkind, denn sie konnte ihre Geschwister nicht leiden und hätte liebend gern auf sie verzichtet. Dickfellig seien sie und hoffnungslos verblödet. Am wohlsten fühlte sie sich, wenn sie nicht da waren. Schon immer wäre sie lieber ein Einzelkind gewesen. Dann hätte sie ungestört so leben können, wie es ihr gefiel.
Bei unserer dritten Verabredung küsste ich sie. An diesem Tag waren wir bei mir zu Hause. Meine Mutter war einkaufen gegangen, und Izumi und ich waren allein. Als ich mein Gesicht dem ihren näherte und meine Lippen auf ihre legte, schloss sie die Augen. Sie sagte kein Wort. Ich hatte mir ein Dutzend Ausreden zurechtgelegt, falls sie wütend werden oder sich wegdrehen würde, aber ich brauchte sie nicht. Als unsere Lippen sich trafen, legte ich die Arme um sie und zog sie näher an mich heran. Es war Spätsommer, und sie trug ein Kleid aus Seersucker-Stoff. Es hatte ein Band an der Taille, dessen Enden am Rücken wie Schwänze herunterhingen. Meine Hände berührten den Metallverschluss ihres BHs, und ich spürte ihren Atem an meinem Hals. Mein Herz schlug zum Zerspringen. Mein zum Bersten harter Penis drückte gegen ihren Oberschenkel, und sie rückte ein wenig zur Seite. Aber mehr auch nicht. Sie schien nichts Unnatürliches oder Empörendes daran zu finden.
So saßen wir eng umschlungen auf dem Sofa in unserem Wohnzimmer. Auf dem Sessel gegenüber kauerte unsere Katze. Sie warf einen Blick in unsere Richtung, räkelte sich stumm und schlief ein. Ich streichelte Izumis Haar und drückte meine Lippen auf ihre kleinen Ohren. Ich hatte das Gefühl, etwas sagen zu müssen, aber mir fiel kein einziges Wort ein. Wie sollte ich auch sprechen, wo ich schon kaum atmen konnte? Ich nahm ihre Hand und küsste sie noch einmal. Lange sagte sie nichts, und ich sagte auch nichts.
Nachdem ich Izumi zur Bahn gebracht hatte, war ich sehr aufgewühlt. Ich ging nach Hause, legte mich aufs Sofa und starrte an die Decke. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Irgendwann kam meine Mutter und sagte, es würde gleich Abendessen geben. Allerdings hatte ich nicht den geringsten Appetit. Wortlos zog ich mir die Schuhe an, verließ das Haus und irrte zwei Stunden durch die Straßen. Es war ein sonderbares Gefühl. Ich war nicht mehr allein, aber zugleich empfand ich eine nie gekannte, tiefe Einsamkeit. Wie jemand, der zum ersten Mal eine Brille trägt, konnte ich die Distanz zu den Dingen nicht mehr richtig einschätzen. Fernes schien zum Greifen nah, einstmals Verschwommenes wirkte glasklar.