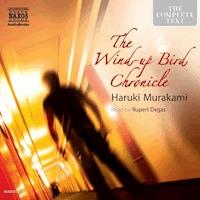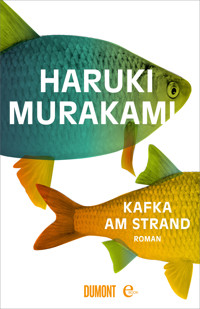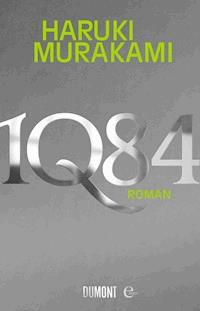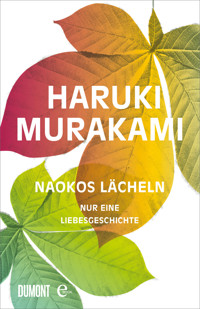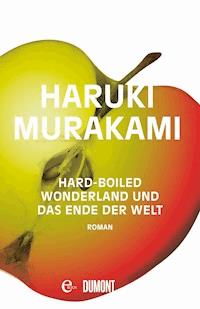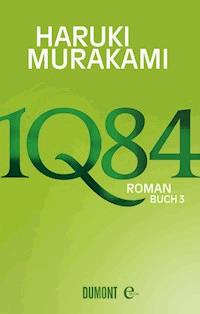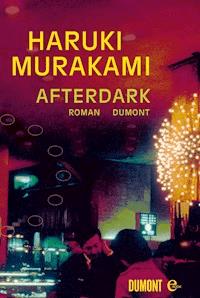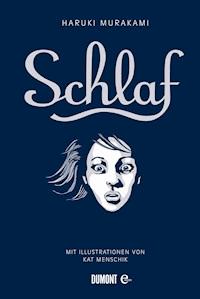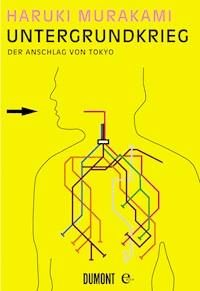
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Wenn das 20. Jahrhundert das Jahrhundert der Weltkriege war, so wird vielleicht das 21. Jahrhundert das Jahrhundert eines ›Untergrundkriegs‹ zwischen den ›verschlossenen Geistessystemen‹ und den ›offenen Geistessystemen‹ werden« Haruki Murakami ›Untergrundkrieg‹ untersucht die Vorgänge und Folgen eines Märztages des Jahres 1995, der als Tag wie jeder andere begann. Doch dann durchlöcherten in der Untergrundbahn einige Mitglieder der Aum-Sekte mit den Spitzen ihrer Regenschirme Plastikbeutel mit einer seltsamen Flüssigkeit. Zwölf Menschen starben durch die austretenden Sarin-Dämpfe, Tausende wurden verletzt. Haruki Murakami hat auf diese Tat geantwortet, in dem er mit Angehörigen der Toten, mit Überlebenden, aber auch mit Mitgliedern der Sekte sprach. Diese Porträts führen den Schrecken und die Verstörung, die Ungeheuerlichkeit und ihre Folgen dort vor, wo sie sich am überwältigendsten zeigen – beim einzelnen Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
HARUKI MURAKAMI
UNTERGRUNDKRIEG
DER ANSCHLAG VON TOKYO
Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe
Durchgesehene und aktualisierte E-Book-Ausgabe 2011 Der erste Teil erschien 1997 unter dem Titel Andaguraundo bei Kodansha, Tokyo, der zweite Teil 1998 unter dem Titel Yakusoku sareta basho de bei Bungeishunjusha, Tokyo.
© 1997, 1998 Haruki Murakami
Erste Auflage 2002
© 2002 für die deutsche Ausgabe: DuMont Literatur und Kunst Verlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Groothuis & Consorten
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN E-Book: 978-3-8321-8608-1
ERSTER TEIL
UNTERGRUND
Vorwort
Als ich eines Nachmittags am Tisch saß und in einer Zeitschrift blätterte, blieb mein Blick beim Überfliegen der Artikel zufällig an den Leserbriefen hängen. Ohne besonderen Grund, mehr zum Zeitvertreib begann ich zu lesen. Sonst schaue ich mir selten Frauenzeitschriften an, und die Leserbriefe interessieren mich meist gar nicht.
Einer der Briefe stammte von einer Dame, deren Mann infolge des Sarin-Anschlags in Tokyo arbeitslos geworden war.1 Er war Pendler und hatte das Pech gehabt, auf dem Weg zur Arbeit Opfer des Anschlags zu werden. Bewusstlos wurde er ins Krankenhaus eingeliefert und mehrere Tage dort behandelt. Unglücklicherweise blieben Beschwerden zurück, und er konnte den Anforderungen, die sein Beruf an ihn stellte, nicht mehr genügen. Anfangs zeigte man in seiner Firma noch Verständnis, doch mit der Zeit begannen seine Kollegen und Vorgesetzten gehässige Bemerkungen zu machen. Außerstande, die feindselige Atmosphäre zu ertragen, sah der Mann keinen anderen Ausweg, als zu kündigen.
Da ich jene Zeitschrift leider nicht mehr besitze, kann ich den Brief nicht wörtlich zitieren, aber ich habe den Inhalt noch ungefähr im Kopf.
Soweit ich mich erinnere, war der Brief frei von Larmoyanz. Er war auch keine wütende Anklage. Sein Tenor glich eher einem verhaltenen Murren. »Wie konnte so etwas überhaupt passieren …?« schien die Frau sich zu fragen, kopfschüttelnd und noch immer fassungslos angesichts des Unglücks, das so aus heiterem Himmel über ihre Familie hereingebrochen war.
Der Brief rüttelte mich auf. Ja wirklich, wie hatte so etwas nur geschehen können? Das Ehepaar litt unter einer tiefen seelischen Kränkung, und ich empfand starkes Mitgefühl für diese Menschen, obwohl mir natürlich klar war, dass mein Mitgefühl ihnen gar nichts nützte.
Andererseits – was hätte ich für sie tun können? Also seufzte ich nur und blätterte weiter, so wie es vermutlich die meisten taten, und wandte mich wieder meinem eigenen Leben und meiner Arbeit zu.
Einige Zeit später fiel mir der Brief wieder ein. Das »Warum?« ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Es blieb dort stehen wie ein großes Fragezeichen.
Nicht genug damit, dass der Mann unmittelbar Opfer des Sarin-Anschlags geworden war, er hatte auch noch unter sekundären Folgen in Form einer nachhaltigen gesellschaftlichen Diskriminierung zu leiden. Warum hatte man das nicht verhindern können? Immer häufiger dachte ich über diese Frage nach.
Mit Sicherheit konnte sich dieser bedauernswerte junge Angestellte keinen Reim darauf machen, warum man ihn quasi zum zweiten Mal attackierte und ihn als »den Typen von dem komischen Anschlag« bezeichnete. Vielleicht war ihm die Perspektive, die ihn von den anderen ausgrenzte – die Einteilung in »wir« und »der da« – nicht einmal bewusst. Wahrscheinlich hielt er sich allen äußeren Anzeichen zum Trotz noch immer für einen von »uns«.
Kurzum, ich wollte mehr über die Frau erfahren, die den Leserbrief geschrieben hatte. Und über ihren Mann. Persönlich. Ich wollte tiefer in die Motive und Strukturen der Gesellschaft eindringen, die diese doppelte Gewaltanwendung zuließ.
Nicht lange danach entschied ich mich, möglichst viele Opfer des Sarin-Anschlags zu befragen.
Die Interviews wurden über den Zeitraum eines Jahres von Anfang Januar bis Ende Dezember 1996 durchgeführt. Die von mir aufgenommenen Gespräche dauerten im Durchschnitt eineinhalb bis zwei Stunden. Mitunter kam es auch vor, dass ich mich bis zu vier Stunden mit einer Person unterhielt.
Anschließend wurden die Bänder komplett transkribiert. Selbstverständlich entstand auf diese Weise eine riesige Menge von Text. Wie bei einer normalen Unterhaltung üblich, drehten sich große Teile der Gespräche um Alltägliches. Daher haben wir redigiert, umgestellt und neu formuliert, soweit es nötig war, um die Lektüre zu erleichtern und ein Manuskript von normalem Buchumfang zu erstellen. Sooft ich beim Lesen der Transkription eine Auslassung entdeckte, habe ich mir das Band noch einmal angehört und fehlende Stellen ergänzt.
Nur eine einzige Person verweigerte den Mitschnitt unseres Gesprächs. Obwohl ich am Telefon darauf hingewiesen hatte, dass unsere Unterhaltung aufgezeichnet würde, behauptete die betreffende Person, als ich mein Tonbandgerät auspackte, sie sei darüber nicht unterrichtet worden. Daher verbrachte ich zwei Stunden damit, Namen und Zahlen mitzuschreiben, während ich das Gesagte verfolgte. Zu Hause angekommen, setzte ich mich sofort an den Schreibtisch, um alles aus dem Gedächtnis niederzuschreiben. Ich war selbst ganz beeindruckt von der menschlichen Gedächtnisleistung, die mich in die Lage versetzte, allein mit Hilfe einiger Notizen ein ganzes Gespräch zu reproduzieren. Für einen Reporter mag das eine ganz alltägliche Aufgabe darstellen, aber mir fiel es nicht leicht. Leider wurde mir schließlich doch nicht gestattet, das Gespräch ins Manuskript aufzunehmen, sodass die Mühe umsonst gewesen war.
Meine beiden Mitarbeiter, Setsuo Oshikawa und Hidemi Takahashi, halfen mir, die Interviewpartner ausfindig zu machen. Dabei bedienten wir uns zweier Methoden:
1. Wir durchforschten die Veröffentlichungen in den Medien nach Namenslisten von Opfern des Sarin-Anschlags.
2. Wir fragten überall herum, ob jemand eventuell Personen kenne, die den Anschlag miterlebt hatten.
Offen gestanden hatte ich mir dieses Unternehmen gar nicht so schwierig vorgestellt und sogar angenommen, es müsse leicht sein, Betroffene ausfindig zu machen, da es ja so viele gab. Nur verfügten die Behörden – die Polizei und die Justiz – über keine Liste der Anschlagsopfer, denn selbstverständlich musste die Privatsphäre der Betroffenen geschützt werden, sodass Außenstehenden die Namen nicht zugänglich waren. Das Gleiche galt auch für die Krankenhäuser. Wir hatten also nicht mehr als die Namen der Leute, die am Tag des Anschlags in den Zeitungen gestanden hatten. Nur die Namen, ohne Adressen oder Telefonnummern.
Als Erstes erstellten wir eine Liste mit 700 Namen, von denen nur zwanzig Prozent »identifiziert« werden konnten, denn es erwies sich als äußerst schwierig, Personen mit gängigen Namen wie beispielsweise »Ichiro Nakamura« ausfindig zu machen. Auch nachdem es uns gelungen war, mit etwa 140 Personen in Verbindung zu treten, lehnten viele ein Gespräch mit der Begründung ab, dass sie den ganzen Vorfall lieber vergessen, nichts mit der Aum-Sekte zu tun haben wollten oder den Medien im Allgemeinen misstrauten. Es war beinahe die Regel, dass Leute bei der bloßen Erwähnung der Presse oder des Namens eines Verlages auflegten. Schließlich erklärten sich von den 140 ermittelten Personen etwa vierzig Prozent zu einem Interview bereit.
Die Aum-Angst vieler Menschen ließ etwas nach, als die führenden Sektenmitglieder verhaftet worden waren. Dennoch weigerten sich noch immer viele mit der Begründung, ihre Aussage sei wertlos, da sie keine starken Vergiftungssymptome erlitten hätten. Andere wären zu einem Gespräch bereit gewesen, wurden aber von ihren Familien daran gehindert. Auch Mitteilungen von Angestellten des öffentlichen Dienstes oder aus dem Finanzwesen ergaben sich nicht.
Aus praktischen Gründen konnten weniger Frauen interviewt werden, da es sich als außerordentlich kompliziert erwies, sie anhand ihres Namens aufzuspüren. Hinzu kommt, dass sich junge unverheiratete Japanerinnen nur höchst ungern von Fremden befragen lassen. Allerdings erklärten sich auch einige Personen gegen den Willen ihrer Familien zu einem Gespräch bereit.
So konnten wir von den etwa 3800 Opfern nur etwa 60 befragen, und schon das erforderte viel Zeit und Hingabe.
Als wir die Interviews bearbeitet hatten, schickten wir die Manuskripte den einzelnen Gesprächspartnern noch einmal zur Durchsicht mit der Bitte, uns auf Punkte hinzuweisen, deren Veröffentlichung ihnen unangenehm sei. Die meisten der Angesprochenen baten auch wirklich um Änderungen, denen wir natürlich gewissenhaft nachgekommen sind. Häufig ging es dabei um Einzelheiten aus dem privaten Leben des Interviewten, um die es mir als Schriftsteller ganz besonders leid tat. Mitunter machte ich Alternativvorschläge und ließ sie von der betreffenden Person absegnen. Einige der Interviews wurden bis zu fünfmal hin- und hergeschickt. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, einer Ausbeutung der Privatsphäre der Interviewten durch die Massenmedien vorzubeugen. Unbedingt galt es zu vermeiden, dass sich jemand hintergangen fühlte. All dies nahm viel Zeit in Anspruch.
Insgesamt hatten wir 62 Interviews, aber wie bereits erwähnt, zogen zwei Personen im letzten Moment ihre Aussagen zurück. Es handelte sich um inhaltlich sehr profunde und wichtige Texte, sodass ich ihre Streichung aus dem Manuskript beinahe wie eine Amputation empfand, aber ich musste das Nein der Betreffenden akzeptieren. Von Anfang an hatten wir unsere Absicht beteuert, die Äußerungen unserer Gesprächspartner mit höchstem Respekt zu behandeln. Also hieß ein Nein eben wirklich nein.
Mit anderen Worten: Alle Ausführungen in diesem Buch sind vollkommen freiwillige Beiträge, und ich freue mich sagen zu können, dass die meisten der Beteiligten damit einverstanden waren, ihren richtigen Namen zu verwenden und damit ihren Worten umso größeres Gewicht zu verleihen: ihren Worten, ihrem Zorn, ihren Vorwürfen, ihren Leiden … Dies soll keinesfalls eine Herabsetzung derjenigen bedeuten, die sich aus persönlichen Gründen zu einem Pseudonym entschlossen haben.
Zu Beginn jedes Interviews habe ich meinen Gesprächspartnern Fragen zu ihrem persönlichen Hintergrund gestellt. Wo geboren, wo aufgewachsen, ihre Ausbildung, ihre Vorlieben, ihre Arbeit, ihre Familie usw. Besonders ausführlich habe ich mit ihnen meist über ihre Arbeit gesprochen. Auf diese Weise wollte ich jedem »Opfer« ein individuelles Gesicht geben, denn gesichtslos sollten diese lebendigen Menschen in meinem Buch auf keinen Fall werden. Vielleicht ist das eine Berufskrankheit von uns Schriftstellern, aber ich habe kein besonderes Interesse am so genannten »großen Ganzen«. Mich interessiert vor allem der konkrete, einzelne Mensch. Daher habe ich versucht, während des größten Teils der durchschnittlich zweistündigen Interviews möglicherweise auch unerhebliche Details zusammenzutragen, mit dem Ziel, den Lesern den Menschen, mit dem sie es zu tun haben, näher zu bringen. Aus diesem Grund konnten wiederum viele Details aus den Interviews am Ende nicht gedruckt werden.
Die Medien hatten die Öffentlichkeit mit unzähligen Profilen der »Attentäter« bombardiert und damit einen so widerspruchsfreien, verlockenden Mythos geschaffen, dass die Durchschnittsbürger – das heißt die »Opfer« – beinahe zur Nebensache geworden waren. Sie wurden auf die Rolle eines »Passanten A« reduziert, und nur sehr selten interessierte sich jemand für ihre Geschichte. Die wenigen Geschichten von Betroffenen, die bekannt wurden, entsprachen ausnahmslos einem Schema, das auf das Bild eines »unschuldigen japanischen Dulders« abzielte. Ein Schema funktioniert entschieden besser, wenn man es nicht mit konkreten Gesichtern zu tun hat, getreu dem klassischen Gegensatz zwischen »(gesichtsloser) gesunder Bevölkerung« und den »(konkreten) Schurken«.
Wenn irgend möglich, wollte ich jedes Schablonendenken vermeiden. Die Fahrgäste, die an jenem Morgen die U-Bahn bestiegen, hatten individuelle Gesichter, Leben, Familien, Freuden, Probleme, eine Geschichte und Widersprüche, die in ihrer Geschichte eine Rolle spielen sollten. Dazu musste ich unbedingt jeden Einzelnen von ihnen persönlich kennen lernen.
Erst wenn ich über diese individuellen Informationen verfügte, wollte ich zur Schilderung der Ereignisse am Tag des Anschlags übergehen. »Wie haben Sie diesen Tag erlebt?« »Was haben Sie gesehen, was gefühlt? Welche Erfahrung war damit für Sie verbunden?« Und auch: »Welche Schäden (physischer oder psychischer Natur) haben Sie durch den Sarin-Anschlag erlitten?« »Handelte es sich um Langzeitschäden, die eventuell noch andauern?«
Die Schwere der durch den Anschlag erlittenen Beeinträchtigungen war sehr unterschiedlich. Einige waren mit einem blauen Auge davongekommen, während andere Unglückliche gestorben waren oder noch immer wegen schwerwiegender gesundheitlicher Störungen in Behandlung sind. Zahlreiche Personen, die zunächst keine nennenswerten Symptome zeigten, haben seither eine posttraumatische Störung entwickelt.
Ich sprach auch mit Augenzeugen, die verhältnismäßig leicht verletzt worden waren und natürlich rascher in ihren Alltag zurückgefunden hatten, aber auch sie machten sich Gedanken, hatten ihre Ängste und ihre Lehren mitzuteilen. In dieser Hinsicht habe ich als Herausgeber keine Auswahl getroffen.
Schließlich wollte ich nicht auf die Aussage einer Person verzichten, weil sie nur leicht verletzt wurde. Für alle Zeugen war der 20. März ein einschneidender und schwerer Tag. Zudem hatte ich den Anspruch, ein durchschnittliches Bild aller Betroffenen zu zeigen, das sich nicht an der Schwere ihres Traumas orientierte. Ich möchte es Ihnen als Lesern überlassen, zuzuhören und sich ein Bild zu machen. Dabei werden Sie ohne Ihre Vorstellungskraft nicht auskommen.
Der Anschlag ereignete sich am Montag, den 20. März 1995, einem wunderschönen klaren Frühlingsmorgen. Es weht ein frischer Wind, und die meisten Leute sind in Mäntel gehüllt. Der Tag davor war ein Sonntag, der folgende ist ein Feiertag – Frühlingsanfang. Viele haben sich zwischen den beiden Feiertagen frei genommen, aber nicht alle hatten dieses Glück. Sie stehen auf, gehen ins Bad, ziehen sich an und machen sich auf den Weg zur U-Bahn, die genauso voll ist wie immer. Noch ist es ein Tag wie jeder andere. Bis in verschiedenen U-Bahnen fünf Männer mit den geschärften Spitzen ihrer Schirme ein paar mit einer sonderbaren Flüssigkeit gefüllte Plastikbeutel perforieren …
CHIYODA-LINIE
Zugnummer A 725 A
Die beiden Männer, die den Auftrag hatten, Sarin in einem Wagen der Chiyoda-U-Bahnlinie freizusetzen, hießen Ikuo Hayashi und Tomomitsu Niimi. Hayashi war der ausführende Täter, Niimi sein Gehilfe.
Warum Hayashi, ein erfahrener Arzt und wichtiger Mann im Ministerium für Wissenschaft und Technik der Aum-Sekte, mit dieser Aufgabe betraut wurde, ist unklar. Er selbst behauptet, es sei geschehen, um ihn zum Schweigen zu bringen, da natürlich nach einer Beteiligung an dem Anschlag kein Entkommen aus der Sekte mehr möglich war. Zu diesem Zeitpunkt war Hayashi bereits ein Mann, der zu viel wusste. Obwohl er dem Sektenführer Shoko Asahara zutiefst ergeben war, misstraute ihm dieser. Als Asahara ihm befahl, Sarin freizusetzen, habe Hayashi das Herz in der Brust zum Zerspringen geklopft. »Andererseits – wo sonst hätte es klopfen sollen?« fügte er hinzu.
Hayashi stieg um 7.48 in den ersten Waggon der aus Kita-Senju kommenden Chiyoda-Linie ein, die in Richtung Yoyogi-Uehara fuhr, durchstach an der Station Shin-Ochanomizu den Beutel mit dem Sarin und stieg aus. Niimi wartete vor dem Bahnhof in einem Wagen auf ihn, und gemeinsam fuhren sie zum Ajid in Shibuya zurück – ihre Mission war beendet. Hayashi hätte sich unter keinen Umständen weigern können. »Es ist nur eine Mahamudra«, versuchte er sich immer wieder selbst zu beruhigen. Die Mahamudra war in der Praxis der Aum-Sekte eine entscheidende Übung auf dem Weg, ein »Wahrhaft Erleuchteter Meister« zu werden.
Als Asaharas Rechtsberater Hayashi fragten, ob er sich überhaupt hätte weigern können, gab er zur Antwort: »Dann wäre es doch nie zu diesem Anschlag gekommen.«
Ikuo Hayashi wurde 1947 als zweiter Sohn eines praktischen Arztes in Shinagawa geboren, besuchte die Keio-Mittel- und Oberschule, um an der Keio-Universität, einer der beiden privaten Spitzenhochschulen in Tokyo, Medizin zu studieren. Anschließend arbeitete er als Herz- und Gefäßchirurg in der Keio-Universitätsklinik. Später wurde er Chefarzt der Abteilung für Herz- und Gefäßerkrankungen am Staatlichen Reha-Klinikum in Tokaimura, Präfektur Ibaragi, und gehörte damit einer gesellschaftlichen Elite an. Hayashi ist ein gut aussehender Mann mit scharfen Gesichtszügen und einem schütteren Haaransatz. Er strahlt das professionelle Selbstbewusstsein eines erfahrenen Arztes aus. Die medizinische Laufbahn schien seinem Naturell zu entsprechen. Wie bei den meisten Angehörigen der Aum-Führungsriege ist seine Haltung aufrecht und sein Blick geradeaus gerichtet. Seine Stimme klingt monoton und unnatürlich. Während seiner Aussage vor Gericht erweckte er den Eindruck eines Menschen, der mit großer Anstrengung ständig einem drohenden Gefühlsausbruch Einhalt gebieten muss.
Mitten in seiner glänzenden Karriere trat Hayashi der Aum-Sekte bei, kündigte 1990 seine Stelle und verließ seine Familie. Seine beiden Kinder sollten später eine besondere Ausbildung innerhalb der Sekte erhalten. Die Reha-Klinik wollte einen Mann von Hayashis Fähigkeiten nicht verlieren und versuchte ihn zurückzuhalten, aber er war fest entschlossen. Offenbar bedeutete ihm der Beruf des Arztes nichts mehr. Als Mitglied der Sekte wurde er von Asahara, der viel für Eliten übrig hatte, geschätzt und zum »Minister für Heilung« ernannt.
Nachdem Ikuo Hayashi mit der Ausführung des Anschlags beauftragt worden war, wurde er am 20. März in das Aum-Hauptquartier Satyam 7 in Kamikuishiki gebracht, wo er mit den vier anderen Attentätern probte, die Beutel mit dem Sarin zu durchstechen. Statt Sarin enthielten die Plastikbeutel, die mit Hilfe von eigens mit einer Schleifmaschine geschärften Schirmspitzen durchstoßen wurden, nur Wasser. Überwacht wurde das Manöver von Hideo Murai. Anscheinend hatten die anderen vier Sektenmitglieder Spaß an der Übung, während Hayashi ihr Verhalten eher distanziert beobachtete. Er durchstach auch seinen Übungsbeutel nicht. Dem achtundvierzigjährigen Arzt kam das Ganze eher wie ein albernes Spiel vor.
»Ich habe nicht geprobt. Vom Hinsehen wusste ich ja Bescheid, auch wenn ich mit dem Herzen nicht bei der Sache war«, sagte er bei der Verhandlung aus.
Nach dem Manöver fuhren alle fünf wieder mit einem Wagen in das Ajid in Shibuya zurück. Dort verteilte Hayashi mit Atropinsulfat gefüllte Spritzen an die Teams und gab die Anweisung, sie sich bei den ersten Anzeichen einer Sarin-Vergiftung zu setzen.
Auf dem Weg zum Bahnhof kaufte Hayashi in einem Supermarkt Handschuhe, ein Messer, Klebeband und ein Paar Sandalen. Niimi, sein Fahrer, besorgte Zeitungen – Seikyo Shimbun und Akahata2 –, um die Plastikbeutel mit dem Sarin darin einzuwickeln. Diese Blätter seien doch interessanter als Zeitungen, die man überall kaufen könne, scherzte er noch. Von den beiden Zeitungen entschied sich Hayashi für Akahata; die Publikation einer anderen Sekte wäre zu verdächtig und damit kontraproduktiv gewesen.
Ehe Hayashi in die Bahn mit der Nummer A 725 K stieg, legte er einen Mundschutz an.3 Als er eine Frau und ein Kind in der Bahn entdeckte, geriet Hayashis Entschluss vorübergehend ins Wanken. »Wenn ich das Sarin jetzt hier freisetze, ist die Frau so gut wie tot. Es sei denn, sie steigt noch aus«, überlegte er. Doch er war nun so weit gegangen, dass es kein Zurück mehr gab. Er kämpfte für die Wahrheit. Schwäche zu zeigen war etwas für Verlierer.
Als die Bahn sich Shin-Ochanomizu näherte, ließ er die Sarin-Beutel auf den Boden zu seinen Füßen fallen, fasste sich ein Herz und durchstach sie mit der Spitze seines Schirms. Er spürte den Widerstand, einen Widerstand, der mit einem leisen Zischen nachgab. Er stach mehrere Male zu, wie oft, weiß er nicht mehr. Allerdings hatte er nur einen der Beutel durchstochen, der andere war unversehrt geblieben.
Aber das Sarin aus dem einen Beutel lief vollständig aus und reichte, um großen Schaden anzurichten; in der Station Kasumigaseki starben zwei Bahnbeamte im Dienst bei dem Versuch, den Beutel zu entfernen. Der Zug A 725 K wurde an der nächsten Haltestelle Kokkai-Gijidomae – dem »Parlamentsplatz« – angehalten, alle Fahrgäste wurden evakuiert und die Wagen gereinigt.
Allein durch Hayashis Anschlag kamen zwei Menschen ums Leben und 231 wurden schwer verletzt.4
»Niemand behielt einen kühlen Kopf!«
Kiyoka Izumi (26)5
Frau Izumi stammt aus Kanazawa. Zurzeit arbeitet sie in der Werbeabteilung einer ausländischen Fluggesellschaft.
Nach ihrem Universitätsabschluss begann sie eine Tätigkeit bei der japanischen Bundesbahn (Japan Railways – JR), beschloss jedoch nach drei Jahren dort aufzuhören und arbeitet seit zwei Jahren für die Fluggesellschaft. Damit hat sie sich einen Kindheitstraum erfüllt. Obwohl ein Stellenwechsel zu einer Fluggesellschaft in Japan sehr schwierig ist und nur einem von 1000 Bewerbern um eine mittlere Anstellung gelingt, hat Frau Izumi es geschafft. Kurze Zeit später wurde sie Opfer des Sarin-Anschlags.
Sie fand ihre Arbeit bei JR, wie sie zugibt, eher uninteressant. Es gab zwar viele Fortbildungsmöglichkeiten, aber sie empfand den starken Einfluss der Gewerkschaft als bedrückend und mit ihrer Persönlichkeit nicht vereinbar. Zudem wünschte sie sich eine Stelle, bei der sie ihre Englischkenntnisse einsetzen konnte. Ihre Kollegen versuchten sie von ihrem Entschluss abzubringen, aber sie blieb fest. Während des U-Bahn-Anschlags erwies sich die Erste-Hilfe-Ausbildung, die sie bei JR erhalten hatte, als von unschätzbarem Wert.
Zur Zeit des Anschlags habe ich in Waseda gewohnt, aber die Wohnung war mir zu klein, und ich bin vor kurzem umgezogen.
Mein Arbeitsplatz befindet sich in Kamiyacho, und ich fuhr immer von Waseda mit der Tozai-Linie bis Otemachi, um in die Chiyoda-Linie nach Kasumigaseki umzusteigen. Von dort ist es mit der Hibiya-Linie nur eine Haltestelle bis Kamiyacho. Um halb neun fange ich an, sodass ich immer zwischen 7.45 und 7.50 aus dem Haus gehe, damit ich kurz vor halb neun da bin. Ich war immer eine der Ersten. Die meisten kommen erst um Punkt halb. Bei einem japanischen Arbeitgeber wird erwartet, dass man schon eine halbe oder sogar eine Stunde vor Arbeitsbeginn im Büro ist, aber bei ausländischen Firmen scheint jeder nach seinem eigenen Rhythmus anzufangen. Früh im Büro zu sein bringt keine besonderen Pluspunkte.
Ich stehe immer gegen 6.15 oder 6.20 auf. Meist frühstücke ich nicht und trinke nur schnell eine Tasse Kaffee. Die Tozai-Linie ist ziemlich voll, aber wenn man nicht gerade zur Spitzenzeit fährt, geht es. Probleme mit Grabschern hatte ich auch nie.
Ich bin sonst selten krank, aber am Morgen des 20. März fühlte ich mich nicht wohl. Mir war sogar ziemlich übel. Trotzdem machte ich mich auf den Weg und stieg in Otemachi in die Chiyoda-Linie um. »Also heute geht’s mir ja mies«, dachte ich und atmete tief durch. Plötzlich stockte mir irgendwie der Atem.
Ich war im ersten Wagen der Chiyoda-Linie. Wenn man in Kasumigaseki ankommt, ist man von dort am schnellsten am Durchgang zur Hibiya-Linie. Die Bahn war nicht besonders voll. Die Sitzplätze waren zwar so ziemlich alle besetzt, aber nur wenige Leute standen. Man konnte durch den ganzen Wagen sehen.
Ich stand ganz vorne an der Fahrerkabine und hielt mich an der Stange neben der Tür fest. Und als ich einatmete, verspürte ich – wie gesagt – plötzlich einen Schmerz. Nein, eigentlich keinen richtigen Schmerz. Eher blieb mir abrupt die Luft weg – als hätte ich einen starken Schlag erhalten. Ich hatte das grässliche Gefühl, mir würden die Eingeweide aus dem Munde quellen, wenn ich noch einen Atemzug täte. Um mich herum schien ein Vakuum zu herrschen. Ich schrieb das Gefühl meiner schlechten Verfassung zu, aber so elend hatte ich mich noch nie gefühlt. Ganz schlimm war das.
Dann – jetzt im Nachhinein klingt das etwas komisch – dachte ich, vielleicht sei mein Großvater gestorben. Mein Großvater lebte in Ishikawa und war damals 94. Er ist voriges Jahr gestorben. Weil ich wusste, dass er gerade eine Erkältung hatte, dachte ich, er sei vielleicht gestorben, und ich hätte es gespürt.
Kurz darauf kriegte ich wieder Luft. Aber als wir die Station Hibiya passierten, also eine Haltestelle vor Kasumigaseki, bekam ich einen furchtbaren Hustenanfall. Inzwischen hatten auch alle anderen Fahrgäste angefangen zu husten. Irgendetwas Seltsames war in diesem Zug im Gange. Alle waren jetzt sehr aufgeregt …
Als wir in Kasumigaseki ankamen, stieg ich aus, ohne mir groß Gedanken zu machen. Einige andere Fahrgäste stiegen auch aus und riefen dem Stationsvorsteher zu: »Kommen Sie schnell, hier stimmt was nicht« und holten ihn in den Wagen. Was dann passierte, habe ich nicht gesehen, aber der Stationsvorsteher war der Mann, der den Beutel mit Sarin raustrug und später gestorben ist.
Ich stieg also aus und machte mich auf den Weg zum Bahnsteig der Hibiya-Linie. An der Treppe hörte ich, wie der Alarm losging -Biiiiiiiieeeep! Aus meiner Zeit bei JR wusste ich sofort, dass es einen Unfall gegeben haben musste. Dann kam eine Ankündigung über Lautsprecher. Ich dachte gerade, »mach lieber, dass du hier rauskommst«, als ein Zug der Hibiya-Linie einlief.
Inzwischen konnte ich an der Aufregung der Bahnbeamten erkennen, dass es sich nicht um einen herkömmlichen Unfall handelte. Und der Zug war völlig leer, ohne einen einzigen Fahrgast. Ich habe erst später davon erfahren, aber in diesem Zug war auch Sarin freigesetzt worden. In Kamiyacho oder sonstwo war es zur Katastrophe gekommen, man hatte alle Fahrgäste evakuiert und den Zug nach Kasumigaseki geschickt.
Nach dem Alarmton kam die Anweisung: »Bitte, verlassen Sie unverzüglich den Bahnhof!«, und die Leute setzten sich in Richtung Ausgang in Bewegung. Mittlerweile fühlte ich mich immer mieser und wollte vor dem Verlassen des Bahnhofs lieber noch auf die Toilette gehen. Die Toiletten sind neben dem Büro des Stationsvorstehers.
Als ich am Stationsbüro vorbeiging, sah ich darin drei Bahnbeamte auf dem Boden liegen. Es musste einen tödlichen Unfall gegeben haben. Nachdem ich auf der Toilette gewesen war, ging ich zum Ausgang am Handelsministerium. Das alles hatte insgesamt etwa zehn Minuten gedauert. In der Zwischenzeit waren die verletzten Stationsbeamten aus dem Büro nach draußen gebracht worden. Was ich sah, als ich oben ankam und mich umschaute, kann ich nur als »die Hölle« beschreiben. Die drei Männer lagen auf dem Boden. Jemand hatte ihnen Löffel in den Mund gesteckt, damit sie nicht an ihren eigenen Zungen erstickten. Ungefähr sechs andere Bahnbedienstete waren bei ihnen, aber sie saßen nur weinend, die Köpfe in die Hände gestützt, zwischen den Blumenbeeten. Ein Mädchen heulte laut. Ich war sprachlos, konnte mir nicht erklären, was geschehen war.
Ich sagte zu einem der Beamten: »Ich habe früher bei JR gearbeitet. Ich weiß über den Umgang mit Notfällen Bescheid. Sagen Sie mir, was ich tun kann.« Aber der Mann stierte nur blicklos vor sich hin. »Ja, wir brauchen Hilfe«, sagte er abwesend. Also wandte ich mich an seine Kollegen, die dort saßen: »Jetzt ist keine Zeit zum Weinen.« »Wir weinen doch gar nicht«, antworteten sie. Aber damals hatte ich den Eindruck, dass ihnen aus Trauer über den Tod ihrer Kollegen die Tränen übers Gesicht liefen.
»Haben Sie die Ambulanz verständigt?« fragte ich. Sie hatten. Ich hörte auch tatsächlich die Martinshörner, aber sie schienen nicht auf uns zu zu kommen. Warum diese Station als letzte von den Rettungswagen angefahren wurde, weiß ich nicht, aber das war der Grund dafür, dass die Schwerverletzten so spät ins Krankenhaus gebracht wurden und zwei von ihnen starben.
Währenddessen drehte der Sender TV Tokyo die ganze Zeit. Neben uns stand ihr Wagen. Ich lief zu ihnen und sagte: »Das ist jetzt nicht der rechte Augenblick für so was. Bringen Sie bitte diese Leute mit Ihrem Wagen ins Krankenhaus.« Der Fahrer verhandelte kurz mit dem Team, und sie willigten ein.
Bei JR hatte ich immer einen roten Schal dabeigehabt, um im Notfall damit einem Zug ein Signal geben zu können. Das fiel mir ein, und ich rief: »Hat jemand vielleicht einen auffälligen Schal dabei?« Schließlich lieh mir jemand ein Taschentuch, das ich dem Fahrer gab. »Bringen Sie die Leute ins nächste Krankenhaus. Das ist ein Notfall, also drücken Sie die ganze Zeit auf die Hupe und fahren Sie einfach so zügig wie möglich weiter, auch wenn eine Ampel rot ist«, erklärte ich ihm.
An die Farbe des Taschentuchs kann ich mich nicht mehr erinnern. Es war irgendwie gemustert. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich ihm gesagt habe, er solle damit winken oder es an den Seitenspiegel knoten. Meine Erinnerung ist nicht ganz deutlich, weil ich ja selbst so aufgeregt war. Dann schafften wir Herrn Takahashi – den Bahnbeamten, der gestorben ist – und einen anderen auf den Rücksitz.
Als ich Herrn Toyoda später wiederbegegnete, schenkte er mir ein neues Taschentuch und sagte: »Ich habe Ihnen Ihr Taschentuch nicht wiedergegeben.« Als ihm auf dem Rücksitz schlecht geworden war, hatte er es benutzt.
Herr Takahashi hat, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch gelebt. Aber man konnte auf den ersten Blick sehen, dass er es nicht schaffen würde. Bis dahin hatte ich zwar noch nie jemanden sterben gesehen, aber man konnte es an seinem Gesicht erkennen. Er würde sterben. Trotzdem musste man ja irgendetwas für ihn tun.
»Bitte, kommen Sie doch auch mit«, bat mich der Fahrer, aber ich wollte nicht. Es wurden immer noch viele Leute heraufgebracht, um die sich jemand kümmern musste, also blieb ich. In welches Krankenhaus der Mann gefahren ist und was dann passiert ist, weiß ich nicht.
Ganz in meiner Nähe stand ein Mädchen, das weinte und am ganzen Körper zitterte. Ich ging zu ihr und versuchte sie zu beruhigen. Inzwischen war endlich ein Rettungswagen eingetroffen. Ich kümmerte mich nun um verschiedene Personen, die alle kalkweiß, ja schon fast farblos waren. Unter ihnen war auch ein älterer Mann, dem Schaum aus dem Mund floss. Ich hätte nie gedacht, dass ein Mensch so viel Schaum produzieren könnte. Ich knöpfte ihm das Hemd auf, löste seinen Gürtel und fühlte ihm den Puls, der ziemlich schnell ging. Ich sprach ihn mehrmals an, aber er war wohl bewusstlos.
Dieser ältere Mann war auch ein Stationsbeamter, aber weil er seine Uniformjacke ausgezogen hatte, habe ich das damals nicht bemerkt. Wegen seines bleichen Gesichts und seines schütteren Haares hielt ich ihn für einen älteren Fahrgast. Später erfuhr ich, dass es Herr Toyoda war, ein Kollege der beiden Beamten [Herr Takahashi und Herr Hishinuma], die ums Leben gekommen sind. Von den dreien auf dem Bahnsteig der Chiyoda-Linie ist er der Einzige, der überlebt hat. Er gehörte auch zu denen, die am längsten im Krankenhaus lagen.
Als der Krankenwagen kam, fragten mich die Sanitäter, ob er bei Bewusstsein sei. »Nein«, schrie ich, »aber sein Puls schlägt noch.« Sie legten ihm eine Sauerstoffmaske an und riefen: »Wir haben noch eine« – also eine Sauerstoffmaske. »Wir können noch jemanden mitnehmen.« Ich stieg in den Krankenwagen und inhalierte, und auch das zitternde, weinende Mädchen inhalierte längere Zeit. Mittlerweile war eine ganze Herde Journalisten eingefallen, die sich sofort auf das zitternde Mädchen stürzte. Die Ärmste war den ganzen Tag im Fernsehen.
Während ich mich um die Verletzten kümmerte, hatte ich mein eigenes Unwohlsein gar nicht gespürt. Erst als ich das Wort Sauerstoff hörte, fiel mir auf, dass ich selber komisch atmete. Aber ich kam noch nicht darauf, dass zwischen dem Vorfall und meinem Zustand eine Beziehung bestand. Ich war nicht verletzt. Deshalb hielt ich es für meine Pflicht, mich um die Opfer des Unfalls zu kümmern und zu helfen. (Was das für ein Unfall war, wusste ich nicht, aber auf jeden Fall musste es ein sehr schlimmer gewesen sein.) Weil mir, wie gesagt, schon morgens nicht besonders gut gewesen war, dachte ich, meine Beschwerden kämen daher.
Zufällig kam ein Kollege von mir vorbei, und wir entrissen das Mädchen den Fängen der Presse. Mein Kollege schlug vor, dass wir zusammen zu Fuß ins Büro gehen sollten, und ich war einverstanden. Von Kasumigaseki bis zu meiner Firma ist es etwa eine halbe Stunde zu Fuß. Beim Gehen fiel mir das Atmen schwer, aber ich musste mich nicht hinsetzen und ausruhen. Ich konnte einigermaßen normal gehen.
Als wir im Büro ankamen, hatten mich die Kollegen schon im Fernsehen gesehen und fragten: »Frau Izumi, fühlen Sie sich auch wirklich wohl?« Inzwischen war es schon nach zehn. Meine Kollegen meinten, ich sollte mich doch etwas ausruhen, aber ich hatte immer noch nicht begriffen, was passiert war, und machte mich an die Arbeit. Bald darauf kam die Nachricht aus der Personalabteilung: »Es scheint Giftgas gewesen zu sein. Kollegen, die sich unwohl fühlen, suchen bitte sofort ein Krankenhaus auf.« Inzwischen ging es mir wirklich immer schlechter. Also setzten sie mich an der Kreuzung Kamiyacho in einen Krankenwagen, der mich in das kleine Azabu-Hospital in der Nähe brachte. Etwa zwanzig Personen hatte man schon dort eingeliefert.
Etwa eine Woche lang litt ich unter erkältungsähnlichen Beschwerden. Ich hatte einen asthmaartigen Husten, und nach drei Tagen kriegte ich etwa 40 Grad Fieber. Ich dachte, das Thermometer sei kaputt – so schoss das Quecksilber in die Höhe. Eigentlich könnte meine Temperatur auch höher gewesen sein, denn das Quecksilber war ganz oben. Auf jeden Fall konnte ich mich nicht mehr rühren.
Auch als das Fieber schon gefallen war, wurde ich diesen asthmatischen Husten noch einen Monat lang nicht los. Das war die Wirkung des Sarins auf meine Bronchien, glaube ich. Es waren qualvolle, lange Hustenanfälle. Mitten in einem Gespräch ging es plötzlich los. In der Werbung muss man mit Leuten sprechen, und die Arbeit fiel mir unter diesen Umständen ziemlich schwer.
Außerdem träumte ich immer wieder die gleiche Szene. Das Bild der Bahnbeamten mit den Löffeln im Mund hatte sich in meinem Kopf festgesetzt und tauchte immer wieder in meinen Träumen auf. Ich sah unzählige Menschen auf dem Boden liegen – soweit das Auge reichte. Viele Male bin ich nachts mit diesem Bild vor Augen aufgewacht. Es war ziemlich beängstigend.
Wir waren genau vor dem Eingang des Ministeriums für Handel und Industrie. Menschen lagen mit Schaum vor dem Mund am Boden. Auf dieser Seite der Straße hatte man eine Szene wie aus der Hölle vor sich, doch auf der anderen Seite gingen die Leute zur Arbeit, als wäre nichts geschehen. Wenn ich, während ich jemanden versorgte, mal einen kurzen Blick nach drüben warf, sah ich, dass die Passanten herüberschauten und sich zu fragen schienen, was los sei, aber niemand ergriff die Initiative und überquerte die Straße. Als gehörten sie einer völlig getrennten Welt an. Alle gingen weiter, als gingen wir sie nichts an.
Ein paar Wachen vom Ministerium standen direkt vor unserer Nase. Drei sterbende Menschen lagen am Boden und warteten verzweifelt auf einen Rettungswagen, der nicht kam. Lange Zeit nicht kam. Doch niemand von den Leuten aus dem Ministerium hat Hilfe geholt. Nicht einmal ein Taxi haben sie gerufen.
Das Sarin wurde um 8.10 freigesetzt, das heißt, es dauerte über anderthalb Stunden, bis überhaupt ein Rettungswagen eintraf. Während dieser ganzen Zeit haben diese Leute uns uns selbst überlassen. Ab und zu wurde später im Fernsehen die Szene übertragen, wie der tote Herr Takahashi mit dem Löffel im Mund dalag. Für mich ein unerträglicher Anblick.
Murakami: Wenn Sie selbst zu den Leuten gehört hätten, die auf dem Weg zur Arbeit auf der anderen Straßenseite vorbeigingen, meinen Sie, Sie wären hinübergegangen, um sich um die Verletzten zu kümmern?
Ja, ich glaube schon. Ich hätte die Verletzten nicht einfach da liegen lassen. Auch wenn ich damit aus dem Rahmen gefallen wäre, wäre ich über die Straße gegangen. Um die Wahrheit zu sagen, ich hätte beim Anblick der ganzen Situation am liebsten laut losgeheult, aber ich riss mich zusammen. Es hätte ja keinen Sinn gehabt, auch noch zusammenzubrechen. Ich hatte den Eindruck, dass niemand da war, der einen kühlen Kopf behielt. Niemand, der sich um die Verletzten kümmerte. Alle starrten nur herüber und ließen uns im Stich. Deshalb musste ich etwas tun.
Ehrlich gesagt, empfinde ich weder besondere Wut noch Hass auf die Verbrecher, die das Sarin freigesetzt haben. Irgendwie kann ich diese Schlüsse nicht ziehen und bin vielleicht auch zu solchen Gefühlen nicht fähig. Eher bedrücken mich die Toten. Sie und ihre Familien, die dieses Leid ertragen müssen, das um so vieles größer ist als die Wut oder der Hass, die ich für diese Kriminellen aufbringen kann. Der Umstand, dass Mitglieder der Aum-Sekte die U-Bahn mit Sarin verseucht haben, ist für mich nicht ausschlaggebend. Ich denke nicht über die Täter nach.
Ich schaue mir auch nie Sendungen über Aum im Fernsehen an. Ich will sie nicht sehen. Ich gebe auch keine Interviews. Wenn es den Opfern und ihren Familien dient, dann spreche ich darüber, aber nur wenn es jemanden interessiert, was geschehen ist. Aber von der Presse möchte ich nicht belästigt werden.
Natürlich muss dieses Verbrechen streng bestraft werden. Vor allem der Gedanke an die Familien der Verstorbenen ist unerträglich. Was sollen sie denn jetzt machen …? Sie haben nichts davon, selbst wenn die Schuldigen zum Tode verurteilt werden. Vielleicht bin ich in Hinblick auf den Tod sehr sensibel geworden, weil direkt vor meinen Augen Menschen gestorben sind. Aber trotz allem finde ich, dass auch die schwerste Strafe für die Täter für die Familien kein Trost ist.
»Schon seit meiner Einstellung arbeite ich am Bahnhof Kasumigaseki, aber mir gefällt es hier auch am besten«
Masaru Yuasa (24)
Herr Yuasa ist viel jünger Herr Toyoda (vgl. Interview weiter hinten) oder der verstorbene Herr Takahashi. Er könnte ihr Sohn sein. Sein zerzauster Haarschopf und sein jungenhaftes, argloses Gesicht lassen ihn sogar noch jünger erscheinen.
Er ist in Chiba geboren und aufgewachsen. Da ein älterer Cousin von ihm bei der Bahn beschäftigt ist, begann sich Herr Yuasa dafür zu interessieren und besuchte die Fachoberschule Iwakura in Ueno, die für künftige Bahnbeamte die besten Voraussetzungen bietet. Ursprünglich wollte Herr Yuasa Fahrer werden und entschied sich für das Fach Maschinenbau. 1988 wurde er von der U-Bahn eingestellt und arbeitet seither an der Station Kasumigaseki, die ihm anscheinend richtig ans Herz gewachsen ist. Er macht den Eindruck eines aufrichtigen, unkomplizierten jungen Mannes, der seine täglichen Aufgaben mit einem praktischen Sinn für das Wesentliche erfüllt. Umso größer war sein Schock über den Giftgasanschlag.
Auf Anweisung eines Vorgesetzten half Herr Yuasa dabei, Herrn Takahashi, der auf dem Bahnsteig der Chiyoda-Linie zusammengebrochen war, auf einer Trage nach oben zu bringen. Dort wartete er auf den Krankenwagen, der aber erst sehr viel später eintraf. Er musste miterleben, wie Herrn Takahashis Zustand sich zusehends verschlechterte, ohne etwas für ihn tun zu können. Unglücklicherweise wurde Herr Takahashi nicht rechtzeitig behandelt und kam ums Leben. Herrn Yuasas Angst, Bestürzung und Zorn sind beinahe maßlos, was auch damit zusammenhängen könnte, dass sein Gedächtnis teilweise getrübt ist. Er hat selbst festgestellt, dass ihm einige Einzelheiten entfallen sind.
Derlei Gedächtnislücken erklären natürlich auch, dass Schilderungen derselben Szene häufig in Details voneinander abweichen. Herr Yuasa hat den 20. März wie folgt erlebt.
Auf der Oberschule hatten wir die Wahl zwischen den Zweigen Transportwesen und Maschinenbau. Viele von denen, die Transportwesen genommen haben, waren ganz schöne Streber. Hatten Fahrpläne in der Schreibtischschublade und so (lacht). Ich interessiere mich auch für die Bahn, aber irgendwie auf einer anderen Ebene. Es ist keine Manie bei mir, wissen Sie?
Eine Anstellung bei der Japanischen Bundesbahn (JR) war das begehrteste Ziel. Viele meiner Mitschüler wollten Superexpress-Fahrer werden. Als ich mit der Schule fertig war, hat JR mich abgelehnt, aber andere private Bahngesellschaften wie Seibu, Odakyu und Tokyu sind ja auch allgemein beliebt. Allerdings muss man, um von ihnen eingestellt zu werden, in einer Gegend wohnen, die an diesen Linien liegt. Und schon mal bei ihnen gejobbt haben. Ziemlich streng, was?
Von Anfang an wollte ich gerne in der U-Bahn arbeiten. Oder überhaupt bei einer U-Bahn-Gesellschaft. Außerdem zahlen die Bahnen im Vergleich zu anderen Firmen gar nicht schlecht.
Zur Arbeit auf einer U-Bahn-Station gehören viele Aufgaben. Nicht nur Fahrkartenverkauf, Bahnsteigaufsicht und so, auch die Betreuung von Fahrgästen, die etwas verloren haben. Manchmal muss man auch Streitigkeiten zwischen den Fahrgästen schlichten, also eine Menge verschiedener Dinge. Es war ganz schön anstrengend, das alles mit achtzehn plötzlich machen zu müssen. Deshalb kam mir meine erste volle Schicht auch unheimlich lange vor. Nach dem letzten Zug ließ ich die Rollläden mit einem Seufzer der Erleichterung runter: »Das war’s für heute.« Jetzt geht es mir nicht mehr so, das war nur am Anfang.
Am schlimmsten finde ich die Betrunkenen. Entweder sie wollen Freundschaft schließen, fangen Streit an oder kotzen alles voll. Kasumigaseki ist ja kein Vergnügungsviertel, deshalb kommt so was bei uns zum Glück eher selten vor, aber manchmal eben doch.
Murakami: Wollten Sie nicht ursprünglich Fahrer werden? Haben Sie eine Fahrprüfung abgelegt?
Nein, habe ich nicht. Ich hatte mehrmals die Gelegenheit und habe es auch erwogen, mich dann aber dagegen entschieden. Nach dem ersten Jahr gab es eine Prüfung für Fahrer, die viele gemacht haben, aber weil ich mich nach dem einen Jahr schon so an die Arbeit in der Station gewöhnt hatte, habe ich dann doch nicht teilgenommen. Wie gesagt, es gibt zwar Betrunkene und ein paar andere Sachen, die ich nicht mag, aber ich wollte trotzdem lieber noch eine Weile auf dem Bahnhof arbeiten. Wahrscheinlich hat sich mein Traum, Fahrer zu werden, durch die Arbeit auf dem Bahnhof allmählich verflüchtigt.
In Kasumigaseki treffen die drei Linien Marunouchi, Hibiya und Chiyoda zusammen. Jede hat ihr eigenes Personal. Ich war damals bei Marunouchi. Das Hibiya-Büro ist das größte, aber Marunouchi und Chiyoda haben auch ihre eigenen Dienst- und Personalräume.
Am Sonntag vor dem Sarin-Anschlag am 20. März schob ich eine volle Schicht für die Chiyoda-Linie. Sie hatten nicht genug Leute zur Verfügung, und ich bin eingesprungen. Über Nacht muss immer eine vorgeschriebene Anzahl von Personal anwesend sein. Damit das klappt, helfen wir gegenseitig aus, wie in einer Familie.
Um 23.30 lassen wir die Rollläden runter, schließen die Schalter, machen die Fahrkartenautomaten aus, waschen uns und machen gegen ein Uhr Schluss. Die frühere Schicht hört gegen 23.30 auf und schläft ab ca. 24.00. Die Frühschicht steht um 4.30 Uhr wieder auf und die spätere um 5.30. Die erste Bahn fährt um 5.00.
Wir stehen auf, waschen uns, ziehen die Rollläden hoch und öffnen die Fahrkartenschalter. Dann wechseln wir uns ab mit Frühstücken. Den Reis und unsere Misosuppe kochen wir selbst. Die Essensvorbereitung gehört zu unseren Pflichten. Wir essen alle am gleichen Tisch, wie man so sagt.
An dem Tag gehörte ich zur späteren Schicht. Also stand ich um halb sechs auf, zog meine Uniform an und war um 5.55 am Fahrkartenschalter. Ich arbeitete bis sieben und ging dann von sieben bis halb acht zum Frühstück. Danach hatte ich bis Viertel nach acht Dienst an einem anderen Schalter. Dann machte ich Schluss.
Als ich gerade auf dem Weg ins Büro war, kam mir Stationsvorsteher Matsumoto mit einem Putzlappen entgegen. »Was haben Sie denn vor?« fragte ich ihn. Er müsse einen Waggon reinigen, antwortete er. Weil ich sowieso fertig war und die Hände frei hatte, bot ich meine Hilfe an. Herr Matsumoto und ich fuhren mit der Rolltreppe hinauf zum Bahnsteig.
Dort trafen wir die Kollegen Toyoda, Takahashi und Hishinuma, die mit irgendwelchen durchweichten Zeitungen herumhantierten. Sie stopften sie mit den Händen in Plastiktüten. Aus ihnen troff eine Flüssigkeit auf den Boden, die Herr Matsumoto mit dem Lappen aufwischte. Weil ich keinen Lappen hatte und der größte Teil der Zeitungen schon in den Plastiktüten war, gab es nichts zu helfen. Ich stand dabei und sah zu.
Ich überlegte, was die Flüssigkeit wohl sein konnte, hatte aber keine Vorstellung. Es roch sehr stark nach irgendwas. Herr Takahashi ging zu einem Mülleimer am Ende des Bahnsteigs, wahrscheinlich, um noch mehr Zeitungen zum Aufwischen zu besorgen. Plötzlich brach er vor dem Mülleimer zusammen. Wir rannten alle zu ihm hin und riefen: »Was ist denn los?« Ich dachte, er wäre eben krank. Auf eine andere Idee bin ich damals gar nicht gekommen. »Können Sie gehen?« fragten die Kollegen, aber weil es nicht danach aussah, schickten wir über Funk nach einer Bahre.
Herr Takahashi sah furchtbar aus. Er konnte nicht sprechen. Wir legten ihn auf die Seite und lockerten seine Krawatte. Was hatte er nur Fürchterliches? … Er sah wirklich sehr krank aus.
Wir trugen ihn nach unten ins Stationsbüro und forderten einen Rettungswagen an. Ich fragte Herrn Toyoda, an welchen Ausgang der Krankenwagen kommen würde. Dafür gibt es Vorschriften, deshalb fragte ich. Aber Herr Toyoda lallte nur etwas. Das kam mir komisch vor, aber ich erklärte es mir so, dass er vor Aufregung nicht richtig sprechen konnte.
Jedenfalls rannte ich zum Ausgang A 11. Ja, bevor ich Herrn Takahashi hinauftrug, rannte ich erst mal selbst dorthin, um auf den Krankenwagen zu warten und ihm Zeichen zu geben. Vor dem Ministerium für Handel und Industrie.
Auf dem Weg zum Ausgang begegnete ich einem Beamten von der Hibiya-Linie. »Am Hibiya-Bahnhof in Tsukiji hat es anscheinend eine Explosion gegeben«, erzählte er mir. Mehr Einzelheiten wisse er nicht. Auch auf unserem Bahnhof war am 15. März ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. »Das ist vielleicht ein komischer Tag heute«, dachte ich, während ich am Ausgang A 11 auf den Rettungswagen wartete.
Aber kein Krankenwagen ließ sich blicken. Bald kamen auch andere Beamte aus dem Stationsbüro nach oben. »Immer noch kein Krankenwagen? Was sollen wir jetzt machen?« fragten sie. Wir beschlossen, Herrn Takahashi schon mal nach oben zu tragen. Ich war ja die ganze Zeit draußen, aber die zwei oder drei Leute aus dem Stationsbüro erzählten mir, dass inzwischen unten allen reihum schlecht wurde. Eigentlich wollten sie nicht wieder runter. Später kam dann ja raus, dass es am Inhalt dieser Plastikbeutel lag.
Aber Herr Takahashi musste auf jeden Fall nach oben gebracht werden. Also gingen wir alle noch einmal runter. Im Büro saß eine Dame, der auch schlecht war, auf dem Sofa an der Tür. Herrn Takahashis Bahre lag im Raum auf dem Boden. Er bewegte sich überhaupt nicht mehr, war wie erstarrt. Sein Zustand hatte sich sehr verschlechtert, und er war kaum noch bei Bewusstsein. Die Kollegen versuchten ihn anzusprechen, aber er reagierte nicht. Zu viert trugen wir ihn auf der Bahre nach oben.
Wir warteten und warteten, aber kein Rettungswagen. Wir wurden furchtbar unruhig. Warum kam er nicht? Inzwischen weiß ich, dass die ganzen Krankenwagen nach Tsukiji gefahren waren. Man hörte die Sirenen in der Ferne, aber keine kam in unsere Richtung. Ich wurde fast wahnsinnig, weil ich dachte, sie wären aus Versehen woandershin gefahren. Am liebsten wäre ich hingerannt und hätte »Hierher!« geschrien. Ich bin tatsächlich ein Stück in die Richtung gerannt, aus der die Sirenen heulten, dann wurde mir schwindlig … Ich bildete mir ein, ich hätte zu wenig geschlafen.
Als wir mit Herrn Takahashi auf der Trage oben am Ausgang ankamen, standen schon Journalisten dort. Eine Reporterin machte ein Foto nach dem anderen von Herrn Takahashi. Anscheinend auch von mir. Gereizt, weil der Krankenwagen nicht kam, schrie ich sie an: »Keine Fotos!« Ihr Assistent trat dazwischen, und ich sagte auch zu ihm: »Keine Fotos!« Andererseits ist es natürlich die Aufgabe von Fotografen, Fotos zu machen.
Dann kam ein Bus von einem Fernsehsender. Später habe ich erfahren, dass es TV Tokyo war. Jemand fragte mich, was passiert sei. Ob er von TV Tokyo war, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls war ich nicht in der Stimmung für ein Interview, solange der Krankenwagen nicht da war.
Mittlerweile war mir aufgefallen, dass die Leute vom Fernsehen einen großen Bus hatten. Also verhandelte ich mit ihnen: »Sie haben einen Wagen. Bitte, bringen Sie diesen Mann ins Krankenhaus.« Wahrscheinlich klang meine Stimme ärgerlich, aber ich weiß es nicht mehr, weil ich so aufgeregt war. Keiner wusste, was eigentlich los war, und es gab einiges Hin und Her. Sie waren nicht gleich einverstanden, und mit dem Palavern verging wieder Zeit.
Endlich klappten sie dann doch den Rücksitz runter, und wir legten Herrn Takahashi und noch einen anderen Angestellten [Herrn Ohori], dem es auch nicht gut ging, darauf. Er war die ganze Zeit mit Herrn Takahashi zusammen gewesen und hatte angefangen, sich zu übergeben, als er oben an die Luft kam. Herr Sawaguchi, ein weiterer Kollege von uns, fuhr auch mit.
»In welches Krankenhaus?« fragte der Fahrer, aber niemand wusste Bescheid. Also setzte ich mich auf den Beifahrersitz und dirigierte den Fahrer zum Hibiya-Krankenhaus, in das wir immer unsere Kranken schicken. Eine Frau sagte: »Halten Sie ein rotes Tuch oder so was aus dem Fenster, damit man weiß, dass es ein Notfall ist.« Später habe ich von Herrn Toyoda erfahren, dass sie früher bei JR beschäftigt war. Weil wir kein rotes Tuch hatten, gab sie uns ihr Taschentuch. Es war nicht rot, sondern irgendwie gemustert. Ich saß vorne und hielt den ganzen Weg bis zum Krankenhaus das Taschentuch aus dem Fenster.
Es war gegen neun, also ziemlich viel Verkehr. Inzwischen war ich total daneben von der ganzen Warterei auf den Krankenwagen, der nicht kam. Ich kann mich weder an das Gesicht des Fahrers noch an das von der Frau mit dem Taschentuch erinnern. Null. Ich hatte keine Zeit zu überlegen, was überhaupt geschehen war. Ich weiß nur noch, dass Herr Ohori sich auf dem Rücksitz übergeben hat.
Als wir ankamen, war das Krankenhaus noch nicht geöffnet. Ich erinnere mich nicht, um wie viel Uhr das genau war. Aber weil sie noch nicht offen hatten, war es vielleicht doch noch vor neun. Wir trugen Herrn Takahashi auf der Bahre zum Eingang, und ich ging an die Aufnahme und sagte, wir hätten einen Notfall. Dann ging ich wieder nach draußen und wartete bei Herrn Takahashi. Er rührte sich nicht mehr. Auch Herr Ohori war zusammengesunken und bewegte sich nicht. Aber vom Krankenhaus ließ sich niemand blicken. Anscheinend dachten sie, es sei wohl doch nicht so ernst. Ich war wohl ziemlich verwirrt gewesen und hatte keine genauen Angaben gemacht, nur gerufen: »Kommen Sie schnell. Es ist ein Notfall.« Jedenfalls warteten wir ewig, aber niemand kam.
Also ging ich wieder an die Aufnahme und rief mit lauter Stimme: »Bitte, kommen Sie doch! Es ist ernst!« Darauf kamen endlich ein paar Leute, die kapierten, dass der Zustand der beiden sehr kritisch war, und die sie sofort ins Krankenhaus trugen. Wie viel Zeit verstrichen war? Vielleicht zwei oder drei Minuten?
Herr Sawaguchi blieb an der Aufnahme, während ich mit dem Fahrer vom Fernsehen zurück zum U-Bahn-Ausgang A 11 fuhr. Inzwischen hatte ich mich etwas beruhigt, zumindest sagte ich mir dauernd, dass ich mich beruhigen müsste. Ich entschuldigte mich bei dem Fahrer dafür, dass Herr Ohori sich auf den Rücksitz erbrochen hatte, aber er wehrte ab. Erst jetzt schaffte ich es, eine einfache Unterhaltung zu führen. Ansonsten erinnere ich mich an kaum etwas.
Als wir ankamen, hatte man, glaube ich, Herrn Toyoda und Herrn Hishinuma nach oben gebracht, beide in völlig reglosem Zustand. Man versuchte sie mit Hilfe von Sauerstoffmasken und Brustmassagen wiederzubeleben. Um sie herum hockten Bahnpersonal und Fahrgäste vor dem Ministerium für Handel und Industrie. Noch niemand wusste, was überhaupt passiert war.
Endlich traf ein Rettungswagen ein. Ich kann mich nicht genau erinnern, aber ich glaube, Herr Toyoda und Herr Hishinuma wurden getrennt transportiert. Nur einer kam in den Krankenwagen, das heißt, der andere wurde vermutlich mit einem PKW befördert. Die beiden waren die Einzigen, die abgeholt wurden. Keine der anderen Personen befand sich in einem so kritischen Zustand.
Inzwischen hatte sich um den Ausgang A 11 eine Menschentraube gebildet. Viele Journalisten, Polizei, Feuerwehr. An die Menschenmenge erinnere ich mich noch gut. Die Medienleute waren in ihrem Element, hielten den Angestellten und Fahrgästen ihre Mikros vor die Nase, um sie zu interviewen. Zu diesem Zeitpunkt durfte man den Bahnhof wahrscheinlich schon nicht mehr betreten.
Nachdem alles ordnungsgemäß abgesperrt war, machte ich mich zu Fuß zum Hibiya-Krankenhaus auf. Im Foyer war der Fernseher eingeschaltet. Die Nachrichten berichteten über den Giftgasanschlag, und ich erfuhr, dass Herr Takahashi gestorben war. Durch einen laufenden Untertitel. »Ach«, dachte ich. »Es war zu spät, er hat es nicht geschafft …« Es tat mir furchtbar leid.
Mein eigener Zustand war nicht sehr ernst. Meine Pupillen waren verengt, und alles um mich herum wirkte dunkel. Ich hustete auch ein bisschen, aber nicht sehr. Sie hängten mich zur Sicherheit eine Weile an einen Tropf. Dabei konnte ich die ganze Zeit meine Kleider anbehalten. Ich bin wirklich gut davongekommen. Von allen Opfern, die in der Nähe waren, hatte ich die schwächsten Symptome. Vielleicht weil ich so früh schon draußen war. Herr Ohori war danach noch ewig im Krankenhaus.
Nach der Infusion ging ich mit ein paar Kollegen zum Bahnhof zurück. Wir setzten uns ins Dienstzimmer der Marunouchi-Linie und besprachen alles Mögliche. Es war schon Abend, bis ich endlich nach Hause kam. Ein langer Tag. Ich nahm mir den nächsten Tag frei. Am 22. März hatte ich wieder die 24-Stunden-Schicht.
Ehrlich gesagt, sind meine Erinnerungen an den Giftgasanschlag ziemlich lückenhaft. An die ein oder andere Einzelheit kann ich mich sehr deutlich erinnern, anderes ist ganz verschwommen. Vielleicht weil ich so aufgeregt war. Wie Herr Takahashi zusammengebrochen ist und wir ihn ins Krankenhaus gebracht haben, weiß ich noch genau. Alles andere ist undeutlich.
Ich war nicht besonders eng befreundet mit Herrn Takahashi. Er war der stellvertretende Stationsvorsteher und ich nur einer von den Jungen, also war unsere Stellung sehr unterschiedlich. Sein Sohn arbeitet auch bei der Bahn, an einer anderen Station, und ist etwa in meinem Alter. Herr Takahashi hätte also mein Vater sein können. Aber wenn ich direkt mit ihm sprach, habe ich den Altersunterschied nie so stark empfunden. Er war kein Mensch, der auf solchen Unterschieden bestand. Alle mochten ihn wegen seiner Gelassenheit. Gegenüber den Fahrgästen war er auch immer höflich und freundlich.
Der Anschlag hat mich nie so belastet, dass ich es nicht mehr aushalten konnte und mir gewünscht hätte, irgendwo anders zu arbeiten. Ich arbeite seit meiner Einstellung hier am Bahnhof Kasumigaseki. Ich habe zwar keine Vergleichsmöglichkeit, aber mir gefällt es hier irgendwie am besten.
»Da war Herr Takahashi noch am Leben«
Minoru Miyata (54)
Herr Miyata arbeitet seit sechs Jahren als Fahrer für TV Tokyo. Er verbringt oft viele Stunden in Bereitschaft, bis ein Auftrag hereinkommt und er die Ausrüstung für Außenaufnahmen so schnell wie möglich zum Ort des Geschehens transportieren muss. Er ist jedoch nicht fest angestellt. Oft geht es in seinem Beruf um Sekunden, und es kann auch vorkommen, dass er plötzlich von Tokyo nach Hokkaido fahren muss. Kein leichter Job.
Herr Miyata arbeitet seit 1965 als Fahrer. Schon als Kind hat er sich für Autos interessiert, und wenn er über sein Lieblingsthema spricht, leuchtet sein Gesicht förmlich auf. Er hatte kaum je einen Unfall, und auch Strafzettel sind für ihn eine Seltenheit. Als er die Opfer des Sarin-Anschlags ins Krankenhaus brachte, konnte er es jedoch nicht vermeiden, die eine oder andere Regel zu brechen.
Er ist in Tokyo geboren und aufgewachsen, ist verheiratet und hat ein Kind. Sein Alter von fast fünfundfünfzig sieht man ihm nicht an. Er spricht rasch, aber deutlich. Er entscheidet schnell, und seine Tatkraft hat bei dem Anschlag vielen geholfen.
Ich fahre einen Toyota-Bus (Hi-Ace). Auf der Seite steht groß der Name des Senders. Er ist mein Einsatzwagen. Die Teams wechseln öfter, aber der Bus bleibt immer der Gleiche, vollgepackt, bereit zum Ausrücken, wenn irgendwo etwas los ist. Regulär geht meine Arbeitszeit von 9.30 bis 18.00 Uhr, aber manchmal mache ich Überstunden oder werde mitten in der Nacht gerufen. Das kommt aber nicht so häufig vor.
Als Fahrer muss man Profi sein. Wenn ein anderer Sender schneller ist, gibt es Ärger. Ein Auto kann nur so schnell fahren, wie es eben fährt. Deshalb muss man, wenn man schnell sein will, die voraussichtlich weniger befahrene Route nehmen. In meiner Freizeit studiere ich gern Karten und Stadtpläne und versuche, mir die kleineren Straßen zu merken. Ich kenne die gesamte Region wie meine Westentasche und fast jeden Weg, auch wenn ich ihn das erste Mal fahre.
Beinahe jeden Tag passiert irgendetwas. Zu tun gibt es immer. Auf die faule Haut legen kann ich mich nicht (lacht).
Am 20. März waren wir ab 8.30 vor Ort. Eigentlich war ich mit einem Kameramann auf dem Weg nach Ueda gewesen. Es ging um Börsengeschäfte, aber da es sich nur um eine Recherche handelte, bestand keine Eile. Ich hatte vor, von der Kreuzung Kamiyacho geradeaus zur Kreuzung Showa-Dori zu fahren, aber an der ersten Kreuzung war schon der Teufel los. Ich überlegte, was denn los sein könnte, und fuhr langsamer, um zu schauen. »Kann passieren, dass sie uns hierher abkommandieren, bevor wir in Ueda ankommen«, meinte der Kameramann. Wir waren zu dritt im Wagen, der Kameramann, sein Assistent und ich. Also fuhren wir noch langsamer.
Kurz vor dem Shimbashi-Tunnel erreichte uns wie auf ein Stichwort der Anruf vom Sender, dass wir zur U-Bahn-Station Kasumigaseki fahren sollten, auf den Platz, wo die Ministerien sind: Außenministerium, Finanzministerium, Ministerium für Handel und Industrie, Ministerium für Fischerei und Ackerbau … Als wir dort ankamen, sahen wir, dass am U-Bahn-Ausgang vier oder fünf Bahnbedienstete in grünen Uniformen irgendwie verletzt waren. Zwei oder drei lagen ausgestreckt am Boden, und ein paar andere krümmten sich. Ein junger Stationsgehilfe schrie: »Schnell, rufen Sie einen Krankenwagen!«
Wir waren der erste Fernsehsender vor Ort. Es kam nur ein einziger Rettungswagen. Mehrere Leute wurden aus dem U-Bahnhof getragen. Daneben stand ein Polizist und bellte in sein Funkgerät: »Schnell, Krankenwagen hierher!« Aber weil inzwischen in Tsukiji und an verschiedenen anderen Orten Panik ausgebrochen war, schaffte es keine Ambulanz bis Kasumigaseki. Es wurden sogar normale Polizeiwagen eingesetzt, um die Opfer zu transportieren. Alle schrien durcheinander. Ikeda – so heißt der Kameramann – hat diese ganzen Szenen gedreht.
Da sprach uns jemand von den Verletzten an: »Wie wäre es, wenn Sie statt zu filmen jemanden ins Krankenhaus bringen würden?« Es klang vorwurfsvoll. Allerdings kamen ja auch keine Rettungswagen, und wir hatten den Bus, also sollten wir jemanden transportieren.
Wegen der Ausrüstung und anderer Erfordernisse geht das nicht so einfach, und wir drei mussten erst beratschlagen. Aber es wäre zu mies gewesen, die Verletzten einfach liegen zu lassen, und wir beschlossen, dass ich sie fahren sollte. Ich fragte den aufgeregten jungen Bahnbeamten, wohin wir sollten. »Ins Hibiya-Krankenhaus«, sagte er, was ich ein bisschen seltsam fand, denn das nähere wäre das Toranomon-Hospital gewesen. Später stellte sich dann heraus, dass das Hibiya irgendwie mit der U-Bahn-Gesellschaft verbunden ist.
Wir hatten natürlich kein Blaulicht, also setzte sich der junge Bahnbeamte auf den Beifahrersitz und hielt, während wir zum Hibiya-Krankenhaus fuhren, ein rotes Taschentuch aus dem Fenster. Das rote Taschentuch hatten wir von einer jungen Frau – vielleicht eine Krankenschwester – am Bahnhof geliehen. Sie sagte, wir sollten damit winken, damit man uns als Notfall erkennt. Im Wagen hatten wir den stellvertretenden Stationsvorsteher Herrn Takahashi, der dann gestorben ist, und noch einen Mann, dessen Namen ich nicht weiß. Auf jeden Fall auch ein U-Bahn-Beamter. Er war ungefähr dreißig und nicht so schwer verletzt wie Herr Takahashi. Immerhin konnte er selbständig in den Wagen steigen. Wir legten beide flach auf den Rücksitz.
Weil der junge Bahnbeamte ununterbrochen fragte: »Herr Takahashi, wie geht es Ihnen?« erfuhr ich den Namen des Mannes. Er war jedoch kaum bei Bewusstsein und konnte offenbar nicht sprechen, nur stöhnen. Unsere Ausrüstung hatten wir ausgeladen, für den Fall, dass sie gebraucht wurde.
Das Hibiya-Krankenhaus liegt in der Nähe vom Bahnhof Shimbashi, neben dem Hotel Daiichi. Es ist ein ziemlich großes Krankenhaus. Wir brauchten etwa drei Minuten, bis wir dort waren … Der junge Bahnbeamte hielt während der ganzen Fahrt das Taschentuch aus dem Fenster. Wir überfuhren sämtliche roten Ampeln und fuhren gegen die Fahrtrichtung durch Einbahnstraßen. Die Polizei hat uns gesehen, aber wir hatten freie Fahrt. Mir war bewusst, dass es um Leben und Tod ging.
Aber jetzt kommt’s. Stellen Sie sich vor: Das Krankenhaus ließ uns nicht rein. Eine Krankenschwester kam nach draußen. Obwohl wir ihr erklärten, dass die Verletzten im Bahnhof Kasumigaseki eine Gasvergiftung davongetragen hatten, sagte sie, es stünde kein Arzt zur Verfügung oder so etwas und ließ uns nicht vor. Ließ uns einfach auf der Straße stehen. Warum sie das getan hat, werde ich nie begreifen.
Der junge Bahnbeamte ging an die Aufnahme und flehte fast unter Tränen: »Bitte, er stirbt. Tun Sie doch etwas.« Ich war mit ihm drin. Da war Herr Takahashi noch am Leben. Seine Augenlider flatterten. Nachdem wir ihn aus dem Wagen gehoben hatten, legten wir ihn auf den Boden. Der andere Mann kauerte am Straßenrand. Uns war vor Wut das Blut in den Kopf gestiegen, aber wir warteten, ich weiß nicht mehr, wie lange, eine ganze Weile.
Endlich kam ein Arzt, und die beiden Verletzten wurden ins Gebäude gebracht. Um es kurz zu machen, sie hatten dort überhaupt keine Ahnung, was passiert war. Niemand hatte dem Krankenhaus mitgeteilt, dass Verletzte unterwegs waren, noch weniger, woher und weshalb. Die Ärzte tappten völlig im Dunkeln. Wussten nicht, was zu tun war. Inzwischen war es nach halb elf, das heißt, seit dem Anschlag war eine Ewigkeit vergangen. Und das Krankenhaus war nicht informiert, was passiert war. Wir hatten anscheinend die ersten Opfer des Anschlags gebracht.
Der junge Bahnbeamte tat mir richtig leid. Vor seinen Augen wurde über Leben und Tod seines Kollegen oder Vorgesetzten entschieden. Verzweifelt rief er immer wieder: »Schnell, schnell, bitte, untersuchen Sie ihn.« Ich war selbst so besorgt, dass ich noch über eine Stunde vor dem Krankenhaus herumstand. Als sich nichts tat, fuhr ich schließlich zurück zum Tatort. Seit damals bin ich nicht mehr im Hibiya-Krankenhaus gewesen, und den jungen Bahnbeamten habe ich auch nie wieder gesehen. Abends erfuhr ich, dass Herr Takahashi gestorben war. Das tat mir sehr leid. Ein Mensch, den ich gefahren hatte, war gestorben.
Ob ich zornig auf die Aum-Sekte bin? Nein, direkt zornig kann ich nicht sagen. Verständnislos eher. Was soll so was? Das ist doch absurd. Diese Leute behaupten, nur getan zu haben, was ihr Anführer Asahara ihnen gesagt hat, also auf Befehl gehandelt zu haben, aber trotzdem sind sie doch die Täter. Also müssen sie vor Gericht gestellt werden und mit der Todesstrafe rechnen.
Ich bin beruflich mehrmals in ihrem Hauptquartier in Kamikuishiki gewesen. Der größte Teil der Anhänger dort wirkte irgendwie weggetreten, so als fehle ihnen die Seele. Sie weinen nicht, und sie lachen nicht. Ausdruckslos wie No-Masken. Ich vermute, das kommt von der Gehirnwäsche. Aber die das Sagen haben, sind anders. Die haben sehr wohl einen Ausdruck, die denken auch. Sie lachen, sie weinen. Bei denen gab’s keine Gehirnwäsche. Sie haben die Anweisungen gegeben. Sie haben sich mit Asahara zusammengetan, um ihren »Höchsten Staat« zu errichten. Für sie gibt es keine Rechtfertigung und keine Entschuldigung. Vielleicht wäre es am besten, alle Drahtzieher zum Tode zu verurteilen?