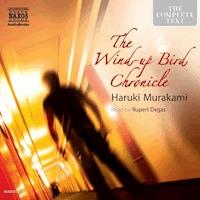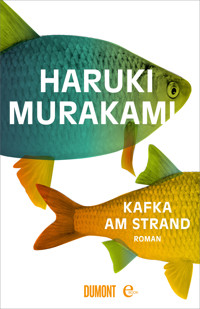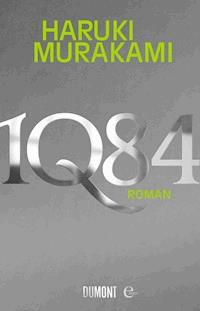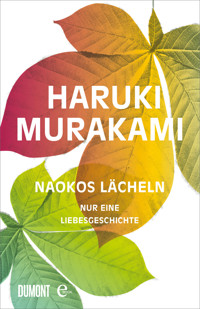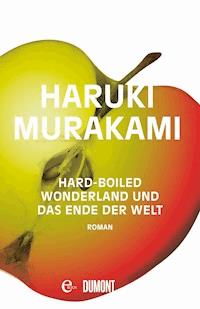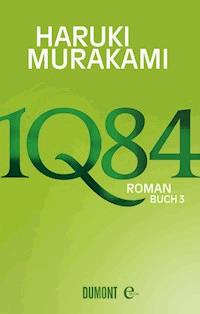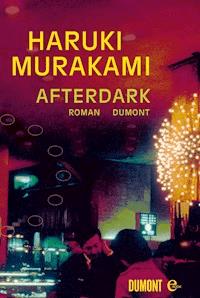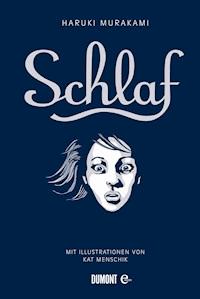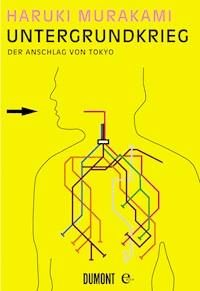8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Kurzum, es ging um eine Leidenschaft von monumentalen Ausmaßen.« Cooler Realismus und Fantastik verbinden sich in der Geschichte von Sumire und Miu. Die eine ist eine junge weltfremde und romantische Möchtegernautorin, die andere eine siebzehn Jahre ältere erfolgreiche Geschäfsfrau. Unempfänglich ist Miu für das Begehren der jungen Frau, von der sie »süßer Sputnik« genannt wird. Auf einer Reise durch Frankreich und Italien bis auf eine kleine griechische Insel verschwindet Sumire plötzlich – alle Spuren ihres Schicksals verlieren sich. Ein junger Lehrer, der die betörende Sumire liebt, findet Aufzeichnungen bizarrer Vorfälle und Geschichten in Geschichten, die auch ein Geheimnis von Miu aufdecken. Mit Haruki Murakamis neuem Roman ›Sputnik Sweetheart‹ geraten wir an die Ränder der Wirklichkeit, aber auch wenn die Menschen auf getrennten Umlaufbahnen einsam wie ein Sputnik ihre Bahnen ziehen, gibt es noch eine andere Seite des Lebens: »Wir brauchen nur zu träumen.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
HARUKI MURAKAMI
SPUTNIK SWEETHEART
ROMAN DUMONT
AUS DEM JAPANISCHEN
VOLLSTÄNDIGE EBOOK-AUSGABE DER IM DUMONT BUCHVERLAG ERSCHIENENEN TASCHENBUCHAUSGABE 3. AUFLAGE 2014 ALLE RECHTE VORBEHALTEN © 1999 HARUKI MURAKAMI DIE JAPANISCHE ORIGINALAUSGABE ERSCHIEN 1999 UNTER DEM TITEL ›SUPŪTONIKU NO KOIBITO‹ BEI KODANSHA LTD., TOKIO © 2002 FÜR DIE DEUTSCHE AUSGABE: DUMONT BUCHVERLAG, KÖLN UMSCHLAG: LÜBBEKE NAUMANN THOBEN, KÖLN UMSCHLAGABBILDUNG: © RUTH BLACK – FOTOLIA.COM
SPUTNIK SWEETHEART
1
Im Frühling ihres zweiundzwanzigsten Lebensjahres verliebte sich Sumire zum allerersten Mal. Heftig und ungezügelt, wie ein Wirbelsturm über eine weite Ebene rast, fegte diese Liebe über sie hinweg. Ein Sturm, der alles niedermäht, vom Boden fegt und hoch in die Lüfte schleudert, wahllos in Stücke reißt, wütet, bis kein Ding mehr auf dem anderen ist. Ohne in seiner Kraft auch nur für einen Augenblick nachzulassen, braust er über die Meere, legt Angkor Wat erbarmungslos in Schutt und Asche, setzt einen indischen Dschungel mitsamt seinen bedauernswerten Tigern in Brand und begräbt als persischer Wüstenwind eine orientalische Festungsstadt im Sand. Kurzum, es ging um eine Leidenschaft von monumentalen Ausmaßen. Sumires Liebe war siebzehn Jahre älter als sie und verheiratet. Überdies, so sollte man hinzufügen, handelte es sich um eine Frau. Der Ort, an dem die Geschichte beginnt, ist zugleich der Ort, an dem (fast) alles zu Ende ging.
Damals kämpfte Sumire verbissen darum, Romanschriftstellerin zu werden. Von all den Möglichkeiten, die das Leben eventuell für sie bereithielt, kam für sie einzig und allein die Laufbahn einer Schriftstellerin in Betracht. Ihr Entschluss stand felsenfest. Kompromisse ausgeschlossen. Zwischen Sumire und ihrer unerschütterlichen Hingabe an die Literatur hätte nicht einmal ein Haar Platz gefunden.
Nachdem Sumire ein staatliches Gymnasium in Kanagawa absolviert hatte, schrieb sie sich im Fachbereich Geisteswissenschaften einer hübschen kleinen Privatuniversität in Tokyo ein. Leider war die Uni überhaupt nicht nach ihrem Geschmack. Sie empfand den Unterricht als fantasielos und lau und war zutiefst enttäuscht. Die Mehrheit ihrer Kommilitonen war für sie hoffnungslos langweilig und mittelmäßig (was leider auch auf mich zutrifft), und sie verließ die Uni abrupt noch vor Ende des Grundstudiums, denn jeder weitere Tag erschien ihr wie reine Zeitverschwendung. Ich hielt ihre Entscheidung für richtig, gestatte mir jedoch den etwas banalen Einwand, dass in unserem unvollkommenen Dasein auch Überflüssiges seine Berechtigung hat. Würde man aus einem ohnehin unvollkommenen Leben auch noch alles Überflüssige streichen, bliebe wohl nicht mehr viel davon übrig.
Mit anderen Worten, Sumire war eine hoffnungslose Romantikerin, eigensinnig und zynisch, und, gelinde gesagt, ziemlich weltfremd. Wenn sie einmal angefangen hatte zu reden, war sie nicht mehr zu bremsen, aber wenn ihr jemand nicht in den Kram passte (was auf den größten Teil der Menschheit zutraf), bekam sie den Mund nicht auf. Sie rauchte zu viel und verlor auch bei kürzesten Bahnfahrten unweigerlich ihre Fahrkarte. Da sie vor lauter Nachdenken zuweilen das Essen vergaß, war sie mager wie die Kriegswaisen in alten italienischen Spielfilmen und bestand fast nur aus unstet umherwandernden Augen. Da sie es hasste, fotografiert zu werden, und nicht den geringsten Wunsch verspürte, der Nachwelt ein Porträt der Künstlerin als junge Frau zu hinterlassen, besitze ich nicht eine einzige Fotografie von ihr. Was schade ist, denn ein Foto von Sumire aus jener Zeit wäre zweifellos ein außergewöhnliches Zeugnis menschlicher Individualität.
Doch ich will der Reihe nach erzählen. Sumires große Liebe hieß Miu. Alle nannten sie so, sodass ich ihren richtigen Namen nicht kenne (woraus mir später einige Schwierigkeiten erwuchsen, aber ich will nicht vorgreifen). Eigentlich war Miu Koreanerin, das heißt, sie hatte die koreanische Staatsbürgerschaft, sprach aber kaum ein Wort Koreanisch, bis sie mit Mitte zwanzig anfing, es zu lernen. Sie war in Japan geboren und aufgewachsen, und da sie an einem Konservatorium in Frankreich studiert hatte, sprach sie neben Japanisch auch fließend Französisch und Englisch. Sie kleidete sich stets makellos und elegant, trug dezente, aber teure Accessoires und fuhr einen zwölfzylindrigen marineblauen Jaguar.
Als Sumire und Miu sich zum ersten Mal begegneten, sprachen sie über Jack Kerouac, für den Sumire gerade schwärmte. Sie wechselte ihre literarischen Idole mit schöner Regelmäßigkeit, und damals war es eben der ein wenig aus der Mode gekommene Kerouac. Sie trug ständig eine Ausgabe von Unterwegs oder Lonesome Traveller in der Jackentasche bei sich und blätterte bei jeder Gelegenheit darin. Passagen, die sie ansprachen, unterstrich sie und lernte sie auswendig wie heilige Sutren. In ihrer Lieblingsepisode aus Lonesome Traveller verbringt Kerouac drei einsame Monate als Brandwache in einer Hütte auf einem hohen Berg. Folgende Zeilen gefielen Sumire am besten:
»Kein Mensch sollte durch das Leben gehen, ohne sich einmal der gesunden, ja langweiligen Einsamkeit auszusetzen, einer Situation, in der er allein auf sich selbst angewiesen ist und dadurch seine wahre und verborgene Stärke kennenlernt.«
»Ist das nicht einfach toll?« sagte sie. »Jeden Tag auf einem Berggipfel zu stehen und einen Ausblick von dreihundertsechzig Grad zu haben. Aufpassen, dass nirgends schwarzer Rauch aufsteigt, und das war’s. Mehr hast du den ganzen Tag nicht zu tun. Danach kannst du lesen, schreiben, machen, was du willst. Und nachts streichen riesige Zottelbären um deine Hütte. Das ist das Leben, das ich mir erträume. Im Vergleich dazu ist ein Literaturstudium wie auf einem bitteren Gurkenende herumzukauen.«
»Das Problem ist nur, dass man irgendwann wieder von dem Berg runterkommen muss«, wandte ich ein. Aber wie üblich machten meine prosaischen und banalen Ansichten keinen großen Eindruck auf sie.
Sumire wünschte sich nichts sehnlicher, als so wild, so cool und ungehemmt zu sein wie eine Figur von Kerouac. Die Hände in die Taschen gestemmt, die Haare absichtlich zerzaust, starrte sie durch eine schwarz gerahmte Sonnenbrille à la Dizzy Gillespie, die ihr Sehvermögen nicht gerade steigerte, betont unbeteiligt in den Himmel. Fast immer trug sie ein viel zu großes Tweedjackett, das sie bei einem Trödler erstanden hatte, und Bauarbeiterstiefel. Am liebsten hätte sie sich vermutlich noch einen Bart stehen lassen.
Mit ihren eingefallenen Wangen und dem etwas zu breit geratenen Mund konnte man Sumire nicht im landläufigen Sinne als hübsch bezeichnen. Sie hatte eine zierliche Himmelfahrtsnase, ein ausdrucksvolles Gesicht und viel Sinn für Humor, obwohl sie so gut wie nie laut lachte. Sie war nicht groß, aber ihre Stimme klang, selbst wenn sie guter Laune war, immer irgendwie aggressiv. Einen Lippen- oder Augenbrauenstift hatte sie wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben noch nie in der Hand gehabt. Ich frage mich, ob sie überhaupt wusste, dass es BHs in verschiedenen Größen gab. Dennoch hatte Sumire etwas Besonderes an sich, das einen anzog. Worin dieses Besondere bestand, kann ich nicht mit Worten beschreiben, aber sooft ich ihr in die Augen sah, leuchtete es mir entgegen.
Am besten gebe ich es gleich zu: Ich war in Sumire verliebt. Schon nach unserer ersten Begegnung fühlte ich mich in ihrem Bann, und irgendwann gab es kein Zurück mehr. Lange Zeit existierte nur Sumire für mich. Natürlich nahm ich unzählige Male Anlauf, ihr meine Gefühle zu offenbaren, konnte aber in ihrer Gegenwart nie die richtigen Worte finden. Vielleicht war das im Endeffekt für mich nicht die schlechteste Lösung, denn sie hätte mich aller Wahrscheinlichkeit nach doch nur ausgelacht.
Während ich mit Sumire befreundet war, traf ich mich mit zwei, drei anderen Mädchen (was nicht heißen soll, dass ich die Zahl nicht mehr genau wüsste. Ob es zwei oder drei waren, hängt einzig davon ab, wie man zählt). Würde ich die Mädchen, mit denen ich nur ein- oder zweimal geschlafen habe, mitzählen, wäre die Liste etwas länger. Wenn ich mit einem Mädchen zusammen war, dachte ich meist an Sumire. Zumindest war sie in irgendeinem Winkel meines Gehirns immer präsent. Natürlich war das nicht richtig, aber es ging dabei ja auch nicht um Kategorien wie richtig oder falsch.
Doch zurück zu der Geschichte, wie Sumire und Miu einander kennen lernten.
Miu hatte den Namen Jack Kerouac schon gehört und erinnerte sich vage, dass er ein Autor war. Aber um wen es sich genau handelte, wusste sie nicht mehr. »Kerouac, Kerouac… war das nicht so ein Sputnik?«
Sumire verstand nicht, was sie meinte, und hielt beim Essen inne, um einen Moment lang zu überlegen. »Sputnik? Sputnik hieß doch dieser Satellit, den die Sowjets 1950 in den Weltraum geschossen haben. Jack Kerouac ist ein amerikanischer Schriftsteller. Ist aber ungefähr die gleiche Zeit, oder?«
»Aber hat man diese Schriftsteller nicht auch so genannt?« fragte Miu und ließ ihre Fingerspitze auf dem Tisch kreisen, als suche sie in einem Gefäß nach einer ganz bestimmten Erinnerung.
»Sputnik?«
»Ja, der Name dieser literarischen Bewegung. Sie wissen schon, diese Gruppen. Wie die ›Weiße Birke‹ in Japan.«
Endlich dämmerte es Sumire. »Beatnik!«
Miu tupfte sich mit ihrer Serviette den Mund ab. »Beatnik, Sputnik – solche Sachen kann ich mir nie merken. Wie die Kemmu-Restauration oder den Vertrag von Rapallo – was eben vor Urzeiten passiert ist.«
Einen Augenblick herrschte ein schwereloses Schweigen, in dem die Zeit wie ein Lufthauch vorüberstrich.
»Der Vertrag von Rapallo?« fragte Sumire.
Miu lächelte. Ein wehmütiges, ungekünsteltes Lächeln, wie nach langer Zeit aus einer halb vergessenen Schublade gezogen. Reizend, wie ihre Augen sich dabei verengten. Dann streckte sie die Hand aus und zerzauste mit ihren fünf langen schlanken Fingern Sumires verstrubbeltes Haar noch ein bisschen mehr. Die Geste war so natürlich und spontan, dass Sumire unwillkürlich zurücklächelte.
Seit dieser Zeit nannte Sumire Miu insgeheim ihren »süßen Sputnik«. Sumire liebte dieses Wort, das in ihr das Bild des künstlichen Satelliten heraufbeschwor, der im Dunkel des Weltalls lautlos seine Bahnen zog, und das der Hündin Laika, wie sie mit schwarzen glänzenden Knopfaugen durch das winzige Bullauge spähte. Was es für einen Hund wohl in der grenzenlosen Leere des Weltalls zu sehen gab?
Zugetragen hatte sich die Sputnik-Geschichte in einem vornehmen Hotel in Akasaka auf der Hochzeitsfeier einer von Sumires Cousinen. Keiner Cousine, die sie besonders mochte (eher im Gegenteil). Überdies waren Hochzeiten für Sumire eine wahre Tortur, aber sie hatte sich nicht drücken können. Sie saß mit Miu an einem Tisch. Miu erwähnte es nur beiläufig, aber anscheinend hatte sie Sumires Cousine Klavierunterricht gegeben oder ihr sonst irgendwie beigestanden, als diese sich auf die Aufnahmeprüfung zum Musikstudium vorbereitete. Obwohl es sich also weder um eine lange noch um eine besonders enge Bekanntschaft handelte, hatte Miu sich offenbar verpflichtet gefühlt, an der Hochzeitsfeier teilzunehmen.
In dem Augenblick, als Miu ihr Haar berührte, verliebte sich Sumire – man könnte fast sagen: reflexartig – in sie. Als hätte sie beim Überqueren eines Feldes jäh der Blitz getroffen, kam diese Liebe über sie wie eine künstlerische Offenbarung. Daher fand Sumire es auch nicht seltsam, dass es sich bei dem Objekt ihrer Begierde um eine Frau handelte.
Soweit ich weiß, gab es nie jemanden, den man als Sumires Liebhaber hätte bezeichnen können. In der Schulzeit hatte sie hin und wieder einen Freund gehabt, mit dem sie ins Kino oder zum Schwimmen ging. Dennoch hatte ich nie den Eindruck, dass diese Beziehungen ihr etwas bedeuteten. Den größten Raum in Sumires Gefühlsleben beanspruchte eine Leidenschaft für den Schriftstellerberuf, wie sie sie mit Sicherheit keinem Mann entgegenbrachte. Falls sie in ihrer Schulzeit sexuelle Erfahrungen (oder etwas Ähnliches) gemacht hatte, waren diese gewiss weniger von Verlangen oder Liebe bestimmt gewesen als von literarischer Neugier.
»Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht mal richtig, was Sexualität bedeutet«, sagte Sumire einmal mit todernstem Gesicht zu mir (kurz bevor sie ihr Studium abbrach, glaube ich. Sie hatte fünf Banana-Daiquiri intus und war ziemlich beschwipst.) »Wie es dazu kommt und so. Was hältst du davon?«
»Sexualität hat nichts mit Verstehen zu tun«, erklärte ich altklug. »Sie ist einfach da.«
Sumire musterte mich zuerst, als wäre ich eine von einer seltenen Energie getriebene Maschine, und schaute dann desinteressiert zur Decke. Damit war das Gespräch beendet. Wahrscheinlich hatte sie es als zwecklos erkannt, mit mir über solche Dinge zu diskutieren.
Sumire war in Chigasaki geboren. Ihr Elternhaus lag so nah am Meer, dass der Wind manchmal mit einem trockenen, knirschenden Geräusch den Sand gegen die Fensterscheiben peitschte. Ihr Vater, ein ausgesprochen gut aussehender Mann, dessen wohlgeformte Nase an Gregory Peck in Ich kämpfe um dich erinnerte, hatte eine Zahnarztpraxis in Yokohama. Zu ihrem Bedauern hatte Sumire diese Nase nicht geerbt. Und ihr Bruder auch nicht. Zuweilen fragte sie sich, was mit den Genen passiert war, die diese einmalig schöne Nase hervorgebracht hatten. Falls sie wirklich unwiederbringlich auf dem Grund des Genpools versunken waren, konnte man das durchaus als kulturellen Verlust bezeichnen. Eine so herrliche Nase war das.
Für die von Zahnschmerz geplagten Frauen von Yokohama und Umgebung war Sumires verdammt gut aussehender Vater geradezu ein Mythos. Obwohl er in der Praxis eine Haube und einen großen Mundschutz trug, der nur seine Augen und Ohren freiließ, blieb nicht verborgen, welch ein Adonis er war. Seine Nase wölbte sich derart kühn und verführerisch unter der Maske, dass fast alle Patientinnen bei diesem Anblick erröteten und sich sogleich in ihn verliebten, ob die Versicherung ihre Behandlung nun bezahlte oder nicht.
Sumires Mutter war mit einunddreißig Jahren an einem angeborenen Herzfehler gestorben. Ihre Tochter war damals erst drei gewesen, sodass ihre einzige Erinnerung an sie der Duft der mütterlichen Haut war. Fotos von der Mutter gab es – außer ein paar Hochzeitsbildern und einem Schnappschuss kurz nach Sumires Geburt – nur wenige. Immer wieder zog Sumire das alte Album hervor und betrachtete die Bilder, auf denen eine zierliche Frau mit einer nichtssagenden Frisur befangen in die Kamera lächelte. Äußerlich machte Sumires Mutter, milde ausgedrückt, keine besonders beeindruckende Figur. Man fragte sich höchstens, was sie sich wohl bei ihrer Garderobe gedacht hatte. Sie wirkte so unauffällig, dass der Anschein entstand, sie müsse nur einen Schritt rückwärts tun, um mit der Wand hinter ihr zu verschmelzen. Sumire bemühte sich immer wieder, sich ihre Gesichtszüge einzuprägen, um ihrer Mutter vielleicht einmal im Traum zu begegnen, ihr die Hand zu drücken und mit ihr zu reden. Aber es wollte ihr nicht gelingen, denn ihre Mutter hatte ein Gesicht, das man sofort wieder vergaß. Wahrscheinlich hätte Sumire sie nicht einmal erkannt, wenn sie am hellichten Tag auf der Straße mit ihr zusammengestoßen wäre.
Ihr Vater sprach kaum von der verstorbenen Mutter. Er war kein Mann von vielen Worten und vermied es im Allgemeinen, über seine Gefühle zu sprechen (als könnten schon Worte die Überträger von Mundinfektionen sein). Sumire erinnerte sich nicht, je mit ihrem Vater über seine tote Frau gesprochen zu haben, abgesehen von dem einen Mal, als sie noch ganz klein gewesen war und ihn gefragt hatte: »Wie war eigentlich meine Mutter?« An dieses Gespräch erinnerte sie sich noch sehr deutlich.
Ihr Vater hatte den Blick abgewandt, einen Moment überlegt und dann geantwortet: »Sie hatte ein sehr gutes Gedächtnis und eine schöne Handschrift.«
Eine seltsame Art, einen Menschen zu beschreiben. Hätte ein Vater seiner kleinen Tochter nicht lieber etwas erzählen sollen, das sie im Herzen bewahren konnte? Ihr Worte mit auf den Weg geben, die für sie eine Quelle des Trostes und der Wärme sein würden? Die ihr einen Halt oder wenigstens einen Anhaltspunkt für das unsichere Dasein auf dem dritten Planeten in unserem Sonnensystem gaben? Erwartungsvoll hatte Sumire die erste blendend weiße Seite in ihrem Heft aufgeschlagen, doch ihr gut aussehender Vater gehörte leider nicht zu den Menschen, die eine leere Seite zu füllen vermögen (obwohl es für Sumire so wichtig gewesen wäre).
Als Sumire sechs Jahre alt war, heiratete ihr Vater wieder, und zwei Jahre später wurde ihr Bruder geboren. Auch die neue Mutter war keine Schönheit und hatte nicht einmal ein besonders gutes Gedächtnis oder eine schöne Schrift. Dennoch war sie eine liebevolle und gerechte Frau, was für ihre kleine Stieftochter Sumire natürlich ein großes Glück bedeutete. Obwohl Glück vielleicht nicht der richtige Ausdruck ist, denn schließlich hatte Sumires Vater bei seiner Wahl außerordentliche Sorgfalt walten lassen. Wenn es ihm auch an Vaterqualitäten mangelte, so war er doch bei der Wahl seiner Gefährtin konsequent, weise und realistisch vorgegangen. Die Stiefmutter liebte Sumire vorbehaltlos durch ihre lange, schwierige Pubertät hindurch, und selbst als Sumire erklärte, sie wolle die Universität verlassen, um zu schreiben, respektierte ihre Stiefmutter diesen Wunsch, obwohl sie im Grunde dagegen war. Allerdings war sie immer froh gewesen, dass Sumire schon als kleines Mädchen so gern las, und hatte sie darin bestärkt.
Schließlich konnte die Stiefmutter den Vater sogar zu einer Vereinbarung überreden, nach der er Sumire bis zu ihrem achtundzwanzigsten Lebensjahr mit einer gewissen Summe unterstützen würde. Sollte sie es bis dahin nicht geschafft haben, müsste sie allein zurechtkommen. Ohne die Fürsprache ihrer Stiefmutter hätte Sumire möglicherweise ohne einen Heller dagestanden, wäre ohne den notwendigen gesellschaftlichen Schliff in die Wildnis gestoßen worden, die man Realität nennt und in der Humor Mangelware ist. Schließlich dreht sich die Erde nicht quietschend und knirschend um die Sonne, damit die Menschen etwas zu lachen haben und sich amüsieren.
Etwa zwei Jahre, nachdem sie ihr Studium abgebrochen hatte, begegnete Sumire ihrem süßen Sputnik.
Sumire lebte damals mit einem Minimum an Möbeln und einem Maximum an Büchern in einem Einzimmerapartment in Kichijoji. Um die Mittagszeit stand sie auf und pilgerte nachmittags unermüdlich wie ein Bergasket durch den Inokashira-Park. Bei schönem Wetter setzte sie sich auf eine Bank, aß Brot oder las, während sie eine Zigarette nach der anderen rauchte. Wenn es regnete oder zu kalt war, ging sie in ein altmodisches Café, in dem klassische Musik dröhnte, sank auf eines der durchgesessenen Sofas und las mit ernster Miene zu den Klängen von Schubert-Symphonien oder Bach-Kantaten. Abends trank sie ein Bier und aß ein Fertiggericht aus dem Supermarkt.
Gegen zehn setzte sie sich an den Schreibtisch. Vor sich hatte sie eine Thermoskanne mit heißem Kaffee, einen großen Becher (mit einem Bild von Snafkin, den ich ihr zum Geburtstag geschenkt hatte), ein Päckchen Marlboro und einen gläsernen Aschenbecher aufgebaut. Ein Wortprozessor gehörte natürlich auch zu ihren Utensilien. Jede Taste ein Zeichen, alles parat.
Es herrschte tiefe Stille. Ihr Kopf war so klar wie der nächtliche Winterhimmel. Der Große Bär und der Polarstern funkelten an ihren angestammten Plätzen. Sumire hatte so viel zu schreiben, so viele Geschichten, die sie erzählen musste. Wenn sie nur das richtige Ventil öffnen könnte, würden die in ihr brodelnden Gedanken und Ideen wie kochende Lava hervorzischen, geistige Gestalt annehmen und allmählich zu einmaligen, originären Werken erstarren. Alle würden angesichts dieses »sensationellen jungen Genies« erstaunt die Augen aufreißen. Die Feuilletons der Zeitungen würden Fotos von ihr bringen, auf denen ein cooles Lächeln ihre Lippen umspielte, und die Redakteure würden ihr in Scharen die Tür einrennen.
Unglücklicherweise war bisher nichts von alldem eingetroffen. Vielleicht lag es daran, dass Sumire nicht imstande war, einen abgerundeten Text mit einem richtigen Anfang und einem richtigen Ende zu schreiben.
Dennoch schrieb Sumire unglaublich flüssig und litt keineswegs an einer Schreibblockade. Im Gegenteil, sie hatte Schwierigkeiten, ein Ende zu finden. Sie schrieb, was ihr durch den Kopf ging, und kam dabei vom Hundertsten ins Tausendste. Ihr Problem war, dass sie zu viel schrieb. Hat man zu viel geschrieben, bräuchte man ja theoretisch nur die überflüssigen Stellen zu streichen, aber so einfach war die Sache nicht. Sumire konnte nicht unterscheiden, was für den Gesamtzusammenhang eines Textes notwendig war und was nicht. Wenn sie am nächsten Tag einen Ausdruck ihrer Arbeit durchlas, erschien ihr entweder jedes Wort unentbehrlich oder aber sie fand alles überflüssig. In ihrer Verzweiflung zerriss sie so manche Manuskriptseite und warf sie weg. In frostigen Winternächten in einem Kaminzimmer hätte die Szene – wie in La Bohème – noch eine gewisse Wärme und Romantik gehabt, aber in Sumires Einzimmerapartment gab es natürlich keinen Kamin. Sie hatte ja nicht mal ein Telefon. Ganz zu schweigen von einem ordentlichen Spiegel.
An Wochenenden stand Sumire oft mit einem Packen neuer Manuskripte unter dem Arm vor meiner Tür. Auch wenn es natürlich nur die glücklichen Überlebenden ihres Massakers waren, kam eine ganz schöne Menge zusammen. Auf der ganzen großen weiten Welt war ich der einzige, dem Sumire ihre Versuche zeigte.
Da ich an der Uni zwei Jahre über ihr war und auch ein anderes Fach studierte, waren wir nur zufällig ins Gespräch gekommen. An einem Montag im Mai nach den Feiertagen, als ich an der Bushaltestelle in der Nähe des Uni-Haupteingangs wartete und in einem Roman von Paul Nizan las, den ich in einem Antiquariat aufgestöbert hatte, fragte mich ein ziemlich klein geratenes Mädchen gereizt, wie ich dazu käme, heutzutage noch Paul Nizan zu lesen. Ich hatte den Eindruck, sie hätte am liebsten irgendetwas durch die Gegend gekickt, und hatte sich mangels eines geeigneteren Objektes mir zugewandt.
Sumire und ich waren einander sehr ähnlich. Zu lesen war für uns beide beinahe eine natürliche Körperfunktion, wie das Atmen. Auch ich zog mich in jeder freien Minute allein in eine ruhige Ecke zurück und verschlang Seite um Seite. Ich las alles, was ich in die Finger bekam – japanische Romane, ausländische Romane, neue und alte, Avantgarde-Literatur, Bestseller – solange es nur den geringsten intellektuellen Reiz besaß. Wie Sumire. In der Stadtbücherei waren wir wie zu Hause und konnten zudem ganze Tage damit verbringen, in Kanda durch die Antiquariate zu streifen. Ich war noch niemals einem anderen Menschen begegnet, der ebenso leidenschaftlich und ausschweifend las wie ich, und ich glaube, Sumire ging es genauso.
Seit sie das Studium abgebrochen und ich mein Examen abgelegt hatte, schaute Sumire etwa zwei-, dreimal im Monat bei mir vorbei. Seltener besuchte ich sie in ihrer Wohnung, denn dort war eigentlich für zwei Personen kein Platz. Bei jeder Begegnung sprachen wir über Literatur und tauschten Bücher aus. Oft machte ich auch etwas zum Abendessen für sie. Mir macht es nichts aus zu kochen, aber Sumire gehörte zu den Leuten, die lieber nichts essen, als selbst zu kochen. Zum Dank brachte sie mir immer irgendwelche Sachen mit, die sie bei ihren Jobs ergatterte. Als sie einmal im Lager einer Arzneimittelfirma arbeitete, kriegte ich sechs Dutzend Kondome, die wahrscheinlich noch immer in irgendeiner Schublade herumliegen.
Die Romane (oder Romanfragmente), die Sumire schrieb, waren gar nicht so schrecklich, wie sie selbst glaubte. Sie hatte vielleicht noch nicht genügend Schreibpraxis, weshalb ihre Texte ein bisschen an eine Patchworkdecke erinnerten, die von einem Verein störrischer älterer Damen mit unterschiedlichen Vorlieben und Gebrechen unter verbissenem Schweigen zusammengestoppelt worden war. Diese Eigenwilligkeit in Verbindung mit Sumires zuweilen manisch-depressivem Wesen führte dazu, dass die Dinge manchmal außer Kontrolle gerieten. Ein weiteres Problem bestand darin, dass Sumire entschlossen war, einen klassischen Ideenroman im Stil und Umfang des 19. Jahrhunderts zu schreiben, vollgestopft mit allen erdenklichen psychologischen und schicksalhaften Phänomenen.
Trotz dieser Schwachpunkte hatte das, was sie schrieb, eine eigentümliche Frische und vermittelte den Eindruck, sie wolle aufrichtig beschreiben, was ihr selbst wichtig war. Mir gefiel, dass sie niemanden imitierte und auch nicht nur mit Fingerspitzengefühl irgendetwas Nettes zurechtbastelte. Außerdem wäre es nicht richtig gewesen, die den Texten eigene subtile Kraft zu beschneiden und in eine kleinere, aber feinere Form zu zwängen. Sie hatte ja noch jede Menge Zeit, alles Mögliche auszuprobieren, und brauchte sich nicht unter Druck zu setzen. Wie man so sagt: Gut Ding will Weile haben.
»Mein Kopf ist vollgestopft mit Zeug, über das ich schreiben will. Wie eine olle Scheune«, sagte Sumire. »Bilder, Szenen, Wortfetzen, Leute toben mir im Kopf rum und brüllen mich an, ich soll schreiben. Ich kriege Lust, mit einer großartigen Geschichte anzufangen, die mich an einen ganz neuen Ort versetzt. Aber wenn ich mich dann an den Schreibtisch setze und schreiben will, merke ich, dass etwas Wichtiges fehlt. Es kristallisiert sich nichts heraus, und ich bleibe auf einem Haufen Geröll sitzen. Ich komme einfach nicht vom Fleck.«
Mit gerunzelter Stirn hob Sumire das zweihundertfünfzigste Steinchen auf und schleuderte es in den Teich.
»Vielleicht fehlt mir etwas. Etwas ganz Entscheidendes, das man als Schriftsteller unbedingt haben muss.«
Einen Moment lang herrschte Schweigen. Anscheinend wartete sie auf einen meiner Gemeinplätze.
Ich dachte kurz nach. »Im alten China waren die Städte von hohen Mauern mit gewaltigen, prächtigen Toren umgeben«, sagte ich dann. »Diese Tore hatten eine wichtige Funktion – sie dienten nicht nur dazu, Leute hinein- oder hinauszulassen. Man glaubte, in den Toren hausten die Geister der Stadt. Oder sollten zumindest dort hausen. Ebenso wie die Europäer im Mittelalter ihre Kathedrale und den Marktplatz für das Herz ihrer Städte hielten. Diese prachtvollen Tore gibt es auch heute noch in China. Weißt du, wie die alten Chinesen ihre Tore gebaut haben?«
»Keine Ahnung«, sagte Sumire.
»Sie zogen mit Karren zu alten Schlachtfeldern und sammelten die ausgebleichten Knochen ein, die dort verstreut oder vergraben lagen. In einem Land mit einer so langen Geschichte wie China herrscht natürlich kein Mangel an alten Schlachtfeldern. Dann errichteten die Bewohner am Eingang ihrer Stadt ein großes Tor, in das sie die Knochen einmauerten, weil sie hofften, die auf diese Weise geehrten Geister der toten Soldaten würden zum Dank die Stadt bewachen. Das war aber noch nicht alles. Wenn das Tor fertig war, schnitten sie ein paar lebenden Hunden die Kehle durch und besprengten das Tor mit dem noch warmen Blut. Erst durch die Verbindung von frischem Blut und ausgebleichten Knochen erlangten die alten Geister ihre magische Macht. Das war der Gedanke, der sich dahinter verbarg.«
Schweigend wartete Sumire darauf, dass ich weitersprach.
»Beim Schreiben von Romanen ist es nicht viel anders. Auch wenn man einen Haufen alter Knochen sammelt und ein prächtiges Tor baut, heißt das noch lange nicht, dass daraus ein lebendiger Roman entsteht. Eine richtige Geschichte hat einen geisterhaften Zauber und ist nicht von dieser Welt. Damit die Verbindung von Diesseits und Jenseits entsteht, ist so etwas wie eine magische Taufe nötig.«
»Das heißt, ich muss losziehen und irgendwo einen lebendigen Hund finden?«
Ich nickte.
»Und dann sein warmes Blut vergießen?«
»Vielleicht.«
Nachdenklich kaute Sumire an ihren Lippen und schmiss einen weiteren wehrlosen Stein in den Teich. »Wenn’s geht, möchte ich kein Tier töten.«
»Das war doch nur eine Metapher«, sagte ich. »Du sollst nicht wirklich einen Hund umbringen.«
Wie immer saßen wir nebeneinander auf einer Bank im Inokashira-Park. Auf Sumires Lieblingsbank. Vor uns lag der Teich. Es war windstill, und die Blätter, die auf die Wasseroberfläche gefallen waren, schienen darauf zu kleben. Ganz in der Nähe hatte jemand ein Feuer entfacht. Ein spätherbstlicher Duft lag in der Luft, und selbst weit entfernte Geräusche tönten unangenehm schrill zu uns herüber.
»Was du brauchst, sind Zeit und Erfahrung. Finde ich.«
»Zeit und Erfahrung«, wiederholte Sumire und schaute in den Himmel. »Die Zeit vergeht von allein. Und Erfahrung? Sprich mir nicht von Erfahrung. Nicht dass ich mir etwas darauf einbilde, aber ich verspüre kein Verlangen nach Sexualität. Wie soll eine Schriftstellerin ohne Libido Erfahrungen machen? Ich komme mir vor wie ein Koch ohne Appetit.«
»Wohin sich deine Libido verkrochen hat, weiß ich nicht«, sagte ich. »Vielleicht hat sie sich nur in irgendeiner Ecke versteckt. Oder sie ist auf eine weite Reise gegangen und hat vergessen zurückzukommen. Aber sich zu verlieben, ist ja auch eine ganz schön unvernünftige Angelegenheit. Ganz plötzlich aus heiterem Himmel kann es dich packen. Schon morgen.«
Sumire wandte den Blick vom Himmel ab und sah mir ins Gesicht. »Wie ein Wirbelsturm auf freiem Feld?«
»Könnte man sagen.«
Einen Moment lang dachte sie über den Wirbelsturm auf freiem Feld nach.
»Hast du schon mal einen Wirbelsturm auf freiem Feld erlebt?«
»Nein«, erwiderte ich. In Musashino bekommt man (dankenswerterweise, muss ich sagen) nur selten einen waschechten Wirbelsturm zu Gesicht.
Eines Tages, ungefähr ein halbes Jahr später, kam die Liebe über Sumire, genau wie ich es vorausgesagt hatte, unvernünftig und heftig, ein Wirbelsturm auf freiem Feld. Die Liebe zu einer siebzehn Jahre älteren Frau – ihrem »süßen Sputnik«.
Als Miu und Sumire bei der Hochzeitsfeier nebeneinander saßen, taten sie, was alle Menschen auf der Welt in solchen Situationen tun: Sie stellten sich mit ihren Namen vor. Da Sumire ihren Namen hasste, nannte sie ihn nach Möglichkeit niemandem. Aber auf die Frage nach ihrem Namen nicht zu antworten, erschien ihr doch zu unhöflich.
Nach Auskunft ihres Vaters hatte Sumires verstorbene Mutter den Namen ausgewählt. Da sie »Das Veilchen« von Mozart besonders liebte, hatte für sie immer festgestanden, dass ihre erste Tochter diesen Namen tragen würde: Sumire, Veilchen. Im Plattenregal im Wohnzimmer stand eine Platte mit Liedern von Mozart, die zweifellos ihrer Mutter gehört hatte. Als Sumire noch klein war, hatte sie die schwere Langspielplatte immer wieder ganz vorsichtig aufgelegt, um sich das von Elisabeth Schwarzkopf und Walter Gieseking vorgetragene Lied anzuhören. Den Inhalt verstand sie nicht, aber die anmutige Melodie überzeugte sie davon, dass in dem Lied die Schönheit blühender Veilchen auf der Wiese besungen wurde. Sumire hatte das Bild deutlich vor Augen und liebte es.
Später jedoch versetzte eine japanische Übersetzung des Liedes aus der Schulbibliothek Sumire einen Schock. Das Lied handelte nämlich von einer gefühllosen Schäferin, die auf der Wiese ein hilfloses kleines Veilchen zertrampelt. Das Mädchen merkt nicht einmal, dass es die Blume zertreten hat. Auch wenn es ein Gedicht von Goethe war, konnte Sumire darin weder Liebreiz noch eine Moral entdecken.
»Warum musste meine Mutter mir ausgerechnet den Namen von einem so scheußlichen Lied geben?«, fragte Sumire mit gerunzelter Stirn.
Miu faltete die Serviette auf ihrem Schoß zusammen und sah Sumire mit einem unverbindlichen Lächeln an. Mius Augen waren sehr dunkel. Mehrere Farben mischten sich in ihnen, aber ihr Blick war klar und unumwölkt.
»Aber die Melodie gefällt Ihnen doch, oder?«
»Ja, die Melodie ist wunderschön.«
»Wenn die Musik schön ist, finde ich, können Sie zufrieden sein. Schließlich kann nicht alles auf dieser Welt nur süß und lieblich sein. Ihre Mutter hat den Text wahrscheinlich nicht beachtet, weil sie die Melodie so hübsch fand. Und außerdem – wenn Sie weiter dauernd so ein Gesicht ziehen, kriegen Sie Falten.«
Sumire entspannte ihr Gesicht.
»Wahrscheinlich haben Sie Recht, ich war nur so schrecklich enttäuscht. Mein Name ist das einzige Konkrete, das mir von meiner Mutter geblieben ist. Abgesehen von mir selbst natürlich.«
»Ich finde jedenfalls, dass Sumire ein bezaubernder Name ist. Mir gefällt er«, sagte Miu, wobei sie den Kopf ein wenig zur Seite neigte, als wolle sie die Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachten. »Ist Ihr Vater übrigens auch hier?«
Sumire schaute sich suchend nach ihrem Vater um. Wegen seiner stattlichen Größe fiel es ihr auch in dem großen Saal nicht schwer, ihn zu entdecken. Er saß zwei Tische weiter und wandte sich im Gespräch gerade einem zierlichen älteren Herrn im Frack zu. Sein Lächeln war so warm und herzlich, dass es einen Eisberg zum Schmelzen gebracht hätte. Im Schein der Kronleuchter erhob sich seine edle Nase sanft wie die Silhouette einer Rokoko-Kamee, und selbst Sumire, die an seinen Anblick gewöhnt war, war von seiner Schönheit beeindruckt. Ihr Vater hatte genau die richtige Erscheinung für ein offizielles Ereignis wie dieses. Seine Anwesenheit allein verlieh dem Saal einen vornehmen Glanz, wie Blumen in einer großen Vase oder eine pechschwarze Stretch-Limousine.
Als Miu Sumires Vater entdeckte, war sie einen Moment lang sprachlos. Sie atmete hörbar ein, ein Laut wie das Rauschen eines Samtvorhanges, der an einem heiteren Morgen zur Seite gezogen wird, um das Tageslicht hereinzulassen und einen geliebten Menschen zu wecken. Sumire überlegte, ob sie vielleicht ein Opernglas hätte mitbringen sollen. Allerdings war sie an die dramatischen Reaktionen gewöhnt, die das Äußere ihres Vaters bei manchen Menschen – besonders bei Frauen mittleren Alters – auslöste. Was bedeutet Schönheit, welchen Wert hat sie? hatte Sumire sich immer wieder gefragt, doch bisher hatte ihr niemand eine Antwort geben können. Jedenfalls schien sie stets die gleiche Wirkung hervorzurufen.
»Wie ist es, einen so gut aussehenden Vater zu haben?«, erkundigte sich Miu. »Ich frage aus Neugier.«
Sumire seufzte – wie oft war diese Frage ihr schon gestellt worden. »Es ist nicht besonders amüsant. Alle denken das Gleiche. Was für ein gut aussehender Mann. Wundervoll. Dabei ist die Tochter so unscheinbar. Wahrscheinlich ein Atavismus.«
Miu wandte sich Sumire zu, senkte leicht das Kinn und musterte ihr Gesicht, als bewundere sie ein Gemälde in einem Museum.
»Falls Sie bisher dieser Meinung waren, haben Sie sich gründlich geirrt. Sie sind ausgesprochen hübsch. Darin stehen Sie Ihrem Vater um nichts nach«, sagte Miu und streckte wie selbstverständlich die Hand aus, um Sumires Hand zu berühren. »Sie sind sehr attraktiv, auch wenn Sie es selbst nicht wissen.«
Sumire wurde es ganz heiß im Gesicht. Ihr Herz hämmerte, als würde ein durchgegangenes Pferd über eine hölzerne Brücke galoppieren.
Von nun an waren Sumire und Miu völlig in ihr Gespräch vertieft und nahmen nichts mehr von dem wahr, was um sie herum vorging. Es war ein lebhaftes Fest. Mehrere Leute erhoben sich, um Reden zu halten (darunter gewiss auch Sumires Vater), und das Essen war auch nicht schlecht. Doch Sumire erinnerte sich an nichts von alldem. Sie wusste weder, ob sie Fleisch oder Fisch, noch ob sie anständig mit Messer und Gabel oder mit bloßen Händen gegessen und anschließend den Teller abgeleckt hatte.
Die beiden sprachen über Musik. Sumire mochte klassische Musik und hatte von klein auf die Platten aus der Sammlung ihres Vaters gehört. Miu und sie teilten viele musikalische Vorlieben. Beide liebten Klaviermusik und hielten Beethovens Klaviersonate Nr. 32 für den Höhepunkt der Musikgeschichte überhaupt. Ebenso waren sie beide der Meinung, dass Wilhelm Backhaus’ unvergleichliche Interpretation der Sonate für Decca mit ihrer vollendeten Heiterkeit und Lebensfreude den Maßstab für jede künstlerische Darbietung setzte.
Wladimir Horowitz’ Tonbandaufnahmen von Chopin, ganz besonders die Scherzi, waren doch hinreißend. Und war es nicht fast unglaublich, wie geistreich und wunderschön Friedrich Gulda Debussys Préluden spielte? Und dann Giesekings bezaubernde Interpretation von Grieg! Gar nicht zu reden von Svjatoslav Richter, der wie kein anderer die herrliche Tiefe von Prokofieffs Werk erfasste, sodass man sich seinem virtuos zurückhaltenden Spiel immer wieder hingeben konnte. Und warum nur wurde Wanda Landowska trotz der Wärme und Empfindsamkeit ihrer Mozart-Sonaten so sehr unterschätzt?
»Was machen Sie zurzeit?« fragte Miu, als sie ihr Gespräch über Musik vorläufig beendet hatten.
Sumire erklärte ihr, sie habe ihr Studium aufgegeben und nehme ab und zu kleinere Jobs an, während sie versuche, Schriftstellerin zu werden. Welche Art von Romanen sie denn schreiben wolle, fragte Miu. Das sei nicht mit einem Wort zu erklären, entgegnete Sumire.
»Und was lesen Sie am liebsten?«, fragte Miu.
»Wenn ich Ihnen das aufzähle, sitzen wir morgen noch hier, aber in letzter Zeit lese ich viel Jack Kerouac.« So kam es zu der Sputnik-Geschichte.
Abgesehen von leichter Unterhaltungsliteratur nahm Miu kaum je ein Buch zur Hand. Sie könne das Wissen, dass alles erfunden sei, einfach nicht aus ihrem Kopf verbannen und darum die Gefühle der Charaktere nicht miterleben, erklärte sie. Das sei seit jeher so gewesen. Daher beschränke sich ihre Lektüre auf Sachbücher, die sich mit der Realität beschäftigten. Fast ausschließlich Werke, die ihr bei ihrer Arbeit nützlich seien.
»Was sind Sie denn von Beruf?« fragte Sumire.
»Meine Arbeit hat viel mit dem Ausland zu tun«, sagte Miu. »Vor dreizehn Jahren habe ich als älteste Tochter die Handelsfirma meines Vater übernommen. Eigentlich wollte ich Pianistin werden, aber mein Vater starb an Krebs, und meine Mutter war auch nicht gesund. Außerdem konnte sie nicht besonders gut Japanisch. Mein Bruder ging noch zur Schule, also sollte zunächst einmal ich die Verantwortung für die Firma übernehmen. Ein nicht unerheblicher Teil unserer Verwandten verdiente seinen Lebensunterhalt in der Firma, sodass wir sie nicht einfach aufgeben konnten.« Wie ein Punkt markierte ein kleiner Seufzer das Ende des Satzes.
»Die Firma meines Vaters importierte ursprünglich getrocknete Lebensmittel und Arzneikräuter aus Korea, aber inzwischen handeln wir mit einem großen Sortiment von Waren, sogar mit Computerteilen. Offiziell bin ich immer noch Leiterin des Unternehmens, aber in Wirklichkeit haben inzwischen mein Mann und mein Bruder die Firma übernommen, sodass ich mich nur noch gelegentlich im Büro blicken lassen muss. Ich habe jetzt mein eigenes Geschäft.«
»Und was ist das?«
»Hauptsächlich importiere ich Wein, bisweilen organisiere ich auch Musikveranstaltungen. Ich muss viel zwischen Japan und Europa hin- und herreisen, persönliche Beziehungen sind in dieser Branche entscheidend. Deshalb kann ich auch, obwohl ich allein bin, mit einigen erstrangigen Handelsunternehmen konkurrieren. Klar, ein solches Netz an Beziehungen aufzubauen und zu unterhalten kostet Zeit und Kraft…« Sie blickte auf, als sei ihr plötzlich eine Idee gekommen. »Übrigens, können Sie Englisch?«
»Sprechen kann ich nicht so besonders, es geht gerade so. Aber ich lese gern Englisch.«
»Können Sie einen Computer bedienen?«
»Nicht richtig, aber ich benutze einen Wortprozessor und könnte es bestimmt schnell lernen.«
»Fahren Sie Auto?«
Sumire schüttelte den Kopf. Seit sie in ihrem ersten Jahr an der Uni mit dem Volvo ihres Vaters rückwärts in die Garage fahren wollte und dabei an einem Pfosten die Tür eingedrückt hatte, war sie kaum noch gefahren.
»Na gut, könnten Sie mit höchstens zweihundert Wörtern den Unterschied zwischen einem Zeichen und einem Symbol erklären?«
Sumire nahm die Serviette von ihrem Schoß, tupfte sich die Mundwinkel ab und legte sie wieder hin. Sie verstand nicht, worauf ihre Gesprächspartnerin hinauswollte. »Zwischen Zeichen und Symbol?«
»Das hat keine besondere Bedeutung. Nur zum Beispiel.«
Sumire schüttelte wieder den Kopf. »Keine Ahnung.«