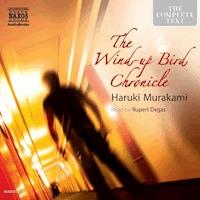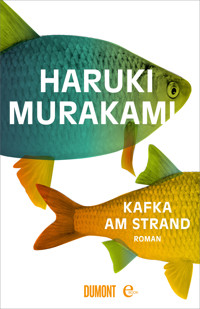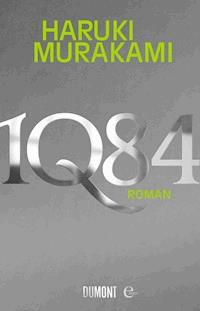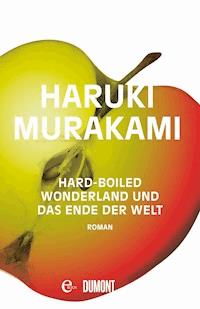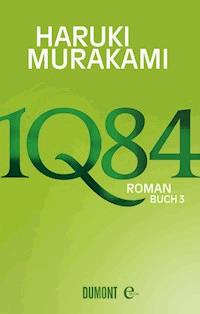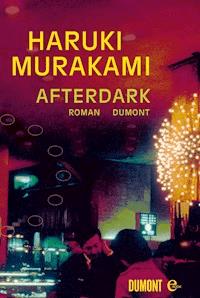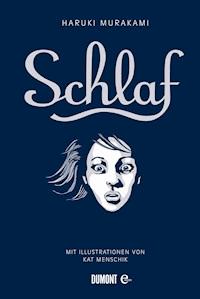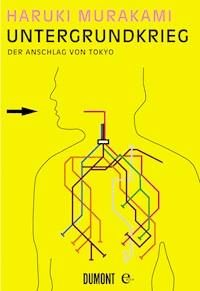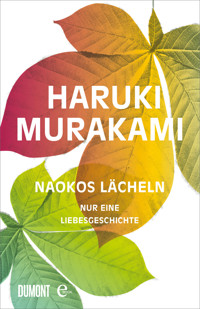
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»I once had a girl / Or should I say, she once had me.« John Lennon/Paul Mc Cartney Der Beatles-Ohrwurm ›Norwegian Wood‹ ist für den siebenunddreißigjährigen Toru Watanabe ein melancholischer Song der Erinnerung: an den Aufruhr der Gefühle in einer schmerzvollen und schicksalhaften Jugend, die er zu bewahren und zu verstehen versucht. ›Naokos Lächeln‹ erzählt lebendig und leidenschaftlich von einer Liebe mit Komplikationen in den unruhigen Sechzigerjahren: Toru, der einsame, ernste Student der Theaterwissenschaft, begeistert von Literatur, Musik und wortlosen Sonntagsspaziergängen auf Tokios Straßen, erfährt früh, dass der Verlust von Menschen zum Leben und zum Drama des Erwachsenwerdens dazugehört. Der Jugendfreund Kizuki begeht Selbstmord, die geheimnisvoll anziehende Naoko verirrt sich in ihrer eigenen unerreichbaren Welt und Toru Watanabe muss sich zwischen ihr und der vor Lebenslust vibrierenden Midori entscheiden. ›Naokos Lächeln‹ wurde 2010 unter dem englischen Titel »Norwegian Wood« verfilmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Der Beatles-Ohrwurm ›Norwegian Wood‹ ist für den siebenunddreißigjährigen Toru Watanabe ein melancholischer Song der Erinnerung: an den Aufruhr der Gefühle in einer schmerzvollen und schicksalhaften Jugend, die er zu bewahren und zu verstehen sucht. Jahre zuvor, an der Universität, ist Toru ein einsamer und ernster Student der Theaterwissenschaft. Er ist begeistert von Literatur, Musik und wortlosen Sonntagsspaziergängen in Tokios Straßen. Früh erfährt er, dass der Verlust von Menschen zum Leben und zum Drama des Erwachsenwerdens dazugehört: Sein Jugendfreund Kizuki begeht Selbstmord, die geheimnisvoll anziehende Naoko, in die er sich verliebt, verirrt sich in ihrer eigenen, für ihn unerreichbaren Welt. Toru muss sich zwischen ihr und der vor Lebenslust vibrierenden Midori entscheiden.
Dieser weise, oft wunderbar sentimentale Roman machte Haruki Murakami zum erfolgreichsten Autor der japanischen Nachkriegsliteratur mit einer Auflage in Millionenhöhe.
© Markus Tedeskino/Ag. Focus
Haruki Murakami, 1949 in Kyoto geboren, lebte über längere Zeit in den USA und in Europa und ist der gefeierte und mit höchsten Literaturpreisen ausgezeichnete Autor zahlreicher Romane und Erzählungen. Sein Werk erscheint in deutscher Übersetzung bei DuMont.
Ursula Gräfe, geboren 1956, hat in Frankfurt am Main Japanologie und Anglistik studiert. Aus dem Japanischen übersetzte sie u.a. den Nobelpreisträger Kenzaburō Ōe, Yōko Ogawa und Hiromi Kawakami.
HARUKI MURAKAMI
NAOKOS LÄCHELN
NUR EINE LIEBESGESCHICHTE
Roman
Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe
1
Ich war siebenunddreißig Jahre alt und saß in einer Boeing 747. In ihrem Anflug auf Hamburg tauchte die riesige Maschine in eine dichte Wolkenschicht ein. Trüber, kalter Novemberregen hing über dem Land und ließ die Szenerie wie ein düsteres flämisches Landschaftsbild erscheinen: die Arbeiter in ihren Regenmänteln, die Fahnen auf dem flachen Flughafengebäude, die BMW-Reklametafeln. Ich war also wieder einmal in Deutschland.
Nach der Landung erlosch das Nicht-Rauchen-Zeichen, und aus den Kabinenlautsprechern ertönte leise Hintergrundmusik – eine gedämpfte Instrumentalversion des Beatles-Stückes Norwegian Wood. Wie immer ließ diese Melodie mich erschauern, nur diesmal heftiger denn je.
Ich musste mich nach vorn beugen und meinen Kopf mit beiden Händen umfassen, damit er mir nicht zersprang; so blieb ich sitzen. Eine deutsche Stewardess kam heran und fragte auf Englisch, ob mir nicht gut sei. Alles in Ordnung, antwortete ich, mir sei nur ein bisschen schwindlig.
»Sind Sie sicher?«
»Ja, wirklich, vielen Dank«, sagte ich.
Mit einem Lächeln verschwand sie. Inzwischen hatte die Musik gewechselt – ein Billy-Joel-Titel. Ich richtete mich auf, sah aus dem Fenster auf die dunklen Wolken, die von der Nordsee herüberzogen, und dachte an all die Verluste, die ich in meinem Leben schon erlitten hatte. Verlorene Zeit, Menschen, die gestorben waren oder mich verlassen hatten, Gefühle, die nie mehr wiederkehren würden.
Während die Maschine zum Stillstand kam, die Leute ihre Sicherheitsgurte lösten und ihre Taschen und Jacken aus den Gepäckfächern nahmen, stand ich im Geist mitten auf einer Wiese. Ich sog den Duft des Grases ein, spürte den Wind auf meiner Haut und hörte Vogelgezwitscher. Es war im Herbst 1969, kurz vor meinem zwanzigsten Geburtstag.
Die Stewardess setzte sich zu mir, um sich nochmals nach meinem Befinden zu erkundigen.
»Danke, es geht mir wieder gut«, sagte ich lächelnd. »Ich kam mir nur ein bisschen verlassen vor.«
»Das geht mir manchmal auch so. Ich kenne das.« Mit einem Nicken stand sie auf und schenkte mir ein liebenswürdiges Lächeln. »Dann also auf Wiedersehen und gute Reise.«
»Auf Wiedersehen«, erwiderte ich.
Achtzehn Jahre sind inzwischen vergangen, und doch habe ich jene Wiese noch immer deutlich vor Augen. Nach mehreren Tagen mit leichtem Sommerregen leuchteten die Hügel tiefgrün und wie frisch gewaschen; die Oktoberbrise ließ die Grasähren schwanken, und dünne Wolkenschleier hafteten am eisblauen Himmel, der so unendlich hoch erschien, dass einem die Augen schmerzten, wenn man zu ihm hinaufsah. Ein Windstoß strich über die Wiese, zauste leicht Naokos Haar und floh in die Wälder. In den Baumwipfeln rauschten die Blätter, und aus der Ferne ertönte das Bellen eines Hundes – leise, erstickte Rufe wie von der Schwelle einer anderen Welt. Sonst drang kein Laut bis zu uns. Wir begegneten keinem Menschen. Nur zwei karmesinrote Vögel flatterten erschreckt aus der Wiese auf und flogen in den Wald davon. Während wir nebeneinander hergingen, erzählte mir Naoko von einem Brunnen.
Mit der Erinnerung ist es eine seltsame Sache. Als ich tatsächlich mit beiden Füßen in dieser Landschaft stand, hatte ich ihr kaum Beachtung geschenkt. Nie hätte ich gedacht, dass sie einen solchen Eindruck hinterlassen würde, und schon gar nicht, dass ich mich nach achtzehn Jahren noch bis in jede Einzelheit an sie erinnern würde. Ehrlich gesagt, mir war die Landschaft an jenem Tag völlig egal. Ich dachte an mich, an das schöne Mädchen an meiner Seite, ich dachte an uns beide und dann wieder an mich selbst. In jenem Alter kehrte alles, was ich sah, was ich fühlte, was ich dachte, am Ende wie ein Bumerang stets zu meiner eigenen Person zurück. Noch dazu war ich verliebt. Und diese Liebe hatte mich in eine entsetzlich komplizierte Lage gebracht. Schon deshalb gab es für so etwas wie eine Landschaft keinen Platz in meinem Kopf.
Und doch kommt mir, wenn ich heute zurückdenke, als erstes die Wiese in den Sinn. Der Duft des Grases, die Brise mit ihrem Anflug von Kühle, die Hügelkette, das Hundegebell. Alles ist ganz deutlich, so deutlich, als müsste ich nur die Hand ausstrecken, um es zu berühren. Aber in dieser Szenerie gibt es keine Menschen. Niemanden. Naoko nicht und mich auch nicht. Was wohl aus uns geworden ist? Wie konnten wir einfach so verschwinden? Alles, was mir damals so wichtig schien – Naoko, ich und meine damalige Welt: Wohin sind sie nur verschwunden? Dabei kann ich mich ja kaum noch an Naokos Gesicht erinnern. Geblieben ist mir nur dieses menschenleere Bild.
Sicher, wenn ich eine Weile nachdenke, fällt mir wieder ein, wie sie aussah. Sie hatte kleine kalte Hände, schönes Haar, das sich völlig glatt anfühlte, und unter dem einen ihrer weichen, runden Ohrläppchen ein winziges Muttermal. Ich erinnere mich an den eleganten Kamelhaarmantel, den sie im Winter trug, an ihre Art, einem in die Augen zu sehen, wenn sie eine Frage stellte, an das leichte Beben, das hin und wieder in ihrer Stimme lag (als spräche sie auf einer stürmischen Bergspitze) – wenn ich diese Bilder nach und nach zusammenfüge, tauchen auch ihre Gesichtszüge wieder vor mir auf. Zunächst ihr Profil, was vielleicht daran liegt, dass Naoko und ich immer nebeneinander gingen. Sie wendet sich mir zu, lächelt, legt den Kopf ein wenig zur Seite und beginnt zu sprechen, wobei sie mir forschend in die Augen sieht. Ganz so, als beobachte sie das Tummeln winziger Fischlein auf dem Grund einer klaren Quelle.
Allerdings dauert es immer eine Weile, bis Naokos Gesicht aus den Tiefen meines Gedächtnisses auftaucht. Von Jahr zu Jahr hat es immer ein bisschen länger gedauert. Traurig, aber wahr. Zuerst brauchte ich fünf Sekunden, um die Erinnerung heraufzubeschwören, dann zehn, dann dreißig, bis eine Minute daraus geworden war. Ähnlich wie Schatten in der Dämmerung allmählich immer länger werden, bis die Dunkelheit sie ganz verschluckt, entfernte sich mein Gedächtnis tatsächlich immer weiter von Naoko, ebenso wie es sich immer weiter von meinem damaligen Ich zu entfernen schien. Allein die Landschaft, die Wiese im Oktober, spulte sich wie die Schlüsselsequenz in einem Film immer wieder vor meinem inneren Auge ab, drängte sich stets von Neuem in mein Bewusstsein. Und jedes Mal, wenn diese Landschaft in meinem Kopf erschien, versetzte sie mir einen Stoß. He, wach auf, ich bin noch da, wach auf, wach auf und überleg dir den Grund dafür, überleg dir, warum ich noch da bin. Es waren keine schmerzhaften Stöße. Sie taten nicht im Geringsten weh. Statt dessen erzeugten sie einen gewissen hohlen Ton, der jedoch eines Tages ebenfalls völlig verschwinden würde. Wie alles andere schließlich auch verschwinden wird. Doch als ich in der Lufthansa-Maschine auf dem Hamburger Flughafen saß, bedrängten mich die Stöße anhaltender und stärker als sonst. Deswegen beschloss ich, ein Buch zu schreiben, dieses Buch. Um aufzuwachen und zu begreifen, denn ich bin nun einmal jemand, der die Dinge aufschreiben muss, um sie zu begreifen.
Worüber hatten wir damals gesprochen?
Ach ja, es ging um einen Brunnen in den Feldern. Ich weiß nicht einmal, ob es einen solchen Brunnen überhaupt gegeben hat. Oder ob er vielleicht ein Symbol oder ein Bild war, das nur in Naokos Innerem existierte – genau wie vieles andere, das sie sich in jenen düsteren Tagen zurechtspann. Doch nachdem sie mir einmal von dem Brunnen erzählt hatte, konnte ich mir die Wiese nicht mehr ohne ihn vorstellen. Die Gestalt jenes Brunnens, den ich nie mit eigenen Augen gesehen habe, ist in meinem Kopf so selbstverständlich mit dem Bild der Landschaft verschmolzen, dass ich ihn bis ins Detail beschreiben kann. Der Brunnen liegt genau an der Grenze, wo die Wiese endet und der Wald anfängt. Ein dunkles Loch in der Erde von etwa einem Meter Durchmesser, tückisch verborgen im Gras. Kein Zaun, kein erhöhter Rand aus Steinen. Nur dieses gähnende Loch, wie eine Mundöffnung. Die rundherum liegenden Steine sind von Wind und Wetter zu einem kränklichen, milchigen Weiß ausgebleicht, geborsten und voller Risse. Zwischen den Spalten huschen Eidechsen umher. Auch wenn man sich so weit wie möglich über das Loch beugt und hineinspäht, kann man nichts erkennen. Das Einzige, dessen ich mir sicher bin, ist seine beängstigende, unermessliche Tiefe. Pechschwarze Finsternis staut sich in dem Loch – als hätte sich alle Dunkelheit der Welt in ihm zu undurchdringlicher Schwärze verdichtet.
»Er ist unheimlich – unheimlich tief.« Naoko wählte ihre Worte mit Bedacht. Mitunter verlangsamte sie auf diese Weise ihre Rede, während sie nach einem bestimmten Wort suchte. »Unheimlich tief. Doch niemand weiß, wo er liegt. Nur dass es hier in der Gegend sein muss.«
Die Hände in den Taschen ihrer teuren Tweedjacke vergraben, sah sie mir wie zur Bestätigung ins Gesicht und lächelte.
»Aber ist das denn nicht zu gefährlich?«, fragte ich. »Irgendwo ein tiefer Brunnen, und keiner weiß, wo. Jemand fällt rein, und weg ist er.«
»Weg, genau, aaaaaahhhhh, platsch. Schluss, aus.«
»So was passiert wirklich manchmal, oder?«
»Klar passiert das manchmal. Alle zwei, drei Jahre einmal. Jemand verschwindet plötzlich und ist trotz allen Suchens nirgends mehr aufzufinden. Von dem heißt es dann hier in der Gegend: Er ist in den Feldbrunnen gefallen.«
»Nicht gerade ein schöner Tod.«
»Ein grauenhafter Tod«, stimmte sie mir zu und pflückte sich ein paar Grassamen von der Jacke. »Wenn du dir dabei den Hals brichst, hast du Glück, aber wenn du dir nur den Fuß verstauchst oder so was, bist du schlecht dran. Du schreist, so laut du kannst – immer wieder –, aber niemand hört dich, und niemand wird dich finden. Um dich herum wimmelt es von Tausendfüßlern und Spinnen, und die Knochen von den Leuten, die dort vermodert sind, liegen überall verstreut. Es ist stockdunkel und feucht. Weit oben über dir schwebt kalt wie der Wintermond ein winzig kleines rundes Licht, und du gehst ganz langsam und allein zugrunde.«
»Wenn ich nur daran denke, kriege ich eine Gänsehaut«, sagte ich. »Jemand sollte den Brunnen suchen und eine Einfriedung bauen.«
»Aber niemand kann ihn finden. Also bleib auf dem Weg.«
Naoko zog die linke Hand aus der Tasche und drückte meine rechte.
»Hab keine Angst. Dir passiert nichts. Du könntest blindlings mitten in der dunkelsten Nacht hier herumrennen, ohne jemals in den Brunnen zu fallen. Und solange ich bei dir bin, kann auch ich nicht in den Brunnen fallen.«
»Nie?«
»Nie!«
»Woher weißt du das denn so genau?«
»Ich weiß es einfach.« Naoko drückte meine Hand noch fester, und wir gingen eine Weile schweigend weiter. »In solchen Sachen kenne ich mich aus. Sie haben nichts mit Logik zu tun: ich spüre sie. Zum Beispiel, wenn ich dir wie jetzt sehr nahe bin, habe ich nicht das kleinste bisschen Angst. Nichts Schlechtes und Düsteres kann mir etwas anhaben.«
»Dann ist ja alles ganz einfach. Du musst nur ständig bei mir bleiben«, sagte ich.
»Meinst du das im Ernst?«
»Natürlich.«
Naoko blieb stehen. Ich auch. Sie legte mir beide Hände auf die Schultern und sah mir in die Augen. Eine tiefschwarze, zähe Flüssigkeit schien in ihrer Iris wundersame Wirbel zu zeichnen. Lange schaute dieses schöne Augenpaar in mich hinein. Dann reckte Naoko sich zu mir hinauf und legte ihre Wange sanft gegen meine. Es war eine warme, zärtliche Geste, die mein Herz einen Augenblick lang stillstehen ließ.
»Danke«, sagte Naoko.
»Gern geschehen«, entgegnete ich.
»Mit dem, was du gerade gesagt hast, machst du mich sehr glücklich. Wirklich.« Sie lächelte traurig. »Aber es würde nicht funktionieren.«
»Warum denn nicht?«
»Weil es nicht richtig wäre, es wäre ungerecht. Es –« Naoko brach ab und ging weiter. Da sie sichtlich ganz mit ihren Gedanken beschäftigt war, störte ich sie nicht und trottete schweigend neben ihr her.
»Es wäre einfach nicht richtig – dir gegenüber und auch mir gegenüber nicht«, fuhr sie nach einer längeren Pause fort.
»In welcher Hinsicht nicht richtig?«, fragte ich leise.
»Es ist eben unmöglich, dass eine Person für alle Ewigkeit auf eine andere aufpasst. Stell dir vor, wir würden heiraten. Du müsstest doch zur Arbeit. Wer würde auf mich aufpassen, während du in der Firma bist? Oder wenn du auf eine Geschäftsreise gehst? Soll ich bis zum Lebensende an dir kleben wie eine Klette? Das wäre doch nicht gerecht. So was kann man doch nicht als zwischenmenschliche Beziehung bezeichnen, oder? Irgendwann hättest du es satt mit mir. ›Was ist aus meinem Leben geworden?‹, würdest du dich fragen. ›Ich kann doch nicht ständig nur auf diese Frau aufpassen.‹ Das könnte ich nicht ertragen. Außerdem wäre es keine Lösung für meine Probleme.«
»Aber die wirst du doch nicht dein ganzes Leben lang mit dir herumschleppen.« Ich berührte ihren Rücken. »Eines Tages hast du es überstanden. Und dann können wir alles noch einmal überdenken und neu anfangen. Vielleicht brauche ich dann sogar deine Hilfe. Wir gehen doch mit unserem Leben nicht um wie Buchhalter. Wenn du mich brauchst, dann stehe ich dir eben zur Verfügung. Verstehst du? Warum siehst du das so eng? Du musst entspannter sein. Lass dich gehen, ich fange dich auf. Du bist so verkrampft, dass du natürlich immer das Schlimmste befürchtest. Entspann dich doch mal, dann geht’s dir auch gleich besser.«
»Was redest du da eigentlich?« Naokos Stimme klang auf einmal rauh.
An ihrem Ton erkannte ich, dass ich wohl etwas Falsches gesagt hatte.
»Warum sagst du so was?« Naoko starrte auf die Erde zu ihren Füßen. »›Alles wird leichter, wenn man sich entspannt.‹ Das weiß ich selbst. Und es nützt mir überhaupt nichts, wenn du mir das sagst. Wenn ich mich entspanne, zerfalle ich in tausend Partikel. Mit diesem Gefühl lebe ich schon lange, damit muss ich weiterleben. Wenn ich mich einmal gehen ließe, fände ich keinen Weg mehr zurück. Ich würde zerfallen, und die Fragmente würden in alle Winde verstreut. Warum begreifst du das nicht? Wie kannst du dich um mich kümmern wollen, wenn du nicht einmal das begreifst?«
Ich schwieg.
»Ich bin viel verstörter, als du denkst. Düster, kalt und verstört … Warum hast du damals überhaupt mit mir geschlafen? Warum hast du mich nicht in Ruhe gelassen?«
Die Stille des Kiefernwaldes, den wir nun durchquerten, wirkte bedrückend. Die auf dem Weg verstreuten, ausgetrockneten Panzer der Zikaden, die den Sommer nicht überlebt hatten, knackten unter unseren Schritten. Naoko und ich gingen langsam und mit gesenkten Blicken durch den Wald, als suchten wir etwas, das wir verloren hatten.
»Entschuldige«, sagte Naoko und nahm sanft meinen Arm. Dann schüttelte sie den Kopf. »Ich wollte dich nicht kränken. Nimm dir nicht zu Herzen, was ich gesagt habe. Es tut mir wirklich leid. Ich war bloß wütend auf mich selbst.«
»Ich glaube, ich verstehe dich noch nicht richtig«, gab ich zu. »Ich bin nicht besonders helle, und es dauert ein bisschen, bis ich etwas kapiere. Aber wenn du mir Zeit lässt, dann werde ich lernen, dich besser zu verstehen als irgendjemand sonst auf der Welt.«
Wir hielten inne und lauschten in den schweigenden Wald hinein. Ich wühlte mit der Schuhspitze in den Zikadenpanzern und Kiefernzapfen und schaute hinauf zum Himmel, der zwischen den Zweigen der Kiefern hindurchschimmerte. Die Hände in den Taschen, starrte Naoko nachdenklich vor sich hin.
»Sag mal, Tōru, liebst du mich?«
»Natürlich«, antwortete ich.
»Darf ich dir zwei Dinge sagen?«
»Klar, sogar drei.«
Naoko schüttelte lachend den Kopf. »Zwei reichen. Nur zwei. Erstens bin ich dir sehr dankbar, dass du mich besuchst. Damit hast du mir eine große Freude gemacht – mir unendlich viel geholfen. Vielleicht kann ich es nicht richtig zeigen, aber es ist so.«
»Ich komme dich wieder besuchen«, sagte ich. »Und das zweite?«
»Ich möchte, dass du mich nie vergisst. Versprich mir, dass du dich immer daran erinnern wirst, dass es mich gab und dass ich hier neben dir gestanden habe? Bitte.«
»Natürlich werde ich mich immer daran erinnern.«
Sie sagte nichts mehr und ging mir nun voraus. Das Herbstlicht drang durch die Zweige und tanzte auf den Schultern ihrer Jacke. Wieder bellte ein Hund. Mir kam es vor, als seien wir dem Gebell ein bisschen näher gekommen. Naoko stieg eine kleine Erhebung hinauf, trat aus dem Kiefernwald und rannte einen sanften Abhang hinunter. Ich war zwei oder drei Schritte hinter ihr.
»Bleib hier bei mir. Der Brunnen könnte hier irgendwo in der Nähe sein«, rief ich ihr nach.
Naoko blieb stehen, lächelte und ergriff sanft meinen Arm. Den Rest des Weges gingen wir nebeneinander her.
»Wirst du mich bitte wirklich nie vergessen?«, fragte Naoko mit leiser, fast flüsternder Stimme.
»Niemals. Ich könnte dich nie vergessen.«
Dennoch scheinen meine Erinnerungen zunehmend zu verblassen. Zu vieles ist mir schon entglitten, und wenn ich die Geschehnisse so aus dem Gedächtnis niederzuschreiben versuche, überfällt mich zuweilen eine schreckliche Unsicherheit. Dann frage ich mich, ob ich nicht vielleicht das Wichtigste ausgelassen habe oder ob es in meinem Inneren einen finsteren Ort, eine Art Gedächtnisfegefeuer, geben könnte, in dem alle wichtigen Erinnerungen zusammengekehrt und in Asche verwandelt werden.
Wie dem auch sei, mehr habe ich eben nicht in der Hand. Was bleibt mir übrig, als mich an diese bereits schwachen, von Augenblick zu Augenblick mehr verblassenden, unvollständigen Erinnerungen zu klammern und in dem Gefühl, an einem blanken Knochen zu saugen, weiterzuschreiben. Nur so habe ich eine Chance, das Versprechen zu halten, das ich Naoko gegeben habe.
Früher, als ich noch jung und die Erinnerungen noch viel frischer waren, habe ich oft versucht, über Naoko zu schreiben. Aber niemals brachte ich auch nur eine einzige Zeile zustande. Dabei wusste ich genau, wenn ich nur eine Zeile schaffte, würde sich die ganze Geschichte wie von selbst schreiben, doch diese eine Zeile brachte ich partout nicht zustande. Alles war noch zu deutlich, sodass ich nie wusste, wo ich beginnen sollte – wie eine allzu detaillierte Landkarte meist eher den Blick verstellt, als eine Hilfe zu sein. Doch nun kann ich es, denn mir ist endlich klar geworden, dass sich unvollkommene Erinnerungen und unvollkommene Gedanken nur in einem ebenso unvollkommenen Gefäß aus geschriebenen Worten auffangen lassen. Je stärker die Erinnerung an Naoko in mir verblasst, desto tiefer wird mein Verständnis für sie. Inzwischen habe ich begriffen, warum sie mich bat, sie nicht zu vergessen. Natürlich wusste Naoko Bescheid. Sie wusste genau, dass meine Erinnerung an sie verblassen würde, und nahm mir das Versprechen ab, sie nicht zu vergessen. Mich für immer an ihre Existenz zu erinnern.
Dieses Wissen erfüllt mich mit fast ebenso unerträglicher Trauer wie das Wissen, dass Naoko mich nie geliebt hat.
2
Vor langer, langer Zeit – auch wenn es höchstens zwanzig Jahre her sein kann – lebte ich in einem Studentenwohnheim. Ich war achtzehn und hatte gerade mein Studium begonnen. Weil ich mich in Tokio nicht auskannte und zum ersten Mal allein leben würde, hatten meine besorgten Eltern dieses Wohnheim ausfindig gemacht. Nicht nur erleichterten dort verschiedene praktische Einrichtungen einem unbedarften Achtzehnjährigen das Leben, sondern man wurde auch verpflegt. Bei dieser Entscheidung hatten auch die Kosten eine Rolle gespielt, denn natürlich war ein Wohnheimplatz billiger als ein Privatzimmer. Bettzeug und eine Lampe genügten, Mobiliar brauchte nicht angeschafft zu werden. Wäre es nach mir gegangen, hätte ich ein eigenes Apartment vorgezogen und es mir allein gemütlich gemacht, aber in Anbetracht der Einschreibe- und Studiengebühren für die Privatuni, auf die ich gehen würde, sowie meines monatlichen Unterhalts konnte ich mich schlecht beschweren. Und im Grunde war es mir egal, wo ich wohnte.
Das Wohnheim lag, von einer hohen Betonmauer umgeben, auf einem Hügel mit Blick auf die Stadt. Gleich hinter dem Tor zu dem weitläufigen Areal stand ein riesiger, hoch in den Himmel ragender Keyaki-Baum, angeblich mindestens hundertfünfzig Jahre alt. Sein grünes Blätterwerk war so dicht, dass man, wenn man zu seinen Füßen stand, den Himmel nicht mehr sah.
Ein betonierter Weg wand sich um den riesigen Baum herum und verlief dann in einer langen Geraden durch den Hof, auf dem zwei einander gegenüberliegende zweistöckige Betongebäude mit zahlreichen Fenstern standen. Sie wirkten wie ein ehemaliges Gefängnis, das man in Apartments umgewandelt hatte. Andererseits hätten es auch Apartments sein können, die man zum Gefängnis umgebaut hatte. Die Gebäude hatten jedoch nichts Schmuddliges, sie wirkten nicht einmal düster. Aus den geöffneten Fenstern ertönte unablässig Radiomusik. Die Vorhänge waren ebenso wie die Räume cremefarben, damit die Sonne sie nicht ausbleichen konnte.
Dem Weg folgend, gelangte man zum einstöckigen Hauptgebäude, in dessen Erdgeschoss sich die Kantine und das Gemeinschaftsbad befanden. Im ersten Stock waren die Aula, Gemeinschaftsräume und sogar Gästezimmer, von denen ich mir nie so recht vorstellen konnte, wem und wozu sie dienten. Daran angrenzend stand noch ein drittes, ebenfalls zweistöckiges Wohnheimgebäude. Auf den ausgedehnten Rasenflächen drehten sich Rasensprenger, deren Sprühregen im Sonnenschein funkelte. Hinter dem Hauptgebäude lagen ein Baseball- und ein Fußballplatz sowie sechs Tennisplätze. Es fehlte also an nichts.
Das einzige Problem war der etwas verdächtige politische Ruf, der dem Wohnheim anhaftete. Es wurde von irgendeiner undurchsichtigen Organisation um einen ultrarechten Typ geleitet. Die Politik der Leitung war – zumindest in meinen Augen – höchst sonderbar. Man wusste gleich einigermaßen Bescheid, wenn man das Faltblatt für neue Studenten und die Hausordnung las. Die Gründungsdevise des Wohnheims bestand in der »Anwendung erzieherischer Grundsätze zum Zwecke der Förderung vielversprechender Talente zum höchsten Wohl und Nutzen der Nation«, und angeblich hatten zahlreiche Größen aus der Finanzwelt, die gleichen Sinnes waren, private Mittel in dieses Projekt investiert. So lautete zumindest die offizielle Version, doch was sich hinter den Kulissen abspielte, war mehr als undurchsichtig. Niemand wusste etwas Genaues. Einige behaupteten, es gehe um Steuerhinterziehung oder einen Publicity-Trick, während wieder andere vermuteten, das Wohnheim sei nur gebaut worden, damit sich jemand ein Grundstück in bevorzugter Lage unter den Nagel reißen konnte. Jedenfalls gab es im Wohnheim so etwas wie einen Eliteclub, dem Star-Studenten mehrerer Universitäten angehörten. Einzelheiten waren mir nicht bekannt, außer dass sich mehrmals im Monat Arbeitsgemeinschaften trafen, in denen auch die Gründer mitmischten. Die Mitglieder dieses Clubs hatten, was ihren künftigen Arbeitsplatz betraf, ausgesorgt, hieß es. Ich wusste nicht, wie viel an diesen Gerüchten stimmte, aber immerhin spürte man deutlich, dass hier irgendetwas faul war.
Jedenfalls verbrachte ich zwei Jahre – Frühjahr 1968 bis zum Frühjahr 1970 – in diesem nicht ganz astreinen Wohnheim. Warum ich es so lange dort aushielt, vermag ich nicht mehr zu sagen. Im alltäglichen Leben macht es wohl keinen großen Unterschied, ob man in einem rechten oder linken Wohnheim, bei guten oder schlechten Heuchlern lebt.
Jeder Tag im Wohnheim begann mit dem feierlichen Hissen der japanischen Flagge. Es versteht sich von selbst, dass währenddessen die Nationalhymne gespielt wurde, denn das Hissen der Flagge ist ebensowenig von der Nationalhymne zu trennen wie der Sportpalastwalzer vom Sechstagerennen. Der Flaggenmast stand genau im Zentrum des Geländes, sodass er von allen Fenstern der Wohnheimgebäude sichtbar war.
Zuständig für die Flaggenzeremonie war der Leiter des Ostgebäudes (in dem auch ich wohnte). Er war ein großer Mann um die sechzig mit scharfem Blick und kurzgeschorenem, graumeliertem Haar. Über seinen wettergegerbten Nacken zog sich eine lange Narbe. Es ging das Gerücht, er sei Absolvent der Nakano-Militärakademie, aber wie üblich gab es dafür keine Beweise. Beim Hissen der Fahne fungierte ein Student als sein Adjutant. Wer dieser Student war, wusste auch niemand. Er trug einen Bürstenschnitt und nie ein anderes Kleidungsstück als seine Studentenuniform. Ich wusste weder, wie er hieß, noch, in welchem Zimmer er wohnte. Im Speisesaal oder im Bad hatte ich ihn auch noch nie gesehen. Vielleicht war er überhaupt kein Student, aber andererseits trug er ja die Uniform. Was hätte er also sonst sein sollen? Neben Herrn Nakano-Militärakademie wirkte er klein, dicklich und blass. Dieses seltsame Paar hisste also Morgen für Morgen um Punkt sechs Uhr mitten auf dem Hof das Banner der aufgehenden Sonne.
Als ich noch neu im Wohnheim war, stand ich oft aus Neugier um sechs Uhr auf, um das patriotische Schauspiel zu beobachten. Die beiden erschienen stets exakt in dem Moment auf dem Hof, wenn es im Radio sechs Uhr piepste. Der in der Uniform trug natürlich seine Uniform und schwarze Lederschuhe, Nakano-Militärakademie kam in Anorak und Turnschuhen. Uniform hielt einen flachen Kasten aus Paulowniaholz, während Nakano einen Sony-Kassettenrecorder unter dem Arm trug, den er am Fuß des Mastes abstellte. Uniform öffnete den Kasten aus Paulowniaholz, in dem ordentlich gefaltet die Flagge lag. Ehrerbietig präsentierte er sie Nakano, der sie nun am Seil des Fahnenmastes befestigte, worauf Uniform den Kassettenrecorder einschaltete.
Die Nationalhymne ertönte.
Feierlich wurde die Fahne gehisst.
Bei »Bis zum Fels der Stein geworden« hatte die Flagge etwa halbe Höhe erreicht, bei »übergrünt von Moosgeflecht, tausend, abertausend Jahre blühe, Kaiserliches Reich« war sie ganz oben angelangt. Bei klarem Himmel und frischem Wind boten die beiden, wie sie in strammer Habachtstellung zur Fahne hinaufschauten, einen erhebenden Anblick.
Am Abend wurde die Zeremonie beim Einholen der Flagge wiederholt. Nur eben umgekehrt. Sie glitt den Mast hinab und wurde in den Paulowniakasten gebettet, denn die Fahne wehte nicht in der Nacht.
Warum sie abends eingeholt wurde, konnte ich mir nicht erklären. Die Nation existierte doch auch in der Nacht, und viele Menschen arbeiteten während dieser Zeit: Schienenarbeiter, Taxifahrer, Bardamen, Feuerwehrleute und Nachtwächter. Es kam mir ungerecht vor, dass die Nachtarbeiter so nicht in den Genuss nationalen Schutzes kommen konnten. Oder vielleicht kam es auch gar nicht darauf an und es war allen egal – außer mir. Und selbst ich dachte nur darüber nach, weil sich mir ein Anlass geboten hatte.
Den Hausregeln entsprechend wurden die Erst- und Zweitsemester auf Doppelzimmer verteilt, während die älteren Studenten Einzelzimmer bewohnten. Die Doppelzimmer waren etwas über sechs Tatami groß und ein wenig schlauchartig. Gegenüber der Tür befand sich ein Fenster mit Aluminiumrahmen, vor dem zwei Schreibtische und zwei Stühle so aufgestellt waren, dass man Rücken an Rücken arbeiten konnte. Links von der Tür stand ein Etagenbett aus Metall. Die ganze Ausstattung war äußerst robust und spartanisch. Außer dem Bett und den Schreibtischen gab es noch zwei Spinde, ein Kaffeetischchen und ein paar Einbauregale. Selbst ein sehr wohlwollender Betrachter hätte den Raum nicht als reizvoll bezeichnen können. Auf den Regalen der meisten Zimmer türmten sich Transistorradios, Haartrockner, Tauchsieder und Kocher, Instantkaffee, Teebeutel, Zuckerwürfel und einfaches Geschirr, in dem man Fertigsuppen zubereiten konnte. An den Wänden klebten Pin-ups aus Heibon Punch oder irgendwo geklaute Pornofilmposter. Aus Witz hatte jemand ein Bild von zwei kopulierenden Schweinen aufgehängt, aber so etwas war eine Ausnahme; üblich waren Fotos von nackten Frauen, jungen Schauspielerinnen oder Sängerinnen. In den Regalen über den Schreibtischen reihten sich die üblichen Lehrbücher, Lexika und Romane.
Da die Bewohner ausschließlich junge Männer waren, befanden sich die Zimmer meist in üblem Zustand. Am Boden der Abfalleimer klebten schimmlige Mandarinenschalen, die Zigarettenkippen standen zehn Zentimeter hoch in den als Aschenbecher verwendeten leeren Dosen, die, wenn sie zu schwelen begannen, mit Kaffee oder Bier gelöscht wurden und dann säuerlich vor sich hin stanken. Alles Geschirr war irgendwie schwärzlich, überall lag undefinierbarer Müll herum. Verpackungen von Fertigsuppen, leere Bierflaschen und Deckel von wer weiß was waren über den Boden verstreut. Niemand kam auf die Idee, den ganzen Schrott einmal zusammenzufegen und in die Abfalltonne zu befördern. Jeder Windzug wirbelte Staubwolken auf. Dazu miefte es in allen Zimmern fürchterlich. Zwar hatte jedes Zimmer einen eigenen charakteristischen Geruch, aber die Komponenten waren stets die gleichen. Schweiß, Körperausdünstungen und Müll. Schmutzige Wäsche wurde unters Bett geschmissen, und da niemand sein Bettzeug regelmäßig lüftete, verströmten die schweißgetränkten Matratzen einen unsäglichen Gestank. Noch heute erscheint es mir wie ein Wunder, dass in diesem Chaos keine lebensbedrohlichen Seuchen ausbrachen.
Verglichen mit diesen Zimmern wirkte unseres steril wie eine Leichenhalle. Auf dem Boden lag kein Stäubchen, das Fenster war blitzblank, die Matratzen wurden jede Woche gelüftet, die Bleistifte standen im Bleistiftständer, und sogar die Gardinen wurden einmal im Monat gewaschen, denn mein Mitbewohner war ein krankhafter Sauberkeitsfanatiker. Als ich den anderen von den Gardinen erzählte, wollte niemand mir glauben. Sie wussten nicht einmal, dass man Gardinen überhaupt waschen konnte, denn sie gehörten ja quasi zum Fenster. »Der ist doch nicht normal«, hieß es, und bald nannten sie ihn nur noch den Nazi oder Sturmbannführer.
Anstelle von Pin-ups zierte unser Zimmer das Bild einer Amsterdamer Gracht. Meinen einzigen Versuch, ein Aktfoto aufzuhängen, hatte mein Zimmergenosse mit den Worten »Watanabe, du weißt doch, dass ich für so was nicht viel übrig habe« zunichte gemacht und anschließend das Bild von der Gracht angebracht. Da mir das Aktposter nicht besonders am Herzen gelegen hatte, protestierte ich nicht, aber sooft Besuch kam, war die Reaktion auf das Grachtenbild ein einhelliges: »Was soll denn das sein!?«
»Ach, das ist Sturmbannführers Wichsvorlage«, sagte ich dann beiläufig. Eigentlich sollte das ein Witz sein, aber alle nahmen es für bare Münze, sodass ich am Ende beinahe selbst daran glaubte.
Man bemitleidete mich, weil ich das Zimmer mit Sturmbannführer teilen musste, aber mir machte es eigentlich gar nicht so viel aus. Er ließ mich in Ruhe, solange ich meine Zimmerhälfte in Ordnung hielt. Also hatte ich wahrscheinlich sogar Glück, denn er übernahm das Putzen, lüftete das Bettzeug und brachte den Müll raus. Wenn ich drei Tage zu beschäftigt gewesen war, um ein Bad zu nehmen, schnupperte er vielsagend an mir, um mich daran zu erinnern. Er wies mich sogar darauf hin, wenn es Zeit war, zum Friseur zu gehen oder mir die Nasenhaare zu schneiden. Als störend empfand ich lediglich, dass er beim Anblick eines einzigen Insekts das Zimmer mit Wolken von Insektenspray eingaste und ich Zuflucht in einem der benachbarten Schweineställe suchen musste.
Sturmbannführer studierte Geografie an einer staatlichen Universität.
»Ich beschäftige mich mit Ka-Ka-Karten«, erklärte er mir bei unserer ersten Begegnung.
»Du interessierst dich für Landkarten?« fragte ich.
»Hm, wenn ich die Uni fertig habe, will ich fürs japanische kartografische Institut arbeiten und Ka-Ka-Karten machen.«
Die Vielfalt der Interessen und Lebensziele auf dieser Welt beeindruckte mich tief. In meiner Anfangszeit in Tokio hatte diese Erkenntnis zu meinen ersten und eindrücklichsten Überraschungen gehört. In der Tat wäre es doch sehr nachteilig, wenn es nicht zumindest einige Menschen mit einem Interesse, ja, sogar einer Leidenschaft für Landkarten gäbe. Sonderbar fand ich allerdings, dass jemand, der das Wort »Karte« nicht einmal aussprechen konnte, ohne zu stottern, Mitarbeiter des staatlichen kartografischen Instituts werden wollte.
»Wa-wa-was ist denn dein Hauptfach?« fragte er mich.
»Theater«, erwiderte ich.
»Du meinst, Theater spielen?«
»Nein, nein, Dramen lesen und theoretisch arbeiten. Racine, Ionesco, Shakespeare und so.«
Abgesehen von Shakespeare hatte er keinen der Namen je gehört. Allerdings wusste ich selbst über diese Autoren kaum mehr als ihre Namen, und die hatten im Vorlesungsverzeichnis gestanden.
»Na ja, jedenfalls magst du Theaterstücke«, sagte er.
»Ach, nicht besonders.«
Die Antwort verunsicherte ihn, und wenn er verunsichert war, verschlimmerte sich sein Stottern. Ich fühlte mich schuldig.
»Mir wäre eigentlich alles recht gewesen«, sagte ich zu ihm. »Ethnologie oder asiatische Geschichte hätten es auch getan. Ich hatte nur gerade Lust auf Theaterwissenschaft. Das ist alles.« Natürlich befriedigte ihn diese Erklärung keineswegs.
»Versteh ich nicht«, sagte er mit wirklich verständnislosem Gesicht. »Ich ma-ma-mag Ka-ka-karten, deshalb studiere ich Ka-ka-kartografie, und dafür bin ich extra nach Tokio auf die Uni gekommen und kriege Geld von zu Hause. Bei dir ist es doch genauso, oder?«
Natürlich hatte er recht. Also verzichtete ich lieber auf weitere Erklärungen zur Wahl meines Studienfachs. Anschließend losten wir mit Streichhölzern die Betten aus. Er bekam das obere, ich das untere.
Seine Garderobe bestand tagaus tagein aus einem weißen Hemd, einer schwarzen Hose und einem marineblauen Pullover; sein Haar trug er kurzgeschoren. Er war groß und hatte hohe Wangenknochen. Zur Uni ging er natürlich immer in Uniform. Schuhe und Mappe glänzten tiefschwarz. Er vermittelte in allem den Anschein eines Studenten aus dem rechten Lager. Deshalb nannten ihn auch alle Sturmbannführer, obwohl er sich in Wirklichkeit nicht die Bohne aus Politik machte und die Uniform nur trug, um sich nicht um die Auswahl seiner Kleidung kümmern zu müssen. Sein Interesse galt ausschließlich solchen Themen wie der Veränderung von Küstenlinien oder der Fertigstellung eines neuen Eisenbahntunnels. Wenn sich die Gelegenheit bot, stotterte er stundenlang unverdrossen auf seine bedauernswerten Gesprächspartner ein, bis sie entweder die Flucht ergriffen oder einschliefen.
Jeden Morgen um sechs, wenn die Hymne ertönte, sprang er aus dem Bett und strafte damit jeden Lügen, der behauptet hätte, die gravitätische Flaggenzeremonie sei für die Katz. Er zog sich an und ging ins Bad, um seine Morgentoilette vorzunehmen, wozu er Ewigkeiten brauchte. Man hätte meinen können, er nähme jeden Zahn einzeln heraus, um ihn zu putzen. Wieder im Zimmer, schüttelte er knallend sein Handtuch aus und hängte es zum Trocknen über die Heizung. Bis er seine Zahnbürste und Seife ordentlich zurück ins Regal gelegt hatte, war es Zeit für die Morgengymnastik im Radio.
Ich las meist bis spät in die Nacht und schlief bis acht, sodass ich, wenn er im Zimmer zu rumoren und nach den Anweisungen aus dem Radio zu turnen begann, noch im Halbschlaf lag. Zumindest, bis der Teil der Übungen mit den Sprüngen kam. Damit weckte er mich unweigerlich. Bei jedem Sprung – und er sprang sehr hoch – war die Erschütterung so gewaltig, dass sich das Bett vom Boden hob. Drei Tage lang hielt ich durch, da man uns eindringlich erklärt hatte, dass das Gemeinschaftsleben ein gewisses Maß an Duldsamkeit erfordere, doch am Morgen des vierten Tages hielt ich es nicht länger aus.
»Hör mal, kannst du deine Übungen nicht auf dem Dach oder sonstwo machen«, sagte ich ohne Umschweife. »Wie soll man denn dabei schlafen?«
»Aber es ist doch schon halb sieben«, erwiderte er voll ungläubigen Staunens.
»Weiß ich. Na und? Für mich ist halb sieben Uhr noch Schlafenszeit. Ich kann’s dir nicht erklären, aber so ist es eben.«
»Geht nicht. Wenn ich auf dem Dach turne, beschweren sich die Leute im zweiten Stock. Hier sind wir über einer Abstellkammer, also kann keiner meckern.«
»Dann geh auf den Hof. Oder auf den Rasen.«
»Geht auch nicht. Wa-wa-weil ich kein Transistorradio habe – ich brauch Strom. Und ohne Radio kann man die Radiogymnastik nicht machen.«
Es stimmte, sein Radio war ein schrecklich alter Kasten mit Netzanschluss. Ich hatte zwar ein Transistorradio, aber es funktionierte nur auf UKW. Na, klasse, dachte ich.
»Also gut, Kompromiss: Du machst deine Gymnastik, aber ohne das Springen. Das ist unheimlich laut. In Ordnung?«
»Das Springen?«, fragte er erstaunt zurück. »Was ist das?«
»Springen ist Springen. Hops, hops. Das eben.«
»Aber das mache ich doch gar nicht.«
Mein Kopf begann zu schmerzen. Ich war drauf und dran aufzugeben, aber dann wollte ich meinen Standpunkt doch noch einmal verdeutlichen und hopste auf und nieder, wobei ich die Anfangsmelodie der NHK-Gymnastiksendung sang.
»Siehst du, das meine ich.«
»Ach das, ja stimmt. Ist mi-mi-mir gar nicht aufgefallen.«
»Na also«, sagte ich und setzte mich aufs Bett. »Den Teil lässt du aus. Das andere kannst du von mir aus machen. Nur mit der Hopserei hörst du auf und lässt mich in Ruhe schlafen, ja?«
»Das geht nicht«, erwiderte er trocken. »Ich kann nicht einfach eine Übung auslassen. Seit zehn Jahren mache ich täglich die Gymnastik, und wenn ich anfange, mache ich automatisch bis zum Ende weiter. Wenn ich was weglasse, ka-ka-kann ich das Ganze nicht machen.«
Was sollte ich dazu sagen? Was hätte ich noch sagen können? Der einfachste und schnellste Weg wäre gewesen, sein verdammtes Radio, wenn er nicht im Zimmer war, aus dem Fenster zu schmeißen, aber dann wäre die Hölle losgewesen. Sturmbannführer gehörte zu den Menschen, die äußerst sorgsam mit ihren Sachen umgehen. Als er mich so sprachlos auf meinem Bett sitzen sah, bekam er Mitleid mit mir.
»Ach komm, Wa-wa-watanabe, wir stehen einfach zusammen auf und machen die Übungen«, tröstete er mich lächelnd und machte sich auf den Weg zum Frühstück.
Naoko kicherte, als ich ihr die Geschichte von Sturmbannführer und seiner Radiogymnastik erzählte. Ich hatte die Geschichte gar nicht als Witz erzählt, aber nun musste ich selber lachen. Ich sah Naoko zum ersten Mal lachen, auch wenn ihr Kichern sogleich wieder erstarb.
Wir waren in Yotsuya aus der Bahn gestiegen und trotteten auf dem Bahndamm entlang in Richtung Ichigaya. Es war ein Sonntagnachmittag Mitte Mai. Die kurzen Regenschauer vom Morgen hatten bis zum Mittag völlig aufgehört, und ein Südwind hatte die tiefhängenden Regenwolken davongejagt. Das frische Grün der Kirschbäume tanzte im Wind und leuchtete im Sonnenschein. An diesem frühsommerlichen Tag hatten die Passanten ihre Pullover und Jacken ausgezogen und trugen sie über der Schulter oder dem Arm. Alle wirkten glücklich an diesem warmen Sonntagnachmittag. Die jungen Männer auf den Tennisplätzen jenseits des Bahndamms hatten die Hemden ausgezogen und schwangen nun mit freiem Oberkörper die Schläger. Nur zwei Nonnen saßen in schwarzem, winterlichem Habit auf einer Bank, als wäre die sommerliche Wärme nicht bis zu ihnen vorgedrungen, aber selbst diese beiden machten zufriedene Gesichter und plauderten sichtlich mit Genuss.
Nach fünfzehn Minuten war mein Rücken so nass geschwitzt, dass ich mein dickes Baumwollhemd auszog und im T-Shirt weiterging. Naoko hatte die Ärmel ihres leichten grauen, adrett verwaschenen Sweatshirts aufgerollt. Ich hatte das Gefühl, ich hätte sie schon einmal vor langer Zeit in einem ähnlichen Hemd gesehen, konnte mich aber nicht genau erinnern. Es war nur ein Gefühl. Zu jener Zeit hatte ich noch nicht allzu viele Erinnerungen, die Naoko betrafen.
»Wie lebt es sich denn so im Wohnheim? Macht es Spaß, mit anderen zusammenzuwohnen?« fragte sie.
»Weiß nicht genau. Ich bin ja erst einen Monat da. Aber es ist gar nicht so übel. So richtig unerträglich ist eigentlich nichts.«
Sie machte an einem Trinkbrunnen halt, um einen Schluck Wasser zu nehmen. Danach zog sie ein weißes Taschentuch aus der Hosentasche und wischte sich den Mund ab, dann bückte sie sich und band sich sorgfältig die Schuhe.
»Glaubst du, ich könnte auch so leben?«
»Mit anderen zusammen?«
»Ja«, sagte Naoko.
»Hm, warum nicht? Alles eine Frage der Einstellung. Es gibt schon einiges Störende, wenn man sich was draus macht. Lästige Vorschriften, großmäulige Typen, Mitbewohner, die um halb sieben Radiogymnastik machen. Aber das ist wahrscheinlich überall so ähnlich. Irgendwie kommt man schon über die Runden.«
»Wahrscheinlich.« Sie nickte und schien darüber nachzudenken. Erst als sie mich anstarrte, als nähme sie einen seltsamen Gegenstand unter die Lupe, fiel mir auf, wie tief und klar ihre Augen waren. Andererseits hatte ich auch noch nie Gelegenheit gehabt, ihr so tief in die Augen zu schauen. Es war das erste Mal, dass wir beide allein spazierengingen.
»Hast du denn vor, in ein Wohnheim zu ziehen?« fragte ich.
»Nein, eigentlich nicht. Ich hab nur überlegt, wie das Leben in einer Gemeinschaft wohl ist. Und außerdem …« Sie biss sich auf die Lippen, offenbar auf der Suche nach den richtigen Worten, die sie aber nicht zu finden schien. Seufzend senkte sie den Blick. »Ach, ich weiß auch nicht, vergiss es.«
Das war das Ende des Gesprächs. Naoko ging weiter in Richtung Osten, und ich folgte ihr sozusagen auf dem Fuße.
Fast ein Jahr war vergangen, seit ich Naoko das letzte Mal gesehen hatte. In diesem einen Jahr hatte sie so sehr abgenommen, dass sie kaum wiederzuerkennen war. Ihre früher runden Wangen waren eingefallen, ihr Hals war schlank und zart geworden, und dennoch sah sie nicht hager oder krankhaft abgezehrt aus. Ihre zierliche Gestalt verströmte eine natürliche Gelassenheit, als hätte sie sich so lange in einem langen schmalen Raum versteckt gehalten, bis ihr Körper sich ihm angepasst hatte. Sie war zudem viel hübscher, als ich sie in Erinnerung gehabt hatte. Ich hätte ihr das gerne gesagt, aber da ich nicht wusste, wie, hielt ich lieber den Mund.
Wir hatten uns nicht verabredet, sondern waren uns zufällig in der U-Bahn begegnet. Sie war auf dem Weg ins Kino, und ich wollte ein bisschen in den Antiquariaten von Kanda stöbern – beides nicht gerade unaufschiebbare Vorhaben. Komm, wir steigen aus, hatte Naoko an der Haltestelle Yotsuya vorgeschlagen. Da wir einander eigentlich nichts Bestimmtes zu sagen hatten, war mir ziemlich rätselhaft, warum Naoko diesen Vorschlag machte. Von Anfang an hatten wir kein richtiges Gesprächsthema gefunden.
Kaum waren wir aus dem Bahnhof heraus, da setzte Naoko sich in Bewegung, ohne zu sagen, wohin. Mir blieb nichts anderes übrig, als ihr zu folgen. Ich hätte sie natürlich leicht einholen können, aber irgendetwas hielt mich davon ab. Also folgte ich ihr in einem Meter Abstand, den Blick auf ihren Rücken und ihr glattes schwarzes Haar gerichtet, das von einer großen braunen Haarspange gehalten wurde. Wenn sie sich zur Seite wandte, fiel mein Blick auf ein zierliches weißes Ohr. Von Zeit zu Zeit drehte sie sich nach mir um und sagte etwas. Auf einige ihrer Fragen konnte ich leicht antworten, auf andere wusste ich nichts zu sagen. Manchmal verstand ich auch nicht, was sie sagte. Anscheinend spielte es jedoch keine Rolle für sie, ob ich sie hörte oder nicht. Wenn sie gesagt hatte, was sie sagen wollte, drehte Naoko sich wieder nach vorn und marschierte weiter. Ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass es immerhin ein schöner Tag für einen Spaziergang war.
Doch Naokos Schritte waren eigentlich zu zielstrebig für einen bloßen Spaziergang. In Iidabashi bog sie nach rechts ab, sodass wir am Graben herauskamen, überquerte die Kreuzung Jinbochō und ging den Hügel in Ochanomizu hinauf, bis wir schließlich in Hongō waren. Von dort folgte sie den Straßenbahnschienen bis Komagome. Nicht gerade ein kleiner Bummel. Als wir in Komagome ankamen, ging bereits die Sonne unter, und eine milde, frühlingshafte Abenddämmerung brach an.
»Wo sind wir hier?« fragte Naoko. Erst jetzt schien sie die Umgebung wahrzunehmen.
»In Komagome. Hast du das nicht gewusst? Wir haben einen Riesenbogen gemacht.«
»Was wollen wir denn hier?«
»Du bist doch vorgegangen. Ich bin dir einfach nur gefolgt.«
Wir gingen in einen Soba-Imbiss am Bahnhof, um rasch etwas zu essen. Ich hatte Durst und trank ein ganzes Bier alleine aus. Nachdem wir bestellt hatten, sprachen wir bis nach dem Essen kein Wort mehr. Ich war erschöpft von der Lauferei, und sie hatte die Hände auf den Tisch gelegt und war anscheinend in Gedanken versunken. Der Nachrichtensprecher im Fernsehen berichtete, dass am heutigen Sonntag alle Ausflugsorte überfüllt gewesen waren. Und wir sind von Yotsuya bis nach Komagome getrabt, dachte ich.
»Du bist gut in Form«, sagte ich, als ich meine Nudeln aufgegessen hatte.
»Überrascht dich das?«
»Ja, schon.«
»In der Mittelstufe war ich Langstreckenläuferin und konnte zehn, fünfzehn Kilometer am Stück laufen. Das kam wohl auch, weil mein Vater mich von klein auf sonntags immer in die Berge mitgenommen hat. Gleich hinter unserem Haus fängt ja schon das Gebirge an. Da habe ich natürlich kräftige Beine gekriegt.«
»Das sieht man nicht.«
»Ich weiß. Alle halten mich für ein sehr zartes Mädchen. Aber der Schein trügt.« Ein kaum wahrnehmbares, winziges Lächeln huschte über ihr Gesicht, als sie das sagte.
»Tut mir leid, aber ich bin fix und fertig.«
»Entschuldige, jetzt habe ich dich den ganzen Tag durch die Gegend gehetzt.«
»Aber ich bin froh, dass wir uns mal unterhalten konnten. Das haben wir noch nie gemacht, nur wir beide, meine ich«, sagte ich, obwohl ich nicht den geringsten Schimmer mehr hatte, worüber wir uns angeblich unterhalten hatten.
Geistesabwesend spielte sie mit dem Aschenbecher, der auf dem Tisch stand.
»Also, wenn es dir recht wäre – ich meine, wenn es keine Last für dich wäre –, könnten wir uns dann vielleicht wieder einmal treffen? Selbstverständlich weiß ich, dass es mir nicht zusteht, dich um so was zu bitten.«
»Es steht dir nicht zu?«, fragte ich erstaunt. »Was meinst du damit?«
Sie wurde rot. Vielleicht hatte ich allzu erstaunt reagiert.
»Ich kann’s nicht erklären«, verteidigte sie sich. Dabei streifte sie die Ärmel ihres Sweatshirts bis zum Ellbogen hoch und zog sie dann wieder herunter. Im Schein des elektrischen Lichts schimmerte der Flaum auf ihren Armen wunderhübsch golden. »Eigentlich wollte ich es anders ausdrücken, aber mir ist nichts Besseres eingefallen.«
Naoko stützte die Ellbogen auf den Tisch und betrachtete eine Weile den Wandkalender, als hoffte sie, dort einen passenderen Ausdruck zu entdecken. Doch natürlich fand sie keinen. Sie seufzte, schloss die Augen und spielte an ihrer Haarspange herum.
»Ist doch egal«, sagte ich. »Ich verstehe schon ungefähr, was du sagen willst. Außerdem wüsste ich selbst nicht, wie man das ausdrücken kann.«
»Ich kann nicht gut reden. Das ist schon lange so. Wenn ich etwas sagen will, kommen immer genau die falschen Worte raus. Ich sage das Falsche oder sogar das Gegenteil. Wenn ich versuche, mich zu korrigieren, mache ich alles nur noch schlimmer, sodass ich zum Schluss selbst nicht mehr weiß, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe das Gefühl, als ob ich irgendwie zweigeteilt wäre und meine eine Hälfte der anderen nachjagte. In der Mitte steht ein dicker Pfeiler, um den ich mich rundherum jage. Mein eines Ich kennt die richtigen Worte, aber mein anderes kann es nicht einholen.«
Naoko hob den Kopf und sah mir in die Augen. »Verstehst du, was ich meine?«
»Das geht fast jedem manchmal so«, erwiderte ich. »Man versucht, etwas Bestimmtes auszudrücken und wird nervös, wenn es nicht klappt.«
Naoko blickte leicht enttäuscht drein. »Nein, das ist wieder etwas anderes«, widersprach sie ohne weitere Erklärung.
»Egal, jedenfalls würde ich dich gerne wiedersehen. Sonntags habe ich immer Zeit, und etwas Bewegung täte mir auch ganz gut.«
Wir nahmen die Yamanote-Linie, und Naoko stieg in Shinjuku in die Chūō-Linie um. Sie wohnte etwas außerhalb in einem kleinen Apartment in Kokubunji.
»Findest du, dass ich anders rede als früher?«, fragte mich Naoko beim Abschied.
»Ein bisschen anders, ja. Aber ich weiß nicht, was anders daran ist. Ich hab dich damals zwar oft gesehen, aber ich glaube nicht, dass wir uns viel unterhalten haben.«
»Hm, stimmt. Kann ich dich dann also nächsten Samstag anrufen?«
»Klar, ich warte darauf«, sagte ich.
Zum ersten Mal war ich Naoko im Frühling der elften Klasse begegnet. Sie ging ebenfalls in die elfte Klasse und war auf einer noblen, von einer christlichen Mission geführten Mädchenschule. Die Schule war so vornehm, dass allzu großer Lerneifer dort als unfein galt. Naoko war die Freundin meines besten (und einzigen) Freundes Kizuki. Die beiden kannten sich fast von Geburt an, denn ihre Familien wohnten kaum zweihundert Meter voneinander entfernt.
Wie bei den meisten Paaren, die sich seit ihrer Kindheit kennen, war ihre Beziehung sehr offen, und sie schienen nie den Drang zu verspüren, allein zu sein. Die beiden gingen seit ihrer Kindheit in der Familie des anderen ein und aus, aßen zusammen und spielten Mah-Jongg. Ein paarmal brachte Naoko eine Klassenkameradin für mich mit, und wir unternahmen zu viert etwas, gingen in den Zoo, ins Schwimmbad oder ins Kino. Die Mädchen, die sie mitbrachte, waren immer hübsch, aber ein bisschen zu wohlerzogen für meinen Geschmack. Der Umgang mit den etwas rauhbeinigeren Mädchen aus meiner Schule fiel mir leichter. Bei Naokos Schulkameradinnen hingegen wusste ich nie, was in ihren hübschen Köpfen vorging, und ihnen erging es mit mir wahrscheinlich auch nicht viel besser.
Nach einer Weile gab Kizuki es auf, Verabredungen für mich zu arrangieren, und wir zogen statt dessen zu dritt los. Wir drei: Kizuki, Naoko und ich. Ein bisschen ungewöhnlich, wenn man es sich überlegt, aber so war es am einfachsten und besten. Kam eine vierte Person hinzu, wurde es gleich ungemütlich. Es war wie bei einer Talkshow: Ich war der Gast, Kizuki der charmante Gastgeber und Naoko seine Assistentin. Kizuki stand immer im Mittelpunkt und füllte diese Rolle gut aus. Auch wenn er eine sarkastische Ader hatte, sodass Außenstehende ihn häufig für arrogant hielten, war er im Grunde ein rücksichtsvoller und gutmütiger Junge. Er richtete seine Bemerkungen und Witze an Naoko und mich gleichermaßen, sodass sich niemand übergangen fühlte. Wenn sie oder ich länger schwieg, lenkte er das Gespräch geschickt in die entsprechende Richtung und brachte uns zum Reden. Das klingt anstrengend, aber wahrscheinlich fiel es ihm überhaupt nicht schwer, denn er besaß die natürliche Begabung, Situationen einzuschätzen und spontan darauf zu reagieren. Darüber hinaus verfügte er über die seltene Fähigkeit, auch den langweiligsten Bemerkungen interessante Aspekte abzugewinnen, sodass er einem im Gespräch das Gefühl vermittelte, ein außergewöhnlich faszinierender Mensch mit einem außergewöhnlich faszinierenden Leben zu sein.
Paradoxerweise war er jedoch kein geselliger Typ und hatte in der Schule außer mir keine weiteren Freunde. Ich konnte nie begreifen, warum ein so scharfsinniger, redegewandter Mensch sich mit der beschränkten Welt unserer Dreierrunde zufrieden gab, statt seine Begabung auf ein weiteres Umfeld zu richten. Auch warum er ausgerechnet mich zum Freund erwählt hatte, blieb mir ein Rätsel. Ich war ein unauffälliger, durchschnittlicher Junge, der gerne las und Musik hörte, und besaß keine besonderen Eigenschaften, die Kizukis Aufmerksamkeit erregt haben mochten. Und doch waren wir auf Anhieb Freunde geworden. Sein Vater war übrigens als Zahnarzt eine Kapazität und für seine saftigen Honorare bekannt.
»Hast du Lust auf eine Verabredung zu viert am Sonntag? Meine Freundin geht auf eine Mädchenschule und kann ein hübsches Mädchen für dich mitbringen«, hatte Kizuki mich gleich bei unserer ersten Begegnung gefragt. Ja, gern, hatte ich geantwortet. So hatte ich Naoko kennengelernt.
Kizuki, Naoko und ich verbrachten viel Zeit miteinander, aber immer wenn Kizuki das Zimmer verließ und wir zu zweit waren, verstummten Naoko und ich. Wir hatten kein einziges gemeinsames Gesprächsthema. Stattdessen tranken wir Wasser oder spielten mit irgendwelchen Gegenständen herum, die auf dem Tisch lagen. Und warteten darauf, dass Kizuki zurückkam. Erst wenn er wieder im Raum war, wurde das Gespräch fortgesetzt. Naoko war ohnehin nicht sonderlich gesprächig. Auch ich bin ein besserer Zuhörer als Redner und fühlte mich zudem unbehaglich, wenn ich mit ihr allein war. Nicht, dass wir etwas gegeneinander gehabt hätten: wir hatten uns bloß nichts zu sagen.
Zwei Wochen nach Kizukis Beerdigung sahen Naoko und ich uns zum einzigen und letzten Mal wieder. Wir trafen uns wegen irgendeiner Belanglosigkeit in einem Café, und als die Angelegenheit erledigt war, gab es nichts mehr zu reden. Ich hatte mehrere Themen angeschnitten, aber das Gespräch war jedesmal versandet. Außerdem hatte Naokos Stimme eine gewisse kantige Schärfe, als wäre sie wütend auf mich, aber ich ahnte nicht, warum. Danach sahen wir uns nicht wieder, bis zu jenem Tag ein Jahr später, als wir uns zufällig in Tokio über den Weg liefen.
Vielleicht nahm Naoko es mir übel, dass ich und nicht sie der letzte Mensch gewesen war, der Kizuki lebend gesehen und mit ihm gesprochen hatte. Das hätte ich sogar verstehen können, und ich hätte gerne mit ihr getauscht, wenn es möglich gewesen wäre. Aber was geschehen war, war geschehen, und es stand nicht in meiner Macht, etwas daran zu ändern.
Es war ein schöner Nachmittag im Mai gewesen. Nach dem Essen schlug Kizuki vor, die Schule sausen zu lassen und Billard spielen zu gehen. Da auch meine Nachmittagsstunden mich nicht besonders interessierten, schlenderten wir hinunter zum Hafen und spielten vier Partien in einem Billardsalon. Nachdem ich das erste Spiel mühelos gewonnen hatte, strengte Kizuki sich plötzlich an und gewann die restlichen drei. Nach dem, was zwischen uns üblich war, hieß das, dass ich zahlen musste. Während wir spielten, hatte Kizuki keinen einzigen Scherz gemacht, was ihm gar nicht ähnlich sah.
»Du bist ja heute so ernst«, bemerkte ich, als wir uns anschließend hinsetzten, um zu rauchen.
»Weil ich heute auf keinen Fall verlieren wollte«, sagte er mit zufriedenem Lächeln.
Am selben Abend nahm Kizuki sich in der Garage seiner Eltern das Leben. Er hatte einen Gummischlauch auf den Auspuff seines N-360 gebunden, die Fensterritzen mit Klebeband versiegelt und den Motor angelassen. Wie lange es dauerte, bis sein Tod eintrat, weiß ich nicht. Als seine Eltern von ihrem Krankenbesuch bei einem Verwandten zurückkamen und die Garagentür öffneten, um ihren Wagen zu parken, war er bereits tot. Das Autoradio war eingeschaltet, und unter dem Scheibenwischer klemmte eine Tankstellenquittung.
Es gab weder einen Abschiedsbrief noch konnte sich jemand ein Motiv vorstellen. Als letzte Person, die mit ihm gesprochen hatte, musste ich eine Aussage bei der Polizei machen. Es habe keinen Hinweis gegeben, erklärte ich dem Polizisten, nein, er sei wie immer gewesen. Der Polizist hatte offenbar sowohl von mir als auch von Kizuki einen schlechten Eindruck gewonnen. So, als wäre es kein Wunder, dass Jungen, die die Schule schwänzten, um Billard zu spielen, anschließend Selbstmord begingen. In der Zeitung erschien eine kleine Notiz; damit war der Fall abgeschlossen. Seinen roten N-360 gab die Familie fort. Auf seiner Bank in der Schule lag eine Zeitlang immer eine weiße Blume.
Die zehn Monate zwischen Kizukis Tod und meinem Schulabschluss verbrachte ich orientierungslos und meiner Umgebung entfremdet. Ich freundete mich mit einem Mädchen an, schlief auch mit ihr, doch letztlich dauerte die ganze Geschichte nicht mehr als ein halbes Jahr. Mich berührte nichts mehr. Ich schrieb mich auf einer privaten Universität in Tokio ein, von der ich wusste, dass bei der Aufnahmeprüfung nicht viel verlangt wurde, und bestand erwartungsgemäß, ohne dass mich das besonders gefreut hätte. Das Mädchen bat mich, nicht nach Tokio zu gehen, aber ich wollte Kōbe unter allen Umständen verlassen, um an einem Ort, an dem ich niemanden kannte, ein neues Leben zu beginnen.
»Jetzt, wo du mit mir geschlafen hast, bin ich dir natürlich egal«, sagte weinend das Mädchen.
»Das stimmt doch nicht«, widersprach ich. Ich musste einfach nur fort aus dieser Stadt. Aber wie sollte ich ihr das erklären? Und so trennten sich unsere Wege. Als ich im Expresszug nach Tokio saß und an all die Dinge dachte, die mir an ihr so lieb gewesen waren, überkam mich das Gefühl, ich hätte etwas Schreckliches getan, aber rückgängig machen ließ es sich nun auch nicht mehr, und ich beschloss, das Mädchen einfach zu vergessen.
Als ich in das Wohnheim zog und mein neues Leben begann, zählte für mich nur noch eins: nicht zu grübeln und Distanz zur Welt zu halten. Den mit grünem Filz bespannten Billardtisch, den roten N-360 und die weiße Blume auf dem Pult – all das musste ich aus meinem Kopf verbannen. Und auch den aus dem Schornstein des Krematoriums aufsteigenden Rauch und die massiven Briefbeschwerer auf der Polizeiwache, einfach alles. Anfangs schien es auch zu funktionieren. Doch nach einer gewissen Zeit wurde mir bewusst, dass trotz meiner heftigen Anstrengungen so etwas wie ein undefinierbarer Knoten aus Luft in meinem Innern zurückgeblieben war, der mit der Zeit eine schlichte, aber deutliche Form annahm. Ich konnte diese Form sogar in Worte fassen.
Der Tod verkörpert nicht das Gegenteil des Lebens, sondern ist ein Bestandteil desselben.
Ausgesprochen klingt das wie eine Binsenweisheit, doch damals empfand ich diese Erkenntnis nicht in Form von Worten, sondern als eben diesen Luftknoten in meinem Innern. Der Tod existierte in Briefbeschwerern ebenso wie in vier roten und weißen Kugeln auf einem Billardtisch. Und unser Leben lang saugen wir ihn wie feinen Staub in unsere Lungen.
Bis dahin hatte ich den Tod als etwas völlig vom Leben Getrenntes und Unabhängiges begriffen. Unweigerlich würde der Tod eines Tages seine Hand auch nach mir ausstrecken, doch bis zu diesem Tag konnte er mir nichts anhaben. Das hatte ich für eine sehr saubere und logische Schlussfolgerung gehalten. Das Leben auf der einen Seite, der Tod auf der anderen. Ich befand mich auf der einen Seite und nicht auf der anderen. Aber an dem Abend, an dem Kizuki starb, wurde diese Grenze unscharf, und es fiel mir nun schwer, den Tod (und das Leben) auf so einfache Art voneinander zu scheiden. Offenbar war der Tod nicht die Antithese des Lebens, sondern ein integraler Bestandteil meiner Existenz, ja, war es immer gewesen. Diese Tatsache ließ sich nicht aus meinem Kopf verbannen, wie sehr ich mich auch darum bemühte. Als an jenem Abend im Mai seines siebzehnten Lebensjahres der Tod nach Kizuki gegriffen hatte, hatte er auch mich berührt.
So verbrachte ich den Frühling meines achtzehnten Lebensjahres mit dem Gefühl eines Knotens aus Luft in meinem Inneren. Gleichzeitig sträubte ich mich, ernst zu werden, denn ich ahnte, dass Ernsthaftigkeit nicht unbedingt mit einer Annäherung an die Wahrheit identisch war, auch wenn es sich beim Tod auf jeden Fall um eine ernste Sache handelte. In diesem erstickenden Widerspruch gefangen, drehte ich mich endlos im Kreise. Es waren seltsame Tage, wenn ich jetzt daran zurückdenke. Mitten in meinem jungen Leben drehte sich alles um den Tod.
3
Am folgenden Samstag erhielt ich einen Anruf von Naoko, und wir verabredeten uns für den Sonntag. Ich nenne es mal eine Verabredung, ein besseres Wort dafür fällt mir nicht ein.
Wie beim letzten Mal wanderten wir ziellos durch die Straßen, tranken irgendwo Kaffee, gingen weiter, aßen zu Abend und verabschiedeten uns. Wieder ließ sie nur hie und da eine Bemerkung fallen, was ihr selbst offenbar nicht seltsam vorkam, und auch ich bemühte mich nicht gerade, das Gespräch in Gang zu halten. Wir sprachen über das, was uns so einfiel, unseren Alltag, die Uni – willkürliche Gesprächsfetzen eben. Die Vergangenheit erwähnten wir mit keinem Wort. Die meiste Zeit trabten wir einfach durch die Straßen. Glücklicherweise ist Tokio sehr ausgedehnt, sodass wir, wie weit wir auch gingen, nie an ein Ende gelangten.
Fast an jedem Wochenende marschierten wir nun so durch die Stadt. Sie ging voran, und ich folgte ihr in kurzem Abstand. Naoko besaß eine Vielzahl von Haarspangen, die sie immer so trug, dass ihr rechtes Ohr frei blieb. Das ist das Einzige, woran ich mich heute noch gut erinnere, denn damals sah ich sie meist nur von hinten. Wenn sie verlegen war, spielte sie an der Haarspange herum. Zudem hatte sie die Angewohnheit, ihren Mund mit einem Taschentuch zu betupfen, wenn sie etwas sagen wollte und nicht wusste, wie. Während ich all diese Angewohnheiten beobachtete, wuchs mir Naoko allmählich ans Herz.
Sie besuchte eine kleine, aber feine Universität für Mädchen am Stadtrand, in Musashino, die für ihren Englischunterricht berühmt war. In der Nähe von Naokos Apartment floss ein klarer Bewässerungskanal, an dem wir mitunter spazierengingen. Manchmal lud sie mich zu sich ein und kochte etwas für uns. Dass wir beide dabei allein in ihrem Zimmer waren, schien sie nicht weiter zu berühren. Sie wohnte in einem nüchternen Raum ohne jeden überflüssigen Schnickschnack, und nur ihre in einer Ecke am Fenster zum Trocknen aufgehängten Strümpfe wiesen darauf hin, dass es sich um das Zimmer eines Mädchens handelte. Sie lebte beinahe spartanisch und schien auch kaum Freunde zu haben. Eine völlig andere Naoko als die, die ich aus der Schulzeit kannte, als sie schicke Sachen getragen und sich mit zahllosen Freunden umgeben hatte. An ihrem Zimmer erkannte ich, dass sie, genau wie ich, die Stadt verlassen hatte, um an einem Ort, wo niemand sie kannte, zu studieren und ein neues Leben anzufangen.
»Die Uni hab ich mir ausgesucht, weil hier bestimmt keine aus meiner Klasse herkommt«, sagte sie lachend. »Die gehen alle auf bessere Unis – du weißt schon.«
Unterdessen entwickelte sich unsere Beziehung durchaus weiter. Allmählich gewöhnte sie sich an mich und ich mich an sie. Als die Sommerferien zu Ende gingen und das neue Semester begann, wanderten Naoko und ich, als wäre es die natürlichste Sache der Welt, wieder jeden Sonntag Schulter an Schulter durch die Stadt. Ich nahm an, dass Naoko mich nun als richtigen Freund betrachtete, und mir war es auch nicht gerade unangenehm, mit einem so hübschen Mädchen unterwegs zu sein. So streiften wir weiter auf unsere ziellose Weise durch Tokio, gingen bergauf, überquerten Bäche und Schienen, streunten überall umher, ohne uns jemals ein Ziel zu setzen. Wir liefen, um zu laufen – konzentriert, als handele es sich um ein religiöses Ritual zu unserer spirituellen Reinigung. Wenn es regnete, spannten wir unsere Schirme auf und gingen ohne Unterbrechung weiter.
Es wurde Herbst, und der Hof des Wohnheims war von einer dichten Schicht Keyaki-Blättern bedeckt. Mit dem Duft der neuen Jahreszeit und zunehmender Kühle begann ich Pullover zu tragen. Ein Paar Schuhe hatte ich bereits durchgelaufen, sodass ich mir ein neues Paar aus Wildleder kaufte.