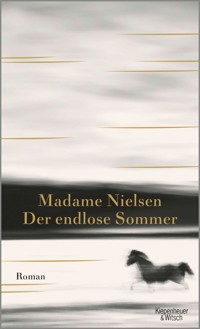
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Rausch eines Sommers – ein flirrender Roman, der die Grenzen des Erzählens sprengt.Die Geschichte einer kleinen Gruppe von Leuten, die im Spiel um die Liebe, die Freundschaft und die Kunst aus der Zeit in einen endlosen Sommer geworfen werden, in dem alles möglich und schicksalsentscheidend ist. Ein Roman wie ein Requiem, musikalisch, melancholisch, verführerisch, der den Leser trunken macht. Ein junges Mädchen in einem weißen Herrenhaus in Dänemark, ihr Freund, der scheue und zarte Junge, der Stiefvater mit dem Gewehr und dem Misstrauen gegenüber seiner Frau, die beiden jüngeren Brüder – diese kleine Gemeinschaft wird durchgerüttelt, als zwei junge Portugiesen in den endlosen Sommer eintreten. Der eine ist Künstler und verliebt sich in die Mutter des Mädchens. Eine Liebesgeschichte nimmt ihren Anfang, die so leidenschaftlich und gewaltig ist, dass alle, die in den Bannkreis dieser Amour Fou geraten, in einer Schicksalsgemeinschaft vereint sind, die auch noch besteht, als der endlose Sommer endet. Der endlose Sommer – das ist dieser Ort, der nie existiert hat und an den wir nie zurückkehren können, d.h. dieser Augenblick der Jugend, in dem alles einfach und verwirrend zugleich erscheint und den wir alle noch einmal erleben möchten. Die Autorin, Sängerin, Künstlerin und Übersetzerin Madame Nielsen ist ein Star in Skandinavien.»Manchmal ist es so, daß man ein Buch am Schluß zuklappt und sich dann wünscht, die Autorin wäre eine gute Freundin und man könne sie anrufen, wann immer man sich traurig fühlt. Das passiert einem ja nicht allzu oft. Bei Karen Blixen und Marguerite Duras und Virginia Woolf ist es so. Und bei Madame Nielsen.« Christian Kracht»Eine literarische Entdeckung. Als Leser wurde ich mitgerissen vom Fluss, der Weisheit und dem Witz des charmanten Erzählers. Als Autor beneide ich Madame Nielsen um ihren meisterhaften Text.« Sjón
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Madame Nielsen
Der endlose Sommer
Ein Requiem
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Madame Nielsen
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Madame Nielsen
Madame Nielsen, geboren 1963, Autorin, Sängerin, Künstlerin, Performerin. Ihre Romane wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, und sie war mehrfach für den Nordic-Council-Preis nominiert. Performances u.a. in Berlin und Wien.
Hannes Langendörfer, geboren 1975 in Heidelberg, studierte in Freiburg und Uppsala Skandinavistik und Germanistik. Er lebt als Übersetzer aus dem Dänischen, Schwedischen und Englischen in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Ein junges Mädchen in einem weißen Herrenhaus, ihr Freund, der scheue und zarte Junge, der Stiefvater mit dem Gewehr und dem Misstrauen gegenüber seiner Frau, die beiden jüngeren Brüder – diese kleine Gemeinschaft wird durchgerüttelt, als zwei junge Portugiesen in den endlosen Sommer eintreten. Der eine ist Künstler und verliebt sich in die Mutter des Mädchens. Eine Liebesgeschichte nimmt ihren Anfang, die so leidenschaftlich und gewaltig ist, dass alle, die in ihren Bannkreis geraten, in einer Schicksalsgemeinschaft vereint sind, die auch noch besteht, als der endlose Sommer endet.
Inhaltsverzeichnis
Förderungshinweis
Der endlose Sommer
Die Arbeit des Übersetzers wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Der Verlag bedankt sich bei der
für die Unterstützung
Der Junge, der vielleicht ein Mädchen ist, es aber noch nicht weiß. Der scheue Junge, der vielleicht ein Mädchen ist, aber nie einen Mann berühren, sich nie mit einem Mann ausziehen und Haut an Haut reiben würde, nie im Leben, wie erregend verworfen die Vorstellung auch sei. Der scheue Junge, dieser hübsche, scheue Junge mit den feinen Zügen, den großen Augen und der großen Angst, vor dem Krieg und vor Krankheiten, vor dem Körper, dem Geschlecht und dem Tod.
Es beginnt mit einem Jungen, einem scheuen Jungen, der vielleicht ein Mädchen ist, es aber noch nicht weiß. Dieser Junge, so hübsch, so zart, so rein, so scheu, spielt Gitarre in einer Band. Sie spielen auf einem Fest vor einer Menge junger Leute, die sie nicht kennen, und von denen auch sie keiner kennt, es ist ihr erstes Konzert, und es ist dieser Abend. (Und später kommt erst das Mädchen, und dann, doch nur wie ein flüchtiger Streif, als Schatten, ein blendender Schatten, ein Schatten aus Licht, die Mutter, dann die zwei kleinen Brüder, die an den Wänden, Regalen und auf den Schränken in den dunklen Kellerzimmern unter dem Haupthaus des Hofs herumklettern, wohin das Mädchen sich zurückgezogen hat, um dem Blick des Stiefvaters zu entgehen, seiner kränklichen, näselnden Stimme, seinem Gewehr, seinem Minderwertigkeitsgefühl und seinem Hass auf Frauen, der Angst, die er als Verachtung maskiert, und wo das Mädchen jetzt wohnt, im Keller, die Wände gepflastert mit Postern von Paul Young, der auf den Bildern jung und schön und verträumt aussieht, aber später, sehr bald schon, fett und versoffen sein und nach einem rasanten, unerbittlichen Abstieg sterben wird, und dann, wie eine Epiphanie, ein blendendes Licht, die Mutter, ihre aristokratische Gestalt mit den langen, graziösen Gliedern und kräftigen Knochen, dem glatten elfenbeinblonden Haar, das ihr bis zur Hüfte reicht, und der Hengst, auf dem sie im Sommer durch den Morgendunst reitet, der von den Feldern aufsteigt, betrachtet durch eins der schmutzigen Fensterchen im Keller, wo er gerade aufgewacht ist und sich unter der Bettdecke aufgestützt hat, in der feuchten Wärme des Mädchens, das noch träge neben ihm schläft, das dunkle, runde, sanfte Mädchen mit den schmalen Knochen und den vollen, weichen Brüsten, die ewig müßige Genießerin, und die aristokratische, nordische Mutter, ihr ranker Rücken und der Dampf aus den schleimfeuchten Nüstern des Pferdes, und dann, ohne Warnung, der Stiefvater, eines Vormittags, allein in der geräumigen Landküche, der schmale, scheue Junge und der Stiefvater, der sich ihm gegenüber hinsetzt und anfängt, von Waffen zu erzählen, von Gewehren, Pistolen und nicht zuletzt von Kugeln, besonders von Dumdumgeschossen und ihrem magischen Effekt, das kaum sichtbare Loch in der Haut, hier, mitten im Solarplexus, wo die Kugel fast spurlos eintritt und dann, sowie sie ins Dunkel vordringt, hinten herausexplodiert und vom Rücken, oder dem, was einmal ein Rücken war, nichts übrig lässt als einen blutigen, fransigen Krater, die Geschichte des Stiefvaters von den Kugeln und die des Mädchens von den Detektiven, denen der Stiefvater dafür, dass sie der Mutter überallhin folgen, sobald sie am Ende der Allee abbiegt und außer Sicht (und außer Reichweite seines Gewehrs) ist, so viel Geld bezahlt, dass sie ihn ruinieren und er, der erst vor wenigen Jahren mit seinem älteren Bruder Buller den Vater beerbt und, über Nacht Millionär geworden, einen Gutshof in Jütland gekauft hat, einen prächtigen Gutshof mit sechzehn Toiletten und Badezimmern, sich kaum das Benzin für seinen Gebrauchtwagen leisten kann, ebenjene Detektive, die er, der scheue Junge, nie zu Gesicht bekommt, obwohl ihre Schatten um ihn durch die verlassenen Zimmer huschen, wenn er allein durchs Haus geht, und über die nie ein Wort fällt, auch wenn bis auf die zwei kleinen Brüder alle im Haus von ihrer Existenz wissen, ganz unverhohlen, wie ein religiöses Tabu, das alle mit größter Selbstverständlichkeit akzeptieren, die Mutter, ihre Tochter und der Stiefvater, der weiß, dass sie wissen, sich davon aber nicht anfechten lässt, auch gar kein Geheimnis daraus macht, als würde der Schrecken dadurch, dass er unverhohlen und unaussprechlich ist, noch lähmender, und als würde die aristokratische Aura der Mutter, ihre Unantastbarkeit dadurch, dass sie mit ihrem Leben, ihrem Alltag fortfährt, als wäre nichts, nur noch erhabener, was den Hass und die Verzweiflung, das Gefühl von Minderwertigkeit und die Besessenheit, die den Stiefvater verzehren, ins Groteske steigert, er wird von Tag zu Tag blasser, magerer, verbissener und verbitterter und noch fester entschlossen, diese Frau niemals gehen zu lassen, sie nie freizugeben, und wenn es ihn ganz verzehren sollte, und das wird es, aber noch nicht jetzt, erst verschwindet er einfach, eines Tages ist er plötzlich weg, und der Sommer fängt an, ein endloser Sommer, in dem nichts geschieht und in dem er, der schmale Junge, aus der Welt fällt, der Welt, aus der er kommt, hinein in jene andere Welt, die eine Welt für sich ist, wo Zeit und Licht stillstehen und der Staub in der Luft schwebt und flimmert und niemand irgendetwas tut, außer leben, als befänden sie sich in einer anderen Zeit und an einem völlig anderen Ort auf der Welt, als wäre der weiße Hof ein Gouverneurspalais auf St. Croix in den letzten Tagen des Kolonialreichs, wo alles zu spät ist und mit einem Mal alles endlich erst möglich. Die Mutter verbringt die Tage auf dem Rücken ihres Hengstes, erst bei Einbruch der Dunkelheit kommt sie zurück und sitzt von Kerzen umringt mit einem Glas Wein in der Küche, und das Mädchen und der Junge bleiben bis spät in den Nachmittag im Bett und stehen nie richtig auf, sondern spazieren in den Kleidern des anderen durchs Haus, der scheue Junge angezogen wie ein Torero, noch ohne Geschlecht, oder eine Jungfrau, und sitzen in der Küche und trinken Milchkaffee und backen Brot von dem letzten Rest Mehl, füllen es mit allem, was sie an Käse, Zwiebeln und Gewürzen finden, verschlingen die dampfenden Scheiben und Brocken und lassen sich lachend auf ihr großes Eisenbett fallen, das jetzt oben in der kleineren der beiden Stuben steht, und lieben sich stundenlang, ohne zu wissen, wer wer ist, ob es ein Geschlecht gibt oder viele, und er für eine Weile seine Angst vor dem Körper vergisst, vor dem Tod, der kommen wird, er kommt, nur mit der Ruhe, er kommt, in jeder Geschichte wie dieser kommt schließlich der Tod, zu guter Letzt vielleicht, oder im Gegenteil jäh wie ein Dumdumgeschoss, das mitten ins Leben trifft und es in Fetzen zurücklässt, über die Erde verstreut.
Doch vorher kommt der Tag, an dem die Tante, die große Schwester der Mutter, aus Amerika heimkehrt. Eines Tages also, als das Mädchen und der scheue Junge zu Besuch in der kleinen Wohnung der Großmutter in der nächsten Stadt sind – was heißt Stadt, eine Ansammlung von Häusern an der Küste, eine Schule, ein Supermarkt, eine Kreuzung und eine Kneipe am Waldrand, wo sich die Jugend in den Sommernächten zum Trinken und Tanzen trifft und hinter der Kneipenküche in dem Lichtkeil, der aus der offenen Küchentür fällt, auf dem Waldboden liegt und rumknutscht und vögelt und sich prügelt – kommt die Mutter mit ihrer großen Schwester aus Amerika die Treppe hoch. Wie jedes weibliche Mitglied einer adligen Familie in einer Zeit, da die Aristokratie als solche nicht mehr existiert, sondern lediglich als verarmtes Relikt überlebt und allein in der Körperhaltung, dem Blick und nicht zuletzt im Bewusstsein der Überlegenheit überdauert, hat auch die Tante einen Kosenamen; so wie die Mutter nicht Benedikte genannt wird, sondern Ditte, und keiner die Großmutter Rigmor nennt, sondern Pip, heißt die Tante in dieser Geschichte nicht Marianne, sondern Tante Janne aus Amerika. Zusammen mit ihrem großen Bruder, dem Rechtsanwalt, der am anderen Ende des Landes wohnt (ganz im Norden in Vendsyssel), ist sie Oberhaupt und Autoritätsperson der Familie. Da sie aber nun mal in Amerika lebt und ihre Autorität nicht tagtäglich ausüben kann, muss sie dies umso effektiver an den wenigen Tagen bewerkstelligen, die sie »daheim in Dänemark« zu Besuch ist. Der scheue Junge, der vielleicht ein Mädchen ist, es aber noch nicht weiß, kennt bis jetzt nur die Erzählungen von dieser Tante, die im Staat Massachusetts an der amerikanischen Ostküste wohnt, zusammen mit ihrem amerikanischen Mann, einem Philosophieprofessor an der Eliteuniversität MIT. Die beiden haben sich in Rom kennengelernt, wo sie auf einer Bildungsreise war und er der jüngste Priester des Vatikans, dazu ausersehen, einmal einer der Kardinäle zu sein, die eines Tages vielleicht einmal Papst werden können, aber von dem Augenblick an, als er sie sieht – und sie sieht, wie er sie sieht – ist es zu spät, noch ehe die Woche um ist, hat er dem Priestergelübde entsagt, seine Klosterzelle und den Vatikan verlassen und sogar seinen Austritt aus der Kirche erklärt, um sein Leben stattdessen der Liebe und jener jungen Frau zu weihen, die nun Tante Janne ist und just in diesem Augenblick aus dem Flur der Wohnung der Großmutter im Obergeschoss eines fantasielosen Häuserblocks in dem kleinen Kaff Bogense über die Türschwelle des kleinen Wohnzimmers schreitet, wo er, der scheue Junge, tief ins Polster des Sofas gedrückt mit einer Mischung aus Neugierde und Schrecken wartet. Sie ist hochgewachsen und schlank wie ihre kleine Schwester, aber dunkler vom Typ her und völlig bar jener Aura der Unergründlichkeit und jenes Glanzes, derentwegen der Junge nie müde wird, die Mutter anzuschauen, weil er immer, wenn er auch nur für einen Augenblick wegsieht, das Gefühl hat, er habe sie noch nicht gesehen. Dagegen strahlt sie, ihre große Schwester, Tante Janne, eine Furcht einflößende Autorität aus. Sie schreitet durch das Wohnzimmer direkt auf ihn zu, aber anstatt sich als wohlerzogener Junge zu erheben, bleibt er völlig gelähmt sitzen, sie macht vor dem Sofatisch halt, blickt zu ihm hinunter und streckt eine Hand aus, und jetzt erst erhebt er sich, schnellt wie ein Springmesser vom Sofa hoch, reicht ihr die Hand und nennt seinen Namen. Und wie noch?, fragt die Frau. Wie?, sagt er verwirrt. Wie heißt du weiter, mit Nachnamen? Er nennt seinen Nachnamen, und sie verzieht keine Miene, fragt ihn aber, wo und wann er geboren sei, und was seine Eltern machen, und wo sie wohnen, ob er Geschwister habe, und was sie machen, und er selbst, was er studiere, und sofern er noch kein Studium angefangen habe, für welches Studium er sich einzuschreiben gedenke, und an welcher Universität und wann? Verwirrt versucht er, all diese Fragen zu beantworten, stotternd, schier sprachlos, er steht weiterhin kerzengerade da, denn noch hat sie ihm nicht bedeutet, sich setzen zu dürfen, auch sie steht unvermindert aufrecht, doch auf völlig andere Art, nicht starr vor Angst wie er, sondern mit rankem Rücken, ganz adlige Verpflichtung und leuchtendes Schicksal. Er, starr vor Demütigung und Beklommenheit, spürt gleichzeitig ein perlendes Lachen in sich aufsteigen, das träum’ ich doch, denkt er, von Glück, Scham und einem Gefühl von Unverwundbarkeit durchflutet, und später, tief in der Nacht, als die Tante schon längst in dem Gästezimmer im oberen Stock des weißen Hofs schläft und auch die Mutter sich mit ihren Büchern im Himmelbett neben dem Fenster ihres nach Osten gehenden Schlafzimmers zur Ruhe gelegt hat, und er unten neben der Tochter, der Nichte, in ihrem großen Eisenbett in dem Mädchenzimmer voll rosa Tüll, Postern und ihrem heillosen Durcheinander liegt und noch immer ganz benommen ist, gleichzeitig zu Tode erschöpft und doch so aufgekratzt, dass er keinen Schlaf findet, wird das Mädchen an seiner Seite ihn auslachen, wird lachen darüber, wie hoffnungslos gewöhnlich er ist, er, der nun einmal aus einer ganz gewöhnlichen Familie kommt, die zweifellos mehr Geld hat als ihre, die schlicht gar keins hat, aber ganz mühelos so tut, als ob, wohingegen seine Familie nicht mit einer Geschichte aufwarten kann. Die Prüfung seines Lebens, und er hat nicht bestanden, und von nun an wird die Tante aus Amerika alles tun, was in ihrer Macht steht – ganz ohne böse Absicht, und schon gar nicht aus wie auch immer gearteten persönlichen Gründen, allein aus adliger Verpflichtung – um ihn aus dieser Geschichte zu entfernen. Aber diese ganze Geschichte in der Geschichte, die Geschichte von Tante Janne aus Amerika und ihrem amerikanischen Philosophieprofessor, Onkel Bob, der dazu bestimmt war, Kardinal der römischen Kurie und Mitglied eines künftigen Konklave zu werden, doch von dem Augenblick an, als er die junge Frau sah, die später Tante Janne werden sollte, seinen Glauben verlor, genauer gesagt, erst da wirklich zu glauben anfing und begriff, dass er bis dahin ein Ungläubiger gewesen war und dass nicht der Gott der katholischen Kirche, sondern die Liebe der wahre Gott ist, diese ganze unwahrscheinliche, jedoch unbedingt glaubwürdige Liebesgeschichte ist, wie jede Geschichte in dieser Geschichte, eine Geschichte für sich, die ständig unterbrochen und aufs Neue weitererzählt werden muss, bis eine jede Geschichte an ihr mehr oder weniger tragisches Ende gelangt.
Doch solange alles noch möglich ist, wollen wir einmal alle Personen sehen, denn schon jetzt sind es so einige, und im Lauf der Geschichte werden noch mehr auftauchen, Haupt- und Nebenpersonen, aber vor allem den anderen Jungen, der eigentlich der erste ist und schon lange hier war, bevor der schmale und oh so feinfühlige Junge ins Bild kam: der schön gewachsene Lars, bester Freund und Vertrauter des Mädchens, er ähnelt dem schmalen Jungen, sie könnten Brüder sein und sind doch, wie oft bei Brüdern, das Gegenteil voneinander: hier der eine, zart und verletzlich, und dagegen der gesunde, kräftige Lars, ein Bild von einem jungen Mann, hochaufgeschossen, blondes Haar, athletischer Körper und dazu diese schönen, schlanken Hände, die aussehen, als würde ihnen alles gelingen, Tennis, Handball, Klavier spielen, und als könne er mit ihnen sein Schicksal, die leuchtende Zukunft, so unbekümmert greifen und halten, als wär’s keine seltene Gabe, sondern das Natürlichste von der Welt, voilà! Er ist der Traum einer jeden Schwiegermutter, gewiss auch der Tante, Tante Janne aus Amerika, sofern sie ihn nicht schon durchschaut und erkannt hat, dass er an demselben fatalen Schlendrian krankt wie ihre Nichte, mit dem Unterschied bloß, dass er anders als sie nicht imstand ist, ihn zu genießen, im Gegenteil, wie alle anderen Gaben wird er auch diese aus den Händen gleiten lassen und mit einem lustlosen Seufzer verloren geben, und gerade er, der scheinbar Gesündere von beiden, der die Zukunft fest in Händen hält, wird als Erster alles loslassen und sterben, nicht wie in einem schlechten Melodram auf einer verzweifelten Todesfahrt durch den Wald oder die Vorstädte, sondern langsam, ganz langsam sich der süßen Verlockung hingebend, welche die Krankheit zum Tode ist. Aber für den Anfang, den ganzen endlosen Sommer lang, soll er wie selbstverständlich dabei sein, der dänische Lars, soll kommen und gehen, wie’s ihm gefällt, im Hof an die südliche Wand gelehnt sitzen, die schönen nackten Füße auf den warmen Pflastersteinen, und sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen, völlig gedankenlos, mit leeren Händen und ohne je aufzustehen, es sei denn, jemand ruft ihn, und auch dann bleibt er erst einmal sitzen, Minuten verstreichen und werden zu halben Stunden, bis er sich endlich blicken lässt und mit einem Seufzer an den Tisch setzt und das chaotische Festmahl sieht, improvisiert aus Resten vom Vortag, mit einem Schuss frischer Milch oder Lauch vom Feld des Nachbarn gestreckt, und ohne dass er je etwas anderes machen würde als einfach dasitzen, essen, plaudern und sein charmantes, sinnlich seufzendes Lachen lachen und dann und wann aufstehen und ein wenig herumschlendern, mit locker hängenden Armen und den schönen Händen, die man nie etwas halten sieht, kein Buch, kein Werkzeug, auch nicht einen anderen Menschen, sondern die, wie auch er selbst, bloß den Anschein erwecken, étant donné, sie verkörperten jene Zukunft, die nie kommen wird, und in der all das, was möglich ist, endlich Wirklichkeit wird. Doch wie gesagt, in diesem »bis auf Weiteres«, in welchem die Geschichte und das Leben spielen, soll er einfach mit dabei sein dürfen, als ein Freund des Hauses, der dritte, verlorene Sohn, dessen fatale Lustlosigkeit die Tante aus Amerika mit Sicherheit schon durchschaut hat, während die Mutter sie in ihrer überragenden, alles verzeihenden Gnade mit derselben maßlosen Liebe ins Herz schließt, die der Vater in Jesu Gleichnis seinem heimgekehrten Sohn erwies, und von der sich als Einzige die Tochter von Zeit zu Zeit etwas genervt fühlt, jedoch ohne zu verstehen, dass Lars nicht einfach nur faul ist wie sie, sondern dass seine Faulheit letztlich fatal ist, denn sie ist die reine Lustlosigkeit, er hat auf nichts, wirklich nichts in der Welt Lust, auch nicht auf das Leben, ihm ist nicht danach.
Und wenn diese Geschichte bis jetzt wie ein Traum klingt, wie ein Kitschroman, den man sich hier und da mal – im Urlaub oder auf einem langen Flug – gönnt wie eine sündige Praline, um sich zurückzulehnen und für ein Weilchen darin zu verlieren, so deshalb, weil das Leben ein Traum ist, ein Traum, aus dem man nie erwacht, und der eines Tages doch plötzlich schon längst vorbei ist – noch aber bist du hier und kannst entweder für »den Rest deiner Tage« vergessen und »schauen, dass du weiterkommst« oder eben, wie ich, aufgeben, was ist, und versuchen, das Verlorene, das einmal war, wiederzufinden, und sei es noch so gering, selbst das, was vielleicht nie wirklich gewesen ist, aber doch zur Geschichte gehört, und im Erzählen heraufzubeschwören, damit es nicht bloß nicht verschwindet, sondern im Gegenteil erst jetzt endlich Wirklichkeit wird und in gewisser Weise wirklicher als alles sonst.
Doch manches ist selbst im Traum nur ein Traum, »der endlose Sommer« zum Beispiel, vielleicht beginnt er nie, vielleicht ist er nichts als die Befreiung, von der das Mädchen oder der schmale Junge träumen, wie er da in dem feuchten Kellerzimmer neben seiner schlafenden Freundin liegt und selbst keinen Schlaf findet wegen der unerträglichen Leichtigkeit, die über dem Hof lastet, demselben metallischen Rauschen realster Unwirklichkeit, das die Filme von David Lynch untermalt, an seiner Seite das Mädchen, das seinen genussvollen Schlaf schläft, nachdem sie ihm gerade noch eine von den Geschichten erzählt hat, die er, bevor er sie kannte, für erfunden hielt, und von denen sie mit ihren bloß sechzehn Jahren schon so viele hat, dass sie sie selbst anscheinend nicht kontrollieren kann, sie sprudeln im Dunkeln einfach so aus ihr raus, gegen Mitternacht, wenn sie von unschuldigem Rosa und Pop-Postern umgeben in dem Eisenbett in ihrem Mädchenzimmer liegen, während er, der schon ein paar Jahre älter ist, keine Geschichten hat und auch nie andere haben wird als die, welche er sich selbst schafft; das Dunkel, ihr ruhiger Atem im Dunkel, und darüber die leeren Zimmer, durch die er manchmal gegangen ist, doch ohne je einem Menschen zu begegnen, und über den Zimmern das Obergeschoss mit dem Schlafzimmer hinter der verschlossenen Tür, die er sich nie zu öffnen getraut hat, und wo sie jetzt wohl liegt, denn wo sollte sie, die Mutter, sonst liegen, neben dem Mann, in den sie sich einmal verliebt haben muss, den sie geheiratet und mit dem sie zwei Kinder bekommen hat, ein Gedanke, der so absurd ist, dass er immer noch nicht fassen kann, wie sie, die eine so natürliche und souveräne und selbstverständliche Freiheit ausstrahlt, eine übermenschliche, ja unmenschliche, tödliche Freiheit, die kein Mensch je zähmen kann, sondern nur bei dem Versuch, sie zu beherrschen, an ihr zugrunde gehen muss, wie sie sich in diesen Mann hat verlieben können, der noch nicht einmal, zumindest jetzt nicht mehr, ein Mann ist, sondern bloß ein sprödes Stück Holz, ein Splitter von einer Pressspanplatte, den man unmöglich anders sehen kann als einen Schatten am Rand des Gesichtsfelds, denn sie muss sich ja in ihn verliebt haben, des Geldes wegen hat sie ihn nicht genommen, das würde sie nie tun, und außerdem muss sie ihm begegnet sein, als er noch Auszubildender oder Assistent in einer unbedeutenden Bankfiliale in der Provinz war und somit mehrere Jahre, bevor er plötzlich seinen Vater beerbte, Knall auf Fall kündigte und, statt wie sein großer Bruder Buller die Hälfte des Erbes in Rassepferde und Wertpapiere zu investieren, den Gutshof kaufte, den er sich in Wirklichkeit, trotz seines beträchtlichen Erbes, gar nicht leisten konnte. Das Mädchen hat ihm gerade im Dunkeln, ehe sie sich in ihren lustvollen Schlaf sinken ließ, schon in dem träumerischen Zustand, in dem die Jahreszeiten den Platz tauschen und auf den Herbst ein weiterer Herbst folgt, von der Zeit auf dem Gutshof erzählt, einem Leben, das tatsächlich nur anderthalb Jahre währte, von dem Tag, an dem der Stiefvater sie ohne Vorwarnung aus dem Reihenhaus am Rand einer Kleinstadt auf der Insel Seeland auf den prächtigen Gutshof in Ostjütland umgesiedelt hatte, den er sich in Wirklichkeit gar nicht leisten konnte und von dem er dann, als Gutsbesitzer, auch nicht die geringste Ahnung hatte, wie er zu führen wäre, sondern ihn gleich vom ersten Tag runterzuwirtschaften begann, und zwar eigentlich, ohne dass er irgendetwas gemacht hätte, im Gegenteil, den er einfach dadurch, dass er eben nicht all die Dinge tat, die man – und zwar Tag für Tag – besorgen muss, um einen Gutshof zu betreiben, im Lauf von anderthalb Jahren von einem Wunschtraum in eine reine Konkursmasse verwandelte. Anfangs beschäftigte er noch eine Handvoll Männer, die ihm helfen sollten, das Gut zu führen, Männer, die er zusammen mit den Feldern, Wäldern und den zu dem Landgut gehörenden Gebäuden von dem vorigen Eigentümer übernommen hatte und die wussten, was zu tun war, aber schon nach ein paar





























