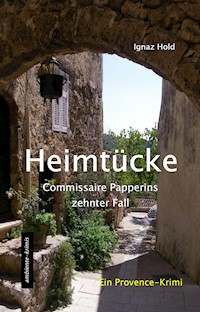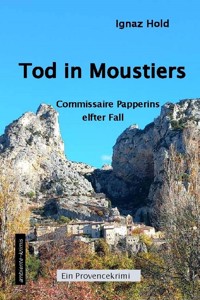Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ambiente-krimis
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein mysteriöser Mord sorgt für Aufregung im beschaulichen Provencedorf Cabanosque. Welche seiner Untaten brachen dem Filialleiter der örtlichen Bank bei seiner letzten Mountainbiketour das Genick? Wer hat diese schreckliche Rache an dem korrupten Banker geübt? Als im abgelegenen Kloster Saint Pierre der Mörder zur Beichte erscheint und sich ein Kletterunfall im Grand Canyon du Verdon als Mord entpuppt, sieht sich Commissaire Papperin mit seinem bisher schwierigsten Fall konfrontiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
IGNAZ HOLD
DER FALL DE MONTAGNE
ambiente-krimis
Buch
Ein mysteriöser Mord sorgt für Aufregung im beschaulichen Provencedorf Cabanosque. Welche seiner Untaten brachen dem Filialleiter der örtlichen Bank bei seiner letzten Mountainbiketour das Genick? Wer hat diese schreckliche Rache an dem korrupten Banker geübt? Als im abgelegenen Kloster Saint Pierre der Mörder zur Beichte erscheint und sich ein Kletterunfall im Grand Canyon du Verdon als Mord entpuppt, sieht sich Commissaire Papperin mit seinem bisher schwierigsten Fall konfrontiert.
Autor
Ignaz Hold ist ein Pseudonym. Der Autor, ein reiselustiger Wissenschaftler, hat seit über einem Vierteljahrhundert in der Provence eine zweite Heimat gefunden und kennt diesen Fleck Europas wie seine Westentasche. Er erholt sich, wann immer sein Beruf es ihm erlaubt, vom Stress des Alltags in seinem Haus in der Haute Provence. Dorthin, in die ländliche Idylle eines provenzalischen Dorfes, zieht er sich zurück, um zu schreiben. Neben nüchternen Fachbüchern entstehen dort seine Provencekrimis, in denen er den ganzen provenzalischen Mikrokosmos mit all seinen Problemen, Charakteren, landschaftlichen und kulinarischen Reizen einfängt und in spannende Krimis einfließen lässt.
Ignaz Hold
DER FALL DE MONTAGNE
Commissaire Papperins neunter Fall
Personen und Handlungen in diesem Roman sind frei erfunden und orientieren sich nicht an lebenden oder toten Vorbildern oder an tatsächlichen Geschehnissen. Etwaige Ähnlichkeiten sind nicht beabsichtigt und wären rein zufällig.
ambiente-krimis
Michael Heinhold
Am Feilnbacher Bahnhof 10
83043 Bad Aibling
Erste Auflage 2021
Copyright © 2021 by Ignaz Hold
Alle Rechte vorbehalten
E-book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
Umschlagfoto: Michael Heinhold
ISBN der Taschenbuchausgabe: 978-3-945503-28-7
Mittwoch, 5. Oktober
Guillaume de Montagne lehnte sich in seinem Bürostuhl zurück und fixierte sein Gegenüber mit einem geringschätzigen, überheblichen Blick, einem Blick, der nur Männern zu eigen ist, die sich ihrer Macht und ihrer unanfechtbaren Position völlig sicher sind. Der sportliche Mitvierziger im dunklen Businessanzug stützte sich mit beiden Ellenbogen auf die Schreibtischplatte.
„Es kursieren Gerüchte, dass du …“, begann er. „Sagen wir besser so: Man hat mir zugetragen, du hättest vor, an meinem Stuhl zu sägen.“
„Das stimmt so nicht!“, wehrte sich der andere.
„Doch! Ich weiß das aus zuverlässiger Quelle. Du versuchst auf subversive Weise, Stimmung gegen mich zu machen.“ Eine Zornesfalte begann sich zwischen monsieur de Montagnes Augenbrauen zu bilden, wurde größer und tiefer, bis sie seine Stirn in zwei symmetrische Hälften teilte.
„Die Situation ist doch folgendermaßen“, versuchte der Beschuldigte abzuwiegeln: „Wir sind eine Organisation, deren Vorstand in regelmäßigem Turnus gewählt wird. Das ist gesetzlich so vorgesehen. Es steht im code civil. Und jeder, der die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, kann sich zur Wahl stellen.“
„Du willst also ernsthaft gegen mich kandidieren, wenn die Wiederwahl des Vorstands ansteht?“ Guillaume de Montagne, der amtierende Vorsitzende, stieß zwei kurze, abfällige Lacher aus.
„Du hast doch keine Chance, Toto! Lass das sein!“
„Wenn du dich da mal nicht täuschst! Du hast einigen Dreck am Stecken. Die Leute wissen das nur noch nicht.“
Der Vorsitzende überlegte kurz und lachte dann seinem Gegenüber ins Gesicht:
„Willst du wirklich öffentlich hinausposaunen, dass ich deine Frau ficke? Das kann mir doch nichts anhaben. Im Gegenteil, bis auf ein paar bigotte Betschwestern würden das alle toll finden. Aber du stündest als Blamierter da. Toto, Toto! Also mach keinen Scheiß!“
Der gehörnte Ehemann wurde blass. Ganz augenscheinlich hatte er davon nichts gewusst. Doch er bekam sich schnell wieder in den Griff und ging zum Gegenangriff über:
„Das meine ich nicht. Da gibt es ganz andere Sachen. Wie war das zum Beispiel mit madame Clurent, die du um ihr gesamtes Erspartes gebracht hast? Oder was anderes: Ich sage nur: Résidence Lantier.“
Mit Befriedigung nahm er das Erschrecken in den Augen seines Gegenübers wahr.
„Außerdem mag ich nicht, wenn du mich mit diesem idiotischen Spitznamen anredest. Ich habe schließlich einen richtigen Namen. Merk dir das endlich!“
Auf einmal hatten sich die Gewichte verschoben. Der von Guillaume de Montagne so abfällig Toto Genannte schien sich plötzlich in der stärkeren Position zu befinden, während de Montagne nachdenklich in seinem Chefsessel zusammengesunken war.
Toto legte noch eines drauf: „An deiner Stelle würde ich nicht für die Wiederwahl kandidieren. Das wäre besser für alle. Vor allem für dich! Konzentriere dich auf deinen Job als Filialleiter der Bank und mach da meinetwegen deine krummen Sachen weiter, aber lass mich hier ran. Sonst … !“
„Jetzt pass mal auf Toto!“ Guillaume de Montagne war zu einem Entschluss gekommen. „Einen Scheißdreck werde ich tun und dich hier ran lassen. Im Gegenteil, ich mach dich fertig. Das, was du mir da vorwirfst, kann mir nichts anhaben. Es ist entweder rechtlich unangreifbar oder verjährt. Aber dich und dein Unternehmen mach ich fertig. Glaub mir, ich habe die Kontakte dazu. Nur ein paar Gerüchte über Zweifel an deiner Kreditwürdigkeit und deine Lieferanten werden dich meiden wie die Pest. Und deine Kunden? Die sind noch anfälliger für geschickt gestreute Gerüchte. Außerdem, gerade fällt mir ein“, in gespielter Nachdenklichkeit fasste sich de Montagne an die Stirn, „unsere Kreditabteilung hatte einige nicht den Tatsachen entsprechende Angaben – um nicht zu sagen Lügen – in deinem Antrag für den Investitionskredit entdeckt, was, wenn ich die Geschäftsbedingungen meiner Bank korrekt anwende, eine sofortige Fälligstellung des Investitionsdarlehens zwingend erforderlich macht.“
Jetzt hatte Guillaume de Montagne wieder Oberwasser.
„Also, mach dich auf raue Zeiten gefasst! Hier in Cabanosque, ach was im gesamten Département, kommst du nicht mehr auf die Beine. Am besten du verschwindest von hier. Geh zurück in deine Heimat. Und jetzt raus!“
Mit einer herrischen Handbewegung wies er zur Tür.
„Größenwahnsinniger Idiot!“, murmelte er. „Der hat tatsächlich geglaubt, er kann mich unter Druck setzen. Mich!“
***
Sichtlich erschüttert verließ Toto das Büro des Vorstands. Wütend schlug er die Tür zu.
„Porca miseria! Damit hat er mich in der Hand“, grummelte er in seiner italienischen Muttersprache vor sich hin, während er die wenigen Treppenstufen hinunter stieg und zu seinem Auto ging. „Selbst wenn ich das durchziehe und er auf den Präsidentenposten verzichten muss, trotzdem kann er mich fertigmachen.“
Die Konsequenzen, die ihm Guillaume de Montagne angedroht hatte, würden ihn wirtschaftlich ruinieren. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als zurück zu rudern, auf seine Kandidatur zu verzichten und drauf zu hoffen, dass der andere seine Drohung dann nicht wahrmachen würde. Aber heimzahlen wollte er es diesem anmaßenden Idioten trotzdem.
„Der glaubt wohl, er kann mit mir alles machen, dieser kriminelle Banker! Und dass er Paola vögelt, dieser Drecksack! Allein dafür könnte ich ihn umbringen! Aber dem werde ich einen Denkzettel verpassen, den er so schnell nicht vergisst!“
Selbstverständlich müsste er es so geschickt anstellen, dass auf ihn keinerlei Verdacht fiel. Während er sich auf den Fahrersitz fallen ließ, die Autotür zuschlug und sich anschnallte, überschlugen sich seine Gedanken, suchten nach Wegen, wie er diesem vermeintlichen Ehrenmann, diesem Halsabschneider im Schafspelz, Schaden zufügen konnte, den der sein Leben lang nicht vergessen würde. Sollte er seine alten Kontakte in die Marseiller Unterwelt reaktivieren? Aber dann gäbe es Mitwisser. Und das sollte er besser vermeiden. Auf der Fahrt nach Hause gingen ihm viele Möglichkeiten durch den Kopf. Von diesen Ideen verwarf er die meisten sofort wieder. Aber ein Gedanke hatte es ihm angetan. Ja, so konnte er es machen. Er musste nur Geduld haben, abwarten, bis sich eine günstige Gelegenheit ergab.
Donnerstag, 6. Oktober
Das Frühstück beim Ehepaar Tomassino hatte in bedrückendem Schweigen stattgefunden. Nachdem ihr Mann endlich den letzten Bissen seines Croissants heruntergeschluckt und mit dem schon kalt gewordenen Espresso nachgespült hatte, begann Paola Tomassino den Tisch abzudecken.
Battista Tomassino deutete auf ihren Stuhl:
„Setz dich und hör mir zu!“, befahl er.
Sie ahnte, was jetzt kommen würde und nahm mit trotziger Miene wieder Platz.
„Es stimmt also, dass du mit diesem … diesem …“ Er suchte nach einer passenden Bezeichnung für den Mann, der ihm Hörner aufgesetzt hatte.
„… Casanova, diesem Hurenbock ein Verhältnis hast. Wie … wie lange ge… geht das schon?“ Vor Zorn kam er ins Stottern.
„Ach Toto!“
„Nenn mich nicht so! Du weißt, wie ich diesen idiotischen Spitznamen hasse.“
Diesen Necknamen hatte er sich durch sein leichtes Stottern zugezogen. Früher war er, wenn er innerlich erregt, aufgewühlt war, leicht ins Stottern verfallen. Vor Jahren, als er sich um den Trainerposten beim örtlichen Rugbyclub beworben und man ihn nach seinem Namen gefragt hatte, hatte er geantwortet:
„To… To… Tomassino.“
Damit war Toto geboren. Lange hatte er dagegen angekämpft. Seinem kumpelhaften Wesen und vor allem seinen Erfolgen im Training mit der Mannschaft war es schließlich zu verdanken, dass seine Freunde ihn mit seinem richtigen Vornamen Battista anredeten – oder die Kurzform Tista verwendeten. Toto hingegen hasste er, weil es ihn an seine Schwachstelle, das Stottern, erinnerte – das er inzwischen weitgehend überwunden hatte.
„Weil du nie Zeit für mich hast. Alles dreht sich um deinen idiotischen Rugbyclub, deine Mannschaft und was du mit ihr alles erreicht hast und noch erreichen willst. Selbst in unserem Restaurant machst du nur noch halbherzig mit.“
„Nur weil mir der Club wichtig ist, brauchst du doch nicht gleich mit einem anderen ins zu Bett hüpfen. Noch dazu mit diesem stronzo, diesem wichtigtuerischen Arschloch!“
„Weil der mich ernst nimmt, sich um mich kümmert. Mir zeigt, dass er mich mag, mir Geschenke macht. Für dich gibt es ja nur deinen Verein!“
„Testa di cazzo!“, verfiel er in seine italienische Muttersprache. “Ma cosa ti è venuta in mente?“ Er schlug mit er Faust auf den Tisch. “Was hast du dir dabei gedacht? Wie steh ich jetzt da? Un cornuto, ein gehörnter Ehemann!“
„Da bist du selber schuld. Wenn mein Herz nicht so an unserem Restaurant hinge, das wir uns aufgebaut haben – mit meinem Geld übrigens – dann würde ich mich von dir trennen.“
Es war eine Tatsache, dass das Restaurant ‚Al Buongustaio‘ nur deshalb so gut ging, weil sie beide ein so gut eingespieltes Team waren. Paola eine begnadete Köchin und Battista, der die Bar betrieb und bei den Gästen den padrone, den Inhaber, spielte. Mit großem Erfolg bot die Küche neapolitanische und sizilianische Gerichte aus der jeweiligen Heimat der Eheleute Tomassino.
„Scheiß auf’s Buongustaio!“ Battista Tomassino schaute seine Frau böse an.
„Du weißt schon, was man in meiner Heimat Sizilien mit einer Frau gemacht hätte, die ihrem Mann untreu geworden ist?“
Aber ihm war auch klar, das Restaurant war ihre Existenzgrundlage. Und der Erfolg beruhte auf ihrer beider Arbeit. Das durfte er nicht aufs Spiel setzen.
„Du kannst dich glücklich schätzen, dass wir in Frankreich sind und nicht in Sizilien! Aber eins sag ich dir: eine Zeit lang will ich dich nicht mehr sehen. So lange, bis du diesem Hurensohn den Laufpass gegeben hast – endgültig! Ist das klar?“
Er stand auf und ging zur Tür, die in die Diele führte. Dort wandte er sich um:
„Solange fahr ich weg. Nach Ventimiglia zu meinem Bruder.“
„Aber das Buongustaio? Das Wochenende steht vor der Tür und wir haben viele Reservierungen!“
„Scheiß drauf!“, brüllte er und verschwand.
Paola schüttelte den Kopf. Wollte sie wirklich mit diesem Mann weiterhin zusammenleben? Während sie das Frühstücksgeschirr abräumte gingen ihr unzählige Gedanken durch den Kopf. Sie hörte, wie die Haustüre zugeschlagen wurde, dann hörte sie einen Anlasser, der Motor des Alpha Romeo heulte auf und ging in ein leises Brummen über, das sich schließlich in der Ferne verlor.
Sie war fassungslos von dem Hass, den Battista ihr entgegen geschleudert hatte. Bloß weil sie den Avancen von Guillaume nachgegeben und sich von ihm hatte verführen lassen. „Aber so sind sie, die Sizilianer“, dachte sie. Heißblütig und rachsüchtig. Frauen wurden verehrt und geachtet, solange sie als treu ergebene Ehefrau und Mama der Kinder funktionierten. Sonst galten sie nicht viel. Sie ließ noch einen Espresso aus der Maschine laufen und setzte sich an den Küchentisch. Ohne zu trinken starrte sie auf die schwarze Flüssigkeit in der Tasse und haderte mit sich und ihrem Leben. Vielleicht sollte sie Battista doch verlassen, so, wie er sich in der letzten Zeit entwickelt hatte. Guillaume würde sie auf Händen tragen. Wie oft hatte er ihr gestanden, wie sehr er sich danach sehnte, gemeinsam mit ihr durchs Leben zu gehen. Bisher war sie es, die das strikt abgelehnt hatte. Immer wieder hatte er sie bedrängt, Toto, wie er Battista stets abschätzig nannte, zu verlassen. Seine Frau bedeute ihm nichts. Außerdem habe sie einen Liebhaber. Er wolle sich ohnehin von ihr scheiden lassen, weil sie ihn betrüge. Das sei nur eine Frage der Zeit. Er warte bloß noch, bis seine Beförderung zum regionalen Leiter aller Bankfilialen im Département durch sei.
Andererseits: Battista? Sie hatte ihn einmal geliebt. Aber wie lange war das her? Und das Restaurant! Doch das könnte sie auch allein weiter betreiben. Schließlich gehörte es ihr, sie war im registre du commerce et des sociétés, dem Handels- und Gesellschaftsregister als Alleineigentümerin eingetragen.
Lange saß sie zweifelnd vor der unberührten Espressotasse. Schließlich gab sie sich einen Ruck, holte das iPhone aus ihrer Handtasche, rief das Telefonverzeichnis auf und tippte auf Guillaumes Mobilfunknummer.
„Salut Guillaume, mon chéri!“
„Paola, ma chouchoute! Wie schön, deine liebe Stimme zu hören.“
„Guillaume, ich habe mich entschieden. Ich verlasse Battista. Ich will mit dir zusammen sein, gemeinsam mit dir durchs Leben gehen. Was sagst du dazu? Ist das nicht eine freudige Überraschung? Die Erfüllung all deiner Wünsche?“
Eine lange Zeit blieb es still in der Leitung.
„Guillaume, so sag doch was!“
„Das stellst du dir so vor. Und knallst es mir vor die Füße! Als ob ich da nichts mit zu reden hätte!“
„Aber das hast du dir doch immer gewünscht, hast gesagt es sei so toll, mit mir zusammen zu sein.“
„Es war ganz nett mit dir zu schlafen. Du bist gut im Bett, das stimmt. Aber das ist es dann auch schon. Von gemeinsam durchs Leben gehen kann keine Rede sein.“
„Aber Guillaume, du hast doch immer … Ich will mit dir … und du willst das doch auch …“
„Nichts will ich. Wie gesagt, es war nett mit dir, aber jetzt ist Schluss!“
„Guillaume!“ Ein Aufschrei.
„Schluss habe ich gesagt! Für immer!“
„Du mieses, gemeines Schwein! Ich hasse dich! Ich hasse Dich! Ich hasse dich!“
Es knackte in der Leitung.
Fassungslos starrte sie das Telefongerät in ihrer Hand an. Dann brach sie schluchzend über der Tischplatte zusammen.
Freitag, 7. Oktober
Obwohl der Nachmittag schon weit fortgeschritten war und alle seine Mitarbeiter bereits nach Hause gegangen waren, hatte für Guillaume de Montagne der Feierabend noch nicht begonnen. Ein Kunde hatte um ein persönliches Beratungsgespräch um diese Uhrzeit gebeten. Natürlich hätte es der Bankchef lieber gesehen, wenn er diesen Termin auf die nächste Woche verschieben und früher hätte nach Hause fahren können. Aber der Kunde, ein sehr wohlhabender Privatmann, war zu wichtig für die Bank. Also hatte er zähneknirschend nachgegeben und seine eigentlich geplante Freizeitbeschäftigung hintan gestellt. Zum Glück waren die Tage im Oktober noch ausreichend lang, so dass er sich seinem Hobby, dem Mountainbiking, auch später noch bei Helligkeit widmen konnte.
Das Gespräch stellte sich als langwierig und entnervend heraus. Der Informationsbedarf des Kunden war schier unbegrenzt. Nachdem der Bankchef unzählige und ermüdende Fragen zu Aktienfonds, ETFs, Immobilienfonds und anderen Anlageformen beantwortet und den Kunden mit einem umfangreichen Paket von Broschüren und Informationsblättern ausgestattet hatte, war er seinen Besuch endlich los, konnte das zur Straße führende Zugangstor verriegeln und die Bank durch die dem Personal vorbehaltene Hintertüre verlassen – nicht ohne vorher die Alarmanlage zu aktivieren.
Es war schon nach achtzehn Uhr, als er in seinen Landrover stieg und sich auf den Weg zu seinem draußen auf dem Land, mitten zwischen Weinbergen und Olivenhainen gelegenen Haus machte.
***
Nach der langen Arbeitswoche, die er fast ausschließlich mit sitzenden Tätigkeiten verbracht hatte – mit Aktenstudium, mit Arbeiten am Computer oder in Beratungsgesprächen – lechzte sein Körper nach sportlicher Bewegung.
„Merci machérie, aber erst, wenn ich wieder zurück bin“, lehnte er den Aperitif ab, den Marie-Claire, seine Frau auf der Terrasse der Villa vorbereitet hatte. „Ich muss mich jetzt erst bewegen, körperlich auspowern. Nach dieser Arbeitswoche brauche ich das ganz dringend.“
„Wirst du lange wegbleiben?“, fragte sie. Als er nickte, seufzte sie: „Erfahrungsgemäß kann das Stunden dauern. Ich glaube, das wird mir zu spät. Mon chéri, ich bin heute etwas kaputt – meine Migräne. Du kennst das ja. Bist du mir böse, wenn ich nicht auf dich warte, sondern mich schon vorher schlafen lege?“
„Aber ganz gewiss nicht, ma chouchoute! Leg dich bald hin und schlaf dich aus, damit es dir morgen wieder gut geht. Nimm vielleicht ein Valium, damit du nicht aufwachst, wenn ich spät heimkomme.“
Er drückte ihr einen flüchtigen Kuss auf die Stirn und enteile ins Obergeschoß. In dem zwischen Schlafzimmer und Bad gelegenen Umkleideraum warf er seinen Businessanzug auf den Boden und schlüpfte in seine Radfahrmontur – eine enge, dunkelblaue Radfahrerhose und ein grellrotes Trikot mit der blauen Aufschrift CCC – Club Cycliste de Cabanosque. In der Garage hob er sein Mountainbike aus der Wandhalterung, setzte den Helm auf, zog seine Fahrradhandschuhe an und fuhr los. Von den vielen Streckenvarianten, die sich von Cabanosque aus für Mountainbiker anboten, hatte er eine zu seinem Lieblingsparcours auserkoren. Er war abwechslungsreich und sehr anspruchsvoll. Wann immer ihm sein Job und seine Frau Zeit dafür ließen, tobte er sich auf dieser seiner Standardstrecke sportlich aus. Wie stets, wählte er auch jetzt diese Route.
***
Marie-Claire de Montagne blickte ihrem Mann nach, wie er sich auf sein Rad schwang, die gekieste Zufahrt zu ihrem Grundstück hinunter fuhr und dann links in die asphaltierte rue communale einbog. Sie ging zurück ins Haus und überlegte, ob sie sich wirklich hinlegen oder lieber die Gelegenheit nutzen und Claude anrufen sollte. Sie entschied sich für Letzteres.
„Claude, jetzt bin ich allein. Guillaume ist weg, er braucht seinen Abendsport, hat er gesagt. Mit seinem Mountainbike. Jetzt haben wir Zeit und können in Ruhe alles besprechen. Kommst du …?“
„Und wenn er zurückkommt? Du weißt ja, er rastet aus, wenn er sieht, dass ich zu euch ins Haus komme. Bist du sicher, dass er lange genug weg bleibt? Weißt du, wohin er gefahren ist?“
„Keine Ahnung, das interessiert mich nicht besonders. Aber normalerweise ist er immer so zwei bis drei Stunden unterwegs.“ Vielleicht war er aber auch zu seiner Geliebten gefahren, dieser Gastwirtin, dachte sie. Das hinge allerdings davon ab, ob deren Mann zuhause war oder nicht.
„Also, was ist? Kommst du?“
„Lieber nicht. Das ist mir zu riskant. Ich kenne seine Touren. Da ist auch eine kürzere dabei. Wenn er die fährt, dann ist er bald zurück. Und wenn er mich dann bei dir sieht …“
„Du weißt, wo er fährt?“
„Ja, früher hatten wir doch zusammen solche Mountainbiketouren gemacht. Daher weiß ich das. Aber seit einiger Zeit ist das passé. Wir beide wissen, warum.“
„Also kommst du nicht?“
„Nein! Sonst gibt es Mord und Totschlag!“
Natürlich war es auch Marie-Claire klar: Ein Zusammentreffen ihres Mannes Guillaume mit ihrem Bruder Claude würde nicht friedlich verlaufen, sondern in Streit und in Handgreiflichkeiten ausarten, wenn nicht sogar in eine brutale Schlägerei. Zu ungestüm waren deren Charaktere und zu gravierend der Grund für ihre Feindschaft.
***
Froh, dem Büro und dem beengenden Zuhause entkommen zu sein, trat Guillaume de Montagne in die Pedale. Zuerst ging es ein paar Kilometer eben auf der Landstraße dahin. Die Ernte in den Weingärten rechts und links der Straße war bereits seit Längerem vorüber. Das Grün der dichten Blätter auf den Rebstöcken begann schon in herbstliches Gelb umzuschlagen. Die tiefstehende Sonne überflutete die Landschaft mit ihrem goldenen Licht und ließ die Farben besonders kontrastreich leuchten. Als die Gegend hügeliger wurde, verließ er die Teerstraße und kämpfte sich einen steilen Schotterweg bergan. Hier änderte sich die Vegetation. Die kultivierten Weingärten und Olivenhaine lagen hinter ihm. Stattdessen säumte hartlaubige und teils stachelige garrigue den Weg. Rosmarin, Thymian, vereinzelt ein wilder Lavendelbusch, weiß und rosablühende Zistrosen mit ihren blassgrünen, behaarten Blättern und immer wieder Ginsterbüsche prägten das Bild. Guillaume de Montagne nahm dies allerdings nicht wahr. Weder sah er die zarten Blüten, noch roch er den würzigen Duft, den der ausgetrocknete Boden und die wilden Pflanzen verströmten. Er quälte sich verbissen den steilen Hang hinauf, den Blick stur auf den steinigen Weg vor sich gerichtet. Er fing zu schwitzen an, spürte, wie sich sein Puls beschleunigte. Langsam fielen die Anspannung und der Stress der Arbeitswoche von ihm ab und er fühlte sich frei. Mit noch mehr Kraft trat er in die Pedale und freute sich über das Geräusch, das die von seinem vorantreibenden Hinterreifen wegspritzenden Steine verursachten.
Bald hatte er die erste Höhe erreicht. Der sich zu einem Pfad verengende Weg führte den nur noch leicht ansteigenden Bergrücken entlang. Jetzt konnte er etwas nachlassen, sich von der Anstrengung erholen. Nun hatte er auch wieder einen Blick für seine Umgebung übrig, für die Schönheit der Landschaft. Rechts, nach Osten, ersteckte sich das hügelige, baumbestandene Land soweit das Auge reichte. Läge nicht das Massif des Maures als breite Barriere dazwischen, dann könnte man von hier oben aus das Meer sehen, dachte er. Guillaume hielt an, stieg ab und setzte sich auf einen Felsbrocken am Wegrand. Links unter ihm lag das Städtchen Cabanosque. Die Dämmerung war schon so weit fortgeschritten, dass die Stadtverwaltung die Straßenlaternen bereits angeschaltet hatte. Die verwinkelten Dächer mit ihren typischen provenzalischen Ziegeln grüßten herauf. Der von einem schmiedeeisernen Käfig bekrönte Turm der alten Kirche war im Scheinwerfer-Spotlicht gut zu erkennen. Daneben das Hôtel de Ville, das Rathaus, am von alten Platanen beschatteten Platz. Dort konnte er das rosafarbene Haus ausmachen, dessen gesamtes Erdgeschoß von seiner Bank eingenommen wurde. Weiter hinten, wo die route départementale am kleinen centre commercial vorbeiführte, ein kurzes Stück weiter, lag der Sportplatz mit drei Tennisplätzen, dem Fußballplatz mit der umlaufenden blauen Tartanbahn für die Leichtathleten, sowie dem großen Rugbyfeld seines CRC, des Club de Rugby de Cabanosque.
Was sich Toto nur einbildete! Als könnte er ihm, dem erfolgreichen und mächtigen Präsidenten des CRC das Wasser reichen! Aber dem hatte er es gegeben. Ihn in seine Schranken verwiesen. Ihm klar gemacht, wer hier das Sagen hatte. Der brauchte sich nicht mehr sehen zu lassen. Zufrieden nahm Guillaume de Montagne die Trinkflasche aus der Halterung und trank einen tiefen Schluck von dem immer noch erfrischend-kalten isotonischen Powerdrink. Er verstaute die Flasche, schwang sich wieder auf sein Mountainbike und setzte seine Tour fort. Seine Standardroute führte ihn zum nächsten Berg. Hier war der Anstieg länger und steiler als beim ersten, kleineren Auftakthügel vorhin. Aber die Mühen würden sich lohnen, dachte er, während er sich im kleinsten Gang den holprigen Pfad hinauf quälte. Oben, auf der Kuppe des Berges, würde er auf einen DFCI-Schotterweg treffen, eine der Pistes de Défence de la Forêt Contre les Incendies, Wegschneisen, die die Forstbehörde zur Brandbekämpfung durch die Wälder gezogen hatte. Auf dieser piste ging es mehr als fünf Kilometer bergab. Dort würde er seinem Mountainbike die Zügel freigeben und die lange, kurvenreiche und teilweise sehr steile Strecke hinunter sausen. Ganz am Ende musste er, um nach Cabanosque zurück zu kommen, die Schotterpiste wieder verlassen und die letzten Kilometer auf einem Wanderweg zurücklegen. Auch dort ging es im Wesentlichen bergab. Es stand ihm also eine spannende und rasante Talfahrt bevor. Aber noch fehlten ein paar Höhenmeter, die er hinaufstrampeln musste.
Die Abfahrt war atemberaubend und erzeugte bei ihm ein seelisches Hochgefühl. Er genoss den Fahrtwind, der ihm ins Gesicht wehte. Aufrecht in den Pedalen stehend hielt er den Lenker fest in den Händen. Die Federgabel seines Hightech-Mountainbikes schluckte die gröbsten Unebenheiten der steinigen Piste. Obwohl die Dämmerung bereits sehr weit fortgeschritten war und durch das dichte Nadeldach der Pinien nur wenig Licht vom abendlichen Himmel drang, konnte er den Weg noch gut erkennen. Wegen der hellen Farbe der Schottersteine lag die Piste wie ein weißes Band vor ihm. Wie jedes Mal, wenn er diese Rundtour, seine übliche Route, fuhr, hatte er auch jetzt wieder befreit aufgeatmet, sobald er die schweißtreibenden Aufstiege hinter sich gelassen hatte und sich dem Rausch der Geschwindigkeit hingeben konnte.
Viel zu schnell war die Stelle erreicht, wo er das breite und helle Band der Schotterpiste verlassen und auf den Wanderweg abbiegen musste. Der schmale Pfad war in der einbrechenden Nacht nur schwer auszumachen. Aber er kannte den Weg wie seine Westentasche, deshalb fuhr er mit nahezu unvermindertem Tempo weiter. Stachelige Rosmarinzweige und biegsame Ginsterruten peitschten gegen seine nackten Schienbeine. Weit vor sich konnte er die Lichter von Cabanosque durch die Büsche und Bäume schimmern sehen. Er fühlte schon den erfrischenden Geschmack des eiskalten Biers auf der Zunge, das er auf der Terrasse seines Hauses trinken würde – in einem der bequemen Schaukelstühle sitzend und den Geräuschen der Nacht lauschend. Allein, weil seine Frau mit Migräne im Bett lag. Marie-Claire – in letzter Zeit gab sie ihm Rätsel auf. Irgendwie hatte sie sich verändert. Wirkte unzufrieden. Oder unglücklich? Aber warum? Er bot ihr doch alles, was sie sich nur wünschen konnte: Ein hohes Einkommen, ein luxuriöses Haus, eine hervorgehobene gesellschaftliche Position. Kinder? Hier waren sie sich doch beide einig. Kinder ließen sich mit ihrer beider Lebensplanung nicht vereinbaren. Also, sie hatte doch überhaupt keinen Grund mit ihrem Leben unzufrieden zu sein. Er würde sie fragen, morgen, beim Frühstück. Sie waren doch ein ideales Paar, glücklich, erfolgreich und vermögend. Für ihn war sie die ideale Ehefrau, leidenschaftlich, anschmiegsam, verständnisvoll und tolerant in persönlichen, intimen Dingen. Und gesellschaftlich hoch angesehen, allenthalben geschätzt und geachtet. Was hatte sie nur? Und Paola? Wie hatte er sich in ihr getäuscht. Für ihn waren das nur ein paar amüsante Seitensprünge. Doch sie hatte sich tatsächlich eingebildet, dass er hier alles aufgeben und sein künftiges Leben mit ihr verbringen würde. Wie konnte sie nur so dumm sein? Aber das war jetzt zu Ende. Endgültig aus!
Diese Gedanken gingen ihm durch den Kopf, während sein Mountainbike ihn mit rasantem Tempo weiter bergab durch den Pinienwald trug.
Plötzlich spürte er einen heftigen Ruck, wurde aus dem Sattel gehoben und durch die Luft geschleudert, sah im Flug die Lichter von Cabanosque blinken. Ein brutaler Schlag traf seinen Kopf. Kurz fühlte er noch das Aufzucken eines brüllenden Schmerzes. Er merkte nicht mehr, wie sein Fahrradhelm an einer scharfen Felsscharte zerbarst und sein Körper, sich mehrmals überschlagend, den steilen Hang hinunter rollte, um von einem einsam aus dem Gestrüpp ragenden Felsblock abrupt gestoppt zu werden.
Samstag, 8. Oktober
Vormittags
Père Sébastien schloss das schwere Eichenportal auf und betrat die Klosterkirche. Der junge Pater sank, zum Altar gewandt, auf die Knie und bekreuzigte sich mit Weihwasser. Dann erhob er sich wieder und ging mit schnellen Schritten zu einem der beiden Beichtstühle, die sich wie zwei große Schränke aus lackiertem Eichenholz auf den beiden Seiten des Kirchenschiffs gegenüber standen. Er öffnete die Tür zum Priesterabteil, nahm auf der schmalen und harten Holzbank Platz und zog die Tür hinter sich wieder zu. Während er auf den ersten Gläubigen wartete, las er in seinem Brevier, betete und plante – ganz weltlich – seinen weiteren Tagesablauf. Erfahrungsgemäß kamen nicht viele in die einsam und weit abseits von allen Orten in den Eichenwäldern gelegene Priorei. Aber unabhängig von der Anzahl der Beichtenden, das Abnehmen des heiligen Sakraments der Buße war eine der vielen Pflichten, die der Orden allen seinen Patres auferlegte. Und heute war eben Pater Sébastien an der Reihe. Lange kam kein Mensch in die Klosterkirche. Doch dann vernahm er das Knarren, das immer beim Öffnen der Kirchentüre erklang, und kurz darauf das dezente Plopp, wenn sie von dem automatischen Türschließer wieder ins Schloss gedrückt wurde. Aber niemand kam zu seinem Beichtstuhl. Er beugte sich vor und schob mit dem Zeigefinger den dunklen Samtvorhang vor dem kleinen Fenster etwas zur Seite, das in der Tür seines Priesterabteils eingelassen war. Soweit er es übersehen konnte, befand sich niemand im Mittelschiff der Kirche. In die beiden Seitenkapellen im Querschiff hatte er von seinem Platz aus keinen Einblick. Er ließ seine Augen über die ihm gegenüber befindliche, aus großen, grau-braunen Kalkquadern gemauerte, nackte Kirchenwand gleiten, bewunderte die einfache und klassische Form der kleinen romanischen Rundbogenfenster. Ein Seitenblick zum schmucklosen Altar, dem Tabernakel, darüber das rote Glimmen des Ewigen Lichts, das die immerwährende Gegenwart Christi symbolisierte. Er ließ den Vorhang zurückgleiten und widmete sich wieder seinem Gebetbuch – soweit das Lesen in dem schummrigen Licht überhaupt möglich war, das durch die vergitterte Öffnung vom anderen, den Beichtenden vorbehaltenen Abteil des Beichtstuhls dringen konnte.
Nach weiteren Minuten der Stille vernahm er sich nähernde Schritte, dann das Knarzen der niedrigen hölzernen Bank, als sich der Beichtende niederkniete. Die runde vergitterte Öffnung verdunkelte sich, als sich die Person nach vorne beugte.
„Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen“, drangen die geflüsterten Worte durch das Gitter an das Ohr des Paters.
„Mon père, ich habe gesündigt und bereue meine Taten aufs Tiefste.“
Die Person beichtete mit flüsternder Stimme, sie habe einen Menschen, den sie hasse, in eine Falle gelockt, damit er sich einen Schaden, wie sie gehofft hatte, einen bleibenden Schaden, zuziehe.
Was genau sie gemacht habe und welcher Art der Schaden sei, fragte der Pater. Im darauf folgenden Beichtgespräch erfuhr der Priester, der reuige Sünder habe einen Radfahrer mit einem über den Weg gespannten Drahtseil vorsätzlich zum Sturz gebracht, in der Hoffnung, dass sich dieser verletze – aus Rache für dessen Verhalten. Der Beichtvater vergewisserte sich der tatsächlichen Reue des Sünders, der Anerkennung seiner Schuld und des ernst gemeinten Vorsatzes und des Bemühens, den Schaden wieder gutzumachen. Er nahm ihm die Verpflichtung ab, mit dem Geschädigten zu sprechen und ihn um Vergebung zu bitten. Zur Buße solle er täglich ein Vaterunser und ein Ave Maria beten. Dann erteilte er die Absolution und entließ den Sünder.
Eine merkwürdige Beichte, dachte père Sébastien, als die Kirchentür mit dem bekannten Plopp wieder ins Schloss gefallen war. Es hatte sich angehört wie ein Kinderstreich, der hier gebeichtet wurde. Aber es war kein Kind, da war sich der Pater sicher. Auch wenn die leise flüsternde Stimme nicht hatte erkennen lassen, ob die Person ein Mann oder eine Frau war, die hier gebeichtet hatte. Auch hatte er sie wegen des diffusen Lichtes und wegen des engmaschigen Gitters, das den Priester vom ihm unbekannten Beichtenden trennte, nicht genauer sehen können. Und das war auch gut so, sagte er sich. Denn dadurch sollte ja gerade die Anonymität des Sünders gewährleistet werden.
Er blickte auf seine Armbanduhr. Kurz nach sieben Uhr. Noch eine knappe Stunde, dann würde ein Mitbruder ihn ablösen. Er lehnte sich zurück und schloss die Augen. Er liebte diese stillen Stunden am Tagesbeginn in der Kirche. Die durch nichts gestörte Ruhe. Nicht einmal das laute Gezwitscher der Vögel von draußen drang durch die Glasfenster und die dicken Mauern in das Kircheninnere. Er sog die kühle, mit einem leichten Hauch von Weihrauch geschwängerte Luft tief ein. Dann vertiefte er sich wieder in sein Gebetbuch.
***
Marie-Claire de Montagne wachte spät auf. Noch schlaftrunken schob sie ihre Hand im breiten Ehebett zu ihrem Mann hinüber. Das Bett war leer. Dann war er also …? Oder sollte er zurückgekommen und schon auf sein? Er machte das manchmal so, stand früh auf, bereitete sich einen Espresso und setzte sich mit dem Kaffee und einem Keks oder einer Madelaine auf die Terrasse. Meist las er dabei irgendwelche Bankbriefe oder Geschäftsberichte.
Sie setzte sich auf, angelte sich ihren seidenen Kimono vom Kleiderhaken an der Garderobentür, schlüpfte hinein und ging durch das Haus, schaute in jedes Zimmer. Doch Guillaume war nicht da, weder auf der Terrasse, noch in der Küche am Espressoautomaten. Auch im Bad und in seinem Arbeitszimmer war er nicht. Sie ging zurück ins Schlafzimmer. Sein Bett war nicht benutzt worden. Die dünne Steppdecke lag noch so, wie sie sie am Abend aufgeschlagen hatte. Dann war er tatsächlich nicht nach Hause gekommen. Sie lief in die Garage. Wie erwartet fehlten das Mountainbike und sein Fahrradhelm. Langsam ging sie in die Küche zurück, schaltete den Kaffeeautomaten ein und wartete, bis das Wasser aufgeheizt war und der Espresso in einem dünnen Kaffeefaden in die kleine Tasse floss. Sie überlegte was geschehen sein konnte. Es war mehr als unwahrscheinlich, dass seine Radtour so lange dauerte und er immer noch unterwegs war – von gestern Abend bis jetzt. Sie schaute auf die Uhr. Inzwischen war es kurz vor zehn Uhr. Ihm musste etwas zugestoßen sein. Ein Unfall? Womöglich war er Opfer eines Überfalls geworden. Genügend Feinde hatte er ja, die einen Grund hatten, Rache zu üben. Allein schon wegen seiner dubiosen Immobiliengeschäfte.
Plötzlich kam ihr eine Idee.
„Oder er ist wieder zu dieser Schlampe gefahren!“, zischte sie. Das war die wahrscheinlichste Lösung. Der würde sie jetzt die Meinung sagen. Sie griff sich das Telefon, suchte im Speicher nach der Rufnummer und wartete, bis sich die Verbindung aufgebaut hatte.
„Paola Tomassino, bonjour“, meldete sich eine Frauenstimme.
„Gib mir Guillaume, sofort!“, schrie sie in den Hörer.
„Hallo, wer spricht dort? Guillaume ist nicht hier!“
„Ich weiß doch, dass er dich vögelt! Also gib ihn mir! Oder sag ihm gleich, er soll sich zum Teufel scheren. Er braucht gar nicht mehr nach Hause zu kommen.“
„Marie-Claire, bist du das? Nein, Guillaume ist nicht hier, wirklich.“
„Das soll ich dir glauben? Jeder im Ort hier weiß doch, dass du ihn …“
„Er … ist … nicht … hier!“, betonte Paola Tomassino laut und eindringlich. Außerdem: Du kannst ihn gerne zurück haben. Diesen Mistkerl! Ich hab Schluss gemacht mit ihm.
„Das soll ich dir glauben?“
„Glaub es oder glaub es nicht. Non me ne frega un cazzo! Das ist mir scheißegal!“
Dann war die Leitung tot.
Sollte Paola wirklich mit Guillaume Schluss gemacht haben? Oder er mit ihr? Aber wo war er dann? War er bei einer anderen Frau? Genügend Auswahl hatte er ja, musste sie sich verbittert eingestehen. Was sollte sie jetzt machen? Sollte sie zur Polizei gehen und ihn als vermisst melden? Aber was, wenn es kein Unfall und kein Verbrechen war und die Gendarmen würden ihn in einem Liebesnest aufstöbern? Welche Schande, welche öffentliche Erniedrigung wäre das für sie persönlich, von der katastrophalen öffentlichen Auswirkung auf ihre Ehe und das gesellschaftliche und berufliche Ansehen ihres Mannes gar nicht zu reden.
Was also sollte sie tun? Sich selber auf die Suche nach Guillaume machen? Aber sie wusste nicht, wo sie ihn suchen sollte. Da sie Radfahren hasste und ihn deshalb nie auf seinen Mountainbikefahrten begleitet hatte, hatte sie keine Ahnung wohin er gefahren sein konnte. Auch kannte sie keine seiner Damenbekanntschaften – von Paola Tomassino abgesehen.
Vielleicht wusste Claude, welchen Weg Guillaume genommen hatte. Schließlich waren die beiden früher gemeinsam Rad gefahren und ihr Bruder kannte Guillaumes Lieblingsstrecken. Falls ihm etwas zugestoßen war, würde Claude wissen, wo man suchen musste.
Sie beschloss ihren Bruder anzurufen und um Hilfe zu bitten. Er ging gleich nach dem ersten Rufton ran.
„SalutMarie-Claire!“, meldete er sich. Er hatte ihren Namen auf dem Display erkannt. „Was gibt es?“
Sie schilderte ihm ihre Überlegungen und bat ihn, ihr bei der Suche nach ihrem Mann zu helfen.
„Nein!“, war seine harsche Antwort. „Du weiß ja, wie wir zueinander stehen. Nach allem was war, was er mir angetan hat.“
„Aber wenn er einen Unfall hatte, vielleicht schwerverletzt und hilflos irgendwo im Gelände liegt …“
„Du weißt genau, dass er mir auch nicht helfen würde. Geh zur Polizei! Die sollen ihn suchen.“
***
In der Dienststelle der police municipale an der Place de la Mairie war nur Maurice, einer der Ortspolizisten.
„Bonjour, madame le directeur!“, begrüßte er die Eintretende ehrerbietig. Schließlich war sie die Gattin des Bankdirektors.
„Maurice, mein Mann ist gestern Abend von seiner üblichen Fitnessrunde mit seinem Mountainbike nicht zurückgekommen. Du musst etwas unternehmen, ihn suchen. Es muss ihm etwas passiert sein.“
Sie duzte den Polizisten. Nicht weil er zu ihrem und ihres Mannes Freundeskreis zählte, sondern weil man die einfachen Dorfbediensteten eben duzte, wenn man selbst zur High Society, zur Dorfelite gehörte, oder sich dazu gehörig fühlte.
Der Polizist befand sich in einer schwierigen Lage. Einerseits munkelte man im Dorf, dass der Bankdirektor zahlreiche Liebschaften pflegte, aktuell vor allem mit der Besitzerin des italienischen Restaurants. Deshalb war nicht von der Hand zu weisen, dass er die Nacht bei ihr oder einer anderen seiner Damen verbracht hatte. Maurice war sogar davon überzeugt. Andererseits konnte er das madame le directeur nicht so unverblümt sagen. Er kratzte sich mit dem Kugelschreiber hinter dem Ohr und überlegte krampfhaft. Während er noch da saß, nachdachte und die Frau anstarrte, fuhr sie ihn an:
„Jetzt tu endlich was!“
Da er ruhig sitzen blieb und keine Anstalten machte, aktiv zu werden, forderte sie ihn eindringlich auf: „Was sitzt du hier noch rum? Ihr müsst etwas unternehmen! Trommel deine Kollegen zusammen! Irgendetwas ist meinem Mann passiert. Ein Unfall, vielleicht wurde er überfallen, oder entführt. Auf jeden Fall müsst ihr etwas unternehmen. Und zwar schnell!“
„Madame le directeur“, ergriff der Ortspolizist den Rettungsring, den die Frau des Bankdirektors ihm unwissentlich zugeworfen hatte. „Wenn, wie Sie vermuten, ein Verbrechen vorliegt, dann sind wir als police municipale gar nicht zuständig. Das ist ein Fall für die gendarmerie nationale. Ich werde gerne ihren Besuch bei der brigade de gendarmerie Saint Maximin la Sainte Baume telefonisch avisieren.“
Faules Pack, dachte madame de Montagne. Laut sagte sie: „Mach das, meinetwegen! Ich bin jedenfalls sehr enttäuscht von dir. Ich glaube, ich werde mich bei maire Renardeau beschweren! Au revoir Maurice!“
Wütend verließ sie die kleine Polizeistation, nicht ohne die Tür mit Nachdruck hinter sich zuzuschlagen.
Der Dorfpolizist Maurice war einerseits froh, dass er diese heikle Angelegenheit vom Hals hatte. Denn er glaubte fest, dass der Bankdirektor die Nacht bei einer seiner Geliebten verbracht hatte. Es wäre nicht das erste Mal. Offiziell war das nicht bekannt, aber es kursierten entsprechende Gerüchte im Dorf.
Andererseits fürchtete er das Donnerwetter, das der Bürgermeister, sein Chef, veranstalten würde. Es war bekannt, dass directeur de Montagne und maire Renardeau eng befreundet waren.
***
Marie-Claire de Montagne stellte ihren Mini auf einem der markierten Parkplätze vor der Kaserne der gendarmerie nationale in Saint Maximin ab. Wie überall auf dem Land konnte man nicht einfach in das Gendarmeriegebäude hineingehen. Die Polizeistation war von einem hohen, stählernen Staketenzaun umgeben. Durch ein ebenfalls aus widerstandsfähigen Stahlstäben mit unüberwindlichen zackigen Spitzen an den oberen Enden bestehendes Tor gelangte man in das Innere des umzäunten und videoüberwachten Areals. Allerdings erst nachdem man geläutet und sein Begehr an der Gegensprechanlage geschildert hatte. So hatte es eine gute Weile gedauert, bis die Frau des Bankdirektors dem diensthabenden Militär gegenüberstand, einem brigadier namens Robert Varenne, wie sie an den Schulterklappen seiner Uniform und am Namensschild erkannte.
„Sie wollen also Ihren Mann als vermisst melden“, stellte der Gendarm fest. „Seit wann ist er denn abgängig?“
„Er ist gestern Abend zu einer kurzen Radtour aufgebrochen und bis heute nicht zurückgekommen“, erläuterte sie. „Ich bin sicher, ihm ist etwas zugestoßen – ein Unfall, ein Raubüberfall, was weiß ich!“
„Kommt es öfter vor, dass ihr Mann über Nacht fort ist?“
„Jetzt stellen Sie keine so unnützen Fragen, sondern tun Sie etwas. Suchen Sie meinen Mann!“
„So schnell geht das nicht. Erst muss ich Ihre Personalien aufnehmen.“ Er wandte sich seinem PC zu und lud ein Formular hoch.
„Aber bevor wir hier eine große Aktion starten, möchte ich doch wissen, ob es das erste Mal ist, dass Ihr Mann über Nacht fortbleibt.“
Durch den Anruf des Dorfpolizisten aus Cabanosque, der das Kommen von Frau de Montagne angekündigt hatte, wusste er von den Gerüchten um den Bankdirektor.
„Nein … ja …, gelegentlich kommt es schon vor, dass mein Mann über Nacht fort ist. Wenn er auswärts zu tun hat oder wenn er mit Freunden auf der Jagd war oder bei seinen Belote-Freunden beim Kartenspielen. Aber das weiß ich, das sagt er mir immer vorher.“
„Madame …?“, der brigadier machte eine Pause und schaute die Frau fragend an.
„de Montagne, Marie-Claire de Montagne, Gattin des Bankdirektors Guillaume de Montagne.“
„Vielleicht hat er diesmal vergessen, es Ihnen zu sagen“, meinte der Gendarm. „Mit einer Vermisstenanzeige warten wir besser noch etwas. Vermutlich kommt er bald zurück. Aus Erfahrung wissen wir, dass fast achtzig Prozent der als abgängig gemeldeten Personen nach ein bis zwei Tagen wieder kommen. Haben sie nicht versucht, ihn auf dem Handy zu erreichen?“
„Zum Radfahren nimmt er sein Handy nicht mit.“
„Haben Sie es bei seinen Freunden versucht?“
„Mais oui! Bei einem mit uns befreundeten Ehepaar habe ich angerufen. Aber da ist er nicht.“ Innerlich widerstrebte es ihr, die Affäre ihres Mannes so zu verharmlosen. Aber der brigadier brauchte ja nicht zu wissen, dass Paola die Geliebte von Guillaume und ihre, Marie-Claires, Feindin war.
„Und sonst?“
„Was sonst?“
„Haben Sie noch weitere Leute angerufen?“
„Nein! Ich bin dann gleich zur police municipale bei uns im Dorf. Und der Beamte dort hat mich zu Ihnen geschickt. Wegen der Zuständigkeit, hat er gesagt.“
„Also dann verbleiben wir doch am besten so: Wir warten noch etwas, bevor wir hier in Aktion treten. In dieser Zeit versuchen Sie telefonisch herauszufinden, ob er nicht bei einem Ihrer sicher zahlreichen Bekannten ist. Falls das zu keinem Ergebnis führen sollte, dann melden Sie uns das und wir leiten eine Suche ein. Auf jeden Fall fertige ich eine Aktennotiz von Ihrem Besuch heute an.“
„Aber …“
„Das ist das in solchen Fällen übliche Vorgehen.“
„Das finde ich unerhört! Ich will Ihren Vorgesetzten sprechen.“
„Der kann Ihnen auch nichts anderes sagen. So ist die Dienstvorschrift! Außerdem“, stellte er mit einem Blick auf den an der Wand hängenden Dienstplan fest, „ist maréchal Mazenc zurzeit nicht da. Au revoir madame de Montagne!“
Samstag, 8. Oktober
Nachmittags
Die milde Oktobersonne schien in die tiefe Schlucht des Grand Canyon du Verdon hinab und tauchte die Felswände über dem rechten Flussufer in goldenes Licht. Kein Lufthauch regte sich. Nur das leise Rauschen des Wassers und der gelegentliche Schrei eines Raubvogels, der über der Schlucht seine Kreise zog, waren zu hören.
Jean-Luc Papperin verfolgte den Flug des Vogels mit den Augen. Ein Geier, dachte er und erinnerte sich an den Artikel im Var Matin, wonach es im letzten Jahrzehnt gelungen war, Gänsegeier in der Schlucht auszuwildern. Seitdem nisteten kleinere Kolonien dieser Aasfresser in den Felswänden des Canyons.
Er lag auf einem sonnendurchwärmten Felsplateau, den kleinen Wanderrucksack als Kissen unter dem Kopf, die Arme weit ausgebreitet, und genoss die Ruhe. Es war das erste freie Wochenende seit langem und er hatte es genutzt, um wieder einmal durch den Grand Canyon du Verdon zu wandern. Er konnte nicht sagen, wie oft er diese Tour schon gemacht hatte. Sicher gut ein Dutzend Mal seit seiner Kindheit. Aber es lohnte sich immer wieder, diesen Teil der GR 4, der Grande Randonnée №4 zu durchwandern, einen der vielen Weitwanderwege des Landes, der von Royan nördlich von Bordeaux bis zur Parfümstadt Grasse in der östlichen Provence führte.
***
Nach einem ausführlichen Frühstück in der heimischen Ölmühle hatte ihn plötzlich die Lust zu Wandern gepackt. Seine Wahl war auf den Grand Canyon gefallen. Mit ausreichend Proviant, vor allem drei Literflaschen Perrier im Rucksack, hatte er sich in sein Auto gesetzt und sich auf den Weg zu der gut hundert Kilometer entfernten Schlucht gemacht. Die Fahrt hatte zunächst durch die sanften, von Weinbergen und Olivenhainen überzogenen Hügel geführt. Doch langsam hatte sich das Landschaftsbild verändert, je weiter er nach Norden kam. Pinien- und Steineichenwälder lösten die landwirtschaftlichen Nutzkulturen ab. Das Gelände wurde bergiger. Nur noch gelegentlich, in gerodeten Talsenken, fanden sich Weingüter. Nach der kleinen Trüffelstadt Aups ging es dann steil hinauf, bis die route départementale wieder hinunter führte zum Lac de Sainte Croix. Türkis-blau leuchtete der riesige Stausee tief unterhalb der Straße, dessen Ufer im Hochsommer von tausenden Touristen bevölkert wurden. Jetzt im Herbst war Ruhe eingekehrt. Zwar hatten die Verleiher der pédalos ihre Boote noch nicht ins Winterquartier gebracht. Die gelben und roten Tretboote lagen in langen Reihen am steinigen Uferstrand. Nur ganz wenige Freizeitkapitäne hatten sich solch ein Schiff gemietet. Sie wirkten wie kleine Farbkleckse auf der spiegelglatten Wasserfläche. Papperin war immer wieder fasziniert von dem überwältigenden, farbenprächtigen Panorama. Unter ihm der blaue See mit den Farbtupfern mitten darauf, am Ufer die wie rote und gelbe Perlenketten wirkende Reihe der Boote. Im Hintergrund, wie eine Theaterkulisse, die hohen Berge mit ihrem hell leuchtenden Felswänden, zu deren Füßen sich der Fluss Verdon in den Stausee ergoss. Dort befand sich der Eingang zur wohl größten und tiefsten Schlucht Europas.
Um zum Ausgangspunkt seiner Wanderung zu kommen, musste Papperin noch ein gutes Stück fahren. Kurz vor Moustiers Sainte Marie zweigte er auf die kurvenreiche Bergstraße ab, die hoch über dem Verdonfluss durch die Felshänge führte und immer wieder fantastische Ausblicke in die Schlucht und auf den sich viele hundert Meter weiter unten dahinwälzenden Fluss bot. Wäre er ein Tourist auf Sightseeingtour, dachte Papperin, dann würde er an jeder der Ausweichstellen anhalten, um mit weichen Knien einen Blick in die atemberaubende Tiefe zu werfen. Da er aber endlich loswandern wollte, fuhr er zügig weiter. Im herbstlich verschlafenen Bergdorf La Palud bog er rechts ab auf die schmale route des crêtes, eine Panoramastraße, die eigens für Touristen im vorigen Jahrhundert angelegt worden war. Nach wenigen Kilometern hatte er das Chalet de la Maline erreicht, ein Refuge de la Fédération Française des Clubs Alpins. Die Hütte des französischen Alpenvereins lag am Beginn des Sentier Blanc-Martel, des beliebten Wanderwegs durch den canyon. Hier parkte Papperin seinen nagelneuen Peugeot und machte sich an den steilen und streckenweise durch Drahtseile gesicherten Abstieg hinunter zum Fluss.
Im Sommer, vor allem in der Ferienzeit, war es kein Vergnügen, die Schlucht zu durchwandern. Nicht nur die Hitze, sondern vor allem die unzähligen Touristen machten dieses großartige Naturerlebnis zu einer Tortur. Jetzt, im Herbst, weit jenseits von Schulferien, hatten die Einsamkeit und die Natur den canyon wieder zurück erobert. Trotz Wochenende und strahlendem Wetter war Papperin bisher auf seiner Wanderung kaum auf Menschen getroffen. Nach den ersten beiden Stunden strammen Fußmarsches hatte er sich die erste Pause gegönnt und sich auf einem kleinen Felsvorsprung über dem Fluss niedergelassen.
Nachdem er lange Zeit regungslos auf dem sonnengewärmten Steinplateau gelegen und in die Luft geschaut hatte, setzte er sich auf und packte sein mitgebrachtes Picknick aus. Ein Baguette, ein größeres Stück vom Tomme de Savoie und einen Ring Chorizo. Auf dem glatten Stein schnitt er von der grobkörnigen spanischen Paprika-Knoblauchwurst mehrere Scheiben ab. Zusammen mit dem mild-würzigen Käse und des noch knusprigen Baguettes ergab das ein schmackhaftes verspätetes Mittagessen. Es fehlte nur die Flasche Rotwein dazu. Aber in Anbetracht der langen und anstrengenden Wanderung hatte er nur Wasser mitgenommen. Alkohol hätte seiner von der vielen Schreibtischarbeit ohnehin mitgenommenen Kondition den Rest gegeben. So saß er vergnügt speisend am Rand der Steinplatte, ließ die Füße über dem Abgrund baumeln und beobachtete die Fische im wenige Meter unter ihm träge dahinfließenden Verdon.
Der nächste Abschnitt des Wanderpfads führte ihn direkt unter den hohen, senkrecht zum Fluss abfallenden Felswänden vorbei, einem Paradies für Kletterer. In den Sommerferien, vor allem in den kühleren Morgen- und Abendstunden, konnte man die akrobatischen und nach Papperins Meinung todesmutigen Sportler zuhauf in den Wänden beobachten. Solokletterer und ganze Seilschaften klebten am Fels, von langen Seilen gesichert. Ihre Rufe hallten laut zwischen den hohen Felswänden wider.
Doch jetzt im Herbst war auch in der Kletterszene Ruhe eingekehrt. Papperin, der mit suchendem Blick die Felswände abtastete, konnte nur zwei Kletterer entdecken – genau gesagt sah er nur bunte Flecken im Fels, T-Shirts und Helme der Sportler. Vielleicht gehörten ihnen die beiden Autos, neben denen Papperin seinen Peugeot am Chalet de la Maline geparkt hatte. Vielleicht aber auch nur Wanderern, die, wie er selbst, in der herbstlichen Einsamkeit die Durchquerung der Schlucht genießen wollten.
Eine kurze Wegstrecke weiter, er hatte gerade eine Felsnase umrundet, sah er, wie sich ein Kletterer abseilte. Er schwebte langsam an der Wand hinab, stieß sich mit den Füßen vom Fels ab, wenn er ihm zu nahe kam, und glitt weiter nach unten. Papperin verfolgte ihn mit den Augen, bis er hinter einem dichten Gestrüpp aus seinem Blickfeld verschwand. Da die Stelle nicht weit abseits vom Wanderpfad lag, kraxelte Papperin die Schotterhalde die wenigen Meter nach oben, bis er zu den Büschen kam, hinter denen der Kletterer verschwunden war. Hier entdeckte er einen schmalen Durchlass, den er auf allen Vieren durchquerte, und fand sich auf einem kleinen Felsband wieder. Ein paar Schritte weiter links stand der Sportler und befreite sich aus dem Seil. Dann zog er das Kletterseil herunter, das geschmeidig wie eine dünne Schlange die Wand hinab glitt. Er legte es in ordentliche Schlingen, entledigte sich seines Klettergurts, an dem eine Reihe silbern glänzender Karabiner klapperte, und verstaute seine Ausrüstung im Rucksack. Papperin schaute den routinierten Bewegungen des Sportlers gebannt zu. Ob er so etwas auch konnte, fragte er sich. Wahrscheinlich würde ihm dort hoch oben in der senkrechten Wand angst und bang, wenn er überhaupt die Kraft und die Kondition hätte, um dort hinauf zu klettern. Ihm würde sicher flau im Magen werden und er würde mit zitternden Beinen im Fels hängen und weder vor noch zurück können.
„Wird Ihnen nicht schwindlig, wenn Sie dort oben nur an einem dünnen Seil hängen?“, traute er sich zu fragen.
Der Mann wandte sich zu Papperin um. Er hatte eine schlanke Figur, wirkte durchaus drahtig und durchtrainiert, war aber, anders als Papperin erwartet hatte, kein kraftstrotzendes Muskelpaket mit breiten Schultern, dicken Bizepsen an den Oberarmen, voluminösen Brustmuskeln und waschbrettartiger Bauchmuskulatur.
„Das ist nur eine Frage der Gewöhnung“, erwiderte der Kletterer. „Außerdem bin ich ja gesichert. Wie bei jeder gängigen Kletterroute sind Haken in der Wand, in die ich mich einhängen kann.“
Auf Papperins zweifelnde Miene erklärte er ausführlicher:
„Ehe ich von hier unten lossteige, fixiere ich ein Seilende, dass es mich bei einem Sturz hält. Dann lege ich das Seil in diese Sicherungsvorrichtung“, er zeigte auf ein kleines Metallgerät, das an seinem Klettergurt befestigt war, „und klettere los bis zum ersten Haken. Dort hänge ich das Seil mit einem Karabiner ein und klettere weiter zum nächsten Haken. Das Seil läuft durch das Grigri, so heißt das Metallding. Bei einem plötzlichen Ruck, also wenn ich abstürze, dann blockiert es das Seil und ich falle höchstens die zwei oder drei Meter, die ich ab dem letzten Haken hochgeklettert bin – das andere Ende des Seils ist ja unten beim Einstieg fest fixiert und hält mich. So kann ich völlig ohne Risiko durch die Wand klettern.“
Papperin schaute skeptisch die senkrechte Wand hoch. Er schüttelte den Kopf. „Ich glaube, das ist nichts für mich“, sagte er. Andererseits würde es ihn schon reizen, so etwas einmal auszuprobieren.
Der Kletterer hatte sich inzwischen auf einen Felsvorsprung gesetzt und eine Tafel Schokolade und eine Getränkeflasche aus dem Rucksack geholt. „Möchten Sie auch einen?“, fragte er und hielt Papperin einen Schokoriegel hin. Dankend nahm ihn Papperin an. Nach einer Weile, Papperin hatte inzwischen auch Wurst, Käse und Baguette ausgepackt und sie dem Sportler angeboten, meinte dieser:
„Sie sind aber kein Tourist.“
„Merkt man das?“
„Ja, an der Sprache. Sie kommen von hier, aus der Provence!“
So kamen sie ins Gespräch. Papperin stellte sich vor: „Jean-Luc Papperin. Ich komme aus Cabanosque.“ Er erzählte von der Ölmühle und von seinem Beruf als Kriminalkommissar in Aix. Der junge Mann hörte ihm interessiert zu.
„Bei Cabanosque?“, sagte er, „da in der Nähe gibt es auch nette Kletterrouten. Nicht so gigantisch wie hier“, dabei deutete er auf die senkrechte und glatte Felswand über ihren Köpfen. „Kleine und überwiegend einfache Routen – im Vallon Sourn am Argensfluss.“
Nach einigen Minuten des Schweigens, während derer die beiden Männer sich über den mitgebrachten Proviant hermachten, erkundigte sich Papperin:
„Und was machen Sie beruflich?“
„Ich bin Priester, Benediktinermönch, heiße père Sébastien und lebe und arbeite im Priorat Saint Pierre.“
Da er den fragenden Blick Papperins sah, erklärte er: „Das liegt sehr einsam mitten in den Wäldern. Der nächste Ort ist Allemagne en Provence. Den kennen Sie sicher.“
Papperin nickte. Das Dorf kannte er, auch von dem Kloster hatte er schon gehört. Aber er war noch nie dort gewesen.
„Und Sie dürfen da raus und hier klettern? Haben die Benediktiner nicht einen streng geordneten Tagesablauf?“
Ora et labora, an dieses Benediktinermotto erinnerte sich Papperin aus seinem Religionsunterricht in der Schule.
„Selbstverständlich haben wir strenge Ordensregeln, an die wir uns strikt halten. Trotzdem haben wir auch Freizeit, in der wir zum Beispiel Sport treiben können. Natürlich darf aber darunter das Klosterleben nicht leiden. Heute, ganz in der Frühe, habe ich noch die Beichte abgenommen. Aber mein Prior hat mir dann bis zur Abendmesse freigegeben.“
Als er den ungläubigen Gesichtsausdruck des Kommissars sah, meinte er:
„Aber das ist doch eigentlich allgemein bekannt. Vor ein paar Monaten stand sogar ein Artikel im Var Matin. Ein Reporter hat mich interviewt. Er war genauso überrascht wie Sie, dass wir Mönche Sport treiben dürfen, sogar außerhalb des Klosters. Ich habe ihn auf eine Klettertour mitgenommen. Darüber hat er eine ausführliche Fotoreportage gemacht. Spätestens seitdem dürften das alle Leser des Var Matin wissen.“
Der Pater verstaute den Rest seines Picknicks im Rucksack und machte ihn zu. Er schaute auf seine Armbanduhr. „Jetzt muss ich mich langsam auf den Rückweg machen, sonst komme ich zu spät zum gemeinsamen Nachtmahl im Refektorium.“
Er stand auf und warf sich den Rucksack über die Schulter. Dann schaute er Papperin an:
„Vielleicht können wir zusammen gehen? Ich muss zum Point Sublime am oberen Ende der Schlucht. Dort steht mein Auto.“
Da Papperin dasselbe Ziel hatte, machten sich die beiden auf den Weg. Der Wanderpfad führte jetzt ziemlich eben wenige Meter über dem Fluss durch Macchie und Wald. Die beiden unterhielten sich angeregt. Papperin erfuhr viel Interessantes über das Leben in einem Benediktinerkloster. Père Sébastiens Prieuré Saint Pierre war kein eigenständiges Kloster, sondern ein Priorat, ein Ableger der Mutterabtei, von der es rechtlich und wirtschaftlich abhängig war.
Bald kamen die beiden zum Couloir Samson, einem besonders spektakulären, schmalen Felsdurchbruch. Zwischen den eng beieinander stehenden, glatten Felsenwänden rauschte der schäumende Verdon hindurch. In vielen Jahrtausenden hatte er sich seinen Weg gegraben, den Fels abgeschliffen, die Wand unterspült und Höhlen ausgewaschen. Die beiden, der Wanderer und der Kletterer, blieben kurz stehen und genossen die überwältigende Kulisse. Da der couloir für Wanderer unpassierbar war, führte der Weg durch einen langen und stockdunklen Tunnel. Es war nass dort drinnen und glitschig. Ohne Papperins Taschenlampe und ohne die Helmlampe des Paters wären sie über die zahlreichen im Weg liegenden Steinbrocken gestolpert und in den tiefen Pfützen baden gegangen. Nicht weit nach dem Ende des fast einen Kilometer langen Tunnels lag der Parkplatz. Als Papperin sein Handy zückte um ein Taxi für die Rückfahrt zu seinem Auto zu bestellen, bot ihm der Mönch an, ihn zu fahren. Das sei kein großer Umweg für ihn.
Auf der Fahrt über die route des crêtes, die schmale Panoramastraße zurück zum Chalet de la Maline, kam das Gespräch wieder aufs Klettern. Die Straße führte kurvenreich oben an der Schlucht entlang. Sie bot immer wieder atemberaubende Einblicke in die Tiefe des canyon.
„Die meisten beginnen ihre Klettertour nicht unten am Fluss, so wie ich heute, sondern sie seilen sich von hier oben in die Wand ab und klettern dann nach einer oder mehreren Seillängen wieder hinauf“, erklärte père Sébastien. „Dadurch spart man sich den langen Fußmarsch vom Point Sublime oder vom Chalet de la Maline zu den Kletterrouten. Man stellt sein Auto hier oben ab und kann praktisch vom Auto weg losklettern. Auch ich mache das oft, vor allem, wenn ich nicht die Zeit habe, den Kletterausflug mit der Wanderung durch den canyon zu verbinden – so wie heute.“
Vom höchsten Punkt, etwa tausend Meter über dem Fluss, führte die Straße steil und in engen Kurven hinunter zum Chalet. Dort verabschiedete sich Papperin und bedankte sich fürs Mitnehmen. Sie trennten sich, nicht ohne vorher die üblichen Einladungen ausgesprochen zu haben:
„Wenn Sie wieder einmal in die Gegend von Allemagne en Provence kommen, dann schauen Sie doch bei unserer Abtei vorbei. Sie ist nicht allzu weit entfernt vom Ort. Ich würde mich über Ihren Besuch sehr freuen.“
Im Gegenzug lud Papperin den Pater in die Ölmühle nach Cabanosque ein. „Und wenn Sie einmal nach Aix kommen, dann besuchen Sie mich doch in meinem Kommissariat.“
Mit dem guten Vorsatz, das wirklich zu tun, aber mit der inneren Überzeugung, dass es wohl nicht dazu kommen würde, trennten sich der Kommissar und der Mönch.
Père Sébastien fuhr in seinem roten Fiat Panda auf schnellstem Weg zu seiner prieuré Saint Pierre, um rechtzeitig zur Abendmesse zurück zu sein. Jean-Luc Papperin zockelte in seinem Peugeot gemütlich nach Cabanosque. In Gedanken ließ er nochmals die großartigen Landschaftsbilder seiner Wanderung durch den Kopf gehen. Zudem hatte er eine neue Bekanntschaft gemacht und einiges dazu gelernt. Zum Beispiel, dass Benediktinermönche Freizeit hatten, in der sie einem Hobby nachgehen konnten, dass sie dabei nicht ihre Mönchskutte tragen mussten, sondern sich sportlich, modern und bunt kleiden durften. Er nahm sich vor, im Internet nach dem Artikel im Var Matin über den kletternden Benediktinermönch zu suchen.
Für Papperin, der mit Kirche und Religion nichts am Hut hatte, war das alles Neuland. Er würde sich zwar nicht gerade als Atheist bezeichnen, trotzdem waren ihm kirchliche Glaubenssätze und Riten fremd, unverständlich und letztlich egal. Viel mehr interessierte ihn der sportliche Aspekt der neuen Bekanntschaft. Es war das erste Mal, dass er einem Sportkletterer begegnet war und von diesem eine kurze Einführung ins Soloklettern bekommen hatte. Vielleicht sollte er das doch einmal selbst ausprobieren? Natürlich nicht an den Steilwänden der Verdonschlucht. Aber, wie père Sébastien gesagt hatte, gab es kleinere und einfache Kletterrouten in der näheren Umgebung von Cabanosque.
Samstag, 8. Oktober
In der Abenddämmerung
Die Sonne war längst hinter dem Sainte-Victoire-Bergmassiv verschwunden und die Hügel um Cabanosque lagen im Zwielicht der Abenddämmerung. Das Tageslicht kämpfte mit der anbrechenden Nacht und drohte, diesen Kampf zu verlieren. Die ideale Zeit für die Jagd!
Gilles Chanteloup, sein Gewehr – eine zweiläufige Schrotflinte – schussbereit in der Hand, streifte durch das Gebüsch. Hätte er nicht die grellrote Warnweste übergezogen, die verhindern sollte, dass andere Freizeitjäger ihn für Wild hielten und auf ihn schossen, man würde ihn im diffusen Abendlicht zwischen den Ginsterbüschen und den Pinien- und Eichenstämmen kaum wahrnehmen. Er war auf Vögel und Kleinwild aus – vor allem Bartavellen und Kaninchen. Langsam voran schreitend, die Ginsterruten und niedere Pinien- und Eichenäste mit der freien linken Hand beiseite drückend, beobachtete er seine Umgebung mit geschultem Auge. Es war still ringsum. Die Zikaden hatten ihr Geschrei schon bei Anbruch der Dämmerung eingestellt. Nur das sanfte Rauschen des Winds in den Baumkronen war zu hören.
Da! Ein Geräusch! Ein Schlagen von Flügeln! Ein stattliches Steinhuhn erschien über der Macchie und flatterte in die Höhe.
Zwei Schrotladungen verließen die Flintenläufe und stoppten abrupt den Flug des Vogels. Federn wirbelten durch die Luft. Die Bartavelle fiel wie ein Stein nach unten und verschwand im dichten, niedrigen Gestrüpp, etwa fünfzig Meter vom Jäger entfernt. Gilles schulterte sein Gewehr und machte sich auf den Weg zum unfreiwilligen Landeplatz seiner Jagdbeute. Er stapfte durch die dichte, stachelige, zwischen den vereinzelt stehenden Bäumen wuchernde Macchie, traf auf den Pfad, der vom Dorf kommend nach oben auf die Kuppe des Hügels führte, und überquerte diesen. Mit seinen Augen fixierte er die Stelle im Gestrüpp, wo die Bartavelle nach seiner Einschätzung liegen musste. Deshalb nahm er das Hindernis, das auf seinem Weg lag, erst wahr, als er schon fast darüber gestolpert war.
„Nom d’un chien! Un homme!“, erschrak er und machte unwillkürlich einen Schritt zurück.
„Allô? Monsieur? Sind Sie verletzt?“, rief er dem vor einem Felsblock verkrümmt Daliegenden zu. Doch er erhielt keine Antwort. Vorsichtig trat er wieder einen Schritt nach vorne und sprach den Mann erneut an:
„Allô? Hören Sie mich?“
Wieder keine Antwort.
Gilles Chanteloup betrachtete den Liegenden, sah das grellrote Trikot und las den Aufdruck CCC – Club Cycl… Der Rest des Schriftzugs wurde von einem Rosmarinbusch verdeckt. Er beugte sich hinunter. Jetzt erst sah er den in zwei Teile zerplatzten Fahrradhelm, der an seinem Haltegurt am Hals des Mannes hing. Er zuckte zurück, als er das zu einer dunklen Masse getrocknete Blut wahrnahm, das in den Haaren klebte. Er zwang sich, seinen Blick auf das Gesicht zu richten.
„Mon dieu! Das ist doch … der Chef unserer Bank!“, murmelte er. „Monsieur de Montagne.“