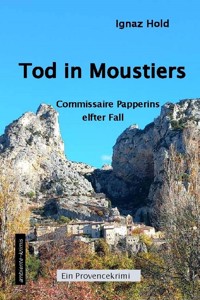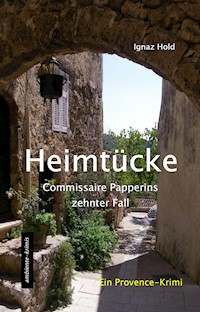
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ambiente-krimis
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Coronapandemie hat die Provence fest im Griff. Doch das hält skrupellose Verbrecher nicht davon ab, ihren kriminellen und gewinnträchtigen Geschäften nachzugehen. Eigentlich sind commissaire Papperin und sein Team von der Mordkommission der police justiciaire von Aix en Provence mit den Coronatodesfällen nicht befasst. Nur durch einen Zufall kommt Papperin dahinter, dass einige der vermeintlich an Corona verstorbenen alten Menschen nicht dem Virus, sondern einem heimtückischen Giftmord zum Opfer gefallen sind und ihr Geldvermögen auf geheimnisvolle Weise verschwunden ist. Doch der Oberstaatsanwalt verhindert weitere Ermittlungen und beruft sich auf die im Totenschein eingetragene Covid-19-Erkrankung als Todesursache. Der Kommissar und sein Team sehen sich gezwungen, ohne Rückendeckung ihrer Vorgesetzten heimlich zu recherchieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
IGNAZ HOLD
HEIMTÜCKECommissaire Papperins zehnter Fall
Buch
Die Coronapandemie hat die Provence fest im Griff. Doch das hält skrupellose Verbrecher nicht davon ab, ihren kriminellen und gewinnträchtigen Geschäften nachzugehen. Eigentlich sind commissaire Papperin und sein Team von der Mordkommission der police judiciaire von Aix en Provence mit den Coronatodesfällen nicht befasst. Nur durch einen Zufall kommt Papperin dahinter, dass einige der vermeintlich an Corona verstorbenen alten Menschen nicht dem Virus, sondern einem heimtückischen Giftmord zum Opfer gefallen sind und ihr Geldvermögen auf geheimnisvolle Weise verschwunden ist. Doch der Oberstaatsanwalt verhindert weitere Ermittlungen und beruft sich auf die im Totenschein eingetragene Covid-19-Erkrankung als Todesursache. Der Kommissar und sein Team sehen sich gezwungen, ohne Rückendeckung ihrer Vorgesetzten heimlich zu recherchieren.
Autor
Ignaz Hold ist ein Pseudonym. Der Autor, ein reiselustiger Wissenschaftler, hat seit über einem Vierteljahrhundert in der Provence eine zweite Heimat gefunden und kennt diesen Fleck Europas wie seine Westentasche. Er erholt sich, wann immer sein Beruf es ihm erlaubt, vom Stress des Alltags in seinem Haus in der Haute Provence. Dorthin, in die ländliche Idylle eines provenzalischen Dorfes, zieht er sich zurück, um zu schreiben. Neben nüchternen Fachbüchern entstehen dort seine Provencekrimis, in denen er den ganzen provenzalischen Mikrokosmos mit all seinen Problemen, Charakteren, landschaftlichen und kulinarischen Reizen einfängt und in spannende Krimis einfließen lässt.
Ignaz Hold
HEIMTÜCKECommissaire Papperins zehnter Fall
ambiente-krimis
Personen und Handlungen in diesem Roman sind frei erfunden und orientieren sich nicht an lebenden oder toten Vorbildern oder an tatsächlichen Geschehnissen. Etwaige Ähnlichkeiten sind nicht beabsichtigt und wären rein zufällig
ambiente-krimis,
Michael Heinhold
Am Feilnbacher Bahnhof 10
83043 Bad Aibling
Erste Auflage 2022
Copyright © 2022 by Ignaz Hold
Alle Rechte vorbehalten
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
Umschlagfoto: Michael Heinhold
ISBN der Taschenbuch-Ausgabe: 978-3-945503-32-4
Prolog
„Unglaublich, diese Summen! Ich verstehe das nicht! Wie konnte es zu diesen Zahlungen kommen“, murmelte père Cyril leise vor sich hin, während er die Treppe hinauf auf dem Weg zu dem für die Finanzen des Bistums Toulon-Fréjus zuständigen Prälaten eilte. In den Räumlichkeiten seines Vorgesetzten angekommen, öffnete der Priester seinen Aktenkoffer, entnahm ihm einige Blatt Papier und übergab sie seinem Chef.
„Das, Monseigneur, sind die Zahlungsein- und -ausgänge auf den Konten meiner Stiftung.“
„Sie meinen die Armenstiftung unserer Kirchenprovinz, mit deren Buchhaltung Sie betraut sind?“
Der Prälat beugte sich über die vor ihm ausgebreiteten Dokumente. Er überflog die beträchtlichen Kontoeingänge und meinte dann:
„Am Telefon sagten Sie, das stammt alles aus Vermächtnissen?“
Als der Pater nickte, meinte der Prälat, während er mit dem Finger die Zahlenkolonnen entlangfuhr:
„Geldbeträge von beachtlichen Ausmaßen, welche die Gläubigen in ihren Testamenten unserer Kirche vermacht haben.“
„Genau gesagt nicht der Kirche, sondern unserer kirchlichen Stiftung Fondation ecclésiastique en faveur des pauvres“, berichtigte der Priester den Prälaten.
„Ja, ich weiß. Unserer ‚Stiftung für die Bedürftigen‘ mit Sitz in Fréjus.“ Der Prälat lehnte sich in seinem weichgepolsterten und mit dunkelrotem Samt bezogenen Schreibtischsessel zurück und blickte seinen für die Stiftungsbuchführung zuständigen Untergebenen mit besorgtem Blick an.
„Man ist direkt beschämt, mon cher père Cyril“, meinte er zu dem auf der anderen Seite seines ausladenden, antiken Schreibtisches stehenden Priester.
„Diese Epidemie reißt unsere Glaubensbrüder und -schwestern in Scharen hinweg und führt ihre Seelen zum Herrn. Und wir profitieren …“
„Pandemie, Monseigneur! Es ist eine Pandemie!“, korrigierte ihn sein Gegenüber.
„Dann eben Pandemie. Das ist doch dasselbe. Das Tragische ist“, der Prälat ließ sich durch den Einwand nicht aus dem Konzept bringen. „Die Tragödie ist doch, dass wir, die heilige katholische Kirche, aus diesen Todesfällen finanziellen Nutzen ziehen.“
Der Prälat blickte den Buchhalter besorgt an.
„So schlimm dieses Virus weltweit unter den Menschen wütet und so traurig der Anlass für diese Vermächtnisse unserer armen, verstorbenen Glaubensbrüder und -schwestern jeweils ist: Natürlich hat das auch einen positiven, erfreulichen Aspekt, denn mit diesem Geld können wir sehr viel Gutes tun!“
Der Prälat erhob sich und reichte seinem Buchhalter die Hand.
„Danke, dass Sie mich über den Kassenstand unserer Stiftung informiert haben. Aber deswegen hätten Sie sich nicht hierher zu bemühen brauchen. Au revoir mon cher ami!“
„Das war noch nicht alles, Monseigneur. Ich wollte …“
„Was gibt es denn noch?“, fragte der Prälat etwas ungeduldig.
„Ich habe etwas entdeckt. Es handelt sich um Überweisungen, Ausgaben, die ich nicht nachvollziehen kann, beziehungsweise wo mir unklar ist …“
„Das werden Sie schon herausbekommen, so gründlich, wie Sie arbeiten. Freuen Sie sich doch über die großzügigen Einnahmen. Und nun: Au revoir! Ich habe zu tun!“ Er gab dem Priester die Buchungsunterlagen zurück und machte mit einer Geste seiner linken Hand zur Tür hin deutlich, dass er das Gespräch für beendet erachtete.
Nachdem der Buchhalter den Raum verlassen hatte, ging der Prälat zu seinem Schreibtisch zurück, um dort wieder Platz zu nehmen. Dabei stieß sein Fuß gegen etwas Hartes.
„Hat Cyril seinen Aktenkoffer stehen lassen!“, murmelte er. Dann griff er zum Telefon und wählte die Nummer des Kaplans in seinem Vorzimmer.
„Das hat père Cyril hier vergessen“, sagte er, nachdem sein Sekretär eingetreten war. „Nehmen Sie es und bringen Sie es gelegentlich bei ihm vorbei. Merci!“
Er ging zurück zu seinem Schreibtisch, setzte sich und zog die Tastatur seines PC näher zu sich heran. Er las den Entwurf seiner Predigt, die er am Sonntag in der Kathedrale halten wollte, feilte an einzelnen Formulierungen und fügte hier und da einen Satz hinzu.
Nach einer knappen Stunde, er hatte sich gerade etwas zurückgelehnt und überlegt, ob er sich von seinem Kaplan ein Glas Orangensaft bringen lassen sollte, meldete sich das Telefon auf seinem Schreibtisch.
„Oui? Was gibt es?“, fragte er, nachdem er auf dem Display seinen Sekretär als Anrufer erkannt hatte.
„Mon…Monseigneur, es…es…ist etwas … Entsetzliches passiert“, drang die aufgeregt stotternde Stimme aus dem Hörer.
„Sie… ha…hatten mi…mir…doch…äh…Ich…ich…habe auftragsgemäß…“
„Jetzt stottern Sie nicht so herum. Sagen Sie endlich, was los ist!“
„Père Cyril, er… er ist tot! Ermordet! Je… jemand hat ihn erstochen.“
Samstag, 6. August
Commissaire Jean-Luc Papperin nahm das Frühstück im Innenhof der moulin à huile Frédéric Papperin ein. In den auf drei Seiten von den hohen Natursteinmauern der Gebäude umsäumten Hof drang so früh am Morgen noch kein Sonnenstrahl. Deshalb war es jetzt, Anfang August, noch angenehm kühl. Später am Tag, wenn die Sonne höher am Himmel stand, würde sie unbarmherzig auf das Anwesen herniederbrennen und etwa die Hälfte des mit groben Kalksteinplatten gepflasterten Hofes bis zur Unerträglichkeit aufheizen. Zum Glück gab es die alte Platane, deren gewaltige, dicht belaubte Krone die andere Hälfte des Hofes mit Schatten versorgte. Vor ihrem meterdicken Stamm befand sich ein riesiger runder Granittisch. Eine Steinbank, die sich der Rundung des Tisches anpasste, bot Sitzgelegenheiten für mindestens drei Personen. Hier saß Jean-Luc Papperin, vor sich le bol, die typische Schale mit café au lait. Ein Körbchen mit knusprigem Baguette sowie mehreren backfrisch duftenden Croissants stand auf dem Tisch. Daneben lag aufgeschlagen Papperins Lieblingszeitung Le Figaro.
An den Wochenenden genoss er es, sofern sein Dienstplan dies zuließ, ausgiebig und gemütlich zu frühstücken und gründlich die Wochenendausgabe der großen Tageszeitung zu lesen. Ohne den Blick von dem interessanten Artikel abzuwenden, tauchte er ab und zu sein Croissant in seine Kaffeeschale und biss dann genüsslich in das von Kaffee und Milchschaum triefende Hörnchen. Die gesamte Titelseite der Zeitung wurde von der Coronapandemie und den aktuellen Maßnahmen zur Lockerung von Auflagen beherrscht, die die Zentralregierung in Paris verfügt hatte, um der Wirtschaft und dem sozialen Leben ihrer Staatsbürger wieder etwas mehr Freiraum zu gewähren. Die Pandemielage war immer noch ernst, aber der strenge Lockdown, le confinement, wie er von den politischen Entscheidungsträgern genannt wurde, hatte Erfolge gezeigt. Die Zahl der Neuinfektionen und der täglich Versterbenden war seit dem Ausbruch der Epidemie im Frühjahr drastisch zurückgegangen. Dennoch fand Papperin die Lage durchaus beunruhigend. Er fürchtete, seine Mitbürger würden sich nicht ausreichend an die nach wie vor dringend empfohlenen Maßnahmen, wie das Tragen von Atemschutzmasken und das Befolgen von Abstandsregeln, halten. Außerdem beunruhigten ihn die Warnungen der Wissenschaftler, die ein schnelles Wiederansteigen der Infektionszahlen prognostizierten.
„Ich finde, es war höchste Zeit, dass die in Paris endlich kapiert haben, dass sie uns nicht länger einsperren können.“ Odile Papperin, die Mutter des Kommissars, kam aus der Küche in den Hof. In der linken Hand hielt sie eine Tasse mit café au lait und mit der rechten schwenkte sie die regionale Zeitung Var Matin.
„In dem Artikel hier schreiben sie, was wir alles wieder dürfen. Jetzt mache ich mich nicht mehr strafbar, wenn ich meine Freudinnen treffe. Und im Bridgeclub brauchen wir keine Angst mehr zu haben, dass die Gendarmen kommen, uns vertreiben und uns ein Bußgeld aufbrummen“, freute sie sich und setzte sich zu ihrem Sohn an den Tisch. Eine gute Weile saßen die beiden schweigend nebeneinander und lasen in ihren Zeitungen.
„Hier steht, dass Julienne in der maison de retraite gestorben ist. Die war doch erst knapp über siebzig“, wunderte sich Odile. Da Papperin nicht reagierte, sagte sie:
„Im Altersheim in Brignoles. Julienne Batoux, die Witwe vom alten Batoux. Die kennst du doch. Es steht aber nicht da, woran sie gestorben ist.“
„Wahrscheinlich an Corona“, murmelte Papperin, der sich nicht von der Lektüre eines Artikels über die Chancen von Marine LePen bei den nächsten Präsidentschaftswahlen ablenken ließ.
„Überhaupt“, störte ihn Odile aufs Neue, „die Todesanzeigen sind viel mehr geworden.“ Dabei schob sie den Var Matin zu ihrem Sohn hinüber und deutete auf die Seite mit den avis de décès.
„Wundert dich das?“, fragte Jean-Luc. „Die Leute nehmen die Coronapandemie nicht mehr ernst. Und die trifft eben hauptsächlich die Alten und Schwachen. An den vielen Todesanzeigen siehst du doch, wie gefährlich das ist. Sei nicht immer so leichtsinnig. Du bist auch nicht mehr die Jüngste.“
“Quatsch! Ich bin erst knapp sechzig und völlig fit“, konterte Odile. Im Stillen musste Papperin ihr Recht geben. Seit dem Unfalltod von Arnaud, ihrem Mann und Jean-Lucs Vater, betrieb sie die Ölmühle alleine und sehr erfolgreich. Selbstverständlich half er ihr, soweit sein Beruf als Leiter der Mordkommission in Aix en Provence dies zuließ. Seine Mithilfe beschränkte sich allerdings meistens auf rechtliche und finanzielle Dinge. Die eigentliche Arbeit, die Pflege der Ölbaumplantage, die Olivenernte, die Produktion des Öls und den Vertrieb managte sie weitgehend alleine – unterstützt nur von Alphonse, ihrem langjährigen Mitarbeiter und Freund seines verstorbenen Vaters, sowie von fallweise engagierten Saisonarbeitern bei der Olivenernte im Winter.
„Trotzdem, du solltest vorsichtiger sein. Maske tragen beim Einkaufen und dich nicht mit deinen Freundinnen treffen. Und überhaupt: Nicht so oft ins Dorf gehen.“
„So ein Unfug! Doch nicht bei uns im Dorf. Was soll da gefährlich sein? Da kenne ich doch jeden. Übrigens“, wechselte sie abrupt das Thema, „wenn ich wirklich zu den Alten gehören würde, wie du das gerade gemeint hast, dann wäre ich schon längst Oma und du hättest mir Enkel beschert.“
Papperin seufzte. Er hasste es, wenn ihr sonst so harmonisches und einvernehmliches Zusammenleben diese Wendung nahm.
„Du weißt, wie wichtig mir mein Beruf ist und wie wenig Zeit er mir für Privates lässt. Außerdem …“ Papperin verzog in schmerzvoller Erinnerung sein Gesicht.
„Das war ja geplant. Wenn Chau mich nicht so …“
„Professeur Chau Iris LeTrans“, unterbrach Odile ihren Sohn. „Die vornehme Diplomatentochter mit Professur an dieser vietnamesischen Universität. Ist doch klar, dass die dich verlassen hat. Das konnte nicht gut gehen. Ich habe es dir oft genug gesagt: Such dir jemanden von hier. Was ist mit Jeannine, deiner Assistentin? Die ist schön, die ist intelligent, sie ist von hier und liebt die Provence genauso wie du. Ihr arbeitet gut zusammen und ihr liebt euch. Also was hindert dich…!“
„Das ist vorbei, Maman!“, unterbrach Papperin den Redefluss seiner Mutter. „Darauf haben wir uns geeinigt. Und das weißt du auch. Also hör endlich auf, mich damit zu quälen.“
Chaus Absage hatte ihn wirklich völlig überraschend getroffen. Sie waren sich doch beide einig gewesen, dass sie heiraten wollten, dass Chau in die Provence ziehen und eine Stelle an der Universität Aix-Marseille annehmen würde. Und dann hatte sie angerufen und alle seine Zukunftspläne zerplatzen lassen, als er mitten in seinem letzten Mordfall gesteckt hatte. Auch wenn das jetzt schon einige Monate her war, er konnte sich immer noch nicht damit abfinden. Er litt nach wie vor unter der Enttäuschung und der hoffnungslosen Leere, die sich seitdem in seinem Inneren breit gemacht hatte. Ihm war auch bewusst, dass seine Arbeit unter seinem fast depressiv zu nennenden Verhalten litt. Zum Glück hatte er gute Mitarbeiter, die hervorragende Arbeit leisteten und seine – hoffentlich vorübergehende – Antriebslosigkeit kompensierten.
Er gab sich einen Ruck, löste sich von diesen trübseligen Gedanken und schaute seine Mutter an.
„Maman, es ist wirklich ernst. Versprich mir, dass du vorsichtig bist. Mit diesem Virus ist nicht zu spaßen. Auch wenn du dich fit fühlst – mit sechzig bist du in dem gefährdeten Alter. Also bitte: Pass sehr auf dich auf, damit du gesund bleibst.“
„Aber du auch! Mit deinen Mitarbeitern und den vielen Leuten, die du in deinem Beruf treffen musst.“
„Selbstverständlich. Außerdem werden wir Polizisten regelmäßig getestet, ob wir uns mit dem Virus infiziert haben – meistens sogar mehrmals pro Woche.“
Er stand auf und meinte:
„Jetzt brauch ich was Stärkeres als diesen milden Milchkaffee. Ich mach mir einen doppelten Espresso. Magst du auch einen?“
Sonntag, 7. August
Wie jeden Morgen auf ihrer Frührunde warf Marie-Claire, die für die Etage zuständige Pflegerin, einen kurzen Blick in jedes der 14 Apartments im ersten Stock der Seniorenresidenz Au Bienêtre. Geschützt durch Atemschutzmaske und medizinische Schutzbrille betrat sie den Vorraum der Wohnung 1.09 und öffnete dann leise die Tür zum eigentlichen Apartment. Es bestand aus einem größeren Wohn- und einem kleineren Schlafzimmer. Außerdem gab es ein Bad, in das man sowohl vom Vorraum als auch direkt vom Schlafraum gelangen konnte. Das Wohn- und Pflegeheim Au Bienêtre am Ortsrand von Grimaud galt in der Region als Geheimtipp und wurde von betuchten Senioren der Oberschicht bewohnt.
Die Pflegerin wusste, die Bewohnerin dieses Apartments hatte sich in den letzten Tagen nicht wohl gefühlt. Seit gestern war etwas Fieber dazu gekommen. Man hatte vorsorglich auf Corona getestet und wartete jetzt auf die Nachricht des Labors mit dem Testergebnis. Marie-Claire durchquerte das Wohnzimmer und betrat den kleinen Schlafraum. Mit einem Blick sah sie: Der alten Frau ging es sehr schlecht. Mit kaum hörbarer Stimme flüsterte die Kranke:
„Luft! Ich bekomme keine Luft!“
Die sofort durchgeführte kontaktlose Temperaturmessung zeigte hohes Fieber an. Als erfahrene Altenpflegerin wusste Marie-Claire, dass hier sofort gehandelt werden musste. Während sie beruhigend auf die Kranke einredete, wählte sie auf ihrem Handy den Heimarzt Dr. Martigny an und bat ihn, sofort in das Apartment 1.09 von madame Feuillet in Haus zwei zu kommen. Nach ihrer Überzeugung handele es sich nicht um einen normalen grippalen Infekt, sondern um einen ernsten Fall von Covid-19. Die Infektion habe sich seit gestern drastisch verschlechtert. Madame Feuillet habe hohes Fieber und schwere Atemnot. Wahrscheinlich müsse die Patientin in ein Krankenhaus verlegt werden.
Der Arzt war innerhalb weniger Minuten zur Stelle.
„Liegt das Ergebnis vom Nasenabstrich schon vor?“, fragte er die Pflegerin. Als Marie-Claire verneinend den Kopf schüttelte, diagnostizierte er:
„Trotzdem, es dürfte sich eindeutig um Corona handeln. Sie haben Recht, sie muss sofort in eine Klinik.“
Routinemäßig wurde alles Nötige in die Wege geleitet. Ein Krankenwagen des SAMU, des Service d’Aide Médicale Urgente wurde gerufen und die Kranke für den Transport vorbereitet. Keine dreißig Minuten später war der Rettungswagen mit der inzwischen bewusstlosen Frau unterwegs zum nächstgelegenen Krankenhaus.
***
Nachdem das Frühstück serviert war – teils in den Apartments der Heimbewohner, teils im großen Speiseraum, trafen sich die Angestellten des Hauses um zehn Uhr zur gemeinsamen Kaffeepause.
„Marie-Claire, was war heute los bei euch im ersten Stock von Haus zwei? Warum ist der SAMU gekommen?“
„Madame Feuillet musste ins Krankenhaus verlegt werden. Docteur Martigny ist überzeugt, dass sie Corona hat. Ich meine das auch. Ich schätze, das Labor wird das bestätigen. Aber noch ist das Ergebnis nicht da. Ganz plötzlich hat es sie sehr schwer erwischt.“
„Die arme madame Feuillet. Sie war immer so gut drauf und so lustig.“
„Mit Trinkgeld hat sie auch nicht gegeizt.“
„Corona sagst du. Wo sie sich wohl angesteckt hat? Bei uns nicht. Wir sind ja alle negativ getestet.“
„Vielleicht bei Pierre? Der war doch positiv. Aber der ist seit einer Woche zuhause in Quarantäne.“
„Und außerdem war der für Haus zwei gar nicht zuständig und ich habe ihn dort auch nie gesehen“, ergänzte die Pflegerin Marie-Claire.
„Hat sie viel Besuch gekriegt? Dass der was reingetragen hat?“
„Möglich! Einmal habe ich einen Priester gesehen, der aus ihrem Apartment kam. Aber mehr kann ich zu Besuchern nicht sagen. Wir sind ein offenes Haus. Unsere Insassen können empfangen, wen sie wollen und wann sie das wollen. Besucher kommen einfach, sie müssen sich ja nicht anmelden.“
„Die von den Services d’Hygiène, vom Gesundheitsamt, werden vermutlich bald auf der Matte stehen und nachforschen, bei wem sich madame Feuillet infiziert hat. Sie werden fragen, mit wem sie alles Kontakt hatte“, meinte die Chefin der Alten- und Pflegekräfte. „Wir sollten schon mal überlegen, wer in den letzten Tagen alles bei ihr war – außer dem Pfarrer, den du gesehen hast. Kanntest du den?“
Marie-Claire schüttelte den Kopf.
Montag, 8. August vormittags
Am folgenden Tag sprach ein Beamter der Services d’Hygiène im Alten- und Pflegeheim Au Bienêtre vor. Er berichtete, dass Yvette Feuillet in der letzten Nacht gestorben sei – und zwar nachweislich an Covid-19. Nun müsse er die Kontakte der Verstorbenen in den vergangenen Tagen nachverfolgen. Nachdem er die Angestellten des Heimes erfolglos mit vielen Fragen genervt hatte, schrieb er in sein Notebook:
‚Alle Mitarbeiter dieses Heims, die mit Yvette Feuillet in den beiden letzten Wochen Kontakt hatten, konnten einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen und scheiden deshalb als Überträger des Virus aus. Sie können allerdings nicht ausschließen, dass das Virus von Besuchern der Verstorbenen eingeschleust worden ist.‘
Nach der weiteren intensiven, aber ergebnislosen Befragung der Angestellten zu möglichen Besuchern wandte er sich an die versammelten Mitarbeiter und stellte mit einem frustrierten Schulterzucken abschließend fest:
„Madame Feuillet war gehbehindert und lebte isoliert in ihrem Apartment. Zu den Mahlzeiten ging sie in der letzten Zeit nicht mehr in den Speisesaal, sondern aß allein in ihrer Wohnung. Sie bekam auch keinen Besuch von anderen Heimbewohnern. Kurz: Sie haben keine Ahnung, mit wem außer den Angestellten hier madame Feuillet Kontakt hatte. Sie können weder sagen, ob es überhaupt Besucher gab, noch wie viele es waren, noch kennen Sie Namen oder können diese Besucher beschreiben. Sie wissen nicht einmal, ob es sich um Männer oder Frauen gehandelt hat. Ist das richtig?“
Allgemeines, zustimmendes Nicken der versammelten Angestellten folgte auf dieses ernüchternde Resümee.
„Wir müssen auch ihre Familienangehörigen befragen. Wissen Sie, ob sie Verwandte hatte und können Sie uns deren Adressen geben?“, wollte der Beamte wissen.
„Nein, sie war alleinstehend“, meinte die Pflegerin Marie-Claire. „Sie hatte niemanden, der sich um sie kümmerte. Ich habe mich oft mit ihr darüber unterhalten. Deshalb hat sie Trost im Glauben gesucht und ist regelmäßig in die Kirche gegangen.“ Nach kurzem Zögern fügte sie hinzu: „Früher, als sie noch ausgehen konnte. Später, als sie dazu zu gebrechlich war, kam eine Zeit lang regelmäßig ein Pfarrer zu ihr ins Heim. Aber das hat irgendwann aufgehört – schon vor Monaten.“
„Du hast vorhin doch gesagt, dass du erst kürzlich einen Priester gesehen hast, wie er aus ihrem Apartment gekommen ist“, fragte die Pflegechefin zu Marie-Claire gewandt.
„Wann war das und wer war das?“, hakte der Mann vom Gesundheitsamt sofort nach. „Ich brauche den Namen und die Adresse dieses Priesters.“
Marie-Claire zuckte mit den Schultern.
„Das weiß ich nicht. Ich habe ihn nur kurz auf dem Korridor gesehen, wie er das Apartment von Yvette Feuillet verlassen hat.“
„Sie haben nicht mit ihm gesprochen?“
Verneinendes Kopfschütteln.
„Wann war das?“
Marie-Claire blickte den Fragenden mit nachdenklich gekräuselter Stirn an.
„Gestern? Nein, vorgest…nein, vor drei Tagen. Nachmittags.“
„Und Sie sind sicher, dass es ein Priester war?“
„Ja, ein katholischer. Er hatte einen schwarzen Anzug an.“
„Bei der Hitze? Mitten im Hochsommer?“
„Doch! Es war ein Sommeranzug aus leichtem Leinenstoff. Vielleicht nicht tiefschwarz, sondern dunkelgrau.“
„Viele Männer haben graue Sommeranzüge. Wieso sind Sie so sicher, dass es ein Priester war?“
„Na wegen dem steifen, weißen Stehkragen. Sowas tragen nur katholische Priester.“
„Mehr können Sie nicht sagen? Zum Beispiel woher er gekommen ist, aus welcher Pfarrei?“
„Non!“
Nachdem der Beamte sich von den Mitarbeitern des Heims verabschiedet hatte und auf dem Weg zu seinem Auto auf dem Parkplatz vor dem Heim war, dachte er:
„Wir werden die gendarmerie einschalten müssen. Die sollen in den Pfarreien in der näheren und weiteren Umgebung nach diesem Priester suchen.“
***
Wie an jedem Wochenbeginn fand auch an diesem Montag in Papperins Kommissariat die übliche Lagebesprechung statt. Während die Ermittler in ihren Dienstzimmern die während des Wochenendes aufgelaufenen Berichte lasen, bereitete Monique Dépardieu, Papperins Sekretärin, den großen, ovalen Konferenztisch in seinem Büro für die Besprechung vor. Da sie wusste, mit welch großem Appetit einige der männlichen Kommissariatsmitglieder gesegnet waren, hatte sie eine ausreichende Menge von Croissants eingekauft, die sie in einer silbern glänzenden Schale mitten auf den Tisch stellte.
Um nicht für jeden Mitarbeiter seinen eigenen Wunschkaffee zubereiten zu müssen, hatte sie schon vor langem durchgesetzt, dass alle dieselbe Kaffeeart tranken wie der Chef – nämlich Espresso, schwarz, ohne Milch. Dann verteilte sie die kleinen Espressotassen.
„Jean-Lucs Gedeck“, murmelte sie, während sie eine kleine, dickwandige Tasse mit Untertasse und dem Originalaufdruck Kimbo – espresso napoletano an seinen Platz an der Schmalseite des Tisches platzierte. Auch von den anderen Mitarbeitern hatte jeder seine Lieblingstasse.
Neben dem Chef saß normalerweise Claude Lavalle, capitaine de police und Papperins Stellvertreter. Heute brauchte sie hier kein Gedeck hinzustellen, denn der schwergewichtige, rothaarige Mann musste daheim die obligatorische Quarantäne absitzen. Er hatte sich mit dem Coronavirus angesteckt, das seine Kinder von der Schule nach Hause mitgebracht hatten.
„Wissen Sie, wie es Claude heute geht?“, fragte Papperin von seinem Schreibtisch aus. Er löste den Blick von dem Dokument, das er auf dem Bildschirm seines PC gelesen hatte und schaute seine Sekretärin fragend an.
„Gestern ging es ihm besser“, antwortete sie. „Heute habe ich noch nicht mit ihm telefoniert. Ruf ihn doch schnell an, bevor es hier losgeht!“
„Sie haben Recht! Das mache ich gleich.“ Papperin nahm den Hörer und drückte auf die Kurzwahltaste.
Anders als es in den meisten Unternehmen und Behörden sonst üblich war, duzte Monique Dépardieu ihren Chef, während Papperin sie stets mit dem höflichen vous – Sie – anredete. Der Grund lag in der Vergangenheit. Vor Jahren hatte Papperin als Polizeianfänger und kleiner sous-brigadier unter dem damaligen commissaire Lafontaine, seinem Vorgänger hier im Kommissariat in Aix, gedient. Schon damals war Monique Dépardieu Kommissariatssekretärin gewesen. Eigentlich war sie mehr als das. Sie hatte die gesamte Abteilung gemanagt und sich um alle organisatorischen und wirtschaftlichen Belange gekümmert. Zudem entlastete sie ihren Chef von den überbordenden Bürokratieanforderungen, so dass dieser sich voll auf die Ermittlungsarbeit konzentrieren konnte. Sie war die heimliche Chefin des Kommissariats. Alle Mitarbeiter wurden von ihr geduzt, auch ihr Vorgesetzter. Und das war so geblieben, als Papperin Jahre später nach einer erfolgreichen Karriere als Kriminalbeamter in Paris zum Leiter der Mordkommission, der brigade criminelle bei der police judiciaire, in Aix berufen wurde. Er selbst hatte sich nicht dazu durchringen können, zum Du überzugehen – aus Respekt vor ihrer Leistung und auch vor ihrem Alter. Sie war gute zwanzig Jahre älter als er.
„Jetzt könnt ihr langsam anfangen“, sagte sie. „Ich stell noch schnell die caffettiera auf die Herdplatte. In drei Minuten gibt es frischen Espresso.“
Papperin schaute ihr nach. Eine elegante Erscheinung in ihrem grauen Hosenanzug, der dunkelblauen Seidenbluse und den modisch zu einer Pagenfrisur geschnittenen grauen Haaren. Er und sein Team konnten sich glücklich schätzen, eine so tüchtige, gut informierte und bestens in der Polizeidirektion und in den städtischen Behörden vernetzte Sekretärin zu haben. Er wandte sich wieder dem Text auf dem Bildschirm zu und blätterte weiter in den aktuellen Berichten von den Gendarmerieposten und Polizeikommissariaten der Region PACA – Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Nach und nach trafen die Mitarbeiter seiner Abteilung in seinem Büro ein. Fast gleichzeitig drängten sich die beiden Guys durch die Türe: Brigadier Guy Malmotte und brigadier Guy Debordeau. Ihr Vorname war das Einzige, was sie gemeinsam hatten. Ansonsten hätten sie nicht gegensätzlicher sein können. Guy Malmotte, ein großer, junger Mann mit schmalem Gesicht, modisch geschnittenen, schwarzen Haaren, und einem dichten, buschigen moustache, war der Einzige, der stets mit einem makellos sitzenden Anzug, blütenweißem Hemd und perfekt gebundener Krawatte gekleidet war.
Im krassen Gegensatz dazu stand der zweite Guy. Zur Unterscheidung von Guy Malmotte wurde er der Einfachheit wegen von allen nur Guy-deux genannt. Er trug immer dasselbe: Ausgeleierte Designerjeans, ein meist viel zu großes, knallrotes T-Shirt mit aufgedrucktem schwarzen Che-Guevara-Portrait auf der Brust – Papperin fragte sich immer, wie viele solcher T-Shirts er wohl besaß, da er jeden Tag so eines anhatte – und die unvermeidliche rote Baseballkappe auf den langen, zu einem Pferdeschwanz gebändigten Haaren. Er war der Computer- und Internetexperte des Kommissariats, der einzige in Papperins Team, der alle Schliche und Tricks der Informationstechnologie souverän beherrschte. Eigentlich wunderte sich Papperin, warum er sich mit dem relativ schlecht bezahlten Posten eines brigadier der police nationale zufriedengab, wo er doch in der boomenden IT-Branche ein Vielfaches seines Polizistengehalts verdienen könnte. Vielleicht übernahm er nebenher in seiner Freizeit private Aufträge. Aber davon hatte Papperin offiziell keine Kenntnis. Und solange Guy-deux seine dienstlichen Aufgaben so perfekt und gründlich erledigte, wie das bisher immer der Fall war, hatte Papperin auch nichts gegen eine private Nebentätigkeit einzuwenden – auch wenn dies eigentlich verboten war.
Nur Sekunden später kam brigadier François Legrand ins Zimmer seines Chefs gestürmt. Mit seinen fünfundzwanzig Jahren war er der jüngste und sportlichste von Papperins Mitarbeitern. Der Mann, ein kleines, gedrungenes Kraftpaket mit schwarzem Dreitagebart und glänzendem Kahlkopf hatte zwei Hobbies: Eines war der Radsport. Wann immer es sein Beruf zuließ, schwang er sich auf sein Rennrad und raste durch die Landschaft. Sein zweites Hobby war die Jagd. Als staatlich geprüfter Jäger und ausgewiesener Waffenspezialist war er bestens in der Welt der Hobby- und Berufsjäger vernetzt.
Alle hatten schon Platz genommen und waren von Monique mit Kaffee versorgt, als die Tür des Sekretariats mit lautem Knall aufflog und das letzte Teammitglied hereinkam.
„Désolée – tut mir Leid, dass ich zu spät komme, aber mich hat ein Scheißanruf aufgehalten. Von unserem obersten Boss in Paris.“ Mit missmutigem Gesichtsausdruck ging brigadier Jeannine Dalmasso zu ihrem Platz, ließ sich auf den Stuhl fallen, nahm die vor ihr stehende Espressotasse und trank sie mit einem großen Schluck aus.
„Warum schaust du so zornig?“, fragte Papperin. „Was war das für ein Anruf?“
„Das sag ich dir später“, fauchte sie ihren Chef und Ex-Geliebten an.
Papperin schaute sie eine Weile mit gerunzelter Stirn an, höchst verwundert über ihr harsches und für sie völlig untypisches Benehmen. Dann wandte er sich den anderen zu.
„Ehe wir mit dem Tagesgeschäft anfangen, will ich kurz von etwas berichten, was gerade im Intranet bei mir angekommen ist. Möglicherweise ein Fall, der uns demnächst beschäftigen könnte.“ Papperin nahm einen Schluck von seinem Espresso und fuhr dann fort:
„Im bischöflichen Palais von Fréjus ist ein Priester ermordet worden. Es handelt sich um den Buchhalter der Diözese. Er wurde erstochen. Sein Büro wurde offensichtlich vom Mörder durchsucht, denn er hat ein Chaos hinterlassen – herausgerissene Schubladen, auf dem Boden verstreut liegende Akten. Notebook und Handy des Mordopfers fehlen. Die hat er wohl mitgenommen. Der Fall liegt bei commissaire Mougeot von der PJ Fréjus-Saint Raphaël. Der Kollege wird sicher nicht sehr glücklich darüber sein, weil er in wenigen Wochen in Rente gehen will.“
„Wieso soll das uns etwas angehen?“, fragte Guy-deux.
„Nun, wenn der Fall bis zum Pensionsbeginn des Kollegen Mougeot nicht gelöst ist und die Bosse in Paris nicht zügig einen Nachfolger bestellen, dann ist das Kommissariat dort verwaist. Bei unserer Erfolgsquote ist nicht auszuschließen, dass die in Paris den Fall uns zuschieben. Das ist aber noch völlig ungewiss und liegt in relativ weiter Ferne. Kommen wir jetzt zu unserem Tagesgeschäft!“
Erneut nahm Papperin einen Schluck aus seiner Espressotasse.
„Noch etwas: Claude geht es deutlich besser. Ich habe vorhin kurz mit ihm gesprochen. So wie es aussieht, wird er in einer Woche wieder arbeiten dürfen. Dann soll er Sie bei Ihrem Fall unterstützen. Hat die Zeugenaussage etwas gebracht?“, wandte Papperin sich an brigadier Legrand.
Fast eine Stunde wurde nun über die anstehenden Arbeitsschritte diskutiert. Schließlich, als alle offenen Fragen besprochen, die Aufgaben neu verteilt und alle Croissants aufgegessen waren, schloss Papperin das Meeting.
„Bien! Dann weiß jeder, was er zu tun hat. Seien Sie bitte vorsichtig! Passen Sie auf, dass Sie sich nicht anstecken. Vergessen Sie nicht, die Maske zu tragen – am besten auch im Freien.“
Es folgte ein Stühlerücken und nach und nach verließen seine Mitarbeiter Papperins Dienstzimmer. Nur brigadier Jeannine Dalmasso blieb an ihrem Platz sitzen.
„Jeannine, was ist los mit dir? Was war mit dem Anruf aus Paris? Nun sag schon!“
„Das fragst du?“, fauchte sie zurück. „Du hast gesagt, du stehst zu mir und biegst das mit Limoges hin!“
„Das habe ich doch auch. Ich habe lange mit dem inspecteur général gesprochen. Er hat mir zugesagt, dass er mit dem Staatssekretär reden wird. Er hat mir praktisch versprochen, dass deine Versetzung rückgängig gemacht wird. Hat das nicht …?“
„Nein! Das hat nicht geklappt. Der Anruf eben kam direkt vom Staatssekretär. Er hat gesagt, dass er auf der Versetzung nach Limoges bestehe, aufgrund der Intervention des inspecteur général habe er aber verfügt, dass ich dort zum commissaire de police befördert werde. Jean-Luc, die wollen mich weghaben aus der Provence und glauben, sie können mir das mit einer Beförderung schmackhaft machen. Aber ich will nicht weg. Das weißt du doch. Die Beförderung ist mir sowas von egal. Ich will nicht zu diesen Spießern und Besserwissern im Norden.“
Papperin war klar: Jeannine war tief in der Provence verwurzelt. Seit Generationen lebte ihre Familie im département Bouches du Rhône. Hier war ihre Mutter zuhause, um die sie sich kümmerte. Hier waren ihre Freunde. Sie beherrschte sogar Altprovenzalisch, Lou Provençau, den speziellen Dialekt des Okzitanischen, der früher hier gesprochen, aber immer mehr vom Französischen verdrängt wurde. Da halfen auch die zweisprachigen Ortsschilder nichts. Diese Sprache war zum Aussterben verurteilt.
„Was hat der inspecteur général noch gesagt?“
„Nichts sonst. Nur dass ich zum nächsten Monatsersten dort anfangen soll. Aber das mache ich nicht – Jean-Luc! Dann kündige ich lieber und suche mir einen anderen Job. Hauptsache ich kann hier bleiben. Im Süden.“
Papperin sah, wie sich Jeannines Augen mit Tränen füllten. Er stand auf, ging zu ihr und legte seine Hand auf ihre Schulter. Er war ratlos. Wie konnte es sein, dass der inspecteurgénéral, der ranghöchste Polizeichef der Nation, bei der Stellenbesetzung die Wünsche der betroffenen Abteilung völlig überging? Schließlich war er, Papperin, kein no-name. Wegen der guten Ermittlungserfolge war sein Kommissariat mehrmals vom inspecteur général belobigt worden. Er war immer der Meinung gewesen, sein oberster Chef sei ihm deshalb besonders gewogen. Er hatte immer geglaubt, dadurch sei ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen ihm und dem inspecteur général entstanden. Aber das hatte er sich wohl nur eingebildet.
„Das ist unerhört! Ich verstehe den Chef nicht. Ich rufe ihn sofort an und sag ihm meine Meinung!“ Er ging zu seinem Schreibtisch, zog den Telefonapparat zu sich und drückte auf eine der vielen Kurzwahltasten.
Als sich eine freundliche Frauenstimme mit einem „Bonjour! Secrétariat de l’Inspec…“ meldete, schnitt ihr Papperin das Wort ab und bellte in den Hörer:
„Chantal, verbinden Sie mich mit dem Chef!“ Er fügte ein freundliches „S’il vous plaît“ hinzu, nachdem ihm bewusst wurde, dass die Sekretärin nichts für das Verhalten ihres Chefs konnte.
„Allô Jean-Luc!“ Sie hatte ihn offensichtlich an der Stimme erkannt. „Das ist jetzt kein guter Zeitpunkt. Der Chef ist miserabel gelaunt. Außerdem macht er gerade seine heilige Kaffeepause. Dabei würde ich ihn jetzt lieber nicht stören. Können Sie später nochmal…“
„Nein, Chantal! Auch ich habe eine Wut im Bauch. Das muss ich ihm gleich sagen. Bitte stellen Sie mich durch!“
„Ich kann mir denken, worum es geht“, meinte die Sekretärin. „Bon courage, Jean-Luc!“
Es knackte ein paarmal in der Leitung, dann klang die Stimme des inspecteur général aus dem Hörer.
„Commissaire Papperin, ich kann mir denken, weshalb Sie anrufen. Aber die Angelegenheit ist entschieden und Sie werden sich fügen müssen. Ich habe keine Zeit, ich habe zu tun. Au revoir monsieur le commissaire!“
Selbst über die große Entfernung war deutlich zu fühlen, wie unangenehm dem inspecteur général der Anruf aus Aix war. Das erklärte auch, dachte Papperin, die harsche und abweisende Reaktion seines Vorgesetzten. Er drückte auf die Lautsprechertaste, damit Jeannine mithören konnte.
„Chef, wie konnten Sie das zulassen. Sie hatten mir doch versprochen, dass Sie…“
„Stopp! Papperin! Ich habe mich vehement für Sie und brigadier Jeannine Dalmasso eingesetzt.“ Der Polizeichef machte eine Pause und Papperin konnte hören, wie er tief ein- und wieder ausatmete. „Aber die Moralapostel im Innenministerium haben den Staatssekretär unter Druck gesetzt. Und den hat er an mich weitergeleitet. Es gehe nicht an, sagt er, dass die Effizienz unserer Kriminalpolizei durch so schamlos zur Schau getragene Liebschaften zwischen Vorgesetzten und Untergebenen leide und dass dies in unseren Kommissariaten Schule mache. Das war sein Originalton! Deshalb bleibe ihm keine andere Wahl.“
„Aber das ist doch längst vorbei!“, widersprach Papperin. „Das haben wir geregelt und das habe ich Ihnen auch zugesichert.“
„Ich glaube Ihnen das ja“, klang die Stimme des inspecteur général schon etwas konzilianter. „Der politische Druck ist wohl sehr groß gewesen. Wenn Sie mich fragen, ich bin überzeugt, da steckt etwas ganz anderes dahinter. Sie haben offensichtlich einen Feind, der gegen Sie intrigiert und einen guten Draht zum Innenministerium hat.“
Papperin war sprachlos. Wer aus seinem Team sollte zu solch einer hinterhältigen Aktion fähig sein? Er ließ jeden seiner Mitarbeiter vor seinem geistigen Auge Revue passieren. Monique, Claude, François und die beiden Guys. Keinem von ihnen traute er das zu.
„Das kann ich nicht glauben. Wir sind ein harmonisch und sehr effizient arbeitendes Team und verstehen uns alle blendend. Ohne jede Ausnahme!“
„Mon cher Papperin! Das weiß ich doch. Was ich Ihnen jetzt sage, muss unter uns bleiben. Es sind nicht Ihre Leute, auch nicht Ihre Kollegen in Aix. Das kommt von außen. Ihre Ermittlungserfolge wecken Neidgefühle bei einem Ihrer Kollegen.“
„Milleré in Toulon! Dem traue ich das zu. Der hatte sich damals schon quergelegt, als Sie mich nach Aix berufen haben.“
„Nun, ich hätte am Telefon lieber keinen Namen genannt. Aber Sie haben Recht. Er spekuliert immer noch auf Ihren Posten in Aix und intrigiert, wo er nur kann. Aber solange ich hier am Quai des Orfèvres das Sagen habe, werde ich das verhindern.“
Eine Weile schwieg der inspecteur général. Am leisen Klappern des Geschirrs konnte Papperin hören, dass sich sein Gegenüber einen Schluck aus der Kaffeetasse gegönnt hatte, ehe er fortfuhr:
„Mit Ihrer Jeannine Dalmasso ist das anders. Hier hat sich der Staatssekretär beim Minister durchgesetzt. Aber weil ich weiß, dass madame Dalmasso aus familiären Gründen nicht aus der Provence weg will, habe ich mit dem Innenminister abgesprochen, dass sie im Süden bleiben kann, allerdings nicht in Aix.“
Wieder trat eine kurze Gesprächspause ein.
„Vor kurzen ist die Stelle des Dezernatsleiters für Betrugs- und Wirtschaftskriminalität in Toulon freigeworden. Commissaire Varennes hat sich in den vorzeitigen Ruhestand versetzen lassen – aus Gesundheitsgründen. Der Innenminister ist damit einverstanden, dass madame Dalmasso diesen Posten bekommt. Das habe ich über den Kopf des Staatsekretärs hinweg mit ihm vereinbart. Es hat doch seine Vorteile, wenn man im selben Golfclub ist. Sie fängt am 1. September dort an. Aber“, die Stimme des inspecteur général nahm wieder einen strengen, obrigkeitlichen Ton an: „Ich gehe davon aus, dass von Ihnen jetzt kein Sperrfeuer mehr kommt. So! Überzeugen Sie Ihre Jeannine von dieser Lösung! Sie erhält aber nur das Eingangsgehalt eines commissaire de police. Beförderungen in höhere Gehaltsstufen muss sie sich erst verdienen. In Kürze wird ihr ein entsprechendes Dekret zugehen. Es ist das Beste, was ich für madame Dalmasso und auch für Sie, mon cher Papperin, erreichen konnte. Jetzt muss ich wieder arbeiten. Au revoir! Und wenn Sie nach Paris kommen, sollten wir wieder einmal zusammen essen gehen. Ich habe ein wunderbares neues Restaurant entdeckt.“
Noch ehe Papperin sich bedanken konnte, war die Leitung unterbrochen. Er legte den Hörer auf und blickte fragend zu Jeannine.
„Meinst du, du kannst damit leben? Toulon statt Aix?“
Sie saß nach wie vor starr am Besprechungstisch und schaute ihn mit großen Augen an, die sich langsam erneut mit Tränen zu füllen begannen. Dann nickte sie und murmelte:
„Entschuldige, dass ich dich vorhin so angefaucht habe. Ich wusste nicht, dass du … dass du …“
Plötzlich sprang sie auf, umarmte ihn und flüsterte:
„Merci Jean-Luc! Du bist der tollste Mann, den ich kenne. Du hast mir das Leben gerettet.“
„Na so toll ist das auch wieder nicht. Du bist dann bei der PJ in Toulon. Zwar im Rang eines commissaire, aber am selben Standort wie commissaire Milleré – mein Erzfeind, wie es scheint. Der wird dir das Leben schwer machen.“
„Oder ich ihm!“, entgegnete sie voller Kampfeslust.
Montag, 8. August, nachts
„Anouk, mir ist so kalt“, flüsterte Philippe Trouchon und wandte den Kopf seiner Frau zu. Sie saß am Bett ihres Mannes und hielt seine eiskalte Hand. Obwohl er so fror, hatte er fast neununddreißig Grad Fieber, wie sie gerade erst gemessen hatte. Sie breitete eine weitere Decke über ihn und strich sorgenvoll über seine heiße Stirn. Dann drückte sie aus dem Blister eine Aspirintablette und schob sie ihm in den Mund.
„Hier, trink das. Möglichst viel!“ Sie reichte ihm ein Glas Leitungswasser. Sich mühsam aufrichtend, leerte er es Schluck für Schluck. Dann ließ er sich wieder zurück in die Kissen fallen.
„Ich krieg so schwer Luft!“, keuchte er.
Anouk Trouchon machte sich Sorgen. Philippe war so gut wie nie krank. Er hatte eine eiserne Konstitution, so sportlich wie er war. Als leidenschaftlicher Hobbymarathonläufer absolvierte er viel Ausdauertraining. Trotzdem, irgendetwas hatte er sich eingefangen. Womöglich hatte er sich in der Arbeit angesteckt, überlegte sie. Vielleicht mit dem Coronavirus? Doch das hielt sie eher für unwahrscheinlich, denn er war negativ getestet worden. Und das lag erst zwei Tage zurück. Wahrscheinlich war es doch nur ein grippaler Infekt, dachte sie.
„Mit dem Aspirin wird das Fieber zurückgehen“, meinte sie. „Morgen früh geht es dir sicher wieder besser.“
***
Sie wusste nicht, was sie aufgeweckt hatte. Reglos lag sie im Bett und lauschte in die Dunkelheit hinein. Was war das für ein merkwürdiges Geräusch? Sie richtete sich auf und schaute zu ihrem neben ihr liegenden Mann. Das Geräusch kam von ihm, ein leises, gequält pfeifendes, ziehendes Atemgeräusch. Sie knipste die Nachttischleuchte an und beugte sich zu ihm hinüber. Große, weit aufgerissene Augen starrten sie angsterfüllt an.
„Philippe, was ist los? Warum schnaufst du so komisch?“
Sie sah, wie er sich bemühte, etwas zu sagen. Aber er brachte keinen Laut zustande. Angstvoll schüttelte sie ihn. „So sag doch etwas! Was ist mit dir?“
Nichts – nur der starre Blick aus den weitaufgerissenen Augen.
Voll Panik griff sie nach dem Handy auf ihrem Nachtkästchen, stieß es in der Hektik auf den Boden. Es rutschte unter die Schlafcouch. Sie sprang aus dem Bett, kniete sich davor und grapschte mit beiden Händen danach. Endlich bekam sie es zu fassen, wählte mit zitternden Fingern die 112.
„Allô! Einen Notarzt! Wir brauchen einen Notarzt! Schnell! Mein Mann! Er kriegt keine Luft!“
Es dauerte eine Weile, bis der Mann in der Notrufzentrale aus ihrem aufgeregten Gestammel die Adresse heraushören konnte. Nur Augenblicke später sagte er:
„Der Notarzt ist unterwegs! Er wird in wenigen Minuten bei Ihnen sein.“
***
„Exitus! Zu spät! Wir sind zu spät gerufen worden. Ich kann ihm nicht mehr helfen!“, murmelte der Notarzt in Richtung des ihn begleitenden Sanitäters. Er richtete sich auf und schaute die auf der anderen Seite des Bettes stehende Frau mitleidsvoll an.
„Es tut mir unendlich Leid. Bitte schildern Sie mir, was genau passiert ist.“
Anouk Trouchon sprach mit stockender, leiser Stimme.
„Seit gestern – nein, eigentlich schon seit vorgestern Abend – hat er sich nicht wohl gefühlt. Er bekam Fieber und atmete schwer. Abends habe ich ihm ein Aspirin 500 gegeben, damit das Fieber runtergeht. Später in der Nacht bin ich aufgewacht, weil er so gequält geschnauft hat. Dann habe ich die 112 gerufen.“
Der Notarzt entnahm seinem Koffer einen Formularblock und ein rotes Plastiktäschchen.
„Covid-19“, murmelte er. „Eindeutig Corona!“ Bei sich dachte er: Aber der war doch noch nicht alt! Erstaunlich, dass es hier einen jungen Mann erwischt hatte.
„Wie alt ist Ihr Mann?“, fragte er die weinende Frau.
„Zweiunddreißig!“
Atypisch, dachte der Arzt. Trotzdem: Diese Symptome deuten eindeutig auf Corona hin.
Während des Ausfüllens des Totenscheinformulars fragte er die Witwe nach den einzutragenden Daten des Verstorbenen: Name, Vorname, Geburtsdatum usw. usw. Als Todesursache trug er Corona ein und setzte ein Fragezeichen dahinter. Er öffnete das Plastiktäschchen und entnahm ihm ein Testkit.
„Laut Verordnung muss bei allen unklaren Todesursachen ein Abstrich für einen PCR-Test gemacht werden“, erklärte er und führte das Teststäbchen in den Rachen des Verstorbenen ein.
Nachdem alle Formalitäten geklärt waren und ein Bestattungsinstitut mit der Abholung des Toten beauftragt war, fragte der Arzt die Frau:
„Madame Trouchon, gibt es jemanden, der heute Nacht zu Ihnen kommen kann, oder zu dem Sie gehen können? Sie sollten nicht allein bleiben.“
„Ja, meine maman!“
Dienstag, 9. August
Es ging schon auf 21 Uhr zu, als commissaire Jean-Luc Papperin an diesem Abend nachhause kam. Er hatte einen anstrengenden, teilweise frustrierenden Arbeitstag hinter sich. Die überbordende Bürokratie, die auch vor den Ermittlern der Kriminalpolizei nicht Halt machte, hatte ihn den ganzen Tag in Beschlag genommen. Während der Heimfahrt durch die in der Abendsonne golden leuchtende Provence hatte er sich etwas entspannen können, als er mit seinem neuen Peugeot gemächlich durch die hügelige Landschaft gefahren war. Weinberge mit prall glänzenden Trauben, die unter dem grünen Blattwerk der Rebstöcke hervorleuchteten, waren an ihm vorübergezogen. Er war an gepflegten Olivenhainen vorbeigekommen, hatte eine Weile warten müssen, als eine Schafherde die kleine route départementale überquert hatte, bis er nach einer guten halben Stunde Fahrt endlich Cabanosque erblickt hatte, das mittelalterliche Dorf, das sich malerisch um die auf einer kleinen Anhöhe thronende Dorfkirche schmiegte.
Er schob die schweren Eichenflügel des Hoftores auf, stieg wieder in sein Auto und rollte langsam in den Hof. Odile eilte ihm aus der Küche entgegen. Offensichtlich hatte sie seiner Ankunft schon mit Ungeduld entgegen gesehen.
„Na endlich! Ich warte schon eine halbe Ewigkeit auf dich“, begrüßte sie ihn, um sofort weiter zu reden, ohne auf eine Antwort zu warten. „Heute gibt es etwas Besonderes zum Abendessen: Aïgo saou, Fischsuppe nach einem alten provenzalischen Rezept. Das stand heute im Var Matin und ich hatte Lust, das gleich nachzukochen. Komm schnell rein, bevor der Fisch völlig verkocht und zerfallen ist. Komm rein, schnell! Der Tisch ist schon gedeckt. Rot oder Rosé? Was wollen wir dazu trinken?“
„Natürlich Rosé! Wenn er eisgekühlt ist. Sonst einen Roten.“
Das dîner unter der großen Platane im Innenhof der alten Ölmühle war ein Genuss. Das Rezept kannte Papperin noch nicht. Im Wesentlichen bestand es aus einem klaren Fischsud, in dem verschiedene, in handliche Stücke geschnittene Fischfilets, Mies- und Jakobsmuscheln und Garnelen neben gewürfelten und gekochten Kartoffeln und Tomatenhälften schwammen. Bestreut mit gehacktem Fenchelkraut wurde das Ganze wie bei der klassischen soupe de poisson oder der bouillabaisse mit getoasteten Baguettescheiben serviert, die mit Knoblauch eingerieben und dick mit rouille, der provenzalischen Knoblauch- und Safranmayonnaise, bedeckt waren. Nachdem alles aufgegessen und die Flasche Rosé geleert war, lehnte sich Papperin wohlig zurück. Er schaute in das dichte Blätterwerk der Platane.
„Maman, das war sehr gut!“, lobte er die Kochkunst von Odile.
„Aber wenn ich ehrlich bin, unsere marmite de poisson, so wie wir sie immer machen, finde ich noch besser. Unsere sämige Soße aus durchpassierten kleinen Fischen und Gemüse schmeckt irgendwie gehaltvoller als die klare Fischbrühe. Trotzdem, es war super! Willst du auch einen Calvados als digestif?“
Odile nickte und er erhob sich, um die Flasche und die Gläser aus dem Haus zu holen, als sich das Handy in seiner Hosentasche meldete. Ein Blick auf das Display zeigte docteur Florian Belinotte als Anrufer, den Laborleiter und Chefchemiker eines landesweit bekannten Biochemie-Instituts in Aix.
„Salut Florian? Was führt dich zu so später Stunde zu mir?“
„Salut Jean-Luc!“ Störe ich dich gerade beim dîner?“
„Nein, das liegt soeben hinter uns. Odile hat heute ein uraltes, provenzalisches Rezept gekocht. Das hätte dir und deiner Émilie auch geschmeckt. Aïgo saou.“
„Das kenn ich. Es kommt aber nicht an deine marmite de pêcheur hin. Übrigens: Wann lädst du uns mal wieder zu einem deiner sagenhaften Menüs ein, du Superhobbykoch. Du stehst im Wort. Deine letzte Einladung ist noch offen!“
„Ich weiß und habe auch schon ein ganz schlechtes Gewissen. Aber das können wir bald machen. Wie wäre es nächsten Samstagabend? Jetzt im August ist nicht viel los im Büro. Da hätte ich Zeit. Die Kriminellen sind, so scheint es, auch im Sommerurlaub.“
„Ich fürchte, da täuschst du dich. Deswegen rufe ich an, um dich vorzuwarnen. Ich habe gerade den Bericht zu einer chemischen Giftanalyse fertiggestellt. Der Fall dürfte wohl auf deinem Schreibtisch landen.“
„Ein Giftmord?“
„So sieht es aus. Mit einem Acetylcholinrezeptorblocker als Tatwaffe. Zuerst hat der Notarzt Corona als Todesursache angegeben. Als aber der von einem Testlabor postmortal durchgeführte PCR-Test negativ ausgefallen ist, wurden sie stutzig und haben die Leiche obduziert. Und weil da nichts gefunden wurde, haben sie mir Proben vom Gewebe und vom Mageninhalt geschickt. Wie du dir denken kannst, war es für mich ein Kinderspiel, die Todesursache zu identifizieren. Schließlich bin ich mit meinem Institut landesweit …“
Papperin unterbrach seinen Freund. Es nervte ihn, wenn dieser mit seinen Fähigkeiten und dem Renommee seines Labors so angab. Zugegeben, er war ein bekannter und hervorragender Wissenschaftler, aber auch sehr von sich und seinen Leistungen eingenommen. Und er hob dies auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit eitel hervor. Trotzdem, Florian war privat ein umgänglicher Mensch und ein lieber Freund.
„Ich weiß! Du bist der größte Biochemiker weltweit und hättest längst schon den Nobelpreis verdient“, neckte ihn Papperin. „Aber wieso hat der Arzt Covid-19 als Todesursache angenommen?“
„Weil die Symptome ähnlich sind: Atemnot, Lungenlähmung, Tod durch Ersticken. Aber das kannst du vergessen. Todesursache war dieses Gift. Auch die Dosis war absolut letal.“
„Tja!“, seufzte Papperin. „Ich fürchte Émilie und du, ihr müsst dann doch noch eine Weile auf die Einladung zum Galadîner hier bei uns warten. Solange, bis der Giftmord aufgeklärt ist.“
„Schade!“, bedauerte docteur Berlinotte. „Dass gerade dieser Notarzt sich so penibel an die Vorschriften halten musste und einen PCR-Test angeordnet hat. Pech für uns beide: Du hast die Arbeit und Émilie und ich, wir haben das Nachsehen. Ich kenne genügend Fälle, wo die Ärzte bei halbwegs eindeutigen Symptomen auf den Test bei Verstorbenen verzichtet haben. Es wird viel zu viel geschlampt in unserem Gesundheitssystem. Aber jetzt ist es nun mal wie es ist! Salut Jean-Luc! Grüß deine Mutter ganz herzlich und bonne nuit!“
Mittwoch, 10. August
„Wir haben einen neuen Fall“, begrüßte Monique ihren Chef, als Papperin am frühen Morgen in sein Kommissariat kam. „Einen Giftmord!“
„Ich weiß!“, nickte er ihr zu.
„Die Unterlagen liegen auf deinem Schreibtisch.“
„Dann muss ich mir die wohl anschauen“, meinte Papperin. „Haben Sie einen Kaffee für mich?“
„Frisch zubereitet. Schwarz und extra stark. Ohne Zucker und mit Croissant? Oder ohne Croissant und mit Zucker?“, fragte sie, die als perfekte Sekretärin die Kaffeevorlieben ihres Chefs genau kannte.
„Ohne Croissant“, sagte er. „Die Krümel machen sonst nur Fettflecken auf den Akten.“
Er setzte sich an seinen Schreibtisch und nahm sich die Dokumente vor. Als erstes las er den Bericht seines Chemikerfreundes docteur Berlinotte, dann den des Pathologen docteur Avenel vom gerichtsmedizinischen Institut der Universitätsklinik, der die Obduktion von Philippe Trouchon durchgeführt hatte. Schließlich warf er noch einen Blick auf den Befund des Coronatestlabors und auf den Totenschein.
„Ich frage mich“, sagte er zu Monique, als sie ihm den Kaffee hinstellte, „ob das wirklich ein Mord war. Könnte es nicht auch Selbsttötung gewesen sein?“
Er überlegte, wie er das herausbekommen könnte. Sollte er die Witwe fragen? Er nahm den Hörer und wählte.
„Wieso bist du in deinem Bericht so sicher, dass es sich um Mord handelt?“, fragte er seinen Freund docteur Berlinotte, nachdem dieser endlich ans Telefon gegangen war.
„Suizid scheinst du auszuschließen. Warum eigentlich?“
„An das hier verwendete Gift kommt man nicht so ohne weiteres dran. Da musst du schon Chemiker oder zumindest Apotheker sein. Und jemand, der vom Fach ist, würde für einen Suizid niemals zu diesem Gift greifen.“
„Wieso?“
„Kannst du dir vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man langsam erstickt? Bei einem Selbstmord würde man ein Mittel nehmen, das einen nicht so qualvoll verenden lässt. Nein: Für mich liegt ganz klar Fremdverschulden vor. Also Mord!“
„Merci Florian! Damit ist meine Frage beantwortet.“
***
In der anschließenden Lagebesprechung herrschte Einigkeit, dass man als Erstes das private Umfeld von Philippe Trouchon unter die Lupe nehmen musste.
„Hier steht, er ist … äh … er war verheiratet. Damit fällt der erste Verdacht auf seine Frau. Sie heißt…“ Papperin blätterte in den Papieren vor sich auf dem Besprechungstisch.
„Anouk Trouchon.“
Ihm war bewusst, dass Tötungsdelikte in der überwiegenden Zahl der Fälle von Verwandten oder von nahestehenden Bekannten ausgeführt wurden.
„Ich möchte so schnell wie möglich mit der Ehefrau sprechen. Monique, kündigen Sie bitte mein Kommen an. Sie wohnt in…“ Papperin blätterte in den vor ihm liegenden Papieren, „…in Trets. Das ist nicht weit von Aix. Eine knappe halbe Stunde mit dem Auto. Kann mich jemand begleiten?“, fragte er in die Runde.
„Jeannine du? Fein!“ Er wandte sich wieder zu seiner Sekretärin: „Rufen Sie bei madame Trouchon an und vereinbaren Sie einen Termin. Sobald wie möglich. Sagen wir: um elf Uhr.“
***
Die Ehefrau des Ermordeten wohnte in einem Mehrfamilienhaus am westlichen Ortsrand von Trets. In der ruhigen Vorortstraße hatte Papperin kein Problem, einen Parkplatz fast direkt vor dem Haus zu finden. Er stieg aus und schaute an der Fassade des Hauses empor. Dann ließ er seinen Blick die Straße hinauf und hinab gleiten. Es war ein ruhiges Wohnviertel. Es gab keinen Gehsteig. Die Häuser grenzten teils direkt an die Fahrbahn, teils lagen kleine Vorgärten zwischen den Gebäuden und der Straße. Hier und da brachte ein Baum mit seinem grünen Laubwerk Abwechslung in das ansonsten eintönige Straßenbild. Es war kein prekäres Wohnviertel, aber auch keine luxuriöse Villengegend. Angestellten- und gehobenes Arbeitermilieu, schätzte Papperin. Auch das dreigeschossige Haus, in dem das Ehepaar Trouchon wohnte, passte zu diesem Gesamtbild. Die Fassade war in dem für die Region typischen hellen Beige verputzt. Die Fensterläden waren ordentlich in einheitlichem Braun lackiert.
Papperin und Jeannine stiegen die wenigen Stufen hinauf, die zur Haustüre führten. Auf der verwitterten Messingplatte mit den Klingelknöpfen suchten sie den Namen Trouchon. Manche der Schilder waren mit Papierstreifen überklebt, auf die die Bewohner ihren Namen mit Kugelschreiber oder Filzstift geschrieben hatten. Jeannine läutete bei Trouchon. Als der Summer erklang, drückte sie die Tür auf und die beiden Kriminalbeamten traten ein. Briefkästen an der rechten und Stromzähler an der linken Wand, jeweils neun an der Zahl, säumten den kahlen Hausflur. Zwei Fahrräder und ein Kinderwagen verengten den Gang.
„Allô? Kommen Sie in den ersten Stock. Ich wohne in der ersten Etage“, rief ihnen von oben eine Frauenstimme entgegen.
Die Frau, die sie unter der linken der drei vom Treppenabsatz abgehenden Wohnungstüren erwartete, war schlank. Man hätte sie hübsch nennen können, wenn nicht ihr verweintes und etwas verquollenes Gesicht, die ungekämmten Haare und die schlampige Kleidung diesen Eindruck getrübt hätten.
„Bonjour madame! Commissaire Papperin. Meine Kollegin brigadier Dalmasso“, stellte Papperin Jeannine und sich vor.
Frau Trouchon führte sie in ein relativ großes Zimmer, dessen linke, schmälere Wand von einer Küchenzeile aus eichenholzfarbigen Ober- und Unterschränken mit den üblichen Einbaugeräten eingenommen wurde. In der Mitte des Raumes befand sich ein quadratischer Esstisch mit vier Stühlen. Die rechte Hälfte diente als Wohnzimmer mit einer Couch aus Lederimitat, einem mit demselben Material bezogenen Fernsehsessel, einem runden Couchtisch und einem großen, flachen TV-Gerät.
Mit einer fragenden Handbewegung deutete Frau Trouchon auf Esstisch und Couch.
„Wo sitzen Sie lieber?“
Papperin nahm am Esstisch Platz und begann sofort, nachdem sich auch die beiden Frauen gesetzt hatten, mit der Vernehmung.
„Zuerst darf ich Ihnen unser herzliches Beileid zum Tod Ihres Mannes aussprechen. Wie Sie wissen, ist er keiner Krankheit zum Opfer gefallen, sondern einem Mordanschlag.“
„Ich weiß, er wurde vergiftet. Man hat mir das am Telefon gesagt.“ Ihre Augen füllten sich mit Tränen, die sie mit einem Papiertaschentuch abwischte.
„Wer hat ihm das angetan? Philippe ist … war … so ein gutmütiger Mann, der keinem etwas zuleide getan hat. Ich bin ratlos.“ Wieder wischte sie die erneut hervorquellenden Tränen mit dem Kleenex weg.
Papperin schaute die Frau an. Sie sah sympathisch aus, sehr ehrlich. Ihre tiefe Erschütterung schien echt zu sein. Andererseits stand sie als Ehefrau unter Hauptverdacht, wie die Kriminalstatistik immer wieder zeigte. Er entschied sich, nicht lange drum herum zu reden, sondern das Problem direkt anzusprechen.
„Wie war Ihr Verhältnis zu Ihrem Mann?“
Als er ihren befremdeten, ja schockierten Gesichtsausdruck sah, erklärte er:
„Als Ehefrau des Ermordeten stehen Sie für uns naturgemäß an erster Stelle als Tatverdächtige. Das lehrt uns unsere langjährige Erfahrung. Also: Wie war Ihr Verhältnis zu Ihrem Mann?“, wiederholte er seine Frage.
„Ich … ich … wir … wir haben eine sehr gute, harmonische Ehe geführt“, stammelte Frau Trouchon.
„Das würde ich auch sagen, wenn ich meinen Ehepartner umgebracht hätte. Können Sie das beweisen?“, setzte Papperin nach.
Die Witwe schaute den Kommissar fassungslos an.
„Sie glauben, dass ich Philippe …? Sie halten mich für seine Mörderin?“
Auf einmal richtete sie sich auf und fixierte Papperin mit zornigem Blick: „Das darf nicht wahr sein! Statt Ihre Arbeit zu tun, für die Sie bezahlt werden, nämlich den Mörder zu fassen, wählen Sie den einfachsten Weg und hängen mir das an. Selbstverständlich kann ich meine Unschuld nicht beweisen. Ich habe kein Alibi, denn ich war bei ihm, als er starb!“ Ihre Stimme erstickte in Tränen.
„Bitte verstehen Sie uns. Wir sind verpflichtet, alle Möglichkeiten …“
„Nein, das verstehe ich nicht! Sie wollen nur einen schnellen Erfolg, weil das gut ist für Ihre Karriere, dann werden Sie schneller befördert. Gehen Sie! Verlassen Sie meine Wohnung! Ich muss Ihnen hier gar nichts sagen. Wenn Sie mich für die Mörderin von Philippe halten, dann kommen Sie mit einem richterlichen Haftbefehl wieder. Aber jetzt: Raus hier!“
Jeannine legte ihre Hand besänftigend auf die Hand der erzürnten Witwe.
„Madame Trouchon, mein Chef meint das nicht so!“, und zu Papperin gewandt: „Monsieur le commissaire, am besten gehen Sie jetzt und lassen mich mit der armen Frau allein.“
Bei sich dachte sie: Was war nur mit ihm los? Das war doch völlig untypisch für ihn. In letzter Zeit machte er viel solchen Unsinn. Die geplatzte Hochzeit hatte ihn wirklich aus der Bahn geworfen.
Papperin schaute Jeannine an. Wie Recht sie hat, dachte er. Was ist nur in mich gefahren?
Beschämt stand er auf und verließ mit einem gemurmelten „Excusez moi, madame!“ die Wohnung.
***
Während Papperin verärgert und beschämt über sich und sein unsensibles Vorgehen auf der Straße hin und her wanderte, versuchte Jeannine die aufgewühlten Wogen wieder zu glätten.
„Nehmen Sie es meinem Chef nicht übel. Er hat in der letzten Zeit viel durchgemacht und reagiert manchmal so komisch. Es klingt brutal, was er gesagt hat. Aber ich weiß, er meint es nicht so.“
„Aber ich bin doch keine Mörderin!“
„Das glaube ich auch nicht. Aber Sie müssen wissen: Es ist eine Tatsache, dass die meisten Morde von Familienmitgliedern verübt werden. Allerdings sind es fast immer die Männer, die ihre Frauen umbringen. Also: Vergessen Sie, was mein Chef gesagt hat! Erzählen Sie mir lieber, mit wem Ihr Mann in der letzten Zeit Kontakt hatte, mit wem er sich getroffen hat, wo er arbeitet. Hatte er vielleicht in der Arbeit Feinde?“
Madame Trouchon schüttelte den Kopf.
„Nein, das glaube ich nicht. Er hat seine Chefin und seine Kolleginnen und Kollegen sehr nett gefunden. Und privat haben wir kaum Kontakte mit anderen gehabt. Eigentlich gar keine. Wegen des Corona-Ausgangsverbots, das lange Zeit gegolten hat. Gott sei Dank hat unser Präsident das jetzt aufgehoben!“
Wie lange das wohl so bleiben würde, fragte sich Jeannine. Wenn die Infektionen wieder anstiegen, dann dürfte sofort wieder ein neues Kontakt- und Ausgangsverbot kommen.
„Aber zur Arbeit musste Philippe. Da galt kein Verbot.“
„Was für einen Beruf hatte Ihr Mann?“
„Er ist Pfleger in einem Alten- und Pflegeheim.“
Erneut kamen Tränen in ihre Augen, als ihr bewusst wurde, dass ihr Mann nie mehr zur Arbeit fahren würde. Jeannine legte ihren Arm tröstend um die Schultern der jetzt bitterlich weinenden Frau. Schweigend saßen die beiden eine Weile nebeneinander.
„Sainte Véronique – Résidence de Retraite Médicalisée in Saint Maximin“, sagte madame Trouchon in die Stille. „So heißt das Alten- und Pflegeheim, in dem er gearbeitet hat. Die Arbeit hat ihm sehr gut gefallen. Wenn er dort einen Feind gehabt hätte, davon hätte er mir mit Sicherheit erzählt. Nein, dass ihn von denen jemand umbringen wollte, das glaube ich nicht.“
Trotzdem notierte sich Jeannine den Namen des Heims und nahm sich vor, es so bald wie möglich aufzusuchen.
„Sagen Sie Ihrem Chef, er soll sich bei meiner Mutter über mich erkundigen. Und bei unseren Freunden. Vielleicht glaubt er mir dann, dass ich Philippe geliebt habe und ihm nie …. niemals etwas angetan hätte. Sagen Sie ihm das. Ich schreibe Ihnen die Namen und Adressen auf.“
Jeannine kramte aus ihrer geräumigen Handtasche einen Zettel und einen Stift hervor und legte beides auf den Tisch. Nachdem sie das voll beschriebene Blatt Papier wieder eingesteckt hatte, erhob sie sich, gab der Witwe die Hand und streichelte ihr tröstend mit der anderen Hand über die Schulter.
„Ich muss jetzt gehen. Wenn Ihnen noch etwas einfällt oder wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie mich an.“
Sie gab ihr eine ihrer dienstlichen Visitenkarten.
„Ich schreibe Ihnen noch meine private Handynummer drauf. Sie können mich zu jeder Zeit anrufen.“ Dann reichte sie die Karte der immer noch sitzenden Frau und verließ mit einem „Au revoir, madame Trouchon!“ die Wohnung.
***
Als Jeannine aus dem Haus kam, schlug ihr die Sommerhitze mit voller Wucht entgegen. Mit den Augen suchte sie die Straße ab, doch sie konnte Papperin nicht entdecken. Schließlich sah sie sein Auto. Es stand nicht mehr vor dem Haus. Er hatte es etwas weiter abseits im Schatten eines Baumes geparkt. Die Mittagssonne brannte unbarmherzig auf sie hernieder, als sie die gut hundert Meter dorthin ging. Sie hörte, dass der Motor lief. Papperin saß weit zurückgelehnt auf dem Beifahrersitz. Er hatte die Augen geschlossen. Sie klopfte ans Fenster.
„Dann soll wohl ich fahren?“ Ein kalter Lufthauch blies ihr ins Gesicht, als die Scheibe heruntergefahren war. Die Klimaanlage in seinem neuen Auto arbeitete auf Hochtouren. Als sie sich hinter das Lenkrad gesetzt hatte, schaute er sie zerknirscht an.
„Désolé! Tut mir leid, das habe ich verbockt.“
„Sag mal, was ist los mit dir in letzter Zeit? Langsam solltest du doch darüber hinweggekommen sein, dass dich deine …“ Sie zögerte. Wie sollte sie die Frau nennen, die aus der Ferne angerufen, die Beziehung unerwartet beendet, seine Zukunftsträume schlagartig zerstört, und die geplante Hochzeit abgesagt hatte? Geliebte? Oder Freundin? „…dass sie dich im Stich gelassen hat. Aber das ist jetzt schon ein halbes Jahr her. Das Leben geht weiter, Jean-Luc!“
„Ich weiß!“, seufzte er. „Es hätte alles so schön werden können. Plötzlich war das alles aus! Wenn ich wenigsten wüsste, warum?“ Er schaute sie niedergeschlagen an.
„Und jetzt gehst auch du noch weg!“
Plötzlich setzte er sich entschlossen auf.
„Du hast Recht! Ich darf mich nicht so gehen lassen. Was hast du rausbekommen beim Gespräch mit der Witwe nach meinem unrühmlichen Abgang?“
Jeannine berichtete vom Pflegeheim, in dem der Ermordete gearbeitet hatte, und von der Liste mit den Namen der Freunde und der Mutter von madame Trouchon.
„Bien! Dann machen wir folgendes“, schlug Papperin wieder voller Tatkraft vor.