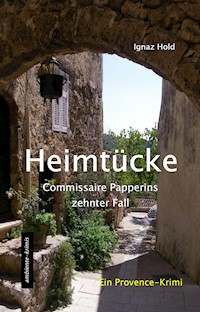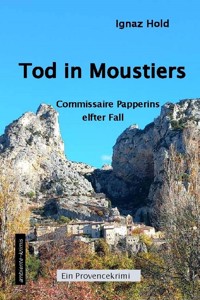
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ambiente-krimis
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Es könnte alles so schön sein, in dem malerischen Städtchen Moustiers-Sainte-Marie. Doch der für seine Fayencen berühmte Ort wird von dem erbitterten Konkurrenzkampf zweier Fayencemanufakturen erschüttert. Als die Leiche des Geschäftsführers eines der beiden Ateliers gefunden wird, eskaliert der Streit. Die Inhaber der beiden verfeindeten Unternehmen sind überzeugt: es war Mord. Sie beschuldigen sich gegenseitig, diese heimtückische Tat begangen zu haben. Die gendarmerie nationale geht von einem Suizid aus und möchte den Fall schnellstmöglich ad acta legen. Commissaire Papperin, den eine Freundin gebeten hat, sich dieses Falles anzunehmen, glaubt nicht an einen Selbstmord. Er muss an zwei Fronten kämpfen – einmal gegen den Leiter des örtlichen Gendarmeriekommandos, der sich dagegen wehrt, dass die verhasste police nationale sich in seine Zuständigkeit drängt und zum anderen gegen den skrupellosen Mörder, der ihm immer einen Schritt voraus zu sein scheint.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
IGNAZ HOLD
TOD IN MOUSTIERS
Commissaire Papperins elfter Fall
Buch
Es könnte alles so schön sein in dem malerischen Städtchen Moustiers-Sainte-Marie. Doch der für seine Fayencen berühmte Ort wird vom erbitterten Konkurrenzkampf zweier Fayencemanufakturen erschüttert. Als die Leiche des Geschäftsführers eines der beiden Ateliers gefunden wird, eskaliert der Streit. Die Inhaber der beiden verfeindeten Unternehmen sind überzeugt: Es war Mord. Sie beschuldigen sich gegenseitig, diese heimtückische Tat begangen zu haben. Die gendarmerie nationale geht von einem Suizid aus und möchte den Fall schnellstmöglich ad acta legen.
Commissaire Papperin, den seine Freundin gebeten hat, sich dieses Falles anzunehmen, glaubt nicht an einen Selbstmord. Er muss an zwei Fronten kämpfen: Einmal gegen den Leiter des örtlichen Gendarmeriekommandos, der sich dagegen wehrt, dass die verhasste police nationale sich in seine Zuständigkeit drängt, und zum anderen gegen den skrupellosen Mörder, der ihm immer einen Schritt voraus zu sein scheint.
Autor
Ignaz Hold ist ein Pseudonym. Der Autor, ein reiselustiger Wissenschaftler, hat seit über einem Vierteljahrhundert in der Provence eine zweite Heimat gefunden und kennt diesen Fleck Europas wie seine Westentasche. Er erholt sich, wann immer sein Beruf es ihm erlaubt, vom Stress des Alltags in seinem Haus in der Haute Provence. Dorthin, in die ländliche Idylle eines provenzalischen Dorfes, zieht er sich zurück, um zu schreiben. Neben nüchternen Fachbüchern entstehen dort seine Provencekrimis, in denen er den ganzen provenzalischen Mikrokosmos mit all seinen Problemen, Charakteren, landschaftlichen und kulinarischen Reizen einfängt und in spannende Krimis einfließen lässt.
Ignaz Hold
TOD IN MOUSTIERS
Commissaire Papperins elfter Fall
ambiente-krimis
Personen und Handlungen in diesem Roman sind frei erfunden und orientieren sich nicht an lebenden oder toten Vorbildern oder an tatsächlichen Geschehnissen. Etwaige Ähnlichkeiten sind nicht beabsichtigt und wären rein zufällig.
ambiente-krimis,
Michael Heinhold
Am Feilnbacher Bahnhof 10
83043 Bad Aibling
Erste Auflage 2023
Copyright © 2023 by Ignaz Hold
Alle Rechte vorbehalten
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
Umschlagfoto: Michael Heinhold
ISBN der E-Book-Ausgabe: 978-3-945503-35-5
ISBN der Paperback-Ausgabe: 978-3-945503-34-8
„À Moustiers, tout est singulier …“
Marcel de Provence et Simone Garnier, La légende de la chaîne de Moustiers, 1961
Commissaire Papperins Provence
Vor längerer Zeit
Abendliche Dämmerung breitete sich über den Bergen der Haute Provence aus. Die Sonne war längst hinter den Höhenrücken verschwunden. Es herrschte friedvolle Ruhe. Plötzlich zerriss ein lauter Knall die abendliche Stille.
Volltreffer, Jean-André!“
Jacques schlug seinem Freund anerkennend auf die Schulter. Gut hundert Meter vor den beiden strauchelte ein riesiges Wildschwein, kippte zu Boden, raffte sich jedoch wieder auf und verschwand taumelnd im Gebüsch.
„Nein! Schau doch, er läuft weg.“
„Er kommt nicht weit. Dein Schuss war gut. Los, wir folgen ihm.“
Die beiden Freunde mussten nicht lange suchen. Unter einer knorrigen, verkrüppelten Eiche lag der Eber. Schwer atmend schaute er die beiden Jäger an, versuchte aufzustehen, brach aber wieder zusammen.
„Fangschuss!“, sagte Jacques. „Ich hab‘ meine Pistole nicht mit. Hast du deine?“
Jean-André nickte, nestelte seine alte Manurhin aus dem Rucksack und zielte.
„Ich kann es nicht“, gestand er. Es war etwas völlig anderes, aus großer Entfernung auf das Wild zu schießen oder direkt vor ihm zu stehen und ihm in die brechenden Augen zu blicken.
„Mach du es! Ich hole inzwischen den Pickup.“
Er gab seinem Freund den Revolver und wandte sich ab. Er wollte und konnte nicht mit ansehen, wie Jacques dem Eber den Fangschuss verpasste.
Er war schon einige Dutzend Meter durch die kniehohe Macchie gestapft, als ihn der Knall des Schusses einholte.
Vor einem halben Jahr
Adéline Lautier umarmte ihre Freundin.
„Salut Jeannine! Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich über deinen Besuch freue. Wie lange ist es her, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben?“
„Ach sehr lange. Der Beruf, meine Beförderung und mein Umzug nach Toulon. Ich hatte einfach keine Zeit. Das letzte Mal, als ich hier war, hat dein Vater noch gelebt.“
„Ja, vorletztes Jahr ist er gestorben. Das war sehr, sehr traurig. Aber jetzt zu dir! Wie geht es dir? Wie ist dein neuer Job als commissaire de police in Toulon? Und wie ist dein Verhältnis zu deinem Chef? Äh, nein! Der ist jetzt ja nicht mehr dein Chef. Seid ihr jetzt …?“
Sie warf Jeannine einen fragenden Blick zu. Nach kurzem Zögern erwiderte diese:
„Nein, zurzeit ist es … etwas schwierig.“
Insgeheim dachte sie aber: Ich liebe ihn noch immer. Aber er ist so anders, seit dem Anschlag auf ihn im Sommer.
„Aber wart ihr nicht…?“
„Lass uns von was anderem reden“, wehrte Jeannine die Neugierde ihrer Freundin ab. Ich bin gekommen, weil ich etwas von dir möchte.“
„Ich weiß. Du hast am Telefon gesagt, du bräuchtest etwas von meinem Atelier. Was genau ist es?“
„Du wirst dich nicht daran erinnern. Vor fünfundzwanzig Jahren haben meine Eltern geheiratet“.
„Hattest du mir nicht mal geschrieben, dass sie sich getrennt haben?“
„Das stimmt. Aber seit einem Jahr sind sie wieder zusammen.“
„Oh, dann müssten sie ja heuer ihre silberne Hochzeit feiern. Aber … Du bist doch schon dreißig, oder sogar noch etwas älter?“
„Ich war damals sieben. Meine maman hat mich in die Ehe mitgebracht.“
„Verstehe. Und jetzt haben sie Silberhochzeit.“
„Oui, les noces d’argent“, bestätigte Jeannine. „Sie hatten damals nur eine kurze Hochzeitsreise gemacht. Hierher in die Fayencestadt Moustiers-Sainte-Marie. Mich hatten sie mitgenommen. Damals haben sie deinen Vater und sein Atelier kennengelernt und sich von ihm ein Geschirrservice töpfern lassen. Tiefe und flache Teller, Schüsseln, eine Socière und eine große Terrine. Alles aus feinster Keramik, handbemalt mit dem typischen Moustiersdekor. Auf den Unterseiten standen die Namen und das Hochzeitsdatum meiner Eltern unter der Glasur.“
„Ja, seit damals sind wir befreundet. Aber an das Service kann ich mich nicht mehr erinnern. Was ist damit?“
„La grande soupière, die große Terrine mit dem Deckel, die hat maman letztes Jahr fallen lassen und sie ist in tausend Scherben zersplittert. Meine Eltern waren sehr traurig. Die würde ich ihnen gerne zur silbernen Hochzeit wieder schenken. Falls Du sie nochmal nachmachen kannst. Ich habe ein Foto dabei.“
„Welch hübsche Idee! Das sollte kein Problem sein. Papa hat von allen seinen größeren Aufträgen die Musterzeichnungen aufgehoben. Ich finde deine Terrine mit Sicherheit in seinen Unterlagen. Bis wann brauchst du sie?“
„Im kommenden Februar ist der Hochzeitstag. Also rechtzeitig vorher.“
„Pas de problème! Jetzt haben wir Spätsommer. Darf ich das Foto sehen?“ Jeannine gab ihr das Bild, das Adéline lange betrachtete. Dann meinte sie: „Eine sehr altmodische Form. Die vielen Ecken, Ausbuchtungen und der verschlungene Griff am Deckel. Soll ich nicht lieber etwas Moderneres machen?“
„Mais non! Sie soll wieder genauso werden. Das hat meinen Eltern damals sehr gefallen.“
„Okay, dann mache ich das so. Aber jetzt sollten wir auf unser Wiedersehen anstoßen. Du hast sicher viel zu erzählen – von deinem neuen Job und deinem alten Chef. Was hältst du von einem apéro auf meiner Veranda im Abendsonnenschein? Un kir? Kir-pêche oder kir-cassis, was magst du lieber?“ Jeannine entschied sich für den Wein mit Pfirsichlikör.
Nachdem sie auf der kleinen, von Bougainvilleen umrankten Terrasse Platz genommen und sich zugeprostet hatten, entwickelte sich eine angeregte Unterhaltung. Jeannine erfuhr von Adélines Sorgen um das Atelier. Seit dem Tod ihres Vaters seien viele alte Kunden abgesprungen und mit ihren relativ teuren, in Handarbeit gefertigten Produkten sei es nicht einfach, neue Kunden in größerer Zahl zu finden. Außerdem machten ihr und den anderen alteingesessenen Ateliers die Billigprodukte schwer zu schaffen, die in großen Mengen aus China importiert würden.
„Unsere alten Muster sind zwar gesetzlich geschützt und dürfen nicht nachgemacht werden. Aber die Chinesen umgehen den Rechtsschutz, indem sie die Dekors leicht abwandeln oder neue Fantasiemuster erfinden, die sie auf ihre Billigwaren applizieren. Aber das ist Ramsch, Fabrikware, die in Massenproduktion hergestellt wird. Wir mit unseren Manufakturen können da preislich nicht mithalten.“
„Und wie wehrt ihr euch dagegen?“
„Eigentlich können wir nichts machen. Wenn wir uns auf das Billig-Preisniveau einlassen würden, dann könnten wir bald zumachen. Unsere Herstellungskosten sind einfach zu hoch.“
„Das sieht hoffnungslos aus. Du tust mir leid. Wie stellst du dir vor, geht es weiter?“
„Es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer. Die Kunden beginnen langsam zu merken, dass das nicht die ursprüngliche Fayence ist, die sie kaufen, und wenden sich wieder unseren Manufakturprodukten zu. Nicht die Touristen, die sind mit der Chinaware zufrieden. Aber die Besserverdienenden in den größeren Städten wollen die echte Moustiersfayence. Und so bekommen wir wieder vereinzelte Anfragen von den Nobelgeschäften dort. Aber, wie gesagt, das ist nur ein Hoffnungsschimmer, aber noch lange kein Durchbruch.“
Sie hob ihr Glas und prostete Jeannine zu.
„Aber lass uns von etwas Schönerem reden. Ich zeige dir mein Atelier, die Töpferei, den Brennofen, die Malstube und den Ausstellungsraum und stelle dir meine Mitarbeiter vor.“
„Oh ja, das interessiert mich sehr. Aber noch eine Frage: Wie teuer wird sie werden – die Terrine?“
„Du bist doch meine Freundin! Mach dir da keine Sorgen. Was anderes: Du bleibst doch zum dîner hier? Mein …“ sie zögerte etwas. „… Freund ist zu wenig, Mann, Lebensgefährte … Paul … kocht heute. Etwas Provenzalisches hat er gesagt. Er kann toll kochen. Einverstanden?“
Jeannine nickte.
„Dann kannst du auch hier übernachten und musst nicht bei Dunkelheit den weiten Weg nach Toulon zurückfahren. Mein Gästezimmer ist bereit.“
Jeannine überlegte eine Weile. Einerseits musste sie morgen wieder in ihrem Kommissariat sein. Spätestens um neun Uhr. Gut zwei Stunden würde sie für die etwa 130km brauchen. Wenn sie jetzt zum Abendessen hierblieb – und das konnte sie ihrer Freundin wohl nicht abschlagen –, dann würde es sehr spät werden. Und mit Sicherheit gab es zu dem sicher hervorragenden Menü einen ebenso ausgezeichneten Wein, auf den sie eigentlich auch nicht verzichten wollte. Dass sie in angeheitertem Zustand Auto fuhr, wie ihr Freund und früherer Chef Jean-Luc bei seinem letzten Fall, kam für sie nicht in Frage. Noch dazu die lange Nachtfahrt auf den teils engen Bergstraßen! Also entweder musste sie auf den Wein zum dîner verzichten, oder sie übernachtete hier bei ihrer Freundin. Dann sollte sie aber am nächsten Tag relativ früh starten – spätestens um halb sieben.
„Also, wenn es dir wirklich nicht zu viel Mühe macht, dann würde ich dein Angebot gerne annehmen. Ich muss dann allerdings morgen sehr früh losfahren – spätestens um halb sieben.“
„Génial! Bei mir fängt der Tag sowieso um sechs Uhr früh an. Dann können wir noch zusammen frühstücken. Ich freue mich, und Paul wird sich auch freuen.“
Ein halbes Jahr später – Ende Februar
Die Konferenz im Präsidium des conseil régional der südfranzösischen Verwaltungsregion PACA – Provence-Alpes-Côte d’Azur – hatte doch länger gedauert als commissaire Jean-Luc Papperin gedacht und befürchtet hatte. Er hasste diese aus seiner Sicht völlig nutzlosen Pflichttermine, die den teilnehmenden Politikern und Verwaltungsbeamten vor allem zur Selbstdarstellung und Selbstbeweihräucherung dienten. Die dringend nötige Erarbeitung von Reformkonzepten hatte dagegen nur eine untergeordnete Rolle eingenommen. Die meisten drängenden Probleme waren vertagt und auf die lange Bank geschoben worden. Diese Konferenzen waren für alle höheren Beamten der Region PACA Pflichttermine. Trotzdem war Papperin den beiden letzten Konferenzen ferngeblieben. Er hatte damals seinen Stellvertreter hingeschickt. Deswegen hatte er das Treffen dieses Mal nicht erneut schwänzen können.
Frustriert von den Zeit und Nerven raubenden, endlosen Diskussionen mit den Bürokraten der Regionalverwaltung und ermüdet von der langen Autofahrt war er zuhause in Cabanosque angekommen. Obwohl der Abend noch relativ kühl war – der Frühling hatte den Winter noch nicht so richtig verdrängt –, setzte sich Papperin mit einem Glas Rotwein auf die Steinbank im Innenhof der alten Ölmühle. Durch die noch laublosen Äste der Platane beobachtete er die Wolken. Angeleuchtet von der bereits hinter den Hügeln versunkenen Sonne schwebten sie rosarot am sich langsam verdunkelnden Himmel.
Er genoss die Ruhe, die nur von den leisen Abendgeräuschen der Natur durchbrochen wurde – dem sanften Rauschen des Windes, dem gelegentlichen Ruf eines Vogels, dem Quaken der Kröten unten am Bach.
Bald war der Stress des Tages vergessen. Er ließ seinen Gedanken freien Lauf. Er dachte an den vergangenen Winter, an die Olivenernte im Dezember, als sie mit klammen Fingern in der Eiseskälte die Oliven von den Zweigen gestreift hatten. Er hatte sehr viel mitgearbeitet damals, weil seine Mutter Odile nicht genügend Pflücker hatte engagieren können. Die Coronapandemie hatte das Arbeiterangebot auch in diesem Berufssektor stark reduziert – wie überall in der Wirtschaft. Trotzdem hatten sie eine zufriedenstellende Ernte eingebracht, so dass das Familienunternehmen Ancien Moulin à Huile F. Papperin, das von der Familie Papperin seit Generationen betrieben und jetzt von seiner Mutter Odile fortgeführt wurde, halbwegs gut durch die coronabedingte Wirtschaftskrise gekommen war.
Er dachte an seinen letzten Fall und die harmonische Zusammenarbeit mit Jeannine, seiner liebsten Kollegin, früheren Mitarbeiterin, Freundin und Geliebten, die damals gerade zur Kommissarin in Toulon befördert worden war. Wie es ihnen gelungen war, die heimtückischen, unter dem Deckmantel der Coronapandemie begangenen Morde aufzuklären. Immer noch war er betroffen und schuldbewusst, dass er dabei Jeannine in Todesgefahr gebracht hatte.
Mit Wehmut erinnerte er sich an die Wochen seiner Rekonvaleszenz, die er in dem Luxus-Reha-Hotel in Hyères verbracht hatte, um seine Schussverletzungen ausheilen zu lassen. Es war nicht nur der medizinische Erfolg, der sich dank der Kompetenz der Ärztinnen und Ärzte, der fürsorglichen Pflege und nicht zuletzt durch das luxuriöse Ambiente überraschend schnell eingestellt hatte und der ihn seine Reha in so guter Erinnerung blieben ließ. Vor allem, dass Jeannine sich freigenommen hatte, um eine ganze Woche dort bei ihm zu bleiben, verlieh dieser Zeit einen besonderen Glanz.
Seit damals hatten sie sich nur ganz selten gesehen. Die zunehmende Kriminalität an den Küsten der Côte d’Azur und im provenzalischen Hinterland hatte ihn voll in Anspruch genommen und keine Zeit für Privates gelassen. Erst jetzt auf der Konferenz hatte er Jeannine wieder getroffen. Für ihn war es der einzige Lichtblick auf diesem sonst so öden und nervigen Meeting gewesen. Doch irgendwie war das Band der Harmonie, des stillschweigenden einander Verstehens zerrissen, das sie damals umfangen hatte.
Warum nur war ihr Verhalten plötzlich so zurückhaltend geworden, so distanziert, fast frostig? Direkt gemieden hatte sie ihn auf der Konferenz. Hatte er etwas falsch gemacht, fragte er sich. Sollte ihn das Attentat und die plötzliche Todesnähe verändert haben? War er missmutig, menschenscheu geworden? Es stimmte schon, er hatte ihre Beziehung vernachlässigt, sie lange Zeit nicht mehr angerufen, geschweige denn getroffen. Früher, als sie noch brigadière in der Mordkommission von Aix-en-Provence war mit ihm, Papperin, als Chef, da hatten sie sich täglich gesehen, zusammen über Ermittlungsakten gebrütet, waren zu gemeinsamen Einsätzen gefahren. Dieser Zusammenhalt war jetzt zerrissen, seit sie Kommissarin in Toulon war, gute achtzig Kilometer von Aix entfernt. Aber lag es wirklich an dieser lächerlich kleinen Entfernung, fragte er sich selbstkritisch.
„Wir müssen uns aussprechen“, murmelte er vor sich hin. „So darf es nicht weitergehen.“
Er nahm sich vor, Jeannine anzurufen. Gleich morgen früh wollte er das tun. Heute wollte er den Tag in aller Ruhe auf der Bank im Hof seiner Ölmühle ausklingen lassen – einfach in die Luft schauen, ein bisschen in der Zeitung schmökern und dabei den wunderbaren Roten vom Weingut Château Sainte Roseline genießen. Ungetrübt von telefonischem Beziehungsstress.
Papperin trank einen Schluck, setzte das Glas wieder auf dem Steintisch ab und zog La Provence aus seiner Jackentasche. Den ganzen Tag über hatte er keine Minute Zeit gefunden, auch nur einen kurzen Blick in die Zeitung zu werfen. Jetzt endlich war Ruhe eingekehrt. Er schlug sie auf und vertiefte sich in die lokale Berichterstattung. Zwischendurch nahm er immer wieder einen Schluck von dem wunderbar tanninhaltigen und trotzdem samtweichen Rotwein.
Er stutzte, als er die fette Überschrift auf Seite drei sah:
Geheimnisvoller Mord vor einem Marseiller Bordell
Commissaire Mahut ermittelt gegen die Chinesen-Mafia
„Sieh an, mein Kollege Mahut in Marseille. Hat er schon wieder einen Mord im Rotlichtmilieu am Hals“, murmelte Papperin. Bei einem seiner letzten Fälle, hatte er mit commissaire Mahut kurze Zeit zusammengearbeitet. Eigentlich sollte er es seinem Kommissarkollegen schon nachtragen, wie dieser es elegant geschafft hatte, sich um alles zu drücken und die ganze Arbeit auf Papperin abzuwälzen. Ein Lebenskünstler, dachte Papperin. Aber insgeheim bewunderte er ihn auch dafür. Manchmal täte auch ihm solch eine lässige Dienstauffassung gut, die alle beruflichen Probleme und Sorgen von seinem privaten Leben fernhielt.
Weniger aus Interesse an diesem Verbrechen, eher schon aus Mitgefühl mit Raymond Mahut, dem Chef der Mordkommission des für die Marseiller quartiers nord zuständigen Dezernats der police judiciaire fing er an, den Artikel zu lesen
„In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen drei Uhr früh wurde Yve Ribesse, ein polizeibekannter Ganove, vor einem Bordell im 14. Arrondissement auf offener Straße erschossen. Der die Untersuchung leitende Kommissar Raymond Mahut sagte unserer Zeitung, er gehe von einem geplanten und von einem professionellen Killer ausgeführten Mord aus. Es sei amtsbekannt, dass der Ermordete im Hafenbezirk eine wichtige Rolle gespielt habe. Nach Hinweisen, die den Strafverfolgungsbehörden vorliegen, gehörte er einer mafiaähnlichen, kriminellen Organisation an, die sich in einem erbitterten Machtkampf mit zwei konkurrierenden Banden um die Vorherrschaft auf dem südfranzösischen Drogenmarkt befindet.
Nähere Auskunft zu den Details des Verbrechens werde er bei der morgen stattfindenden Pressekonferenz geben, betonte der Kommissar auf die Nachfrage unseres Reporters. Commissaire Mahut vermutet jedoch, dass die Tat von der in Marseille tätigen sogenannten Chinesen-Mafia verübt wurde. Denn die verwendete Munition weise auf eine Pistole des Typs Norinco QSW hin, ein chinesisches Fabrikat, das überwiegend in China Verwendung findet.“
„Da hat mein Kollege Mahut einen haarigen Fall am Hals. Mit den Chinesen ist nicht zu spaßen“, dachte Papperin, froh darüber, dass dieser Mord nicht in seinem Zuständigkeitsbereich stattgefunden hatte. Er legte die Zeitung beiseite, nahm einen Schluck von seinem Rotwein und blickte durch die blattlosen Äste der Platane in den inzwischen nachtschwarzen Himmel. Er trank einen weiteren Schluck, stellte das Weinglas auf den Steintisch zurück, schloss die Augen und lauschte auf die sanften Geräusche der provenzalischen Nacht.
Vielleicht sollte er Jeannine doch gleich anrufen? Oder war es schon zu spät? Er ließ das Display seines Smartphones aufleuchten. Einundzwanzig Uhr zweiunddreißig stand dort. Nein, um diese Zeit schlief sie mit Sicherheit noch nicht. Also scrollte er in der Telefonliste zu ihrer Nummer und drückte auf den grünen Button. Es läutete mehrmals, bis sie das Gespräch annahm.
„Nett, dass du auch mal anrufst“, meldete sie sich. „Dir scheint ja nichts mehr an mir zu liegen.“
„Jeannine, das stimmt doch nicht. Du bist es doch, die mich in der letzten Zeit meidet. Heute, auf dem Kongress, da bist du mir direkt aus dem Weg gegangen. Was ist los, Jeannine? Magst du mich nicht mehr?“
„Also, jetzt verdrehst du die Dinge. Du bist es doch, der mich abweist. Du weißt doch genau, letzthin in Hyères, als du in der REHA warst. Da bin ich zu dir gekommen, habe mir extra Urlaub genommen, um bei dir zu sein. Aber du warst so mit dir beschäftigt, dass du mich gar nicht zur Kenntnis genommen hast.“
„Aber das war doch so schön und harmonisch.“
„Das hast nur du so empfunden. Eigentlich wollte ich … Ich hatte gehofft, dass du …“
Leises Wimmern klang aus Papperins Handy.
„Warum weinst du?“
„Nach all dem Grauen, das ich durchgemacht hatte. Ich allein auf der Yacht, mit den beiden Verbrechern. Und du…“
„Aber Jeannine!“
„Du bist eben ein Egoist und denkst nur an dich. Ich bin dir nichts wert. Das habe ich in Hyères gemerkt.“
„Aber ich liebe dich doch!“
„Ja dann, wenn du eine Frau zum Schlafen brauchst. Auf diese Liebe kann ich verzichten.“
„Spinnst du jetzt? Wenn es mir nur um das Schlafen mit einer Frau ginge, da gäbe es genug Möglichkeiten. Aber ich…“
„Bordelle oder Straßennutten meinst du? Dann geh doch zu denen!“
„Jeannine, du verstehst mich nicht! Ich will …“
„Du willst, du willst! Es geht dir immer nur um dich.“
„Jeannine, aber das stimmt doch gar nicht!“
„Ach, hau ab! Ich will dich nicht mehr sehen.“
Abrupt war das Gespräch unterbrochen. Fassungslos schaute Papperin auf sein Handy. Sollte er sofort zurückrufen? Nein! Er hatte schließlich auch seinen Stolz. Es war doch sie, die im Unrecht war.
Frustriert und innerlich erschüttert steckte er sein Handy ein, nahm die Weinflasche und sein Glas und ging ins Haus.
Dienstag, siebter März
Im kleinen Büro des Atélier Lautier in Moustiers-Sainte-Marie brütete Adéline Lautier über den Dateien, die sie von ihrem Steuerberater per E-Mail geschickt bekommen hatte.
„Es will und will nicht aufwärts gehen“, seufzte sie beim Anblick der Umsatzstatistik. Fast alle Artikel, die das Atélier Lautier fertigte, wiesen einen deutlichen Abwärtstrend auf. Nur eine Produktlinie gab Anlass zur Hoffnung: Das neue service pour le dîner aus hellgrauem Ton, dessen Formen sie selbst designt und ausgeformt hatte und das mit dem feinen Dekor bemalt war, das ihr Urgroßvater vor mehr als hundert Jahren entworfen und das sie vor Kurzem im Archiv wiederentdeckt hatte. Das Dinnerservice stieß ganz offensichtlich auf das Interesse ihrer Kunden. Ob es die sehr eigenwillige, moderne Formgebung der Teller, Schalen und Terrinen war, die zu diesem starken Umsatzwachstum geführt hatte, oder die fein ziselierte, konservativ-altmodisch wirkende Bemalung mit Fantasiepflanzen und -tieren, konnte sie nicht sagen. Aber sie vermutete, dass es eher das sehr ansprechende Dekor nach dem Entwurf ihres Urgroßvaters war, das für den unerwarteten Verkaufserfolg verantwortlich zeichnete. Trotzdem: Insgesamt sah die wirtschaftliche Lage des Ateliers Laurier alles andere als gut aus.
„Ich werde wohl einige Artikel und Produktlinien aus dem Sortiment nehmen müssen“, überlegte sie und strich die mit den dicksten Minuszeichen versehenen Positionen mit einem roten Marker an.
„Und dafür mehr mit meinen neuen Formen und den alten Mustern arbeiten“, entschied sie.
Mit Schwung wurde die Tür aufgerissen und prallte an das dahinterstehende Aktenregal.
„Adéline, hast du das schon gesehen?“
Ghyslaine Colpart war ins Büro gestürmt und knallte eine etwa weinflaschengroße Fayencevase auf Adélines Schreibtisch. Entrüstet und vor Aufregung außer Atem stammelte sie:
„C’est une cochonnerie! Eine Sauerei ist das! Du musst das verhindern!“
Adéline Lautier blickte ihre Verkäuferin erschrocken an:
„Was gibt es denn so Schlimmes, das dich derart erregt? Ist im Laden etwas passiert?“
„Der Marrasse, dieses Schwein, klaut unser Erfolgsdekor. Schau es dir doch an, das Stück da! Das darf der doch gar nicht!“
Jetzt wandte Adéline ihren Blick der vor ihr stehenden Vase zu. Sie hatte die typische Form, wie sie ihr Konkurrent Jacques Marrasse für seine Fayencen verwendete. Aber die Bemalung! Das gab es doch nicht! Eins zu eins waren das die Fantasiepflanzen und -tiere ihres Urgroßvaters. Auch die Farben waren identisch.
„Wo hast du das her?“, fragte sie ihre Verkäuferin.
„Ein Kunde hat mich darauf aufmerksam gemacht.“
„Wie?“
„Er hat gesagt, er habe in unserem Schaufester gesehen, dass wir auch diese Motive verwenden. Dann hat er mir diese Vase gezeigt. Er suche eine deutlich größere, aber mit derselben Bemalung. Ich habe ihn gefragt, woher er die Vase habe. Vom Atelier Marrasse hat er gesagt und mir die Rechnung gezeigt. Hundertzehn Euro! Mit unserem Design!“
Adéline nahm die Vase, drehte sie langsam in ihrer Hand und betrachtete mit scharfem Blick jedes einzelne Bild. Dann schüttelte sie fassungslos den Kopf.
„Das ist das Dekor unseres einzigen Erfolgsmodells. Das darf er nicht nachmachen. Nein, das geht wirklich nicht. Dieses Muster wurde in meinem Atelier entwickelt, von meinem Urgroßvater. Und Jacques Marrasse klaut uns das einfach, bemalt seine Produkte damit und verkauft sie, als wäre es seine Erfindung. Das kann er nicht machen. Noch dazu ohne uns zu fragen und um Erlaubnis zu bitten. Das ist Plagiat. Das ist verboten. Schließlich gibt es ein Urheberrecht in Frankreich.“
„Was machen wir jetzt? Was willst du dagegen unternehmen?“, fragte Ghyslaine.
„Ich gehe sofort zu Jacques und stell ihn zur Rede.“
Sie riss ihren Steppanorak vom Kleiderhaken, schlüpfte hastig hinein und hängte sich ihre Handtasche mit Schwung über die Schulter. Wütend verließ sie das Atelier.
***
Adélines Atelier lag am südwestlichen Ortsausgang von Moustiers an der Avenue Frédéric Mistral. Bis zum Betrieb ihres Konkurrenten, der Faïencerie Jacques Marrasse, am anderen Ortsende hatte sie ein gutes Stück zu laufen. Erregt und innerlich aufgewühlt wie sie war, hatte sie keinen Blick für das malerische, mittelalterliche Dorf. Es galt als einer der schönsten Orte Frankreichs. Sie sah nicht die romanische Kirche mit ihrem in drei Etagen von schlanken Rundbogenfenstern durchbrochenen Turm. Auch dem golden blitzenden Stern an der Kette, die die Felsschlucht hinter dem Dorf überspannte, widmete sie keinen Blick. Sie überquerte die romanische Brücke über den ravin de notre dame, dessen wasserreiche Fluten das Dorf in einer tiefen Schlucht durchschnitten.
Als sie am Posten der police municipale vorbeikam, stoppte sie. Sollte sie hineingehen und eine Anzeige erstatten? Sie zögerte kurz. Nein! Erst wollte sie Jacques die Leviten lesen. Also ging sie weiter und erreichte endlich Jacques Marrasses Verkaufsladen. Sofort fielen ihr die vielen Exponate im Schaufenster auf, die mit ihren Motiven bemalt waren. Eine Unverschämtheit!
Melodisches Glockengeläute erklang, als sie die Türe zum Verkaufsraum aufstieß. Die wenigen Kunden im Raum blickten erstaunt auf, als sie die junge Verkäuferin anblaffte:
„Wo ist Jacques?“
Als die junge Frau nicht sofort antwortete, sondern sie nur verständnislos anstarrte, fauchte sie:
„Na wer wohl? Dein Chef!“
„Ah … madame Lautier …bonjour“, stammelt die Verkäuferin, als ihr bewusst wurde, wer diese Frau war, die so zornig in den Laden gestürmt war. Sie kannte Adéline Lautier eigentlich nur als freundlichen und umgänglichen Menschen. Ihr jetziges harsches Auftreten war völlig untypisch.
„Monsieur Marrasse arbeitet. In seinem Büro. Aber er hat gesagt, dass er nicht gestört werden darf.“
Mit einem gezischten „je m’en cogne – das ist mir scheißegal“ durchquerte Adéline den Laden und riss die Tür mit der Aufschrift BUREAU auf.
„Sag mal, was fällt dir ein, einfach unser Dekor nachzumachen? Das darfst du nicht!“
„Salut Adéline. Ich habe schon darauf gewartet, dass du kommst. Setzen wir uns doch. Un café? Ou de l’eau?“
„Ich will keinen Kaffee und kein Wasser. Ich will wissen, was in dich gefahren ist, dass du unser dessin einfach klaust.
„Aber das habe ich doch gar nicht. Das ist ein typisches Moustiersmuster. Das kann jeder verwenden.“
„Da bin ich anderer Meinung. Dieses dessin wurde von unserem Atelier entworfen. Deshalb steht es uns zu. Ausschließlich uns.“
„Jetzt setz dich erst mal! Dann reden wir in Ruhe.“
Widerwillig folgte sie ihm zu den Ledersesseln, die um einen niedrigen Glastisch standen. Monsieur Marrasse öffnete eine der Badoitflaschen, die auf dem Tisch standen und goss das sanft sprudelnde Wasser in zwei Gläser.
„Wieso greifst du uns plötzlich an?“, fragte Adéline mit ruhiger Stimme. Ihr war bewusst geworden, dass sie nur mit klarem Kopf und guten Argumenten bei Marrasse etwas würde erreichen können, aber nicht mit emotionalen Attacken oder Wutausbrüchen.
„Mein Vater ist doch immer gut mit dir ausgekommen. Auch seit ich unser Atelier führe, hat doch alles immer bestens funktioniert. Wir sind Konkurrenten, aber wir haben uns nie bekämpft – so wie du das jetzt angefangen hast. Also lass das bitte künftig.“
Marrasse schaute sie wortlos an und trank einen Schluck aus seinem Wasserglas.
„Das ist unser Dekor“, fuhr Adéline fort. „Und das weißt du. Das hat mein Urgroßvater entworfen, damals um die Jahrhundertwende. Ich glaube 1901 war das.“
Auch Adéline trank jetzt von ihrem Mineralwasser.
„Und du weißt, dass das unser größter Umsatzbringer ist. Du darfst das nicht kopieren. Das ist nicht fair!“
Marrasse setzte sein Glas ab und blickte Adéline mit fast unmerklichem Kopfschütteln an.
„Was heißt hier fair? Jean-André … dein Vater … ist tot.“ Er machte eine Pause und trank wieder einen Schluck Wasser.
„Und du als Frau bist doch gar nicht in der Lage, seinen Betrieb weiter zu führen. Jeder weiß, dass es immer schlechter läuft bei euch. Fayencen herzustellen ist ein schwieriges Handwerk und nichts für eine Frau. Du solltest froh sein, dass ich dein Dekor weiter am Leben erhalte, wenn dein Laden demnächst Pleite geht.“
Adéline hatte ihrem Gegenüber zuerst verblüfft und dann mit entsetzter Miene zugehört.
„Erstens gehen wir nicht pleite. Und zweitens geht es in letzter Zeit wieder bergauf, nicht zuletzt wegen dieses Dekors. Außerdem darfst du das rein rechtlich gar nicht nachmachen. Schließlich gibt es ein Urheberrecht!“
„Da täuschst du dich. Klar, es gibt ein Urheberrecht. Aber das steht auf meiner Seite. Vor einiger Zeit haben wir die Muster im Registre de Dessin et Modèle beim INPI eintragen lassen.“
„INPI?“
Jacques Marrasse sah ihren ratlosen Blick, mit dem sie ihn anstarrte.
„Offensichtlich kennst du den neuen Code de la Proprièté Intellectuelle nicht? INPI ist das Institut Nationale de la Propriété Intellectuelle. Das kümmert sich um den Schutz des geistigen Eigentums – unter anderem um den Gebrauchsmuster- und Geschmacksmusterschutz. Da kann man auch solche Fayencedesigns registrieren lassen. Das haben wir getan. Damit ist das Dessin rechtlich geschützt und niemand darf es ohne unsere Zustimmung verwenden. Also unterlass das ab sofort. Meinetwegen kannst du deinen Lagerbestand noch abverkaufen. Aber dann …“
„Das kann nicht sein! Unser Dessin existiert schon seit über hundert Jahren. Mein Recht ist also viel älter als dein INPI-Quatsch.“
Marrasse nahm sein Glas und wollte einen weiteren Schluck Mineralwasser trinken. Da es leer war, schenkt er es bedächtig wieder voll und führte es zu seinem Mund.
„Übrigens: Das interessiert mich eigentlich alles nicht mehr. Das musst du mit meinem Geschäftsführer ausmachen, Pierre Simard. Du kennst ihn ja. Ich werde ihm mein Geschäft verkaufen. Ich bin alt genug und will mit all dem nichts mehr zu tun haben. Wir haben alles schon geregelt. Kommende Woche ist der Notartermin. Er hat das auch alles gemanagt mit dem INPI und dem ganzen juristischen und bürokratischen Scheiß. Ich ruf ihn, dann kannst du mit ihm weiter streiten.“
Marrasse zog das Handy aus seiner Sakkotasche und wählte.
„Pierre, kannst du mal kurz rüberkommen in mein Büro?“
Adéline konnte nicht hören, was der Geschäftsführer erwiderte. Offensichtlich wollte er wissen, wieso er kommen sollte, denn Marrasse sagte:
„Die kleine Lautier ist da und regt sich wegen des Dekors auf.“
Innerlich kochte sie. Was fiel Marrasse ein, sie „die kleine Lautier“ zu nennen – herabwürdigend, fast verächtlich. Das konnte sie sich von diesem Emporkömmling nicht bieten lassen. Schließlich war sie die Geschäftsführerin und Inhaberin eines alten und angesehenen Unternehmens, das seit Jahrzehnten, sogar über ein Jahrhundert, Fayencen in Moustiers herstellte. Das Atelier Marrasse gab es dagegen erst seit etwa zwanzig Jahren.
„Du aufgeblasener …“, hatte sie gerade zu einer zornigen Replik angesetzt, als die Tür aufging und Pierre Simard eintrat: Groß, athletisch und schick gekleidet – blaues Polohemd von Lacoste und elegante Jeans von Valentino, an den Füßen Sneakers, das neueste Modell von Nike, wie Adéline mit fachkundigem Blick feststellte. Er musterte sie von oben herab und meinte mit abschätziger Miene:
„Ich habe gehört, dass Sie was gegen unsere neue Produktlinie unternehmen wollen? Gauben Sie mir, da haben Sie keine Chance.“
„Doch! Das ist Unrecht. Die gab es schon lange, bevor Sie das Dessin in dieses komische Register haben eintragen lassen. Ich habe es Ihrem Chef schon gesagt: Unterlassen Sie das, sonst…!“
„Was sonst?“
„Ich habe die älteren Rechte. Das ist eindeutig.“
„Da muss ich Sie aufklären: Das INPI trägt unser Dessin auf Antrag ein und gewährt den Geschmacksmusterrechtsschutz. Die müssen nicht prüfen, ob es da noch ältere Rechte gibt. Mit der Registrierung ist das rechtswirksam.“
„Du siehst also, dass wir im Recht sind“, flocht Jacques Marrasse ein.
„Ich werde mich dagegen wehren, denn ich kann beweisen, dass wir das Muster entwickelt haben – mein Urgroßvater“, ergänzte sie. Folglich sind wir im Recht.“
Mit einem geringschätzigen Lächeln auf den Lippen meinte der Geschäftsführer und künftige Unternehmer:
„Dann müssten Sie klagen – vor Gericht und das kostet Sie …“
„Schau, Adéline“, unterbrach ihn Jacques Marrasse mit gespielt väterlicher Miene. „Das kannst du dir doch gar nicht leisten – bei deiner Finanzlage. Also lass es sein.“
„Monsieur Simard, können Sie mal kommen? Der erste Entwurf für das neue Modell ist gerade fertig geworden.“
„Sofort! Wir haben hier noch kurz etwas zu besprechen. Aber ich bin gleich da.“
Ein junger Mann war ins Büro getreten. Einer der Arbeiter aus der Fayenceproduktion. Seine Jeans und sein T-Shirt waren übersäht von großen weißen und grauen Flecken – Modellierton.
Adéline wandte sich zur Tür und musterte den Mann. Aber das war doch…? Sie blinzelte zweimal um ihn genauer sehen zu können.
„Arnaud, was machst du hier? Warum bist du nicht im Atelier? Nochmal: was tust du hier?“
„Er arbeitet jetzt für uns!“, sagte Pierre Simard. Und zu dem Arbeiter gewandt: „Gehen Sie wieder an die Arbeit. Ich komme gleich.“
„Stopp!“
Adélines Ruf ließ den Arbeiter unter der Tür haltmachen.
„Du arbeitest für die da?“ Dabei deutete sie auf Jacques Marrasse und Pierre Simard.
Arnaud zuckte verlegen mit der Schulter und schwieg.
„Ohne mir etwas zu sagen? Ohne mich zu fragen? Das geht nicht!“
Mit einer herrischen Handbewegung wies der Geschäftsführer den Arbeiter aus dem Büro.
„Gehen Sie!“
Zu Adéline gewandt:
„Arnaud arbeitet jetzt für uns.“
Mit einem Achselzucken und einer Kopfbewegung zu Marrasse fügte er hinzu:
„Der Chef zahlt eben viel besser. Arnaud ist ein begnadeter Modelleur, den können Sie sich nicht mehr leisten. Übrigens, falls Sie das noch nicht wissen sollten: Ab nächster Woche bin ich Inhaber der Faïencerie Marrasse. Darf ich Ihnen einen Rat geben?“
Er schaute Adéline geringschätzig an.
„Suchen Sie sich einen Job! Sekretärin oder … ach was weiß ich! Ich übernehme Ihre Mitarbeiter … äh … Mitarbeiterinnen. Sie haben ja nur noch Frauen, seit Ihr Modelleur weg ist. Meinetwegen kaufe ich Ihnen Ihr Equipment und Ihre Lagerbestände ab. Sie werden ja viel Geld brauchen, um Ihre Schulden…“
„Halten Sie Ihr Schandmaul!“
Mit hochrotem Kopf und wutentbrannt über die erniedrigenden Beleidigungen sprang Adéline auf und stürmte zur Tür. Dort wandte sie sich noch einmal um und rief mit drohender, sich überschlagender Stimme:
„Ich werde mich wehren! Mit allen Mitteln! Es wird Ihnen noch Leid tun, wie Sie mich hier fertig gemacht haben und mein Unternehmen in den Ruin treiben wollen. Und dir auch, Jacques! Sehr Leid wird es euch tun.
Mit lautem Knall flog die schwere Bürotür hinter ihr ins Schloss.
***
Zornig und innerlich aufgewühlt eilte sie mit hastigen Schritten die Dorfstraße entlang. Doch schon nach kurzer Zeit musste sie Halt machen. Zu heftig raste ihr Puls und sie bekam kaum noch Luft. Sie lehnte sich an das Brückengeländer, schaute hinab zu dem rauschenden Wasserfall und versuchte langsam und tief durchzuatmen. Als sich ihr Herzschlag wieder beruhigt hatte, setzte sie ihren Weg fort – jetzt aber langsamer, denn sie wusste, durch Aufregung und seelischen Stress verschlimmerten sich ihre Herzrhythmusprobleme drastisch.
Also ging sie gemäßigten Schrittes weiter und versuchte, ihren Ärger zu verdrängen. Sie war betrübt und enttäuscht von Arnauds Verhalten. Doch dann kam Trotz in ihr auf. Denen würde sie es schon zeigen, dachte sie:
„Soll er sich doch an diesen Verbrecher verkaufen. Auf ihn kann ich verzichten! Dann werde ich eben wieder selber verstärkt modellieren und töpfern. Nicht umsonst habe ich das von der Pike auf von papa gelernt.“
Irgendwie begann ihr die Aussicht Freude zu machen, sich wieder mehr dem Handwerklichen zu widmen und weniger im Büro und im Vertrieb zu arbeiten. Vielleicht konnte sie ihren Freund Paul dazu bringen, sich neben seinem Job als Koch auch noch um ihren kommerziellen Kram zu kümmern.
Sie schlenderte an den Schaufenstern der Geschäfte vorbei und erfreute sich an den teilweise sehr hübschen Dekorationen in den Auslagen der am Weg liegenden Fayence-Ateliers. Manche boten ihre Produkte auch auf Tischen im Freien vor ihren Läden an. Adéline nahm das eine oder andere Stück in die Hand, betrachtete kritisch die Form und die Bemalung, drehte es um und sah sich die Marke auf der Unterseite an. Nicht immer konnte man erkennen, ob es sich um billige Importware handelte oder um in den hiesigen Werkstätten gefertigte Fayence. Wenn dort nichts oder nur Moustiers oder Décor Moustiers zu lesen war, dann war das ein Hinweis, dass es sich nicht um originäre Moustiersfayencen handelte. Bei Letzteren wurde stets das Atelier angegeben, so wie bei Adélines Produkten. Bei jedem ihrer Stücke war unter der Glasur eingebrannt: Fait main dans l’atélier Lautier. Und so war das auch bei allen anderen seriösen Ateliers. Allerdings waren diese Fayencen teuer – erheblich teurer als die Importware.
Es gab viele Geschäfte, Ateliers und Galerien in Moustiers, die Fayence verkauften. Teilweise waren die Werkstätten direkt an die Verkaufsläden angegliedert. Überwiegend befanden sich die Manufakturen und Fabriken jedoch außerhalb. In dem kleinen, engen mittelalterlichen Dorf wäre auch gar kein Platz dafür.
Als nächstes kam sie an einem Ladengeschäft mit großen, weit geöffneten Schaufenstern vorbei.
Aldo Francini Faïences SARL
stand in breiten Schriftzügen darüber. In den Auslagen wurden bunt bemalte Keramiken zum Verkauf angeboten, dicht gedrängt auf übervollen Tischen.
„Der verkauft nur solche billige Importware, der hat gar keine eigenen Werkstätten“, dachte Adéline. Sie betrachtete die Exponate nachdenklich und kam ins Grübeln. Vielleicht sollte sie auch umstellen, überlegte sie, und nur solche billige Ramschware verkaufen. Damit könnte sie viel mehr Umsatz machen, zumindest im Sommer, wenn Abertausende von Touristen und Urlaubern das Dorf überschwemmten. Die würden sich darauf stürzen. Denn die meisten von ihnen waren nicht bereit, die hohen Preise für originale Moustiersfayencen zu bezahlten.
Im Weitergehen überlegte sie. Diese Billigware kam meistens aus Asien, weil dort die Löhne so viel niedriger waren. Da sie dorthin keinerlei Verbindungen hatte, müsste sie sich einen Zwischenhändler suchen, der die Stücke aus China oder aus welchem asiatischen Land auch immer für sie importierte.
Aber das wäre Verrat, dachte sie, Verrat an der Tradition ihres Familienunternehmens, am Lebenswerk ihrer Vorfahren.
„Nein!“, entschied sie. „Das hat mein papa nicht getan und sein papa auch nicht. Ich schaffe das auch!“
***
Wieder zurück in ihrem Atelier setzte sie sich frustriert an ihren Schreibtisch und nahm sich aufs Neue die ernüchternden Ausführungen ihres Steuerberaters vor. Aber eigentlich hatte sie keine Lust, sich jetzt mit diesen kaufmännischen Dingen zu beschäftigen. Also schloss sie die Datei, schaltete den Computer auf Stand-by und ging in die Modellierwerkstatt. Nachdem Arnaud sie verlassen hatte, arbeitete dort nur noch eine Aushilfskraft, die sie kürzlich zu seiner Entlastung eingestellt hatte.
„Jasmine, lass das das jetzt liegen und komm mit. Es gibt Neuigkeiten, die ich dir und den anderen sagen muss.“
Die Angesprochene stellte eine weiße Rohkeramik ab, die sie für den Brennofen vorbereitet hatte und folgte ihrer Chefin. Als auch die Mitarbeiterin aus dem Malraum und die Verkäuferin Ghyslaine Colpart sich in Adélines Büro versammelt hatten, begann diese:
„Es gibt drei beunruhigende Neuigkeiten, mit denen wir fertig werden müssen. Erstens: Bis auf unsere neue Produktlinie, dem grauen Dinner-Service mit dem Dekor meines Uropas machen wir mit allen anderen Produkten Verluste. Zweitens: Jacques Marrasse hat uns dieses Dekor gestohlen und sich dafür widerrechtlich einen Geschmacksmusterschutz beim INPI eintragen lassen. Offiziell dürfen wir dieses Dessin gar nicht mehr verwenden.“
„Aber wir haben doch die viel älteren Rechte!“, wandte die Dekormalerin Marie-Louise ein.
„Das stimmt zwar, aber ich habe nicht das Geld, um unser Recht einzuklagen. Rechtsanwälte und Gerichtskosten verschlingen Unsummen. Und bis wir endlich Recht bekommen und unsere Auslagen zurückkriegen, können Jahre vergehen. Bis dahin bin ich längst pleite. Im Augenblick bin ich ratlos. Ich muss nochmal mit Jacques reden. Vielleicht kommt er mir doch etwas entgegen. Aber ich fürchte das Schlimmste. Vor allem, weil er sein Atelier seinem Geschäftsführer überschreiben wird, diesem Unsympathen Simard – nächste Woche.“
Adéline fuhr mit leiser Stimme fort:
„Drittens kommt hinzu, dass Jacques uns Arnaud abgeworben hat. Der arbeitet jetzt in der Faïencerie Marrasse. Das heißt: Ab sofort werde ich wieder die Formen entwickeln und modellieren – mit deiner Hilfe, Jasmine.“
Sie stieß sich von der Schreibtischplatte ab, an der sie halb sitzend gelehnt hatte, richtete sich zu ihrer vollen Größe auf und verkündete:
„So beschissen die Lage auch aussieht, ich werde nicht aufgeben. Ich werde unser einziges Erfolgsprodukt mit unserem alten Dessin weiter herstellen und verkaufen. Soll Jacques mich doch verklagen! Oder sein Nachfolger, dieser Lackaffe Pierre Simard!“
Adéline schaute in die Runde.
„Ich weiß, das wird eine sehr harte Zeit. Vielleicht schaffe ich es auch nicht und unser Atelier geht wirklich pleite. Ihr müsst da nicht mitmachen. Ich bin euch nicht böse, wenn ihr euch lieber einen sicheren Job suchen wollt.“
Sie blickte jede ihrer Mitarbeiterinnen an. Dabei war ihr bewusst: Wenn diese drei jetzt kündigten, dann wäre es das Aus für sie und ihr Atelier. Denn alleine würde sie die viele Arbeit nicht stemmen können: Einkaufen, modellieren, bemalen, brennen, im Verkaufsladen die Laufkundschaft bedienen und die engen Kontakte zu ihren langjährigen Stammkunden pflegen und dazu noch den Zeit fressenden Bürokratiekram, das war für eine Person nicht zu schaffen. Und neue Mitarbeiter zu finden war bei der prekären finanziellen Lage ihres Unternehmens aussichtslos. Ihr Konkurrent Jacques Marrasse hatte in den einschlägigen Fachkreisen schon entsprechende Gerüchte über ihre angeblich bevorstehende Pleite verbreitet. Das schreckte jeden Bewerber ab.
„Adéline, ich lass dich nicht im Stich! Ich bleibe!“ Marie-Louise ging zu ihrer Chefin, umarmte sie und flüsterte ihr ins Ohr: „Wir schaffen das!“
Dann blickte sie die beiden anderen Frauen an.
„Und ihr? Macht ihr mit oder lasst ihr Adéline im Stich?“
Ghyslaine und Jasmine schauten sich an. Man spürte förmlich, dass sie lieber weggehen und sich einen sicheren Job suchen wollten. Vor allem Jasmine, die Adéline erst vor Kurzem als Aushilfe eingestellt hatte, war das anzumerken.
„Ihr müsst wirklich nicht bleiben“, meinte Adéline. „Ich zahle euren letzten Lohn aus und dann …“
Es entstand eine bedrückende Stille.
„Nein! Ich gehe nicht! Ich helfe euch!“, beendete Ghyslaine Colpart das Schweigen. „Und du doch auch, Jasmine. So ein tolles Arbeitsklima wie hier, wirst du nirgends mehr finden.“
Jasmine Menardi zögerte, dann nickte sie. „Okay, ich mache mit.“
„Super!“, freute sich Ghyslaine. „Wir werden es dem Marrasse zeigen. Bevor der uns ruiniert, bring ich ihn eigenhändig um, diesen Verbrecher.“
„Und den Simard dazu, diesen bösartigen Wichtigtuer!“, fügte Marie-Louise hinzu.
„Danke! Ihr seid toll!“ Adéline war sichtlich gerührt von der Treue ihrer Mitarbeiterinnen. „Aber umbringen werden wir niemanden.“
„Natürlich nicht! Aber wir werden hart arbeiten, höherwertige Produkte herstellen als dein Feind Marrasse, ihn preislich unterbieten und ihm so seine Kundschaft abspenstig machen.“
„Dein Wort in Gottes Ohr“, dachte Adéline. Sie zweifelte, dass ihnen das gelingen würde. Trotzdem: Sie mussten es versuchen. Es gab keinen anderen Weg.
***
Zurück in ihrem kleinen Büro nahm sie am Schreibtisch Platz und erweckte ihren Computer aus dem Stand-by-Schlaf. Sie musste den von Jacques im Internet verbreiteten Gerüchten widersprechen und ihn als Lügner an den Pranger stellen. Als erstes würde sie dies ihren Stammkunden per E-Mail mitteilen.
Sie sah, dass im Posteingang ihres Mail-Accounts ein paar neue Nachrichten eingetroffen waren. Bei den meisten handelte es sich um unwichtige Werbemails, die sie sofort löschte. Interessanter schon war die Mail mit dem Absender [email protected]. Neben der Absenderadresse stand kein Betreff in der Posteingangsliste.
„Was will er denn jetzt schon wieder von mir“, murmelte sie und öffnete die Mail.
„Liebe Adéline“, las sie. „Wie du weißt, habe ich vor vielen Jahren ein Lagergebäude draußen an der route départementale Richtung Riez an Jean-André, deinen Vater, bzw. an sein Unternehmen vermietet. Die allgemeine Preissteigerung macht es erforderlich, die monatliche Miete anzupassen. Sie beträgt ab dem nächsten Ersten …“
Eine Unverschämtheit, dachte sie, als sie den horrenden Betrag las. Er wollte sie rücksichtslos in den Ruin treiben, wohl um sich dann ihr Atelier billig unter den Nagel reißen zu können. Den geforderten monatlichen Betrag konnte sie nie und nimmer leisten.
„Das formelle Mieterhöhungsschreiben meines Anwalts geht dir in Kürze zu“, ging die Mail weiter und endete ohne die übliche Grußformel.
Wütend schob sie den Laptop von sich und legte den Kopf in ihre auf der Schreibtischplatte verschränkten Arme. Das Lagerhaus – es war eher ein Schuppen – war für ihr Atelier unverzichtbar, weil dort all die Dinge lagerten, für die ihr stadtnahes Atelier keinen Platz mehr hatte. Trotzdem: Niemals würde sie die geforderte Wuchermiete bezahlen. Andererseits: Sich zu demütigen und Marrasse um eine niedrigere Miete zu bitten, das kam überhaupt nicht in Frage. Lieber verzichtete sie auf den Lagerraum. Sie würde schon irgendwie zurechtkommen – auch ohne den Schuppen. Trotzig und immer noch wütend zog sie den Laptop wieder heran, klickte auf „Antworten“ und hackte in die Tastatur:
„Monsieur! Da ich nicht gewillt bin, die geforderte Wuchermiete zu bezahlen, kündige ich den Lagerraum fristlos mit sofortiger Wirkung. Das formelle Kündigungsschreiben geht Ihnen per eingeschriebenem Brief zu.“
Sie beendete die Mail mit der ins Unfreundliche modifizierten üblichen Grußformel:
„Recevez, Monsieur, l’expression de mes sentiments extrêmement inamicaux – mit äußerst unfreundlichen Grüßen.“
Trotzig und stolz über ihre harsche Reaktion klappte sie den Laptop zufrieden zu.
Donnerstag, neunter März
„Also, das ganze Gerümpel hier muss raus. Das Dach muss etwas angehoben werden. Dann will ich an der hinteren Wand ein Hochregal für das Rohmaterial haben. Links kommen Regale hin und rechts die Brennöfen. Und in der Mitte muss eine ausreichend breite Bahn für den Gabelstapler bleiben. Wie Sie das im Detail hinbekommen, das ist Ihre Aufgabe. Sie sind schließlich Architekt.“
„Architecte d’intérieur, Innenarchitekt“, korrigierte der Angesprochene. „Aber, monsieur Marrasse, für die Anhebung des Daches brauchen wir einen Statiker. Das darf ich nicht machen. Dazu bin ich nicht befugt. Außerdem muss das behördlich genehmigt werden.“
„Dann suchen Sie einen und kümmern sich um die Genehmigung! Ich habe genug Arbeit am Hals und kann mich nicht auch noch darum kümmern.“
Jacques Marrasse schob die schwere Schiebetür der Lagerhalle hinter sich zu und deutete zur Rückseite des langen Raumes. „Wenn das Zeug da weg ist, dann können Sie dort hinten anfangen.“
„Wann genau?“
„Eigentlich sofort. Die bisherige Nutzerin hat den Mietvertrag fristlos gekündigt. Sie können also hier walten und schalten, wie Sie es für nötig halten. So, jetzt gehen wir nach hinten.“
Die beiden bahnten sich einen Weg an alten Holzregalen und allerlei herumliegenden Dingen vorbei zum rückwärtigen Teil des Raumes.
„Diese alten Holzplanken müssen auch raus. Ich will einen durchgehend glatten Betonboden haben.“ Marrasse deutete auf die teilweise morschen Bretter, die mit großen Zwischenräumen am Boden verlegt waren.
„Hé Pierre, was machst du hier?“, rief er erstaunt aus, als er seinen Geschäftsführer hinter einem mit unglasierten Tonkrügen gefüllten Regal am Boden sitzen sah. „Hast du nichts Besseres zu tun, als hier faul herumzusitzen?“
Da Pierre Simard nicht reagierte, ging Marrasse zu ihm.
„Bist du wieder mal besoffen?“ schimpfte er und stupste ihn an der Schulter. Der Geschäftsführer und künftige Inhaber des Atélier Marrasse gab keine Antwort. Stattdessen kippte sein Körper langsam zur Seite und landete rücklings auf den Bodenplanken. Verärgert bückte sich Marrasse und zog seinen Nachfolger wieder hoch.
„Vielleicht sollte ich ihm mein Geschäft doch nicht überschreiben, wenn er so viel säuft“, dachte er.
„Monsieur Marrasse, sehen Sie, das ist … da… da ist Blut!“ Erschrocken deutete der Innenarchitekt auf die Brust des Geschäftsführers. „Er hat sich verletzt und ist ohnmächtig geworden. Wir müssen einen Arzt holen.“
Jacques Marrasse schaute erst zweifelnd zu seinem Begleiter, dann wandte er sich wieder seinem Geschäftsführer zu und sah sich die angebliche Verletzung an, öffnete schließlich den Reißverschluss der Strickjacke von Simard, sah den deutlich größeren Blutfleck auf dem weißen T-Shirt, schob dieses nach oben und betrachtete die Wunde. Er schüttelte den Kopf.
„Der ist nicht ohnmächtig! Der ist tot. Erschossen. Das ist eindeutig eine Einschusswunde. Ich bin Jäger. Ich weiß wie Schusswunden aussehen. Wir brauchen keinen Arzt, sondern die Gendarmerie.“
Er ließ den Toten behutsam wieder in die liegende Position zurück gleiten und zog dann sein Handy aus der Innentasche seines Sakkos.
„Merde! Kein Netz“, schimpfte er nach einem Blick auf das Display. „Stimmt! Hier draußen ist ja ein Funkloch. Ich fahr schnell ins Dorf. Sie bleiben hier und halten Wache.“
***
Es dauerte keine Viertelstunde, bis Jacques Marrasse mit seinem Landrover wieder zur Lagerhalle zurückkam. Der Innenarchitekt lehnte draußen neben dem Schiebetor an der Hauswand.
„Wieso sind Sie nicht bei Simard drinnen geblieben?“
„Ich … ich … kann das nicht. Ne… neben einer Leiche!“
„Schwächling!“, dachte Marrasse. Laut sagte er: „Meinetwegen! Dann bleiben Sie draußen. Ich geh rein und halte die Stellung bis die Gendarmen da sind.“ Nach diesen Worten verschwand er in der Halle und schob das Tor hinter sich wieder zu.
***
Nach einer weiteren Viertelstunde näherten sich zwei Gendarmeriefahrzeuge mit Blaulicht und gellenden Sirenen. Sie stoppten so abrupt, dass sie tiefe Bremsspuren im Kies hinterließen.
„Hier soll ein Ermordeter liegen. Wo ist er?“, rief ein Gendarm, offensichtlich der Einsatzleiter, nachdem er aus dem ersten der beiden Fahrzeuge gesprungen war und die Wagentür hinter sich hatte weit offenstehen lassen.
„Und wo ist Jacques?“
Auf den fragenden Blick des Innenarchitekten, der immer noch an der Hauswand lehnte, bellte er:
„Jacques Marrasse. Der hat einen Mord gemeldet.“
„D… d… drinnen!“, stotterte der eingeschüchterte Bauplaner.
„Pascal, du kommst mit rein“, befahl der Gendarm einem seiner Untergebenen. „Die anderen sichern das Terrain.“
Mit gezogener Waffe schwärmten vier Gendarmen aus und umstellten das Gebäude, während der Chef und sein subordonné das Schiebetor öffneten und vorsichtig die Halle betraten – beide ebenfalls mit gezogener Dienstwaffe.
„Hé Yves! Hier hinten!“, rief Marrasse dem Obergendarmen zu. „Die Pistolen könnt ihr wegstecken. Hier bin nur ich … und die Leiche“, fügte er hinzu. „Der Mörder ist längst weg.“
„Lieutenant Yves Colobert und sein adjudant verstauten ihre Waffen wieder in den Holstern und gingen zu Marrasse und der Leiche im rückwärtigen Teil der Lagerhalle.
Der Leutnant begrüßte Jacques Marrasse mit Handschlag. Die beiden schienen sich gut zu kennen. Dann wandte er den Blick dem Toten zu.
„Kennst du den?“
„Mais oui! Das ist Pierre Simard, mein Geschäftsführer. Kommende Woche wollte ich ihm mein Unternehmen überschreiben.“
„Er wurde erschossen, sagtest du am Telefon. Hast du oder der Typ draußen was angerührt? Wer ist das übrigens?“
„Das ist mein Architekt. Die Halle hier gehört mir, das weißt du doch. Er soll den Umbau leiten. Natürlich habe ich Pierre angefasst.“ Marrasse deutete auf den Toten.
„Ich dachte erst, er ist stockbesoffen und ich habe ihm einen Schubs gegeben. Davon ist er umgekippt und ich hab ihn wieder hochgezogen und hingesetzt – so wie wir ihn auch vorgefunden haben. Da wusste ich noch nicht, dass er ermordet worden ist.“
„Wie kommst du überhaupt auf Mord?“
Marrasse zog wieder den Reißverschluss der Jacke auf und schob das weiße T-Shirt zur Seite.
„Da! Eindeutig eine Schusswunde.“
Der Gendarm nickte überzeugt.
„Wir brauchen die Spurensicherung“, meinte er nach einer Weile. „Merde! Jetzt hast du alles angefasst. Das mögen die überhaupt nicht.“
„Aber ich hab doch nachsehen müssen, ob er noch lebt und ob ich ihm helfen kann. Das geht nicht ohne Berühren.“
„Ja, das stimmt“, gab der lieutenant zu. „Sag mal, habt ihr eine Waffe gesehen? Oder Patronenhülsen?“
„Non! Aber daran haben wir gar nicht gedacht. Wir waren zu schockiert von der Leiche.“
Lieutenant Colobert ließ den Blick suchend über den Boden im Umfeld des Toten schweifen, sah aber nichts dergleichen.
„Da liegt nichts. Seine Waffe hat der Mörder wieder mitgenommen. Und die Patronenhülsen hat er wohl auch gesucht und eingesteckt. Aber vielleicht hat er nicht alle gefunden. Warten wir auf die Kollegen von der gendarmerie technique et scientifique. Die sollen sich darum kümmern. Pascal“, befahl er seinem jüngeren Kollegen, „funk die an und sag ihnen, sie sollen den Gerichtsarzt mitbringen.“
Er wandte sich wieder seinem Freund Marrasse zu:
„Das dauert, bis die von Manosque hier sind. In der Zeit könnten wir etwas Essen gehen. Im Belvedère gleich an der Brücke haben sie einen preiswerten plat du jour. Kommst du mit?“
„D’accord! Aber was machen wir mit Simard?“ Marrasse deutete auf den Toten.
„Meine Leute bleiben hier. Pascal!“, rief er seinem brigadier zu. „Ich geh mit Jacques schnell was Essen. Wenn die Kollegen von der Technik kommen, erklär ihnen alles. Die wissen dann schon, was sie zu tun haben. Wir sind in einer halben Stunde wieder zurück.“
***
Es hatte dann doch etwas länger gedauert bis lieutenant Yves Colobert und der faïencier Jacques Marrasse ihr Mittagsmahl beendet hatten. Die angenehme Atmosphäre im Restaurant hatte ihnen so gefallen und vor allem hatte ihnen der plat du jour, ossobuco à la provençal mit ratatouille und pommes frites so gut geschmeckt, dass sie noch ein Dessert bestellt und anschließend einen café und einen Cognac getrunken hatten. Es war fast drei Uhr, als sie wieder zu Adéline Lautiers früherer Lagerhalle zurückkamen. Die Beamten der Spurensicherung waren mitten unter der Arbeit und der Gerichtsmediziner, docteur Pastrellon, untersuchte die Leiche.
„Lieutenant Colobert, kommen Sie mal her“, rief einer der Beamten von der gendarmerie scientifique. „Schauen Sie, was wir entdeckt haben.“ Er zeigte dem erstaunten Leutnant einen durchsichtigen Plastikbeutel mit einem Revolver darin.
„Ein Manurhin-Revolver vom Typ MR73. Eine französische Waffe. Ein etwas älteres Baujahr, das früher von der Gendarmerie und heute noch gerne von Jägern, speziell für den Fangschuss, genutzt wird“, erklärte er.
„Wo lag der? Meine Männer haben keine Waffe am Tatort gefunden. Jacques, du oder dein Architekt, ihr habt doch auch keinen Revolver gesehen, als ihr den Simard entdeckt habt?“
Jacques Marrasse war nähergetreten und beäugte die Waffe in dem Asservatenbeutel neugierig.
„Nein, da war nichts. Das hab ich dir doch schon gesagt. Wo haben Sie den entdeckt?“, fragte er den Spurensicherer.
„Der war in eine breite Fuge zwischen zwei Bodenplanken gerutscht und lag halb verborgen in einem Hohlraumunter einer Planke. Wir haben ihn schon auf Fingerabdrücke untersucht.“
„Und?“
„Also, da waren nur Prints von einer Person drauf – und zwar vom Toten hier. Es spricht viel dafür, dass er vorher sorgfältig abgewischt worden war, bevor er ihn in die Hand genommen hat. Wir haben Baumwollfusseln am Abzug gefunden.“
„Und was heißt das?“ fragte lieutenant Colobert.
„Nun – für mich sieht das nach Selbstmord aus“, mutmaßte der Techniker von der Spurensicherung. „Ich nehme an, dass der Mann“, dabei zeigte er mit der Hand auf den Toten, „diese Waffe schon länger im Besitz hatte, sie aufbewahrt und sorgfältig gepflegt hat. Daher das Abwischen und die Baumwollfasern. Und als er sich umbringen wollte, hat er den Revolver in die Hand genommen. Die frischen Schmauchspuren an der Trommel beweisen, dass vor kurzem ein Schuss abgefeuert worden ist. Man riecht das übrigens auch. Nach dem Schuss ist ihm die Waffe aus der Hand gefallen und in die Bodenfuge geglitten. Meines Erachtens eindeutig ein Selbstmord.“
„Okay!“, meinte lieutenant Colobert. „Das klingt logisch.“
Jacques Marrasse schüttelte den Kopf.
„Es könnte doch auch so gewesen sein: Der Mörder erschießt meinen Geschäftsführer, wischt dann die Waffe ab und drückt sie dem Toten in die Hand. Daher die Fingerprints. Und dann platziert er den Revolver so, dass es aussieht, als wäre er ihm aus der Hand geglitten. Außerdem: Es ist ja nicht gesagt, dass es ein Mann ist. Es kann genauso gut eine Frau gewesen sein – eine Mörderin!“
„Jetzt schießt du aber übers Ziel hinaus“, bremste der Leutnant seinen Freund. „Außerdem: Wenn Frauen morden, dann meistens mit Gift und nicht mit schweren, großkalibrigen Revolvern. Ich denke auch, es ist Selbstmord. Schließlich meint das auch der Kollege von der gedarmerie scientifique. Fragen wir doch den Arzt, was er dazu sagt.“
„Ich neige auch zur Selbstmordthese““, wandte sich docteur Pastrellon, der diesen Disput verfolgt hatte, an den leitenden Gendarmen und unterbrach seine vorläufige Untersuchung des Toten.