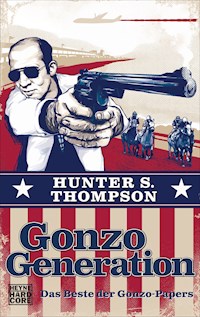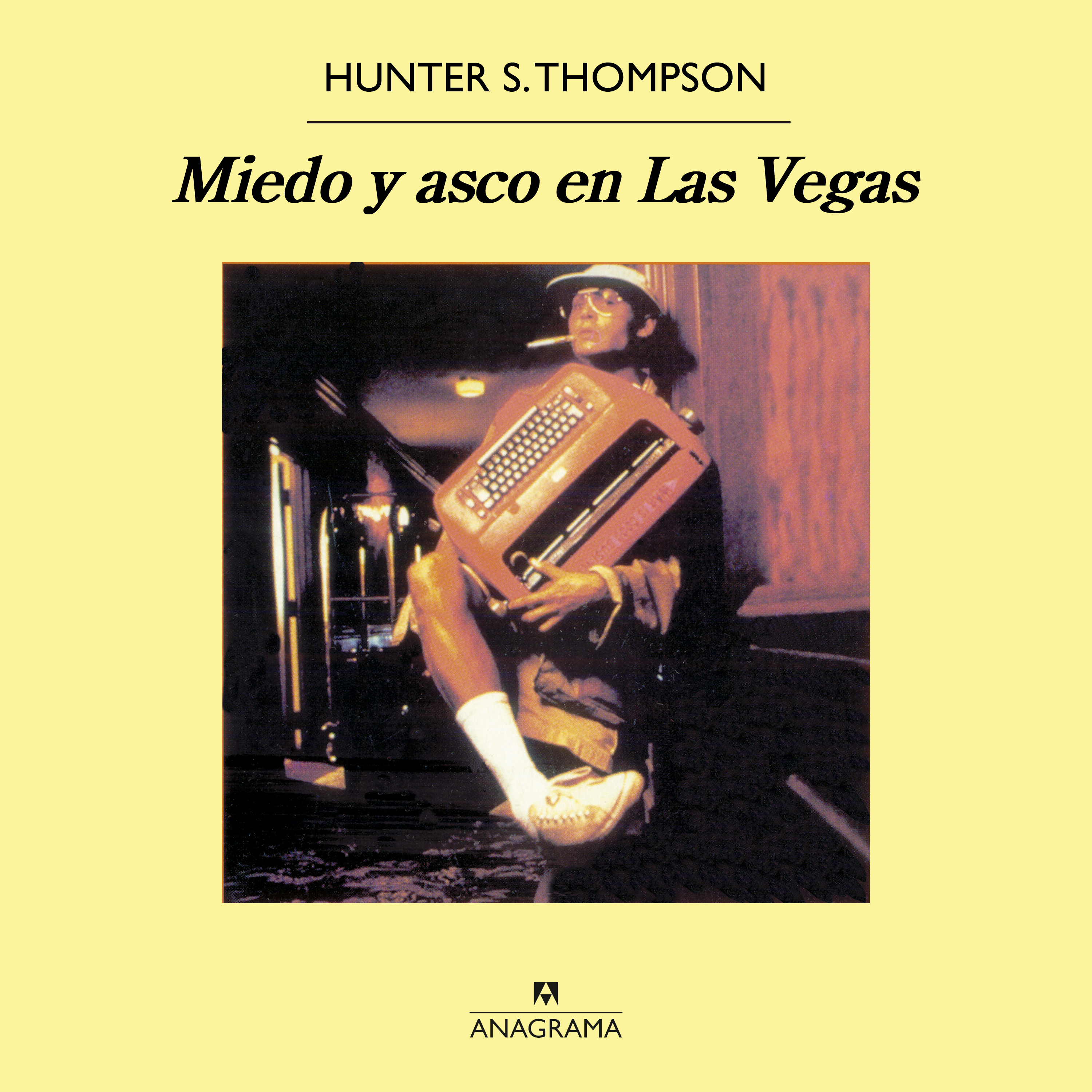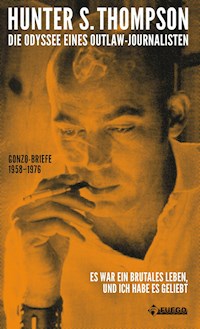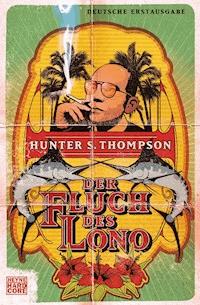
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Endlich! Hunter S. Thompsons legendäres Meisterwerk jetzt in deutscher Sprache
Hunter S. Thompson erhält den Auftrag, über den Honolulu-Marathon zu berichten: für ihn in erster Linie ein bezahlter Urlaub. Doch wie immer bei Thompson entwickelt sich die Reise zu einem durchgeknallten Trip, in den neben dem Marathon-Wahnsinn auch Surfer, Orkane, ein Riesen-Marlin und natürlich der hawaiianische Gott Lono irgendwie verwickelt sind. Der König des Gonzo-Journalismus beweist einmal mehr seine Meisterschaft: ein halluzinogenes Vergnügen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Ähnliche
ZUM BUCH
Im Auftrag des Magazins Running fliegt Hunter S. Thompson nach Hawaii, um über den Honolulu-Marathon zu berichten. Thompson widmet sich zunächst vor allem dem Beschaffen diverser Rauschmittel und erlebt den Marathon dann auf die ihm eigene Weise. Versorgt mit tragbaren Fernsehern, Strandschirmen, kistenweise Bier und Whisky, lauter Musik und bedröhnten Frauen kampiert er an der Laufstrecke – was seiner entlarvenden Analyse des Marathon-Rummels keinen Abbruch tut.
Danach nimmt das Chaos unweigerlich seinen Lauf. Als Hawaii von einem Hurrikan heimgesucht wird, sitzt Thompson fest. Unter dem Einfluss von Margaritas und Marihuana überwindet er sein anfängliches Gefühl der Entfremdung und gerät mehr und mehr in den Bann Hawaiis. Im halluzinogenen Rausch baut er Bomben, macht das idyllische Städtchen Kona unsicher und begibt sich auf LSD-getränkte Tauchtrips. Als Thompson behauptet, die Reinkarnation des hawaiianischen Gottes Lono zu sein, und damit einen Frevel begeht, wird er schließlich zum meistgesuchten Mann der Insel. Bei all dem Wahnsinn jedoch beweist er seine journalistische Meisterschaft und zeichnet ein faszinierendes Bild Hawaiis. Der Fluch des Lono erschien erstmals 1983 in Amerika und war lange Zeit nicht mehr erhältlich. Jetzt liegt Hunter S. Thompsons rauschhaftes Hawaii-Epos erstmals in deutscher Sprache vor.
ZUM AUTOR
Hunter S. Thompson wurde 1937 in Louisville, Kentucky, geboren. Er begann seine Laufbahn als Sportjournalist, bevor er Reporter für den Rolling Stone und als Begründer des Gonzo-Journalismus zu einer Ikone der Hippiebewegung wurde. Zu seinen wichtigsten Werken gehört neben Hell’s Angels vor allem Angst und Schrecken in Las Vegas, das 1998 von Terry Gilliam mit Johnny Depp und Benicio Del Toro verfilmt wurde. Thompson nahm sich am 20. Februar 2005 in seinem Wohnort Woody Creek, Colorado, das Leben.
Inhaltsverzeichnis
Für meine Mutter,Virginia Ray Thompson
»Now it is not good for the Christian’s health to hustle the Arian brown,
For the Christian riles, and the Arian smiles, and it weareth the Christian down;
And the end of the fight is a tombstone white with the name of the late deceased,
And the epitaph: ›A fool lies here who tried to hustle the East.‹«
RUDYARD KIPLING,The Naulahka
Der romantische Gott Lono
Letzthin habe ich ziemlich viel über den großen Gott Lono geschrieben und darüber, wie Captain Hook in die Rolle dieses Gottes schlüpfte. Nun, da ich mich in Lonos Heimat befinde, auf jener Erde, die vor langer Zeit von seinen grausamen Füßen betreten wurde – es sei denn, die Eingeborenen lügen, und das würden sie wohl kaum tun –, kann ich ebenso gut erzählen, wer er war.
Das Götzenbild, das die Eingeborenen in seinem Namen anbeteten, war ein dünner, ungeschmückter, zwölf Fuß langer Stab. Die prosaische Geschichtsschreibung berichtet, er sei der beliebteste Gott auf der Insel Hawaii gewesen – ein großer König, der für seine Verdienste vergöttlicht worden war –, genauso wie wir unsere Helden belohnen, nur dass wir ihn zweifellos zu einem Postmeister gemacht hätten und nicht zu einem Gott. In einem Wutanfall ermordete er seine Frau, eine Göttin namens Kaikilani Alii. Sein reumütiges Gewissen trieb ihn in den Wahnsinn, und die Überlieferung schenkt uns das einzigartige Bild eines Gottes, der sich auf seiner Wanderschaft »durchboxt«. Denn in seinem nagenden Schmerz wanderte er von Ort zu Ort und kämpfte gegen jeden und rang mit jedem, den er traf. Dieser Zeitvertreib verlor natürlich bald seinen Reiz, insbesondere, weil es vorhersagbar war, dass ein schwacher menschlicher Gegner gegen eine mächtige Gottheit keine Chance hatte und keine Revanche verlangen würde. Deswegen führte Lono einen Wettkampf namensmakahikiein und befahl, dass er zu seinen Ehren abgehalten werden solle. Dann segelte er in einem dreieckigen Floß in fremde Länder, mit dem Versprechen, eines Tages zurückzukehren, und das war das Letzte, was man je von Lono hörte. Er wurde nie wieder gesehen. Vielleicht ist sein Floß gekentert. Doch das Volk erwartete stets seine Wiederkehr und konnte leicht dazu überredet werden, Kapitän Cook als zurückgekehrte Gottheit anzuerkennen.
MARK TWAINPost aus Hawaii
DER AUFTRAG
23. Mai 1980
Hunter S. Thompson c/o General Delivery Woody Creek, CO
Lieber Hunter,
um eine längere Epistel auf ein paar Zeilen zu reduzieren: Wir möchten, dass Sie für uns über den Honolulu-Marathon schreiben. Wir kommen für sämtliche Spesen auf und zahlen ein exzellentes Honorar. Bitte melden Sie sich.
Lassen Sie’s sich durch den Kopf gehen. Wäre doch eine schöne Gelegenheit, mal Urlaub zu machen.
Mit freundlichen Grüßen,
Paul Perry
Herausgeber, Running Magazin
Owl Farm25. Oktober 1980
Lieber Ralph,
ich schätze, diesmal haben wir einen dicken Fisch an der Angel, alter Sportsfreund. Ein Strohkopf namens Perry oben in Oregon will uns ein Weihnachtsgeschenk machen: einen Monat auf Hawaii. Wir brauchen nur über den »Honolulu-Marathon« zu berichten. Und zwar für seine Zeitschrift, die sich Running schimpft …
Ja, ja, ich weiß, was Du denkst, Ralph. Du marschierst in der Kommandozentrale des Old Loose Court auf und ab und fragst Dich: »Warum ich? Und warum gerade jetzt? Wo ich doch dabei bin, zum ehrbaren Bürger zu werden?«
Machen wir uns doch nichts vor, Ralph: Zum ehrbaren Bürger kann jeder werden, besonders in England. Aber bei weitem nicht jeder wird dafür bezahlt, wie eine gesengte Sau 26 Meilen bei einem irrwitzigen Medienrummel-Rennen mitzulaufen, das sie den »Honolulu-Marathon« nennen.
Wir sind beide für diese Veranstaltung angemeldet, Ralph, und ich bin zuversichtlich, dass wir gewinnen können. Wir müssen zwar ein bisschen trainieren, aber das hält sich in Grenzen.
Hauptsache ist, dass wir als registrierte Teilnehmer laufen und auf den ersten drei Meilen ein Mordstempo vorlegen. Diese Fitnessnazis haben das ganze Jahr lang trainiert, um beim Super Bowl der Marathons Höchstleistungen abzuliefern. Die Veranstalter erwarten 10 000 Teilnehmer, und die Strecke ist 26 Meilen lang; was bedeutet, dass alle das Rennen langsam angehen lassen … 26 Meilen sind nämlich eine höllische Distanz, egal, warum man sie zurücklegen möchte, und alle Profis in diesem Feld werden langsam starten und ihr Tempo während der ersten 20 Meilen sehr sorgfältig dosieren.
Ganz anders wir, Ralph. Wir werden uns wie menschliche Torpedos aus den Startblöcken katapultieren und den Charakter dieser Laufsportart total verändern, indem wir die ersten drei Meilen Schulter an Schulter in weniger als zehn Minuten runterreißen.
Eine solche Rasanz wird ihnen allen Schneid abkaufen, Ralph. Diese Leute sind zum Laufen da, nicht zum Rasen – daher wird es unsere Strategie sein, während der ersten drei Meilen zu flitzen wie die Höllenhunde. Ich schätze, wir sind in der Lage, uns so hemmungslos hochzuputschen, dass wir die Stoppuhren am Drei-Meilen-Kontrollpunkt bei ungefähr 9,55 Minuten passieren … was uns so weit vor das gesamte Teilnehmerfeld bringt, dass wir nicht mal mehr zu sehen sind. Wir sind übern Berg und gehen einsam in Führung, sobald wir das Streckenstück am Ala Moana Boulevard erreichen und immer noch Schulter an Schulter rennen, und zwar mit so irrer Geschwindigkeit, dass selbst den Laufrichtern angst und bange wird … und wir den Rest des Felds so weit abhängen, dass viele Läufer von blinder Wut und fassungsloser Verblüffung heimgesucht werden.
Ich habe Dich auch für das »Pipeline Masters« angemeldet, einen Weltklasse-Surf-Wettbewerb, der am 26. Dezember an der Nordküste von Oahu stattfindet.
Dafür musst Du natürlich noch etwas an Deinem Balancegefühl bei Höchstgeschwindigkeiten feilen, Ralph, denn Du wirst mit bis zu 50 oder gar 75 Meilen die Stunde durch den Wellentunnel rauschen und ganz bestimmt nicht stürzen wollen.
Bei dem Pipeline-Gig werde ich Dir leider nicht zur Seite stehen können, weil mein Anwalt wegen des unvermeidlichen Dopingtests und potenzieller strafrechtlicher Konsequenzen energische Bedenken angemeldet hat.
Beim berüchtigten »Liston Memorial Rooster Fight« steig ich aber wieder ein, denn hier sind die Preisgelder in 1000-Dollar-Schritten gestaffelt – z. B. eine Minute im Käfig mit einem Hahn, und du gewinnst 1000 Dollar … oder fünf Minuten mit einem Hahn bringen 5000 Dollar … und fünf Minuten mit fünf Hähnen 10 000 Dollar … usw.
Das wird ein riskantes Ding, Ralph. Diese hawaiianischen Schlitzerhähne können einen Menschen in Sekundenschnelle zu Hackfleisch machen. Ich trainiere hier zu Hause bereits mit meinen Pfauen – sechs 20-Kilo-Vögel in einem 6 × 6 Fuß großen Käfig, und ich denke, allmählich hab ich die Kampftechnik drauf.
Es wird Zeit, ihnen allen wieder in die Ärsche zu treten, Ralph, selbst wenn es bedeutet, den Ruhestand kurz zu unterbrechen und sich nochmal der Öffentlichkeit zu stellen. Ich brauche ohnehin eine kleine Auszeit – aus juristischen Gründen –, und daher möchte ich, dass dieser Gig ganz friedlich und harmlos verläuft, und mein Herz sagt mir, dass es so sein wird.
Keine Sorge, Ralph. Mit dieser Nummer werden wir den einen oder anderen ziemlich verblüffen. Unser Hauptquartier hab ich schon klargemacht: zwei Häuschen mit einem 50-Meter-Pool am Meeresufer, ganz in der Nähe des Alii Drive in Kona, wo die Sonne niemals untergeht.
OKHST
DER BLAUE ARM
San Francisco lag ungefähr 40 Minuten hinter uns, als die Crew sich endlich entschloss, das Problem in Toilette 1B anzugehen. Seit wir abgehoben hatten, war die Tür ununterbrochen verriegelt gewesen, und jetzt hatte die Chefstewardess den Copiloten aus dem Cockpit herbeigerufen. Er stand plötzlich direkt neben mir im Gang und hielt ein merkwürdiges schwarzes Gerät in der Hand, das aussah wie eine Taschenlampe mit Propellerblättern oder eine Art Schlagbohrmaschine. Er nickte gelassen, während er dem eindringlichen Flüstern der Stewardess lauschte. »Ich kann zwar mit ihm sprechen«, sagte sie und wies mit einem langen roten Fingernagel auf das »Besetzt«-Zeichen an der geschlossenen Toilettentür. »Aber ich krieg ihn da nicht raus.«
Der Kopilot nickte nachdenklich und kehrte den Passagieren den Rücken zu, während er irgendwelche Einstellungen an seinem martialischen Werkzeug vornahm. »Weiß man, wer er ist?«, fragte er.
Sie warf einen Blick auf ihr Klemmbrett mit der Passagierliste. »Mister Ackerman«, sagte sie. »Adresse: Box 99, Kailua-Kona.«
»Die Große Insel«, sagte er.
Sie nickte, während sie immer noch ihr Klemmbrett studierte. »Mitglied im Red Carpet Club«, sagte sie. »Vielflieger, bisher völlig unauffällig … in San Francisco an Bord gegangen, Hinflug erster Klasse nach Honolulu. Ein perfekter Gentleman. Keine Anschlussflüge gebucht.« Sie fuhr fort: »Keine Hotelreservierungen, kein Mietwagen …« Sie zuckte die Achseln. »Sehr höflich, nüchtern, entspannt …«
»Tja«, sagte er. »Die Sorte kenne ich.« Der Pilot musterte kurz sein Werkzeug und hob dann die andere Hand, um laut an die Tür zu klopfen. »Mister Ackerman«, rief er. »Hören Sie mich?«
Es kam keine Antwort, aber ich saß dicht genug an der Tür, um von drinnen Geräusche zu hören: zuerst ein Toilettensitz, der aufs Becken schlug, dann Wasserrauschen …
Ich kannte Mr. Ackerman nicht, aber ich erinnerte mich, ihn gesehen zu haben, als er an Bord kam. Er sah aus wie ein Mann, der irgendwann in Hongkong Tennisprofi gewesen war und sich anschließend lukrativeren Geschäften zugewandt hatte. Die goldene Rolex, die Safarijacke aus weißem Leinen, die thailändische Goldkette um seinen Hals, der schwere lederne Aktenkoffer mit Kombinationsschlössern … das waren nicht die äußeren Attribute eines Mannes, der sich unmittelbar nach dem Start auf der Toilette einschließt und nach fast einer Stunde immer noch nicht herausrührt.
Das ist definitiv zu lange, egal, auf welchem Flug. Wer sich so aufführt, provoziert Fragen, die schließlich kaum mehr zu ignorieren sind – besonders im geräumigen Erste-Klasse-Abteil einer 747 auf einem fünfstündigen Flug nach Hawaii. Leute, die für ein Ticket derart viel Geld hinblättern, können sich keinesfalls mit dem Gedanken anfreunden, vor der einzigen benutzbaren Toilette Schlange zu stehen, während in der anderen etwas definitiv Unerquickliches vorgeht.
Zu diesen Leuten zählte auch ich … In meinen Augen berechtigte mich mein geschäftliches Übereinkommen mit United Airlines, jederzeit problemlos eine mit einem Türschloss ausgestattete Blechzelle zur persönlichen Hygiene nutzen zu können. Schließlich hatte ich sechs Stunden im Red Carpet Room im Flughafen von San Francisco verbracht, um dieses Ticket zu ergattern, hatte mich an Schaltern auf Streitgespräche einlassen müssen, eine ganze Menge getrunken und mich ständig seltsamer Erinnerungen erwehrt, die mich in Wellen heimsuchten …
So ungefähr auf halber Strecke zwischen Denver und San Francisco hatten wir beschlossen, umzusteigen und die nächste Etappe in einer 747 zurückzulegen. Die DC-10 ist ja ganz nett für kurze Strecken und kleine Schläfchen, aber bei Langstreckenflügen eignet sich die 747 für einen freischaffenden Profi weitaus besser: Sie bietet eine Lounge auf dem Oberdeck, die man nur über eine Wendeltreppe aus dem Erste-Klasse-Abteil erreicht – eine Art Salon mit tiefen Sesseln, hölzernen Kartentischen und einer separaten Bar. Zwar geht man beim Umsteigen das Risiko ein, sein Gepäck zu verlieren und einen qualvollen Zwangsaufenthalt im Flughafen von San Francisco ertragen zu müssen … aber ich brauchte Platz zum Arbeiten, um mich ein wenig auszubreiten und vielleicht sogar langzumachen.
Ich plante, mir in dieser Nacht sämtliche Quellen über Hawaii anzusehen, die ich mir beschafft hatte. Da gab es Memos und Pamphlete, die ich lesen wollte – und sogar Bücher. Ich hatte Houghs The Last Voyage of Captain James Cook dabei, The Journal of William Ellis und Mark Twains Post aus Hawaii – dicke Wälzer und lange Traktate: »The Island of Hawaii«, »Kona Coast Story«, »Pu’uhonua o Honaunau«. Und noch jede Menge mehr.
»Du kannst nicht einfach hier rauskommen und nur über den Marathon schreiben«, hatte mir mein Freund John Wilbur vorgehalten. »An Hawaii ist verdammt viel mehr dran als die 10 000 Japse, die beim Marathon an Pearl Harbor vorbeiflitzen. Aber komm unbedingt«, sagte er. »Diese Inseln stecken voller Rätsel, vergiss einfach Don Ho und den ganzen Touristenhumbug – hier gibt’s so viel zu entdecken, von dem die meisten Leute keine Ahnung haben.«
Wunderbar, dachte ich – Wilbur ist wahrhaft weise. Jeder, der freiwillig die Washington Redskin hinter sich lässt und in ein Strandhaus auf Honolulu zieht, muss einen Lebenssinn entdeckt haben, der mir bisher verborgen geblieben ist.
Genau. Ran an die Rätsel. Und zwar sofort. Alles, was sich durch Eruptionen aus den Tiefen des Pazifiks selbst erschaffen kann, ist näherer Betrachtung wert.
Nach sechs Stunden verwirrten Scheiterns und alkoholisierter Kopflosigkeit war es mir schließlich doch gelungen, zwei Plätze für den letzten 747-Flug des Tages nach Honolulu zu ergattern.
Jetzt brauchte ich einen Ort, um mich zu rasieren, mir die Zähne zu putzen, um vielleicht auch nur einen Moment dazustehen, in den Spiegel zu sehen und zu überprüfen, wer mich wohl daraus anblicken würde.
Vermutlich ist ein rein privater Ort irgendeiner Art in einer Zehn-Millionen-Dollar-Flugmaschine weder ökonomisch noch sonst wie zu rechtfertigen. Das Risiko ist einfach zu groß.
Klar. Kann man ja verstehen. Zu viele Leute – wie zum Beispiel frühzeitig in den Ruhestand versetzte Stabsfeldwebel – haben versucht, sich in diesen kleinen Blechzellen in Brand zu stecken … zu viele Psychotiker und halbirre Drogensüchtige haben sich darin eingeschlossen, einen Haufen Pillen runtergewürgt und dann versucht, sich durch die lange blaue Röhre wegzuspülen.
Der Copilot klopfte mit der Faust energisch an die WC- Tür. »Mister Ackerman! Ist alles in Ordnung?«
Er zögerte und rief dann nochmals. Diesmal wesentlich lauter. »Mister Ackerman! Hier spricht Ihr Kapitän. Fühlen Sie sich nicht wohl?«
»Was?«, fragte eine Stimme von drinnen.
Die Stewardess beugte sich näher zur Tür. »Wir können das ohne weiteres zu einem medizinischen Notfall erklären, Mister Ackerman – dann sind wir befugt, Sie innerhalb von 30 Sekunden da herauszuholen.« Sie lächelte Captain Goodwrench triumphierend zu, als die Stimme sich unmittelbar darauf wieder meldete.
»Mir geht es gut«, erklärte der Mann. »In einer Minute bin ich draußen.«
Der Copilot trat zurück und beobachtete die Tür. Drinnen bewegte sich etwas – doch sonst geschah nichts, bis auf das Geräusch fließenden Wassers.
Inzwischen reagierten sämtliche Passagiere der ersten Klasse alarmiert auf die Krisensituation. »Holt den Irren da raus!«, rief ein alter Mann. »Vielleicht hat er eine Bombe!«
»O mein Gott!«, schrie eine Frau. »Womöglich ist er bewaffnet!«
Der Copilot zuckte zusammen und wandte sich den Passagieren zu. Er deutete mit seinem Werkzeug auf den alten Mann, der immer hysterischer wurde. »Sie da!«, fauchte er. »Halten Sie die Klappe! Ich regle das hier.«
Plötzlich öffnete sich die Tür, und Mr. Ackerman trat heraus. Er schlüpfte schnell in den Gang und lächelte die Stewardess an. »Tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten«, sagte er. »Jetzt ist frei.« Er zog sich durch den Gang zurück, die Safarijacke lässig über dem Arm, den sie jedoch nicht ganz verbarg.
Von meinem Platz aus konnte ich erkennen, dass der Arm, den er vor der Stewardess zu verstecken suchte, bis hinauf zur Schulter knallblau war. Bei diesem Anblick kauerte ich mich nervös in den Sitz. Auf den ersten Blick hatte ich Mr. Ackerman gemocht, denn er wirkte wie ein Mann, der eventuell meine Vorlieben teilte … aber jetzt sah er nach Ärger aus, und ich war bereit, ihn bereits aus dem nichtigsten aller Anlässe wie ein Maultier in die Eier zu treten. Mein ursprünglicher Eindruck hatte sich total verflüchtigt. Dieser Gimpel, der sich so lange auf der Toilette eingeschlossen hatte, bis einer seiner Arme blau angelaufen war, konnte nicht derselbe kultivierte und in Leinen gekleidete pazifische Segler sein, der in San Francisco unser Flugzeug bestiegen hatte.
Die meisten Passagiere waren glücklich und zufrieden, weil der problematische Toilettenbesetzer friedlich herausgekommen war: keine Spur von einer Waffe, keine mit Klebeband an die Brust gehefteten Dynamitstangen, keine unverständlichen Terroristenslogans und auch keine Drohungen, den Leuten die Kehle aufzuschlitzen … Der alte Mann grummelte immer noch leise und vermied es, Ackerman nachzusehen, der weiter den Gang zu seinem Sitz entlanglief. Sonst schien sich niemand größere Gedanken zu machen.
Der Copilot jedoch musterte Ackerman mit einer Miene puren Entsetzens. Er hatte den blauen Arm gesehen – ebenso wie die Stewardess, die keinen Ton hervorbrachte. Ackerman versuchte immer noch, den Arm unter der Safarijacke verborgen zu halten. Keiner der anderen Passagiere hatte etwas bemerkt – oder wenn doch, wussten sie nicht, was es zu bedeuten hatte.
Aber ich wusste es, und die glotzäugige Stewardess ebenfalls. Der Copilot bedachte Ackerman mit einem letzten vernichtenden Blick und schüttelte sich betont angeekelt, bevor er sein martialisches Werkzeug zusammenklappte und ging. Auf dem Weg zur Wendeltreppe, die nach oben zum Cockpit führte, hielt er direkt neben mir inne und flüsterte Ackerman zu: »Du mieser Dreckskerl, lass dich nie wieder auf einem meiner Flüge erwischen.«
Ackerman nickte höflich und glitt dann in seinen Sitz, ganz in meiner Nähe auf der anderen Seite des Gangs. Ich stand schnell auf und machte mich mit meinem Rasierzeug auf den Weg zur Toilette – und nachdem ich mich sicher verbarrikadiert hatte, klappte ich zunächst sorgfältig den Toilettendeckel zu, bevor ich irgendetwas anderes tat.
Es gibt nur eine Möglichkeit, sich in einer Höhe von 38 000 Fuß über dem Pazifik in einer 747 den Arm blau zu färben. Aber die Wahrheit ist so abwegig und unwahrscheinlich, dass selbst erfolgreiche Flugmeilensammler kaum je damit konfrontiert wurden – und die wenigen Ausnahmen sprechen verständlicherweise nicht gerne darüber.
Das starke Desinfektionsmittel, das die meisten Fluglinien für ihre Toilettenspülung benutzen, ist eine chemische Verbindung mit dem Namen Dejerm, die strahlend blau leuchtet. Nur ein einziges Mal zuvor hatte ich einen Mann mit blauem Arm aus einer Flugzeugtoilette kommen sehen: auf einem Langstreckenflug von London nach Zaire, unterwegs zum Ali-Forman-Kampf. Ein britischer Korrespondent von Reuters war auf die Toilette gegangen und hatte es irgendwie geschafft, seinen einzigen Schlüssel für das Telexgerät von Reuters in Kinshasa in die Aluminiumschüssel fallen zu lassen. Er kam 30 Minuten später wieder heraus, und für die restliche Strecke nach Zaire hatte er eine ganze Sitzreihe für sich allein.
Es war fast Mitternacht, als ich Toilette 1B verließ und zu meinem Sitz zurückkehrte, um mein Recherchematerial zusammenzusammeln. Das Deckenlicht war ausgeschaltet und die anderen Passagiere schliefen. Es war Zeit, sich nach oben in die Lounge zu begeben und etwas Arbeit zu erledigen. Der Honolulu-Marathon würde nur einen Teil der Story bilden. Der Rest würde sich mit Hawaii selbst beschäftigen, ein Thema, über das nachzudenken, ich bisher keinen Grund gehabt hatte. Ich trug eine Literflasche Wild Turkey in meiner Umhängetasche bei mir und wusste, dass es in der Oberdeckbar massenweise Eiswürfel gab – und dass man dort nachts üblicherweise ungestört war.
Diesmal war es anders. Als ich oben an der Wendeltreppe ankam, sah ich Mr. Ackerman, meinen Mitreisenden, auf einem der Sofas nahe der Bar friedlich schlafen. Als ich auf dem Weg zu einem der hinteren Tische an ihm vorbeikam, wachte er auf. In seinem erschöpften Lächeln bemerkte ich einen Anflug des Wiedererkennens.
Im Vorübergehen nickte ich beiläufig. »Hoffe, Sie haben es gefunden«, sagte ich.
Er sah zu mir auf. »Ja«, erwiderte er. »Natürlich.«
Zu dem Zeitpunkt befand ich mich bereits drei Meter hinter ihm und stapelte mein Material auf dem großen Kartentisch. Was immer es gewesen war, ich wollte nichts davon wissen. Er hatte seine Probleme, und ich hatte meine. Ich hatte gehofft, das Oberdeck in diesen Stunden für mich allein zu haben, aber Mr. Ackerman hatte sich offenbar für die Nacht hier eingerichtet. Es war der einzige Ort im Flugzeug, an dem seine Anwesenheit keine Entrüstung hervorrief. Da er also eine Weile in meiner Nähe sein würde, fand ich, wir sollten uns miteinander arrangieren.
Ein strenger Geruch nach Desinfektionsmittel hing in der Luft. Die gesamte Lounge roch wie das Untergeschoss eines drittklassigen Krankenhauses. Ich öffnete sämtliche Lüftungsventile über meinem Sitz und breitete mein Material auf dem Tisch aus. Ich versuchte mich zu erinnern, ob der britische Korrespondent bei seinem Erlebnis Schmerzen erlitten oder Verletzungen davongetragen hatte, aber mir fiel nur ein, dass er während des gesamten Aufenthalts in Zaire ausschließlich langärmelige Hemden getragen hatte. Keine Fleischwunden, keine Giftstoffe im Nervensystem, aber drei Wochen in der Hitze des Kongo hatten einen gruseligen Pilz auf seinem Arm wuchern lassen, und als ich ihn zwei Monate später in London sah, schimmerte seine Hand noch immer auffällig blau.
Ich ging an die Bar und holte mir Eis für meinen Drink. Auf dem Rückweg an den Tisch fragte ich: »Wie geht’s Ihrem Arm?«
»Ist blau«, erwiderte er. »Und juckt.«
Ich nickte. »Das Zeug hat’s in sich. Sie sollten in Honolulu besser zum Arzt gehen.«
Er stemmte sich ein wenig in die Höhe. »Sind Sie denn nicht Arzt?«, fragte er.
»Was?«
Lächelnd zündete er sich eine Zigarette an. »Steht doch auf Ihren Gepäckanhängern«, sagte er. »Dass Sie Arzt sind.«
Ich lachte und blickte hinunter auf meine Tasche. Klar, der Anhänger vom Red Carpet Club verkündete: »Dr. H. S. Thompson.«
»Jesus«, sagte ich. »Stimmt ja. Ich bin Doktor.«
Er zuckte die Achseln.
»Also schön«, sagte ich schließlich, »versuchen wir, das Scheißzeug von Ihrem Arm abzukriegen.« Ich stand auf und bedeutete ihm, mir zu der winzigen, ausschließlich fürs Flugpersonal reservierten Toilette hinterm Cockpit zu folgen. Die folgenden 20 Minuten verbrachten wir damit, seinen Arm mit seifigen Papiertüchern abzuschrubben. Anschließend rieb ich ihn mit Coldcream aus dem Tiegel ein, den ich beim Rasierzeug hatte.
Ein hässlicher roter Ausschlag wie von Giftefeu bedeckte seinen gesamten Arm, Tausende von fiesen kleinen Bläschen … Ich ging zurück zu meiner Tasche, um eine Tube Desenex zu holen und mit der Salbe den Juckreiz zu mildern. Doch es war unmöglich, die blaue Verfärbung loszuwerden.
»Was?«, sagte er. »Das lässt sich nicht abwaschen?«
»Nein«, erwiderte ich. »Zwei Wochen im Salzwasser, und die Farbe könnte vielleicht verblassen. Immer schön hinaus in die Brandung, viel am Strand abhängen.«
Er reagierte verwirrt. »Am Strand?«
»Ja«, sagte ich. »Einfach so tun, als wenn nichts wäre. Erzählen Sie denen, was immer Sie wollen, nennen Sie es ein Muttermal …«
Er nickte. »Klar. Gute Idee, Doc – Keine Ahnung, was Sie meinen, welcher blaue Arm denn? So in der Art?«
»Richtig«, sagte ich. »Sich niemals entschuldigen. Niemals eine Erklärung abgeben. Sich einfach normal verhalten und das Mistding ausbleichen lassen. Sie werden am Waikiki Beach zur Berühmtheit.«
Er lachte. »Danke, Doc. Vielleicht kann ich mich eines Tages bei Ihnen revanchieren – was bringt Sie nach Hawaii?«
»Berufliches«, sagte ich. »Ich schreibe für eine medizinische Fachzeitschrift über den Honolulu-Marathon.«
Er nickte und setzte sich. Seinen blauen Arm streckte er auf dem Sofa aus, um ihn zu lüften. »So«, bemerkte er schließlich. »Was Sie nicht sagen, Doc.« Er grinste hintergründig. »Eine medizinische Fachzeitschrift. Großer Gott, das klingt gut.«
»Was?«
Er nickte nachdenklich, legte die Füße vor sich auf den Tisch, drehte sich um und lächelte mich an. »Ich hab nur gerade überlegt, wie ich mich erkenntlich zeigen könnte«, sagte er. »Bleiben Sie lange auf den Inseln?«
»Aber nicht in Honolulu«, sagte ich. »Nur bis nach dem Marathon am Sonnabend. Dann reisen wir an einen Ort namens Kona.«
»Kona?«
»Ja«, sagte ich, lehnte mich zurück und schlug eines meiner Bücher auf, ein Werk aus dem 19. Jahrhundert mit dem Titel The Journal of William Ellis.
Er ließ sich in die Kissen sinken und schloss wieder die Augen. »Ein schöner Ort«, sagte er. »Dort wird es Ihnen gefallen.«
»Gut zu wissen«, sagte ich. »Bezahlt hab ich nämlich schon.«
»Bezahlt?«
»Ja. Ich habe zwei Häuser am Strand gemietet.«
Er sah auf. »Sie haben im Voraus bezahlt?«
Ich nickte. »Es war die einzige Möglichkeit, etwas zu bekommen«, sagte ich. »Alles ist ausgebucht.«
»Was?« Er schnellte in die Höhe und sah mich entgeistert an. »Ausgebucht? Was zum Teufel mieten Sie denn da alles – Kona Village?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein«, erwiderte ich. »Es ist ein Anwesen mit zwei großen Häusern und einem Pool, ziemlich weit draußen vor der Stadt.«
»Wo?«, fragte er.
Irgendwas stimmte nicht mit seinem Tonfall, aber ich versuchte, es zu überhören. Ich wollte gar nicht wissen, was immer er mir eventuell zu sagen hatte. »Freunde haben es für mich gefunden«, sagte ich schnell. »Es liegt direkt am Strand. Total isoliert. Wir haben eine Menge Arbeit zu erledigen.«
Jetzt wirkte er endgültig besorgt. »Von wem haben Sie es gemietet?«, fragte er. Und dann nannte er tatsächlich den Namen des Immobilienmaklers, über den ich es gebucht hatte. Meine Miene musste ihn erschreckt haben, denn er wechselte unverzüglich das Thema.
»Warum Kona?«, fragte er. »Wollen Sie Fische fangen?«
Ich zuckte die Achseln. »Nicht unbedingt. Aber ich will raus aufs Wasser und tauchen. Ein Freund von mir hat da drüben ein Motorboot.«
»Oh? Und wer ist das?«
»Ein Typ aus Honolulu«, sagte ich. »Gene Skinner.«
Er nickte. »Ja«, sagte er. »Klar doch, ich kenne Gene – The Blue Boar.« Er beugte sich aus den Kissen nach vorn und musterte mich, inzwischen mehr als halb wach. »Sie sind mit ihm befreundet?«
Ich nickte, überrascht von seinem Lächeln. Dieses Lächeln hatte ich schon einmal gesehen, konnte es aber nicht gleich einordnen.
Ackerman beäugte mich noch immer und hatte plötzlich ein seltsames Leuchten in den Augen. »Hab ihn lange nicht mehr gesehen«, sagte er. »Ist er zurück auf Hawaii?«
Hallo, dachte ich. Hier stimmt was nicht. Und dann erkannte ich das Lächeln: Ich hatte es auf den Lippen anderer Männer gesehen, in anderen Ländern, wenn Skinners Name fiel.
»Wer?«, fragte ich und stand auf, um Eis zu holen.
»Skinner«, sagte er.
»Zurück von wo?« Ich wollte nichts mit Skinners uralten Fehden zu tun haben.
Er schien zu verstehen. »Kennen Sie sonst jemanden in Kona?«, fragte er. »Außer Skinner?«
»Ja. Ich kenne ein paar Leute im Whisky-Business. Und ein paar Immobilienmakler.«
Er nickte gedankenvoll und musterte dabei die langen Finger seiner neuerdings blau gefärbten Hand, als habe er soeben erst etwas Sonderbares an ihr entdeckt. Es war die professionelle Denkpause eines Mannes, der wohlvertraut ist mit den Arbeitsgeräuschen seines Gehirns. Ich konnte ihn fast hören – den Hochgeschwindigkeits-Gedächtnis-Scan seines mentalen PCs, der früher oder später die Tatsache, den Link oder das längst vergessene Detail ausspucken würde.
Er schloss erneut die Augen. »Die Große Insel unterscheidet sich von den anderen«, erklärte er. »Besonders von dem Chaos in Honolulu. Als hätte man die Zeit zurückgedreht. Niemand belästigt dich, jede Menge Platz, um sich zu bewegen. Wahrscheinlich ist es der einzige Ort auf den Inseln, wo sich die Menschen noch Sinn für die alte hawaiianische Kultur bewahrt haben.«
»Wunderbar«, sagte ich. »Wir werden nächste Woche dort sein. In Honolulu müssen wir uns nur um den Marathonlauf kümmern. Dann verschanzen wir uns für eine Weile in Kona und stricken unsere Story zusammen.«
»Genau«, sagte er. »Rufen Sie mich an, sobald Sie dort eingezogen sind. Ich kann Ihnen ein paar Orte zeigen, an denen die alte Magie noch immer lebendig ist.« Er lächelte versonnen. »Ja, wir können runterfahren nach South Point, zur Stätte der Zuflucht, und dort ein wenig Zeit mit dem Geist von Captain Cook verbringen. Teufel auch, wir könnten vielleicht sogar tauchen – wenn das Wetter passt.«
Ich legte mein Buch beiseite, und wir unterhielten uns eine Weile. Es war das erste Mal, dass mir überhaupt jemand etwas Interessantes über Hawaii erzählte – die Legenden der Eingeborenen, die Kriege in alten Zeiten, die Missionare, das seltsame und schreckliche Schicksal des Captain Cook.
»Diese Stätte der Zuflucht hört sich interessant an«, sagte ich. »Man findet nicht mehr viele Kulturen, in denen heilige Zufluchtsorte so sehr in Ehren gehalten werden.«
»Ja, aber man musste erst mal hinkommen, und man musste schneller sein als der oder das, von dem man gejagt wurde.« Er lachte leise. »Auf jeden Fall eine sportliche Herausforderung.«
»Aber wenn man erst einmal dort war, stand man unter absolutem Schutz – richtig?«
»Absolut«, bestätigte er. »Nicht einmal die Götter konnten einem etwas anhaben, wenn man durchs Tor eingetreten war.«
»Wunderbar, einen solchen Ort könnte ich vielleicht gebrauchen.«
»Ja. Ich auch. Und deswegen wohne ich ja auch dort, wo ich wohne.«
»Wo?«
Er lächelte. »An klaren Tagen kann ich den Berg hinunterschauen und von meiner Veranda aus die Stätte der Zuflucht sehen. Das schenkt mir Seelenfrieden.«
Er sprach ganz offensichtlich die Wahrheit. Welches Leben Ackerman auch führen mochte, es schien eine eingebaute Rückversicherung zu erfordern. Man trifft nicht viele Anlageberater aus Hawaii oder von sonst wo, die etwas so Wichtiges ins Klo einer 747-Toilette fallen lassen können, dass sie sich die Arme hellblau färben, bloß um es wieder herauszufischen.
Wir waren allein auf dem Oberdeck, 38 000 Fuß über dem Pazifik, und hatten noch mindestens zwei Flugstunden vor uns. Ungefähr zu Sonnenaufgang würden wir in Honolulu landen. Über den Rand meines Buchs konnte ich Ackerman sehen. Im Halbschlaf kratzte er sich ständig den Arm. Seine Augen waren geschlossen, aber die hellwachen Finger seiner sauberen Hand und ihre spastischen Bewegungen machten mich langsam nervös.
Die Stewardess kam, um nach uns zu sehen, doch der Anblick von Ackermans Arm ließ sie erschaudern, und sie kletterte hastig die Treppe hinunter. Uns stand eine kleine Kühlbox mit Miller High Life zur freien Verfügung und dazu in der Schnapsschublade eine Auswahl an Miniaturflaschen; also blieb nichts anderes zu tun, als ein wachsames Auge auf Ackerman zu haben.
Endlich schien er zu schlafen. Im Oberdeck war es dunkel bis auf das sanfte Glimmen der Tischleuchten, und ich machte es mir auf der Couch bequem, um über meinem Recherchematerial zu brüten.