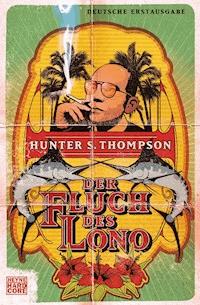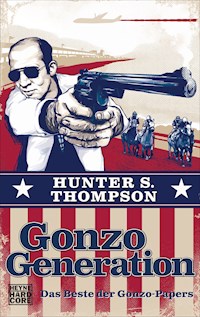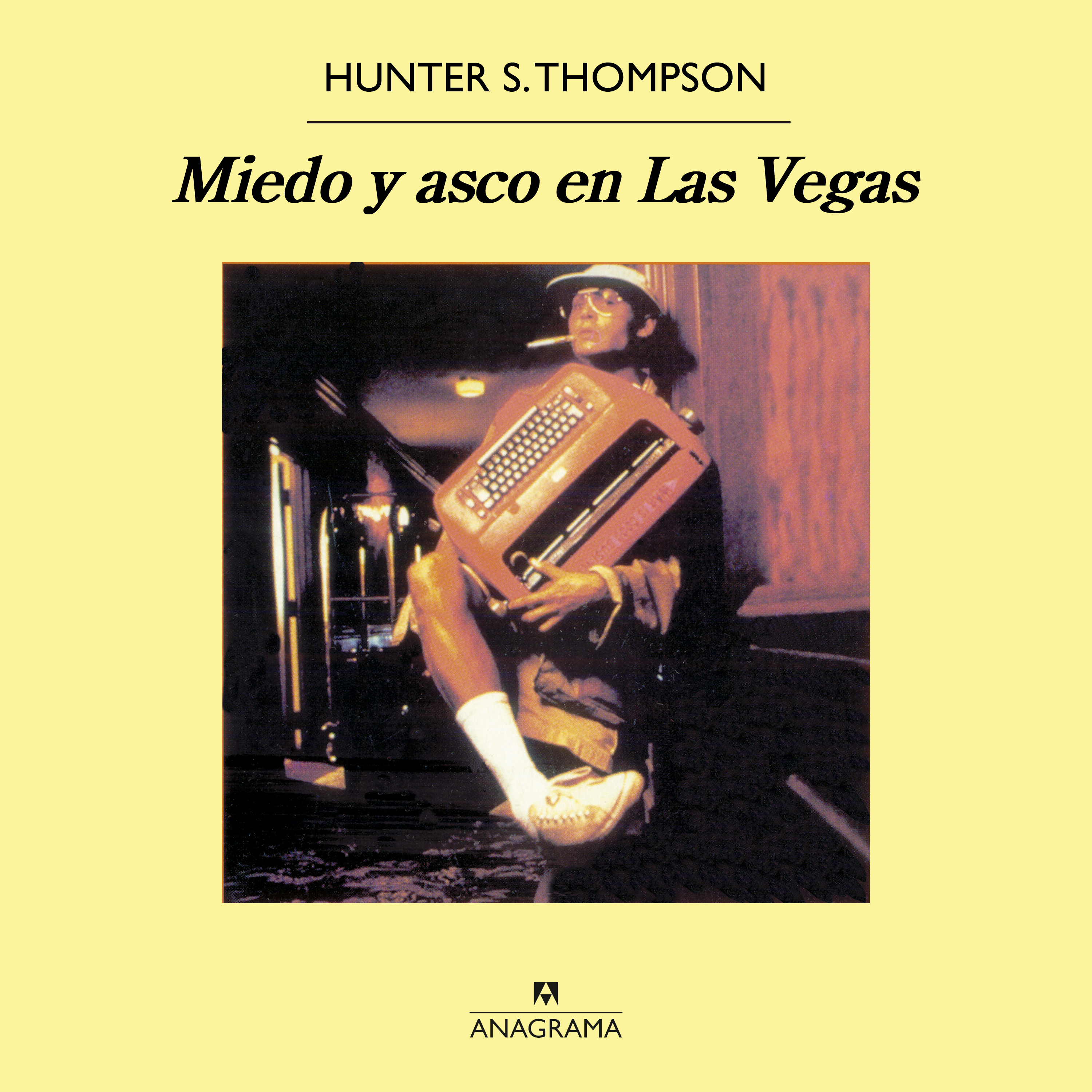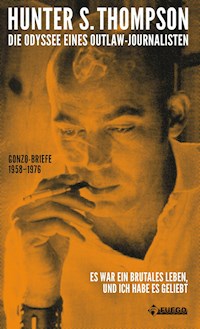8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Nach "Angst und Schrecken in Las Vegas" die nächste Kultverfilmung mit Johnny Depp
Im Winter 1959 fliegt der dreißigjährige Amerikaner Paul Kemp nach Puerto Rico, um dort eine Stelle als Reporter anzutreten. Es folgt eine wilde Reise voll Sonne, Sex, Rum – und der Ahnung vom drohenden Untergang. Der lange verloren geglaubte erste Roman von Hunter S. Thompson erzählt die höchst aktuelle Geschichte vom Ende der Unschuld Amerikas und wurde jetzt mit Johnny Depp in der Hauptrolle verfilmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 389
Ähnliche
Zum Buch
New York, 1959. Paul Kemp, dreißig, fliegt in einer Winternacht nach San Juan und tritt dort eine Stelle als Reporter bei den San Juan Daily News an. In jener Zeit vor Castro und Kennedy, vor Vietnam und Flower Power ist Puerto Rico ein tropisches Paradies, das gerade von amerikanischen Investoren entdeckt wird. Bald wird Kemps neues Leben in der Karibik zu einer wilden Reise an die Grenzen der eigenen Möglichkeiten. Vor dem Hintergrund einer korrupten Gesellschaft, privilegierten Touristen, einem launischen Vorgesetzten und einer unablässig herunterbrennenden Sonne, wird die Insel zum Spiegelbild einer Welt, deren scheinbar grenzenlose Freiheit sich jederzeit in Angst und Schrecken verwandeln kann.
Der lange verloren geglaubte erste Roman von Hunter S. Thompson wurde in den USA ein Bestseller. Jetzt liegt die höchst aktuelle Geschichte vom Ende der Unschuld Amerikas, die auch vom Ende einer Jugend erzählt, zum ersten Mal auf deutsch im Taschenbuch vor. Eine Kinoverfilmung von The Rum Diary mit Johnny Depp und Benicio Del Toro in den Hauptrollen ist in Vorbereitung.
Zum Autor
Hunter S. Thompson wurde 1937 in Louisville, Kentucky geboren. Er begann seine Laufbahn als Sportjournalist, bevor er Reporter für den Rolling Stone und als Begründer des Gonzo-Journalismus zu einer Ikone der Hippiebewegung wurde. Hunter S. Thompson nahm sich am 20.02.2005 in seinem Wohnort Woody Creek, Colorado, das Leben.
Lieferbare Titel
Angst und Schrecken in Las Vegas – Hell’s Angels
Inhaltsverzeichnis
Für Heidi Opheim, Marysue Rucci und Dana Kennedy
My rider of the bright eyes,What happened you yesterday?I thought you in my heart,When I bought you your fine clothes,A man the world could not slay.
DARK EILEEN O’CONNELL, 1773
SAN JUAN, WINTER 1958
Anfang der Fünfziger, als San Juan eine Touristenstadt wurde, baute ein ehemaliger Jockey namens Al Arbonito eine Bar, die im Hinterhof seines Hauses in der Calle O’Leary lag. Er nannte sie Al’s Backyard. Über die Eingangstür hängte er ein Schild mit einem Pfeil, der den Weg an zwei baufälligen Gebäuden vorbei zum Hof markierte. Zuerst gab es bei Al nur Bier, die Flasche für zwanzig Cents; und Rum, den Schuß für zehn und mit Eis für fünfzehn Cents. Nach einigen Monaten begann er, selbstgemachte Hamburger zu verkaufen.
Es war ein angenehmer Ort zum Trinken. Vor allem morgens, wenn die Sonne noch kühl war und salziger Nebel vom Ozean heraufstieg und der Luft einen frischen, gesunden Geruch verlieh, der sich in den ersten Stunden des Tages gegen die dampfende, schweißtreibende Hitze behaupten würde, die San Juan gegen Mittag fest im Griff hat und bis lange nach Sonnenuntergang bleibt.
Auch am Abend war es dort ganz okay, nur nicht so kühl. Manchmal gab es eine leichte Brise, und normalerweise bekam die Bar etwas davon ab, dank ihrer nahezu perfekten Lage: auf der Spitze des Bergs, den die Calle O’Leary hinaufführt, so weit oben, daß man über die ganze Stadt hätte schauen können – wenn der Hof Fenster gehabt hätte. Doch der war von einer dicken Mauer umgeben, und man konnte nur den Himmel sehen und ein paar Bananenbäume.
Nach einiger Zeit besorgte sich Al eine neue Registrierkasse, dann kaufte er Schirmtische aus Holz für den Hof. Und schließlich zog er mit seiner Familie aus der Stadt, vom Haus in der Calle O’Leary in eine neue Siedlung in der Nähe des Flughafens. Er stellte einen stämmigen Neger namens Sweep ein, der das Geschirr spülte, Hamburger servierte und irgendwann sogar kochen lernte.
Sein ehemaliges Wohnzimmer verwandelte Al in einen Live-Club, und er holte sich einen Pianisten aus Miami, einen dünnen Mann mit traurigem Gesicht, der Nelson Otto hieß. Das Klavier war ein altes Baby Grand, hellgrau lackiert und mit Spezial-Schellack überzogen, der die Oberfläche vor der aggressiven Salzluft schützen sollte. Es stand genau zwischen Cocktailbar und Hof – und sieben Abende die Woche, an zwölf Monaten des endlosen karibischen Sommers, setzte sich Nelson Otto an die Tasten, um seinen Schweiß mit den müden Akkorden seiner Musik zu mischen.
Im Fremdenverkehrsbüro erzählen sie gern vom kühlenden Passat, der die Küsten von Puerto Rico das ganze Jahr über umspielt, Tag und Nacht – doch Nelson Otto schien jemand zu sein, an dem der Passat einfach vorbeiwehte. In jenen schwülen Stunden kämpfte er sich durch ein Repertoire abgestandener Bluesnummern und sentimentaler Balladen, der Schweiß tropfte ihm vom Kinn und durchnäßte die Achseln seiner geblümten Baumwoll-Sporthemden. Er verfluchte die »gottverdammte Scheißhitze« so heftig und so voller Haß, daß es manchmal die Atmosphäre in der Bar zerstörte. Die Leute standen dann auf und gingen die Straße hinunter in die Flamboyan Lounge, wo die Flasche Bier auf sechzig Cents kam und ein Lendensteak auf drei fünfzig.
Als Lotterman, ein Exkommunist aus Florida, auftauchte und die SAN JUAN DAILY NEWS gründete, wurde Al’s Backyard allmählich zum englischsprachigen Presseklub. Keiner der Träumer und Herumtreiber, die für Lottermans neue Zeitung arbeiten sollten, konnte sich die »New York Bars« leisten, die in der ganzen Stadt wie giftige Neonpilze aus dem Boden schossen. Die Reporter und Redakteure der Tagesschicht tröpfelten gegen sieben ein, und gegen Mitternacht kamen meistens die Letzten von der Nachtschicht – Sportredakteure, Korrektoren, Setzer. Ab und zu hatte jemand eine Verabredung, aber an normalen Abenden war ein Mädchen in Al’s Backyard ein seltener erotischer Lichtblick. Man sah ohnehin kaum weiße Mädchen in San Juan, und wenn, dann höchstens Touristinnen, Nutten oder Stewardessen. Kein Wunder, wenn sie lieber ins Spielkasino gingen oder in die Terrassenbar des Hilton.
Die unterschiedlichsten Typen begannen für die NEWS zu arbeiten: von jungen wilden Rebellen, die die Welt am liebsten in der Mitte auseinander gerissen und noch mal ganz von vorn angefangen hätten, bis hin zu bierbäuchigen alten Zeilenschindern, die nur ihre Ruhe haben und ihre letzten Tage retten wollten, bevor ein Haufen von Verrückten die Welt in der Mitte auseinander riß.
Es gab die ganze Packung. Echte Talente und anständige Männer genauso wie degenerierte und hoffnungslose Verlierer, die nicht einmal in der Lage waren, eine Postkarte zu schreiben. Idioten und Flüchtlinge und gemeingefährliche Säufer fanden sich ebenso wie ein kubanischer Ladendieb, der eine Pistole unter der Armbeuge trug, oder ein schwachsinniger Mexikaner, der kleine Kinder belästigte. Dazu kamen Zuhälter und Päderasten und Infizierte aller Art, und die meisten arbeiteten gerade lange genug, um sich ein paar Drinks und ein Flugticket zu verdienen.
Es waren aber auch Leute wie Tom Vanderwitz dabei, der später für die WASHINGTON POST schreiben und den Pulitzer-preis bekommen sollte. Und ein Mann namens Tyrrell, heute Redakteur bei der Londoner TIMES, der fünfzehn Stunden am Tag schuftete, damit das Blatt nicht unterging.
Als ich anfing, gab es die NEWS gerade seit drei Jahren, und Ed Lotterman war am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Wenn er redete, schien es, als würde er über die ganze Welt herrschen und sich für eine Kombination aus Gott, Pulitzer und der Heilsarmee halten. Und er hatte eine Vision: Würden alle Mitarbeiter der letzten Jahre gleichzeitig vor den Thron des Allmächtigen treten und mit ihren Ticks und Lügen und Fehltritten herausrücken müssen – dann, so glaubte er fest, würde Gott persönlich einen Anfall bekommen und sich die Haare ausreißen.
Natürlich neigte Lotterman zu Übertreibungen. Bei seinen Wutausbrüchen vergaß er die wirklich guten Leute, er hatte es immer nur auf diejenigen abgesehen, die er »die Saufköpfe« nannte. Doch von denen gab es nun einmal mehr als genug. Mit ein bißchen gutem Willen ließe sich über die Redaktion sagen: ein seltsamer, kaum zu bändigender, nicht gerade vertrauenserweckender Haufen, der es immerhin schaffte, eine Zeitung herauszubringen. Im schlimmsten Fall aber waren die Jungs verwahrlost, betrunken und launisch wie Ziegenböcke.
Sie maulten und stöhnten, als Al den Bierpreis auf fünfundzwanzig Cents erhöhte – in einem »Anfall von Habgier«, wie sie es nannten. Sie maulten und stöhnten aber nur so lange, bis Al eine Liste mit den Bier- und Schnapspreisen des Caribé Hilton an die Wand pinnte; seine mit schwarzer Kreide gekritzelte Schrift hing für jeden gut sichtbar über dem Tresen.
Da die Zeitung eine Anlaufstelle für alle möglichen Schreiberlinge, Fotografen und selbsternannten Schriftsteller war, die es zufällig nach Puerto Rico verschlagen hatte, kam Al bald in den zweifelhaften Genuß einer anderen Seite dieser Branche: Die Schublade unter der Registrierkasse quoll über vor Zetteln aus aller Welt, auf denen hoch und heilig versprochen wurde, »diese Rechnung demnächst zu begleichen«. Vagabundierende Journalisten sind notorische Schnorrer, und auch wenn offene Rechnungen beunruhigend sein mögen, finden sie das irgendwie auch schick.
Ich nenne sie vagabundierende Journalisten, weil sie nie lange blieben, und wenn einer verschwand, kam der nächste. Sie konnten lange ausharren und sich blitzschnell in Bewegung setzen und folgten weder einer Ideologie noch irgendwelchen Werten. Was zählte, waren Glück und gute Kontakte.
Manche von ihnen waren eher Journalisten als Vagabunden, andere eher Vagabunden als Journalisten. Von wenigen Ausnahmen abgesehen arbeiteten sie nebenbei als freie Möchtegern-Auslandskorrespondenten und wollten mit dem journalistischen Establishment möglichst wenig zu tun haben. Schmierige Karrieristen und nationalistische Plappermäuler wie bei den finanzstarken Zeitungen und Nachrichtenmagazinen des Luce-Konzerns gab es hier allerdings nicht.
Puerto Rico war eher wie ein brackiges Gewässer, und bei der DAILY NEWS arbeiteten hauptsächlich schlecht gelaunte Typen, die nie zur Ruhe kamen. Sie ließen sich treiben, wohin der Wind des Gerüchts und der günstigen Gelegenheit sie trug. Durch ganz Europa, Lateinamerika und in den fernen Osten – wo immer es englischsprachige Zeitungen gab, hüpften sie von der einen zur anderen, immer auf der Suche nach der sensationellen Geschichte oder der reichen Erbin, die schon die nächste Flugreise versprach.
In gewisser Weise gehörte ich dazu – kompetenter und beständiger als einige andere –, und ich war selten arbeitslos in jenen Jahren. Manchmal arbeitete ich für drei Zeitungen gleichzeitig. Ich schrieb Werbetexte für neue Spielkasinos und Bowlingcenter, war Experte für das Hahnenkampf-Syndikat, hundertprozentig korrupter Kritiker von Luxusrestaurants, außerdem Yacht-Fotograf und regelmäßiges Opfer von Polizeigewalt. Ich war gierig nach Leben, und ich war gut darin. Ich machte ein paar interessante Bekanntschaften, hatte ausreichend Geld, um herumzukommen, und lernte einiges über die Welt, das einem nirgendwo sonst beigebracht wird.
Wie die meisten war ich ein Suchender, unzufrieden und immer auf Achse, dann wieder ein kopfloser Draufgänger. Nie hatte ich genug Muße, großartig darüber nachzudenken, aber ich spürte, daß ich instinktiv richtig lag. Ich hielt es mit dem Optimismus der Heimatlosen, der besagte: wir waren auf dem richtigen Weg, einige kamen unglaublich gut voran, und die Besten von uns würden es irgendwann wie von selbst über den Berg schaffen.
Gleichzeitig wurde ich den dunklen Verdacht nicht los, daß unser Leben eine verlorene Sache war und wir wie Schauspieler in einer sinnlosen Odyssee herumirrten und uns selbst in die Tasche logen. Es war die Spannung zwischen diesen beiden Polen – einem ungebrochenen Idealismus auf der einen und einer Ahnung vom drohenden Untergang auf der anderen Seite –, die mich auf den Beinen hielt.
1
MEIN APARTMENT IN NEW YORK lag in der Perry Street, fünf Minuten vom White Horse entfernt. Ich ging dort öfters was trinken, wurde aber nicht akzeptiert, da ich eine Krawatte trug. Die Leute aus der Szene wollten mit mir nichts zu tun haben.
Ich war dort auch in jener Nacht, in der ich nach San Juan aufbrach. Phil Rollins, mit dem ich zusammengearbeitet hatte, zahlte das Bier, und ich kippte es in mich hinein und versuchte betrunken genug zu werden, um im Flugzeug schlafen zu können. Mit dabei waren Art Millick, der fieseste Taxifahrer New Yorks, sowie Duke Peterson, der gerade von den Virgin Islands zurückgekommen war. Ich weiß noch, daß mir Peterson eine Liste von Leuten gab, mit denen ich mich in Verbindung setzen sollte, sobald ich nach St. Thomas käme. Aber ich verlor die Liste und habe keinen von ihnen je getroffen.
Es war eine miese Nacht Mitte Januar, trotzdem hatte ich nur ein leichtes Cordjackett an. Alle anderen trugen dicke Jacken oder Flanellanzüge. Als letztes erinnere ich mich, daß ich auf dem verdreckten Gehsteig in der Hudson Street stand, Rollins die Hand schüttelte und den eiskalten Wind verfluchte, der vom Fluß herüberwehte. Dann stieg ich in Millicks Taxi und schlief den ganzen Weg bis zum Flughafen.
Ich war spät dran, und vor dem Reservierungsschalter hatte sich eine Schlange gebildet. Ich stellte mich in die Reihe hinter vielleicht fünfzehn Puertoricaner, und ein Stück vor mir stand ein kleines blondes Mädchen. Ich hielt sie für eine Touristin – eine junge wilde Sekretärin, die zwei Wochen lang in der Karibik einen draufmachen wollte. Sie hatte einen hübschen kleinen Körper und stand ungeduldig herum, als hätte sie jede Menge aufgestauter Energie. Ich sah sie intensiv an, lächelte, spürte das Bier in meinen Adern und wartete darauf, daß sie sich für einen kurzen Blickkontakt umdrehen würde.
Sie bekam ihr Ticket und spazierte Richtung Flugzeug. Noch drei Puertoricaner waren vor mir. Zwei davon wurden abgefertigt und gingen weiter. Der dritte wurde von dem Mann hinter dem Schalter gestoppt, sein riesiger Pappkarton war als Handgepäck nicht zulässig. Die beiden redeten aufeinander ein, und ich knirschte mit den Zähnen.
»Hey!« rief ich. »Zum Teufel, was soll das? Ich muß in dieses Flugzeug!«
Der Schalterbeamte sah mich an, das Geschrei des kleinen Mannes vor mir ignorierend. »Wie heißen Sie?«
Ich sagte ihm meinen Namen, bekam mein Ticket und flitzte zum Gate. Als ich das Flugzeug erreichte, mußte ich mich an fünf oder sechs Leuten vorbeidrängeln, die darauf warteten, an Bord zu gehen. Ich zeigte der murrenden Stewardeß mein Ticket, stieg ein und suchte die Sitzreihen auf beiden Seiten des Mittelgangs ab.
Nirgends ein Blondschopf. Ich ging rasch nach vorn und dachte, sie wäre vielleicht so klein, daß ihr Kopf hinter den Sitzen verschwand. Doch sie war definitiv nicht im Flugzeug, und inzwischen waren nur noch zwei Doppelsitze frei. Ich nahm den Platz am Gang und stellte meine Schreibmaschine auf den Fensterplatz. Die Motoren liefen gerade warm, als ich nach draußen schaute und das Mädchen über die Rollbahn laufen und der Stewardeß zuwinken sah – die gerade die Türe schließen wollte.
»Moment!« rief ich. »Ein Passagier!« Ich sah, wie sie die Gangway erreichte. Dann drehte ich mich, damit ich ihr zulächeln konnte, sobald sie den Gang herunterkam. Ich wollte gerade nach meiner Schreibmaschine greifen, um sie auf den Boden zu stellen, da zwängte sich ein alter Mann an mir vorbei und setzte sich neben mich.
»Der Platz ist reserviert«, sagte ich schnell und packte ihn am Arm.
Er riß sich los, brabbelte etwas auf Spanisch und drehte sich zum Fenster.
Ich packte ihn erneut. »Stehen Sie auf«, sagte ich wütend.
Jetzt fing er zu plärren an, während das Mädchen vorbeikam und etwas weiter vorn stehen blieb. »Hier ist noch ein Platz frei«, rief ich und zerrte den Alten hoch. Bevor sie sich umdrehen konnte, hatte sich die Stewardeß auf mich gestürzt und zog an meinem Arm.
»Er hat sich auf meine Schreibmaschine gesetzt«, sagte ich und mußte hilflos mitansehen, wie das Mädchen ganz vorn einen Platz fand.
Die Stewardeß faßte den Alten besänftigend an der Schulter und half ihm auf seinen Platz zurück. »Was sind Sie nur für ein brutaler Kerl?« fuhr sie mich an. »Ich sollte Sie rauswerfen!«
Grummelnd ließ ich mich in meinen Sitz fallen. Der Alte starrte stur geradeaus, bis wir abhoben. »Mieser alter Sack«, knurrte ich in seine Richtung.
Keine Reaktion. Schließlich machte ich die Augen zu und versuchte zu schlafen. Ab und zu warf ich einen Blick nach vorn auf die Blonde. Dann schalteten sie die Lichter aus, und ich konnte nichts mehr erkennen.
Als ich wach wurde, dämmerte es. Der Alte schlief immer noch, und ich beugte mich über ihn, um aus dem Fenster zu schauen. Mehrere tausend Fuß unter uns lag der Ozean, dunkelblau und glatt wie ein See. Weiter vorn sah ich eine Insel, die grün in der frühen Morgensonne schimmerte, mit Stränden und braunen Sümpfen weiter im Landesinneren. Die Maschine setzte zur Landung an, und die Stewardeß sagte durch, daß wir die Gurte anlegen sollten.
Kurz darauf schoß das Flugzeug dicht über Palmwäldern hinab und rollte vor dem großen Terminal aus. Ich wollte auf meinem Platz bleiben, bis das Mädchen vorbeikam, dann aufstehen und mit ihr zusammen über das Rollfeld gehen. Da wir beide die einzigen Weißen im Flugzeug waren, würde das ganz natürlich wirken.
Die anderen Passagiere standen herum, quatschten, kicherten und warteten darauf, daß die Stewardeß die Tür öffnen würde. Plötzlich sprang der Alte auf und versuchte, wie ein Hund über mich hinwegzukrabbeln. Reflexartig stieß ich ihn zurück ans Fenster. Es gab ein dumpfes Geräusch, das die Menge verstummen ließ. Dem Mann schien jetzt übel zu werden und er versuchte wieder, an mir vorbeizukrabbeln. Dabei brüllte er hysterisch auf Spanisch.
»Verrückter alter Sack!« schrie ich, drückte ihn mit der einen Hand weg und griff mit der anderen nach der Schreibmaschine. Die Tür war jetzt offen, und alle strömten ins Freie. Das Mädchen kam an mir vorbei. Ich versuchte sie anzulächeln und presste dabei den Alten immer noch gegen die Scheibe, bis ich rückwärts auf den Gang treten konnte. Er brüllte und ruderte hilflos mit den Armen und führte sich jetzt dermaßen auf, daß ich kurz davor war, ihm einen Handkantenschlag auf die Kehle zu verpassen, damit er endlich Ruhe gab.
Schließlich kam die Stewardeß, gefolgt vom Copiloten, der wissen wollte, was ich mir eigentlich einbildete.
»Er fängt immer wieder an, auf diesen älteren Herrn einzuschlagen – seit wir in New York gestartet sind«, sagte die Stewardeß. »Das muß ein Sadist sein.«
Sie behielten mich für zehn Minuten da, und ich befürchtete schon, daß sie mich festnehmen lassen wollten. Ich versuchte alles zu erklären, aber ich war so müde und durcheinander, daß ich nicht wußte, was ich da sagte. Als sie mich endlich gehen ließen, schlich ich aus dem Flugzeug wie ein Verbrecher, blinzelte in die Sonne und überquerte schwitzend die Rollbahn Richtung Gepäckausgabe.
Dort wimmelte es nur so von Puertoricanern, das Mädchen aber war spurlos verschwunden. Die Hoffnung, sie jetzt noch zu finden, schien gering – und selbst wenn, rechnete ich mir keine großen Chancen aus. Wenige Mädchen fühlen sich zu einem Mann hingezogen, der alte Menschen terrorisiert. Ihren Gesichtsausdruck hatte ich noch genau vor Augen, als sie sah, wie ich den alten Mann gegen das Fenster presste. Überhaupt war mir das alles zu viel. Ich beschloß, frühstücken zu gehen und mein Gepäck später zu holen.
Der Flughafen von San Juan ist ein hübscher, moderner Bau, überall leuchtende Farben und sonnengebräunte Menschen und Latino-Rhythmen, die in der Halle von nackten Traversen herab aus den Lautsprechern dröhnen. Ich lief die lange Gangway hinauf, Mantel und Schreibmaschine in der einen, eine kleine Ledertasche in der anderen Hand. Die Hinweisschilder führten mich zu einer weiteren Gangway und schließlich zum Coffee Shop. Als ich hineinging, schaute ich in einen Spiegel. Abgerissen und zwielichtig sah ich aus, ein bleicher Reisender mit geröteten Augen.
Und ich stank auch noch nach Bier. Es rumorte in meinem Magen wie ranzige Milch, und ich versuchte, niemanden anzuatmen, als ich mich an die Theke setzte und Ananas in Scheiben bestellte.
Draußen glitzerte das Rollfeld in der Morgensonne. Dahinter, zwischen mir und dem Ozean, lag ein dichter Palmendschungel. Einige Meilen weiter draußen auf dem Meer strich ein Segelboot langsam über den Horizont. Ich starrte eine Weile hinaus und fiel in eine Art Trance. Es sah friedlich aus dort draußen, friedlich und heiß. Ich wollte zwischen den Palmen umherlaufen und schlafen, Ananasstücke essen, durch den Dschungel wandern und umkippen.
Statt dessen bestellte ich einen Kaffee und sah mir wieder das Telegramm an, das ich zusammen mit meinem Flugticket bekommen hatte. Dort stand etwas von einer Reservierung im Condado Beach Hotel.
Es war noch nicht einmal sieben Uhr morgens, und der Coffee Shop füllte sich. Grüppchen von Männern saßen an den Tischen beim großen Fenster, nippten an einem milchigen Gebräu und unterhielten sich aufgeregt. Einige trugen Anzüge, die meisten aber eine Art Inseluniform – klobig eingefaßte Sonnenbrille, schimmernde dunkle Hose, weißes kurzärmeliges Hemd, Krawatte.
Ich schnappte einige Gesprächsfetzen auf: » … am Strand gibt’s doch nichts Billiges mehr … ja, aber das hier ist nicht Montego, meine Herren … keine Sorge, der hat mehr als genug, was zählt … alles unter Kontrolle, aber wir müssen schnell sein, bevor Castro mit seiner Meute einfällt und dann …«
Nach zehn Minuten halbherzigem Zuhören hatte ich den Verdacht, in ein Spekulantennest geraten zu sein. Die meisten schienen auf den Sieben-Uhr-Dreißig-Flug aus Miami zu warten, der den Gesprächen zufolge randvoll sein mußte mit Architekten, Sprengmeistern, Beratern und dem einen oder anderen Sizilianer, der aus Kuba flüchtete.
Ihre Stimmen gingen mir durch und durch. Auch wenn ich persönlich keinen vernünftigen Grund haben mag, über Spekulanten zu lästern: Der Akt des Verkaufens widert mich an. Ich hegte das klammheimliche Verlangen, einem Geschäftsmann die Fresse zu polieren, ihm die Zähne auszuschlagen und ein paar blaue Augen zu zaubern.
Sobald das Geschwätz in mein Bewußtsein gedrungen war, konnte ich nichts anderes mehr hören. Es verdarb mir meine angenehm träge Stimmung und nervte mich schließlich so sehr, daß ich den Rest meines Kaffees hinunterspülte und ging.
An der Gepäckausgabe war niemand mehr. Ich fand meine beiden Matchbeutel und ließ sie von einem Kofferträger zum Taxistand bringen. Den ganzen Weg durch die Halle versuchte der Kerl mich mit seinem Dauergrinsen freundlich zu stimmen und sagte andauernd: »Sí, Puerto Rico está bueno … ah, sí, muy bueno … mucho ha-ha, sí…«
Im Taxi lehnte ich mich zurück und zündete ein Zigarillo an, das ich im Coffee Shop gekauft hatte. Jetzt fühlte ich mich besser; warm und schläfrig und absolut frei. Während die Palmen vorbeirauschten und eine gigantische Sonne vor uns auf die Straße hinunterbrannte, bekam ich einen Flash, wie zuletzt in meinen ersten Monaten in Europa: eine Mischung aus Ahnungslosigkeit und lockerem »Was soll’s«-Vertrauen, das einen Mann beschleicht, wenn er den Wind spürt und sich schnurgerade auf einen unbekannten Horizont zubewegt.
Wir rasten auf einer vierspurigen Schnellstraße dahin. Auf beiden Seiten erstreckte sich ein weitläufiger Komplex gelber Wohnsiedlungen mit hohen Maschendrahtzäunen. Kurz darauf fuhren wir an etwas vorbei, das wie ein neuer Wohnblock aussah, voll von identischen pinkfarbenen und blauen Häusern. An der Zufahrt war eine Reklametafel, die dem Reisenden mitteilte, daß er gerade die El Jippo Urbanización passierte. Gleich neben der Tafel stand eine winzige Hütte aus Palmwedeln und Blechresten, und daneben ein handbemaltes Schild mit der Aufschrift Coco Frío. Drinnen lehnte sich ein Junge von vielleicht dreizehn Jahren auf ein Holzbrett und starrte auf die vorbeifahrenden Wagen hinaus.
Halb betrunken an einem fremden Ort anzukommen, zerrt an den Nerven. Es ist ein Gefühl, daß irgend etwas nicht stimmt, daß man nichts in den Griff bekommt. Genau dieses Gefühl hatte ich, und als ich im Hotel ankam, ging ich sofort ins Bett.
Es war halb fünf, als ich aufwachte, hungrig und ungewaschen und ohne recht zu wissen, wo ich war. Ich trat hinaus auf den Balkon und starrte nach unten zum Strand. Dort planschten jede Menge Frauen, Kinder und dickbäuchige Männer in der Brandung herum. Zu meiner Rechten befand sich ein weiteres Hotel, dahinter noch eines, jedes mit seinem eigenen überfüllten Strand.
Ich duschte und ging dann zur Freiluftlobby hinunter. Das Restaurant war geschlossen, also probierte ich es mit der Bar. Sie wirkte bis ins Detail so, als wäre sie komplett aus einem Urlaubsort in den Catskill Mountains eingeflogen worden. Ich saß dort zwei Stunden lang, knabberte Erdnüsse, bestellte Drinks und starrte auf den Ozean. Es waren vielleicht ein Dutzend Leute in der Bar. Die Männer sahen aus wie blasse Mexikaner, mit kleinen schmalen Schnurrbärten und glänzenden Seidenanzügen. Die meisten Frauen waren Amerikanerinnen in fortgeschrittenem Alter, eine erbärmliche Runde – alle trugen sie ärmellose Cocktailkleider, die an ihnen hingen wie Gummisäcke.
Ich fühlte mich wie Strandgut. Mein verknittertes Cordjackett war fünf Jahre alt und am Kragen durchgescheuert, meine Hose hatte keine Bügelfalten, und obwohl ich nie auf die Idee gekommen wäre, eine Krawatte umzubinden, war ich ohne anscheinend fehl am Platz. Da ich mich nicht anbiedern wollte, bestellte ich mir keinen Rum, sondern Bier. Der Bartender warf mir einen mürrischen Blick zu, und ich wußte warum – nichts, was ich anhatte, glänzte. Zweifellos war ich ein Spielverderber. Wenn ich es hier zu etwas bringen wollte, würde ich mir Glitzerkram zulegen müssen.
Um halb sieben verließ ich die Bar und ging hinaus. Es wurde dunkel, und die große Avenida sah kühl und elegant aus. Auf der anderen Seite standen Häuser, die einmal Meerblick gehabt haben mußten. Jetzt war dieser Blick von Hotels verstellt, und die meisten Bewohner hatten sich hinter hohen Hecken und Mauern zurückgezogen und waren so von der Straße abgeschnitten. Hier und da konnte ich eine Terrasse oder eine Veranda sehen, auf der Leute unter Ventilatoren saßen und Rum tranken. Irgendwo weiter oben auf der Straße waren Glocken zu hören, das verträumte Klingklang von Brahms’ Wiegenlied.
Ich ging einen Block weiter, um ein Gefühl für die Gegend zu bekommen, und die Glocken kamen näher. Bald tauchte ein Eiscreme-Wagen auf und bewegte sich langsam die Straße hinab. Auf dem Dach steckte ein riesiges Eis am Stiel, das immer wieder im rötlichen Neonschein aufleuchtete und die Umgebung erhellte. Tief aus den Eingeweiden des Wagens kam das Geklimper von Mr. Brahms’ Melodie. Der Fahrer fuhr an mir vorbei, grinste glücklich und drückte auf seine Hupe.
Ich winkte mir sofort ein Taxi und sagte dem Fahrer, er solle mich in die Stadtmitte bringen. Old San Juan ist eine Insel und durch mehrere Dämme mit dem Festland verbunden. Wir überquerten den Damm, der stadtauswärts nach Condado führt. Dutzende von Puertoricanern standen am Geländer und angelten in der flachen Lagune; etwas weiter rechts war ein riesiges weißes Neonschild mit dem Schriftzug CARIBÉ HILTON. Das, so wußte ich, war der Grundstein des Boom. Mr. Conrad Hilton war aufgetaucht wie Jesus, und alle Fische waren ihm gefolgt. Vor seiner Zeit gab es nichts; jetzt war nur der Himmel die Grenze. Wir kamen an einem leerstehenden Stadion vorbei und fuhren bald auf einem Boulevard, der entlang einer Felskuppe verlief. Auf der einen Seite war der dunkle Atlantik, und auf der anderen, hinter der schmalen Stadt, glommen tausende bunte Lichter von Luxusdampfern, die im Hafen vertäut lagen. Wir bogen ab und hielten an einem Platz, den der Fahrer als Plaza Colón bezeichnete. Die Fahrt kostete einen Dollar dreißig, und ich gab ihm zwei.
Er sah sich die Scheine an und schüttelte den Kopf.
»Stimmt was nicht?« fragte ich.
Er zuckte die Achseln. »Kein Wechselgeld, señor.«
Ich tastete in meiner Tasche – nichts außer einem Nickel. Mir war klar, daß er log, aber ich wollte es vermeiden, irgendwo einen Dollar wechseln zu müssen. »Du gottverdammter Dieb«, sagte ich, warf ihm die Scheine in den Schoß und stieg aus. Er zuckte wieder die Achseln und brauste davon.
Die Plaza Colón war ein Knotenpunkt, an dem mehrere schmale Straßen zusammenliefen. Die Gebäude standen eng aneinander, zwei bis drei Stockwerke hoch, und hatten Balkone, die über die Straße hingen. Die Luft war heiß, und eine leichte Brise trug einen Geruch von Schweiß und Abfällen mit sich. Musik und Stimmengewirr drang aus offenen Fenstern. Die Gehwege waren so schmal, daß man aufpassen mußte, um nicht im Rinnstein zu landen. Obsthändler versperrten die Straßen mit Holzkarren und verkauften geschälte Orangen für fünf Cents das Stück.
Ich spazierte eine halbe Stunde lang umher, betrachtete die Auslagen von Geschäften, die »Ivy League«-Mode verkauften, spähte in üble Spelunken voll von Huren und Seeleuten, wich den Menschen auf den Gehwegen aus und dachte, ich würde jeden Moment umkippen, wenn ich nicht gleich ein Restaurant fand.
Schließlich gab ich es auf. In Old San Juan schien es keine Restaurants zu geben. Der einzige Laden, den ich sah, hieß »New York Diner« und hatte geschlossen. In meiner Verzweiflung winkte ich mir ein Taxi und sagte dem Fahrer, er solle mich zur DAILY NEWS bringen.
Er starrte mich an.
»Die Zeitung!« brüllte ich und schlug die Wagentür hinter mir zu.
»Ah, sí«, murmelte er. »EL DIARIO, sí.«
»Nein, gottverdammt«, sagte ich. »Die DAILY NEWS – die amerikanische Zeitung – El NEWS.«
Er hatte nie davon gehört, also fuhren wir zur Plaza Colón zurück. Ich beugte mich aus dem Fenster und fragte einen Cop. Der wußte es auch nicht, aber schließlich kam ein Mann von der Bushaltestelle herüber und erklärte uns den Weg.
Wir fuhren auf einer gepflasterten Straße einen Berg hinunter ans Wasser. Nichts deutete auf eine Zeitung hin, und ich hatte den Verdacht, daß er mich nur hierher brachte, um mich loszuwerden. Wir bogen um eine Ecke, und plötzlich stieg er auf die Bremsen. Gleich vor uns war so etwas wie ein Bandenkrieg im Gang. Ein kreischender Mob versuchte in ein altes, grünliches Gebäude einzudringen, das wie ein Lagerhaus aussah.
»Mach schon«, sagte ich zu dem Fahrer. »Da kommen wir leicht dran vorbei.«
Er murmelte etwas und schüttelte den Kopf.
Ich schlug mit der Faust auf seine Rückenlehne. »Mach endlich! Keine Fahrt – kein Geld.«
Er murmelte wieder etwas, schaltete aber in den ersten Gang, manövrierte den Wagen auf die andere Straßenseite und hielt so viel Abstand wie möglich zwischen uns und dem Mob. Er stoppte, als wir direkt vor dem Gebäude waren, und ich sah, daß es sich um eine Bande von vielleicht zwanzig Puertoricanern handelte, die einen hochgewachsenen Amerikaner in braunem Anzug angriffen. Der wiederum stand auf den Stufen und schwang ein großes Holzschild wie einen Baseballschläger.
»Ihr miesen kleinen Penner!« brüllte der Amerikaner. Eine verschwommene Bewegung, dann hörte ich einen dumpfen Schlag und Geschrei. Einer der Angreifer stürzte mit blutendem Gesicht zu Boden. Der Amerikaner zog sich, immer noch sein Schild schwenkend, in Richtung Eingangstür zurück. Zwei Männer versuchten, es sich zu schnappen, und er schlug dem einen so auf die Brust, daß der die Stufen herunterfiel. Die anderen hielten Abstand, schrien und drohten mit den Fäusten. Der Amerikaner knurrte sie an: »Kommt schon, ihr Penner – holt es euch!«
Keiner rührte sich. Er wartete einen Moment, dann hob er das Schild über die Schulter und warf es mitten in die Menge. Es traf einen Mann in den Bauch, der auf die anderen stürzte. Ich hörte lautes Gelächter, dann verschwand der Amerikaner im Gebäude.
»Okay«, sagte ich zu meinem Fahrer. »Das wär’s – fahren wir.«
Er schüttelte den Kopf und zeigte erst auf das Gebäude, dann auf mich. »Sí, está NEWS.« Er nickte, dann zeigte er wieder auf das Gebäude. »Sí«, sagte er düster.
Mir dämmerte, daß wir uns vor der DAILY NEWS befanden – meinem neuen Zuhause. Ich warf noch einen letzten Blick auf den stinkenden Mob und beschloß, wieder ins Hotel zu fahren. In diesem Moment hörte ich ein neues Geräusch. Ein Volkswagen hielt hinter uns. Drei Cops stiegen aus, schwangen ihre schweren Schlagstöcke und schrien etwas auf Spanisch. Einige aus dem Mob rannten los, andere blieben, um zu diskutieren. Ich schaute noch einen Moment zu, dann gab ich dem Fahrer einen Dollar und flitzte ins Gebäude.
Auf einer Tafel stand, die Nachrichtenredaktion der NEWS befinde sich in der ersten Etage. Ich nahm den Fahrstuhl und rechnete schon damit, auszusteigen und mich inmitten der nächsten Gewaltszene wiederzufinden. Doch die Tür öffnete sich zu einem dunklen Flur, und etwas weiter links waren nur die üblichen Geräusche einer Lokalredaktion zu hören.
In dem Moment, als ich die Redaktion betrat, fühlte ich mich gleich besser. Es herrschte freundliches Chaos, das beständige Klappern von Schreibmaschinen und Fernschreibern und sogar der Geruch wirkten vertraut. Der riesige Raum schien fast leer zu sein, obwohl mindestens zehn Leute zu sehen waren. Der Einzige, der nicht arbeitete, war ein kleiner, dunkelhaariger Mann am Schreibtisch bei der Tür. Er saß zurückgelehnt da und starrte an die Decke.
Ich ging zu ihm hinüber, und als ich etwas sagen wollte, wirbelte er auf seinem Stuhl herum. »Na schön!« zischte er. »Zum Teufel noch mal, was willst du?«
Ich starrte auf ihn herab. »Ich fang hier morgen an«, sagte ich. »Mein Name ist Kemp, Paul Kemp.«
Er lächelte matt. »Entschuldigung – dachte, du wärst hinter meinen Negativen her.«
»Was, bitte?« fragte ich.
Er grummelte etwas von »klauen einem alles unterm Hintern weg« und »aufpassen wie ein Schießhund«.
Ich sah mich im Raum um. »Die sehen normal aus.«
Er schnaubte. »Diebe – alles Ratten.« Er stand auf und streckte mir die Hand hin. »Bob Sala, Fotoredaktion. Was führt dich heute Abend zu uns?«
»Ich muß unbedingt was essen.«
Er lachte. »Pleite?«
»Nein, ich bin reich – ich finde bloß nirgends ein Restaurant.«
Er ließ sich wieder in seinen Stuhl fallen. »Da kannst du froh sein. Das erste, was du hier lernst – vermeide Restaurants.«
»Warum?« fragte ich. »Die Ruhr?«
Er lachte. »Die Ruhr, Filzläuse, Gicht, die Franzosenkrankheit – du kannst dir hier alles einfangen, einfach alles.« Er sah auf die Uhr. »Warte zehn Minuten, und ich nehm dich mit rauf zu Al’s.«
Ich schob eine Kamera beiseite und setzte mich auf seinen Schreibtisch. Er lehnte sich zurück und starrte wieder an die Decke, kratzte sich ab und zu seine drahtigen Lokken und schien gerade gedanklich in ein besseres Land abzuschweifen, in dem es gute Restaurants gab und keine Ratten. Er wirkte verloren hier – eher wie ein Kartenabrei-ßer auf irgendeinem Rummelplatz in Indiana. Seine Zähne waren schlecht, er brauchte dringend eine Rasur, sein Hemd war dreckig, und seine Schuhe sahen aus, als wären sie von der Wohlfahrt.
Wir saßen schweigend da, bis zwei Männer aus einem Büro von der anderen Seite des Raumes kamen. Der eine
Die Originalausgabe THE RUM DIARY erschien 1998 bei Simon & Schuster, New York
Die deutsche Hardcover-Ausgabe erschien 2004 im blumenbar Verlag, München
2. Auflage
Deutsche Taschenbucherstausgabe 12/2005
Copyright © 1998 by Hunter S.Thompson Copyright © 2004 der deutschen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlagillustration und Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München Satz: Frese, München
eISBN 978-3-641-09725-7
http//www.heyne.de
www.randomhouse.de
Leseprobe