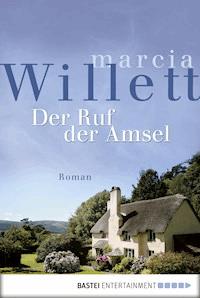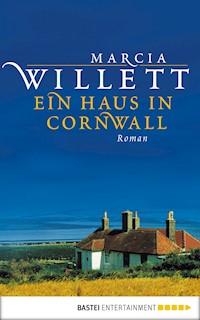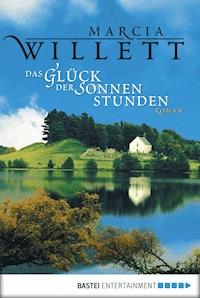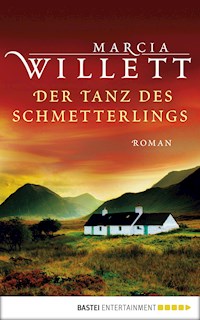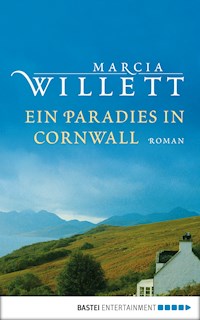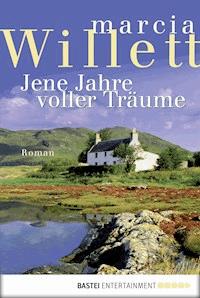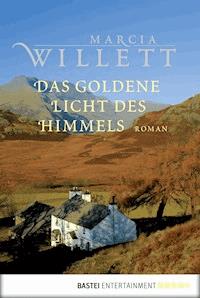7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
DUNKLE FAMILIENGEHEIMNISSE IM IDYLLISCHEN CORNWALL. Die Geschwister Ed und Billa sind nach gescheiterten Ehen aufs Land zurückgekehrt, um im wunderschön gelegenen Haus ihrer Eltern den Lebensabend zu verbringen. Das Dorfleben ist behaglich und friedvoll. Bis zu dem Tag, an dem ihr Halbbruder Tristan nach fünfzig Jahren Funkstille bei ihnen vor der Haustür steht. Einst hatte Tristan ihnen mit seinen Gemeinheiten die Kindheit zur Hölle gemacht. Nun hat er ihnen eine Nachricht zu überbringen, die Ed und Billa abermals vor eine große Herausforderung stellt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 415
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
Über die Autorin
Marcia Willett, in Somerset geboren, studierte und unterrichtete klassischen Tanz, bevor sie ihr Talent für das Schreiben entdeckte. Ihre Bücher erscheinen in 18 Ländern. Sie lebt mit ihrem Ehemann in Devon, dem Schauplatz vieler ihrer Romane. Besuchen Sie die Website der Autorin: www.marciawillett.co.uk
Marcia Willett
DERGEHEIMNISVOLLEBESUCHER
Roman
Aus dem Englischen vonBarbara Röhl
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2013 by Marcia Willett
Titel der englischen Originalausgabe: »Postcards from the Past«
Originalverlag: Transworld Publishers
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: © shutterstock; © shutterstock/ChristianM;
© shutterstock/Helen Hotson; © shutterstock/Gizele
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-5926-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Linda Evans
1. Kapitel
Heute Nacht scheinen zwei Monde. Die runde, weiße, leuchtende Scheibe, die zerbrechlich und scharfkantig wie Glas wirkt, sieht auf ihr Spiegelbild hinunter, das auf dem Rücken im schwarzen Wasser des Sees liegt. Nichts regt sich. Kein Windhauch kräuselt die Oberfläche. Am Seeufer neigt sich die Vogelkirsche wie ein elegantes Gespenst. Ihre zarten, kahlen Äste sind mit silbrigem Eis überzogen und sehnen sich nach der Wärme vergangener Sommertage. Hohe Hartriegel, deren Farben durch das kalte, grelle Licht ausgelöscht werden, sodass sie schwarz-weiß erscheinen, bewachen das Nordufer des Sees und werfen spitzige Schatten über das reifbedeckte Gras.
Sie steht in dem warmen Raum und sieht auf die eisige Winterszene hinunter, und die ganze Zeit über fingert sie am Rand der Postkarte herum, die sie tief in die Tasche ihrer Steppweste gestopft hat; genau wie ihre Gedanken sich unaufhörlich um die Bedeutung der Worte drehen, die auf die Rückseite einer Reproduktion von Toulouse-Lautrecs La Chaîne Simpson gekritzelt sind, einem Plakat, auf dem Radrennfahrer zu sehen sind.
Ein Gruß aus der Vergangenheit. Wie geht’s euch? Vielleicht sollte ich euch einen Besuch abstatten und es selbst herausfinden!
Die Karte ist an sie und ihren Bruder adressiert – Edmund und Wilhelmina St. Enedoc –, und die Unterschrift besteht nur aus einem Wort: Tris. Billa betastet die Karte, wobei sie versehentlich eine Ecke abknickt. Aus einem Raum unten steigen ein paar Töne auf; der lyrische Schmerz einer Trompete. It never entered my mind von Miles Davis, einer von Eds Lieblingstiteln.
Vorhin, als Ed in die Küche kam, um zu sehen, was der Briefträger gebracht hatte, hat Billa die Postkarte instinktiv versteckt und unter die Zeitung vom Vortag geschoben. Sie hat eine unbeschwerte Bemerkung gemacht und ihm die Handvoll Umschläge und Kataloge gereicht, während die Schrift auf der Postkarte sich in ihr inneres Auge eingebrannt hat.
… Vielleicht sollte ich euch einen Besuch abstatten und es selbst herausfinden. Tris.
Später hat sie die Karte in die Tasche gesteckt, um sie in ihrem Zimmer ungestört anzusehen. Sie ist vor drei Tagen in Paris abgestempelt. Inzwischen könnte er im Land sein und nach Westen fahren. Wie hatte er wissen können, dass Ed und sie nach über fünfzig Jahren noch zusammen hier leben würden?
Fünfzig Jahre.
»Tris, die Zecke.« – »Tris, die Kröte.« – »Tris, die Petze.« Mit zwölf Jahren hatte Ed eine ganze Sammlung von abfälligen Spitznamen für ihren neuen Stiefbruder gehabt. »Den müssen wir im Auge behalten, Billa.«
»Versuch, nett zu sein, Tristan, Liebling!« Die Stimme ihrer Mutter. »Ich weiß, dass es schwer für dich und Ed ist, aber ich möchte wirklich, dass ihr euch alle versteht. Tut es für mich! Wirst du es versuchen?«
Fünfzig Jahre. Billa zieht die Karte aus der Tasche und starrt sie an.
»Billa?« Eds Stimme. »Kommst du herunter? Abendessen ist fertig.«
»Ich komme«, ruft sie. »Einen winzigen Moment noch.«
Sie sieht sich um und nimmt ein Buch von dem kleinen Drehtisch – dem Nussbaumtischchen ihrer Mutter – und steckt die Postkarte hinein. Sie zieht die Vorhänge zu und sperrt die beiden Monde und den See aus. Dann geht Billa nach unten zu Ed.
Er beugt sich über das Essen, das er gekocht hat, und schmeckt die Sauce ab. Die Hähnchenschenkel sind über Nacht in mit Oregano und Knoblauch versetztem Rotweinessig mariniert und dann in Weißwein gegart worden, und jetzt betrachtet Ed beifällig das Ergebnis, das auf einem Teller angerichtet und mit Oliven, Kapern und Backpflaumen verziert ist. Es duftet köstlich. Eds Küche ist kapriziös, extravagant und gelegentlich auch katastrophal, aber er leistet gern seinen Beitrag. Groß und breitschultrig wie er ist, sieht er in seinem dunkelblauen Aran-Pullover, der an den Bündchen fusselt und an den Ellbogen geflickt ist, wie ein liebenswürdiger Bär aus. Als er sich bückt, um Teller aus dem Wärmeteil des Aga-Herdes zu nehmen, fällt ihm sein mit grauen Strähnen durchzogener Haarschopf in die Stirn. Eds Herangehensweise an das Leben ist einfach und gemütlich; er hasst Aufregung oder überschäumende Gefühle und hält sich selbst für unfähig, die Erwartungen anderer an ihn zu erfüllen. Die Frauen, die sich von seiner angeborenen Freundlichkeit und Sanftmut angezogen fühlen, verzweifeln an seiner Bindungsunfähigkeit. Er ist nach dem Studium direkt zu einem großen Verlag gegangen und dort bis zur Frührente geblieben, hat die Wochenenden aber immer hier in Mellinpons verbracht. Er hat seine Autoren – Naturforscher, Reisende, Gärtner – gehegt und gepflegt und die Präsentationen und Geschäftsessen genossen. Doch als er Mitte fünfzig war und seine kinderlos gebliebene Ehe auf eine einvernehmliche Scheidung hinsteuerte, hatte er beschlossen, wieder nach Cornwall zu ziehen. Sein eigenes, zwei Jahre später veröffentlichtes Buch Wildvögel der Halbinsel – war ein erstaunlicher Erfolg, was teilweise auf seine bezaubernden Tuschezeichnungen und schönen Fotos zurückzuführen war. In derselben Serie folgte darauf Wildvögel der Klippen und Küsten Cornwalls, und gerade jetzt plant er den Band Wildvögel der Binnenseen Cornwalls über den Colliford-, den Crowdy- und den Siblyback-See.
Zu seinem Bedauern ist ihr eigener See zu klein, um mehr als ein paar Wildenten zu beherbergen, und zu gezähmt für Reiherenten oder Haubentaucher. Zeitig im Frühjahr kommen die Frösche in Scharen, um im flachen Wasser herumzurutschen, sich aneinanderzuklammern und übereinanderzuklettern, und ihre Paarungsgesänge hallen unheimlich durch die Nacht.
Ed hebt die angewärmten Teller aus dem unteren Teil des Ofens. Billa und er waren hier in Mellinpons stets am glücklichsten gewesen und immer froh, das große Stadthaus in Truro hinter sich zu lassen, sobald die Sommerferien begannen. Er erinnert sich an die Aufregung, wenn die Stadt hinter ihnen zurückblieb. Sein Vater fuhr den großen Rover, neben ihm saß ihre Mutter, und Billa und er waren mit ihren Lieblingsspielzeugen und Büchern auf die Rückbank gepackt. Mellinpons war 1710 als Mühle errichtet und 1870 von Bauern aus der Gegend zu einer als Kooperative betriebenen Butterfabrik ausgebaut worden.
Der Zweig der Familie St. Enedoc, dem sie angehörten, war durch Bergbau zu Wohlstand gelangt, und Billas und Eds Urgroßvater hatte dieses Stück Land mit seiner – inzwischen stillgelegten – Mine, der Mühle und ein paar Cottages in den 1870er Jahren erworben. 1939, als die Männer in den Krieg gerufen worden waren, war die Butterfabrik geschlossen worden und hatte brachgelegen, bis Harry St. Enedoc beschloss, sie umzubauen. Mellinpons war sein Nachkriegsprojekt. Er hatte im Krieg Schlimmes erlebt und danach nur noch wenig Interesse für das Familienunternehmen aufgebracht, seinen Abteilungsleitern größere Verantwortung übertragen und war aus den Vorständen der großen Bergwerksgesellschaften zurückgetreten, bis er schließlich mit seiner Familie aus Truro wegzog und sich in diesem stillen Tal niederließ. Danach lebte er nur noch sechs Jahre und starb dann.
Merkwürdig, denkt Ed, dass der Einfluss seines Vaters in der Butterfabrik noch so stark zu spüren ist, obwohl er nur so kurz hier gelebt hat. Es war seine Idee gewesen, den alten Mühlstein als Kaminplatte unter einen Kaminsims aus Granit zu setzen, der eine ganze Ecke der Eingangshalle einnimmt. Vor dort aus sieht man vorbei an der offenen Galerie bis zu den gewaltigen schwarzen Balken hoch am Dach hinauf. Auch das Panoramafenster mit dem Blick auf das Tal hatte er einbauen lassen. Der aus den dicken Granitwänden herausgehauene Alkoven ist groß und tief genug, um Platz für zwei Sessel zu bieten. Ihr Vater hat der alten Butterfabrik auch den Namen Mellinpons gegeben, die »Mühle auf der Brücke«.
Ed setzt die Teller auf den riesigen Küchentisch mit der Schieferplatte, auf der früher die Butter zu Blöcken geformt wurde. Als Billa hereinkommt, blickt er auf.
»Das sieht gut aus«, meint sie anerkennend.
Die Küche ist warm und von köstlichen Düften erfüllt, Miles Davis spielt I’ll remember April, während Eds Neufundländer, der tabakbraun ist und Bär heißt, weil er als Welpe wie ein Braunbärenjunges aussah, friedlich auf einem alten, durchgesessenen Sofa unter dem Fenster schläft. Billa sieht entschlossen über das Chaos hinweg, das Ed bestimmt am fürs Geschäftliche bestimmten Ende der Küche angerichtet hat, und setzt sich an den Tisch. Der große Hund hebt den Kopf, registriert ihr Eintreten und rollt sich wieder zusammen. Gemächlich wedelt er mit dem Schwanz; eigentlich schlägt er zur Begrüßung nur ein-, zweimal damit auf die fadenscheinige Decke und schläft dann weiter.
»Steh bloß nicht extra auf!«, meint Billa trocken zu ihm.
»Wird er nicht«, sagt Ed gelassen. »Wäre ja viel zu anstrengend.«
Er löffelt etwas Hähnchen und Sauce auf einen schönen alten Spode-Teller, dessen Goldauflage fast abgetragen ist, und reicht ihn Billa. In einer Keramikschale von Clarice Cliff gibt es Püree aus gerösteten Pastinaken, und auf einer Platte aus Mason-Steingut liegen ein paar Strünke violetter Brokkoli. Ed wählt seine Teller nach Design und Farbe aus, aber nicht danach, ob sie zusammenpassen. Merkwürdigerweise funktioniert es jedoch: alt oder neu, kostbar oder wertlos – alle führen eine fröhliche Koexistenz. Der Tisch ist nur teilweise frei geräumt: Sämereienkataloge, ein Fernglas, ein paar alte Tageszeitungen sowie der Terminkalender, der vor wichtigen Zetteln mit Adressen, Telefonnummern und den Notizen, die sich Ed beim Telefonieren macht, aus den Nähten platzt, sind über die schwarze Schieferplatte verstreut. Ein mit Alpenveilchen bepflanzter Terrakottatopf steht neben einem hübschen, mehrarmigen Kerzenleuchter aus Silber.
Ed füllt Billas Glas mit Wein, einem weichen südafrikanischen Merlot, der am Herd Zimmertemperatur angenommen hat, und setzt sich. Er erzählt begeistert von seinen Plänen, wilde Blumen und Gräser auf der kleinen Wiese auszusäen und mehr Blumenzwiebeln unter die große Rotbuche zu setzen. Die ganze Zeit über, während sie nickt und »hmm, gute Idee«, sagt, schleichen ihre Gedanken um die Worte auf der Postkarte herum.
Ed bemerkt, dass sie zerstreut ist, sagt aber nichts. Sie interessiert sich allgemein mehr für ihre wohltätige Arbeit für das hiesige Hospiz als für sein Schreiben und Zeichnen, seine Bemühungen um die Entwicklung des Landes am Wasserlauf und seine Studien über Wildtiere. Das ist Eds uneingeschränktes Reich, und Billa versucht gar nicht, ihm auf einem dieser Gebiete Ratschläge zu erteilen.
Während er die Teller abräumt und dabei ein paar leckere Brocken in Bärs Napf fallen lässt, denkt er über Billas Ehe mit dem viel älteren bekannten Physiker Philip Huxley nach. Ed war schon immer der Überzeugung, dass die Beziehung auf Billas Seite eher auf Heldenverehrung denn auf Leidenschaft beruhte und auf Philips Seite auf einer beinahe väterlichen Freundlichkeit. Billa war nach und nach durch eine Reihe verheerender Fehlgeburten geschwächt worden und hatte ihren Kummer durch ihre Arbeit als Leiterin der Fundraising-Abteilung einer großen Hilfsorganisation für behinderte Kinder kompensiert. Sie hatte Philip während seiner langen letzten Krankheit gepflegt und war dann wieder nach Mellinpons gezogen. Doch selbst jetzt, als Witwe und im Ruhestand, ist Billa immer noch stark, und Ed ist froh darüber, dass sein Fachgebiet außerhalb ihres Tätigkeitsbereichs liegt. Die beiden kommen sehr gut miteinander aus.
Bär klettert von seinem Sofa und inspiziert den Inhalt seines Napfs. Er sieht zu Ed auf, als wollte er sagen: Was bitte soll das sein?
»Nichts für dich, Alter?«, fragt Ed besorgt. »Zu viel Oregano vielleicht?«
Billa verdreht die Augen. »Wahrscheinlich möchte er lieber von dem Spode-Teller fressen.«
»Kann schon sein«, antwortet Ed völlig unberührt von ihrem Sarkasmus, »doch davon sind nur noch zwei Stück da. Soweit ich mich erinnere, haben sie Urgroßmutter gehört, und ich schätze sie sehr. Aber du hast schon recht, Bär, deine alte angeschlagene Emailschüssel ist ziemlich schäbig, was?«
Billa lacht schallend. »Armer Bär! Wir kaufen ihm zum Geburtstag eine neue. Soll ich jetzt Kaffee kochen, oder übernimmst du das?«
Das Lachen nimmt ihr einen Teil der Spannung, und sie fühlt sich wieder kräftiger. Was kann Tristan ihnen heute schließlich noch tun? Dieser spezielle Teil der Vergangenheit ist lange vorbei und abgeschlossen.
Doch als sie jetzt Ed beim Kaffeekochen zusieht, verschwimmt seine Gestalt, und Billa sieht stattdessen ihre Mutter, die im Stehen mit Tassen und Untertellern hantiert und dem Blick ihrer Kinder ausweicht, die nebeneinander am Tisch sitzen.
»Ich weiß, dass es zuerst schwer sein wird«, erklärte sie schnell, während ihre Hände sich mit dem Wasserkessel und der Teedose beschäftigen. »Aber ich weiß auch, dass ihr ihn genauso lieben werdet wie ich, wenn ihr ihn erst einmal kennenlernt. Schließlich ist euer Vater jetzt über fünf Jahre tot, und …« Der Kessel begann zu singen, und sie nahm ihn von der Kochplatte. »Und ich möchte, dass ihr euch wirklich Mühe gebt zu verstehen, wie einsam ich bin, wenn ihr in der Schule seid …«
»Wir brauchen ja nicht beide aufs Internat zu gehen.« Billas Stimme klang rau vor Besorgnis. Der Anblick ihrer so nervösen und flehentlich bittenden Mutter war Furcht einflößend und peinlich. »Ich brauche nicht weg zu sein«, sagte sie. »Ed natürlich schon, vor allem, weil er ja jetzt einen Platz in Sherborne hat, aber ich könnte ja als Externe auf die Schule in Truro gehen.«
»Aber Liebling …« Endlich schaute ihre Mutter sie beide an, und Billa sah, dass sie ihr Glück und ihre Aufregung nicht verbergen konnte. Sie streckte ihnen die Hände entgegen wie ein Kind bei einer Party, das sie zum Mitspielen einlädt. »Andrew und ich lieben uns, versteht ihr? Ich glaube, ihr seid alt genug, um das zu begreifen. Versteht ihr, ich bin so glücklich.«
Ed spürte die Anspannung seiner Schwester.
»Vielleicht verstehen wir es ja«, sagte er höflich, »wenn wir …« Er stolperte über die Worte »diesen Mann« oder »ihn« und entschied sich dann unsicher für »Andrew«. »… wenn wir Andrew kennengelernt haben«, schloss er mit festerer Stimme.
Ihre Mutter goss Tee auf, obwohl Billa sehen konnte, dass ihre Hände zitterten. »Und«, erklärte sie in einem speziellen Tonfall, als wäre das eine besondere Dreingabe, »Andrew hat auch einen Sohn namens Tristan. Er ist zehn, zwei Jahre jünger als du, Ed, und ich bin mir sicher, dass wir sehr glücklich zusammen sein werden. Wieder eine richtige Familie. Die beiden werden hierher zu uns nach Mellinpons ziehen.«
Billa und Ed waren so fassungslos, dass es ihnen die Sprache verschlug. Ein zehnjähriger Junge. Tristan. Der hier in ihrem Haus leben sollte.
Unter dem Tisch, wo niemand es sehen konnte, streckte Billa die Hand nach Ed aus und legte sie fest um sein Handgelenk. Wie versteinert starrten sie ihre Mutter an, die durch die Küche kam und den Tee auf den Tisch stellte.
Ed schiebt Billas Kaffeetasse auf sie zu, sieht sie an und beugt sich dann ein wenig vor, um sie genauer zu mustern. »Geht’s dir gut?«, fragt er.
Stirnrunzelnd erwidert sie seinen Blick und nickt. »Tut mir leid«, sagt sie. »Einen Moment war ich abgelenkt. Ich habe gerade daran gedacht, wie Mutter uns eröffnete, dass sie diesen abscheulichen Andrew heiraten würde.«
»Wahrscheinlich war er gar nicht so übel«, meint Ed. »Für ihn kann es auch nicht leicht gewesen sein.«
»Wir waren einfach im falschen Alter«, sagt Billa nachdenklich. »Vierzehn ist nicht das richtige Alter, um zuzusehen, wie sich die eigene Mutter leidenschaftlich verliebt. Natürlich war Andrew auf eine ungewöhnliche Art sehr attraktiv, aber sie war so verrückt nach ihm, dass es schon peinlich war, vor allem in der Öffentlichkeit. Ich habe sie schließlich nicht mehr zu Schulveranstaltungen eingeladen, weil ich die Demütigung nicht ertragen habe. Mädchen können so grausam sein!«
»Für mich war es leichter.« Ed setzt sich an den Tisch. »Andrew kannte sich ziemlich gut mit Sachen wie Rugby und Kricket aus. Ich konnte eher diese kleine Wanze nicht ausstehen, Tris. Der war so eine Giftspritze, oder?«
Billa schweigt und denkt an die Postkarte, und erneut zieht sich ihr Magen vor Panik zusammen. »Hmm«, sagt sie, denn sie will nicht über Tristan reden, und beugt den Kopf über die Tasse, damit Ed ihre Miene nicht sieht. Kurz darauf steht sie auf und nimmt ihren Kaffeebecher. »Ich sehe mal meine E-Mails nach«, erklärt sie.
Ed trinkt seinen Kaffee, und Bär kommt herüber und lehnt sich schwer gegen ihn. Eds Stuhl rutscht langsam seitwärts über den großen Teppich weg, der über den Schieferboden geworfen ist, bis Bär langsam zu Boden sinkt. Miles Davis’ Trompete verklingt, und Ed steht auf, um die Kerzen auszublasen, und beginnt, das Abendessen abzuräumen. Während er die Teller, die in die Spülmaschine können, von den empfindlicheren Teilen – den Spode-Tellern und der Clarice-Cliff-Schale – trennt, grübelt er über Billas Gedankenverlorenheit nach. Sie ist schon den ganzen Tag nervös, doch er weiß, dass jede Art von Fragen oder Besorgnis dazu führen werden, dass sie sofort abstreitet, dass etwas nicht stimmt. Und bei den seltenen Gelegenheiten, wenn sie eine Sorge oder Angst mit ihm teilt, nimmt sie das gleich wieder zurück. »Aber es ist in Ordnung. Wirklich, alles bestens«, setzt sie dann hinzu, zieht sich eilig vor jedem Trost zurück, den er ihr vielleicht bieten könnte, und wechselt das Thema.
Sogar als Kind hat sie nach dem Tod ihres Vaters ihre eigene Last getragen, ihre eigenen Entscheidungen getroffen. Als sie klein waren, hat Ed sich stark auf sie gestützt. Ihre eifrige, leidenschaftliche Vitalität hat seiner ruhigen, gedämpften Persönlichkeit Farbe verliehen und ihm etwas von Billas Brillanz geschenkt. Sie hat ihn tapfer gemacht, indem sie über seine Ängste lachte und ihn über die bescheidenen Grenzen, die er sich selbst setzte, hinaus anfeuerte.
Nachdem ihr Vater an einem kalten Tag im März plötzlich gestorben war, ließ sie der Schock wochenlang verstummen, und ihre Miene war starr vor Leid. Damals war Billa neun Jahre alt und Ed sieben, und die Art und Tiefe ihres Kummers jagte ihm Angst ein und schwächte sein eigenes Verlustgefühl. Er lenkte seinen Schmerz und seine Panik vor dem Tod in die Konzentration auf das Leben, das um ihn herum herzlos weiterbrodelte. Der kalte, süße Frühling, wie lebendig und großzügig er ist – und in seinem Überfluss beinahe verschwenderisch! In dieser Zeit bemerkte er, dass viele Wildblumen gelb sind, und zum ersten Mal legte er eine Liste an, die erste von vielen, die noch folgen sollten. Es wurde zu einer Prüfung, einer Herausforderung, und er konnte sich wunderbar darauf konzentrieren.
Weidenkätzchen – schrieb er in seiner rundlichen Kinderhandschrift –, Schlüsselblumen, Narzissen, Primeln, Löwenzahn, Butterblumen, Schöllkraut, Sumpfdotterblumen. Neben jeden Namen zeichnete er ein Bild der Blume und malte es sorgfältig aus. Dabei fiel ihm die große Bandbreite von Gelbtönen in der Natur auf: Dottergelb, Zitronengelb, Cremegelb. Die Weidenkätzchen waren vielleicht ein wenig gepfuscht, weil sie eher grau als gelb waren, aber er schrieb sie trotzdem dazu. Billa beobachtete ihn, tief in ihr Elend versunken.
»Was machst du da?«
»Eine Liste aller gelben Blumen, die ich kenne«, gab er abwehrend zurück, für den Fall, dass seine Beschäftigung unter den gegebenen Umständen als zu unterhaltsam betrachtet werden könnte. »Fast alle wilden Frühlingsblumen sind gelb, Billa.«
Er sah ihr an, dass sie versuchte, sich welche einfallen zu lassen, die nicht gelb waren, um zu beweisen, dass er sich irrte. Aber selbst das schien ihr zu viel zu sein, was ihm noch mehr Angst einjagte.
»Was hast du denn bis jetzt?«, fragte sie düster.
Er las ihr seine Liste vor und sah zu, wie Billa sich den Kopf zerbrach, um auf etwas zu kommen, das er vergessen hatte. Er wünschte, sie würde weitermachen, denn er sehnte sich nach der alten, lebhaften Billa, die ihn auf Trab hielt.
»Stechginster!«, rief sie schließlich triumphierend aus. Und er fühlte sich ganz schwach vor Erleichterung, als hätten sie einen wichtigen Meilenstein überwunden. »Und Forsythien.«
Sie buchstabiere es ihm, und er schrieb es gehorsam nieder. Dabei verzichtete er auf die Bemerkung, dass Forsythien keine Wildblumen waren, sondern ein kultivierter Gartenstrauch. Trotzdem pochte sein Herz vor unbändiger Freude: Ihre Rollen hatten sich vertauscht, und er hatte sie vom Rand des Abgrunds zurückgezogen. Doch eigentlich war es Dom, der die beiden wirklich aus ihrer Verzweiflung rettete.
»Dominic ist so eine Art Verwandter«, erklärte ihre Mutter ihnen. Sie wirkte unbehaglich, als würde sie lieber nicht darüber sprechen, aber Billa und er hatten nur die Neuigkeit im Kopf, dass Mrs. Tregellis’ Enkelsohn zu ihr in ihr Cottage weiter unten an der Straße gezogen war.
»Er ist zwölf«, sagte Billa zu ihr, »und er ist ganz allein mit dem Zug den weiten Weg von Bristol gekommen. Und er sieht genau wie Ed aus. Das ist so komisch! Mrs. Tregellis hat uns erzählt, wir wären verwandt.«
Und an diesem Punkt sagte ihre Mutter es. »Dominic ist tatsächlich so eine Art Verwandter.« Das Blut war ihr in die Wangen gestiegen und ließ sie dunkelrot erscheinen, und sie hatte den Mund zu einer schmalen Linie zusammengepresst, aber sie waren so aufgeregt, dass es ihnen nicht besonders auffiel. Doms Ankunft lenkte sie von ihrem Kummer ab und gab ihnen etwas Neues, über das sie nachdenken konnten.
Das durchdringende Schrillen des Telefons unterbricht Eds Gedanken. Als er sich die Hände abtrocknet und nach dem Hörer greift, verstummt das Klingeln, und er weiß, dass Billa an den anderen Apparat gegangen ist. Wahrscheinlich einer ihrer Kollegen von der Wohlfahrt. Er schenkt sich noch Kaffee ein und nimmt die CD von Miles Davis aus dem Player. Er räumt sie weg, zögert vor dem Regal, in dem sich weitere CDs stapeln, und wählt dann eine Aufnahme von Dinah Washington.
Billa beendet das Gespräch mit dem Kassenwart, legt den Hörer wieder auf die Gabel und starrt den Computerbildschirm an. Der kleine Raum neben der Küche ist jetzt ihr Büro. Ein alter Waschtisch aus Kiefernholz dient ihr als Schreibtisch, und Eds Kiste, in der er im Internat seine persönlichen Gegenstände aufbewahrt hat, ist ihr Aktenschrank. Sie ist erstaunlich unordentlich. Sogar Ed, der kein methodischer Mensch ist, verschlägt die Unordnung in Billas Büro die Sprache.
»Wie bist du bloß klargekommen, als du noch gearbeitet hast?«, hat er einmal, beeindruckt von dem Ausmaß ihrer Schlamperei, gefragt.
»Ich hatte eine Assistentin und eine Sekretärin«, antwortete sie knapp. »Ich wurde nicht dafür bezahlt, die Ablage zu machen, sondern für meine Ideen, Spenden zu sammeln.«
Zettel, Bücher und Briefe stapeln sich auf dem Boden, auf dem Schreibtisch, auf dem Lloyd-Loom-Stuhl, auf dem tiefen Fenstersims aus Granit. Ab und zu startet sie eine Aufräumaktion.
»Dem Himmel sei Dank, dass heute so viel per E-Mail erledigt wird!«, pflegt sie dann zu sagen und tritt in die Küche. Ihr kurzes blondes Haar steht nach solch einer ungeliebten Arbeit in die Höhe, und sie hat die Hemdsärmel aufgekrempelt. »Sei ein Schatz und mach mir Kaffee, Ed! Ich sterbe vor Durst.«
Jetzt starrt sie die E-Mail über Fundraising bei einer Veranstaltung in Wadebridge an und denkt dabei an Tristan. Ihre erste instinktive Reaktion ist es, Ed zu schützen, ihre zweite, mit Dom zu reden. Ihr ganzes Leben lang – jedenfalls seit ihr Vater starb und ihr Sicherheitsgefühl unwiderruflich zerstört wurde – hat sie sich an Dom gewandt, um Rat oder Trost zu suchen. Sogar als er im Ausland, in Südafrika, arbeitete, und auch nach seiner Heirat hat sie ihm geschrieben und Freud und Leid mit ihm geteilt. Sie fühlt sich untrennbar mit ihm verbunden. Von Anfang an war es, als wäre ihr Vater in Gestalt des jungen Dom zu ihnen zurückgekehrt.
Er baute Dämme über den Bach und ein Baumhaus in der Buche im Wald – wenn auch nicht allzu hoch, weil Ed noch klein war – und zeigte ihnen, wie man ein Lagerfeuer anzündet und ganz einfache Mahlzeiten kocht. Den ganzen langen Sommer über – der Sommer nach dem Tod ihres Vaters – war Dom mit ihnen zusammen. Er war groß und stark und einfallsreich, und die ganze Zeit über erkannten sie seinen Blick, die Art, wie er lachte, den Kopf zurückwarf oder seine Hände gebrauchte, um etwas zu beschreiben, indem er es in der Luft formte. Billa fühlte sich so sicher bei ihm, fast, als wäre ihr Vater wieder bei ihnen, aber wieder jung und unbekümmert und lustig.
Ihre Mutter reagierte kühl auf ihre Begeisterung – und sie waren sich ihrer Trauer zu sehr bewusst, um sie aufregen zu wollen. Außerdem hielt sich Dom lieber im gemütlichen Cottage seiner Granny auf oder in der wilden Landschaft dahinter als in der alten Butterfabrik und ihrem Gelände.
»Ich frage mich, wie wir jetzt zurechtkommen sollen«, sagte Billa zu Dom, während sie zusahen, wie Ed in dem ruhigen, tiefen Wasser hinter dem Damm planschte. »Ohne Daddy, meine ich. Ed ist noch zu klein, um die Verantwortung zu übernehmen, und Mutter ist …«
Sie zögerte, denn sie kannte das richtige Wort für ihre instinktive Wahrnehmung nicht, für die Bedürftigkeit ihrer Mutter und ihre Abhängigkeit von anderen, ihre Stimmungsumschwünge zwischen Tränen und Lachen und ihre Instabilität.
Holztauben gurrten behaglich in dem hohen Blätterdach, das ihr Lager mit bebenden Mustern aus Sonnenlicht und Schatten übergoss. Hohe Fingerhutstauden klebten in den Rissen der alten, steinernen Fußgängerbrücke über den Bach, wo winzige Fische durch das klare, seichte Wasser huschten.
»Mein Vater ist auch tot«, erklärte Dom. »Ich habe ihn nie kennengelernt. Er war im Krieg bei der Marine und ist gefallen, als ich noch ganz klein war.«
Noch so ein wundersamer Zufall. »Unser Vater war auch bei der Marine«, sagte sie. »Er hätte auch umkommen können, doch er ist nur verletzt worden. Aber deshalb ist er auch gestorben. Zuerst die Verletzung, und dann hatte er einen Herzanfall. Ich weiß nicht, was Mutter ohne ihn anfangen wird.«
Von ihrem eigenen überwältigenden Verlustgefühl und dem Schmerz sprach sie nicht.
»Meine Mutter arbeitet«, sagte Dom. »Inzwischen arbeitet sie. Deswegen bin ich auch allein gefahren. Sie findet, ich bin jetzt alt genug.«
»Ich bin froh, dass du gekommen bist«, sagte Billa. »Wir beide sind das. Und wir freuen uns, dass du mit uns verwandt bist.«
Mit ernster Miene sah er sie an. »Komisch, was?«, murmelte er, und sie spürte einen kleinen Schreck – und Aufregung. Er war ihr so vertraut und doch ein Fremder. Am liebsten hätte sie ihn berührt und wäre immer in seiner Nähe gewesen.
Jetzt greift Billa spontan zum Telefon und drückt eine Reihe von Tasten.
»Dominic Blake hier.« Dominics kühle, unpersönliche Stimme beruhigt sie sofort.
»Ich bin’s, Dom. Ich hatte mich nur gefragt, ob ich vielleicht morgen Vormittag bei dir vorbeikommen kann.«
»Billa. Ja, natürlich. Alles in Ordnung?«
»Ja. Na ja …«
»Du klingst nicht besonders sicher.«
»Nein. Die Sache ist die …« Instinktiv spricht sie leiser. »Wir haben eine Ansichtskarte von Tristan bekommen.«
»Tristan?«
»Ja. Komisch, oder, nach so vielen Jahren?«
»Was will er?«
»Das ist ja die Sache. Er schreibt, er kommt uns vielleicht besuchen.«
In dem Schweigen, das jetzt eintritt, kann sie sich Doms Gesicht vorstellen, diese konzentrierte, nachdenkliche Miene, bei der er die braunen Augen zusammenzieht, und sein dichtes Haar, das schwarz und von dicken grauen Strähnen durchzogen ist wie Eds. Die geraden Augenbrauen sind gerunzelt.
»Was sagt denn Ed dazu?«
»Ich habe es ihm noch nicht erzählt. Ich will nicht, dass er sich Sorgen macht.«
Sie hört das nachsichtige, amüsierte Schnauben, mit dem Dom ihr tief verwurzeltes Gefühl quittiert, für Eds Wohlergehen verantwortlich zu sein.
»Du nimmst also an, dass es Grund zur Sorge gibt?«
»Du nicht? Fünfzig Jahre kein Wort und dann eine Postkarte. Woher wusste er, dass wir beide noch hier leben?«
»Wo ist sie denn abgestempelt?«
»Paris. Ist Tilly bei dir?«
»Ja. Wir haben gerade zu Abend gegessen.«
»Ist sie morgen früh auch da?«
»Gegen zehn müsste sie weg sein.«
»Dann komme ich gegen elf.«
»Okay.«
Billa seufzt erleichtert. Als sie den Hörer wieder auf die Gabel legt, hört sie Dinah Washington It could happen to you singen. Durch die Küche geht sie in die Eingangshalle, wo Ed Scheite auf das Feuer stapelt und Bär an seinem Lieblingsplatz auf den kühlen Schieferplatten bei der Haustür liegt. Billa betrachtet sie und fühlt sich von überwältigender Zuneigung zu beiden erfüllt.
Morgen wird sie mit Dom sprechen; alles wird gut.
2. Kapitel
Dom steht still und mit nachdenklicher Miene da, die Arme vor der Brust verschränkt. Tristan, Eds und Billas Stiefbruder. Er ruft sich das Gesicht des Jungen vor sein inneres Auge: schmal, scharf geschnitten, gut aussehend, eiskalte graue Augen, die einen ausdruckslos und herausfordernd anstarren. Dom war achtzehn, als er Tristan Carr zum ersten Mal begegnete, und er hatte noch nie bei einem so jungen Menschen eine solche Zerstörungskraft wahrgenommen. Sogar heute noch, über fünfzig Jahre später, erinnert sich Dom an den Schock dieser Begegnung: ein Gefühl wie von einem Faustschlag in die Magengrube.
Er war zurück in Cornwall und hatte einen Platz an der Camborne School of Mines, wo er Bergbauwesen studieren sollte. Er fühlte sich stark, stolz und frei, und er konnte es kaum abwarten, Billa und Ed zu sehen, besonders die arme Billa, die ihm in einem Brief von der katastrophalen zweiten Ehe ihrer Mutter erzählt hatte.
Warte ab, bis du den abscheulichen Tris triffst!, hatte sie geschrieben. Er ist richtig widerlich. Ich bin froh, dass Ed und ich das ganze Schuljahr über im Internat sind. Ed wird es nie mit Tris aufnehmen können. Und ich auch nicht …
Dom schrieb zurück, versuchte, sie zu trösten und ihre Abneigung herunterzuspielen.
So übel kann er doch gar nicht sein, oder?, hatte er geantwortet. Sagtest du nicht, er wäre erst zehn? Ich bin mir sicher, dass du einem Zehnjährigen mühelos gewachsen bist …
Als er jetzt den Fahrweg zur alten Butterfabrik entlangging, bewegte sich ein Schatten unter der Esche, und ein drahtiger Knabe mit rotbraunem Haar trat Dom in den Weg. Dieser Junge starrte ihn kurz an – er musste zu Dom aufsehen, was ihn aber nicht zu stören schien –, und dann schoss seine linke Augenbraue nach oben, und seine Lippen zuckten belustigt, als erkenne er ihn.
»Aha, du bist also der Bastard«, bemerkte er leichthin …
Selbst jetzt noch, viele Jahre später, ballt Dom die Fäuste bei dem Gedanken an diese Begegnung. Fragmentarisch und wahllos überfallen ihn Erinnerungen: das kleine Haus in Bristol, in dem er und seine Mutter mit einer Cousine zusammenlebten, und wie sie sich alle drei unter dem Küchentisch zusammendrängten, als die Bomben fielen. Sein Vater, James Blake, erklärten sie ihm, sei fort, auf See, im Krieg – und dann war er tot. Später kam die kleine Schule um die Ecke, und dann, als Dom acht und der Krieg schon vorüber war, das Bewerbungsgespräch an der Domschule. Er verdiente sich ein Stipendium, sang im Chor, wurde größer. Und die ganze Zeit über war da eine schattenhafte Präsenz, jemand im Hintergrund, der ihnen Geld schickte und sie unterstützte.
»Ein Verwandter«, erklärte seine Mutter ausweichend. »Du hast Verwandte unten in Cornwall. Nein, nicht Granny. Noch andere Verwandte. Ich erzähl’s dir, wenn du älter bist.« Aber schließlich war es Granny, die es ihm sagte.
Und jetzt verschieben und verändern sich die Erinnerungen. An einem heißen Juninachmittag war er mit Billa im Küchengarten. Grannys Gemüsegarten, wo der Duft der Kräuter und des Lavendels in der warmen Luft hing, war ein geradezu magischer Ort. Als ihr Mann 1919 bei dem Grubenunglück von Levant starb, war sie erst zwanzig. Der alte Matthew St. Enedoc erlaubte ihr, so lange in dem Cottage zu wohnen, wie sie die symbolische Pacht bezahlen konnte. Also hatte sie sich eine Stelle in der alten Butterfabrik gesucht und ihre ganze Leidenschaft auf ihre sechs Monate alte Tochter Mary und den Garten hinter dem Häuschen übertragen.
Sie pflanzte das notwendige Gemüse an – so viel, wie es auf ihrer kleinen Parzelle möglich war –, aber sie liebte Blumen und setzte ihre Lieblingsblumen zwischen die Gemüsepflanzen. Zarte Wicken kletterten an den Erbsenreisern empor, Sonnenblumen steckten die gelben Köpfe aus den Wigwams aus Weidenzweigen, die die Stangenbohnen stützten, und am Rand der schmalen Wege wuchs Lavendel. Kapuzinerkresse spross neben Glockenblumen, Geranien und Dianthuskraut über die Steinmauer. Zwischen Salatköpfen, Roter Beete und Mangold mit seinen roten und gelben Stängeln wuchsen Kräuterbüschel; Fenchel, Basilikum, Schnittlauch, Rosmarin und Thymian.
Die junge Witwe hegte ihren Garten fast so leidenschaftlich, wie sie für ihr Kind sorgte, das neben ihr hertappte, hinfiel, einen Schmetterling jagte oder sich plötzlich hinsetzte, um einen Stock oder Stein zu untersuchen. Das Kind wuchs, besuchte die kleine Dorfschule und wurde zu einem schönen Mädchen – und die ganze Zeit über grollten die Gerüchte über einen neuen Krieg wie ferner Kanonendonner. Und dann kam der junge Harry St. Enedoc. Sein Vater war verstorben, und er war ihr neuer Grundherr. Er fuhr ein schickes, glänzendes Automobil und war freundlich und amüsant. Zu Beginn waren die beiden Frauen schüchtern, doch dann begannen sie, sich zu entspannen. Er trank Tee in der kleinen Wohnstube, neckte Mary und machte ihrer Mutter Komplimente über ihren köstlichen Kuchen, bevor er auf dem Fahrweg zur Butterfabrik weiterfuhr.
»Er ist nett«, sagte Mary. Ihre Augen strahlten, und ihre Wangen waren so rot wie die Mohnblumen im Gemüsegarten.
»Ja«, antwortete ihre Mutter und betrachtete ihre Tochter in einer Mischung aus Furcht und herzzerreißendem Mitgefühl. »Vielleicht ein bisschen zu nett für uns.«
Doch Mary hörte nicht zu. Verträumt drehte sie eine ihrer Haarsträhnen und schlenderte bald auf die Straße hinaus …
Aber an diesem Juninachmittag achtzehn Jahre später, als Dom und Billa im Gemüsegarten Erbsen pflückten, hatte Granny ihm diese Geschichte noch nicht erzählt.
Billa war wütend. Während sie die Erbsenschoten von ihren Stängeln drehte, erzählte sie ihm, dass ihre Mutter diesen Mann namens Andrew heiraten würde und er einen Sohn hatte, der Tristan hieß und bei ihnen wohnen würde, und dass das Leben nie wieder wie früher sein würde. Billa war vierzehn; Dom fast achtzehn. Fünf Jahre lang waren sie und Dom und Ed während der langen Sommerferien unzertrennlich gewesen. Heute blieb ihr weizenblondes Haar an den Blättern hängen, und in ihren veilchenblauen Augen glänzten Tränen. Mit bebenden Lippen sah sie zu ihm auf, und Dom legte einen Arm um sie und zog sie an sich, ohne darüber nachzudenken, was er tat. Zu seiner Überraschung – und Freude – schlang sie beide Arme um ihn und klammerte sich an ihn.
»Was sollen wir nur tun?«, schluchzte sie. »Es wird nicht mehr wie vorher sein, oder? Das wird alles verderben.«
Er hielt sie in den Armen und tröstete sie, und dann sah er, dass Granny sie vom schmalen Weg aus beobachtete. Etwas an ihrer Miene brachte ihn dazu, sich rasch loszumachen, obwohl er behutsam mit Billa umging und sie zum Pfad führte, wo Granny ihm Billa abnahm und sie ins Haus brachte.
Granny brühte Tee auf, hörte Billa zu und ging dann mit ihr zurück zur alten Butterfabrik. Dom wies sie an, das Kartoffelbeet umzugraben. Er arbeitete hart und verausgabte sich im heißen Sonnenschein, bis Granny zurückkam und ihm hier, auf der kleinen Bank inmitten der Düfte des Küchengartens, von dem jungen Harry St. Enedoc und seinem schnellen, schicken Auto erzählte.
Sie erklärte ihm, dass Harry nichts davon gewusst hatte. Er war in den Krieg gezogen, ein paar Monate bevor Mary ihrer Mutter weinend und verzweifelt von geheimen Treffen im Wald am Bach erzählte – und von dem Ergebnis, das unter ihrem Herzen heranwuchs. Ihre Mutter zerbrach sich den Kopf über die Folgen. Sie stellte sich das Gerede im Dorf vor, wie der pikante Klatsch eifrig von einem zum anderen weitergetragen werden würde. Sie dachte an ihre Cousine Sally in Bristol. Sally hatte eine gute Partie gemacht, war jedoch früh verwitwet und kinderlos. Vielleicht wäre es ihr recht, während der dunklen Kriegstage Gesellschaft zu haben. Und so schickte sie Mary über den Tamar ins ferne Bristol, um Cousine Sally zu helfen; und bald freuten sich ihre alten Freunde und Nachbarn in Cornwall sehr für sie, als sich die Nachricht verbreitete, Mary habe einen netten jungen Seemann namens James Blake kennengelernt, und ein Kind sei unterwegs. Und als der nette junge Seemann drei Jahre später, 1942, auf See fiel, war das inzwischen eine ganz alltägliche Sache, und die Menschen verhielten sich mitfühlend, waren aber nicht schockiert oder auch nur erstaunt.
Dom war beides. Er saß auf der kleinen Bank, und ihm schwirrte der Kopf von dieser erstaunlichen Geschichte. Granny beobachtete ihn. Sie berührte ihn nicht und achtete darauf, dass ihre Stimme fest, doch unbeschwert klang.
Und dann, erzählte sie weiter, kehrte Harry St. Enedoc aus dem Krieg zurück. Er war zweimal torpediert worden und nicht besonders gut in Form, aber er hatte in der Zwischenzeit geheiratet und plante, die alte Butterfabrik umzubauen. Er hatte sich nach Mary erkundigt, und da hatte sie, Granny, ihm die Wahrheit gesagt.
Kurz saß sie schweigend da, als sähe sie wieder Harrys schockierte Miene vor sich. »Oh, mein Gott!«, sagte er. »Oh, mein Gott, ich hatte ja keine Ahnung! Ich schwöre, dass ich nichts davon wusste, Mrs. Tregellis.« Und sie hatte ihm geglaubt, ihm Tee gekocht und ihm von Mary und Dom erzählt – und sie hatte ihm einen Schnappschuss von seinem Sohn gezeigt.
Harry hatte weder angezweifelt noch abgestritten, dass er der Vater war, sondern nur das Foto angestarrt. »Ich habe eine kleine Tochter, Wilhelmina«, sagte er. »Und meine Frau erwartet noch ein Kind.« Er hatte sie angesehen und trotz seiner achtundzwanzig Jahre selbst wie ein Kind gewirkt. »Das kann ich Elinor nicht sagen«, hatte er erklärt. »Unmöglich. Das würde sie mir nie verzeihen.«
Irgendwie regelten er und Granny alles. Als der alte Mr. Potts im Nachbarcottage starb, ließ Harry beide Cottages auf Dom überschreiben und setzte Granny als Treuhänderin ein. Harry zahlte seine Schuluniformen und alle Gebühren, die sein Stipendium nicht abdeckte, und half, wo er konnte. Aber er suchte das kleine Haus in Bristol nicht auf, und Mary und Dom kamen nur nach Cornwall, wenn die St. Enedocs fort waren. Granny fuhr mit dem Zug, um ihre Tochter und ihren Enkelsohn zu besuchen, bis Harry St. Enedoc starb, als Dom zwölf war und man der Meinung war, er sei alt genug, um allein mit dem Zug nach Cornwall zu fahren.
Wieder trat ein kurzes Schweigen ein, während Granny ihn beobachtete und Dom sich an den ersten Besuch in Cornwall erinnerte. Billa und Ed waren in Grannys Küche gerannt gekommen, um ihn kennenzulernen, und hatten Bemerkungen darüber gemacht, wie ähnlich er und Ed sich sähen. Die Sonne schien ihm auf den Rücken, als er jetzt dasaß und mit der Erkenntnis rang, dass Billa seine Halbschwester war.
»Und sie haben keine Ahnung?«, fragte er Granny rasch. »Billa und Ed und ihre Mutter? Keiner von ihnen?«
Doch es sah so aus, als wüsste Mrs. St. Enedoc Bescheid. Als Harry starb, hatte er sich in seinem Testament klar ausgedrückt, aber Mrs. St. Enedoc weigerte sich, ihren Kindern davon zu erzählen. Sogar als Dom begann, seine Sommerferien bei Granny zu verbringen, wollte sie Billa und Ed immer noch nichts sagen, obwohl Granny sie anflehte und einwandte, sie sollten die Wahrheit erfahren.
»Aber ich habe ihr klargemacht, dass sie es ihnen jetzt mitteilen muss«, erklärte Granny. Sie stand auf, hielt kurz inne und strich Dom leicht mit der Hand über den gebeugten Kopf. »Und wenn sie es nicht tut, übernehme ich das selbst.«
Sie ging davon und ließ Dom sitzen, der die Hände zwischen den Knien zusammenkrampfte, versuchte, diese Nachricht zu verarbeiten, die alles auf den Kopf stellte, und sich fragte, was er Billa sagen sollte.
Doch schließlich war es Ed, der die Lage rettete; Ed, der mit Billa im Schlepptau den Fahrweg hinuntergerannt kam und Dom stürmisch umarmte. »Eigentlich habe ich es die ganze Zeit gewusst!«, schrie er glücklich. »Ich habe es einfach gewusst. Du bist unser Bruder, Dom! Tris wird vielleicht unser Stiefbruder, aber du bist unser richtiger Bruder.«
Und Dom sah über Eds Kopf hinweg Billa an, die zögerte und nervös und verlegen wirkte.
Sie ist erst vierzehn, dachte er. Ich muss das in die Hand nehmen, muss der Stärkere sein.
Er grinste ihr zu. »Das ist schon ein Schock, was? Aber Ed hat recht. Es erklärt eine Menge Merkwürdigkeiten … und Gefühle. Deswegen stehen wir uns also alle so nahe.« Und er sah, wie sie sich ein wenig entspannte.
»Und Dom wird Tris zeigen, wo es langgeht«, warf Ed eifrig ein. »Tris, die Zecke. Tris, die Kröte. Dom wird es ihm schon zeigen.«
Und ein paar Monate später, als Dom mit seiner guten Nachricht von seinem Studienplatz an der Camborne School of Mines den Fahrweg entlangeilte, bewegten sich die Schatten unter der Esche, und ein Junge trat heraus.
»Aha, du bist also der Bastard«, sagte Tris …
Jetzt tritt Dom aus seinem kleinen Arbeitszimmer in die Diele und wirft einen Blick durch die halb offene Tür zum Wohnzimmer, das Granny immer so ordentlich und sauber gehalten hat. In einem tiefen, bequemen Sessel sitzt seine Patentochter Tilly und sieht fern. Sie hat einen Fuß unter den Körper gezogen und den anderen auf den Rücken von Doms Golden Retriever gestellt. Ihr langes, dichtes blondes Haar ist zu einem Zopf geflochten, und sie hält das Ende in der Hand und zwirbelt es durch ihre Finger, während sie eine Dokumentation über Wildtiere anschaut. Ihr Vater war vor fünfundzwanzig Jahren, als Tilly ein Baby war, in Camborne Doms Assistent, und jetzt hat er angerufen, weil Tilly ihren Job in einem Hotel in Newquay hingeworfen hat. Er und Tillys Mutter haben gerade einen Posten in Kanada übernommen, und er hat seinen alten Freund und Mentor gebeten, seine Tochter im Auge zu behalten.
»Du kennst doch Tilly«, meinte er betreten zu Dom. »Man hat sie gebeten, das Hotel zu organisieren und es ins einundzwanzigste Jahrhundert zu führen, und sie hat die Leute beim Wort genommen. Sie hat wirklich geglaubt, es sei ihnen ernst, und war so aufgeregt. Natürlich hat es alle möglichen Streitigkeiten gegeben, und jetzt hat Tilly gekündigt. Was heißt, dass sie keine vernünftige Wohnung hat, weil sie sich weigert, Cornwall und ihre Freunde zu verlassen und zu uns zu kommen. Sie schläft bei einer Freundin auf dem Sofa. Könntest du sie vielleicht eine oder zwei Wochen aufnehmen? Sie wird sich sehr schnell wieder aufraffen, weil sie nicht lästig fallen will.«
»Ach, Tilly weiß gar nicht, wie man jemandem zur Last fällt«, gibt Dom zurück. »Und ich würde mich sehr freuen, sie hierzuhaben, falls sie kommen will. Obwohl sie wahrscheinlich gar nicht will.«
Aber Tilly will; und sie taucht in einem ziemlich ramponierten kleinen Auto auf, in dem sich ihre gesamten irdischen Besitztümer befinden – einschließlich ihres Surfbretts auf einem Dachgepäckträger –, und zieht in das Zimmer hinten in dem Cottage, das einmal dem alten Mr. Potts gehört hat. Sie stellt ihren Laptop auf, um an ihrem Lebenslauf zu arbeiten. Schon jetzt hat sie einen Teilzeitjob bei einer Freundin, die ein privates Projekt ins Leben gerufen hat. U-Connect hilft Menschen, die nichts von Computern verstehen, oder älteren Menschen in ländlichen Gebieten, mit dem Internet zurechtzukommen. Alles ist noch ziemlich im Experimentalstadium, doch Tilly gefällt es, obwohl sie die Arbeit nicht ganz als Berufung fürs Leben ansieht. Drei Abende pro Woche arbeitet sie in einem Pub im Ort.
»Das ist so grauenvoll«, sagt sie jetzt zu Dom, den sie an der Tür gehört hat, dreht sich aber nicht zu ihm um. »Diese riesigen Fregattvögel sind am Nistplatz der Möwen gelandet und laufen einfach herum und fressen die Kleinen, während deren Eltern unterwegs sind, um Futter zu suchen. Arme winzige Wesen; sie sind so hilflos! Ich kann es gar nicht ertragen.«
»Ja«, meint Dom. »Es ist schon hart, Teil der Nahrungskette zu sein.«
Tilly sieht sich stirnrunzelnd zu ihm um. »Das ist so herzlos!«
Er zuckt mit den Schultern. »Was soll ich dagegen unternehmen? So ist es nun einmal in der Natur.«
Sie starrt ihn an. »Wieso bist du so mürrisch?«
»Ich bin nicht mürrisch.« Er hat nicht vor, ihr zu verraten, dass er einen Ausflug in die Vergangenheit unternommen hat. »Wenn es dich aufregt, sieh es dir eben nicht an! Möchtest du eine Tasse Tee?«
»Ja, bitte«, sagt sie und wendet sich erneut dem Massaker zu. »Oh, schau doch! Das sind die Laubenvögel. Viel besser. Sind sie nicht toll? Der da sieht richtig aus wie ein schwuler Modeschöpfer in seinem Atelier.«
»Du musst es ja wissen.«
Dom geht, gefolgt von Bessie, in die Küche und setzt den Wasserkessel auf. Er öffnet die Hintertür und lässt die Hündin in den kalten Abend hinaus. Der weiße Mond hängt wie eine Lampe hoch über dem Nebel, der über den Talboden fließt, sich über dem Bach hebt und über dem Garten kräuselt. Bachabwärts hallt der auf- und abschwellende Ruf einer Eule durch die Stille.
Dom lehnt am Türrahmen und wartet. Eine hungrige Füchsin schleicht, den mageren Bauch tief über dem eisigen Boden und mit hinter ihr herschleifendem Schwanz, an der Hecke entlang. Sie hält inne, dreht sich um, sieht Dom an und verschwindet dann am Bachufer entlang. Er wartet. Hinter ihm beginnt der Kessel zu pfeifen. Was will Tris?, denkt er.
Bessie taucht schwanzwedelnd wieder auf, und beide gehen zurück in die Wärme der hell erleuchteten Küche.
»Aber was will Tris bloß?«, fragt Billa am nächsten Morgen. »Nach all diesen Jahren? Was kann er nur wollen?«
Sie sitzen in dem kleinen, quadratischen Raum hinter der engen Küche, wo die Glastüren in den Garten führen, an dem Eichentisch mit den abklappbaren Seiten, der einmal Granny gehört hat. Heute sind die Türen geschlossen, um die bittere Kälte des Februartages abzuhalten, aber der Sonnenschein hebt die Farben der Kissen in einem Sessel aus Weidengeflecht hervor und schimmert auf einigen Porzellanstücken, die hinter den Glastüren einer alten Eichenvitrine aufgestellt sind. Bessie liegt, die Nase auf den Pfoten, an der Tür und beobachtet ein Rotkehlchen, das die vorhin von Dom ausgestreuten Krumen aufpickt.
»Mir fällt kein vernünftiger Grund ein«, antwortet Dom, der den größten Teil der Nacht wachgelegen und sich Gedanken darüber gemacht hat. Er liest die Postkarte noch einmal. »Ich sehe, dass er deinen Ehenamen nicht benutzt hat. Ihr habt gar keinen Kontakt mehr gehabt, seit Andrew weggegangen ist und Tris mitgenommen hat, oder?«
Billa schüttelt den Kopf. »Sobald die Flitterwochen vorüber waren, haben die Streitigkeiten begonnen. Das Eheglück hat ein Jahr gedauert, vielleicht zwei. Möglich, dass Andrew glaubte, es wäre mehr Geld zu haben, als das tatsächlich der Fall war, obwohl er immer den Eindruck erweckt hat, gut betucht zu sein. Unser Vater hat Ed und mir allerdings alle Anteile an der Firma hinterlassen, obwohl Großvater, bis Vater dann erbte, ziemlich mit dem Geld um sich geworfen hat. Und dann der Krieg … Vielleicht hat Andrew beschlossen, sich davonzumachen, als er feststellte, dass doch nicht so viel Geld da war.«
»Und eure Mutter hat alles selbst kontrolliert? Merkwürdig, dass es bei ihrem Tod kein Testament gab, oder? Ich erinnere mich noch, dass du mir geschrieben und etwas über das Testament gesagt hast.«
Sie sehen einander an, und zwischen ihnen flackert Furcht auf.
»Es gab schon ein Testament, doch das hatte sie schon vor Daddys Tod gemacht. Darin hat sie alles ihm hinterlassen, und falls er zuerst sterben würde, sollte alles zu gleichen Teilen an Ed und mich gehen. Unser Anwalt fand es eigenartig, dass sie nach ihrer Wiederverheiratung nie ein zweites Testament aufgesetzt hat, aber schließlich sind wir zu dem Schluss gelangt, dass sie einfach nicht dazu gekommen ist …«
»Oder Andrew hat nach ihrer Heirat ihre Angelegenheiten seinem eigenen Anwalt übertragen.«
»Dafür gab es keinen Anhaltspunkt«, versetzt Billa rasch. »Unser Anwalt hat sie weiter beraten. Das musste er, weil es nie eine Scheidung gab.«
»Was auch merkwürdig war.«
»Ja, nun ja, Mutter konnte sich nicht dazu durchringen, weil es ja keinen wirklichen Grund gab …«
»Außer, dass Andrew sie verlassen hat.«
»Ja, doch ich glaube, sie hat immer gedacht, er würde zurückkommen. Sie konnte der Wahrheit nicht ins Auge sehen, und damals begannen ja schon ihre schrecklichen Depressionen.«
»Dann könnte also ein Testament existieren, in dem Andrew bedacht wird.«
Ängstlich starrt sie ihn an. »Aber der muss doch lange tot sein. Sonst müsste er ja … mindestens neunzig sein.«
»Eine Menge Menschen werden neunzig und älter, Billa.«
»Ich weiß«, begehrt sie auf. »Um Gottes willen, Dom! Versuchst du mich eigentlich zu trösten oder was?«
»Ich versuche, mir einen Grund zu denken, aus dem Tris dir nach über fünfzig Jahren eine Postkarte schickt, und die einzige Erklärung, die mir einfällt, ist, dass sein Vater gestorben ist und unter seinen Papieren etwas gefunden wurde. Denk daran, dass ich in Südafrika gearbeitet habe, als Andrew eure Mutter verließ, und bis ich nach Hause zurückgekehrt bin, war deine Mutter schon tot und alles geregelt.«
»Jedenfalls dachten wir das«, gibt Billa finster zurück. »Oh, mein Gott! Was, wenn es ein Testament gab, in dem Andrew bedacht war?«
»Dann nehme ich an, dass er wahrscheinlich wiederum alles Tris hinterlassen hat. Aber warum dieses lange Schweigen? Wenn Andrew wusste, dass er geerbt hatte, hätte er dann nicht ein Auge darauf gehalten, was hier los war? Vielleicht sind die beiden ja ins Ausland gegangen.«
Sie schüttelt den Kopf. »Ich habe keine Ahnung, wohin sie gegangen sind. Möglicherweise gab es kein Testament, oder sie hat ihm nicht genug hinterlassen, dass es der Mühe wert gewesen wäre, sich zu präsentieren. Jedenfalls hätte sie Ed oder mich nicht rundweg enterbt.«
»Nein«, pflichtet er ihr bei. »Nein, das hätte sie nie getan …« Doch er zögert.
»Was?«, fragt sie sofort. »Was denkst du?«