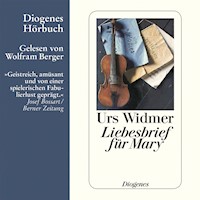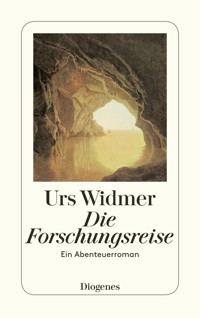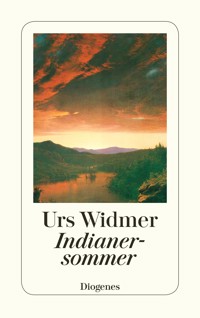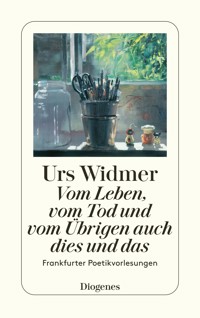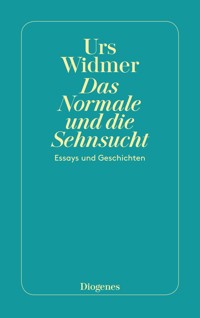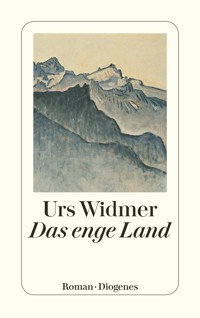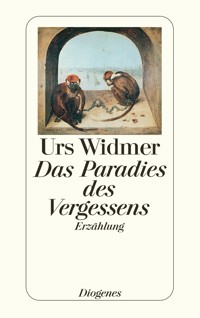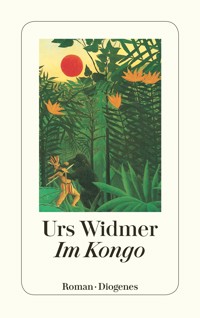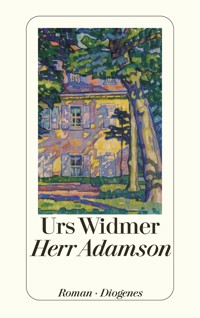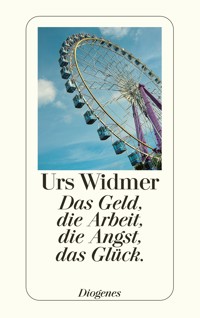7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
›Der Geliebte der Mutter‹ handelt von der unerwiderten lebenslangen Liebe Claras zu dem berühmten Dirigenten Edwin, aufgezeichnet von ihrem Sohn. Es ist zugleich ein Roman über das Geld und die Macht, über die Umkehr der Verhältnisse und über das 20. Jahrhundert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Urs Widmer
Der Geliebte der Mutter
Roman
Diogenes
Für Nora
{5}HEUTE ist der Geliebte meiner Mutter gestorben. Er war steinalt, kerngesund noch im Tod. Er sank um, während er, sich über ein Stehpult beugend, eine Seite der Partitur der Sinfonie in g-Moll von Mozart umblätterte. Als man ihn fand, hielt er einen Notenfetzen in der toten Hand, jene Hornstöße zu Beginn des langsamen Satzes. Er hatte meiner Mutter einmal gesagt, die g-Moll-Sinfonie sei das schönste Stück Musik, das jemals komponiert worden sei. – Er las seit immer Partituren, so wie andere Bücher lesen. Alles, was ihm in die Hände fiel, Archaisches und Oberflächliches. Vor allem aber sah er sich nach Neuem um. Erst im Alter, so gegen neunzig, holte ihn das Bedürfnis ein, nochmals das schon Vertraute zu erfahren, anders nun, in der Beleuchtung der schwindenden Lebenssonne. Nun las er den Don Giovanni wieder, den er einst als Jüngling mit brennenden Augen verschlungen hatte, und die Schöpfung. – Er war Musiker gewesen, Dirigent. Drei Tage vor seinem Tod hatte er in der Stadthalle sein letztes Konzert dirigiert. György Ligeti, Bartók, Conrad Beck. – Die Mutter liebte ihn ihr ganzes Leben lang. Unbemerkt von ihm, unbemerkt von jedermann. Niemand wußte von ihrer Passion, kein Wort sagte sie jemals davon. »Edwin!« flüsterte sie allerdings, wenn sie am See stand, allein, mit ihrem Kind an der Hand. Von Enten umschnattert, im Schatten selber, schaute sie auf das in der Sonne leuchtende Ufer gegenüber. »Edwin.« Der Dirigent hieß Edwin.
{6}ER war ein guter Dirigent. Und er war, als er starb, der reichste Bürger des Landes. Er besaß die kostbarste Partiturensammlung weit und breit; die Partiturseite, die er im Tod zerfetzte, war das Original gewesen. Ihm gehörte die Aktienmehrheit eines Firmenkonglomerats, das – in der Hauptsache – Maschinen herstellte und immer noch herstellt. Lokomotiven, Schiffe, aber auch Webstühle und Turbinen und neuestens sogar Hochpräzisionsinstrumente für die Laserchirurgie. Künstliche Gelenke, auch jene Minikameras, die man durch die Blutbahnen bis zum Herz schicken kann und die alles, was sie auf ihrer Reise vorfinden, auf einen Bildschirm nach draußen senden. Der Hauptsitz der Firma war und ist auf jener minderen Seeseite, die immer im Schatten liegt. Während Edwin auf der Sonnenseite wohnte, über dem See, in einer Besitzung mit dreißig oder auch fünfzig Zimmern, mit Gestüten, mit Hundezwingern, mit Gäste- und Gesindehäusern in einem Park, in dem chinesische Zirbelkiefern und Sequoiabäume wuchsen, himmelhohe Trumme, in deren Schatten er wandelte und das nächste Konzert memorierte. Royal Albert Hall zum Beispiel, oder Glyndebourne. Er forderte für seine Konzerte stolze Gagen, aber nicht, weil er auf Geld aus war, auf noch mehr Geld, sondern, weil er sich an Bruno Walter und Otto Klemperer maß. Er wollte eine gleich hohe Gage, und er kriegte sie.
EINST, als junger Mann, war er mausarm gewesen. Wohnte in einem möblierten Zimmer im Industriequartier, vor Ehrgeiz und noch nicht erweckter Begabung rasend. Er {7}tigerte mit Blitzen im Hirn im Zimmer auf und ab, stieß gegen Waschschüsseln und Stühle, ohne es zu bemerken, jagte der wilden Musik in seinem Schädel nach, die sich nicht erhaschen ließ. Manchmal übergoß er sich mit eiskaltem Wasser. Er hatte Notenpapier in allen Taschen und schrieb auf seinen Spaziergängen, die gehetzten Gewaltmärschen glichen, Melodienfetzen auf, obwohl er kaum Noten schreiben konnte. Sein Klavierspiel war noch dürftiger. Aber er lebte in der Musik, für die Musik. Zu den Abonnementskonzerten von damals – Preise zum Fürchten, auch in jenen Zeiten schon – ging er in den Pausen, wenn keine Türkontrollen mehr stattfanden und die müdesten Melomanen nach Hause gegangen waren. Auf deren Plätzen saß er nun, hielt die vernichtenden Blicke der Sitznachbarn aus. So hörte er wenigstens alle zweiten Teile der Konzerte, sowieso war es immer Brahms, Beethoven, Bruckner. Weil er kein Abitur hatte, war ihm das Konservatorium verschlossen. Er ließ sich also privat von einem lokalen Komponisten ausbilden, der, als Edwin ihm seine Bedürftigkeit dargelegt hatte, auf jedes Honorar verzichtete. Allerdings arbeitete er unregelmäßig – er trank, um die Wahrheit zu sagen – und war ein radikaler Anhänger von Richard Wagner und Richard Strauss. Von allen Richarden eigentlich, auch François Richard mochte er mehr, als der das verdiente. Dessen »Ruisseau Qui Cours Après Toy-Mesme« sang er in fast jeder Unterrichtsstunde, sich selber mit kraftvollen Oktavgriffen am Klavier begleitend, obwohl das Original eine zarte Lautenstimme erfordert. – Edwin hätte es später, viel später, auf einer Auktion kaufen können, für ein Butterbrot. Erst bot er zögernd mit, dann {8}überließ er es einem dicken Herrn, der heftig schwitzte und die J.-Paul-Getty-Foundation for Ancient Music vertrat. – Er schuf das Werk Gesualdos nochmals, bebte über den Wundern Mozarts, hielt die Längen Schuberts aus, und bald einmal schrieb er ein erstes eigenes Werk, eine zweisätzige Sinfonie, die der lokale Komponist kopfschüttelnd las. Als sich das erste Kompositionsfeuer gelegt hatte, lernte er Klavier spielen. (Darin war der lokale Komponist sehr kundig.) Aber er konnte nicht üben – wie denn, er hatte ja kein Klavier –, oder nur, wenn der Komponist sich betrunken hatte und im Nebenzimmer schlief. So blieb er einer, dem auch langsame Sätze zu schnell waren. Verzweifelnd schon zeigte ihm der lokale Komponist eines Tags, wie man dirigiert. Wie man einen richtigen Auftakt schlägt oder ein Ritardando bewirkt, all dies. Er kannte alle Schlagarten. Auch wenn er betrunken war oder gerade dann schlug er ohne die geringsten Probleme mit der linken Hand einen Sechsneunteltakt und mit der rechten einen Fünfachtel. Edwin merkte zu seiner und auch seines Lehrers Verblüffung, daß er das auch konnte, auf Anhieb beinah. Er wußte sofort, daß das Dirigieren seine Bestimmung war. Er arbeitete sich – der lokale Komponist saß am Klavier und ersetzte ihm das Orchester – durch die Werke Johann Sebastian Bachs, Haydns und Mendelssohns hindurch, später sogar durch den ganzen Debussy. Seine Interpretation von Pelléas et Mélisande geriet ihm so intensiv, daß er, als er es dann einmal mit einem wirklichen Orchester spielte, todtraurig wurde, weil sie längst nicht so großartig wie die imaginierte klang. An einem hellen Sommermorgen sagte ihm sein Lehrmeister, er habe bei ihm – {9}bei ihm! – nichts mehr zu lernen. Er umarmte ihn. Edwin ging. Er drehte sich nicht mehr um und sah nicht, daß der lokale Komponist am Fenster stand, die eine Hand zum Winken erhoben, in der andern eine Flasche. – Er pfiff vor sich hin. Er konnte zwar noch immer nicht komponieren, und sein Klavierspiel war jämmerlich geblieben; aber wenn er eine Partitur las, hörte er, und aufs Dirigieren verstand er sich jetzt auch. – Seinen Lebensunterhalt – die Studien hatten ihn ja nichts gekostet – hatte er verdient, indem er im Akkord Fensterläden anstrich, in einem Gartenlokal kellnerte und im Hauptpostamt Briefe sortierte.
EDWIN arm, meine Mutter jedoch reich: so war es zu Beginn gewesen. Erst später wurde es umgekehrt. Nun schwamm Edwin im Geld, und die Mutter, brüchiges Gestein geworden, sprach immer häufiger von der Sorge, im Armenhaus zu enden. – Die junge Mutter, eine leuchtende Schönheit, war wie im Traum dahergeweht gekommen. Lange Beine mit Stöckelschuhen, ernst, mit schwarzen Augen, vollen Lippen, einem Pelz um die Schultern, einem Hut, der so groß wie ein Wagenrad war und unter dem eine gekrauste Mähne hervorquoll. Federn. Neben ihr sprang ein Windspiel. – Im Abonnementskonzert saß sie neben ihrem Vater, an Mutters Statt – diese war gestorben, als meine Mutter ein Backfisch war –, überwältigend jung zwischen all den greisen Abonnenten, die dasaßen wie Tote. Auch ihr Vater sah dann nicht sehr lebendig aus, und jedes Mal, kaum hatte das Konzert begonnen, hatte die Mutter das Bedürfnis, laut zu schreien. Die Toten zu {10}wecken. – Ihr Vater glich dem alten Verdi, einem Verdi mit dicken Lippen, liebte tatsächlich auch die Traviata über alles und war Vizedirektor just jener Maschinenfabrik, die Edwin später – so viel später nun auch wieder nicht! – anheimfallen sollte. Der hätte damals nie gewagt, meine Mutter anzusprechen. Sie, hätte er es doch getan, hätte durch ihn hindurchgeschaut und ihn noch während des Schauens vergessen. Damals. – Sie hatte ihn zuweilen beobachtet, von ihrem Balkon herab, wie er nach der Konzertpause im Parkett nach einem freien Platz suchte, ein schäbig gekleideter junger Mann, ratlos und zielstrebig. Sie dachte sich nichts weiter dabei.
EINMAL spielte sie, fünf oder sechs Jahre alt, im Korridor mit ihren Puppen – sie gab ihnen Unterricht im Sich-an-ständig-Benehmen –, und die Tür des Arbeitszimmers tat sich auf, und der Vater stand in ihr, mit funkelnden Augen, die Lippen zu einem Strich verdünnt, mit einem Bart wie eine Schaufel. Mit diesem Bart wies er ins Innere des Raums. Die kleine Mutter ging zitternd hinein, stand auf einem Teppich, in dem ihre nackten Füße versanken, vor dem ehernen Schreibtisch, hinter dem ihr Vater, das Fenster verdunkelnd, in die Höhe wuchs. Dunkle Bücher überall, dumpfe Lampen mit Glasperlentroddeln, griechische Marmorköpfe von Zeus oder Apoll, Reagenzgläser, ein Terrarium, in dem Skorpione und Kreuzspinnen krochen. Der Vater stand und schwieg, sah sie an, sah und sah, sagte endlich, ohne den Mund zu öffnen: »Niemand will dich! Keiner! Das ist wegen deiner Art!« Jäh brüllte er. »In {11}dein Zimmer!« brüllte er. »Daß ich dich nicht mehr sehe!« – Er und seine Frau hatten nach Mailand fahren wollen. Gutes Hotel, gutes Essen, schöne Weine, vielleicht die Traviata in der Scala, oder wenigstens die Tosca. Aber niemand hatte die kleine Mutter für ein paar Tage nehmen wollen, keine der Tanten, Kusinen, Patinnen, Freundinnen. »Die? Nie!« Nicht einmal Alma, mit der ein jeder nur im äußersten Notfall sprach, war bereit gewesen, sie zu hüten. Wegen ihrer Art. Die Eltern blieben zu Hause. – Die Mutter ging in ihr Zimmer. Stand tränenlos am Fenster und fragte sich, was ihre Art war. Daß sogar ihr Vater und ihre Mutter sie nicht wollten. – Auch später hatte sie nie Tränen. Ihre Augen waren so trocken, daß sie schmerzten.
ODER sie mochte, sechs und auch acht Jahre alt, ihr Essen nicht aufessen. Spinat, Blumenkohl, irgend so ein gesunder Schmierpapp. Joghurt!, vom Dienstmädchen zubereitet, manchmal eigenhändig von der Mama. Dann verlangte der Vater, daß sie alles fertigaß, bis auf den letzten Bissen. Und wenn es drei Tage dauerte, ein Jahr. Oft saß sie allein in ihrem Zimmer, ihr Joghurt vor sich, mit starren Magenwänden. Keinen Bissen kriegte sie in sich hinein. Der Vater, beim nächsten Essen, würdigte sie keines Blickes, aß mit steinernem Genuß sein Steak. Vor ihr stand immer noch das halb gegessene Joghurt. Schimmel war nicht giftig für Kinder. – Nur einmal, ein einziges Mal hatte sie versucht, das Joghurt hinterrücks in die Blumenvase zu tun. Der Vater, allwissend, griff hinein, zeigte seinen joghurtverschmierten Zeigefinger, wischte ihn wortlos an der {12}Serviette ab. Und schon war das nächste Joghurt da. – Sie ging in den Kindergarten, dann in die Schule: Und wenn sie nicht eine Viertelstunde nach Schulschluß zurück war, verschloß der Vater die Tür. Da stand sie dann, klingelte und rief, bis der Vater das Türfensterchen öffnete, ein vergittertes Viereck, hinter dem er wie ein Gefängniswärter aussah, der aus irgendeinem Grund im Gefängnis drin war, während die Gefangene draußen um Einlaß bettelte. Er sagte ruhig, klar, daß sie zu spät sei, da müsse sie nun halt warten, bis das Tor wieder aufgehe, irgendwann dann, jetzt jedenfalls gewiß nicht. Das habe sie ihrer Art zu verdanken. – Einmal war die Zeit gerade erreicht – nein, sie war zu spät, gewiß um eine Minute –, und der Vater verriegelte die Tür, obwohl sie schon durch den Vorgarten gelaufen kam. Zu spät war zu spät. So saß sie dann auf der Stufe vor der Tür und sah einem Eichhörnchen zu, das auf der Pinie von Ast zu Ast sprang. Ihre Art, ihre Art, was war ihre Art?
VIELLEICHT war ihre Art, daß sie oft starr in einer Zimmerecke stand, mit Augen, die nach innen sahen, geballten Fäusten, einer glühenden Hitze im Hirn. Sie atmete kaum mehr dann, stöhnte zuweilen auf. In ihr drin kochte alles, nach außen hin war sie tote Haut. Taub, blind. Man hätte sie wie ein Stück Holz wegtragen können, wie einen Sarg, sie hätte es nicht bemerkt. Sie allerdings, hätte man sie in ihrer Fieberstarre überrascht, wäre vor Scham gestorben. Vor Schreck, vor Schuld. Darum horchte sie auf das geringste Geräusch im Haus, ob irgendwo eine Tür ging, auf Schritte im Korridor, auf jedes Knistern und Knacken. {13}Aber nie entdeckte jemand ihr Geheimnis, da war sie sich sicher. – (Dabei starrte sie mehr als einmal durch ihre Eltern hindurch, die sie nicht aufzuwecken wagten.) – In ihr drin war dann eine Welt voller Glanz und Licht, mit Wäldern, Getreidefeldern, mit Wegen, die dahin führten, dorthin. Schmetterlinge, Leuchtkäfer. Ferne Reiter. Sie ging auch selber in sich, sah sich, wie sie hüpfte, das Rad schlug, juchzte. Sie trug entzückende Kleidchen, Bänder, weiße Schuhe, einen Strohhut voller Kornblumen. Alle liebten sie, ja, sie war der Liebling aller. Sie war nicht die Königin, oder nur selten, nein, sie war bescheiden wie niemand sonst, teilte all ihre Habe mit den Ärmsten der Armen. Sie behielt nur, was sie wirklich brauchte. Das Pony natürlich, das Himmelbett. Oft weinte sie mit den andern – in jener Welt hatte sie Tränen –, weil es denen so schlecht ging. Tröstete sie, sie hatte eine große Tröstkraft. Alle kamen immer zu ihr, es war ein richtiges Gedränge um sie herum. Flehend ausgestreckte Arme, ihr Name wurde gerufen. Allerdings konnte sie sich auch freizaubern, dann war sie ganz allein, ging auf dem Wasser, konnte gar fliegen. Sie war dann nahe an den Sternen, rief ihnen zu, bekam ihr Lachen zur Antwort. Gott, mit Gott ging sie nicht um; aber manchmal kam der kleine Jesus des Wegs, bat sie um Rat wegen der Zukunft der Welt. So mußte sie zuweilen auch eine strenge Richterin sein. Stand dann auf einer Empore über einem kirchenähnlichen Saal, der voller schwarzer Männer war, die Böses getan oder geplant hatten. Ja, da mußte sie sie dann schon im Öl sieden, es war dann nicht zu vermeiden, ihnen die Köpfe abzuhacken, sie vom Turm zu stürzen. Ihr Flehen half dann nichts, dieses {14}Auf-den-Knien-Herumrutschen und Händeringen, um ihre Vergebung zu erlangen. Sie blieb gerecht, zeigte mit dem Daumen nach unten. – Irgend etwas weckte sie dann auf, ein Hund etwa, der auf der Straße bellte, oder das Knarren einer Diele (die davonschleichenden Eltern). Dann fuhr sie hoch, sah sich verstört um, sammelte ihre sieben Sinne. – Beim Abendessen dann die großen Augen der Mama. Was war los? Wieso schaute sie der Vater so an?
DIESER hatte auch nicht immer mit antiken Götterköpfen und Perserteppichen gelebt. Im Gegenteil, er war in einem möbellosen Steinhaufenhaus in der Nähe von Domodossola zur Welt gekommen, ein arvenholzfarbener Säugling, der schon bei seiner Geburt Haare wie Stahlwolle hatte, und jene Lippen. Er war das letzte von zwölf Kindern – auch sie alle kraushaarig, dicklippig – und wurde Ultimo getauft. Ein Flehen seiner Eltern zu Gott, es endlich genug sein zu lassen. (Von den zwölf Kindern wurden gerade fünf erwachsen.) Er ging ohne Schuhe, suchte Kastanien in den Wäldern, fütterte die Kaninchen mit Gras. Das Haus, unter einen Felsen geduckt, bestand aus einem Raum, einem tiefen Gewölbe ohne Fenster, in dem im Winter ein Feuer unter einem schlundgroßen Kamin loderte, das die Luft dennoch kaum erwärmte. Im Sommer dafür war das Gewölbe kühl, auch wenn draußen die Sonne glühte. Die Söhne, sieben Söhne, halfen alle dem Vater. Nur Ultimo durfte nicht mittun, der Vater brauchte keinen achten Knecht; keinen so kleinen jedenfalls. Ultimo mußte zu Hause bleiben. Er wußte nicht genau, was der Vater und {15}die Brüder taten, ihre Abenteuer hatten irgendwie mit Maultieren zu tun, mit Schlitten und Fuhrwerken. Er dachte, sie seien so etwas wie gute Räuber, fielen jenseits der Berge über die Schlösser böser Herren her und verteilten das Geraubte an die Armen. Oh, das hätte er auch gern getan, um fünf Uhr früh aufstehen, nach Sonnenuntergang zurückkehren, erschöpft, verschwitzt, zerschunden zuweilen, von Abenteuern erzählend, in denen Lawinen auf sie niederdonnerten, Felsschläge. Die Maultiere brannten durch und jagten schreiend bergauf, die Schlitten hinter sich herschleudernd, von denen sich Fässer losrissen und zu Tal donnerten, platzend im Sturz, den Schnee blutrot färbend. Der Vater saß am Tisch und sah strahlend zu, wie die Mutter den tollen Brüdern die Polenta in die Teller kratzte. Er wischte sich die Tränen aus den Augen, so sehr lachte er. Ultimo in seiner dunklen Ecke, er hatte schon gegessen. – Der Vater war ein Säumer. Er transportierte im Auftrag von Winzern aus dem Piemont Weinfässer über den Simplon, zwischen Domodossola und Brig. Im Winter auf Schlitten, im Sommer mit Fuhrwerken. Die Söhne halfen ihm, sieben Söhne in den besten Jahren; bald einmal nur noch drei. Die andern waren gestorben, Typhus, Kinderlähmung, eine Blutvergiftung. Aber Ultimo durfte keinen ersetzen, nie. Vielleicht, als der Vater alt geworden war und kaum noch seinen Ältesten dazu überreden konnte, ihn auf dem Weg über den Paß zu begleiten, ihn und die Gespanne, da hätte er vielleicht gedurft. Aber da war er längst woanders, Ultimo, in einem andern Land, mit andern Freunden, mit neuem Geld.
{16}ZUM Glück war er ein guter Schüler, Ultimo. Der Dorflehrer merkte das, irgendein Geistlicher mischte sich ein, der Pfarrer des Kirchsprengels von Villa di Domodossola, und jäh fand sich der begabte Ultimo jenseits des Passes wieder, auf der andern Seite der Berge. Er wurde Zögling des Jesuiteninternats von Brig. Zwar bescherte ihm diese heiligmäßige Schule eine lebenslange Abscheu vor allem Religiösen – er ging später nie mehr zur Messe, ließ seine Tochter nicht taufen –, aber er lernte vieles. Ein singendes Deutsch und lateinische Gebete, aber auch addieren, subtrahieren, genau zeichnen, ordnen, mischen und trennen, Käfer sezieren, Kuben so in Kegel verwandeln, daß ihr Inhalt der gleiche blieb. Er machte ein glanzvolles Abitur. Die Schlußfeier fand im Dom statt. Ein paar hundert gerührte Bürger. Ein Bischof oder sonst ein Kirchenoberer betete und verteilte die Zeugnisse und betete wieder, strich Ultimo, als er ihm sein Zeugnis gab, sogar über die Haare. Das war das letzte Mal, daß Ultimo eine Kirche von innen sah. Später, als er mit seiner Frau Bildungsreisen unternahm – Chartres, Autun, Vézelay –, wartete er immer draußen vor dem Kirchenportal, während sie staunend durch Krypten und Kreuzgänge ging. – Er besuchte das Polytechnikum des Landes (bekam ein Stipendium, obwohl er Ausländer war), wurde Maschineningenieur und trat, gerade vierundzwanzig Jahre alt, in jene Fabrik am Schattenufer des Sees ein, die damals eine kleine Klitsche war. Ein paar Schuppen, in denen großkalibrige Schrauben hergestellt wurden, rechts- und linksdrehende Gewinde, Metallspindeln, Federungen und Bremsklötze. Ultimo saß in einem Büro, einem Holzverschlag, und bearbeitete die {17}spärlichen Aufträge. Er heiratete und kriegte eine Tochter, meine kleine Mutter. Dann kam der Erste Weltkrieg. Die Kriegführenden hüben und drüben brauchten so viele Maschinen (schossen so viele zu Schrott), daß der Betrieb vier Jahre später ein Großunternehmen war und Ultimo einer seiner Vizedirektoren. Ihm unterstand die Nutzfahrzeugproduktion, eine rasant größer werdende Abteilung. Er verdiente nun viel Geld, baute ein Haus, trug Flanell aus England, hatte eine Dienstmagd, ließ den Käse, das Trockenfleisch, den Polentamais und den Wein aus seiner alten Heimat kommen, kaufte ein Grammophon, vor dem er Abend für Abend saß, mit einem Sherry in der Hand, und sich daran berauschte, wie Caruso La donna è mobile sang. Er rauchte Zigarren. Er wurde Bürger seiner neuen Heimat. Kaufte eines der ersten Autos der Stadt, einen barberaroten Fiat, ein Cabriolet, das er selber in Turin abholte. Die Sitze, das Armaturenbrett, alles war nach seinen Wünschen montiert. Singend fuhr er über die Berge (vermied den Simplon, weil er den Geist seines Vaters – der war längst tot – und die Gespenster der Maultiere fürchtete). Er wechselte drei Räder, verbrühte sich, als er arglos den Kühler aufschraubte, um nach dem Wasser zu sehen. Mit einem verbrannten Kinn und bandagierten Händen steuerte er – trotz allem strahlender Laune – sein Wunderfahrzeug durch Wälder, Schluchten, Dörfer, Staubwolken hinterlassend. Im Licht der untergehenden Sonne kam er zu Hause an und wurde von seiner Frau und seiner kleinen Tochter mit Blumen empfangen. Lächelnd zog er die Rennbrille, die Ledermütze und den Staubmantel aus. Nachbarn äugten durch die Zäune, verschwanden wie {18}