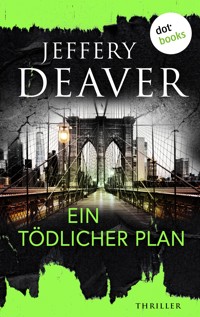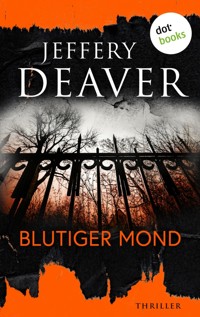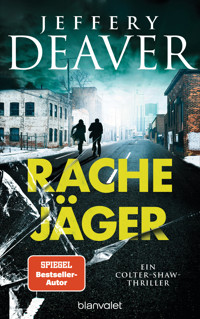9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lincoln-Rhyme-Thriller
- Sprache: Deutsch
Der 11. Fall für Lincoln Rhyme und Amelia Sachs.
In einem düsteren Versorgungstunnel wird die Leiche einer jungen Frau gefunden, angestrahlt vom Schein einer Taschenlampe. Auf ihrer Haut eine Botschaft, eintätowiert mit Gift anstatt mit Tinte. Vom Mörder keine Spur. Nur einen einzigen Hinweis entdeckt Amelia Sachs, als sie den unheimlichen Tunnel absucht: ein zusammengeknülltes Stück Papier, das diesen Mord mit einem lange zurückliegenden Fall verbindet, den Amelia und Lincoln Rhyme nie vergessen haben. Ein eiskalter, akribisch vorgehender Serienkiller versetzt New York schon bald in Angst und Schrecken – ein Killer, der dem legendären Knochenjäger in seiner skrupellosen Grausamkeit eindeutig das Wasser reichen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 657
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Jeffery Deaver
Der Giftzeichner
Thriller
Ins Deutsche übertragen von Thomas Haufschild
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem TitelThe Skin Collector bei Grand Central Publishing, New York
1. Auflage
© Gunner Publications, LLC 2014© der deutschsprachigen Ausgabe 2015 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbHUmschlaggestaltung: www.buerosued.deUmschlagmotiv: Arcangel Images/Malgorzata MajSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-15901-6
www.blanvalet.de
Für Dennis, Patti, Melissa und Phillip.
Die Kreaturen, die ich gesehen hatte, waren keine Menschen und auch nie Menschen gewesen. Sie waren Tiere – vermenschlichte Tiere –, Triumphe der Vivisektion.
H. G. WellsDie Insel des Dr. Moreau
IDAS VERGRIFFENE BUCH
Dienstag, 5. NovemberMittag
1
Der Keller.
Sie musste in den Keller.
Chloe hasste es da unten.
Aber das Rue du Cannes – dieses altmodisch geblümte kleine Ding mit dem bestickten Saum und dem gewagten Ausschnitt – war in Größe vierzig und zweiundvierzig ausverkauft, und sie musste die Kleiderständer nachfüllen, damit die Schnäppchenjägerinnen auch ja fündig wurden. Chloe war Schauspielerin, keine Einzelhandelsfachfrau, und außerdem neu im Modegeschäft. Daher war es ihr ein Rätsel gewesen, wieso ausgerechnet diese Kleider sich gerade so gut verkauften, zumal der November sich auch noch wie ein Januar anfühlte. Bis ihre Chefin ihr erklärt hatte, dass der Laden zwar im alternativen SoHo in Manhattan lag, die Kundinnen aber vornehmlich aus Jersey, Westchester und von Long Island stammten, wie ihre Postleitzahlen erkennen ließen.
»Und?«
»Seereisen, Chloe. Kreuzfahrten.«
»Ach.«
Chloe Moore ging in den hinteren Bereich des Ladens. Die Ecke hier war das genaue Gegenteil des Verkaufsraums und ungefähr so schick wie ein Frachtcontainer. Chloe suchte unter den Schlüsseln an ihrem Handgelenk den passenden heraus und öffnete die Kellertür. Sie schaltete das Licht ein und musterte die wacklige Treppe.
Mit einem Seufzen machte sie sich auf den Weg. Die Tür hatte einen Schließer und fiel hinter ihr von selbst wieder zu. Chloe war keine zierliche Frau und stieg die Stufen vorsichtig hinab. Sie trug Vera-Wang-Imitate. Pseudo-Designer-Stöckelschuhe und hundert Jahre alte Architektur können eine gefährliche Mischung ergeben.
Der Keller.
Sie hasste ihn.
Nicht dass sie Eindringlinge befürchtete. Es gab nur einen Zugang – die Tür, die sie soeben selbst benutzt hatte. Aber der Keller war muffig, feucht, kalt … und voller Spinnweben.
Was bedeutete, dass es hier hinterhältige, gefräßige Spinnen gab.
Und Chloe wusste, dass sie einen Kleberoller brauchen würde, um den Staub von ihrem dunkelgrünen Rock und der schwarzen Bluse zu entfernen (Le Bordeaux und La Seine).
Sie trat auf den unebenen, rissigen Betonboden, hielt sich links, um ein großes Netz zu umgehen, und lief dafür mitten in einen anderen langen Spinnwebenstrang hinein, der an ihrem Gesicht kleben blieb und kitzelte. Nach einem lächerlich anmutenden Tanz, bei dem sie versuchte, das verdammte Ding abzustreifen, ohne hinzufallen, setzte sie ihre Suche fort. Fünf Minuten später fand sie den Vorrat an Rue du Cannes, die französisch aussehen und klingen mochten, aber auf deren Versandverpackungen hauptsächlich chinesische Schriftzeichen standen.
Als Chloe die Kartons aus dem Regal zog, hörte sie ein Scharren.
Sie erstarrte. Neigte den Kopf.
Das Geräusch wiederholte sich nicht. Doch dann hörte sie etwas anderes.
Tropf, tropf, tropf.
War da irgendwas undicht?
Chloe kam oft nach hier unten, wenngleich widerwillig, und hatte dabei noch nie Wasser gehört. Sie stellte die vermeintlich französischen Kleider bei der Treppe ab und machte sich auf die Suche. Der größte Teil des Lagerbestands war in den Regalen verstaut, aber einige Kartons standen auf dem Boden. Ein Wassereinbruch konnte verheerende Folgen haben. Und obwohl Chloe letztlich an den Broadway wollte, würde sie noch eine ganze Weile auf den Job hier im Chez Nord angewiesen sein. Ein Leck zu entdecken, bevor überteuerte Kleidung im Wert von zehntausend Dollar ruiniert werden konnte, würde vielleicht erheblich dazu beitragen, dass auch weiterhin ein stetiges Gehalts-Rinnsal auf ihr Konto floss.
Sie ging in den rückwärtigen Teil des Kellers und war entschlossen, die undichte Stelle zu finden. Auf die Spinnen achtete sie natürlich trotzdem.
Das Tropfen wurde lauter, je weiter sie vordrang. Hier hinten war es noch düsterer als vorn bei den Stufen.
Chloe trat hinter ein Regal voller Blusen, die dermaßen hässlich waren, dass nicht mal ihre Mutter sie anziehen würde – die Großbestellung eines Einkäufers, der, so vermutete Chloe, bereits gewusst hatte, dass man ihn ohnehin entlassen wollte.
Tropf, tropf …
Sie kniff die Augen zusammen.
Komisch. Was war das? In der Rückwand stand eine Zugangstür offen. Das Wassergeräusch kam von dort. Die Tür, die so grau gestrichen war wie die Wände, maß ungefähr neunzig Zentimeter mal einen Meter zwanzig.
Wohin führte sie? Gab es ein zweites Kellergeschoss? Chloe war die Tür noch nie aufgefallen, aber sie hatte wohl auch noch nie einen Blick auf die Wand hinter dem letzten Regal geworfen. Wozu auch?
Warum stand das Ding offen? Die Stadt richtete ständig Baustellen ein, vor allem in den älteren Vierteln wie hier in SoHo. Doch niemand hatte das Personal – zumindest nicht Chloe – darüber in Kenntnis gesetzt, dass unter dem Gebäude irgendwas repariert werden musste.
Womöglich hatte dieser unheimliche polnische oder rumänische oder russische Hausmeister da unten zu tun. Aber nein, das konnte nicht sein. Ihre Chefin traute ihm nicht; er hatte keinen Schlüssel für die Kellertür.
Okay, der Gruselfaktor nahm zu.
Hör auf zu suchen. Erzähl Marge von dem Tropfgeräusch und dem offenen Durchgang. Hol Vlad oder Mikhail oder wie auch immer er heißt und lass ihn hier unten sein Gehalt verdienen.
Dann wieder ein Scharren. Diesmal kam es ihr wie ein Schuh vor, der über den sandigen Beton schlurfte.
Scheiße. Jetzt reicht’s. Nichts wie weg hier.
Doch praktisch im selben Moment, bevor sie auch nur ansatzweise kehrtmachen konnte, stürzte er sich von hinten auf sie und knallte ihren Kopf gegen die Wand. Er presste ein Stück Stoff auf ihren Mund. Vor lauter Schreck fiel sie fast in Ohnmacht. Ihr Hals tat plötzlich weh.
Chloe fuhr herum.
O Gott, o Gott …
Bei dem Anblick wurde ihr beinahe schlecht: die gelbliche Latexmaske über seinem Kopf, mit Schlitzen für Augen, Mund und Ohren, die so eng saß, dass sie das Fleisch verformte, als wäre sein Gesicht geschmolzen. Er trug einen Arbeitsoverall mit irgendeinem Logo darauf, das sie nicht genau erkennen konnte.
Heulend schüttelte sie den Kopf, flehte und schrie durch den Knebel, den er unverwandt auf ihren Mund drückte. Seine Handschuhe waren so eng und eklig gelb wie die Maske.
»Bitte, hören Sie mir zu! Tun Sie das nicht! Sie verstehen nicht! Bitte, bitte …« Aber die Worte drangen nur als unverständliche Laute durch den Stoff.
Wieso hab ich oben keinen Keil in die Tür geklemmt?, fragte sie sich. Ich hab noch daran gedacht … Sie war wütend auf sich selbst.
Sein ruhiger Blick musterte sie – aber nicht ihre Brüste oder Lippen oder Hüften oder Beine. Nur die Haut ihrer bloßen Arme, ihrer Kehle, ihres Halses, wo er die kleine blaue Tätowierung einer Tulpe genau in Augenschein nahm.
»Nicht schlecht, nicht gut«, flüsterte er.
Sie wimmerte, zitterte, stöhnte. »Was … was … was wollen Sie?«
Doch warum fragte sie überhaupt? Sie wusste es doch. Natürlich wusste sie es.
Und bei diesem Gedanken bekam Chloe ihre Furcht in den Griff. Sie wappnete sich.
Okay, du Arschloch, du willst es auf die harte Tour? Das wird dir noch leidtun.
Sie erschlaffte. Seine Augen, umgeben von gelbem Latex wie von kränklicher Haut, wirkten verwirrt. Der Angreifer hatte offenbar nicht mit ihrem Zusammenbruch gerechnet und wollte ihren Sturz abfangen.
Sobald sein Griff sich löste, sprang Chloe vor und packte ihn am Kragen. Der Reißverschluss gab nach, und Stoff riss – sowohl der Overall als auch die Kleidung darunter.
Sie wollte wütend auf sein Gesicht und die Brust einprügeln. Und ihm das Knie in den Unterleib rammen. Dann noch mal und noch mal.
Aber irgendwie gelang es ihr nicht. Sie konnte nicht richtig zielen. Er wäre so einfach zu treffen gewesen, doch ihr war auf einmal schwindlig, und ihre Bewegungen waren unkoordiniert. Er drückte ihr mit dem Knebel die Luft ab – vielleicht lag es daran. Oder am Schock.
Mach weiter, zürnte sie. Hör nicht auf. Er hat Angst. Das kannst du sehen. Scheißfeigling …
Und sie versuchte, erneut nach ihm zu schlagen und die Fingernägel in sein Fleisch zu graben, doch ihre Kraft ließ nun rapide nach. Ihre Hände betatschten ihn harmlos. Ihr Kopf sackte nach vorn, und Chloe sah, dass sein Ärmel sich hochgeschoben hatte. Da war eine unheimliche Tätowierung, in Rot, irgendein Insekt mit Dutzenden kleiner Insektenbeine und Insektenklauen, aber menschlichen Augen. Und dann fiel ihr Blick auf den Boden des Kellers. Da lag eine Spritze. Deshalb hatte ihr Hals wehgetan – und schwanden ihr die Kräfte. Er hatte ihr irgendwas injiziert.
Was auch immer es war, es wirkte gründlich. Sie war erschöpft. Ihre Gedanken gerieten durcheinander, als würde sie wiederholt in einen Traum abdriften, und aus irgendeinem Grund kam ihr das billige Parfüm in den Sinn, das es im Chez Nord an der Kasse zu kaufen gab.
Wer gab Geld für so einen Mist aus? Und warum …?
Was soll das?, dachte sie in einem klaren Moment. Wehr dich gefälligst! Wehr dich gegen dieses Schwein!
Aber ihre Hände hingen mittlerweile reglos herab, und ihr Kopf war schwer wie ein Stein.
Sie saß auf dem Boden, und dann kippte der Raum und fing an, sich zu bewegen. Der Kerl zerrte sie zu der Zugangstür.
Nein, nicht dahin, bitte!
Hören Sie mir zu! Ich kann Ihnen erklären, wieso Sie das besser nicht tun sollten. Bringen Sie mich nicht dorthin! Hören Sie!
Hier im eigentlichen Keller bestand wenigstens ein bisschen Hoffnung, dass Marge nach dem Rechten sehen und sie beide entdecken würde. Dann würde sie schreien, und dieser Kerl würde auf seinen Insektenbeinen davonhuschen. Doch wenn Chloe erst einmal tief unter der Erde in seinem Bau war, wäre es zu spät. Es wurde nun dunkel, aber auf merkwürdige Weise, als würden die Glühbirnen an der Decke, die immer noch brannten, das Licht nicht ausstrahlen, sondern einsaugen und verlöschen lassen.
Wehr dich!
Aber sie konnte nicht.
Der schwarze Abgrund rückte näher und näher.
Tropf, tropf, tropf …
Schrei!
Das tat sie.
Aber ihrem Mund entrang sich lediglich ein Zischen, das Zirpen einer Grille, das Brummen eines Käfers.
Dann hob er sie durch die Tür ins Wunderland auf der anderen Seite. Wie in dem Film. Oder Comic. Oder so.
Sie sah einen kleinen Haustechnikraum.
Chloe fühlte sich, als würde sie fallen, tiefer und tiefer, und dann schlug sie auf dem Boden auf, auf der Erde, dem Dreck, und rang nach dem Atem, den der Aufprall ihr aus der Lunge getrieben hatte. Doch es tat gar nicht weh, überhaupt nicht. Das Tropfgeräusch war hier deutlicher zu vernehmen, und sie entdeckte ein Rinnsal an der gegenüberliegenden Wand, die aus alten Steinen gemauert war und an der Rohre und Kabel hingen, rostig und abgenutzt und verrottet.
Tropf, tropf …
Ein Rinnsal Insektengift, ein Rinnsal schimmerndes klares Insektenblut.
Alice, dachte sie. Ich bin Alice. Unten im Kaninchenbau. Die Raupe mit der Wasserpfeife, der Märzhase, die Rote Königin und das rote Insekt auf seinem Arm.
Sie hatte diese dämliche Geschichte noch nie gemocht!
Chloe ließ das Schreien sein. Sie wollte nur noch wegkriechen, sich weinend zusammenkauern und in Ruhe gelassen werden. Aber sie konnte sich nicht rühren. Sie lag auf dem Rücken und starrte hinauf zu dem schwachen Licht aus dem Keller des Ladens, in dem sie so ungern arbeitete und in dem sie in diesem Moment doch so gern wieder mit schmerzenden Füßen stehen würde, um nickend Begeisterung zu heucheln.
Nein, nein, Sie sehen darin total schlank aus, wirklich …
Dann wurde es noch dunkler, als ihr Angreifer, das gelbgesichtige Insekt, durch die Öffnung kam, die kleine Tür hinter sich zuzog und die kurze Leiter zu Chloe nach unten stieg. Gleich darauf flammte ein grelles Licht auf; er hatte sich eine Grubenlampe auf die Stirn gesetzt und eingeschaltet. Der weiße Lichtstrahl blendete Chloe, und sie schrie auf oder auch nicht.
Dann wurde es schlagartig stockfinster.
Ein paar Sekunden oder Minuten oder ein Jahr später kam Chloe wieder zu sich.
Sie befand sich nun irgendwo anders, nicht mehr in dem Haustechnikraum, sondern in einer geräumigeren Kammer, nein, in einem Tunnel. Es war schwer zu erkennen, denn die einzigen Lichtquellen waren ein schwacher Schimmer über ihr und der klar umrissene Strahl an der Stirn des maskierten Insektenmanns. Er blendete Chloe jedes Mal, wenn er ihr ins Gesicht sah. Sie lag wieder auf dem Rücken, starrte nach oben, und er kniete über ihr.
Doch was sie erwartet oder vielmehr befürchtet hatte, geschah nicht. In gewisser Weise war das hier aber noch schlimmer, denn das andere – ihr die Kleider vom Leib zu reißen und … nun ja – wäre wenigstens noch nachvollziehbar gewesen. Es wäre in eine bekannte Kategorie des Schreckens gefallen.
Das hier war anders.
Ja, er hatte ihr die Bluse hochgeschoben, aber nur ein Stück, sodass ihr Bauch frei lag, vom Nabel bis zum unteren Rand ihres Büstenhalters, der sich weiterhin keusch an seinem Platz befand. Ihr Rock lag eng um ihre Oberschenkel, fast als wolle der Mann jeden Anschein von Unschicklichkeit vermeiden.
Vorgebeugt starrte er mit dem ruhigen Blick seiner Insektenaugen nun eindringlich auf die glatte weiße Haut ihres Bauches, als würde er im Museum of Modern Art ein Gemälde betrachten, mit leicht geneigtem Kopf, um Jackson Pollocks Farbspritzer oder Magrittes grünen Apfel auch ja aus dem richtigen Winkel zu erwischen.
Dann streckte er langsam den Zeigefinger aus und strich über ihren Bauch. Mit seinem gelben Finger. Danach mit der ganzen Handfläche, hin und her. Er nahm mehrmals ein Stück Fleisch zwischen Daumen und Zeigefinger, ließ es los und beobachtete, wie es sich sogleich wieder glättete.
Sein Insektenmund verzog sich zu einem schwachen Lächeln.
»Sehr schön«, glaubte sie ihn sagen zu hören. Vielleicht redete da aber auch die Raupe mit den Rauchringen oder der Käfer auf seinem Arm.
Sie vernahm ein leises Summen oder Vibrieren. Er sah auf die Uhr. Noch ein Summen, von irgendwo anders. Dann schaute er ihr ins Gesicht und bemerkte ihre Augen. Es schien ihn zu überraschen, dass sie wach war. Er wandte sich um, zog einen Rucksack in ihr Sichtfeld und entnahm ihm eine gefüllte Spritze. Diesmal injizierte er Chloe den Inhalt in eine Armvene.
Wärme breitete sich aus, die Angst ließ nach. Während es allmählich wieder dunkler um sie wurde und die Geräusche verstummten, sah sie seine gelben Finger, seine Raupenfinger, seine Insektenklauen abermals in den Rucksack greifen und behutsam ein Kästchen daraus hervorholen. Er stellte es mit so großer Ehrfurcht neben ihrer bloßen Haut ab, dass sie unwillkürlich an den Priester letzten Sonntag denken musste, wie er beim heiligen Abendmahl den silbernen Kelch mit dem Blut Christi ebenso respektvoll auf dem Altar platziert hatte.
2
Billy Haven schaltete seine American-Eagle-Tätowiermaschine ab, um die Batterie zu schonen.
Er richtete sich auf und begutachtete die bisherige Arbeit mit prüfendem Blick.
Die Bedingungen hier waren zwar alles andere als ideal, aber das Ergebnis konnte sich sehen lassen.
Man musste für seine Mods stets alles geben. Vom simpelsten Kreuz auf der Schulter einer Kellnerin bis zur amerikanischen Flagge auf der Brust eines Söldners, komplett dreifarbig und mit mehreren Falten, als würde sie im Wind wehen – man hängte sich rein, als wäre man Michelangelo, der die Decke einer Kirche bemalte. Gott und Adam, Fingerspitze an Fingerspitze.
Hier und heute hätte Billy sich durchaus auch beeilen können. In Anbetracht der Umstände hätte ihm wohl niemand deswegen einen Vorwurf gemacht.
Aber nein. Die Mod musste eine Billy-Mod sein. So nannten sie das bei ihm zu Hause, in seinem Laden.
Ein Schweißtropfen kitzelte ihn.
Er hob den Zahnarztmundschutz an, wischte sich mit einem Papiertuch das Gesicht ab und steckte das Tuch ein. Ganz vorsichtig, damit sich keine Fasern lösten. Verräterische Fasern, die für ihn so gefährlich sein konnten wie die Tätowierung für Chloe.
Die Maske war lästig. Aber notwendig. Sein Tattoo-Lehrer hatte ihm das eindrucksvoll beigebracht. Er hatte Billy einen Mundschutz aufsetzen lassen, bevor dieser auch nur zum ersten Mal eine Tätowiermaschine in die Hand nahm. Billy, wie die meisten jungen Lehrlinge, hatte protestiert: Ich hab doch eine Brille vor den Augen. Mehr brauche ich nicht. Es war nicht cool. Sich eine bekloppte Maske umzuhängen war so, als würde man einem Neuling bei dessen erster Tätowierung einen Pussyball zum Drücken geben.
Die Schmerzen gehören nun mal dazu. Finde dich damit ab!
Doch dann hatte Billys Lehrer ihn neben sich sitzen lassen, während er einen Kunden tätowierte. Eine kleine Arbeit: Ozzy Osbournes Gesicht. Warum auch immer.
Mann, wie das gespritzt hatte! Die Maske war mit Blut und Flüssigkeit gesprenkelt gewesen wie die Windschutzscheibe eines Pick-ups im August.
»Sei nicht dumm, Billy. Denk immer dran.«
»Werd ich.«
Seitdem stellte er sich jeden Kunden als Hepatitis-C-, -B- oder HIV-Träger vor oder was sonst noch für Geschlechtskrankheiten gerade in Mode sein mochten.
Und angesichts der Mods, die er während der nächsten paar Tage tätowieren würde, durfte es natürlich keinerlei Rückschläge geben.
Daher die Schutzmaßnahmen.
Darüber hinaus hatte er auch noch die Latexmaske und -haube getragen, um sicherzustellen, dass er keines seiner reichlich vorhandenen Haare oder irgendwelche Hautzellen hinterließ. Und um seine Gesichtszüge zu verzerren. Es bestand nämlich immer die vage Gefahr, dass jemand ihn zufällig entdeckte, obwohl er sich bei der Auswahl der abgeschiedenen Orte besondere Mühe gegeben hatte.
Nun wandte Billy Haven sich wieder seinem Opfer zu.
Chloe.
Dieser Name stand jedenfalls auf dem kleinen Schild an ihrer Brust und davor ein prätentiöses Je m’appelle. Was auch immer das hieß. Vielleicht Hallo. Vielleicht Guten Tag. Französisch. Er senkte die doppelt behandschuhte Hand und streichelte ihre Haut, kniff sie, dehnte sie, achtete auf die Elastizität, die Textur, die schöne Spannkraft.
Er sah aber auch den kleinen Hügel zwischen ihren Beinen unter dem waldgrünen Rock. Und den unteren Teil des BHs. Doch es kam gar nicht infrage, sich danebenzubenehmen. Er berührte eine Kundin stets nur da, wo es erforderlich war.
Das eine war Fleisch. Das andere war Haut. Zwei völlig verschiedene Dinge, und Billy Haven war eindeutig der Haut zugetan.
Er wischte sich mit einem neuen Papiertuch abermals den Schweiß ab und verstaute es danach ebenso sorgfältig wie das andere. Ihm war warm, und seine eigene Haut kribbelte. November oder nicht, hier im Tunnel war es heiß und stickig. Die etwa hundert Meter lange Röhre war an beiden Enden verschlossen, das heißt, es fand so gut wie keine Be- und Entlüftung statt. Hier in SoHo, südlich von Greenwich Village, gab es viele solcher Tunnel. Sie stammten aus dem neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert und durchzogen das ganze Viertel. Ursprünglich hatten sie dazu gedient, unterirdische Warentransporte zwischen Fabriken, Lagerhäusern und Verladestellen durchführen zu können.
Heutzutage wurden sie nicht mehr genutzt und waren somit perfekt für Billys Zwecke geeignet.
Die Uhr an seinem rechten Handgelenk summte erneut. Einige Sekunden später meldete sich die Reserveuhr in seiner Tasche mit einem ähnlichen Signal. Sie sollten ihn an die Zeit erinnern; Billy verlor sich oft in seiner Arbeit.
Gleich ist Gottes Knöchel perfekt, nur noch eine Minute …
Aus dem kleinen Knopf in seinem linken Ohr ertönte ein Klappern. Er lauschte einen Moment lang, ignorierte das Geräusch dann und nahm wieder die American-Eagle-Maschine zur Hand. Es handelte sich um ein altertümliches Gerät mit Rotationsantrieb, der die Nadel wie bei einer Nähmaschine bewegte, im Gegensatz zu modernen Maschinen, die eine vibrierende Spule benutzten.
Er schaltete sie ein.
Bzzzz …
Rückte Mundschutz und Brille zurecht.
Dann zog er mit der Nadel Millimeter um Millimeter die Konturen nach, die er zuvor flink aufgezeichnet hatte. Billy war ein geborener Künstler, brillant bei Bleistift- und Tuschezeichnungen, brillant bei Pastellbildern. Und brillant mit der Nadel. Er zeichnete freihändig auf Papier, und er zeichnete freihändig auf Haut. Die meisten Mod-Künstler, wie talentiert auch immer, benutzten vorbereitete (oder – für die Unbegabten – zugekaufte) Schablonen, die sie auf die Haut klebten und mit der Nadel nachzogen. Billy griff so gut wie nie darauf zurück. Dazu bestand für ihn keine Veranlassung. Von Gottes Geist direkt in deine Hand, hatte sein Onkel immer gesagt.
Jetzt das Ausfüllen. Er wechselte die Nadel. Ganz, ganz vorsichtig.
Für Chloes Tätowierung benutzte Billy eine gebrochene Schriftart, auch bekannt als Blackletter, Gothic oder Old English. Sie war durch besonders dicke in Kombination mit überaus filigranen Strichen gekennzeichnet. Konkret entschied er sich für die Schriftfamilie Fraktur. Er hatte sie gewählt, weil sie stark dem Satz der Gutenberg-Bibel ähnelte – und weil sie eine Herausforderung bedeutete. Er war ein Künstler, und welcher Künstler stellte nicht gern seine Fähigkeiten zur Schau?
Zehn Minuten später war er fast fertig.
Und wie ging es seiner Kundin? Er musterte ihren Körper und hob dann ihre Augenlider an. Die Pupillen reagierten noch nicht wieder. Aber ihr Gesicht zuckte ein paar Mal. Das Propofol würde nicht mehr lange vorhalten. Allerdings hatte bereits die Wirkung der nächsten Substanz eingesetzt.
Da fuhr ein jäher Schmerz durch seine Brust. Das beunruhigte ihn.
Er war jung und in sehr guter Verfassung; den Gedanken an einen Herzinfarkt ließ er daher sofort wieder fallen. Doch es blieb die große Frage: Hatte er etwa irgendwas eingeatmet, das er lieber nicht eingeatmet hätte?
Das war nämlich eine sehr reale (und tödliche) Möglichkeit.
Dann tastete er seinen eigenen Körper ab und erkannte, dass der Schmerz von der Oberfläche herrührte. Und er begriff. Als er Chloe gepackt hatte, hatte diese sich gewehrt. Vor lauter Aufregung hatte er gar nicht gemerkt, wie hart sie ihn traf. Nun, da das Adrenalin abgeebbt war, meldete sich der Schmerz. Billy blickte an sich herab. Es war nichts Ernstes, abgesehen von dem Riss in seinem Hemd und dem Overall.
Er ignorierte die Ablenkung und machte weiter.
Dann registrierte Billy, dass Chloes Atemzüge tiefer wurden. Das Anästhetikum ließ immer mehr nach. Er legte eine Hand auf ihre Brust – Lovely Girl hätte nichts dagegen gehabt – und spürte, dass Chloes Herz kräftiger schlug als zuvor.
Da kam ihm ein Gedanke: Wie wäre es wohl, ein lebendiges, schlagendes Herz zu tätowieren? Wäre das möglich? Im Zuge der Vorbereitung seiner Pläne hier in New York war Billy vor einem Monat in eine Firma für Medizinbedarf eingebrochen und hatte Geräte, Medikamente, Chemikalien und andere Materialien im Wert von vielen Tausend Dollar erbeutet. Er fragte sich, ob er sich wohl beibringen könnte, jemanden zu narkotisieren, den Brustkorb zu öffnen, ein Bild oder eine Inschrift auf das Herz zu tätowieren und das Opfer wieder zuzunähen. Sodass der- oder diejenige mit dem verzierten Organ weiterleben würde.
Was würde er als Motiv wählen?
Ein Kreuz.
Die Worte: Das Gesetz der Haut.
Vielleicht:
Billy + Lovely Girl für immer
Interessanter Ansatz. Doch der Gedanke an Lovely Girl machte ihn traurig, und er widmete sich wieder Chloe und beendete die letzten Buchstaben.
Gut.
Eine Billy-Mod.
Aber sie war noch nicht ganz fertig. Er nahm ein Skalpell aus einem dunkelgrünen Zahnbürstenbehälter, beugte sich vor und zog die fabelhafte Haut ein letztes Mal glatt.
3
Man kann den Tod auf zweierlei Weise betrachten.
In der Disziplin der forensischen Wissenschaft ist der Tod für den Ermittler eine abstrakte Tatsache, schlicht ein Ereignis, das eine Reihe von Aufgaben nach sich zieht. Gute forensische Cops nehmen dieses Ereignis wie eine historische Begebenheit in Augenschein; für die besten unter ihnen aber ist der Tod reine Fiktion, und das Opfer hat niemals als reale Person existiert.
Bei der Tatortarbeit ist dieser innere Abstand eine notwendige Voraussetzung, so wie die Latexhandschuhe und die alternativen Lichtquellen.
Lincoln Rhyme saß in seinem grau-roten Merits-Rollstuhl an einem Fenster seines Stadthauses am Central Park West und dachte auf genau diese Weise über einen Todesfall aus jüngster Vergangenheit nach. Letzte Woche war in Downtown ein Mann ermordet worden; offenbar war ein Raubüberfall eskaliert. Das Opfer hatte am frühen Abend sein Büro bei der städtischen Umweltschutzbehörde verlassen und war auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf das Gelände einer zu diesem Zeitpunkt menschenleeren Baustelle gezerrt worden. Anstatt seine Brieftasche herzugeben, hatte der Mann sich zur Wehr gesetzt und war vom eindeutig überlegenen Täter erstochen worden.
Der Fall, dessen Akte Rhyme nun vor Augen hatte, sah nach reiner Routine aus, und auch die kargen Beweise waren typisch für solch einen Mord: die billige Waffe, ein Küchenmesser mit Sägeschliff – zwar voller Fingerabdrücke, doch waren die weder bei IAFIS noch sonst wo registriert –, die undeutlichen Schuhabdrücke im Schlamm, der an jenem Abend den Boden bedeckt hatte, sowie Partikel, Abfälle und Zigarettenstummel, bei denen es sich allesamt um tage- oder wochenalte und somit nutzlose Partikel, Abfälle und Zigarettenstummel gehandelt hatte. Allem Anschein nach war es ein Zufallsverbrechen; es gab keinen Ausgangspunkt für die Suche nach dem Täter. Die Polizei hatte die Kollegen des Opfers im Amt für öffentliche Arbeiten befragt und mit den Freunden und Angehörigen gesprochen. Es gab keine Drogenvorgeschichte, keine prekären Geschäfte, keine eifersüchtigen Geliebten und auch keine eifersüchtigen Ehepartner von Geliebten.
Angesichts der dürftigen Spurenlage würde dieser Fall sich nur auf eine Weise lösen lassen, wusste Rhyme: Jemand würde leichtfertig damit prahlen, in der Nähe des Rathauses eine Brieftasche erbeutet zu haben. Und wenn sein Gegenüber dann das nächste Mal wegen Drogenbesitzes, häuslicher Gewalt oder Diebstahls verhaftet wurde, würde er oder sie eine Abmachung mit der Staatsanwaltschaft treffen und den Prahler verraten.
Für Lincoln Rhyme war die Tat, dieser fehlgeschlagene Raubüberfall, ein distanziert wahrgenommener Tod. Historisch. Fiktional.
So viel zur Betrachtungsweise Nummer eins.
Bei der zweiten Möglichkeit kommt das Herz ins Spiel: wenn ein Mensch, zu dem eine echte Beziehung besteht, nicht länger auf dieser Erde weilt. Und der andere Todesfall, der Rhyme an diesem stürmischen grauen Tag beschäftigte, setzte ihm so sehr zu, wie der des Überfallopfers ihn kaltließ.
Rhyme standen nicht viele Leute nahe. Das lag nicht an seiner körperlichen Verfassung – er war vom Hals abwärts weitgehend gelähmt. Nein, er war nie besonders gesellig gewesen. Er war Wissenschaftler. Ein Verstandesmensch.
Oh, es hatte durchaus ein paar enge Freunde gegeben, einige Verwandte, Geliebte. Seine Frau, inzwischen seine Ex.
Thom, seinen Betreuer.
Amelia Sachs natürlich.
Doch der zweite Mann, der vor einigen Tagen gestorben war, war ihm in einem Punkt nähergekommen als alle anderen: Er hatte für Rhyme eine bislang unerreichte Herausforderung bedeutet, ihn gezwungen, die Grenzen seines ohnehin schon beachtlichen Verstandes zu erweitern, vorausschauend zu denken, Strategien zu entwerfen und sich selbst zu hinterfragen. Und er hatte Rhyme gezwungen, um das eigene Leben zu kämpfen; es war dem Mann beinahe gelungen, ihn zu töten.
Der Uhrmacher war der faszinierendste Verbrecher gewesen, mit dem Rhyme jemals zu tun gehabt hatte. Richard Logan, der Mann mit den vielen Identitäten, war in erster Linie ein Profikiller, wenngleich er alle möglichen Straftaten verübt hatte, von Terroranschlägen bis hin zu Einbruchdiebstählen. Er arbeitete für jeden, der sein saftiges Honorar zahlte – vorausgesetzt, der Auftrag war, jawohl, herausfordernd genug. Was auch für Rhyme das ausschlaggebende Kriterium war, wenn er beschloss, einen Fall als beratender forensischer Wissenschaftler zu übernehmen.
Dem Uhrmacher war es als einem von sehr wenigen Kriminellen gelungen, Rhyme intellektuell zu übertrumpfen. Obwohl der Kriminalist letztlich die Falle gestellt hatte, die Logan ins Gefängnis brachte, machte es ihm immer noch zu schaffen, dass es ihm zuvor mehrmals nicht gelungen war, die Verbrechen des Uhrmachers zu vereiteln. Und sogar wenn er scheiterte, vermochte dieser Täter bisweilen großes Unheil anzurichten. Als Rhyme das Attentat auf einen mexikanischen Polizisten verhinderte, der gegen die Drogenkartelle ermittelte, konnte Logan immerhin einen internationalen Zwischenfall provozieren. Am Ende wurde vereinbart, die Akten zu versiegeln und so zu tun, als hätte es den Mordversuch nie gegeben.
Doch nun war der Uhrmacher nicht mehr da.
Der Mann war in der Haft gestorben – und zwar nicht etwa durch die Hand eines Mitgefangenen oder durch Selbstmord, wie Rhyme bei Erhalt dieser Nachricht zunächst vermutet hatte. Nein, die Todesursache war ganz alltäglich – ein Herzinfarkt, wenngleich ein sehr schwerer. Der Arzt, mit dem Rhyme am Vortag gesprochen hatte, war der Überzeugung, dass Logan eine permanente und gravierende Hirnschädigung zurückbehalten hätte, wenn es ihnen gelungen wäre, den Mann zu retten. Obwohl Mediziner keine Formulierungen wie »sein Tod war ein Segen« verwendeten, hatten die Ausführungen des Arztes doch genau diesen Eindruck bei Rhyme hinterlassen.
Eine Bö des launischen Novemberwinds ließ die Fenster von Rhymes Haus erzittern. Er befand sich im ehemaligen Salon des Gebäudes – dem Ort, an dem er sich so wohl wie nirgendwo sonst auf der Welt fühlte. Das Wohnzimmer aus viktorianischer Zeit diente heutzutage als voll ausgestattetes Kriminallabor mit blitzblanken Tischen zur Untersuchung von Beweismaterial, mit Computern und hochauflösenden Monitoren, Gestellen voller Instrumente, hoch entwickelten Geräten wie Abrauch- und Partikelabzügen, Fingerabdruck-Visualisierungskammern, Licht- und Rasterelektronenmikroskopen sowie dem Herzstück: einem Gaschromatographen samt Massenspektrometer, dem Arbeitstier aller forensischen Laboratorien.
Die Ausrüstung im Wert von mehreren Millionen Dollar hätte jeder kleinen oder sogar mittelgroßen Polizeibehörde des Landes zur Ehre gereicht. Rhyme hatte alles aus eigener Tasche bezahlt. Die Abfindung nach dem Arbeitsunfall, der Rhymes Querschnittslähmung zur Folge gehabt hatte, war ziemlich beträchtlich ausgefallen; das Gleiche galt für die Höhe der Honorare, die er dem NYPD und anderen Strafverfolgungsorganen für seine Dienste berechnete. (Mitunter gab es auch Angebote aus anderer Richtung, die sich womöglich als lukrativ erwiesen hätten, zum Beispiel aus Hollywood, wo man Rhymes spektakulärste Fälle für das Fernsehen verfilmen wollte. Einer der vorgeschlagenen Titel lautete Der Mann im Rollstuhl, ein anderer Ein Rhyme zu jeder Jahreszeit. Thom hatte die Reaktion seines Chefs auf dieses Ansinnen – »Hat denen etwa jemand ins Hirn geschissen?« – folgendermaßen übermittelt: »Mr. Rhyme hat mich gebeten, Ihnen für Ihr freundliches Interesse zu danken. Leider lassen seine zahlreichen Verpflichtungen die Arbeit an einem derartigen Projekt vorläufig nicht zu.«)
Rhyme wendete nun seinen Rollstuhl und blickte zu einer wunderschönen filigranen Taschenuhr, die in einer kleinen Halterung auf dem Kaminsims stand. Eine Breguet. Ein Geschenk des Uhrmachers höchstpersönlich.
Seine Trauer war vielschichtig und spiegelte die beiden verschiedenen Weisen wider, den Tod zu betrachten. Es gab mit Sicherheit analytische – forensische – Gründe, den Verlust zu bedauern. Der Kriminalist würde nun niemals die Möglichkeit haben, den Verstand des Mannes zu seiner Zufriedenheit zu ergründen. Wie der Spitzname erkennen ließ, war Logan von der Zeit und den Zeitmessern regelrecht besessen gewesen und hatte sogar eigenhändig Uhren verschiedener Größe gebaut. Die gleiche Sorgfalt und absolute Präzision hatte er auf die Planung seiner Verbrechen verwandt. Rhyme hatte vom ersten Moment an bewundert, wie Logans Intellekt funktionierte. Er hatte darauf gehofft, dass der Mann ihm gestatten würde, ihn im Gefängnis zu besuchen, um über die an eine Partie Schach gemahnende Struktur der Taten zu reden.
Doch Logans Tod warf auch wesentlich profanere Fragen auf. Die Staatsanwaltschaft hatte Logan eine Verfahrensabsprache angeboten, eine Strafminderung im Gegenzug für die Namen mancher seiner Auftraggeber und Komplizen; der Mann hatte eindeutig über ein ausgedehntes Netzwerk krimineller Kollegen verfügt, deren Identität die Polizei brennend interessierte. Gerüchteweise hatte Logan vor seiner Ergreifung zudem mehrere Tatpläne bereits fertig ausgearbeitet.
Doch Logan war nicht auf das Angebot eingegangen. Und was noch ärgerlicher war, er hatte sich in allen Punkten schuldig bekannt und dadurch Rhyme der Gelegenheit beraubt, mehr über ihn zu erfahren und seine Familienangehörigen und Mittäter zu identifizieren. Rhyme hatte sogar vorgehabt, Gesichtserkennungstechnologie und verdeckte Ermittler einzusetzen, um sämtliche Besucher des Prozesses zu durchleuchten.
Letztlich jedoch lag, wie Rhyme sehr wohl wusste, in Betrachtungsweise Nummer zwei der Grund dafür, dass ihm der Tod des Mannes so nahe ging: wegen der besonderen Verbindung zwischen ihnen. Unsere Gegner definieren und stimulieren uns. Und mit dem Tod des Uhrmachers war auch Lincoln Rhyme ein kleines Stück gestorben.
Er schaute zu den beiden anderen Personen im Raum. Einer war der Jungspund in Rhymes Team, der NYPD-Streifenbeamte Ron Pulaski; er packte gerade die Beweismittel des Rathaus-Raubüberfalls/Mordes zusammen.
Der andere war Rhymes Betreuer, Thom Reston, ein gut aussehender, schlanker und stets tadellos gekleideter Mann. Heute trug er eine dunkelbraune Stoffhose mit beneidenswert scharfer Bügelfalte, ein blassgelbes Hemd und eine Krawatte in Grün- und Brauntönen, offenbar mit zoologischen Motiven. Rhyme glaubte, ein oder zwei Affengesichter zu erkennen. Schwer zu sagen. Ihm selbst war Mode vollkommen unwichtig. Seine schwarze Jogginghose und der grüne langärmelige Pullover waren praktisch und hielten warm. Mehr interessierte ihn nicht.
»Ich möchte Blumen schicken«, verkündete Rhyme nun.
»Blumen?«, fragte Thom.
»Ja. Blumen. Schick welche. Das ist doch nach wie vor so üblich, nehme ich an. Mit Bändern, auf denen Ruhe in Frieden steht, auch wenn ich den Sinn dahinter nicht ganz begreife. Was sollen die Toten denn sonst machen? Aber immer noch ein besserer Spruch als Alles Gute, meinst du nicht auch?«
»Blumen für … Moment mal. Redest du etwa von Richard Logan?«
»Natürlich. Wie viele Blumenwürdige sind denn noch in letzter Zeit gestorben?«
»Hm, Lincoln«, sagte Pulaski. »›Blumenwürdig‹. Ich hätte nie damit gerechnet, aus Ihrem Mund ein solches Wort zu vernehmen.«
»Jawohl, Blumen«, wiederholte Rhyme gereizt. »Wieso ist das so seltsam?«
»Und wieso hast du so schlechte Laune?«, fragte Thom.
So manchem Beobachter, der den Betreuer und seinen Schützling zusammen erlebte, fiel als Erstes der Begriff »altes Ehepaar« ein.
»Hab ich ja gar nicht. Ich möchte einfach nur Blumen an ein Bestattungsinstitut schicken. Aber niemand kümmert sich darum. Wir können den Namen des Unternehmens von dem Krankenhaus erfahren, in dem die Autopsie durchgeführt wurde. Die müssen den Leichnam ja schließlich an ein Bestattungsinstitut übergeben. In Krankenhäusern wird weder einbalsamiert noch eingeäschert.«
»Wissen Sie, Lincoln«, sagte Pulaski, »man könnte das durchaus als Sieg der Justiz betrachten. Der Uhrmacher hat am Ende doch noch die Todesstrafe erhalten.«
Der blonde, zielstrebige und dienstbeflissene Pulaski hatte das Zeug zu einem erstklassigen Tatortermittler, und Rhyme war zu seinem Mentor geworden. Das beinhaltete nicht nur Lektionen in forensischer Wissenschaft, sondern auch Unterweisungen im Gebrauch des Verstandes. Letzteren schien der Junge aber gegenwärtig nicht zu benutzen.
»Und was genau hat eine zufällige Arterienverstopfung mit der Justiz zu tun, Grünschnabel? Wenn die Staatsanwaltschaft des Staates New York beschlossen hat, die Todesstrafe nicht zur Anwendung zu bringen, ist ein vorzeitiger Tod doch wohl eher eine Untergrabung dieser Absicht, keine Förderung.«
»Ich, äh …«, stammelte der junge Mann und wurde knallrot.
»So, Grünschnabel, bitte keine hinkenden Vergleiche mehr. Zurück zu den Blumen. Finden Sie heraus, wann der Leichnam vom Westchester Memorial freigegeben und wohin er gebracht wird. Ich möchte, dass die Blumen so schnell wie möglich dort eintreffen, ob es nun eine Trauerfeier gibt oder nicht. Einschließlich einer Karte von mir.«
»Was soll darin stehen?«
»Nur mein Name.«
»Blumen?«, ertönte die Stimme von Amelia Sachs aus dem Durchgang, der zur Küche und zur Hintertür des Stadthauses führte. Sie betrat den Salon und nickte den Anwesenden grüßend zu.
»Lincoln wird Blumen zu dem Bestattungsinstitut schicken. Für Richard Logan. Genau genommen werde ich sie schicken.«
Amelia hängte ihre dunkle Jacke an einen Haken im Flur. Sie trug eine enge schwarze Jeans, einen gelben Pullover und ein schwarzes Wollsakko. Auf ihre Tätigkeit als Polizeibeamtin wies allenfalls die Waffe hin, die hoch an ihrer Hüfte hing, und auch das war ein weit hergeholter Rückschluss. Beim Anblick der hochgewachsenen, schlanken Schönheit mit dem langen roten Haar hätte man eher auf ein Mannequin getippt. Und genau das war ihr Job gewesen, bevor sie zum NYPD gestoßen war.
Sachs kam näher und küsste Rhyme auf den Mund. Sie schmeckte nach Lippenstift und roch nach Pulverrückständen; sie war an jenem Morgen auf dem Schießstand gewesen.
Bei Kosmetika musste Rhyme daran denken, dass das Opfer des Rathaus-Raubüberfalls/Mordes sich unmittelbar vor dem Verlassen seines Büros rasiert hatte; an seinem Hals und den Wangen waren nahezu unsichtbare Rasiercremereste und winzige gekappte Bartstoppeln gefunden worden. Außerdem hatte er kurz vor seinem Tod Aftershave verwendet. Als Rhyme während der Untersuchung diese Fakten als eventuell hilfreich erwähnt hatte, war Sachs ganz still geworden. »Demnach war er an dem Abend verabredet, vermutlich mit einer Frau«, hatte sie gesagt. »Für seine Kumpel hätte er sich nicht rasiert. Weißt du, Rhyme, wenn er diese letzten fünf Minuten nicht am Waschbecken der Herrentoilette zugebracht hätte, wäre er womöglich früher gegangen. Und alles wäre anders gekommen. Er hätte überlebt. Und vielleicht noch viele erfüllte Jahre gehabt.«
Oder er wäre irgendwann betrunken Auto gefahren und hätte einen Bus voller Schulkinder gerammt.
Die Frage »Was wäre, wenn …?« war reine Zeitverschwendung.
Betrachtungsweise Nummer eins, Betrachtungsweise Nummer zwei.
»Wisst ihr schon das Bestattungsinstitut?«, fragte Sachs.
»Noch nicht.«
Als Logan kurz vor seiner Verhaftung geglaubt hatte, Rhyme wäre ihm nun hilflos ausgeliefert, hatte er versprochen, Sachs’ Leben zu verschonen. Vielleicht war auch diese unerwartete Milde ein Grund dafür, dass Rhyme den Tod des Mannes bedauerte.
Thom nickte Sachs zu. »Möchtest du einen Kaffee? Oder sonst etwas?«
»Nur Kaffee, danke.«
»Lincoln?«
Der Kriminalist schüttelte den Kopf.
Als der Betreuer mit dem Becher zurückkehrte, reichte er ihn Sachs, die sich bedankte. Mochten die meisten Nerven in Rhymes Körper auch nichts mehr spüren, seine Geruchs- und Geschmacksknospen funktionierten noch einwandfrei und verrieten ihm, dass Thom Reston einen sehr guten Kaffee zubereitet hatte. Ihm kamen weder Kapseln noch vorgemahlene Bohnen ins Haus, und das Wort »Instant« gehörte nicht zu seinem Vokabular.
»Also«, wandte der Betreuer sich mit gequältem Lächeln an sie. »Was hältst du denn von Lincolns gefühlvoller Seite?«
Sie wärmte ihre Hände an dem Becher. »Nein, nein, Thom, ich glaube, hinter dieser Regung steckt Methode.«
Ah, meine Sachs. Immer aufgeweckt. Das war einer der Gründe, aus denen er sie liebte. Ihre Blicke trafen sich. Rhyme wusste, dass sein Lächeln, so winzig es auch sein mochte, wahrscheinlich Muskel für Muskel dem ihren entsprach.
»Der Uhrmacher war immer ein Rätsel«, fuhr Sachs fort. »Wir haben nicht viel über ihn gewusst – eigentlich nur, dass er Verbindungen nach Kalifornien hatte. Irgendwelche entfernten Verwandten, die wir nie ausfindig machen konnten, ebenso wenig seine Komplizen. Dies könnte die Gelegenheit sein, auf Leute zu stoßen, die ihn gekannt und mit ihm zusammengearbeitet haben – ob nun legal oder bei seinen Straftaten. Richtig, Rhyme?«
Hundertprozentig, dachte er.
»Und sobald Sie das Bestattungsinstitut herausgefunden haben, beziehen Sie dort Stellung«, sagte Rhyme zu Pulaski.
»Ich?«
»Ihr erster Einsatz als verdeckter Ermittler.«
»Nicht mein erster«, korrigierte er.
»Der erste bei einer Beerdigung.«
»Das stimmt. Wer soll ich sein?«
»Harold Pigeon«, schlug Rhyme spontan vor.
»Harry Pigeon?«
»Ich habe an Vögel gedacht.« Rhyme nickte in Richtung der Wanderfalken, die auf dem Fenstersims nisteten und sich vor dem Sturm zusammenkauerten. Bei schlechtem Wetter entschieden sie sich meistens für eines der unteren Fenster.
»Harry Pigeon.« Der Streifenbeamte schüttelte den Kopf. »Kommt nicht infrage.«
Sachs lachte. Rhyme verzog das Gesicht. »Mir ist es egal. Denken Sie sich einfach selbst einen Namen aus.«
»Stan Walesa. Mein Großvater. Der Vater meiner Mutter.«
»Perfekt.« Ein ungeduldiger Blick zu einer Schachtel in der Zimmerecke. »Da. Nehmen Sie sich eins.«
»Was ist das?«
»Prepaid-Telefone«, erklärte Sachs. »Wir halten ein halbes Dutzend für Einsätze wie diesen bereit.«
Der junge Mann holte eines der Geräte. »Ein Nokia. Hm. Zum Aufklappen. Auf dem neuesten Stand der Technik.« Er sagte das mit vollendetem Sarkasmus.
Bevor er wählte, mahnte Sachs: »Prägen Sie sich vorher unbedingt die Nummer ein, damit Sie es nicht verpatzen, falls jemand danach fragt.«
»Ja. Geht klar.« Pulaski rief mit dem Prepaid-Telefon sein eigenes Telefon an, notierte sich die Nummer und trat dann auf den Flur, um den Anruf zu erledigen.
Sachs und Rhyme wandten sich dem Bericht über den Rathaus-Raubüberfall zu und feilten an den Formulierungen.
Kurz darauf kam Pulaski zurück. »Das Krankenhaus wartet noch auf Anweisungen, wohin der Leichnam gebracht werden soll. Der Chef der Kühlkammer sagt, er rechnet in den nächsten paar Stunden mit einem Anruf.«
Rhyme musterte ihn von oben bis unten. »Kriegen Sie das hin?«
»Sicher, wieso nicht?«
»Falls es eine Trauerfeier gibt, nehmen Sie daran teil. Falls nicht, werden Sie rein zufällig zum selben Zeitpunkt im Bestattungsinstitut eintreffen wie die Person, die den Leichnam abholt. Die von mir gesandten Blumen werden ebenfalls dort sein – eine gute Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Mann, den Richard Logan töten wollte und der ihn ins Gefängnis gebracht hat, schickt Blumen zu seiner Beerdigung.«
»Wen soll Walesa darstellen?«
»Einen Mitarbeiter von Logan. Wen genau, da bin ich mir nicht sicher. Ich muss noch mal darüber nachdenken. Aber es sollte jemand Unergründliches sein, jemand Gefährliches.« Er runzelte die Stirn. »Ich wünschte nur, Sie würden nicht wie ein Messdiener aussehen. Waren Sie mal einer?«
»Ja, zusammen mit meinem Bruder.«
»Nun, dann üben Sie schon mal, ungepflegt zu wirken.«
»Und gefährlich, nicht zu vergessen«, sagte Sachs. »Obwohl das noch schwieriger sein dürfte als unergründlich.«
Thom brachte Rhyme einen Becher Kaffee mit Strohhalm. Offenbar hatte der Betreuer seinen Blick auf Sachs’ Getränk registriert. Rhyme nickte ihm dankbar zu.
Ein altes Ehepaar …
»Jetzt geht es mir schon wieder besser, Lincoln«, sagte Thom. »Einen Moment lang habe ich doch allen Ernstes geglaubt, du hättest aus heiterem Himmel ein weiches Herz bekommen. Das war ganz verwirrend. Aber die Erkenntnis, dass du lediglich einen Hinterhalt vorbereitest, um die Familie eines Toten auszuspionieren, hat meinen Glauben an dich wiederhergestellt.«
»Es ist einfach nur logisch«, murrte Rhyme. »Weißt du, ich bin wirklich nicht der kalte Fisch, für den alle mich halten.«
Ironischerweise wollte Rhyme die Blumen zum Teil tatsächlich aus einem sentimentalen Grund schicken: um einem würdigen Gegner seinen Respekt zu erweisen. Er nahm an, dass der Uhrmacher im umgekehrten Fall genauso gehandelt hätte.
Die Betrachtungsweisen Nummer eins und zwei schlossen einander natürlich nicht aus.
Dann blickte Rhyme plötzlich auf.
»Was ist?«, fragte Sachs.
»Wie kalt ist es draußen?«
»So um den Gefrierpunkt.«
»Sind unsere Stufen vereist?« Rhymes Stadthaus verfügte sowohl über eine Treppe als auch über eine Rollstuhlrampe.
»An der Hintertür waren sie es jedenfalls«, sagte sie. »Vorn wohl auch, nehme ich an.«
»Ich schätze, wir bekommen gleich Besuch.«
Obwohl es zu diesem Thema keine echten Beweise, sondern nur Anekdoten gab, war Rhyme zu der Ansicht gelangt, dass er seit dem Unfall zwar vieles nicht mehr spüren konnte, seine verbliebenen Sinne sich dafür aber umso mehr geschärft hatten. Vor allem sein Gehör. Er hatte ein Knirschen auf der Vordertreppe vernommen.
Gleich darauf klingelte es, und Thom ging, um die Tür zu öffnen.
Als der Besucher den Flur betrat und mit charakteristischem Schritt den Salon ansteuerte, erkannte Rhyme, um wen es sich handelte.
»Lon.«
Detective First Grade Lon Sellitto kam um die Ecke und durch den Türbogen. Er zog seinen gelbbraunen Mantel aus, der ebenso zerknittert war wie der Rest von Sellittos Garderobe, was an seiner beleibten Statur und seiner Unachtsamkeit lag. Rhyme fragte sich, warum er nicht wenigstens bei dunkler Kleidung blieb, damit die zahllosen Falten nicht so auffielen. Sobald der Mantel jedoch auf einem der Rattansessel landete, sah Rhyme, dass das Marineblau des Anzugs so gut wie überhaupt nichts kaschierte.
»Mistwetter«, murmelte Sellitto. Er fuhr sich durch das schüttere grauschwarze Haar, und einige Hagelkörner fielen zu Boden. Als er ihnen hinterherblickte, bemerkte er, dass er Schmutz und Eis ins Haus getragen hatte. »Tut mir leid.«
Thom sagte, er solle sich deswegen keine Gedanken machen, und brachte ihm einen Becher Kaffee.
»Mistwetter«, wiederholte der Detective und wärmte seine Hände an dem Getränk, genau wie zuvor Sachs. Er schaute zum Fenster hinaus, wo man jenseits der Falken nur Hagel und Dunst und schwarze Äste erkennen konnte. Sonst kaum etwas vom Central Park.
Rhyme kam nicht oft vor die Tür, und das Wetter war ihm ohnehin egal, außer es war für einen Tatort von Bedeutung.
Oder es half seinem Frühwarnsystem, Besucher zu entdecken.
»Wir sind so gut wie fertig«, sagte Rhyme und wies mit dem Kopf auf den Bericht über den Rathaus-Raubüberfall/Mord.
»Ja, ja, deshalb bin ich nicht hier.« Er stieß das so hastig hervor, dass es fast wie ein einziges Wort klang.
Rhyme merkte auf. Sellitto war ein leitender Ermittler der Abteilung für Kapitalverbrechen, und wenn es ihm nicht um den Bericht ging, zog am Horizont womöglich etwas Neues und Interessanteres herauf. Diese Hoffnung wurde außerdem durch den Umstand genährt, dass Sellitto den Teller mit Thoms hausgemachtem Gebäck gesehen und einfach links liegen gelassen hatte. Die Sache schien sehr zu eilen.
Wie überaus angenehm.
»Uns wurde vorhin ein Mord unten in SoHo gemeldet, Linc. Also haben wir Strohhalme gezogen, und du warst der Glückliche. Ich hoffe, du hast Zeit.«
»Wie kann ich der Glückliche sein, wenn ich gar keinen Strohhalm gezogen habe?«
Ein Schluck Kaffee. Er ignorierte die Frage. »Eine wirklich üble Sache.«
»Ich höre.«
»Eine Frau wurde aus dem Keller des Ladens entführt, in dem sie gearbeitet hat. Irgendeine Boutique. Der Täter hat sie durch eine Zugangstür in einen Tunnel unter dem Gebäude gezerrt.«
Rhyme wusste, dass unter SoHo ein regelrechtes Labyrinth existierte, in dem ursprünglich Waren von einer Fabrik zur nächsten transportiert worden waren. Er hatte schon immer geglaubt, dass es nur eine Frage der Zeit sein konnte, bis jemand die Abgeschiedenheit für einen Mord nutzte.
»Wurde sie vergewaltigt?«
»Nein, Amelia«, sagte Sellitto. »Wie es aussieht, ist der Täter eine Art Tattoo-Künstler. Nach den Kollegen vor Ort zu schließen sogar ein verdammt guter. Er hat sie tätowiert. Allerdings nicht mit Tinte, sondern mit Gift.«
Rhyme war seit vielen Jahren forensischer Wissenschaftler; schon aus den spärlichsten vorläufigen Erkenntnissen zog sein Verstand daher oft akkurate Schlüsse. Doch das funktionierte nur, wenn er auf entsprechende frühere Erfahrungen zurückgreifen konnte. Die aktuellen Informationen waren für Rhyme vollkommen neu und einzigartig und lösten keinerlei Theorien aus.
»Was für ein Gift hat er verwendet?«
»Das wissen wir noch nicht. Wie ich schon sagte, es ist gerade erst passiert. Wir haben den Tatort abgeriegelt.«
»Red weiter, Lon. Wie sieht die Tätowierung aus?«
»Es soll ein Wort sein, heißt es.«
Das wurde ja immer interessanter. »Und was genau?«
»Das haben die Kollegen nicht gesagt. Aber es wirkt wohl, als wäre es mitten aus einem Satz gegriffen. Und du kannst dir ja ausrechnen, was das bedeutet.«
»Er wird sich weitere Opfer suchen«, sagte Rhyme und sah zu Sachs. »Damit er den Rest seiner Botschaft übermitteln kann.«
4
»Das Opfer heißt Chloe Moore, sechsundzwanzig«, erklärte Sellitto. »Teilzeitschauspielerin – sie hatte ein paar Auftritte in Werbespots und als Statistin in Krimis. Mit dem Job in der Boutique hat sie ihren Lebensunterhalt bestritten.«
Sachs stellte die Standardfragen: Ärger mit dem Freund, Ärger mit dem Ehemann, Ärger in einer Dreiecksbeziehung?
»Nein, nichts von alledem, soweit wir bislang wissen. Ich habe gerade erst Streifenbeamte losgeschickt, die sich in der Gegend genauer umhören sollen, aber laut den Kollegen im Laden und ihrer Mitbewohnerin gab es in ihrem Umfeld keine Probleme. Sie war eher konservativ und derzeit Single, ohne schmutzige Trennung in letzter Zeit.«
Rhyme war neugierig. »Hatte sie noch andere Tätowierungen?«
»Keine Ahnung. Die Kollegen vor Ort haben sich nach dem TATF der Gerichtsmedizin sofort zurückgezogen.«
Tod am Tatort festgestellt. Die offizielle Verlautbarung der Rechtsmediziner bedeutete den Startschuss für die Arbeit der Spurensicherung und setzte eine Vielzahl von Abläufen in Gang. Nach dem TATF gab es keine Veranlassung mehr, sich weiter am unmittelbaren Tatort aufzuhalten; Rhyme bestand darauf, dass alle so schnell wie möglich von dort verschwanden, um eine Verunreinigung zu vermeiden. »Gut«, sagte er zu Sellitto und merkte, dass er vollständig auf Todesbetrachtungsweise Nummer eins geschaltet hatte.
»Also gut, Sachs. Wie weit sind wir mit dem städtischen Angestellten?« Ein Blick auf den Rathaus-Bericht.
»Fertig, würde ich sagen. Wir warten noch auf die Listen der Käufer eines solchen Messers, aber ich wette, der Täter hat weder seine Kreditkarte benutzt noch einen Fragebogen zur Kundenzufriedenheit ausgefüllt. Das wäre es im Wesentlichen.«
»Einverstanden. Okay, Lon, wir sind dabei. Obwohl du uns ja eigentlich gar nicht richtig gefragt hast. Du hast in meinem Namen einen Strohhalm gezogen und bist mit deinen Schlammschuhen hier hereingestampft. Meine Zusage hast du einfach vorausgesetzt.«
»Scheiße, was willst du denn sonst machen, Linc? Einen Ski-Langlauf quer durch den Central Park?«
Rhyme mochte es, wenn die Leute vor seiner Behinderung nicht zurückschreckten und keine Angst hatten, Witze zu reißen wie soeben Sellitto. Er wurde wütend, sobald jemand ihn wie eine zerbrochene Puppe behandelte.
Ach je, du Armer …
»Ich habe die Spurensicherung in Queens verständigt. Die sind schon unterwegs. Amelia, Sie werden vor Ort die Leitung übernehmen.«
»Alles klar.« Sie legte sich einen Wollschal um und zog Handschuhe über. Dann nahm sie eine andere Lederjacke vom Haken, länger als die erste, bis zur Mitte der Oberschenkel. Während all ihrer gemeinsamen Jahre hatte Rhyme sie nie einen langen Mantel tragen gesehen. Lederjacken oder Sakkos, das war es so ziemlich. Selten mal einen Anorak, es sei denn, sie ermittelte verdeckt oder nahm an einem taktischen Zugriff teil.
Der Wind rüttelte abermals an den alten Fensterrahmen, und Rhyme hätte Sachs beinahe ermahnt, sie möge vorsichtig fahren – sie besaß ein klassisches Muscle Car mit Heckantrieb, das auf Eis noch schwieriger in den Griff zu bekommen war als ohnehin schon. Doch von Sachs Zurückhaltung zu verlangen wäre ebenso sinnlos gewesen wie Rhyme zur Geduld anzuhalten; es würde niemals gelingen.
»Soll ich helfen?«, fragte Pulaski.
Rhyme überlegte. »Hast du Verwendung für ihn?«, fragte er Sachs.
»Keine Ahnung. Vermutlich nicht. Ein einzelnes Opfer, ein begrenzter Tatort.«
»Grünschnabel, Sie spielen bis auf Weiteres unseren vermeintlichen Trauergast. Bleiben Sie hier. Wir werden uns eine Hintergrundgeschichte für Sie ausdenken.«
»Geht klar, Lincoln.«
»Ich melde mich, sobald ich am Tatort bin«, sagte Sachs, schnappte sich die schwarze Segeltuchtasche mit der Kommunikationseinheit, über die sie von unterwegs Funk- und Videokontakt zu Rhyme aufnehmen konnte, und eilte hinaus. Die Tür knarrte, der Wind heulte kurz auf, die Tür fiel ins Schloss, und dann herrschte Stille.
Rhyme sah, dass Sellitto sich die Augen rieb. Sein Gesicht war grau, und er wirkte zutiefst erschöpft.
Der Detective bemerkte Rhymes Blick. »Dieser verfluchte Met-Fall. Ich krieg keinen Schlaf. Wer bricht in ein Museum mit Kunstwerken im Wert von einer Milliarde Dollar ein, schnüffelt eine Weile herum und geht mit leeren Händen wieder raus? Das ergibt keinen Sinn.«
Letzte Woche waren mindestens drei überaus clevere Täter nach Geschäftsschluss ins Metropolitan Museum of Art an der Fünften Avenue eingebrochen, nachdem sie die Videokameras und die Alarmanlage deaktivieren konnten – was keine Kleinigkeit war. Eine gründliche Tatortanalyse erbrachte später die Erkenntnis, dass sie sich vornehmlich in zwei Bereichen aufgehalten hatten: in der allgemein zugänglichen Halle mit antiken Waffen – dem Traum eines jeden Schuljungen, voller Schwerter, Streitäxte, Rüstungen und Hunderter anderer schlauer Erfindungen zur Entfernung von Körperteilen; und im Keller des Museums, wo die Archive, Lagerräume und Restaurierungswerkstätten lagen. Nach mehreren Stunden waren die Täter verschwunden und hatten von außen das Überwachungssystem wieder eingeschaltet. Am nächsten Tag fiel zunächst nur auf, dass der Alarm laut Protokoll unterbrochen gewesen war. Um den Ablauf der Ereignisse stückweise zu rekonstruieren, hatte die Polizei die Computer des Sicherheitssystems und alle Räume des Museums minutiös untersuchen müssen.
Es sah fast so aus, als hätten die Eindringlinge sich wie viele der Touristen verhalten, die das Museum besuchten: Irgendwann hatten sie genug von all den Exponaten, langweilten sich und gingen lieber in ein nahes Restaurant oder eine Bar.
Ein vollständiger Bestandsabgleich ergab, dass in beiden Bereichen einige Gegenstände bewegt worden waren, doch die Einbrecher hatten nicht das Geringste gestohlen: kein einziges Gemälde, kein Sammlerstück, nicht mal einen kleinen Block Haftnotizzettel. Die Spurensicherung – Rhyme und Sachs waren nicht daran beteiligt gewesen – hatte vor der schieren Größe des Tatorts beinahe kapitulieren müssen; die Halle mit Waffen und Rüstungen war schon schlimm genug, aber das Labyrinth aus Archiven und Lagerräumen erstreckte sich unter der Erde weit nach Osten, ein ganzes Stück über die Fünfte Avenue hinaus.
Der Zeitaufwand war daher beträchtlich, doch laut Sellitto gar nicht mal der nervigste Aspekt des Falls. »Die Politik. Diese Scheißpolitik«, hatte er geklagt. »Der Herr Bürgermeister findet, dass dieser Einbruch in sein persönliches Kronjuwel so gar keine positive Außenwirkung hat. Im Klartext: Wir ackern rund um die Uhr nur daran, und zum Teufel mit allen anderen Fällen. Linc, wir erhalten in dieser Stadt Terrordrohungen. Sollte ein Code Rot oder Orange oder welche Farbe auch immer eintreten, sind wir am Arsch. Es gibt da draußen einen Haufen Möchtegern-Tony-Sopranos. Und was mache ich? Ich begutachte im Keller jeden verstaubten Raum, jedes bekloppte Gemälde und jede nackte Statue. Wirklich alle. Willst du wissen, was ich von Kunst halte, Linc?«
»Was denn, Lon?«, hatte Rhyme gefragt.
»Einen Scheißdreck. Das halte ich von Kunst.«
Doch nun hatte der neue Fall – der Gifttätowierer – den alten Fall übertrumpft, zur sichtlichen Erleichterung des Detectives. »Bei einem Killer wie diesem dürfte die Presse wenig Verständnis dafür aufbringen, dass wir unsere Zeit mit Seerosenbildern und griechischen Götterstatuen mit kleinen Pimmeln verschwenden. Hast du so eine Statue schon mal gesehen, Linc? Manche von den Kerlen … Also ehrlich, wer auch immer da Modell gestanden hat, man sollte doch meinen, dass er den Bildhauer bitten würde, ein paar Zentimeter hinzuzufügen.«
Er ließ sich auf einen Stuhl fallen und trank noch einen Schluck von seinem Kaffee. Das Gebäck interessierte ihn immer noch nicht.
Da runzelte Rhyme die Stirn. »Eines noch, Lon.«
»Ja?«
»Wann genau ist dieser Tattoo-Mord passiert?«
»Der Todeszeitpunkt war vor etwa einer Stunde. Vielleicht neunzig Minuten.«
Rhyme war verwirrt. »So schnell könnt ihr doch unmöglich eine Laboranalyse durchgeführt haben.«
»Nein, der Gerichtsmediziner hat was von zwei Stunden gesagt.«
»Woher wusste er dann, dass das Opfer vergiftet wurde?«
»Oh, einer seiner Kollegen hatte vor ein paar Jahren mit einem Giftfall zu tun. Er hat gesagt, man könne das an der verzerrten Grimasse und dem gekrümmten Leib erkennen. Wegen der Schmerzen, du weißt schon. Das muss ein unglaublich qualvoller Tod sein. Dieser Drecksack darf uns nicht durch die Lappen gehen, Linc.«
5
Toll. Ganz toll.
Amelia Sachs stand in SoHo im Keller der Boutique, aus dem Chloe Moore verschleppt worden war. Sie hatte sich vorgebeugt und einen Blick in den Haustechnikraum geworfen. Mit verkniffener Miene starrte sie auf die enge Röhre, die von dort aus zum eigentlichen Tatort führte, offenbar einem größeren Tunnel, in dem Chloe ermordet worden war.
Der Leichnam würde vom Haustechnikraum aus gerade noch zu erkennen sein, hell erleuchtet dank der Lampen, die von den Ersthelfern aufgestellt worden waren.
Sachs’ Hände wurden feucht. Sie musterte weiterhin den engen Schacht, durch den sie würde kriechen müssen.
Ganz toll.
Sie wich ein paar Schritte zurück und atmete zwei- oder dreimal tief durch. Die muffige Luft roch nach Heizöl. Lincoln Rhyme hatte vor Jahren die vom Baudezernat und anderen städtischen Ämtern kartierten unterirdischen Bereiche New Yorks in einer Datenbank gesammelt. Sachs hatte sich den entsprechenden Plan mittels einer sicheren App auf ihr iPhone heruntergeladen und machte sich nun bestürzt mit den Einzelheiten vertraut.
Woher Phobien wohl kommen mochten, fragte Sachs sich. Hält irgendein Kindheitstrauma oder eine Art genetischer Prädisposition uns davon ab, Giftschlangen zu streicheln oder am Rand eines Abgrunds umherzutanzen?
Wobei ihr Problem nicht Schlangen und Abgründe waren, sondern Klaustrophobie. Falls Sachs an frühere Leben geglaubt hätte, was sie nicht tat, wäre sie in einer vorigen Inkarnation womöglich lebendig begraben worden. Oder, falls man der Logik des Karma folgte, sie wäre wohl eher eine rachsüchtige Königin gewesen, die ihre Gegner langsam in der Erde verschütten ließ, während diese um Gnade flehten.